Kapitel fünfundvierzig
Am nächsten Tag ging es Kitty schon viel besser,
aber im Krankenhaus hieß es, man wolle sie zur Beobachtung noch ein
paar Tage dabehalten. Sie schien keine Erinnerung an die erlittenen
Torturen zu haben, und man kam überein, sie in Ruhe zu lassen, bis
sie das, was sie erlebt hatte, von selbst ansprach.
Das war ganz nach Cathys Wunsch. Je weniger über
die Qualen gesprochen wurde, desto besser.
Richard sorgte dafür, dass die Polizei entsprechend
instruiert wurde und Kitty nicht behelligte. Es hatte den Anschein,
als wolle das Mädchen nur noch schlafen. Die Ärzte rieten, sie
schlafen zu lassen. Sie würde die Geschehnisse auf ihre eigene
Weise verarbeiten.
Cathy hielt die Hand ihrer Tochter, und ihre Liebe
teilte sich ohne Worte mit. Mehr brauchte Kitty nicht, denn solange
ihre Mutter, Desrae oder Richard bei ihr waren, fühlte sie sich
glücklich. Cathy reichte es zu sehen, dass ihre Tochter zu Kräften
kam und die Wunden an ihrer Seele heilten. Sie brauchte nur die
Gewissheit, Kitty bei sich zu haben, behütet und in
Sicherheit.
Als Kitty nach dem langen Schlaf aufwachte, sah sie
ihre Mutter an und lächelte. »Ich hab Hunger, Mom. Kann ich was zu
essen bekommen?«
Cathy schmunzelte. »Und ob du das kannst. Die
Mädels kommen nachher, um dich zu besuchen, was sagst du?«
Kitty stellte sich vor, was für Gesichter die
Krankenschwestern und Ärzte machen würden, wenn die »Mädels«
aufliefen. Aber dann fiel ihr Michaela ein, und ihr Gesicht
verdüsterte sich.
»Warum ist Michaela gekommen, um mich abzuholen,
Mom?«
Sekundenlang fehlten Cathy die Worte. »Das weiß bis
jetzt noch niemand, Liebling.«
Kitty zupfte nervös an ihrer Bettdecke. »Ich möchte
ihn nicht sehen, Mom.«
Bei diesen Worten wurde Cathy klar, dass sich Kitty
an mehr erinnerte, als sie zugab. Aber sie war eigensinnig wie ihre
Mutter.
»Keine Angst, Kleines«, sagte Cathy besänftigend.
»Alles ist wieder gut, und es wird dir nie wieder Böses geschehen.
Das verspreche ich dir.«
Kitty versuchte ein Lächeln. »Ich liebe dich, Mom.
Ich liebe dich so sehr.«
Sie schlossen einander in die Arme und weinten. So
saßen sie auch noch da, als Desrae mit den Mädels aus dem Club
hereinschneite. Wie eine zwitschernde Vogelschar umflatterten sie
das Mädchen, überreichten Körbe mit Obst und Süßigkeiten und legten
Kitty schließlich eine bestickte giftgrüne Bettjacke um die
Schultern. Während sie noch rechts und links Küsschen gaben, davon
schwärmten, wie gut die Kleine doch schon wieder aussah, und nicht
oft genug gute Besserung wünschen konnten, flüsterte Desrae Cathy
zu: »Susan P. ist draußen. Fahr mal für ein paar Stunden nach
Hause.«
Cathy nickte. Nachdem sie sich von den aufgeregt
plappernden Fummeltrinen verabschiedet hatte, verließ sie das
Krankenhaus und stieg erleichtert in Susans Wagen.
Als sie im ersten Stau standen, brach Susan P. das
Schweigen: »Wie geht es ihr?«
»Sie erinnert sich an mehr, als sie zugeben will,
Sue, aber sie scheint es ganz gut wegzustecken.«
Susan P. drehte die Scheibe des Lotus runter und
fauchte einen Fußgänger an, der sich zwischen den Autos
hindurchquälte. »Bist wohl lebensmüde, was?« Übergangslos wandte
sie
sich an Cathy. »Eddie Durrant will wissen, wann wir unseren Teil
der Abmachung erfüllen.«
Cathy lehnte sich auf dem Ledersitz zurück und
atmete tief durch. »Das muss bald geschehen, nicht? Und was ist mit
Michaela?«
Susan zuckte die Achseln. »Wurde heute Morgen
beseitigt. Seine Leiche wird in ein paar Jahren irgendwo an den
Essex Marshes angespült werden. Vergangen und vergessen.«
Cathy steckte sich eine Zigarette an und sah
gedankenverloren hinaus auf den Verkehr. »Ich kann dir gar nicht
genug danken, Susan.«
Die ältere Freundin warf ihr einen Blick zu.
»Bedank dich nicht bei mir. Es war das Schicksal, das ihn uns vom
Hals geschafft hat, Liebes, genau wie das Schicksal auch Campbell
beseitigen wird. Es ist alles arrangiert. Wir müssen nur abwarten.
Er wird sich im Gefängnis die Pulsadern aufschneiden. Zumindest
wird es sich meiner Meinung nach so zutragen. Die Frage ist
nur noch, wann es geschieht, und das kann uns nur Richard sagen.
Hoffentlich sehen wir danach von Eddie Durrant nur noch den
Rücken.«
»Was passiert mit all den anderen Leuten, die bei
der Party mitgemacht haben?« Cathys Stimme klang bitter.
Susan P. grinste. »Ein guter Fang, unter anderem
ein Richter vom Obersten Gerichtshof, ein Stuckateur aus East
London und ein paar Leute aus dem Außenministerium. Ist das nicht
schön zu hören? Wie diese Perversen zusammenfinden, ist mir
schleierhaft. Aber gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es
doch, oder?«
Sie hielten vor Cathys Haus. »Durrant ist da
drinnen. Ich bring nur den Wagen weg und bin in ungefähr fünfzehn
Minuten bei dir, okay? Richard ist auch oben. Er wird inzwischen
mehr wissen, hoffe ich.«
Eddie Durrant war mit einer kubanischen Zigarre und
einem großen Scotch in Cathys Salon gesetzt worden. Cathy war wie
immer davon beeindruckt, wie blendend und respektabel er aussah.
Gates war schweigsam wie immer und sprach erst dann, wenn er etwas
zu sagen hatte.
Cathy war froh über Eddie Durrants Anwesenheit,
denn die Ereignisse des vergangenen Abends machten sie immer noch
verlegen. Sie begrüßte die Besucher mit einem Lächeln.
»Wie geht es Ihrer Tochter?«, fragte Eddie.
Cathy trat zu ihm und streckte die Hand aus. Als er
sie schüttelte, gab sie Auskunft. »Gut, danke.«
»Schön. Das hört man gerne. Kinder sind
kostbar.«
»Da haben Sie Recht. Darf ich Ihnen noch mal
nachschenken?«
»Ein Kaffee wäre mir lieber, aber zuvor sollten Sie
hören, was Mister Gates zu sagen hat.«
Richard sprach sehr ruhig, doch was er sagte, ließ
sie frösteln.
»Campbell wird keine Aussage machen. Er ist sich
sicher, dass die anderen Leute zu große Angst haben, um als Zeugen
aufzutreten. Wir haben daher beschlossen, ihn auszuschalten,
während er sich in Haft befindet. Das ist schwierig, aber nicht
unmöglich. Er wird morgen sterben. Die anderen werden allesamt
büßen. Dieser Johnny ist bereit, als Zeuge auszusagen, und wir
hoffen, dass Cathy wegen ihres traumatischen Erlebnisses nicht vor
Gericht erscheinen muss. Ihre Aussage könnte verlesen werden.
Campbells ›Selbstmord‹ wird von der Jury als Schuldeingeständnis
gewertet werden. Außerdem können wir die ganze Sache nach unserem
Gutdünken aufbauschen, sobald Campbell erstmal aus dem Weg ist.
Also, Mr. Durrant, so sieht es aus.«
Der große Schwarze nickte, höchst zufrieden mit den
neuen Entwicklungen. »Sie sind ein Polizist nach meinem Geschmack,
Mr. Gates. In Fällen wie diesem siegt die Gerechtigkeit nur selten,
wie Sie wohl wissen. Ich nehme an, der Oberste Richter kommt auch
davon?« Richard ignorierte den Spott in seiner Stimme.
Das Telefon klingelte. Cathy ging in die Küche, um
das Gespräch
anzunehmen. Eamonn war dran, und als sie seine Stimme hörte, wurde
ihr klar, dass sie während der vergangenen vierundzwanzig Stunden
nicht ein einziges Mal an ihn gedacht hatte. Sie antwortete nicht
sofort, und Eamonn, der eine schlechte Verbindung vermutete, sagte
laut: »Ist alles in Ordnung? Ich hab schon ein paarmal angerufen,
aber niemand ist rangegangen.«
Sie sah das Blinken am Anrufbeantworter. Eamonn
sagte die Wahrheit. Sie schilderte ihm in kurzen Worten, was
geschehen war. Anschließend fragte er: »Geht es ihr gut?«
Cathy nickte und vergaß, dass er sie natürlich
nicht sehen konnte.
»Klappt es denn mit unserem Wochenende? Ich hab
dich so vermisst, Cathy, du weißt gar nicht, wie sehr du mir
fehlst.«
Sie glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. »Hab ich
richtig gehört, Eamonn? Meine Tochter, mein einziges Kind, wurde
von einem Pädophilen entführt und beinahe vergewaltigt - von einer
Horde Männer -, und du meinst ganz im Ernst, dass ich sie hier
einfach zurücklasse und am Wochenende nach New York komme? Bist du
tatsächlich so dämlich?«
Eamonn verstummte. »Ich ruf dich am Wochenende an,
Cathy«, sagte er schließlich. »Du bist ja im Moment nicht du
selbst. Du müsstest doch wissen, dass ich nicht so egoistisch
…«
Sie unterbrach ihn mit lauter Stimme und vergaß
dabei ihre Besucher im Nebenzimmer.
»Erzähl keine Scheiße, Eamonn! Du bist schon immer
ein selbstsüchtiger Bastard gewesen und wirst immer einer bleiben.
Ich hätte im nächsten Flugzeug nach New York gesessen, wenn du mich
gebraucht hättest. Aber das ist nicht dein Stil, oder? Alles muss
schön problemlos sein, stimmt’s? Also, du bekommst mich zu Gesicht,
wenn es so weit ist - und keinen Augenblick vorher! Meine Tochter,
unsere Tochter, braucht mich, und ich werde dafür sorgen, dass sie
bekommt, was sie braucht.«
»Ich finde, du wirst ein bisschen ungerecht, Cathy.
Ich bin nicht der Feind …«
»Nein, das bist du nicht. Mit meinen Feinden werde
ich allein fertig, aber trotzdem vielen Dank für dein Angebot, mir
zu helfen - ich weiß es zu schätzen. Auch wenn du es noch gar nicht
gemacht hast!«
»Cathy, Liebling, bitte, hör mich an.« Seine Stimme
verriet Anteilnahme, aber er ließ auch seinen ganzen Charme
spielen. »Wenn du mich brauchst - ich bin da. Ich dachte nur, dass
du vielleicht eine kleine Atempause gebraucht hättest. Es tut mir
leid, ich wollte dich nicht verärgern. Ich steig ins nächste
Flugzeug, ich chartere einen Jet, ich tu alles, um dich glücklich
zu machen.«
»Das dürfte nicht nötig sein. Ich muss hier noch
einiges regeln, dann melde ich mich.«
Eamonn wusste, dass er damit entlassen war, und das
wurmte ihn. Er schluckte seinen Unmut hinunter und sagte
einschmeichelnd: »Ich liebe dich, Baby, vergiss das nie.«
»Ich liebe dich auch, Eamonn.« Sie legte auf und
merkte in dem Moment, dass sie ihn wirklich noch immer
liebte - wenn auch nicht mehr so sehr, wie sie einmal gedacht
hatte.
Als sie sich zur Tür wandte, sah sie Richard dort
stehen. Er hatte nur den letzten Teil des Gesprächs mitgehört, und
das tat ihr weh, denn er war mehr wert als fünfzig Eamonns.
Auch wegen seiner strafenden Blicke hätte sie am
liebsten ihren ganzen Frust laut hinausgeschrien. Stattdessen
schenkte sie ihm ein Lächeln.
»Ich mache uns Kaffee.«
»Lass dir Zeit, keine Eile«, sagte er. »Wie geht’s
denn Eamonn?«
Plötzlich ärgerte sich Cathy über alle beide. Da
gab es so viel, was sie zu bedenken, was sie zu bewältigen hatte,
und die beiden Männer, die ihr etwas bedeuteten, machten ihr noch
zusätzlich das Leben schwer.
»Es geht ihm ausgezeichnet, danke«, sagte sie
sarkastisch. »Kommt am Wochenende her, um mein Händchen zu halten
und mich richtig durchzuficken. Du kennst doch Eamonn - ist immer
zur Stelle, wenn man ihn braucht. Scheiße!«
»Es gibt keinen Grund, in diesem Ton mit mir zu
sprechen, Cathy. Ich bin nicht dein Feind.«
Sie seufzte, und ihr Kampfgeist schwand. Er hatte
dasselbe Wort benutzt wie Eamonn. Konnte es sein, dass alle Männer
insgeheim Frauenfeinde waren? Vielleicht gar nicht so
abwegig.
»Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will nichts
mehr hören!«
Richard ging, und ein paar Sekunden später hörte
sie die Eingangstür zufallen. Sie rannte durch die Wohnung und
folgte ihm hinaus auf die Straße, wo abendlicher Verkehr herrschte
und die ersten Nachtschwärmer vorbeischlenderten.
»Richard, bitte warte doch!«, rief sie mit
schriller Stimme. An der Ecke Greek Street hatte sie ihn eingeholt.
»Bitte, Richard, verzeih mir. Bitte, es tut mir leid. Ich war
gekränkt und unglücklich. Ich hab’s nicht so gemeint, ich schwöre,
ich hab’s nicht so gemeint.«
Er sah sie an. Er wusste, dass sie die Wahrheit
sagte. Aber es hatte ihn verletzt. Nach allem, was zwischen ihnen
gewesen war, hatte es ihn wirklich verletzt.
Sie klammerte sich an ihn, und die Passanten
starrten sie neugierig an, die kleine Blondine und den großen
kahlköpfigen Mann.
Er umarmte sie. »Schon gut, Cathy. Beruhige dich.
Es ist dir ja verziehen, okay? Und jetzt hör bitte auf zu weinen,
Liebes, bitte. Auch gute Freunde streiten sich mal, das ist ganz
natürlich.«
Er brachte sie zurück zu ihrer Wohnung und
besänftigte sie unterwegs mit tröstenden Worten. Als sie ankamen,
stellten sie fest, dass Eddie Durrant so rücksichtsvoll gewesen
war, die Wohnung zu verlassen. Richard drückte sie wieder an sich,
aber sie wollte nicht aufhören zu weinen, sondern wiederholte nur
immer wieder: »Es tut mir leid, glaub mir bitte, es tut mir so
leid.«
Schließlich sah er ihr in die Augen und sagte
sanft: »Hör zu, Cathy, du hast harte Tage hinter dir. Ich versteh
dich doch. Trinken wir erstmal einen Kaffee, hm? Ich möchte Kitty
besuchen und endlich was essen. Lass uns einfach wieder normal
werden.«
Sie nickte. Trotz ihrer rotgeränderten Augen und
der Schniefnase war sie in seinen Augen wunderschön. Wie auch immer
sie aussehen mochte, er würde immer seine Cathy in ihr
erkennen.
Und deswegen würde er sie immer lieben.
Trevale war sehr mit sich zufrieden. Er hatte
keine Erklärung abgegeben und bei den Verhören die Aussage
verweigert. Er vertraute darauf, schon bald freigelassen zu werden,
weil die anderen Beteiligten sich eher selbst die Kehle
durchschneiden würden, als ihn zu bezichtigen, an den Geschehnissen
beteiligt gewesen zu sein. Er hatte dafür gesorgt, dass ihm sein
Ruf als durchgeknallter Irrer unter Umständen wie diesen von Nutzen
war.
Als er auf seiner Pritsche lag und Rachepläne
schmiedete, wurde die Zellentür geöffnet. Er setzte sich auf und
grinste breit, als zwei vierschrötige Polizisten eintraten.
»Kann ich gehen? Habt ihr endlich festgestellt,
dass ihr einen Unschuldigen eingesperrt habt, ihr verdammten
Trottel?«, tönte er arrogant und provozierend.
Sie schlossen die Zellentür hinter sich. Als ihn
der größere von beiden zu Boden schlug, nahm er noch an, dass sie
ihn zu einem Geständnis zwingen wollten, und hoffte nur, dass sie
deutliche Spuren hinterlassen würden. Das käme ihm nur zugute -
vielleicht würde er die Arschlöcher sogar verklagen. Er grinste bei
dem Gedanken und musste dann sogar laut lachen.
»Schlagt mich nur, Jungs, ich hab nichts dagegen.
Ich bitte euch sogar darum.« Das Grinsen wich aus seinem Gesicht,
als er das Schneidemesser sah. Er wollte aufstehen, wurde aber
gnadenlos zu Boden gedrückt.
»Gute Nacht, Mr. Campbell.«
Die rasiermesserscharfe Klinge fuhr über seine
Handgelenke und wurde zur Sicherheit noch über seine Kehle gezogen.
Gleich darauf verließen die Männer eilig seine Zelle. Er lag auf
dem Boden, und mit jedem Herzschlag quoll mehr Blut aus seinen
Wunden. Deutlich hörte er die beiden auf der anderen Seite der Tür
lachen.
Er raffte sich auf und torkelte zur vergitterten
Luke in der Tür. Sie ließ sich natürlich nicht öffnen. Er sah sich
in der Zelle um. Sie war völlig verschmutzt, die Wände mit Graffiti
bedeckt. Der Gestank aus dem Toilettenbecken war bestialisch.
Plötzlich wurde Trevale Campbell klar, dass er hier sterben würde.
In dieser armseligen kleinen Zelle. Allein.
Zwanzig Minuten später kamen sie zurück und
brachten eine Tasse Tee und ein Sandwich für den eingesperrten
Mann. Es war alles klug inszeniert. Ein neuer Insasse sollte sein
Zellengenosse werden und als Zeuge für seinen »Selbstmord« dienen.
Dieser junge Mann, in Gewahrsam wegen eines Verkehrsdelikts, wäre
bei dem Anblick, der sich ihm bot, beinahe in Ohnmacht
gefallen.
Alles schwamm in Blut, aber es war das Gesicht des
Toten, das ihm die Fassung raubte. Seine Augen waren aus den Höhlen
hervorgetreten, und eine derart wutverzerrte Fratze hatte der Junge
noch nie gesehen.
Auf dem Boden der Zelle war ein einziges Wort zu
lesen, mit Blut geschrieben: BASTARDE.
In ihrer Wohnung füllte Cathy die
Geschirrspülmaschine und hörte dabei ihren Anrufbeantworter
ab.
Die erste Nachricht war von Eamonn. Sie hörte nur
mit halbem Ohr hin, denn heute war Eamonn nicht mehr als nur eine
Stimme auf Band. Die zweite Nachricht war von Michaela, und Cathy
hörte fassungslos, aber voller Hass zu.
»Hallo, Cathy, versuche nur, dich zu erreichen …
ich ruf dann später wieder an.« Mickey hatte offenbar herausfinden
wollen, ob entweder Cathy oder Desrae aus irgendeinem Grund Kittys
Schule aufsuchen wollten. Das war einleuchtend, denn er selbst
wollte ja das Mädchen abholen. Sie hoffte, dass er in der Hölle
schmorte.
Die dritte Nachricht ließ sie aufhorchen. Sie
erkannte die Stimme. Es war zweifellos die von Shaquila
Campbell.
»Mrs. Pasquale? Hier ist Shaquila, rufen Sie mich
bitte zurück? Ich habe Informationen für Sie, an denen Sie bestimmt
interessiert sind.« Sie nannte ihre Handynummer und legte
auf.
Cathy verzichtete darauf, auch noch die restlichen
Nachrichten abzuhören. Stattdessen warf sie sich ihren Mantel über
und verließ die Wohnung. Eine Stunde später stand sie vor Shaquilas
Tür.
Die Frau wirkte sehr nervös. »Sie hätten anrufen
sollen. Wenn Terry wüsste … ich mein, gestern hat er sich
unheimlich aufgeregt …«
Cathy berührte den Arm der Frau. »Beruhigen Sie
sich, Shaquila. Sie haben nie wieder etwas von ihm zu
befürchten.«
Shaquila machte große Augen. »Was soll das
heißen?«
»Er ist tot«, flüsterte Cathy. »Oder wird es
zumindest sehr bald sein.«
Shaquila sah sie an, als hätte Cathy den Verstand
verloren.
»Er ist tot, glauben Sie mir, dieser Mann ist aus
Ihrem Leben verschwunden«, beharrte Cathy. »Er hat einen Selbstmord
mit Beihilfe begangen, wie man es in der Unterwelt nennt, und sich
die Pulsadern und die Kehle aufgeschlitzt. Oder er wird es
spätestens heute Abend noch tun.«
Tonlos fragte Shaquila: »Ist das wirklich
wahr?«
Cathy nickte. »Es ist wahr. Sie können aufatmen,
Shaquila. Er wird nie wiederkommen.«
Die andere Frau schloss die Augen, von ihren
Gefühlen überwältigt. »Wie oft ich von diesem Tag geträumt habe!
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist.«
Cathy lachte leise. »Das kann ich doch, Shaquila,
glauben Sie mir.«
»War es Ihre Tochter, die er gestern in seiner
Gewalt hatte?«
Cathy nickte abermals. »Ich bin gerade noch
rechtzeitig bei ihr gewesen. Aber vielen Dank für Ihre Warnung,
auch wenn ich sie nicht früh genug bekommen habe. Ich weiß, was es
für Sie bedeutet hat, sich so gegen Terry aufzulehnen.«
»Ich hatte furchtbare Angst. Ich habe das Mädchen
nicht gesehen, sondern nur gehört, dass er von ihr sprach. Ich
erinnerte mich daran, dass Ihre Tochter Kitty heißt, und hab zwei
und zwei zusammengezählt. Ich hoffe, es geht ihr gut?«
»Mitgenommen, verschüchtert, aber okay. Nochmal
vielen Dank.«
Plötzlich lachte Shaquila laut. »Ist er wirklich
tot?«
Cathy sagte gut gelaunt: »Mausetot.«
Mit Rotwein tranken sie auf Terrys Tod und lachten
und plauderten wie zwei langjährige Freundinnen. Shaquila war keine
lebende Tote mehr, sondern hatte ein neues Leben geschenkt
bekommen.
»Was werden Sie jetzt tun?«, fragte Cathy.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Allein
mich frei bewegen zu können, wird ein großartiges Gefühl sein,
verstehen Sie? Nicht darauf warten zu müssen, dass er mich abholen
kommt, wann und wie oft es ihm passt. Endlich bin ich frei.«
»Glauben Sie, je wieder ein normales Leben führen
zu können? Sie wissen schon, mit einem anderen Mann?«
Shaquila lachte verbittert. »Ich will keinen Mann,
vielen Dank, und bevor Sie mich fragen - ich will auch keine Frau.
Ich möchte nur frei sein. Ich möchte meine Kinder großziehen und
glücklich sein.«
»Ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber Sie sind
so schön, Shaquila, dass die Männer Sie nicht in Ruhe lassen
werden.«
Sie zuckte die Achseln. »Was auch immer. Wie ist es
denn mit Ihnen? Sind Sie verheiratet, geschieden, oder was?«
»Verwitwet. Aber es gibt da einen Mann. Er lebt in
den Staaten, und daher sehe ich ihn nur einmal im Monat. Aber wir
können damit gut leben. Außerdem ist da noch jemand, den ich noch
mehr zu lieben glaube, aber er ist älter als ich und vollkommen
anders als der, den ich habe.«
»Wie viel älter?«
Cathy rechnete nach. »So ungefähr sechzehn Jahre.
Ich weiß nicht genau, aber er sieht auch noch viel älter aus, als
er wirklich ist.«
»Es gibt ein altes afrikanisches Sprichwort - Je
älter der Bock, desto härter sein Horn.«
Sie lachten.
»Nochmals vielen Dank, Shaquila, ich weiß es sehr
zu schätzen, dass Sie versucht haben, mir zu helfen«, sagte
Cathy.
Sie umarmten einander, wie es nur Frauen tun.
»Danke, Cathy, du hast mich aus einem Alptraum
befreit, der fast mein ganzes Leben dauerte.«
»Nun ist er vorüber.« Sie sah auf die Uhr. »Es wird
leider Zeit, Shaquila, ich muss wieder ins Krankenhaus.«
Sie umarmten einander nochmal.
»Mach dich nicht rar, okay?«
Cathy schmunzelte. »Nein, werde ich nicht tun. Pass
auf dich auf.«
Shaquila nickte. »Du auch, und nochmals vielen
Dank.«
Sie schloss die Tür. Ihr Leben, ihr wahres Leben
würde jetzt anfangen. Nach einem Stoßseufzer ballte sie die Fäuste
und machte einen kleinen Luftsprung.
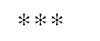
An diesem Abend feierte Cathy mit allen, die ihr
nahestanden, aber im Herzen war sie traurig. Richard war mit einer
von Susan P.s Frauen gekommen, die er sehr gut zu kennen schien.
Als sie
ihn so vertraut mit der hochgewachsenen Brünetten reden sah,
versetzte es ihr einen Stich. Sie musste sich gestehen, dass sie
eifersüchtig war.
Susan trat zu ihr. Sie hatte mehr Kokain als sonst
geschnupft und redete los, ohne nachzudenken.
»Yvonne ist eine von seinen Favoritinnen und weiß
genau, worauf Richard steht.«
Cathy lächelte. »Ich hätte gar nicht gedacht, dass
er dafür bezahlt.«
»Und ob er das tut. Mag es manchmal auch ein
bisschen exotisch, unser Richard. Weiß, was er will, und gönnt es
sich.«
»Kann ich mir vorstellen.«
Susan P. sah ihre Freundin an und fragte betroffen:
»Bin ich jetzt ins Fettnäpfchen getreten?«
Cathy zuckte die Achseln. »Keineswegs.«
»Er hat wirklich sehr viel für dich übrig. Das
weißt du doch, oder?«
»Mir liegt auch viel an ihm - als Freund. Er ist
ein guter Freund.« Als sie ihn dort mit der beeindruckenden
Prostituierten stehen sah, wusste sie, dass sie füreinander niemals
mehr als nur gute Freunde sein würden.
Jetzt, da die Gefahr vorüber war, wusste sie nicht,
ob sie überhaupt mehr wollte als das. Vielleicht waren die Gefühle
für Richard gestern Abend nur den Ereignissen zuzuschreiben.
Außerdem hatte sie doch Eamonn. Eamonn, ihren
irischen Jungen, den Mann, der ihr die Unschuld genommen hatte, den
Mann, den sie mit Herz und Seele liebte.
War es möglich, zwei Männer zu lieben? Cathy meinte
es zu tun, auf verschiedene Weise. Plötzlich kam ihr der Gedanke,
dass sie durchaus zwei Männer lieben könnte, aber keinen von
beiden brauchte.
Einer war ihr Geliebter, einer ein guter Freund -
der beste Freund, den man sich denken konnte.
Und eben dabei würde sie es belassen.
Terry Campbells Tod im Gefängnis machte
Schlagzeilen. Der scheinbare Selbstmord war einer von vielen, die
es im Laufe der letzten Jahre gegeben hatte.
Auf der Straße atmete man bei der Nachricht auf.
Der einzige Mensch, der um Trevale weinte, war seine Mutter. Die
Nachricht brach ihr das Herz.
Sie hatte ihren Sohn mit einer Leidenschaft
geliebt, die so hemmungslos wie pervers gewesen war. Sie starb noch
im selben Jahr und wurde neben ihm bestattet. Dafür sorgte
Shaquila. Aber es wurde kein Grabstein aufgestellt, gar nichts.
Kein einziger Hinweis darauf, dass sie gelebt hatten.
Auch dafür sorgte Shaquila.