Epilog
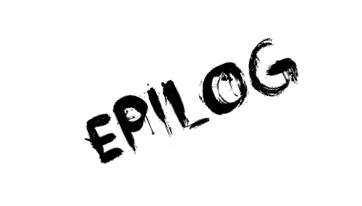
Ich habe den Winter in Melbourne immer gehasst, den feuchten Morgennebel, die eiskalten Winde, den Frost und die furchtbare Kälte. Jetzt, wo ich mir den Arsch in Berlin abfriere, sehne ich mich fast nostalgisch nach Fingernägeln, die von der Kälte nur blau werden, nicht tiefrot, nach Zehen, die ich spüren kann, nach Zähnen, die nicht ständig klappern. Es ist viel kälter, als ich erwartet habe, eine hinterhältige, gierige Kälte, die anders ist als alles, was ich je erfahren habe. Europäische Kälte. Eine Kälte wie aus den Märchen der Gebrüder Grimm.
Aber zumindest ist es hier drin warm, in diesem Café-Querstrich-Internetcafé, das um die Ecke von meiner Jugendherberge liegt und wo ich die letzten zwei Abende damit verbracht habe, gegen Jetlag und Kulturschock und die schreckliche, endlose Kälte anzukämpfen. Ich rühre das dritte Päckchen Zucker in meine Tasse, in den schlammig schwarzen, dampfenden Kaffee, extrastark, wie ich ihn bestellt habe – und verdammt will ich sein, wenn die Deutschen nicht genau verstehen, was damit gemeint ist. Zucker! steht in weißen Buchstaben auf dem leeren blauen Päckchen, und ich bin unfähig zu entscheiden, ob das witzig oder tiefschürfend oder einfach nur traurig ist.
Sugar. Zucker. Sucker. Trottel. Wir alle: nur Trottel.
Aber du bist da draußen, Madigan. Irgendwo da draußen im dreckigen Schneematsch, auf den überlaufenen Straßen. Da bin ich mir sicher. Ich kann dich fühlen wie einen Phantomschmerz. Und ich werde dich finden.
Ich kratze den Verband an meinem linken Handgelenk. Es war der tiefere Schnitt und braucht deswegen länger, um zu heilen, und noch länger, wenn ich weiter daran herumkratze. Mit dem Konto und den Kreditkarten habe ich genug Mittel, um mich monatelang über Wasser zu halten, und wenn es länger dauert als das … na ja.
Darum mache ich mir Sorgen, wenn es so weit ist.
Denn wie schwer kann es schon werden? Der hübsche kleine Joaquin, der süße vietnamesische Junge mit dem noch süßeren australischen Akzent. Er muss doch aus den supercoolen Kreisen, in denen du verkehrst, herausstechen wie ein betrunkener Nazi. Und wenn ich ihn finde, finde ich dich.
Ich werde dich finden, Madigan.
Und wie du habe ich aus meinen Fehlern gelernt.
Ich habe es in meiner Brusttasche, dein Messer. Ich bewahre es an meinem Herzen auf. Weil es jetzt endet. Mit Joaquin, mit mir, hier in Berlin. Bevor du die Chance hast, den nächsten Schoßhund zu finden, die nächste Bindung zu schmieden.
Es endet hier.
Und wenn du zurückfliehst zu mir, wenn du dich zurückschleichst in meinen Geist, setze ich diese Klinge schneller an unsere Kehle, als einer von uns blinzeln kann. Manchmal ist das meiner Meinung nach das, was man tun muss.
Denn es endet jetzt. Es endet hier.
Madigan mein, Madigan mein.
Dein Name ist mein neues Mantra, mein Ziel und das Zentrum meines Denkens. Denn es muss enden. Weil ich das hinter mir lassen muss, dich hinter mir lassen muss, und das werde ich erst können, wenn ich mir sicher bin, dass du verschwunden bist. Wenn ich mir absolut sicher sein kann, dass es vorbei ist.
Dass wir vorbei sind.
Ich nippe an meinem Kaffee und lächle. Selbst wenn ich zu spät komme, selbst wenn meine Suche mit einem toten oder komatösen Jungen endet, spielt es keine Rolle. Ich kann dich spüren, ich werde dich immer spüren können. Und ich werde dich an deinem Blick erkennen, an deinem Mienenspiel. Diesem gehetzten, hungrigen Blick, den ich einst so sehr geliebt habe. Den ich, Gott helfe mir, höchstwahrscheinlich immer noch liebe, irgendwo unter dem Hass und dem Schmerz.
Vielleicht ist es die Liebe und nicht du, die sich weigert, mich gehen zu lassen.
»Madigan mein.« Ich starre durch das Fenster auf diese Stadt, die dein Herz erobert hat. Diese kalte, schneegebeutelte Stadt, den letzten Ort, an dem du je atmen wirst.
»Madigan mein«, flüstere ich. »Wo versteckst du dich, Madigan mein?«