Kapitel 22
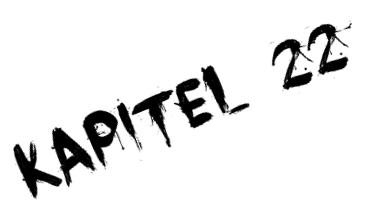
Letztendlich falle ich nur bis ins Krankenhaus. Dicke weiße Verbände umschlingen meine Handgelenke, mir wurde ein intravenöser Tropf gelegt und eine Krankenschwester mit fröhlichem, sauberem Gesicht rückt gerade die Bettlaken zurecht, als ich mühsam ins Bewusstsein zurückkehre. Schön, dass Sie endlich wieder bei uns sind. Privatklinik, Privatzimmer, wie sich herausstellt, hochklassige Krankenversicherung, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Madigan. Nichts, worüber ich je nachgedacht hätte, aber wahrscheinlich ging es genau darum.
Es hat sie drei Tage gekostet, mich wirklich zu retten. Drei Tage und eine ziemliche Menge A-positive Blutkonserven. Ziemlich erstaunlich, dass ich es überhaupt geschafft habe, zumindest sagen das die Ärzte. Ein Wunder, so die Deutung meiner Mutter, die meine Hand so fest umklammerte, dass es wehtat. Meine gesamte Familie war aufgetaucht, Sarah, Ginny und selbst Martin, der fast den gesamten Besuch über schweigend an der Tür stand. Ich war froh, als sie endlich gingen, alle außer Sarah, die jetzt auf meiner Bettkante sitzt und ständig eine Haarsträhne um einen Finger windet.
»Spuck’s aus«, sage ich.
»Hmmm?«
»Komm schon, lass es ab, die Ansprache, die Beschuldigungen, alles, was du nicht sagen konntest, als Mum und Dad noch da waren. Lass hören, bring es über die Bühne.«
Aber sie starrt mich nur traurig an und schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll, Alex, ich weiß nie, was ich zu dir sagen soll. Du bist jetzt wie ein Fremder; die meiste Zeit fühlt es sich an, als hätte ich gar keinen Bruder.«
Darauf habe ich nichts zu erwidern.
Sarah lehnt sich vor und ergreift meine Hand. Ihre Finger sind warm und vorsichtig. »Das wird lahm und kitschig klingen, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist nicht deine Schuld, nichts davon ist deine Schuld und du kannst dir keine Selbstvorwürfe machen, nur weil andere Leute dumme Dinge tun, okay?«
Ich bin ehrlich verwirrt. »Über wen sprichst du?«
»Diese Mädchen«, sagt sie und starrt auf unsere verschlungenen Hände. »Ruth und … es tut mir leid, ich habe ihren Namen vergessen.«
»Madigan«, flüstere ich. Dass meine Schwester sich nicht erinnert, ist ein kleiner Schock, die Vorstellung, dass irgendwer es vergessen kann. Aber es ist auch gut, eine Erinnerung daran, dass es da draußen eine ganze Welt gibt, die sich nicht um Madigan gedreht hat. Eine Welt, die sie kaum kannte und der sie noch weniger bedeutete.
»Ich weiß, es muss wirklich furchtbar sein«, sagt Sarah. »Zwei Freundinnen so zu verlieren. Dass sie das getan haben, es muss dich wirklich fertigmachen. Aber es wird nichts helfen, ihnen zu folgen.«
Was sagt sie? Will sie sagen …?
»Ich liebe dich, Alex, wir alle lieben dich. Wir kennen dich nicht mehr besonders gut, aber das können wir ändern. Wir wollen alle helfen, wenn wir können. Wenn du uns lässt.«
»Du denkst, ich bin selbstmordgefährdet, ist es das? Dass ich wegen Madigan und Ruth …« Ich fange an zu lachen, unfähig, mich davon abzuhalten, und meine Schwester reißt überrascht die Augen auf. »Tut mir leid, Sarah, ich lache nicht über dich. Tue ich wirklich nicht. Und ich bin auch nicht selbstmordgefährdet.«
Sie nickt in Richtung meiner Verbände. »Du kannst mir nicht erzählen, das wäre ein Unfall gewesen.«
»Nein.« Jetzt lache ich nicht mehr. »Es war kein Unfall. Aber es wird nicht wieder passieren, das kann ich dir versprechen.«
Sarah lächelt, nur kurz, einen Moment. »Schau, wir wollen, dass du für eine Weile wieder nach Hause kommst, sobald sie dich hier rauslassen. Mum räumt bereits Ginnys altes Zimmer aus. Du solltest nicht allein sein, das verstehst du, oder?«
Wie soll ich erklären – ihr, den Ärzten oder irgendwem anderem –, dass allein sein genau das ist, was ich im Moment brauche? Es ist phantastisch, dieses Gefühl, meinen Geist wieder ganz für mich zu haben. Als würde ich nach einem Tausend-Kilometer-Marsch in einem Hagelsturm in ein warmes, trockenes Bett fallen. Die Erleichterung ist so übermächtig, dass ich sie fast schmecken kann.
»Ich weiß nicht, Sarah. Im Moment fühle ich mich nicht danach, von Leuten umgeben zu sein.«
»Wir sind keine Leute, wir sind deine Familie.« Sie zieht ihre Hand aus meiner. »Ich komme morgen wieder, okay? Denk drüber nach.« Und sie wirkt so verletzt, so verwirrt, als sie vom Bett aufsteht.
»Sarah, warte. Es tut mir leid, okay?«
Wann ist meine kleine Schwester erwachsen geworden, wann hat sie sich in diese dünne, schmalgesichtige junge Frau mit dem vernünftigen Haarschnitt und den kurzen, gutgepflegten Nägeln verwandelt? Ich kann das Mädchen, das ich früher im Garten an den Handgelenken herumgewirbelt habe, während Ginny kichernd darauf wartete, auch endlich dranzukommen, kaum noch erkennen. Sie ist mir entglitten. Sie alle sind mir entglitten, meine ganze Familie. Kaum bin ich von zu Hause ausgezogen, habe ich sie quasi vergessen und wieder entschuldige ich mich bei ihr. Es tut mir alles leid.
Sarah nickt. »Mum will dich wirklich zu Hause haben, sie hat sich regelmäßig im Schlafzimmer eingeschlossen, um zu weinen. Sie hat oft geweint.«
Aber sie sind mir entglitten, oder ich habe mich entfernt – es spielt keine Rolle. Keiner von ihnen könnte es verstehen, selbst wenn ich einen Weg finden würde, ihnen zu erklären, was ich in diesen letzten, zerstückelten Monaten durchgemacht habe. Zu was ich geworden bin.
Mit dieser Sache bin ich allein. Ich war immer allein.
Richtig?
»Also?«, drängt Sarah. »Was sage ich Mum?«
Ich schlucke schwer. »Sag ihr, dass es mir leidtut.«
»Ist das alles?«
»Alles, was ich im Moment geben kann.« Ich versuche zu lächeln. »Ich nehme an, ich sehe dich morgen?«
»Ja«, antwortet sie. »Wir sehen uns morgen.«
∞
Die Fenster in St. Patrick’s Cathedral schimmern gelb wie alte Augen. Das Licht und das ständige Flüstern um mich herum verursachen mir Kopfweh und diese Leute, die sich in die Bänke gedrückt haben wie Pendler in der Rushhour. Es ist so verdammt kalt hier drin, mein Atem steigt in Wolken vor meinem Gesicht auf und vernebelt die Kirschen auf dem Hut der Frau vor mir. Echte Kirschen, rot und glänzend, aber eine von ihnen schimmelt bereits grünlich und ich frage mich, ob die Frau es weiß.
Irgendwie erscheint es mir unhöflich, danach zu fragen.
Inzwischen müssen alle hier sein, alle, die zählen. Die Sargoods sitzen mit steifem Rücken in der ersten Bank, Bailey hat eine Hand auf die Schulter seines Vaters gelegt und dort, in einer nahegelegenen Bank, sitzt eine Frau, die mir ihr Gesicht halb zuwendet und zu den hölzernen Engeln hinaufschaut, die aus den Enden der Deckenpfeiler geschnitzt sind. Ich lehne mich vor und schaue genauer hin. Ruth, ist es wirklich Ruth? Ja, und der Platz neben ihr ist leer.
Ich bewege mich so schnell, wie der Ort es mir erlaubt, bin mir der Leute, die sich umdrehen, nur allzu bewusst. Ihre Mienen sind nicht zu deuten, aber trotzdem unfreundlich. Jetzt dreht Ruth sich auf ihrem Sitz. Ihre Miene ist nur allzu leicht zu lesen. Eine Mischung aus Wut und Abscheu. Mit einem fast unmerklichen Kopfschütteln wendet sie den Blick ab und für eine Sekunde stehe ich einfach nur verwirrt da.
Jemand zieht mich am Ärmel. Eine ältere Frau mit Adlernase, älter als die Sünde, sogar älter als Äpfel. »Du wirst dich hinsetzen müssen, Liebes. Es fängt in ein paar Minuten an.«
Aber jemand hat mir meinen Sitz weggeschnappt, die ganze Kathedrale ist jetzt bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Nachzügler sind gezwungen, sich stehend an den Wänden aufzureihen. Ausgebreitet über ganze zwei Bankreihen stoßen sich die Marionetten gegenseitig mit den Ellbogen an und kichern hinter vorgehaltenen Händen. Joaquin wirft mir einen wissenden Blick zu, bewegt seine schwarzlackierten Finger in einem trägen Winken. Ich wende mich ab, nur um mich Auge in Auge mit Serge wiederzufinden, der sich seine salamanderartigen Lippen leckt und ein paar Worte sagt, die ich nur halb verstehe.
cleveres kleines Mädchen
Zu offensichtlich suche ich mit den Augen nach einem freien Sitzplatz und erst jetzt fällt mir auf, dass der Deckel des Sarges weit offen steht. Die rote Innenverkleidung sieht aus wie eine offene Wunde. War er vorher nicht geschlossen, die silbernen Verschlüsse sorgfältig verriegelt, ein Kranz aus glatten weißen Lilien auf dem noch glatteren, noch weißeren Deckel?
Doch, da bin ich mir ganz sicher.
Jetzt will ich es sehen, muss es sehen und jogge fast den Gang entlang. Bailey fängt meinen Blick auf, als ich vorne ankomme, und nickt in Richtung des plötzlich leeren Platzes auf der Bank neben sich. Ich schüttle den Kopf und gehe zum Sarg.
Wo ich für einen Moment verwirrt stehen bleibe.
Denn es ist nicht Madigan, die inmitten all des roten Satins liegt, sondern ein bleicher, allzu vertrauter junger Mann.
Ich, erkenne ich plötzlich und schockiert. Ich, gekleidet in einen schwarzen Anzug, den ich nie besessen habe, meine Haare sauber geschnitten und aus der Stirn gekämmt, die Augen friedlich geschlossen.
Aber das ist Madigans Beerdigung, nicht meine, und ich strecke die Hand aus, um –
Was zu tun? Es spielt keine Rolle mehr, sobald ich meine Hand sehe. Sie ist kleiner und viel glatter, als sie sein sollte, die gepflegten Nägel in einem tiefen, blutigen Rotton lackiert. Hände, die einer Frau gehören, genauso wie dieses Kleid aus burgunderfarbenem Samt, das eng an Hüfte und Busen anliegt, genauso wie die Haare, die in weichen, kastanienbraunen Locken über meine Schultern fallen.
Meine Knie geben nach und ich klammere mich an den Sarg, um nicht zu fallen. Die Leiche – meine Leiche, ich – liegt mit den Armen über der Brust gekreuzt und in den leicht gekrümmten Fingern der rechten Hand blitzt etwas metallisch auf. Ich lehne mich vor, um genauer hinzusehen.
Ein Messer. Ihr Messer.
Auf der Stirn der Leiche glänzt ein roter Fleck, ein zweiter zittert auf der Wange, bevor er sich löst und in die Muschel des kalten, toten Ohres fließt. Blutstropfen, die von oben herabfallen. Als ich nach oben starre, entdecke ich, dass die geschnitzten Engel jetzt über die Pfeiler kriechen und dicke, blutige Tränen aus ihren Augen quellen. Einer von ihnen segelt herab, um auf dem offenen Deckel des Sarges zu landen, die kleinen Hände aus Mahagoni fest zusammengepresst. Seine lidlosen Augen sind grün, ihr bösartiger, kalter Blick ist auf mein Gesicht gerichtet. Als die Kreatur lächelt, entdecke ich spitze, scharfe Zähne und weiß plötzlich mit absoluter Sicherheit, dass sie Fleisch zerreißen können, als wäre es Papier.
Lexi. Der Name durchfährt mich wie eine Klinge.
Der hölzerne Engel schlägt einmal, zweimal mit den Flügeln, dann stürzt er sich auf meine Kehle –
– und ich liege allein im Krankenhausbett, allein in meiner schweißbedeckten Haut.
Ich könnte laut auflachen, so überwältigend ist die Erleichterung, die sich in mir ausbreitet. Keine Erinnerung, keine Halluzination und definitiv keine verquere, psychische Nachricht von Madigan, sondern einfach nur ein normaler Albtraum. Und warum zur Hölle auch nicht? Es ist lange her, seit ich fähig war, einfach zu träumen; mein Gehirn muss eine Menge nachzuholen haben.
»Hey du.«
Ich zucke zusammen und schaffe es kaum, einen überraschten Schrei zu unterdrücken.
Joaquin, nur Joaquin. Er lungert verlegen im Türrahmen, die Unterlippe zwischen die Zähne geklemmt, während er an den Ärmeln von etwas herumspielt, was wirkt, als wäre es ein recht neuer Ledermantel; mattes Schwarz, das über seine Knie fällt. Sein Gesicht ist seltsam natürlich. Überhaupt kein Make-up, zum ersten Mal, seitdem ich ihn kenne, nur ein dickes Pflaster auf seiner Wange.
Schuldgefühle melden sich, aber ich beiße die Zähne zusammen. »Habe ich dir nicht gesagt, dass du dich von mir fernhalten sollst? Ich bin mir da ziemlich sicher, bin mir ziemlich sicher, dass ich das klargemacht habe.«
Er zuckt mit den Achseln und kommt ins Zimmer, hält am Fußende des Bettes an. »Wollte nur schauen, ob es dir gut geht, Mann.« Er starrt auf meine verbundenen Handgelenke. »Du weißt schon.«
»Mir geht’s gut, einfach prima.« Ich hebe beide Arme, wedle damit vor ihm herum. »Also kannst du jetzt gehen.«
Aber der Junge geht nicht. Der Junge bleibt und schweigt, während eine Hand nach oben gleitet, um das Pflaster auf seiner Wange zu kratzen. Ich kann nicht anders, als mich schlecht zu fühlen. Was für eine Scheiße auch immer abgegangen ist, als Madigan sich noch in mir aufhielt, nichts davon ist seine Schuld. Ihn hat sie mindestens so sehr benutzt wie mich, auch wenn er kaum etwas davon weiß.
Aber das bedeutet nicht, dass ich zulassen werde, dass er mir folgt wie ein ausgesetzter Welpe.
»Joaquin, bitte geh einfach. Du und ich, das ist jetzt vorbei. Mehr vorbei, als du dir vorstellen kannst, okay?«
»Ja, das ist cool, aber kann ich dich was fragen?«
Er wirkt so unglücklich. Seine Mundwinkel hängen genauso nach unten wie seine dürren kleinen Schultern. Seine Finger ziehen nervös an einem Zipfel meiner Decke.
»Sicher.« Ich seufze. »Was?«
»Es geht um sie, um Madigan.«
Ich kann das nicht mehr. Ich habe genug eigene Probleme. »Madigan ist tot, Joaquin, sie ist jetzt schon lange Zeit tot. Du musst sie gehen lassen.«
»Ja, was auch immer.« Der Junge zuckt mit den Achseln. »Es ist nur, weißt du, ist sie das? Ist sie wirklich tot?«
Der Blick, den er mir jetzt zuwirft, hinterhältig und böse hinter seinem Pony hervor, sorgt dafür, dass mir kalt wird.
Denn wie hat Joaquin herausgefunden, was passiert ist, ganz abgesehen davon, wo ich bin? Meine Familienangehörigen sind die einzigen, die es wissen, und sie ahnen nicht mal, dass dieses Kind existiert, und noch weniger, wie sie ihn benachrichtigen sollten. Gott, selbst ich weiß nicht, wie ich ihn finden kann, und die einzige Person, die es wusste, die einzige Person, nach dessen Pfeife er getanzt hat …
Nein. Auf keinen Fall.
Aber jetzt liegt ein Lächeln auf diesem schmalen Gesicht, ein Grinsen, das mir nur zu vertraut ist. Und diese ruhelosen Hände spielen an nichts mehr herum, sondern liegen stattdessen ruhig verschränkt vor dem Bauch. Er wirkt auch größer, als er sich aus seiner üblichen, gebeugten Haltung aufrichtet, und der Blick in diesen Augen …
Diesen Blick hätte ich überall erkannt.
»Aber du bekommst Fleißpunkte, Lexi.« Selbst die Stimme klingt jetzt anders, als alle Schauspielerei abfällt. Subtil, aber deutlich erkennbar, diese klare Melodie, die kleinen Veränderungen in der Aussprache. Und, natürlich, mein Name.
Nur eine Person auf der ganzen Welt würde mich je so nennen.
»Ich habe gefühlt, wie du verschwunden bist«, sage ich. »Du solltest tot sein.«
»Oh, Lexi.« Sie lächelt und setzt sich neben meine Füße. »Kann ich dir begreiflich machen, wie verblüffend es war? Und wie beängstigend, einfach so zu gehen, ohne zu wissen, wohin und ob ich überhaupt irgendwo hinging?«
»Aber Joaquin, woher wusstest du, wo du ihn findest?«
Das musste sie gar nicht, erklärt sie mir. Sie musste nicht suchen, denn die Verbindung zwischen seinem Geist und meinem, unserem, war so hell, so stark, dass das leuchtende Band sie fast von alleine weitergezogen hat. So viel einfacher als beim ersten Mal – bei mir –, ein so einfacher, schöner Übergang, einfach wunderbar, sie wünschte, ich hätte es sehen können, erleben können.
»Mein Gott, muss dieser Junge dich geliebt haben«, sagt sie, eine Hand über dem Herzen. »Das arme Ding hatte eigentlich nie eine Chance.«
»Wo ist er jetzt?«
»Er ist weg.« Madigan lächelt. »Ich wollte denselben Fehler nicht zweimal machen, nicht nach all dem Ärger, den du mir bereitet hast.«
»Weg? Was meinst du mit weg?«
»Ich glaube, ich meine tot«, antwortet sie. »Ich kann ihn überhaupt nicht fühlen, nicht wie bei dir. Gott, du warst immer da, wie eine Migräne, die nur darauf wartet, mich umzuwerfen.«
»Du hast ihn umgebracht? Das kannst du?«
»Serge hat es mir beigebracht, zusammen mit allem anderen. Aber es muss sofort geschehen, während der einheimische Geist noch im Schock ist. Sonst …« Sie hält inne, um mir zuzuzwinkern. »Sonst verschanzt er sich einfach und macht Ärger.«
Mir ist schlecht. »Und was passiert mit Joaquin, wenn du mit ihm fertig bist?«
»Mit dem Körper, meinst du?« Madigan schüttelt den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Vielleicht stirbt er, vielleicht fällt er in ein dauerhaftes Koma. Wer weiß das schon?«
»Interessiert es dich überhaupt?«
»Ich habe ihn nie geliebt, Lexi.« Sie lehnt sich vor und legt mir eine Hand aufs Knie. »Nicht, wie ich dich geliebt habe.«
Ich schüttle den Kopf. »Du bist unfähig zu lieben.«
Ihr Lächeln gerät ins Wanken. »Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst in mir, du weißt, was ich gefühlt habe. Ich wollte dich behalten, ich wollte dich mitnehmen. Wir hätten zusammenbleiben können, Lexi. Du und ich, für immer. Das hast du mir mal versprochen, erinnerst du dich?«
Ich wende den Blick ab. Ich habe dieser Frau, diesem Ding, was auch immer sie jetzt ist, nichts mehr zu sagen.
»Aber ich kann dir nicht vergeben, was du getan hast, Lexi, und ich kann dir nicht vertrauen. Also versäumst du jetzt die Ewigkeit.«
Schnell wie eine Schlange packt sie meine Handgelenke und ihre Finger vergraben sich tief in den Verbänden. Ich versuche, mich ihr zu entziehen, aber mein eigener Körper ist immer noch schwach, und Joaquin ist so verdammt stark, stärker, als er sein sollte.
»Vergiss mich bloß nicht«, flüstert Madigan, ihr Gesicht nur ein paar Zentimeter vor meinem. »Wenn du alt und krank bist und dein Schniedel nicht mal mehr zum Pissen gut ist, besonders dann. Vergiss niemals, was du ausgeschlagen hast.«
Dann presst sie ihre Lippen – Joaquins Lippen – auf meine, und für einen kurzen, atemlosen Moment gleitet sie in mich, windet sich um meinen Geist wie eine Katze, die nach einem gemütlichen Schlafplatz sucht …
adieu, Lexi. versuch, mich nicht zu sehr zu vermissen
… bevor sie verschwunden ist und mich wieder einmal schockiert und entsetzt zurücklässt.
Madigan lächelt. »Ich hasse es, dich zu lieben und zu verlassen, aber …«
Hinter uns räuspert sich jemand. Lautstark.
Eine der Krankenschwestern, die bedeutungsvoll auf ihre Uhr tippt, um uns mitzuteilen, dass die Besuchszeit seit einer Stunde vorbei ist. Madigan schaltet wieder in Joaquin-Modus, ihre Finger gleiten nervös an ihren Hals, ihre Haare – tut mir leid, Mann, ich wollte sowieso gehen – und die Verwandlung ist so mühelos, die Imitation so verdammt perfekt, dass ich mich frage, ob der Junge nicht vielleicht doch noch irgendwo da drin ist.
Aber nein, denn der Abschiedsblick, den sie mir zuwirft, ist so giftig, so voll von Madigan, dass es keinen Platz mehr für etwas anderes geben kann.
»Ciao, Lexi«, sagt sie. »Pass gut auf dich auf – für mich.«