Kapitel 21
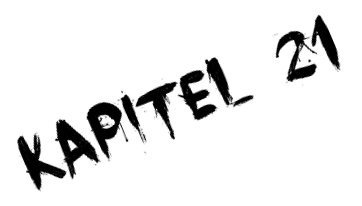
»Wo es immer ist«, murmelt er. »Was, hältst du mich jetzt für einen Dieb?«
»Würdest du es für mich holen?«
Zu beleidigt und dumm, um misstrauisch zu werden, lässt Joaquin sich auf die Knie fallen und zieht die unterste Kommodenschublade heraus. Er greift in den schmalen Zwischenraum darunter, holt das Messer hervor und gibt es mir. »Siehst du?«
Die Klinge glänzt und ist vollkommen sauber, sie liegt leicht in meiner Hand, ist aber alles andere als harmlos. Und sie ist auch überraschend scharf, das erkenne ich, als ich mit meinem Daumen über die Schneide streiche und vor Schmerz das Gesicht verziehe, weil aus dem oberflächlichen Schnitt Blut quillt. Ich wische den Finger an meiner Hose ab, dann trete ich auf Joaquin zu, das Messer auf halber Höhe zwischen uns gezückt. Der Junge weicht ein wenig zurück und lacht unsicher.
»Ich dachte, du willst, dass ich verschwinde, Mann.«
»Das tue ich.« Noch ein Schritt, zu schnell für ihn, um auszuweichen, und jetzt habe ich ihn am Arm, ziehe ihn so nah an mich heran, dass ich seinen Atem riechen kann, süßlich und voller Angst.
»Hey, pass auf.« Sein Blick ist unruhig, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, mir einerseits in die Augen zu sehen und andererseits die Klinge zu beobachten, die jetzt gefährlich nah vor seinem Gesicht schwebt. »Jetzt dreh mir nicht durch.«
»Ich dachte, du stehst auf durchgedreht.«
»Schon, aber …«
»Hör mir zu.« Ich ziehe ihn noch näher, sodass unsere Nasen sich fast berühren. »Pack dein Zeug und verschwinde, jetzt sofort. Vergiss, was ich bisher gesagt habe, das ist etwas anderes. Du musst gehen, verschwinden, untertauchen. Ich will dich hier nie wieder sehen und auch an keinem anderen Ort. Ich will niemals auch nur wieder von dir hören, hast du das verstanden?«
Joaquin windet sich, versucht es mit einem Lächeln. »Diese Scheiße hast du schon früher gesagt, Mann, du …«
Ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ziehe ich die Klinge gerade über eine Seite seines Gesichtes. Eine geschmeidige, flüssige Bewegung und fest genug, dass Blut aus der Wunde quillt. Der Junge jault auf, mehr vor Schock als vor Schmerz, und ich stoße ihn heftig von mir, beobachte, wie er erst gegen die Wand knallt, dann stolpert und wie betäubt zu Boden sinkt, eine Hand an seine blutende Wunde gepresst, den Mund erstaunt aufgerissen. Ich beuge mich vor, packe Joaquins Hemd, zerre ihn auf die Beine. Er schlägt mit der freien Hand nach mir, so lächerliche Schläge mit der offenen Hand, dass ich lachen will – ist das das Beste, das du hinkriegst? –, aber in seinen Augen stehen Tränen, Blut läuft über sein Gesicht, als wäre es eine schreckliche Maske, und plötzlich kann ich nichts Erheiterndes mehr an der Situation entdecken. Ich zerre ihn ins Badezimmer, schubse ihn Richtung Waschbecken.
»Mach dich sauber und verschwinde. Wenn ich dich noch mal sehe, wird von deinem Gesicht nichts übrig bleiben.«
»F-fick dich.« Trotzig, bis ich einen Schritt auf ihn zumache, dann schreit er wieder auf und drückt sich gegen das Waschbecken, die blutigen Hände zitternd erhoben. Der Gestank von Urin steigt auf.
Bin ich zu weit gegangen? Zu heftig gewesen? Nein, denn er muss sich fernhalten, diesmal wirklich.
»Ich meine es ernst, Joaquin. Egal, was passiert, egal, ob ich wieder Kontakt aufnehme, egal, was ich dir erzähle. Halte dich einfach von mir fern, in Ordnung? Ich bin momentan nicht ganz ich selbst, ich bin nicht … ich kann nicht verantwortlich sein für das, was ich vielleicht tue. Verstanden?«
Joaquin schluckt schwer und nickt. »Ja, was auch immer, okay.«
»Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich.«
Ich sitze auf meinem Bett und lausche, wie Joaquin sich im Bad bewegt, mit Wasser plätschert, sich schnäuzt und vor sich hin murmelt; vielleicht redet er auch mit mir. Das Messer liegt immer noch in meiner Hand und auf der Klinge trocknet Blut. Ich packe mir ein T-Shirt vom Boden, wische das Messer ab und poliere es, bis der Stahl glänzt. Meine Finger zittern – Adrenalin, Schock, vielleicht sogar Vorfreude – und ich bemühe mich, nicht zu lachen. Es ist verrückt, die gesamte Situation ist verrückt wie ein Fiebertraum oder eine Halluzination, wie ein zweitklassiger Gangsterfilm, und welche Rolle spiele ich darin? Pate oder Handlanger?
Joaquin huscht zurück in den Raum, vorsichtig wie eine Katze, mit einer gemurmelten Erklärung, dass er seine Stiefel holen muss. Er drückt sich einen Waschlappen an die Wange, Blut sickert hindurch und verwandelt das helle Gelb in ein hässliches, rostiges Orange.
»Du solltest das anschauen lassen«, erkläre ich ihm. »Muss vielleicht genäht werden.«
Der Junge sammelt seine Stiefel und ein schwarzes Samthemd vom Boden am Fußende des Bettes auf und drückt alles eng an die Brust. An der Tür zögert er, die Unterlippe zwischen die Zähne geklemmt, als wolle er noch etwas sagen, einen griffigen Spruch zum Abschied oder etwas, um sein Gesicht zu retten, aber ich drehe das Messer vielsagend in den Händen. »Geh einfach.« Und das tut er.
Sekunden später knallt die Tür zu.
Ich schließe die Augen, lasse mich aufs Bett zurückfallen, während meine Finger die glatte, warme Klinge streicheln. Ein unglaublich beruhigendes Gefühl. Vorsichtig suche ich in mir nach Madigan, weil ich sie weder stören noch beunruhigen will, und ziehe mich zurück, sobald ich das vertraute, dauerhafte Gefühl ihrer Anwesenheit spüre. Sie ist da, aber sehr, sehr tief. In nächster Zeit wird sie nicht herauskommen und das ist gut, besser als gut. Denn das würde nur eine Diskussion über Joaquin bedeuten und ich habe keine Zeit, keine Energie zu verschwenden.
Ich sollte herausfinden, was sie sonst noch getan hat, während ich weg war, sollte meine Haut Stück für Stück nach Narben oder anderen verfänglichen Zeichen absuchen, sollte das Haus durchsuchen, rausfinden, was fehlt und was neu ist. Aber was soll’s? Ich kann nichts ändern oder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen und jetzt geht es nur noch vorwärts, das ist meine einzige Möglichkeit. Entweder ich nutze sie oder ich nutze sie.
Es gibt keine Alternative.
Ruhe breitet sich in mir aus, wird größer, überlagert sogar das alles verzehrende Feuer des Hasses, das ich so sorgfältig kultiviert habe. Ein allumfassendes Gefühl von Entschlossenheit, von Gewissheit, das ich vielleicht der Tatsache zu verdanken habe, dass ich zurück bin in meinem Körper, wieder Haut und Muskeln und Fleisch besitze, meine Körperlichkeit wieder spüre. Ich schlucke, bewege meine Hände, dehne die Sehnen in meinen Händen und Beinen und genieße es, wieder dreidimensional zu sein, wieder real und ganz. Meine fehlgeleitete Überzeugung der Reinheit fällt von mir ab, denn Erin hatte recht. Hat noch recht. Geist und Körper können nicht voneinander getrennt werden, nicht dauerhaft. Nicht, ohne dem Wahnsinn zu verfallen.
Madigan, hast du das je bedacht? Auch nur für eine Sekunde?
Es gibt Dinge, auf die ich mich vorbereiten muss.
Ja, und uns läuft die Zeit davon, uns beiden. Wenn ich also je handeln will, dann sollte es besser jetzt sein, bevor sie aufwacht und nach vorne drängt. Was auch immer sonst geschieht, ich muss das Überraschungsmoment auf meiner Seite haben.
Nur noch ein paar Minuten, dann stehe ich auf.
Nur noch ein paar Minuten, fünf, zehn, fünfzehn, um hier mit geschlossenen Lidern zu liegen, tief durchzuatmen, um meinen Geist zu klären und meinen Mittelpunkt zu finden.
Nur noch ein paar Minuten.
∞
Ein Geräusch ist zu hören und ich öffne die Augen. Es war nichts, nur das Hupen eines vorbeifahrenden Autos, das sich noch dreimal wiederholt, während das Motorengeräusch verklingt. Laut der Uhr auf dem Nachttisch ist es fast fünf Uhr. Ich habe den Großteil des Tages verschlafen, aber Selbstbeschuldigungen sind jetzt mehr als nutzlos und außerdem scheint es mir gutgetan zu haben. Ich fühle mich leichter, wacher. Mein Kopf ist klarer.
Ich rolle mich herum und etwas Hartes drückt sich an meine Hüfte. Das Messer, die Klinge dankbarerweise nicht auf meinen Körper gerichtet. Mit vorsichtigen Bewegungen hebe ich es auf.
Fünf Uhr. Eine Zeit ist so gut wie die andere, nehme ich an.
Im Bad setze ich mich auf den Wannenrand, während das heiße Wasser in die Wanne plätschert, gerade noch kühl genug, um mich nicht bei lebendigem Leib zu verbrühen. Ich kratze mich am Kinn und frage mich, ob ich mich rasieren sollte. Es ist nur ein Zweitagebart, aber heute ist ja nicht irgendein Tag, oder? Meine Eingeweide verkrampfen sich, als meine guten alten Freunde, Zweifel und Angst, Arm in Arm zu mir zurückkehren. Denn was, wenn ich verrückt bin? Was, wenn das Ganze wirklich eine Wahnvorstellung ist? Dann erinnere ich mich an Ruths Gewicht in meinen Armen, tot und schlaff und kalt, und schüttle den Kopf. Wahnsinn wäre sogar noch schlimmer.
Es ist viel, viel angenehmer, meine Sünden mit Madigan zu teilen.
Die Wanne ist jetzt voll und dampft. Als ich mich vorlehne, um den Wasserhahn abzudrehen, bemerke ich eine kleine Glasflasche in einer Ecke, halbversteckt hinter einer Shampooflasche. Ungleichmäßige grüne Kristalle klappern im Glas, Badesalz, der Geruch von Äpfeln trifft mich wie ein Schlag, als ich den Korken hebe. Und noch schlimmer ist die Erinnerung an Madigan, die gleichzeitig aufsteigt, so natürlich wie ein Atemzug, so schmerzhaft wie ein Lungenriss …
sie kommt dampfumhüllt aus dem Bad, warm und feucht und nur in ein Handtuch gewickelt, legt ihre Arme um meine Hüfte, drückt sich eng und hungrig an mich. Ein nach Zahnpasta riechender Kuss, eine aufreizende Berührung mit der Zunge, und wofür war das, frage ich überrascht. Sie grinst, breit und herzerweichend. Nur weil ich dich liebe, Dummerchen
… und entschlossen verdränge ich das Bild.
Muss wohl die rosarote Brille sein.
Denn selbst wenn diese Erinnerung wahr ist, zeigt sie eine Madigan, die schon lange tot ist, und ich weigere mich, dieses Gespenst auch nur eine weitere Sekunde zu beachten.
Ich ziehe mich aus, falte meine Kleidung und lege sie ordentlich auf den Wäschekorb. Fast kann ich Ruth hören: Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Ich vertreibe auch sie aus meinen Gedanken. Direkt unter meinen Lippen entdecke ich einen eindrucksvollen blauen Fleck, der bereits verblasst, und noch ein paar kleinere auf meinem linken Oberarm. Wenn man sie zu dem Schnitt an meinem Ellbogen hinzurechnet, ist es der Anfang einer schönen Sammlung.
Das Messer wartet auf dem Badewannenrand.
Zeit, es zu erledigen.
Zeit, sie zu erledigen.
Wasser schwappt über den Rand, als ich vorsichtig in die Wanne steige, meine Eier ziehen sich protestierend zusammen, als sie mit dem fast kochenden Wasser in Kontakt kommen. Ich greife nach dem Kaltwasserhahn, halte aber inne, bevor ich ihn aufdrehe. Das Wasser wird schnell genug von allein abkühlen und außerdem werde ich es auf jeden Fall nicht lange ertragen müssen. Das Messer zittert in meiner Hand, die Klinge schwebt über meinem linken Handgelenk, über meiner Haut, die von feinen blauen Venen durchzogen ist. Ich kann das Zittern nicht stoppen, finde nicht genug Spucke, um meinen Mund zu befeuchten. Angst pulsiert in meinen Ohren, trommelt im Stakkato gegen meine Rippen.
Atme, atme. Atme.
Denn das ist der einzige Ausweg. Die Erkenntnis hat sich langsam in mir ausgebreitet und schließlich habe ich es verstanden, nach all den klaustrophobischen Stunden und Tagen – Wochen? –, die ich versteckt und mit Selbstgesprächen in mir selbst verbracht habe. Ich bin nicht stark genug, um sie zu verdrängen, nicht ansatzweise stark genug. Und ihr zu erlauben, zu gehen, sich im Fleisch von jemand anderem zu vergraben – selbst wenn es dieser Idiot Joaquin sein sollte –, nein, auch das werde ich nicht zulassen. Madigan fällt in meine Verantwortung. Ich habe die Tür geöffnet und sie eingeladen und zumindest bei einer Sache hat sie recht: Wir gehören jetzt zusammen.
Du kannst sie nicht umbringen, nicht ohne dich selbst zu töten.
Ja, Serge, aber dann ist der Umkehrschluss ebenso wahr. Der Körper stirbt, der Geist folgt. Ich atme ein letztes Mal tief durch. Das Messer schwebt über meinem Arm. Ein einziger Schnitt, mein Freund, schnell und sauber und rasch.
Ein einziger Schnitt.
was führst du jetzt im Schilde?
Ihre Stimme erklingt so unerwartet, dass ich tatsächlich aufschreie und das Messer im Wasser versinkt. Diesmal gab es keinen Hinweis, nicht die leiseste Vorwarnung, dass sie nach vorne drängt. Schnell suche ich nach dem Messer.
leg das weg, Lexi. es ist kein Spielzeug
Ich ignoriere sie, meine Energie ist zu schwer errungen, um verschwendet zu werden …
das ist ein wenig melodramatisch, findest du nicht auch?
… und drücke das Messer gegen meine Haut
ich gehe sowieso bald. du hast gewonnen
Nein, wir verlieren beide. Die Klinge gleitet der Länge nach über meinen Unterarm, schneidet tief in weiches, nachgiebiges Fleisch und o Scheiße, es tut weh, sogar noch schlimmer, als ich erwartet habe …
das war dumm und unnötig
… aber ich keuche nur einmal kurz auf, bevor ich mir das andere Handgelenk aufschlitze. Diesmal nicht so tief, weil ich mit links nicht so geschickt bin, nicht so fähig. Aber es wird reichen. Ich laufe aus, blute aus, lasse das Messer fallen, lasse alles gehen und beobachte fasziniert, wie das Blut im Rhythmus meines Herzschlages aus mir herausfließt.
steh auf! steig aus dieser Wanne und verbinde das!
Madigan kreischt jetzt, aber es ist Wut mit einem guten Anteil Angst. Endlich. Ich schließe die Augen und lasse mich tiefer ins Wasser sinken.
Es ist fast vorbei.
genug. hör auf mit dieser Scheiße, Lexi
Ein Ziehen an meinem Geist, deutlich fühlbar, aber es ist nichts, womit ich nicht gerechnet habe, nichts, worauf ich mich nicht vorbereitet habe. Ich kämpfe gegen sie an, kämpfe mit allem, was ich noch habe. Meine Arme heben sich langsam aus dem Wasser wie die einer Marionette, Madigan zieht meine Fäden, aber ich grinse nur und zwinge sie wieder nach unten. Denn ich bin keine Marionette und war es nie, und daran hätte sie denken sollen.
»Ich bin stärker, als du denkst, Madigan. Ich mag ja nicht fähig sein, dich loszuwerden, aber ich kann die Kontrolle über meinen Körper halten. Und ich kann dich in mir gefangen halten, ich kann uns beide in die Tiefe reißen.«
du bluffst
Ich konzentriere mich auf meinen Herzschlag, der das Blut aus meinem Körper pumpt. Jede Sekunde erscheint unglaublich lang, während Madigan mich erst anzischt aufzustehen, steh jetzt sofort auf, du dämliches, selbstmordgefährdetes Arschloch, dann ändert sie die Taktik, bettelt mich mit flehendem Tonfall an, damit aufzuhören, wir können einen gemeinsamen Weg finden, wenn ich nur damit aufhöre, weil sie mich liebt, verstehe ich das denn nicht, verstehe ich das denn nicht? Zufällige Bilder flackern unter den Worten auf, Szenen und Gerüche und Geräusche aus unserem Gedächtnis, die sie mir in panischer Unordnung entgegenwirft, während ich mich frage, warum sie sich überhaupt noch die Mühe macht.
Sie weiß, was ich will. Glaubt sie immer noch, sie könnte mich umstimmen?
Lexi, bitte. o Gott, bitte, bitte
»Es ist vorbei. Und du kannst nicht einfach zu Joaquin abflattern, richtig? Weil du nicht bereit bist, weil du nicht einmal weißt, wo er ist. Du hättest mich nie in deinen Geist lassen dürfen, Madigan, du hättest mir nie deine Geheimnisse verraten sollen …«
Sie schreit, ein Geräusch so voller Wut und Terror und Frust, dass es nur eins bedeuten kann. Sie weiß, sie hat endlich verstanden, dass ich es ernst meine, dass ich wirklich vorhabe, zu sterben. Und dass ich wirklich vorhabe, sie mitzunehmen.
fick dich, Lexi! verdammt sollst du sein ins Nichts!
Ein reißender, brennender Schmerz schießt durch meinen Kopf, mein Geist wird von Zähnen und Klauen zerfetzt. Ich reiße die Hände an die Schläfen, drücke dagegen, um meinen Kopf davor zu bewahren, zu explodieren. Das Gefühl ist unerträglich, das Kreischen, das die Schmerzen begleitet, ist vollkommen unmenschlich. Bis plötzlich, so plötzlich, wie sie begonnen haben, die Schmerzen verschwinden und mir auffällt, dass ich es bin, der schreit.
Also höre ich auf. Klappe den Mund zu. Und jetzt schwebe ich, fühle nichts mehr oder zumindest fast nichts. Und es ist einfacher, als ich dachte, es fällt mir leicht, alles gehen zu lassen, einfach nur zu schweben, bis ich eins bin mit dem Nichts, bis ich nichts bin.
Du bist nichts, Alex. Du warst nie etwas anderes.
Ruth, ein Echo ihrer Stimme, weit entfernt und tief in mir, und jetzt öffnet sich noch tiefer etwas, schwingt auf, denn ihre Worte sind der Schlüssel zu dem einen Ort, den Madigan niemals gefunden hat.
Lebe. Lebe. Lebe.
Mein Herz schlägt weiter, weil das dumme, entschlossene Organ sich bis zum Letzten weigert, aufzugeben. Ich konzentriere mich auf das Pochen, nutze den Herzschlag als Hebel, um mich nach oben zu ziehen. Meine blutigen Hände rutschen am Badewannenrand ab. Ich bin schwach und frage mich, ob ich nicht doch zu lange gewartet habe, ein Stück über den Punkt hinausgeschossen bin, an dem es kein Zurück mehr gibt. So viel Blut im Wasser, das in der Badewanne schwappt, als ich mich herausziehe und mit ungeschickten Fingern nach Handtüchern greife, die ich fest um meine Handgelenke binde.
Mein Kopf ist so … leer. Als wäre ich nach der schlimmsten Grippe meines Lebens wieder erwacht. Ich bleibe für einen Moment auf dem Boden liegen, ignoriere den Schüttelfrost, der meinen Körper beutelt, ignoriere mein Zähneklappern. Liege einfach nur da, taste mich zurück in meinen eigenen Geist, weil ich sicher sein will. Denn wenn sie sich immer noch irgendwo da drin versteckt, wenn sie nicht wirklich verschwunden ist, werde ich dieses Messer suchen und das Ganze verdammt noch mal zu Ende bringen.
Aber nein, hier ist niemand außer meinem eigenen, einsamen Ich.
Keine Madigan. Nicht mehr. Und nie, niemals wieder.
Jetzt weine ich und lache gleichzeitig. Die Hysterie ist gefährlich nahe und ich kämpfe um Beherrschung. Denn ich bin nicht in Sicherheit, noch nicht, um mich herum ist zu viel Blut und nicht mehr genug in mir. Ich muss jemanden rufen, bevor ich in Ohnmacht falle, aber, o Gott, wie sehr ich diesen Moment genießen will, diesen Sieg. Meinen Sieg.
Ich habe gewonnen.
Denn sie hat ihn nie gefunden, diesen essenziellen Punkt im Endspiel, den ich sorgfältig geplant und tief in dem einen kleinen Teil meines Unterbewusstseins versteckt habe, den ich vor ihr verschließen konnte und auch vor mir selbst. Ein winziges Stück Geist, aber genug, um mich am Leben zu halten, ansatzweise. Denn sie hat ihn nie gefunden, und so hat sie endlich geglaubt und ist geflohen, hat mit ihrer Flucht im Gegenzug den geisterhaften Refrain von Ruth – lebe lebe lebe – ausgelöst. Ihre Stimme war die einzige, der ich genug vertrauen konnte, um mich zurückzuholen.
»Ruth, o Ruth, es tut mir leid.«
Schwärze bedrängt mich, das Nichts kommt näher und Blut sickert durch die Handtücher, als ich mich auf den Bauch rolle und ins Wohnzimmer krieche. Ich ziehe das Telefon auf den Boden und schaffe es kaum, den Hörer abzunehmen. Meine Finger zittern auf den Tasten. Blut verschmiert alles, und ich murmle der Dame am anderen Ende der Leitung meinen Namen ins Ohr. Ich habe mich verletzt, könnte sie einen Notarztwagen schicken? So viel Blut, bitte, sie müssen sofort kommen. Bitte, bitte. Ich lasse das Telefon fallen, jetzt ist es mir egal und mir ist kalt, so furchtbar kalt.
Hat sich Madigan so gefühlt an diesem letzten, schrecklichen Abend? Hat sie dieselben Farben gesehen, die jetzt hinter meinen Lidern aufblühen und explodieren? Empfand auch sie das als schön?
Madigan Madigan Madigan
Ich forme ihren Namen mit den Lippen, drücke meine Handgelenke an die Brust.
adieu Madigan adieu meine einstmalige Geliebte adieu meine einstmalige Gehasste adieu
Oh, aber die Farben, die Kälte, ich kann das alles nicht mehr ertragen und jetzt falle ich wirklich, falle falle falle
frei