Kapitel 8
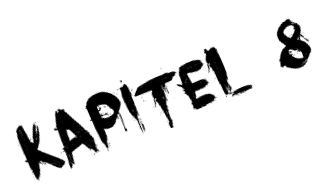
Samstagnachmittag, wieder einen Tag sinnlos verschlafen. Vier Wochen seit der Beerdigung, all diese Stunden dazwischen gefüllt mit wenig mehr als Arbeit, Schlaf und der Aufweichung des Gehirns durch furchtbare Reality-Shows und Gerichtsserien. Aber überwiegend mit Schlafen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich je so viel geschlafen habe oder so erschöpft war.
Es ist nur ein verzögerter Schock, versichert mir Ruth, die ihre Diagnose während einer unserer kurzen, aber regelmäßigen Gespräche verkündet. Drei- oder viermal pro Woche ruft sie an, offensichtlich, um zu erfahren, wie es mir geht, aber so beiläufig freundlich, dass es mir nichts ausmacht. Ich erwische mich sogar dabei, wie ich mich darauf freue, ans Telefon zu gehen und ihre Stimme am anderen Ende zu hören: Und, Alex, wie läuft es so bei dir? Das letzte Mal hat sie vorgeschlagen, dass wir am Wochenende etwas unternehmen, vielleicht ins Kino gehen, aber ich habe sie abgewimmelt, indem ich gesagt habe, dass ich mich dazu noch nicht wirklich bereit fühle, und überwiegend war das auch die Wahrheit.
Ich habe keinerlei Alkohol mehr getrunken seit der Nacht nach der Beerdigung, aber der Blackout scheint permanent zu sein. Nicht eine einzige Erinnerung ist aufgetaucht, was oder was nicht während dieser paar verlorenen Stunden passiert ist, und das, mehr als alles andere, hält mich seitdem von der Flasche fern.
Trotz meiner Nüchternheit scheinen die Auswirkungen des letzten Gelages noch nachzuwirken. Die tiefe Erschöpfung, das Kopfweh, das dauernd in meinen Schläfen pocht, der entsetzliche Durst jeden Morgen, wenn ich aufwache, die ständigen Muskelschmerzen. Vielleicht ist es ja doch mehr als die Trauer im Endstadium, an dem ich erkrankt bin.
Aber zumindest sind die Stimmen verstummt – na ja, nicht die Stimmen, wenn ich wirklich ehrlich bin; nur die eine Stimme, ihre – und das muss doch ein gutes Zeichen sein.
Also was jetzt?
Ruth hat mich das mehr als einmal gefragt, die Besorgnis in ihrer Stimme allzu offensichtlich: Glaubst du nicht, dass du die Periode der jugendlichen Existenzängste langsam weit genug ausgereizt hast?
Und sie hat recht. Zum ersten Mal, seitdem ich die Kunstakademie verlassen habe, versuche ich, mir ernsthafte Gedanken über dieses schwammige Gebilde zu machen, die Zukunft. Meine Zukunft, mit all diesen schwarzen, nutzlosen Jahren, die sich vor mir bis zum Horizont erstrecken. Vielleicht zurück in die Schule, einen berufsvorbereitenden Kurs für irgendwas und dann ein Echter Beruf, ein Echtes Leben, die Art von Leben, auf das meine Eltern immer drängen. Mein siebenundzwanzigster Geburtstag steht bald vor der Tür und wenn ich noch länger warte, wird die Zeit zu schnell vergehen, sodass ich für den Rest meines Lebens DVDs in Regale zurückstelle und überfällige Gebühren eintreibe. Es ist ein schrecklicher Gedanke und genug, um mir Feuer unter dem Hintern zu machen.
Ich dusche und entscheide, Ruth anzurufen, um herauszufinden, ob sie immer noch ausgehen will und sei es nur zum Essen. Alles, um von hier zu entkommen, denn dieses leere Haus ruft einfach zu viel Klaustrophobie hervor, um es noch zu ertragen, gefangen in der kalten, grauen Umklammerung eines Winters in Melbourne, die Handtücher noch nass von gestern, während der Schimmel im Bad an der Decke den nächsten Angriff startet.
Aber an Ruths Handy springt direkt die Mailbox an und ich hinterlasse keine Nachricht. Das Haus ist still. Gleichgültigkeit dringt aus den Wänden wie alter Schweiß.
Wie auch immer, ich werde trotzdem rausgehen. Vielleicht steige ich in die Tram Richtung Innenstadt oder fahre raus an die Bucht, die bei diesem Wetter so gut wie menschenleer sein wird. Ein perfekter Ort, um meine Gedanken treiben zu lassen, um endlich den Anfang einer Zukunft zu planen.
∞
Am Wasser war es durch den scharfen, salzigen Seewind zu kalt, also zog ich mich stattdessen in ein Café in St. Kilda zurück. Ich suchte mir das aus, das am wenigsten so aussah, als würde es von Trendsettern und Hipstern frequentiert. Mein neues Buch, ein schwerer Bildband aus dem Kunstladen in der Fitzroy Street, liegt offen vor mir auf dem Tisch. Joel Peter Witkin, irgendein Fotograf, von dem ich noch nie gehört hatte: viel zu teuer, aber was soll’s. Weitere Aufnahmen von Leichen, die mich kurzfristig an Dante erinnern und an Madigan in ihrem feuerbeschienenen Kleid – hier ging es nie um die Kunst, es ging immer um mich –, aber es ist noch viel mehr darin: Freaks und Amputierte und einfach seltsames Zeug, das die Sinne verwirrt. Sie gefallen mir gut, diese seltsamen Gegenüberstellungen und krassen Kontraste. Eine armlose Frau im Korsett, der Rücken verbrannt, als hätte man ihr dort Flügel aus den Schultern gerissen, Vogelflügel, Engelsflügel; Missbildungen und fabelhafte Kostüme; ein Mann mit den Beinen eines Satyrs, riesig und pelzig und behuft; ein Hund, bei dem aus einer offenen Wunde am Bauch Früchte quellen, hündischer Überfluss, die toten Augen blicken wissend.
Während ich die Seiten umblättere, steigen in mir Pläne auf, wieder an die Kunstakademie zu gehen. Pinsel und Farbe eingetauscht gegen eine Kamera, deren starr blickende Linse die Bilder einfängt, über die meine ungeschulten Hände nur stolpern könnten. Es muss auch Arbeit in dieser Richtung geben, ein Job bei einem Fotostudio, das Familienporträts oder Schulfotos oder Babybilder in Einkaufszentren schießt; irgendetwas, das Geld für die Rechnungen bringt, während ich am Wochenende an meiner echten Kunst arbeite, eine Technik entwickle und sie perfektioniere.
In meiner Unterwäscheschublade liegen immer noch fünftausend Dollar – ich habe nicht einen Cent davon ausgegeben, habe das Geld nicht mal mehr angeschaut, aber wäre das nicht eine gute Sache, die Summe dafür zu verwenden? Für den Neuanfang, wegen dem mir Ruth ständig in den Ohren liegt, eine Chance, wirklich etwas Konstruktives zu tun? Schuldet Madigan mir nicht wenigstens das?
Schulde ich es mir nicht selbst?
»Hey, Mann. Was haste da?«
Er ist jung, der Kerl, der sich mir gegenüber einen Stuhl herauszieht, sich hinsetzt und die Ellbogen auf den verkratzten Tisch stemmt. Vielleicht Anfang zwanzig, olivfarbene Haut und pechschwarzes langes Haar, das er locker im Nacken zusammengebunden trägt. Und dunkelbraune Augen, so dunkel, dass sie fast schwarz erscheinen. Er greift nach dem Buch und dreht es halb zu sich um. »Witkin, o ja, dieser Kerl ist heiß. Abgedreht, oder?« Dünne Lederbänder, ein Dutzend oder mehr davon, ziehen sich um seine Handgelenke wie Baby-Aale. Sein Akzent ist schwach und wirkt europäisch, oder vielleicht ist das nur ein Tick, der nicht wirklich geografisch begründet ist, sondern in den Innenstadt-Bars und der Café-Szene gut ankommt, in der er sich zweifellos herumtreibt.
»Ähm, ja«, murmle ich, vor den Kopf gestoßen von seiner Selbstsicherheit, der entwaffnenden Vertrautheit, die er an den Tag legt. Aber irgendetwas an ihm erscheint mir vertraut, ein nagendes Gefühl von flüchtiger Bekanntschaft. Ich erinnere mich nicht daran, ihn je getroffen zu haben, also frage ich mich, ob er ein wenig berühmt ist, ob ich irgendwo ein Bild von ihm gesehen habe oder jemand ihn mir aus der Ferne gezeigt hat. Oder vielleicht ist er jemand, den Madigan kannte, einer aus der Menge bei ihrer unglückseligen Ausstellung in der Galerie.
Der Kerl blättert schnell durch das Buch, dann klappt er es zu und trommelt mit den Fingern einen unregelmäßigen Rhythmus. »Was läuft heute Abend, hast du Lust, was zu unternehmen?«
Oh. O Scheiße, er baggert mich an. Ich unterdrücke ein Lachen. Okay, dann sitze ich eben allein mit einem Kunstband in einem Café in St. Kilda – einem ziemlich schicken Café, jetzt, wo ich mich genauer umsehe –, aber bitte.
»Schau«, erkläre ich ihm. »Ich will einfach nur allein sein. Nichts für ungut.«
Das Trommeln der Finger bricht ab. »Was?«
Ich bemühe mich, freundlich zu klingen, danke für das Angebot, aber sorry, bin nicht interessiert. »Ich bin wirklich nicht dein Typ, vertrau mir.«
Er lehnt sich mit zornigem Blick vor und zischt wütend: »Du hättest mich fast getäuscht, Mann, so wie du dich benommen hast. Du hast gestöhnt wie ein abgestochenes Schwein.«
»Was? Entschuldigung, ich verstehe nicht …«
»Verdammt, letzten Samstag im Fritz, erinnerst du dich?«
»Tut mir leid«, sage ich und stehe auf. »Du verwechselst mich mit jemand anderem.«
»Mann, so dunkel war es nicht.« Er steht jetzt ebenfalls auf. Er ist mindestens einen Kopf größer als ich, mit breiten Schultern. Er stemmt eine Hand in die Hüfte, während er mit der anderen immer noch das Witkin-Buch festhält. Scharfkantige Ringe glitzern an seinen Knöcheln, als er seine Finger um den Buchrücken schließt. »Was, hast du irgendwo in den Vororten eine Frau und ein paar Kinder versteckt? Wissen sie, was du am Wochenende treibst, mit wem du es treibst?«
Inzwischen schauen uns die Leute an. Seitenblicke und vielsagendes Nicken, in Erwartung eines kleinen Dramas zu ihrem Nachmittagsespresso. Mir schießt das Blut ins Gesicht und ich suche mit ungeschickten Fingern in meinem Portemonnaie nach genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen.
»Vergiss dein Buch nicht, Schwuchtel.«
Mein Kopf beginnt zu schmerzen. Plötzlich und scharf drückt der Schmerz gegen meine Schläfen, und mit ihm kommen Übelkeit und Schwindelgefühl. Ich greife nach dem Tisch, um mich abzustützen, während ich immer noch versuche, den Kerl zu beruhigen, ihn davon zu überzeugen, dass er die falsche Person erwischt hat, weil ich auf keinen Fall mit seiner Faust in meinem Magen enden will, nicht, wenn ich mich bereits fühle, als würden dort tausend blinde, sich windende Kreaturen nur nach einer Öffnung suchen, also –
– sitze ich am Küchentisch, ein halbgetrunkenes Glas Wasser vor mir, das Witkin-Buch zur Seite geschoben, sein Schutzumschlag ist halb zerrissen und jemand hämmert laut an die Eingangstür.
Mein Magen verkrampft sich. Nach der Uhr an der Wand ist es fast acht und vor dem Fenster herrscht Dunkelheit. Das Café ist das Letzte, an das ich mich erinnere. Das Café und die gefährlichen Blicke dieses Kerls – Paul, aus irgendeinem Grund weiß ich, dass er Paul heißt –, aber da kann es kaum später als drei Uhr gewesen sein, was bedeutet …
Fünf Stunden verschwunden? Wohin genau? Und wie?
Das Klopfen geht weiter, das feste Wummern einer Faust auf Holz, und ich bewege mich unsicher den Flur entlang. Die Tür ist verschlossen, sogar die Sicherheitskette ist vorgelegt, und ich zögere. Was, wenn der Kerl – Paul –, was wenn Paul mir hierher gefolgt ist, sich im Schatten verborgen hat, während ich … was? Wie bin ich überhaupt nach Hause gekommen?
Ein weiterer Schlag. Ich drücke meine Wange gegen das Holz. »Wer ist da?«
»Ich bin es, Alex, mach auf. Mir friert hier draußen der Schwanz ab.«
Joaquin.
Erleichterung und Abscheu kämpfen um die Vorherrschaft, als ich die Tür entriegle und sie diese paar paranoiden Zentimeter öffne, die mit der Kette möglich sind. Joaquin steht allein in zerrissenem Schwarz vor der Tür, die Wimpern von Mascara verklebt, und reibt sich die Hände über die nackten, mit Gänsehaut überzogenen Arme.
»Komm schon, Alex, mir ist echt kalt.«
»Was willst du?«
»Kumpel, es ist zu kalt für diese Scheiße«, protestiert er. »Ich weiß, dass du gesagt hast, ich soll sofort kommen, aber so viel zu spät bin ich nicht und außerdem ist es nicht mein Fehler. Meine Alten wollten mich nicht in Ruhe lassen, und ich habe die Tram verpasst.«
»Ich habe nicht …«
»Um so viel.« Er drückt Zeigefinger und Daumen fest zusammen, um anzuzeigen, wie knapp es war. »Das Arschloch von Fahrer wollte nicht anhalten.«
»Joaquin, was tust du hier?«
»Sag du es mir, du hast mich schließlich angerufen.«
Die Unterhaltung verursacht mir Kopfschmerzen. Ich habe ihn angerufen? Daran kann ich mich nicht erinnern, und obwohl ich mich bemühe, Licht ins Dunkel der letzten Stunden zu bringen, ist es, als würde man versuchen, lange nach dem Aufstehen einen Traum zu rekonstruieren. Nur ein einziges Bild steigt in mir auf: Paul, der jetzt lächelt und mir mit ausgestreckten Armen … etwas gibt? Ich klopfe meine Taschen ab, finde aber nichts. Was auch immer es war, es ist jetzt weg, versteckt oder ausgegeben oder geschluckt.
Joaquin jammert wieder und springt auf der Türschwelle von einem Fuß auf den anderen, also gebe ich schließlich nach und nehme die Kette ab, um ihn reinzulassen. Warum ich ihn angerufen habe, will er wissen, was es über Madigan zu erzählen gibt, das so wichtig ist, dass er es sofort erfahren muss? Und persönlich?
»Ich weiß es nicht«, gestehe ich. »Ich erinnere mich nicht mal daran, mit dir gesprochen zu haben.«
Er kneift misstrauisch die Augen zusammen. »Du machst Witze. Oder hast du was geschluckt?«
»Das wäre wohl die glaubwürdigste Erklärung.«
Gelächter, als hätte er noch nie etwas Lustigeres gehört. Er folgt mir in die Küche, wo ich mit zunehmender Feindseligkeit beobachte, wie er sich durch den Kühlschrank gräbt und seinen Arm mit Käse und Brot und einem Glas Senfgurken füllt, von dem ich mich nicht erinnern kann, es gekauft zu haben: Er macht es sich bequem, als hätte die Welt sich nicht um hundertachtzig Grad gedreht, seitdem er zum letzten Mal hier war.
»Willst du auch was?« Dicke Scheiben Käse landen auf dem Brot, das er bereits auf dem Tisch ausgebreitet hat, dann kämpfen seine Hände mit dem Deckel des Gurkenglases.
»Nimm nur, Joaquin. Es ist kein beschissenes Problem oder irgendwas.«
»Hä?« Seine Augen sind verwirrt, weit aufgerissen. »Ich mache mir nur ein Sandwich.«
»Ja, mit meinem Essen. Du hättest fragen können.«
»Bis jetzt hattest du nie etwas dagegen.«
»Das war vor langer Zeit.«
Joaquin schüttelt den Kopf und auf seinen Lippen spielt ein vorsichtiges Lächeln, als wäre es ein Scherz, den er eigentlich verstehen sollte. »Worüber redest du, Mann? Ich war doch erst gestern Nacht hier.«
∞
Ruth hat die Arme verschränkt und den Mund besorgt verzogen, während sie über die neuen, interessanten Entwicklungen des Geheimnisses nachdenkt, zu dem mein Leben scheinbar geworden ist. Zumindest ist sie mitfühlender als bei meinem Anruf.
Ach, jetzt willst du, dass ich vorbeikomme, war ihre erste, bittere Abfuhr, denn sicherlich erinnerte ich mich daran, dass ich ihr erst vor ein paar Stunden gesagt hatte, sie solle endlich aus meinem Leben verschwinden, damit aufhören, sich wie ein halbverhungerter Krebs bei Ebbe an mir festzuklammern. Aber dann wurde sie still, als ich anfing, die Blackouts zu erklären. Meine Stimme zitterte genauso wie meine Hände, als ich eine Entschuldigung für alles Gesagte stammelte, an das ich mich nicht erinnern konnte.
Innerhalb von zwanzig Minuten war sie da und verbannte Joaquin ins Wohnzimmer, wo er jetzt schmollend auf der Couch lümmelt und mit fast ausgeschalteter Lautstärke eine DVD schaut; irgendein düsteres, französisches Drama, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass ich es je sehen wollte und mich noch weniger daran erinnere, es aus der Videothek mitgenommen zu haben. Ein weiteres kleines Mysterium, das ich meiner wachsenden Sammlung hinzufügen kann.
»Wie lang geht das schon so?«, fragt Ruth.
Ich schüttle den Kopf, weil ich keine Antwort darauf habe. Denn wie soll man Zeit beziffern, besonders vertane oder verlorene Zeit, wie soll man die Sekunden und Minuten und Stunden zu einer nahtlosen Bilanz von allem zusammenfassen, was man gesagt und getan hat? Rückblickend gesehen, wie kann irgendwer sich sicher sein, dass man in jedem Moment seines wachen Lebens absolut bei Bewusstsein war? Es ist ja sogar unmöglich, den Unterschied zwischen Schlaf und Blackout zu benennen, zwischen halb erinnerten Träumen und versteckten Erinnerungen.
Und wenn ich nicht geschlafen habe, was zur Hölle habe ich dann getrieben?
»Es gibt ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind«, erkläre ich Ruth. Belanglose Dinge, aber jetzt, wo ich aufgewacht bin und wirklich nach Beweisen suche, beängstigend offensichtlich. Wie der seltsame Film, den Joaquin sich ansieht, ab und zu dreckiges Geschirr in der Spüle, das ich mir nicht erklären kann, oder halbgegessenes Essen im Kühlschrank, von dem ich mir sicher bin, es nie angerührt zu haben. Manchmal ist die Bettwäsche plötzlich frisch gereinigt und gewechselt. Solche Dinge.
Ruth wirkt ungläubig. »Wie kannst du so was nicht bemerkt haben? Ich finde, das ist ziemlich offensichtlich.«
Ich versuche zu erklären, dass ich es sehr wohl bemerkt habe, nur ohne es wirklich zu bemerken, wenn das auch nur im Mindesten Sinn ergibt. Es ist, als läge ein Belag auf meinem Geist, irgendeine Membran, die verhindert, dass ich solche Anomalien wirklich verarbeite, dass sie tief genug einsinken, um die Alarmglocken schrillen zu lassen – erst jetzt bin ich mir dieser Dinge wirklich bewusst, weil die Membran nicht mehr funktioniert. Sie ist abgerissen worden und stattdessen stehe ich vor einer beängstigenden Ansammlung von Rätseln und Seltsamkeiten.
»Das ist nicht gut, Alex. Du musst zu jemandem gehen, zu einem Arzt.« Sie hält inne und sieht mich direkt an. »Vielleicht zu einem Psychiater.«
»Du denkst, ich werde wahnsinnig?«
»Nein!« Ihre Antwort kommt sofort und unmissverständlich. »Du leidest an Trauer und Schock und Erschöpfung, nicht an Wahnsinn. Das ist sowieso ein veralteter Begriff – Leute verfallen nicht mehr dem Wahnsinn, das ist viktorianisches Denken, um Himmels willen! Das ist ›Einer flog über das Kuckucksnest‹.« Ihre Hand liegt warm auf meiner. »Du bist nicht verrückter als ich.«
»Danke für dein Vertrauen.«
Das bewirkt ein Grinsen – touché – und einen leichten Schlag auf meinen Arm. Dann will sie wieder vollkommen ernst wissen, ob ich noch mal darüber nachgedacht habe, dass sie wieder einziehen könnte. Kein Druck, aber jetzt ist es wahrscheinlich besser, wenn ich nicht allein bin, nicht beim momentanen Stand der Dinge.
Ich lächle. »Bewirbst du dich um den Job als Krankenschwester oder Babysitter, Ruth?« Aber unrecht hat sie nicht: Ich bin zu einsam geworden. Kein Wunder, dass ich aus den Fugen gerate.
Ruth zieht eine Augenbraue hoch und wartet auf die Antwort.
»Sicher«, meine ich. »Warum nicht?«
»Okay. Das ist toll. Ich finde, das ist wirklich toll.«
»Nur noch nicht sofort«, füge ich schnell hinzu. »Das Gästezimmer – dein altes Zimmer – ich muss es noch für dich ausräumen. Da drin hat sich ziemlich viel Dreck angesammelt.«
»Madigan-Dreck?«
»Ja, sie ist so plötzlich verschwunden, ich habe es noch nicht geschafft …«
»Hör auf, Entschuldigungen für sie zu finden, Alex.« Aber sie lächelt. »Ich muss sowieso meine Kündigungsfrist einhalten. Reichen zwei Wochen?«
»Ich nehme an, das kann ich schaffen.«
»Gut, dann ist es abgemacht.« Sie wirft einen vielsagenden Blick Richtung Wohnzimmer. »Was ist mit …«
Joaquin, die letzte Verbindung zu Madigan. Vielleicht habe ich mich deswegen mit ihm getroffen. Ein verräterischer Kampf zwischen meinem Unterbewusstsein und meinem wachen Selbst. Ersteres weigert sich, die Vergangenheit gehen zu lassen, das andere weiß nicht, was kommen wird.
Und ich bleibe im Niemandsland dazwischen zurück.
»Mach dir keine Sorgen«, sage ich und sehe Ruth dabei direkt in die Augen. »Er wird auch verschwunden sein.«