Regel Nr. 15: Niemand ist eine Insel
Jeder Held braucht einen Gefährten. Auch Schurken arbeiten nicht alleine.
Rebecca konnte nicht abschätzen, wie viel Zeit vergangen war, seitdem der Lkw das Lagerhaus verlassen hatte. Es kam ihr wie Stunden vor, aber sie war sich nicht sicher. Zu Beginn der Fahrt hatte sie lange Zeit versucht, das Mädchen zu trösten. Schließlich hatte sie der Kleinen ein Lied vorgesungen, das ihre Mutter früher immer gesungen hatte, und sie hatte sich beruhigt.
»Kothbiro« war ein kenianisches Wiegenlied, das Rebeccas Mutter ihr sogar noch als Teenager vorgesungen hatte, wenn es ihr schlecht ging. Sie hatte sich dann immer auf den Schoß ihrer Mutter gesetzt, und diese hatte sie in den Arm genommen und ihr diese Melodie leise vorgesungen, bis sie sich wieder besser fühlte. Rebecca wusste, dass ihre Stimme bei Weitem nicht so beruhigend war wie die ihrer Mutter, aber etwas Besseres war ihr nicht eingefallen.
Sie lagen auf ihre Betten gefesselt in einem kalten Lkw und wurden quer durch das Land zu einem unbekannten Ort gebracht, daher beruhigte Rebeccas Gesang nicht nur das Mädchen, sondern auch sie selbst. Sie hatte das Lied mit leiser, gleichmäßiger Stimme mehrmals gesungen, bis das Kind mit einfiel, auch wenn es noch immer hin und wieder schluchzte. Es brach Rebecca schier das Herz.
Als das Mädchen sich schließlich so weit beruhigt hatte, dass es reden konnte, hatte Rebecca ihr ein paar Fragen gestellt. Woher stammte sie? Wie hieß sie? Wie alt war sie? Sie tat es auf sanfte Weise, sprach in die Dunkelheit, drängte nicht auf Antworten und unterbrach ihre Fragen mit seltsamen Geschichten über ein Schwein namens Peppa und darüber, dass sie keine Erbsen mochte. Rebecca konnte gut mit Kindern umgehen, da sie in ihr oft eine Verbündete sahen.
Nach und nach bekam sie heraus, dass das Mädchen Sofiya hieß und sieben Jahre alt war. Sie hatte mit ihrer Schwester und ihrer Mutter Urlaub in Spanien gemacht; ihre Mutter hatte die Kinder schlafend im Hotelzimmer zurückgelassen, als sie nach unten zum Essen gegangen war. Das Mädchen wusste nicht genau, was dann passiert war, schien sich aber an die Hoffnung zu klammern, dass ihre Mutter sie retten würde.
Rebecca fragte sich, wie viele solcher Fälle es momentan wohl auf der Welt geben mochte – eine verzweifelte Mutter, die ihr Kind verloren hatte, und ein Kind, das nicht begreifen konnte, warum seine Mutter ihm nicht zu Hilfe eilte.
Erleichtert stellte Rebecca fest, dass die Kleine noch nicht lange dort war. Ganz vorsichtig fragte sie das Mädchen, ob es verletzt sei. Sie hatte Angst vor der Antwort und war beruhigt, als Sofiya ihr versicherte, dass sie zwar krank und verängstigt war, die Entführer ihr aber sonst nichts angetan hatten. Rebecca erzählte ihr, wer sie war und woher sie stammte, und sie versprach ihr erneut, dass alles gut werden würde.
Sofiya fragte, ob Rebecca ihre Schwester gesehen hatte, und war traurig und verzweifelt, als Rebecca dies verneinen musste. Obwohl das Mädchen erst sieben Jahre alt war, schien es sehr verantwortungsbewusst zu sein. Rebecca fragte sich, ob Sofiyas Schwester sich zusammen mit ihnen im Lkw befand. Sie konnte noch andere Menschen atmen hören, aber niemand sagte etwas.
Ob Roche wohl auch hier war?
Als sie schließlich spürte, dass der Lkw langsamer wurde und um ein paar Kurven fuhr, glaubte Rebecca, dass sie ihrem Ziel näher kamen. Sie hätte zu gern gewusst, wo sie sich gerade befanden.
»Sofiya?«, sagte sie in die Dunkelheit und versuchte, nicht allzu besorgt zu klingen. »Ich glaube, wir sind gleich da. Dann werden diese Männer wieder reinkommen und uns woanders hinbringen.«
»Nein, bitte nicht …« Das Mädchen klang, als würde es jeden Moment in Panik geraten.
»Pssst, ganz ruhig. Du musst jetzt zuhören, okay? Wir spielen ein Spiel. Wie Verstecken. Das kennst du doch, oder?«
»Ja«, antwortete Sofiya leise.
»Gut. Unser Spiel läuft so ähnlich. Du weißt, wann du dich verstecken musst, und wenn der Suchende in deine Nähe kommt, versuchst du, nicht zu laut zu atmen und nicht zu kichern.«
»Genau.« Sofiya klang ganz und gar nicht so, als wäre ihr nach Kichern zumute.
»Okay. Wenn die Männer hier reinkommen, musst du die Augen schließen und darfst sie nicht aufmachen. Du musst so tun, als würdest du schlafen, verstehst du? Dann ist es so, als könnten sie dich nicht sehen.«
»Aber man wird nicht unsichtbar, nur weil man die Augen zumacht«, erwiderte Sofiya trotzig.
»Das weiß ich, Liebes«, sagte Rebecca. »Aber wenn die Männer glauben, dass du schläfst, geben sie dir keine Medizin mehr. Hast du verstanden?«
»Ja«, antwortete Sofiya tapfer. »Also gut. Ich tue so, als würde ich schlafen.«
»Fein. Wenn die Männer wieder weg sind, kannst du die Augen öffnen, aber beweg dich nicht. Sie werden eine Weile brauchen, bis sie alle hier rausgebracht haben. Ich komme zu dir, bevor sie damit fertig sind. Du musst aber bereit sein, sofort loszulaufen, okay? Kannst du laufen?«
»Ja«, antwortete Sofiya. »Ich kann sehr schnell laufen.«
»Du bist ein tapferes Mädchen«, meinte Rebecca. »Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe: Lass die Augen zu, und beweg dich nicht.«
Sie spürte, wie der Lkw zum Stehen kam. Dann hörte sie draußen Stimmen, der Wagen fuhr weiter. Würde sie sehr weit laufen müssen, bis sie in Sicherheit war? Sie konnte sich die Entfernungen im Kopf einfach nicht vorstellen. Natürlich war ihr klar, dass ihr Vorhaben damit enden konnte, dass sie und das Mädchen umgebracht wurden. Ein Teil von ihr war sogar der Ansicht, dass das besser wäre als das Schicksal, was sie sonst erwartete.
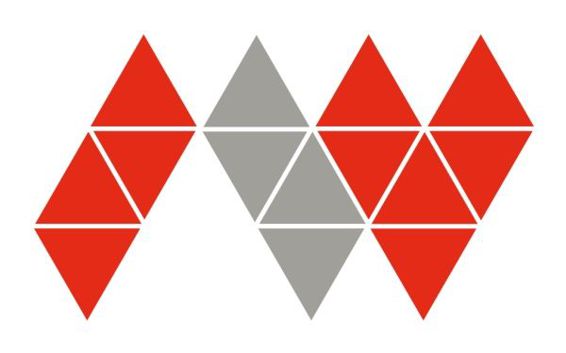
Strider hatte noch nie Rachegelüste verspürt. Nun aber hatte er das überwältigende Verlangen, Roches Tod zu rächen. Er hatte seine Worte im Besprechungsraum ernst gemeint. Jetzt ging es nicht mehr alleine darum, sich selbst zu beschützen. Roche hatte nur seine Arbeit gemacht und es nicht verdient, zu sterben. Insbesondere nicht auf so eine brutale Weise – zu Tode geprügelt und einfach auf ein Feld geworfen.
Genau das war es, was Strider seiner Meinung nach von Kriminellen wie Black Flag unterschied: Ihm bedeutete das Leben etwas. Die Freiheit zu leben war ein Vorrecht, und dieses Vorrecht hatten seine Zielpersonen verwirkt, als sie den Code gebrochen hatten. Trotz allem war ihr Tod angemessen gewesen. Roche jedoch hatte den Code nicht gebrochen – im Gegensatz zu denen, die ihn auf dem Gewissen hatten. Und diese Mörder waren jetzt da draußen und verspotteten ihn mit jedem Atemzug, den sie taten.
Eine Spur hatte Roche erst zu ihnen geführt, doch er hatte den Fehler begangen, seine Gegner zu unterschätzen. Nun, da die NCCU wusste, mit wem sie es zu tun hatte und wie weit diese Leute gehen würden, um ihre Interessen zu schützen, musste Mitchell nur noch eine neue Spur finden, die zu ihnen zurückführte. Es musste eine solche Spur geben, schließlich waren sie gezwungen gewesen, überstürzt zu handeln, und da machte man immer Fehler. Wenn er sie fand, wollte er am liebsten auf seine Weise mit ihnen abrechnen, doch wenn er die NCCU zu ihnen ließ, konnte er das nicht – aber er war bereit, dieses Opfer zu bringen.
Außerdem war es nicht Mitchells Hauptziel, Roches Tod zu rächen. Es ging ihm vor allem um den Schutz Striders, seines Alter Ego. Und Strider konnte er nur beschützen, indem er die Gefahr beseitigte, die der Salesman und Nightshade darstellten. Der Salesman hatte gesagt, Teddybärs Picknicknetzwerk wäre viel größer, als Strider sich vorstellen könne – und nach dem, was Willis im Lagerhaus entdeckt hatte, schienen sie sich nicht nur mit Kinderpornografie, sondern auch mit Menschenhandel zu beschäftigen. Mitchell fragte sich, ob sie sich dabei nur auf Kinder beschränkten. Wie groß war die ganze Sache?
Dank der wenigen Informationen, die Mitchell über den Schwarzhandel hatte, wusste er, dass die Kinder häufig auf Bestellung entführt und über die ganze Welt transportiert wurden. Neben Drogen und Waffen war der Menschenhandel die drittgrößte Einnahmequelle im organisierten Verbrechen, und Mitchell wusste, dass das Deep Web den perfekten anonymen Marktplatz für den Verkauf und Austausch solcher Menschen darstellte. Ob sie nun in die Sklaverei verkauft, in der Sexindustrie eingesetzt oder für medizinische Experimente und den Organhandel genutzt wurden, immer ging es ums große Geld. Und es war offensichtlich ein Geschäftszweig, an dem Black Flag mitverdiente.
Jetzt, wo er darüber nachdachte, ergaben die Verbindungen, die Roche gefunden hatte, Sinn. Die effizientesten kriminellen Operationen geschahen immer hinter einer legitimen Fassade. Die Zugverbindung, der Vertrag über die Biomasselieferung, die Logistikfirma – hinter diesen legalen Fassaden verbarg sich eine üble kriminelle Organisation.
Plötzlich kam Mitchell der Gedanke, dass Black Flag die Datenbank nicht etwa gestohlen hatte, um jeden angreifen zu können, der darin gespeichert war – vielmehr wollten sie dafür sorgen, dass sie nach Prince’ Tod nicht aufflogen. Hatten sie den Datenbankserver gar nicht hacken wollen? Das würde bedeuten, dass Strider sie durch den Mord an Prince gewissermaßen dazu gezwungen hatte. Vielleicht war auch gar nicht das der Auslöser gewesen, und die veränderten Passwörter hatten dazu geführt, dass Nightshade seine Logdateien nicht hatte löschen können. Erst diese Logdateien hatten Prince belastet und dazu geführt, dass die Ermittlungen gegen Teddybärs Picknicknetzwerk wieder aufgenommen worden waren. War Nightshade gezwungen gewesen, sich Zugriff auf die Datenbank zu verschaffen, um sie von Teddybärs Picknicknetzwerk abzulenken? Möglicherweise war ihnen Black Flag gar nicht immer einen Schritt voraus, sondern versuchte vielmehr, die eigenen Operationen zu schützen. Der Angriff auf das Kraftwerk war eine Kurzschlussreaktion gewesen, die sie der NCCU anlasten wollten, aber auf diese Weise war auch eine weitere Schwachstelle in der Panzerung von Black Flag zutage getreten. Nightshade war zwar ein hervorragender und erfindungsreicher Hacker, aber auch ein arroganter Hitzkopf, der unbedacht handelte.
Mitchell wusste jetzt, dass er ihn kriegen konnte.
Er fragte sich, ob Nightshade das Kraftwerk, getarnt als Roche, persönlich betreten und den Wurm eingepflanzt hatte. Das hätte zu ihm gepasst. Nightshade hatte den direkten Zugang schon immer bevorzugt, und er war sehr gut darin. Und er hatte die von ihm bewirkten Zerstörungen auch früher schon gerne mit eigenen Augen gesehen. Prince’ Tod hätte Nightshade auch in jener Nacht dazu gezwungen, voreilig zu handeln. Mitchell ärgerte sich über sich selbst, weil ihm das nicht früher eingefallen war. Sie waren die ganze Zeit davon ausgegangen, dass man auf die Datenbank zugegriffen und diese gestohlen hatte. Aber das war zu offensichtlich – Nightshade hätte gewusst, dass man es entdecken würde.
Natürlich steckt da noch mehr dahinter, dachte Mitchell verärgert. Ich hätte es gleich sehen müssen.
Er war so überrascht gewesen, dass jemand anderes zur selben Zeit wie er auf Prince’ Computer zugegriffen hatte, dass er nicht weitergedacht hatte. Das ganze Team hatte sich nur auf die Tatsache gestürzt, dass auf die Datenbank zugegriffen worden war, und sich mit der Frage beschäftigt, was Black Flag mit diesen Daten anstellen konnte. Dabei hatten sie gar keine Daten gestohlen, sondern nur Beweise beseitigt.
In diesem Augenblick wünschte sich Mitchell, Rebecca wäre bei ihm. Er hätte zu gerne einen raschen Blick in die Datenbank geworfen, um herauszufinden, ob einer der Klienten nach dem Hack von Black Flag verschwunden war. Rebecca hatte gesagt, dass die Firmenarchive jeden Tag gesichert wurden, was bedeutete, dass man sie sich genau in dem Zustand ansehen konnte, in dem sie sich an einem ganz bestimmten Zeitpunkt befunden hatten. Auf diese Weise hatte sie auch den Fotoordner auf Prince’ Desktop wiederhergestellt. Mitchell hätte zu gern gewusst, ob dasselbe auf den Datenbankserver zutraf. Er hatte nichts von diesem Archivierungssystem des Unternehmens gewusst, und er ging davon aus, dass es für Black Flag ebenfalls neu war. Wenn sie einen Klienten aus dieser Datenbank finden konnten, der nach dem Zugriff darauf gelöscht worden war, dann wussten sie, wo sie Black Flag und vermutlich auch Rebecca aufspüren konnten. Mitchell war überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein.
Schnell sammelte er seine Unterlagen zusammen, ging zu Franklins Büro und klopfte an die Tür. Ohne auf eine Antwort zu warten, betrat er das Büro. Franklin saß am Schreibtisch, den Kopf in die Hände gestützt. Er sah schrecklich müde aus.
»Nicht jetzt, Mitchell. Geben Sie mir eine Minute, okay?«
»Es ist wichtig«, entgegnete Mitchell und schloss die Tür hinter sich. »Ich glaube, ich habe eine weitere Spur gefunden, aber wir brauchen eine archivierte Kopie der Datenbank, um sie zu überprüfen. Wir sollten mit Jack Taylor von PrinceSec sprechen. Weiß er schon, dass Rebecca vermisst wird?«
»Nein, ich muss ihn noch anrufen. Was haben Sie gefunden?«
Franklins Miene wurde deutlich optimistischer, als Mitchell ihm von seiner Theorie über die Datenbank erzählte.
»Das könnte genau der Durchbruch sein, den wir brauchen, Mitchell. Gut gemacht«, sagte er. Mitchell hatte das Gefühl, dass er es wirklich so meinte. Franklin schaute ihn einen Moment ernst an; dann bedeutete er ihm, Platz zu nehmen.
»Könnten Sie sich kurz setzen, Mitchell? Wir können Taylor gleich anrufen.«
»Ja, sicher.« Mitchell ließ sich auf den Stuhl sinken und faltete die Hände auf dem Schoß. Er fand, dass Franklin sich merkwürdig benahm. Sonst konnte er ihn, Mitchell, doch gar nicht schnell genug loswerden.
»Ich möchte mich entschuldigen«, begann Franklin mit betretener Miene. »Ich weiß, dass ich Sie schlecht behandelt habe, seitdem Sie hier sind. Außerdem habe ich Sie unterschätzt.«
Mitchell zuckte mit den Achseln. Er wusste nicht, worauf sein Gegenüber hinauswollte.
»Ich habe Sie völlig falsch eingeschätzt, und das tut mir leid«, fuhr Franklin fort. Offensichtlich musste er sich einiges von der Seele reden. »Aber ich konnte nicht einfach darüber hinwegsehen, was Sie vorher getan haben.«
»Schon okay«, sagte Mitchell.
»Das soll nicht bedeuten, dass wir jetzt Freunde wären, aber ich musste das mal loswerden. Ich habe das Gefühl, Sie falsch eingeschätzt zu haben, und Sie sollen wissen, dass ich durchaus zu schätzen weiß, was Sie hier geleistet haben, insbesondere in der letzten Woche.«
Oh, du hast mich nicht falsch eingeschätzt, dachte Mitchell. Ich glaube, deine Instinkte sind noch verdammt gut.
»Danke«, erwiderte er unsicher.
»Das war eine schlimme Woche für uns alle, und sie ist noch lange nicht zu Ende. Ich versuche hier nicht, mich bei Ihnen einzuschleimen, aber ich hatte das Gefühl, Ihnen unrecht getan zu haben, was vermutlich vor allem daran lag, dass Sheila Davies immer für Sie eingetreten ist. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir über alles offen reden können, finden Sie nicht?«
Nicht über alles, dachte Mitchell, während er freundlich lächelte.
»Wie viel wissen Sie wirklich über diese Leute? Über Black Flag, meine ich. Sie sagten, Sie würden sie kennen.« Franklin stellte die Frage direkt und meinte sie nicht als Anschuldigung.
Mitchell beschloss, dass ein wenig Ehrlichkeit nicht schaden konnte. »Ich habe sie zu meiner Zeit kennengelernt«, antwortete er. »Sie haben versucht, mich zu rekrutieren, und ich habe ein paar einfache Jobs für sie gemacht. Nichts Großes. Doch ihre Arbeitsweise gefiel mir nicht.«
»Können Sie mir das genauer erklären?«
»Sie waren wütend und chaotisch.«
»Ich dachte, das wäre der Sinn der Sache«, meinte Franklin schmunzelnd.
»Das mag schon sein, aber nicht für mich. Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren nicht mehr zusammen.«
»Wissen diese Leute, wo Sie gelandet sind?«
»Ob sie wissen, dass ich hier arbeite? Nein, ich denke nicht. Ich nutze den Alias nicht mehr, den ich damals verwendet habe.«
»Was würde passieren, wenn Sie ihn wieder aktivieren?«
»Sie würden mich sofort entdecken«, antwortete Mitchell, der nicht einen Augenblick daran zweifelte. Doch er hatte eine Idee. »Es gibt noch einen anderen Alias, den ich im Notfall benutzen könnte, aber wenn ich das tue, muss ich auch einiges in der Hinterhand haben. Ich muss mir diese Datenbank ansehen. Wenn ich recht habe, können wir sie genau da erwischen, wo es wehtut.«
Franklin lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schaute Mitchell lächelnd an.
»Okay, dann wollen wir Taylor mal anrufen. Hoffentlich haben Sie auch dieses Mal recht.«