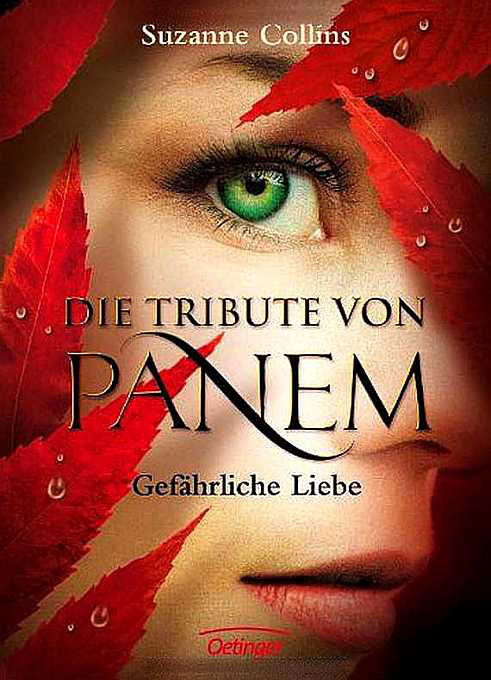

S pürst du, was sie wirklich fühlt?
Seitdem Katniss und Peeta sich ge-
weigert haben, einander in der Arena
zu töten, werden sie vom Kapitol als
Liebespaar durch das ganze Land ge-
schickt. Doch da ist auch noch Gale,
der Jugendfreund von Katniss. Und
mit einem Mal weiß sie nicht mehr,
was sie wirklich fühlt oder fühlen
darf.
Als immer mehr Menschen in ihr und
Peeta ein Symbol des Widerstands se-
hen, geraten sie al e in große Gefahr.
Und Katniss muss sich entscheiden
zwischen Peeta und Gale, zwischen
Freiheit und Sicherheit, zwischen Le-
ben und Tod.
Die grandiose Fortsetzung des Best-
sel ers »Die Tribute von Panem. Töd-
liche Spiele«. Nominiert zum Book
of the Year (Publishers Weekly).
»Überwältigend!« (Stephenie Meyer)
2
3
4

Suzanne Collins, 1962 geboren, US-amerikanische Auto-
rin, gelang bereits 2003 ein internationaler Bestseller mit
»Gregor und die graue Prophezeiung«, dem Auftakt einer
fünfteiligen Abenteuer-Reihe. 2009 erlebte sie mit der Ver-
öffentlichung ihrer Trilogie »Die Tribute von Panem« er-
neut einen grandiosen Erfolg. Die bisher erschienenen Bän-
de »Tödliche Spiele« und »Gefährliche Liebe« errangen die
ersten Plätze der amerikanischen Beststellerlisten, u. a. von
New York Times und Wal street Journal. »Tödliche Spiele«
wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Aus der Begründung der Jugendjury: „Brandaktuelle Fra-
gen entflammen im Kopf des Lesers: Wie abhängig bin ich
von der Mediengesellschaft? … Wie erschreckend ähnlich
ist die fiktive Gesellschaft Panems schon der unseren?“
Suzanne Collins
Die Tribute von
PANEM
Gefährliche Liebe
Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss
Verlag Friedrich Oetinger ∙ Hamburg
Suzanne Collins bei Oetinger
Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele
Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe
Gregor und die graue Prophezeiung
Gregor und der Schlüssel zur Macht
Gregor und der Spiegel der Wahrheit
Gregor und der Fluch des Unterlandes
Gregor und das Schwert des Krieges
Auch als Hörbücher bei Oetinger audio
© Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg 2010
Alle Rechte für die deutschsprachige Ausgabe vorbehalten
© Suzanne Collins 2009
Die amerikanische Originalausgabe erschien bei Scholastic Inc.,
557 Broadway, New York, NY 10012 USA,
unter dem Titel »The Hunger Games. Catching Fire«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss
Einband von Hanna Hörl
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany 2010/II
ISBN 978-3-7891-3219-3
www.dietributevonpanem.de
www.oetinger.de
Für meine Eltern,
Jane und Michael Collins,
und meine Schwiegereltern,
Dixie und Charles Pryor
Teil 1
Der Funke
1Ich halte die Thermoskanne in der
Hand, obwohl sich die Wärme des Tees
längst in der eisigen Luft verflüchtigt hat. Meine Mus-
keln sind vor Kälte ganz starr. Wenn jetzt ein Rudel
wilder Hunde auftauchen würde, stünden die Chan-
cen, dass ich auf dem Baum wäre, ehe sie mich angrei-
fen, nicht besonders gut. Ich müsste eigentlich aufste-
hen, herumlaufen und die Steifheit aus den Gliedern
vertreiben. Stattdessen sitze ich da, reglos wie der Stein
unter mir, während das Morgenlicht allmählich durch
den Wald bricht. Gegen die Sonne kann ich nichts aus-
richten. Ich kann nur hilflos zusehen, wie sie mich in
einen Tag hineinzieht, vor dem mir seit Monaten graut.
Gegen Mittag werden sie alle in mein neues Haus im
Dorf der Sieger einfallen. Reporter und Kamerateams aus
dem Kapitol werden nach Disktrikt 12 kommen und auch
Effie Trinket, meine alte Betreuerin, wird da sein. Ich über-
lege, ob Effie wohl immer noch die alberne rosa Perücke
trägt oder ob sie extra für die Tour der Sieger eine andere
künstliche Farbe zur Schau trägt. Und noch mehr Men-
schen werden auf mich warten. Eine Gruppe von Dienern,
13
die mich während der langen Zugfahrt rundum versorgen.
Ein Vorbereitungsteam, das mich für die öffentlichen Auf-
tritte zurechtmacht. Und mein Stylist und Freund Cinna,
der die hinreißenden Kostüme entworfen hat, dank deren
das Publikum bei den Hungerspielen überhaupt erst auf
mich aufmerksam geworden ist.
Ginge es nach mir, würde ich versuchen, die Hunger-
spiele aus meiner Erinnerung zu streichen. Nie mehr davon
sprechen. So tun, als wären sie nur ein schlimmer Traum
gewesen. Doch die Tour der Sieger macht das unmöglich.
Das Kapitol hat sie, strategisch günstig, fast genau zwi-
schen den jährlichen Spielen eingeplant, damit das Grauen
frisch und lebendig bleibt. Nicht nur, dass sie die Bewoh-
ner der Distrikte dazu zwingen, sich jedes Jahr wieder an
den eisernen Griff des Kapitols zu erinnern – wir müssen
ihn auch noch feiern. Und in diesem Jahr bin ich einer der
Stars der Show. Ich werde von einem Distrikt zum ande-
ren reisen müssen, vor der jubelnden Menge stehen, die
mich insgeheim verabscheut, ich werde den Familien ins
Gesicht sehen müssen, deren Kinder ich getötet habe …
Die Sonne steigt beharrlich weiter, also zwinge ich
mich aufzustehen. Meine Gelenke rebellieren, und mein
linkes Bein war so lange eingeschlafen, dass ich einige Mi-
nuten auf und ab gehen muss, bis ich wieder Gefühl darin
14
habe. Ich war drei Stunden im Wald, aber da ich nicht
ernsthaft versucht habe, etwas zu jagen, kann ich keinen
Erfolg vorweisen. Für meine Mutter und meine kleine
Schwester Prim ist das auch nicht mehr nötig. Sie können
es sich jetzt leisten, Fleisch beim Metzger in der Stadt zu
kaufen, auch wenn es keinem von uns besser schmeckt als
frisches Wild. Doch mein bester Freund Gale Hawthorne
und seine Familie sind auf frische Beute angewiesen und
ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich mache mich auf den
Weg, eineinhalb Stunden dauert es, unsere Fallen abzulau-
fen. Als wir noch zur Schule gingen, hatten wir nachmit-
tags Zeit, gemeinsam die Fallen abzulaufen, zu jagen und
zu sammeln, und waren immer noch rechtzeitig zum Tau-
schen auf dem Markt. Aber jetzt, da Gale im Kohleberg-
werk arbeitet und ich den ganzen Tag nichts zu tun habe,
habe ich diese Aufgabe übernommen.
In diesem Augenblick hat Gale schon beim Bergwerk
gestempelt, ist mit dem Förderkorb in schwindelerregende
Tiefen gefahren und schlägt die Kohle aus der Erde. Ich
weiß, wie es dort unten zugeht. Jedes Jahr in der Schu-
le mussten wir mit der Klasse die Bergwerke besichtigen,
das war Teil des Unterrichts. Als ich noch klein war, war
es nur unangenehm. Die klaustrophobischen Tunnel,
die schlechte Luft, die erstickende Dunkelheit von allen
15
Seiten. Doch nachdem mein Vater und einige andere
Bergarbeiter bei einer Explosion ums Leben gekommen
waren, konnte ich mich kaum noch überwinden, den För-
derkorb zu betreten. Der jährliche Ausflug wurde für mich
zum Horrortrip. Zweimal wurde mir vorher so übel, dass
meine Mutter mich zu Hause behielt, weil sie dachte, ich
hätte die Grippe.
Ich denke an Gale, der nur im Wald richtig lebendig ist,
im Wald mit der frischen Luft, der Sonne und dem sau-
beren Wasser. Ich weiß nicht, wie er das aushält. Oder …
doch, ich weiß es. Er hält es aus, weil er nur so für seine
Mutter und seine beiden jüngeren Brüder und die Schwes-
ter sorgen kann. Und hier sitze ich mit einem Haufen Geld,
mehr als genug für unsere beiden Familien, und er weigert
sich, auch nur das kleinste bisschen anzunehmen. Selbst das
Fleisch von mir zu nehmen, kostet ihn Überwindung, ob-
wohl er ganz bestimmt für meine Mutter und Prim gesorgt
hätte, wenn ich bei den Spielen getötet worden wäre. Ich
sage ihm, dass er mir damit einen Gefal en tut und dass
es mich verrückt machen würde, den ganzen Tag herum-
zusitzen. Trotzdem bringe ich das Fleisch nie vorbei, wenn
er zu Hause ist. Was kein Problem ist, da er täglich zwölf
Stunden arbeitet.
Ich bekomme Gale jetzt nur noch sonntags zu Gesicht,
16
wenn wir uns im Wald treffen, um gemeinsam zu jagen.
Das ist immer noch der beste Tag der Woche, aber nicht
mehr so wie früher, als wir uns alles erzählen konnten.
Selbst das haben die Spiele kaputt gemacht. Ich hoffe im-
mer noch, dass wir eines Tages wieder so ungezwungen
zusammen sein können, doch im Grunde weiß ich, dass
das nicht geht. Es gibt kein Zurück.
Die Fallen bringen gute Beute – acht Kaninchen, zwei
Eichhörnchen und einen Biber, der in ein Drahtgeflecht
geschwommen ist, das Gale erfunden hat. Im Fallenstel-
len ist er einfach genial. Er befestigt sie an heruntergebo-
genen jungen Bäumen, sodass Raubtiere nicht an die Beu-
te herankommen, er tarnt feine Auslösemechanismen mit
schweren Ästen und webt undurchdringliche Reusen zum
Fangen von Fischen. Während ich durch den Wald gehe
und jede Falle sorgfältig wieder aufstelle, weiß ich, dass
mein Blick für die Balance nie an seinen heranreichen
wird, an seinen Instinkt dafür, wo das Beutetier den Weg
kreuzt. Das ist mehr als Erfahrung. Er ist ein Naturtalent.
So wie ich noch bei fast völliger Dunkelheit auf ein Tier
zielen und es mit einem einzigen Pfeil treffen kann.
Als ich wieder an dem Maschendrahtzaun bin, der Dist-
rikt 12 umgibt, steht die Sonne schon recht hoch am Him-
mel. Wie immer lausche ich kurz, doch kein verräterisches
17
Summen von elektrischem Strom ist zu hören. Eigentlich
hört man es fast nie, obwohl der Zaun rund um die Uhr
unter Strom stehen müsste. Ich zwänge mich durch die
Lücke unter dem Zaun und komme auf der Weide heraus,
nur einen Steinwurf von zu Hause entfernt. Meinem alten
Zuhause. Wir dürfen es behalten, weil es offiziell für mei-
ne Mutter und meine Schwester bestimmt ist. Wenn ich
jetzt tot umfallen würde, müssten sie dorthin zurückkeh-
ren. Doch zurzeit sind sie beide glücklich im neuen Haus
im Dorf der Sieger untergebracht, und ich bin die Einzige,
die das gedrungene Häuschen benutzt, in dem ich aufge-
wachsen bin. Für mich ist es mein eigentliches Zuhause.
Jetzt gehe ich dorthin, um mich umzuziehen. Tausche
die alte Lederjacke meines Vaters gegen einen feinen Woll-
mantel, der mir an den Schultern immer zu eng vorkommt.
Die weichen, ausgetretenen Jagdstiefel gegen ein Paar teu-
rer, maschinell gefertigter Schuhe, die meine Mutter für
jemanden in meiner Stellung angemessener findet. Pfeil
und Bogen habe ich in einem hohlen Baumstamm im
Wald verstaut. Obwohl die Zeit drängt, setze ich mich für
ein paar Minuten in die Küche. Sie wirkt verlassen ohne
Feuer im Herd und ohne Tischtuch. Ich trauere meinem
alten Leben nach. Wir kamen kaum über die Runden,
aber ich wusste, wohin ich gehörte, ich wusste, wo mein
18
Platz in dem festen Gefüge unseres Lebens war. Ich würde
gern dorthin zurückkehren, im Nachhinein kommt es mir
so sicher vor im Vergleich zu jetzt, da ich so reich bin und
so verhasst bei den Machthabern im Kapitol.
Ein Maunzen an der Hintertür lässt mich aufhorchen.
Ich mache auf, und da steht Butterblume, Prims räudiger
alter Kater. Ihm gefäl t das neue Haus so wenig wie mir,
und wenn meine Schwester in der Schule ist, verzieht er sich
immer. Wir konnten uns nie besonders gut leiden, doch die
Abneigung gegen das neue Haus verbindet uns. Ich lasse
ihn herein, gebe ihm ein Stück Biberfett und kraule ihn so-
gar ein bisschen zwischen den Ohren. »Du bist hässlich, das
weißt du, oder?«, sage ich. Butterblume stupst gegen meine
Hand, er wil weiter gestreichelt werden, aber wir müssen
los. »Na komm.« Ich hebe ihn mit einer Hand hoch, greife
mit der anderen meine Jagdtasche und nehme beide mit hi-
naus auf die Straße. Der Kater befreit sich mit einem Satz
und verschwindet unter einem Busch.
Die Schuhe drücken an den Zehen, während ich über
den Ascheweg gehe. Ich nehme die Abkürzung durch klei-
ne Gassen und Hintergärten und bin im Nu bei Gales
Haus. Seine Mutter Hazelle steht am Waschbecken in der
Küche und sieht mich durchs Fenster. Sie trocknet sich die
Hände an der Schürze und kommt an die Tür.
19
Ich kann Hazelle gut leiden. Habe Hochachtung vor
ihr. Bei der Explosion, die meinen Vater das Leben kos-
tete, starb auch ihr Mann, und sie blieb mit drei Jun-
gen zurück und einem Baby im Bauch, das jeden Tag zur
Welt kommen konnte. Keine Woche nach der Geburt
zog sie schon durch die Straßen und suchte Arbeit. Der
Bergbau kam nicht infrage, schließlich musste sie für das
Baby sorgen, doch es gelang ihr, Arbeit als Wäscherin für
einige Kaufleute aus der Stadt zu bekommen. Im Alter
von vierzehn wurde Gale, ihr ältester Sohn, der Haupter-
nährer der Familie. Er hatte sich bereits für Tesserasteine
eintragen lassen, das bescherte ihnen eine bescheidene
Ration an Getreide und Öl im Tausch dafür, dass sein
Name mehrfach in die Lostrommel für die Ziehung
der Tribute wanderte. Hinzu kam, dass er auch damals
schon ein geschickter Fallensteller war. Aber das allein
hätte nicht ausgereicht, um eine fünfköpfige Familie zu
ernähren, und so schrubbte Hazelle sich die Finger auf
dem Waschbrett wund bis auf die Knochen. Im Winter
waren ihre Finger immer so rot und rissig, dass sie beim
geringsten Anlass anfingen zu bluten. Das wäre immer
noch so, hätte meine Mutter nicht eine spezielle Salbe
dagegen entwickelt. Doch Hazelle und Gale sind ent-
schlossen, den anderen Kindern, dem zwölfjährigen Rory,
20
dem zehnjährigen Vick und der sechsjährigen Posy, die
Tesserasteine zu ersparen.
Hazelle lächelt, als sie die Beute sieht. Sie packt den Bi-
ber am Schwanz und wiegt ihn in der Hand. »Das gibt
einen schönen Eintopf.« Anders als Gale hat sie kein Prob-
lem mit unserem Jagdabkommen.
»Hat auch einen schönen Pelz«, sage ich. Es ist tröst-
lich, hier bei Hazelle zu sein. Über die Vorzüge der Beute
zu sprechen wie eh und je. Sie schenkt mir einen Becher
Kräutertee ein und ich lege dankbar meine eiskalten Hän-
de darum. »Weißt du, als ich von der Jagd kam, dachte
ich mir, ich könnte doch Rory ab und zu mal mitnehmen.
Nach der Schule. Könnte ihm beibringen, wie man mit
Pfeil und Bogen umgeht.«
Hazelle nickt. »Das wär gut. Gale würde ja gern, aber
er hat nur die Sonntage, und ich glaub, die hält er sich
lieber für dich frei.«
Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Wangen flam-
mend rot werden. Das ist natürlich albern. Kaum jemand
kennt mich besser als Hazelle. Sie weiß, wie ich mit Gale
verbunden bin. Bestimmt haben viele Leute geglaubt, wir
würden später einmal heiraten, auch wenn ich nie daran
gedacht habe. Doch das war vor den Spielen. Bevor mein
Mittribut Peeta Mellark verkündet hat, er sei unsterblich
21
in mich verliebt. Unsere Liebesgeschichte wurde in der
Arena zu unserer wichtigsten Überlebensstrategie.
Allerdings war es für Peeta nicht bloß eine Strategie.
Was es für mich war, weiß ich nicht so genau. Aber dass es
für Gale eine einzige Qual war, das weiß ich inzwischen.
Meine Brust schnürt sich zusammen, als ich daran denke,
dass Peeta und ich auf der Tour der Sieger wieder als Lie-
bespaar auftreten müssen.
Ich stürze den Tee hinunter, obwohl er zu heiß ist, und
schiebe schnell den Stuhl zurück. »Ich muss jetzt los. Muss
mich für die Kameras herrichten.«
Hazelle umarmt mich. »Genieß das Essen.«
»Ganz bestimmt«, sage ich.
Als Nächstes mache ich auf dem Hob halt, wo ich frü-
her den meisten Handel getrieben habe. Vor langer Zeit
wurde im Hob Kohle gelagert, später dann wurde er zum
Treffpunkt für zwielichtige Geschäfte, bis schließlich ein
richtiger Schwarzmarkt entstand. Er zieht kriminelle Ele-
mente an und deshalb gehöre ich wohl auch dorthin. Wer
in den Wäldern um Distrikt 12 herum jagt, bricht min-
destens ein Dutzend Gesetze und riskiert die Todesstrafe.
Auch wenn sie es nie erwähnen, verdanke ich den
Leuten vom Schwarzmarkt eine Menge. Gale hat mir er-
zählt, dass Greasy Sae, die alte Frau, die Suppe verkauft,
22
während der Spiele eine Sammlung für Peeta und mich ins
Leben gerufen hat. Sie sollte eigentlich auf den Schwarz-
markt beschränkt sein, doch viele Leute hörten davon und
steuerten etwas bei. Ich weiß nicht genau, wie viel es war,
und die Preise für die Sponsorengeschenke in der Arena
waren unglaublich hoch. Doch soweit ich weiß, hat es mir
das Leben gerettet.
Es ist immer noch merkwürdig, den Eingang mit einer
leeren Jagdtasche zu betreten, ohne etwas zum Tauschen,
und stattdessen den schweren Geldbeutel an der Hüfte
zu spüren. Ich versuche, so viele Stände wie möglich zu
besuchen und meine Einkäufe gleichmäßig zu verteilen:
Kaffee, Brötchen, Eier, Garn und Öl. Schließlich kommt
mir noch die Idee, drei Flaschen klaren Schnaps bei einer
einarmigen Frau namens Ripper zu kaufen. Sie war Opfer
eines Bergwerksunfalls und clever genug, sich trotzdem
durchzuschlagen.
Der Schnaps ist nicht für meine Familie bestimmt, son-
dern für Haymitch, der bei den Spielen Peetas und mein
Mentor war. Haymitch ist mürrisch, grob und meistens be-
trunken. Aber er hat ganze Arbeit geleistet – mehr als das,
denn zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele durften
zwei Tribute gewinnen. Also ganz gleich, wie Haymitch
ist, ich habe auch ihm viel zu verdanken. Und zwar für
23
den Rest meines Lebens. Ich besorge den Schnaps, weil er
vor ein paar Wochen mal keinen mehr hatte und es auch
keinen zu kaufen gab, woraufhin er Entzugserscheinun-
gen bekam. Er zitterte und schrie irgendwelche schreck-
lichen Erscheinungen an, die nur er sehen konnte. Prim
erschrak zu Tode, und mir machte es, ehrlich gesagt, auch
keinen Spaß, ihn so zu sehen. Seitdem horte ich das Zeug
sozusagen, für den Fall, dass es mal wieder einen Engpass
geben sollte.
Cray, der Oberste Friedenswächter, runzelt die Stirn,
als er mich mit den Flaschen sieht. Er ist ein älterer Mann
mit ein paar silbernen Haarsträhnen, die er schräg über
den knallroten Kopf gekämmt hat. »Das Zeug ist zu stark
für dich, Mädchen.« Er muss es ja wissen. Abgesehen von
Haymitch trinkt Cray mehr als alle, die ich kenne.
»Ach, meine Mutter braucht es für ihre Medizin«, sage
ich leichthin.
»Tja, damit kann man alles abtöten«, sagt er und knallt
eine Münze für eine Flasche auf den Tresen.
Als ich zu Greasy Saes Stand komme, hieve ich mich
auf den Tresen und bestelle etwas Suppe, die nach einer
Mischung aus Flaschenkürbis und Bohnen aussieht. Wäh-
rend ich esse, kommt ein Friedenswächter namens Darius
und bestellt auch eine Portion. Von den Gesetzeshütern ist
24
er mir noch der liebste. Er ist nicht so ein Wichtigtuer und
meistens zu einem Spaß aufgelegt. Er dürfte in den Zwan-
zigern sein, sieht jedoch kaum älter aus als ich. Irgendet-
was an seinem Lächeln und seinen roten Haaren, die in
alle Richtungen abstehen, lässt ihn jungenhaft wirken.
»Müsstest du nicht schon im Zug sitzen?«, fragt er.
»Ich werde um zwölf abgeholt«, sage ich.
»Müsstest du nicht besser aussehen?«, fragt er flüsternd,
aber so, dass es jeder hören kann. Obwohl ich nicht in
der Stimmung bin, muss ich über seine Neckerei lächeln.
»Vielleicht eine Schleife im Haar oder so?« Er zieht kurz an
meinem Zopf und ich schiebe seine Hand weg.
»Keine Sorge. Wenn sie mit mir fertig sind, wirst du
mich nicht wiedererkennen«, sage ich.
»Gut«, sagt er. »Zeig zur Abwechslung mal ein bisschen
Stolz auf deinen Distrikt, Miss Everdeen. Hm?« Er schaut
Greasy Sae im Spaß missbilligend an und schüttelt den
Kopf, dann geht er zu seinen Freunden.
»Die Suppenschale krieg ich aber wieder!«, ruft Greasy
Sae ihm nach, aber sie lacht dabei, deshalb klingt es nicht
besonders streng. »Kommt Gale dich verabschieden?«,
fragt sie mich.
»Nein, er stand nicht auf der Liste«, sage ich. »Aber ich
hab ihn Sonntag gesehen.«
25
»Ach, ich hätte gedacht, dass er auf der Liste steht. Wo
er doch dein Cousin ist«, sagt sie ironisch.
Das ist ein weiterer Teil der Lügengeschichte, die sie
sich im Kapitol ausgedacht haben. Als Peeta und ich bei
den Hungerspielen unter die letzten acht kamen, wurden
Reporter losgeschickt, die persönliche Geschichten über
uns bringen sol ten. Als sie nach meinen Freunden fragten,
haben al e auf Gale verwiesen. Aber das konnten sie nicht
schreiben, denn in der Arena spielte ich ja die Liebesge-
schichte, und da konnte ich nicht Gale als besten Freund
haben. Er sah zu gut aus, zu männlich, und er war kein
bisschen bereit, für die Kameras zu lächeln und den netten
Jungen von nebenan zu spielen. Und wir sehen uns tatsäch-
lich ganz schön ähnlich. Wir haben das typische Aussehen
des Saums. Dunkle glatte Haare, olivfarbene Haut. Also
hat irgendein Schlaukopf ihn zu meinem Cousin ernannt.
Ich wusste nichts davon, bis wir wieder zu Hause waren, auf
dem Bahnsteig, und meine Mutter sagte: »Deine Cousins
können es kaum erwarten, dich wiederzusehen!« Da drehte
ich mich um und sah Gale und Hazel e und die Kinder –
was blieb mir anderes übrig, als mitzuspielen?
Greasy Sae weiß, dass wir nicht verwandt sind, aber
selbst manche Leute, die uns schon jahrelang kennen,
scheinen es vergessen zu haben.
26
»Ich kann es kaum erwarten, es hinter mir zu haben«,
flüstere ich.
»Ich weiß«, sagt Greasy Sae. »Aber du musst da durch,
um es hinter dir zu haben. Also sieh zu, dass du nicht zu
spät kommst.«
Als ich mich auf den Weg zum Dorf der Sieger mache,
fängt es ein wenig an zu schneien. Das Dorf liegt nur ei-
nen knappen Kilometer von dem Platz im Stadtzentrum
entfernt, aber es scheint wie eine völlig andere Welt.
Es ist eine eigene kleine Gemeinde, die um eine schöne
Grünfläche herum errichtet wurde, dazwischen blühende
Sträucher. Zwölf Häuser, jeweils so groß, dass zehn von
der Sorte hineinpassen würden, in der ich aufgewachsen
bin. Neun davon stehen leer, wie immer schon. Die drei,
die bewohnt sind, gehören Haymitch, Peeta und mir.
Die Häuser, in denen meine Familie und Peeta leben,
haben eine warme, lebendige Ausstrahlung. Licht hinter
den Fenstern, Rauch aus dem Schornstein, leuchtende
Maisbüschel, mit denen der Eingang zum bevorstehenden
Erntefest geschmückt ist. Haymitchs Haus dagegen wirkt,
obwohl der Hausmeister sich um alles kümmert, trostlos
und verwahrlost. Vor der Haustür mache ich mich auf den
Dreck gefasst, der mich drinnen erwartet.
Unwillkürlich rümpfe ich die Nase. Haymitch weigert
27
sich, jemanden zum Saubermachen hineinzulassen, und
er selbst putzt nicht gerade gründlich. Im Lauf der Jahre
haben sich die Gerüche von Schnaps und Erbrochenem,
gekochtem Kohl und angebranntem Fleisch, ungewa-
schenen Kleidern und Mäusedreck zu einem Gestank
vermischt, der mir die Tränen in die Augen treibt. Ich
bahne mir einen Weg durch weggeworfene Verpackun-
gen, Glasscherben und Knochen bis zu der Stelle, wo
Haymitch normalerweise zu finden ist. Er sitzt am Kü-
chentisch, die Arme über die Holzplatte ausgebreitet, das
Gesicht in einer Schnapspfütze, und schnarcht, was das
Zeug hält.
Ich rüttele ihn an der Schulter. »Aufstehen!«, sage ich
laut, denn inzwischen weiß ich, dass man ihn auf die sanf-
te Tour nicht wach bekommt. Für einen Moment setzt
sein Schnarchen aus, wie ein kurzes Zögern, dann geht es
wieder los. Ich rüttele ihn fester. »Aufstehen, Haymitch!
Heute beginnt die Tour der Sieger!« Mit Gewalt öffne ich
das Fenster und sauge die frische Luft tief ein. Dann stap-
fe ich durch den Müll auf dem Boden, fördere eine Kaf-
feekanne aus Blech zutage und fülle sie am Waschbecken
mit Wasser. Der Ofen ist noch nicht ganz aus, und ich
schaffe es, den wenigen glühenden Kohlen eine Flamme
zu entlocken. Ich schütte Kaffeepulver in die Kanne, so
28
viel, dass es auf jeden Fall ein gutes, starkes Gebräu ergibt,
und stelle sie zum Kochen auf den Ofen.
Haymitch ist immer noch weggetreten. Da alles ande-
re nichts genützt hat, fülle ich eine Schale mit eiskaltem
Wasser, kippe sie ihm über den Kopf und bringe mich
in Sicherheit. Er stößt einen kehligen, animalischen Laut
aus. Er springt auf, wobei der Stuhl drei Meter nach hin-
ten fliegt, und schwingt ein Messer. Ich hatte vergessen,
dass er immer mit dem Messer in der Hand schläft. Ich
hätte es ihm aus der Hand nehmen sollen, aber ich hatte
zu vieles zu bedenken. Er flucht wie ein Kesselflicker und
schlägt mehrmals um sich, ehe er zu sich kommt. Mit dem
Hemdsärmel wischt er sich über das Gesicht und dreht
sich dann zu mir um. Ich hocke auf dem Fenstersims, für
den Fall, dass ich schnell Reißaus nehmen muss.
»Was soll das?«, fährt er mich an.
»Du hast gesagt, ich soll dich wecken, eine Stunde be-
vor die Kameras kommen«, erkläre ich. »Was?«, sagt er. »Es
war deine Idee«, sage ich.
Jetzt scheint er sich zu erinnern. »Wieso bin ich
klatschnass?«
»Ich hab dich nicht wach gekriegt«, sage ich. »Hey,
wenn du verhätschelt werden willst, musst du Peeta
fragen.«
29
»Was soll er mich fragen?« Beim bloßen Klang seiner
Stimme bekomme ich im Bauch einen Knoten aus lauter
unangenehmen Gefühlen: schlechtes Gewissen, Trauer,
Angst. Und Sehnsucht. Ich kann ruhig zugeben, dass die
auch hineinspielt. Aber gegen die anderen Gefühle hat sie
keine Chance.
Ich schaue Peeta an, während er zum Tisch kommt.
Die Sonnenstrahlen fangen sich im glitzernden Schnee in
seinem blonden Haar. Er sieht stark und gesund aus, so
ganz anders als der kranke, halb verhungerte Junge, den
ich aus der Arena kenne, und sein Hinken fällt kaum
noch auf. Er legt ein frisch gebackenes Brot auf den Tisch
und hält Haymitch die Hand hin.
»Ob du mich wecken kannst, ohne dass ich mir eine
Lungenentzündung hole«, sagt Haymitch und gibt Pee-
ta das Messer. Er zieht sein dreckiges Hemd aus, sodass
ein nicht minder dreckiges Unterhemd zum Vorschein
kommt, und reibt sich mit einem trockenen Zipfel ab.
Peeta lächelt und spült Haymitchs Messer mit klarem
Schnaps aus einer Flasche ab, die auf dem Boden steht.
Er wischt das Messer am Hemd sauber und schneidet
das Brot in Scheiben. Peeta versorgt uns alle mit frischen
Backwaren. Ich jage. Er backt. Haymitch trinkt. Jeder von
uns beschäftigt sich auf seine Weise, um die Gedanken an
30
unsere gemeinsame Zeit als Mitstreiter in den Hungerspie-
len fernzuhalten. Erst als er Haymitch die Brotkante ge-
reicht hat, sieht Peeta mich zum ersten Mal an. »Möchtest
du auch ein Stück?«
»Nein, ich hab auf dem Hob gegessen«, sage ich. »Aber
vielen Dank.« Meine Stimme klingt fremd, so förmlich.
Wie immer, wenn ich mit Peeta spreche, seit die Kameras
unsere glückliche Heimkehr gefilmt haben und wir in un-
ser richtiges Leben zurückgekehrt sind.
»Keine Ursache«, erwidert er steif.
Haymitch wirft sein Hemd mitten in das Durcheinan-
der. »Brrr! Ihr beide müsst euch aber noch ordentlich auf-
wärmen, bevor die Show losgeht.«
Da hat er natürlich recht. Das Publikum erwartet die
beiden Turteltäubchen, die die Hungerspiele gewonnen
haben. Nicht zwei Menschen, die einander kaum in die
Augen sehen können. Aber ich sage nur: »Geh dich mal
waschen, Haymitch.« Dann schwinge ich mich zum Fens-
ter hinaus, springe nach unten und gehe über die Wiese
nach Hause.
Der Schnee bleibt jetzt liegen und meine Füße hin-
terlassen eine Spur. Vor der Haustür befreie ich meine
Schuhe von dem nassen Zeug. Meine Mutter hat Tag und
Nacht geschuftet, damit alles schön ist für die Kameras,
31
da will ich ihren glänzenden Fußboden nicht gleich wie-
der dreckig machen. Ich bin kaum im Haus, da kommt sie
schon auf mich zu und fasst mich am Arm, als wollte sie
mich aufhalten.
»Keine Sorge, ich ziehe sie hier aus«, sage ich und lasse
die Schuhe auf der Fußmatte stehen.
Meine Mutter lacht ein eigenartiges, heiseres Lachen
und nimmt mir die prall gefüllte Jagdtasche von der
Schulter. »Es ist ja nur Schnee. Hast du einen schönen
Spaziergang gemacht?«
»Spaziergang?« Sie weiß, dass ich die halbe Nacht im
Wald verbracht habe. Da sehe ich den Mann, der hinter
ihr in der Küchentür steht. Ein einziger Blick auf seinen
maßgeschneiderten Anzug und sein chirurgisch perfektio-
niertes Gesicht verrät mir, dass er aus dem Kapitol kommt.
Irgendetwas stimmt nicht. »Das war eher ein Schlittern.
Es wird jetzt richtig glatt draußen.«
»Du hast Besuch«, sagt meine Mutter. Ihr Gesicht ist
zu blass, und in ihrer Stimme höre ich die Angst, die sie
zu verbergen sucht.
»Ich dachte, wir erwarten sie erst gegen Mittag.« Ich
tue so, als ob ich nichts bemerke. »Ist Cinna schon da, um
mir beim Umziehen zu helfen?«
»Nein, Katniss, es ist …«, setzt meine Mutter an.
32
»Bitte hier entlang, Miss Everdeen«, sagt der Mann. Er
zeigt in Richtung Flur. Es ist merkwürdig, durch das ei-
gene Haus geleitet zu werden, aber ich hüte mich, etwas
dazu zu sagen.
Im Gehen lächele ich meine Mutter über die Schulter
hinweg zuversichtlich an. »Bestimmt noch ein paar An-
weisungen für die Tour der Sieger.« Sie haben mir schon
alle möglichen Informationen über die Reiseroute und die
Etikette in den unterschiedlichen Distrikten zukommen
lassen. Doch als ich auf die Tür zum Arbeitszimmer zu-
gehe, eine Tür, die ich bis zu diesem Moment noch nie
geschlossen gesehen habe, fangen meine Gedanken an zu
rasen. Wer ist da drin? Was wol en sie von mir? Warum ist
meine Mutter so blass?
»Gehen Sie nur hinein«, sagt der Mann vom Kapitol,
der mir durch den Flur gefolgt ist.
Ich drehe den Messingknauf herum und trete ein. Mei-
ne Nase nimmt Rosen wahr und gleichzeitig Blut. Ein
kleiner weißhaariger Mann, der mir irgendwie bekannt
vorkommt, steht mit dem Rücken zu mir und liest in ei-
nem Buch. Er hebt einen Finger, als wollte er sagen: Einen
Moment noch. Dann dreht er sich um und mein Herz
setzt einen Schlag aus.
Ich schaue in die Schlangenaugen von Präsident Snow.
33
2 Für mich gehört Präsident Snow vor Mar-
morsäulen und riesige Flaggen. Es ist verstö-
rend, ihn hier im Zimmer inmitten al täglicher Dinge zu sehen.
Als würde man den Deckel von einem Topf nehmen und da-
rin statt Suppe eine Viper mit aufgerissenem Maul vorfinden.
Was kann er hier wol en? Meine Gedanken rasen zurück
zu den Eröffnungstagen vergangener Siegertouren. Ich erin-
nere mich daran, die siegreichen Tribute zusammen mit ih-
ren Mentoren und Stylisten gesehen zu haben. Auch einige
hohe Repräsentanten der Regierung tauchten gelegentlich
auf. Doch Präsident Snow habe ich noch nie gesehen. Er ist
bei Feierlichkeiten im Kapitol anwesend. Und das war’s.
Wenn er die ganze Reise von seiner Stadt hierher ge-
macht hat, kann das nur eins bedeuten. Ich stecke in
ernsten Schwierigkeiten. Und mit mir auch meine Fami-
lie. Es schaudert mich bei dem Gedanken, wie nah meine
Mutter und meine Schwester diesem Mann sind, der mich
verabscheut. Der mich immer verabscheuen wird. Denn
ich habe ihn bei seinen sadistischen Hungerspielen aus-
getrickst, habe das Kapitol lächerlich gemacht und damit
seine Macht untergraben.
34
Dabei habe ich nichts getan, als Peeta und mir selbst
das Leben zu retten. Dass das gleichzeitig ein rebellischer
Akt war, war reiner Zufall. Doch wenn das Kapitol ver-
fügt, dass nur ein Tribut gewinnen kann, und jemand so
dreist ist, diese Regel infrage zu stellen, ist das wohl an
sich schon eine Rebellion. Ich konnte mich nur verteidi-
gen, indem ich so tat, als hätte meine leidenschaftliche
Liebe zu Peeta mir den Verstand geraubt. Deshalb durf-
ten wir beide überleben. Und zu Siegern gekürt werden.
Durften nach Hause zurückkehren und feiern und in die
Kameras winken und wurden in Ruhe gelassen. Bis jetzt.
Vielleicht ist es das neue Haus oder der Schreck, ihn
zu sehen, oder dass wir beide wissen, er könnte mich von
jetzt auf gleich töten lassen; jedenfalls komme ich mir so
vor, als wäre ich der Eindringling. Als wäre das hier sein
Zuhause und ich der ungebetene Gast. Deshalb begrüße
ich ihn auch nicht und biete ihm keinen Platz an. Ich sage
kein Wort. Im Grunde behandele ich ihn so, als wäre er
wirklich eine Schlange, eine Giftschlange. Reglos stehe ich
da, den Blick auf ihn geheftet, und schmiede Fluchtpläne.
»Ich glaube, wir können die ganze Situation sehr ver-
einfachen, wenn wir uns darauf einigen, einander nicht zu
belügen«, sagt er. »Was denkst du?«
Ich denke, dass meine Zunge festgefroren ist und dass
35
ich unmöglich sprechen kann, aber ich überrasche mich
selbst und antworte mit fester Stimme: »Ja, ich glaube, da-
mit würden wir Zeit sparen.«
Präsident Snow lächelt und zum ersten Mal fallen mir
seine Lippen auf. Ich hatte Schlangenlippen erwartet, also
gar keine. Aber seine Lippen sind außergewöhnlich voll,
die Haut spannt. Ich frage mich, ob er sich den Mund
hat operieren lassen, damit er attraktiver aussieht. Wenn ja,
war es Zeitverschwendung, denn er ist nicht die Spur at-
traktiv. »Meine Berater hatten Sorge, du könntest Schwie-
rigkeiten machen, aber du hast nicht vor, Schwierigkeiten
zu machen, oder?«, fragt er.
»Nein«, sage ich.
»Das habe ich ihnen auch gesagt. Ich habe gesagt, ein
Mädchen, das so viel auf sich nimmt, um sein Leben zu
retten, wird kein Interesse daran haben, es leichtfertig
wegzuwerfen. Und sie wird auch an ihre Familie denken.
An die Mutter, die Schwester und all die … Cousins.« An
der Art, wie er das Wort »Cousins« dehnt, merke ich, er
weiß, dass Gale und ich nicht richtig verwandt sind.
Jetzt liegen die Tatsachen also auf dem Tisch. Vielleicht
ist es besser so. Mit unbestimmten Drohungen komme ich
nicht gut zurecht. Ich will lieber wissen, woran ich bin.
»Setzen wir uns doch.« Präsident Snow setzt sich an den
36
großen Schreibtisch aus glänzendem Holz, an dem Prim
ihre Hausaufgaben macht und meine Mutter die Haus-
haltsplanung. Ebenso wie er nicht einfach in unser Haus
kommen dürfte, hat er auch kein Recht, diesen Platz ein-
zunehmen. Und doch hat er jedes Recht. Ich setze mich
vor den Tisch auf einen der geschnitzten Stühle mit hoher
Lehne. Er ist für jemand Größeren als mich gemacht, ich
berühre den Boden nur mit den Zehen.
»Ich habe ein Problem, Katniss«, sagt Präsident Snow.
»Ein Problem, das in dem Moment auftauchte, als du in
der Arena die giftigen Beeren hervorgeholt hast.«
Er meint den Moment, in dem ich mir dachte, dass die
Spielmacher, vor die Wahl gestellt, Peeta und mir beim
Selbstmord zuzusehen – womit es keinen Sieger gegeben
hätte – oder uns beide am Leben zu lassen, sich für die
zweite Möglichkeit entscheiden würden.
»Wenn Seneca Crane, der Oberste Spielmacher, ein we-
nig Grips gehabt hätte, hätte er dich auf der Stelle in die
Luft gejagt. Doch er hatte leider eine sentimentale Ader.
Deshalb bist du hier. Kannst du dir denken, wo er ist?«,
fragt er.
Ich nicke, denn so, wie er es sagt, ist klar, dass Seneca
Crane hingerichtet wurde. Jetzt, da nur der Schreibtisch
uns trennt, ist der Geruch von Rosen und Blut noch
37
stärker. Präsident Snow trägt eine Rose am Revers, die
immerhin auf die Quelle des Blumendufts hinweist, aller-
dings muss sie genmanipuliert sein, denn keine echte Rose
riecht so. Aber was das Blut angeht … keine Ahnung.
»Danach konnten wir nichts tun, als dich dein kleines
Theater zu Ende spielen zu lassen. Und du hast dich wirk-
lich recht gut gemacht als liebestolles Schulmädchen. Die
Leute im Kapitol waren ziemlich überzeugt. Leider sind in
den Distrikten nicht alle auf dein Schauspiel hereingefal-
len«, sagt er.
Für einen kurzen Moment muss sich die Verwirrung in
meinem Gesicht gespiegelt haben, denn er geht darauf ein.
»Das kannst du natürlich nicht wissen. Du hast keinen
Zugang zu Informationen über die Stimmung in ande-
ren Distrikten. Doch in einigen wurde dein kleiner Bee-
rentrick als Herausforderung gedeutet, nicht als Akt der
Liebe. Und wenn ausgerechnet ein Mädchen aus Distrikt
12 das Kapitol herausfordern kann und so einfach davon-
kommt, was sollte andere dann davon abhalten, dasselbe
zu tun?«, sagt er. »Was sollte zum Beispiel einen Aufstand
verhindern?«
Es dauert einen Augenblick, bis ich den letzten Satz
begreife.
»Es hat Aufstände gegeben?«, frage ich. Die Vorstellung
38
erschreckt mich, gleichzeitig spüre ich so etwas wie freudi-
ge Erregung.
»Noch nicht. Aber wenn es so weitergeht, wird es dazu
kommen. Und Aufstände führen, wie man weiß, zur Re-
volution.« Präsident Snow reibt eine Stelle über der linken
Augenbraue, genau dort, wo ich auch immer Kopfschmer-
zen bekomme. »Kannst du ermessen, was das bedeuten
würde? Wie viele Menschen sterben würden? Das Elend
der Überlebenden? Was für Probleme man mit dem Kapi-
tol auch haben mag – wenn es in seiner Strenge nur kurz
nachlassen würde, dann würde das gesamte System zu-
sammenbrechen, das kannst du mir glauben.«
Ich bin verblüfft, wie offen und aufrichtig das klingt.
Als hätte er vor allem das Wohlergehen der Bürger von
Panem im Auge, während ihm doch nichts ferner liegt.
Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehme, die folgenden
Worte zu sagen, aber ich tue es. »Das System muss sehr
wacklig sein, wenn eine Handvoll Beeren es zum Einsturz
bringen kann.«
Lange Zeit ist es still und er sieht mich nur an. Dann
sagt er: »Es ist wacklig, aber nicht so, wie du denkst.«
Es klopft an der Tür und der Mann vom Kapitol
streckt den Kopf herein. »Die Mutter lässt fragen, ob Sie
Tee möchten.«
39
»Oh ja. Ich hätte gern einen Tee«, sagt der Präsident.
Die Tür geht weiter auf, und da steht meine Mutter, sie
bringt ein Tablett mit einem Teeservice aus Porzellan, das
sie bei ihrer Heirat mit in den Saum genommen hat. »Stel-
len Sie es bitte hierhin.« Er legt sein Buch auf die Ecke des
Tisches und klopft auf die Tischmitte.
Meine Mutter setzt das Tablett ab. Darauf stehen
eine Teekanne und Tassen, Sahne und Zucker und ein
Teller mit Keksen. Sie sind wunderhübsch verziert mit
pastellfarbenen Zuckerblumen. Das kann nur Peetas
Werk sein.
»Was für ein willkommener Anblick! Wissen Sie, es
ist merkwürdig, wie oft vergessen wird, dass auch Präsi-
denten essen müssen«, sagt Präsident Snow liebenswürdig.
Immerhin wirkt meine Mutter nach seinen Worten nicht
mehr ganz so nervös.
»Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen? Ich kann
etwas Sättigenderes kochen, wenn Sie hungrig sind«, bietet
sie an.
»Nein, besser als dies hier könnte es gar nicht sein. Vie-
len Dank«, sagt er, eine deutliche Aufforderung, uns wie-
der allein zu lassen. Meine Mutter nickt, wirft mir einen
Blick zu und geht. Präsident Snow schenkt uns beiden Tee
ein, nimmt sich Sahne und Zucker und rührt dann lange
40
in seiner Tasse. Ich spüre, dass er gesagt hat, was er zu sa-
gen hatte, und auf meine Antwort wartet.
»Ich wollte keine Aufstände verursachen«, sage ich.
»Das glaube ich dir. Es spielt keine Rolle. Dein Stylist
hat sich hinsichtlich der Wahl deines Kostüms als Prophet
erwiesen. Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flam-
men stand – von dir ist ein Funke ausgegangen, der sich,
wenn wir uns nicht darum kümmern, zu einem Inferno
auswachsen könnte, das Panem zerstört«, sagt er.
»Warum bringen Sie mich jetzt nicht einfach um?«,
platze ich heraus.
»Öffentlich?«, fragt er. »Das hieße nur Öl ins Feuer
gießen.«
»Dann lassen Sie es wie einen Unfall aussehen«, sage
ich.
»Wer sollte das glauben?«, fragt er. »Du bestimmt nicht,
wenn du Zuschauer wärst.«
»Dann sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich werde es
tun«, sage ich.
»Wenn es nur so einfach wäre.« Er nimmt einen Blu-
menkeks und betrachtet ihn. »Wie hübsch. Hat deine
Mutter die selbst gebacken?«
»Peeta.« Und zum ersten Mal merke ich, dass ich sei-
nem Blick nicht standhalten kann. Ich nehme die Tasse,
41
stelle sie jedoch zurück, als ich merke, wie sie an die Un-
tertasse klirrt. Um es zu überspielen, nehme ich schnell
einen Keks.
»Peeta. Wie ist sie denn, die Liebe deines Lebens?«,
fragt er.
»Gut«, sage ich.
»Wann genau hat er gemerkt, wie gleichgültig er dir
wirklich ist?«, fragt er und tunkt seinen Keks in den Tee.
»Er ist mir nicht gleichgültig«, sage ich.
»Aber vielleicht bist du nicht ganz so hingerissen von
dem jungen Mann, wie du das Land glauben machen
wolltest«, erklärt er.
»Wer sagt das?«, frage ich.
»Ich«, sagt der Präsident. »Und wenn ich der Einzige
wäre, der seine Zweifel hat, wäre ich nicht hier. Wie geht
es dem feschen Cousin?«
»Ich weiß nicht … ich …« Mein Widerwillen gegen
dieses Gespräch, dagegen, dass ich mit Präsident Snow
über meine Gefühle für zwei der Menschen spreche, die
mir am meisten bedeuten, lässt meine Stimme ersterben.
»Sprich nur, Katniss. Ihn kann ich leicht umbringen,
wenn wir keine glückliche Lösung finden. Du tust ihm
keinen Gefallen damit, dass du jeden Sonntag mit ihm in
den Wald verschwindest.«
42
Wenn er das weiß, was weiß er dann noch alles? Und
woher weiß er es? Viele Leute könnten ihm erzählt haben,
dass Gale und ich sonntags zusammen auf die Jagd ge-
hen. Kreuzen wir nicht am Ende jedes Sonntags schwer
bepackt mit Wild auf? Ist das nicht schon seit Jahren so?
Die eigentliche Frage ist, was seiner Meinung nach in den
Wäldern hinter Distrikt 12 passiert. Bestimmt haben sie
uns dort nicht aufgespürt. Oder doch? Kann uns jemand
gefolgt sein? Das erscheint mir unmöglich. Jedenfalls kein
Mensch. Kameras? Bis zu diesem Augenblick ist mir das
nie in den Sinn gekommen. Der Wald war für uns immer
ein sicherer Ort – der Ort, wo uns das Kapitol nicht errei-
chen konnte, wo wir bedenkenlos sagen konnten, was wir
fühlten, so sein konnten, wie wir waren. So war es jeden-
falls vor den Spielen. Wenn sie uns seitdem beobachtet ha-
ben, was haben sie gesehen? Zwei Menschen auf der Jagd,
die ketzerische Bemerkungen über das Kapitol machen,
das schon. Aber nicht zwei Verliebte, wie Präsident Snow
anzudeuten scheint. Was das angeht, sind wir auf der si-
cheren Seite. Es sei denn … es sei denn …
Es ist nur ein Mal passiert. Es kam schnell und überra-
schend, aber es ist doch passiert.
Nachdem Peeta und ich von den Spielen zurückkamen,
vergingen mehrere Wochen, bis ich Gale wieder allein traf.
43
Erst waren da die obligatorischen Feierlichkeiten. Ein Fest-
essen für die Sieger, zu dem nur die ranghöchsten Leute
eingeladen waren. Ein Feiertag für den gesamten Distrikt
mit Gratisessen und Entertainern aus dem Kapitol. Der
Pakettag, der erste von zwölf, an dem jeder im Distrikt ein
Essenspaket bekam. Das war das Schönste für mich. Zu
sehen, wie all die hungrigen Kinder im Saum herumliefen
und Gläser mit Apfelmus schwenkten, Dosen mit Fleisch,
sogar Süßigkeiten. Zu Hause warteten noch Getreidesäcke
und Ölkannen, die waren zu schwer zu tragen. Zu wissen,
dass sie ein Jahr lang jeden Monat so ein Paket bekommen
würden. Das war einer der wenigen Momente, in denen
ich es richtig gut fand, dass ich die Spiele gewonnen hatte.
In dieser Zeit der Feierlichkeiten, als die Reporter jeden
meiner Schritte festhielten, während ich im Mittelpunkt
stand und allen dankte und Peeta für das Publikum küss-
te, da hatte ich keinen Augenblick für mich. Nach ein
paar Wochen hatte sich die Lage endlich beruhigt. Die
Kamerateams und Reporter packten ihre Sachen und
reisten wieder ab. Das Verhältnis zwischen Peeta und mir
wurde so kühl, wie es seither ist. Ich zog mit meiner Fami-
lie in unser Haus im Dorf der Sieger. Der Alltag in Dist-
rikt 12 – Arbeiter in die Bergwerke, Kinder in die Schu-
le – ging wieder seinen gewohnten Gang. Ich wartete, bis
44
ich dachte, dass die Luft jetzt wirklich rein war, und eines
Sonntags stand ich, ohne irgendjemandem ein Wort zu sa-
gen, mehrere Stunden vor Sonnenaufgang auf und zog los
in den Wald.
Es war immer noch warm genug, um ohne Jacke zu
gehen. Ich nahm eine Tasche mit besonderem Essen mit,
kaltes Hühnchen und Käse und Brot vom Bäcker und
Orangen. In unserem alten Haus zog ich mir die Jagd-
stiefel an. Wie üblich stand der Zaun nicht unter Strom,
sodass es ein Leichtes war, in den Wald zu schlüpfen und
Pfeile und Bogen zu schnappen. Ich ging zu Gales und
meinem Ort, dort, wo wir am Morgen der Ernte, bei der
ich für die Spiele ausgelost worden war, unser Frühstück
geteilt hatten.
Ich wartete mindestens zwei Stunden und dachte
schon, dass er mich in den Wochen, die vergangen waren,
aufgegeben hätte. Oder dass ich ihm nichts mehr bedeu-
tete. Dass er mich sogar hasste. Und die Vorstellung, ihn
für immer verloren zu haben, meinen besten Freund, den
Einzigen, dem ich je meine Geheimnisse anvertraut hatte,
tat so weh, dass ich es nicht ertragen konnte. Nicht nach
all dem, was passiert war. Ich spürte, wie meine Augen
sich mit Tränen füllten und meine Kehle eng wurde, wie
immer, wenn ich kurz davor bin, zu weinen.
45
In dem Moment schaute ich auf, und da stand er, drei
Meter entfernt, und sah mich nur an. Ohne darüber nach-
zudenken, sprang ich auf, schlang die Arme um ihn und
stieß einen merkwürdigen Laut aus, in dem sich Lachen,
Atemlosigkeit und Weinen mischten. Er hielt mich so fest,
dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte, aber es dauerte
wirklich lange, bis er mich losließ, und auch da nur, weil
ihm kaum etwas anderes übrig blieb, denn ich hatte einen
wahnsinnig lauten Schluckauf bekommen und musste un-
bedingt etwas trinken.
Wir machten an dem Tag dasselbe wie früher auch
immer. Zusammen frühstücken. Jagen und fischen und
sammeln. Über die Leute in der Stadt reden. Aber nicht
über uns, sein neues Leben im Bergwerk, meine Zeit in
der Arena. Nur über andere Dinge. Als wir schließlich an
der Lücke im Zaun ankamen, die dem Hob am nächs-
ten ist, glaubte ich wohl wirklich daran, dass es wieder so
sein könnte wie früher. Dass wir so weitermachen könnten
wie bisher. Ich hatte Gale das ganze Wild zum Handeln
gegeben, weil wir zu Hause jetzt so viel zu essen hatten.
Ich sagte, ich würde nicht mit zum Hob kommen, obwohl
ich sehr gern gegangen wäre, aber meine Mutter und mei-
ne Schwester wüssten nicht einmal, dass ich auf der Jagd
sei, und fragten sich bestimmt schon, wo ich steckte. Und
46
gerade als ich vorschlug, dass ich die tägliche Runde an
den Fallen entlang übernehmen könnte, nahm er mein
Gesicht in die Hände und küsste mich.
Es traf mich völlig unvorbereitet. Man hätte meinen
können, dass ich nach den vielen Stunden, die ich mit
Gale verbracht hatte – da ich ihn erzählen und lachen und
finster blicken gesehen hatte –, über seine Lippen genau
Bescheid gewusst hätte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass
sie sich so warm auf meinen anfühlen würden. Oder dass
diese Hände, die so komplizierte Fallen stellen konnten,
ebenso gut mich einfangen könnten. Ich glaube, ich stieß
einen kehligen Laut aus, und ich erinnere mich dunkel an
meine Hände, fest zusammengeballt, die auf seiner Brust
lagen. Dann ließ er mich los und sagte: »Ich musste das
tun. Wenigstens ein Mal.« Und dann war er weg.
Obwohl die Sonne schon unterging und meine Fami-
lie sich bestimmt Sorgen machte, setzte ich mich an einen
Baum neben dem Zaun. Ich überlegte, wie es mir mit dem
Kuss ging, ob er mir gefallen hatte oder ob ich mich da-
rüber ärgerte, aber ich erinnerte mich nur an das Gefühl
von Gales Lippen auf meinen und den Duft von Orangen,
der immer noch an seiner Haut haftete. Es hatte keinen
Sinn, diesen Kuss mit den vielen Küssen zu vergleichen,
die ich mit Peeta getauscht hatte. Ich war mir immer noch
47
nicht darüber im Klaren, ob auch nur einer davon zählte.
Schließlich ging ich nach Hause.
In dieser Woche kümmerte ich mich um die Fallen
und brachte das Fleisch zu Hazelle. Doch Gale sah ich erst
am folgenden Sonntag wieder. Ich hatte eine komplette
Rede im Kopf, dass ich keinen Freund wollte und niemals
heiraten würde, aber ich brauchte sie gar nicht. Gale tat
so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Vielleicht wartete er
darauf, dass ich etwas sagte. Oder dass ich ihn auch küss-
te. Stattdessen tat ich ebenfalls so, als hätte es den Kuss
nie gegeben. Aber es hatte ihn gegeben. Gale hatte eine
unsichtbare Schranke zwischen uns zerstört und mit ihr
meine Hoffnung, wir könnten zu unserer alten, unkom-
plizierten Freundschaft zurückkehren. Wenn ich auch so
tat, als ob, ich konnte seine Lippen nie mehr so ansehen
wie früher.
All das geht mir blitzschnell durch den Kopf, während
Präsident Snow mich mit seinem Blick durchbohrt, nach-
dem er gedroht hat, Gale zu töten. Wie dumm von mir,
zu denken, das Kapitol würde mich nicht mehr beachten,
wenn ich erst einmal zu Hause wäre! Ich hatte zwar kei-
ne Ahnung von möglichen Aufständen. Aber ich wusste,
dass sie im Kapitol wütend auf mich waren. Anstatt die
gebührende Vorsicht walten zu lassen, was tat ich da? Aus
48
der Sicht des Präsidenten habe ich Peeta ignoriert und vor
dem ganzen Distrikt demonstriert, dass ich Gale vorzie-
he. Und damit kundgetan, dass ich das Kapitol wirklich
verspottet habe. Mit meinem unbedachten Verhalten habe
ich Gale und seine Familie, meine Familie und auch Peeta
in Gefahr gebracht.
»Bitte tun Sie Gale nichts«, flüstere ich. »Er ist nur ein
Freund. Wir sind schon seit Jahren befreundet. Mehr ist
nicht zwischen uns. Außerdem halten uns jetzt sowieso
alle für Cousin und Cousine.«
»Mich interessiert nur, wie das dein Verhältnis zu Peeta
beeinflusst und damit die Stimmung in den Distrikten«,
sagt er.
»Bei der Tour der Sieger wird es so sein wie immer. Ich
werde genauso in ihn verliebt sein wie vorher«, sage ich.
»Wie jetzt«, verbessert Präsident Snow mich. »Wie jetzt«,
bestätige ich.
»Aber wenn die Aufstände abgewendet werden sollen,
wirst du noch überzeugender sein müssen«, sagt er. »Diese
Tour ist deine letzte Chance, das Blatt zu wenden.«
»Ich weiß. Und es wird mir gelingen. Ich werde alle in
den Distrikten davon überzeugen, dass ich nicht das Kapi-
tol herausfordern wollte, sondern verrückt vor Liebe war«,
sage ich.
49
Präsident Snow erhebt sich und tupft die Wulstlippen
mit einer Serviette ab. »Du musst dir ein höheres Ziel ste-
cken, für den Fall, dass du es nicht erreichst.«
»Wie meinen Sie das? Was für ein höheres Ziel soll ich
mir stecken?«, frage ich.
»Überzeuge mich«, sagt er. Er lässt die Serviette sinken
und nimmt wieder sein Buch. Ich schaue ihn nicht an,
als er zur Tür geht, deshalb zucke ich zusammen, als er
mir ins Ohr flüstert: »Übrigens, ich weiß von dem Kuss.«
Dann fällt die Tür hinter ihm ins Schloss.
50
3 Der Geruch von Blut … er lag in seinem
Atem. Was macht er bloß? , denke ich. Trinkt
er es? Ich stel e mir vor, wie er Blut aus einer Teetasse trinkt. Wie
er einen Keks hineintunkt und ihn rot triefend herauszieht.
Draußen vorm Fenster kommt ein Auto in Gang, sanft
und leise wie das Schnurren einer Katze, dann verschwin-
det es in der Ferne. Es stiehlt sich davon, wie es gekom-
men ist, unbemerkt.
Das Zimmer scheint sich in langsamen, schiefen Krei-
sen zu drehen, ich frage mich, ob ich womöglich ohn-
mächtig werde. Ich beuge mich vor und stütze mich mit
einer Hand am Schreibtisch ab. In der anderen halte ich
noch immer Peetas wunderhübschen Keks. Ich glaube, es
war eine orangefarbene Lilie darauf, doch jetzt sind nur
noch Krümel in meiner Faust. Ich habe gar nicht gemerkt,
dass ich ihn zerdrückt habe, aber ich musste mich wohl
an irgendetwas festhalten, während meine Welt aus den
Fugen geriet.
Ein Besuch von Präsident Snow. Distrikte kurz vor dem
Aufstand. Eine direkte Morddrohung gegen Gale, auf
die weitere folgen werden. Alle, die ich liebe, todgeweiht.
51
Und wer weiß, wer noch für meine Taten bezahlen muss?
Wenn ich bei der Tour der Sieger das Blatt nicht wende.
Die Unzufriedenen besänftige und den Präsidenten beru-
hige. Und wie? Indem ich überall im Land jeden Zweifel
daran ausräume, dass ich Peeta Mellark liebe.
Das schaffe ich nicht, denke ich. So gut bin ich nicht.
Peeta ist der Gute, der Liebenswürdige. Er kann die Leute
von allem überzeugen. Ich schweige lieber, halte mich zu-
rück, überlasse das Reden so weit wie möglich ihm. Aber
nicht Peeta soll seine Zuneigung unter Beweis stellen, son-
dern ich.
Ich höre den leichten, schnellen Schritt meiner Mutter
im Flur. Sie darf das nicht erfahren, denke ich. Nichts von
al dem. Ich halte die Hände über das Tablett und wische
mir schnell die Kekskrümel von den Fingern. Zittrig trin-
ke ich einen Schluck Tee.
»Ist alles in Ordnung, Katniss?«, fragt sie.
»Alles gut. Wir haben es im Fernsehen nie gesehen,
aber der Präsident besucht die Sieger immer vor der Tour,
um ihnen Glück zu wünschen«, sage ich fröhlich.
Ich sehe ihr an, wie erleichtert sie ist. »Ach so. Ich dach-
te schon, es gäbe irgendwelche Schwierigkeiten.«
»Nein, gar nicht«, sage ich. »Aber ich kriege Schwie-
rigkeiten, wenn das Vorbereitungsteam sieht, wie meine
52
Augenbrauen schon wieder zugewachsen sind.« Meine
Mutter lacht, und ich denke daran, dass ich damals, als
ich mit elf Jahren die Sorge für die Familie übernahm,
eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen habe. Und
dass ich meine Mutter immer werde beschützen müssen.
»Soll ich dir schon mal dein Bad einlassen?«, fragt sie.
»Ja, gern«, sage ich, und ich sehe, wie froh sie über die
Antwort ist.
Seit ich wieder zu Hause bin, gebe ich mir große Mühe,
das Verhältnis zu meiner Mutter zu verbessern. Anstatt
jedes Hilfsangebot abzulehnen, wie ich es jahrelang aus
Wut getan habe, bitte ich sie jetzt ab und zu um einen
Gefallen. Ich lasse sie das ganze Geld verwalten, das ich
gewonnen habe. Erwidere ihre Umarmungen, anstatt sie
bloß über mich ergehen zu lassen. In der Arena ist mir
klar geworden, dass ich sie nicht länger für etwas bestrafen
darf, woran sie nicht schuld ist, vor allem nicht für die
schrecklichen Depressionen, in die sie nach dem Tod mei-
nes Vaters versunken ist. Manchmal sind die Menschen
einfach machtlos gegen das, was mit ihnen geschieht.
Wie ich zum Beispiel, in diesem Moment.
Außerdem hat sie bei meiner Rückkehr in den Dis-
trikt etwas ganz Wunderbares getan. Nachdem unsere
Freunde und Verwandten Peeta und mich am Bahnhof
53
begrüßt hatten, durften uns die Reporter ein paar Fragen
stellen. Einer fragte meine Mutter, was sie von meinem
neuen Freund halte, und sie antwortete, Peeta sei zwar
ein Traum von einem jungen Mann, aber ich sei noch
nicht alt genug, um überhaupt einen Freund zu haben.
Daraufhin warf sie Peeta einen durchdringenden Blick
zu. Von der Presse gab es viel Gelächter und Bemerkun-
gen wie: »Da hat aber einer ein Problem«, und Peeta ließ
meine Hand los und trat einen Schritt zur Seite. Das
dauerte nicht lange – der Druck, sich anders zu verhalten,
war zu groß –, doch wir hatten jetzt einen Vorwand, ein
wenig zurückhaltender zu sein als im Kapitol. Und viel-
leicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich von Peeta,
seit die Kameras verschwunden sind, nicht mehr allzu
viel gesehen habe.
Ich gehe hinauf ins Badezimmer, wo mich eine Wan-
ne mit dampfendem Wasser erwartet. Meine Mutter hat
einen kleinen Beutel getrocknete Blumen hinzugegeben,
die ihren Duft verströmen. Keiner von uns ist den Luxus
gewohnt, einen Wasserhahn aufzudrehen und eine unbe-
grenzte Menge warmes Wasser zur Verfügung zu haben.
In unserem Haus im Saum gab es nur kaltes Wasser, und
wenn man baden wollte, musste man das Wasser über
dem Feuer erwärmen. Ich ziehe mich aus, lasse mich in
54
das seidenweiche Wasser gleiten – meine Mutter hat auch
irgendein Öl hineingetan – und versuche, alles zu ordnen.
Die erste Frage ist, wem ich davon erzählen soll, wenn
überhaupt jemandem. Natürlich nicht meiner Mutter und
Prim, sie wären krank vor Sorge. Gale auch nicht. Selbst
wenn ich mit ihm sprechen könnte. Was sollte er damit
anfangen? Wenn er allein wäre, könnte ich versuchen, ihn
zur Flucht zu überreden. Ganz sicher würde er im Wald
überleben. Aber er ist nicht allein und er würde seine Fa-
milie niemals im Stich lassen. Und mich auch nicht. Wenn
ich wieder zu Hause bin, muss ich ihm irgendwie erklären,
weshalb unsere Sonntage der Vergangenheit angehören
müssen, aber darüber kann ich jetzt nicht nachdenken.
Nur über den nächsten Schritt. Außerdem ist Gale schon
so wütend auf das Kapitol, dass ich manchmal glaube, er
organisiert seinen eigenen Aufstand. Da brauche ich ihn
jetzt wirklich nicht noch zusätzlich anzustacheln. Nein,
von denen, die ich in Distrikt 12 zurücklasse, kann ich es
keinem erzählen.
Es gibt aber noch drei Menschen, denen ich mich an-
vertrauen könnte. Zunächst einmal Cinna, meinem Stylis-
ten. Aber ich fürchte, dass Cinna jetzt schon in Gefahr ist,
und ich möchte ihn nicht noch mehr in Schwierigkeiten
bringen, indem ich ihn auf meine Seite ziehe. Dann Peeta,
55
der bei diesem Theater mein Partner sein wird – aber wie
sollte ich ein solches Gespräch anfangen? Du, Peeta, weißt
du noch, als ich dir erzählt hab, ich hatte nur so getan, als ob
ich in dich verliebt wäre? Tja, also, das musst du unbedingt
vergessen und dich jetzt ganz besonders verliebt aufführen,
sonst bringt der Präsident womöglich Gale um. Ausgeschlos-
sen. Abgesehen davon wird Peeta seine Sache sowieso gut
machen, ob er nun weiß, was auf dem Spiel steht, oder
nicht. Bleibt noch Haymitch. Der unleidliche, streitsüchti-
ge Trunkenbold Haymitch, dem ich vor nicht allzu langer
Zeit eine Schüssel eiskaltes Wasser über den Kopf gekippt
habe. Als mein Mentor bei den Spielen war es seine Aufga-
be, für mein Überleben zu sorgen. Hoffentlich betrachtet
er das immer noch als seinen Job.
Ich lasse mich ganz ins Wasser gleiten, blende die Ge-
räusche um mich herum aus. Jetzt müsste die Badewanne
sich ausdehnen, dann könnte ich schwimmen, wie an hei-
ßen Sommertagen mit meinem Vater im Wald. Das waren
ganz besondere Tage. Wir verließen dann schon frühmor-
gens das Haus und wanderten tiefer in den Wald hinein als
sonst, bis zu einem kleinen See, den er bei der Jagd einmal
entdeckt hatte. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich schwim-
men gelernt habe, so klein war ich, als er es mir beibrachte.
Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich immer getaucht
56
bin, im Wasser Purzelbäume schlug und herumplanschte.
An den schlammigen Grund des Sees unter meinen Zehen.
Den Duft von Blüten und Laub. Wie ich mich auf dem
Rücken treiben ließ, so wie jetzt, und in den blauen Him-
mel schaute, während das Waldgezwitscher vom Wasser
ausgeblendet wurde. Er erlegte Wasservögel, die am Ufer
nisteten, ich suchte im Gras nach Eiern, und wir beide
gruben im seichten Wasser nach Katniss-Knollen, dem
Pfeilkraut, nach dem er mich benannt hat. Abends, wenn
wir nach Hause kamen, tat meine Mutter so, als würde sie
mich nicht wiedererkennen, weil ich so sauber war. Dann
bereitete sie ein großartiges Essen aus gebratener Ente und
gebackenen Knollen mit Soße.
Mit Gale bin ich nie zu dem See gegangen. Ich hätte es
tun können. Es ist ein langer Weg dorthin, aber die Wasser-
vögel sind so leichte Beute, dass man die verlorene Jagdzeit
wieder wettmacht. Doch ich wol te den Ort mit nieman-
dem teilen, den Ort, der nur meinem Vater und mir gehörte.
Nach den Spielen, als ich wenig zu tun hatte, war ich ein
paarmal da. Es war immer noch schön, dort zu schwimmen,
aber die Ausflüge haben mich eher deprimiert. Der See hat
sich in den letzten sechs Jahren erstaunlich wenig verändert,
während ich kaum wiederzuerkennen bin.
Selbst unter Wasser höre ich den Tumult. Autohupen,
57
laute Begrüßungen, Türenknallen. Das kann nur bedeu-
ten, dass meine Begleiter eingetroffen sind. Ich habe gera-
de noch Zeit, mich abzutrocknen und einen Bademantel
überzuziehen, bevor mein Vorbereitungsteam ins Bade-
zimmer platzt. Eine Intimsphäre gibt es nicht. Was mei-
nen Körper angeht, haben wir keine Geheimnisse vorein-
ander, die drei und ich.
»Katniss, deine Augenbrauen!«, kreischt Venia sofort,
und trotz des Unheils, das über mir schwebt, muss ich ein
Lachen unterdrücken. Ihre blauen Haare stehen in spitzen
Zacken vom Kopf ab, und ihre goldenen Tattoos, bisher
nur über den Augenbrauen, schlängeln sich jetzt bis un-
ter die Augen. All das verstärkt den Eindruck, dass ich sie
wirklich erschreckt habe.
Octavia kommt und klopft Venia beruhigend auf den
Rücken, ihr kurvenreicher Körper wirkt neben Venias
dünnem, eckigem besonders füllig. »Na, na. Die kriegst
du doch im Nu wieder hin. Aber was soll ich bloß mit die-
sen Nägeln anstellen?« Sie packt meine Finger und drückt
sie zwischen ihren erbsgrünen Händen ganz platt. Nein,
ihre Haut ist im Moment nicht richtig erbsgrün. Eher von
einem hellen Immergrün. Bestimmt ist das im Kapitol ge-
rade die neueste Mode. »Katniss, du hättest mir wirklich
ein wenig Material übrig lassen können!«, jammert sie.
58
Sie hat recht. In den letzten Monaten habe ich meine
Nägel völlig heruntergekaut. Ich hatte überlegt, es mir ab-
zugewöhnen, aber mir fiel kein vernünftiger Grund ein.
»Tut mir leid«, murmele ich. Darüber, was das für mein
Vorbereitungsteam bedeuten würde, habe ich nicht groß
nachgedacht.
Flavius hebt ein paar Strähnen meiner nassen, wirren
Haare hoch. Er schüttelt missbilligend den Kopf, sodass
seine orangefarbenen Korkenzieherlocken wippen. »Hat
irgendjemand diese Haare berührt, seit wir uns das letz-
te Mal gesehen haben?«, fragt er streng. »Du weißt doch,
wir haben dich vor allem gebeten, deine Haare in Ruhe zu
lassen.«
»Ja!«, sage ich, dankbar, ihnen zeigen zu können, dass
ich nicht völlig achtlos war. »Ich meine, nein, keiner hat
sie geschnitten. Daran hab ich gedacht.« Nein, habe ich
nicht. Die Frage hatte sich gar nicht gestellt. Seit ich zu-
rück war, habe ich sie einfach, wie eh und je, zu einem
Zopf geflochten.
Das scheint sie zu besänftigen, und sie küssen mich
alle, setzen mich in meinem Schlafzimmer auf einen
Stuhl, und dann plappern sie, wie üblich, unaufhörlich,
ohne sich darum zu scheren, ob ich zuhöre. Während Ve-
nia meine Augenbrauen wieder in Form bringt, Octavia
59
mir künstliche Fingernägel verpasst und Flavius irgendein
Zeug in meine Haare massiert, erfahre ich alles über das
Kapitol. Wie toll die Spiele waren, wie öde es seitdem ist,
dass sie es alle gar nicht erwarten können, bis Peeta und
ich am Ende der Tour der Sieger wieder vorbeikommen.
Danach wird es nicht mehr lange dauern, bis sich das Ka-
pitol auf das Jubel-Jubiläum vorbereitet.
»Ist das nicht spannend?«
»Hast du nicht ein unverschämtes Glück?«
»In deinem allerersten Jahr als Siegerin darfst du schon
Mentorin bei einem Jubel-Jubiläum sein!«
In der allgemeinen Aufregung überschneiden sich ihre
Worte.
»Doch, ja«, sage ich ausdruckslos. Mehr bringe ich
nicht zustande. Schon in einem gewöhnlichen Jahr ist es
ein Albtraum, Mentor der Tribute zu sein. Ich kann nicht
mehr an der Schule vorbeigehen, ohne mich zu fragen,
wen ich wohl betreuen muss. Aber zu allem Übel ist dies
das Jahr der fünfundsiebzigsten Hungerspiele und damit
ein Jubel-Jubiläum. Alle fünfundzwanzig Jahre ist es so
weit, dann wird die Niederlage der Distrikte ganz beson-
ders großartig gefeiert, und als besonderer Spaß wartet
noch eine spezielle Grausamkeit auf die Tribute. Natürlich
habe ich das noch nie miterlebt. Doch in der Schule habe
60
ich mal gehört, dass das Kapitol zum zweiten Jubel-Jubi-
läum die doppelte Anzahl Tribute in die Arena geschickt
hat. Die Lehrer haben das Thema nicht weiter vertieft, was
erstaunlich ist, schließlich machte in dem Jahr Haymitch
Abernathy aus unserem Distrikt 12 das Rennen.
»Haymitch kann sich schon mal darauf gefasst machen,
dass er so richtig im Mittelpunkt stehen wird«, kreischt
Octavia.
Haymitch hat mir gegenüber noch nie von seiner eige-
nen Zeit in der Arena gesprochen. Ich würde ihn auch nie
danach fragen. Und falls ich seine Spiele je als Wiederho-
lung gesehen habe, war ich wohl noch zu klein, um mich
daran zu erinnern. Aber dieses Jahr wird das Kapitol ihn
am Vergessen hindern. Im Grunde ist es ganz gut, dass
Peeta und ich bei dem Jubiläum als Mentoren zur Verfü-
gung stehen, denn Haymitch wird garantiert sturzbetrun-
ken sein.
Nachdem sie sich hinreichend über das Jubel-Jubiläum
ausgelassen haben, tauschen sie sich endlos lange über ihr
unsäglich belangloses Leben aus. Wer was über wen auch
immer gesagt hat, was für Schuhe sie gerade gekauft ha-
ben und dann noch eine lange Geschichte von Octavia
darüber, was für ein Fehler es gewesen sei, dass die Gäste
auf ihrer Geburtstagsfeier Federschmuck tragen sollten.
61
Schon bald brennt die Haut unter meinen Augenbrau-
en, meine Haare sind glatt und seidig und meine Nägel
bereit für den Lack. Anscheinend ist das Team angewie-
sen, nur meine Hände und mein Gesicht zu behandeln, al-
les andere wird bei dem kalten Wetter wohl bedeckt sein.
Flavius würde zu gern sein eigenes Markenzeichen, lila
Lippenstift, bei mir anwenden, gibt sich dann aber doch
mit Rosa zufrieden. An der Farbpalette, die Cinna festge-
legt hat, sehe ich, dass wir auf mädchenhaft machen, nicht
auf sexy. Gut so. Wenn ich versuchen müsste, aufreizend
auszusehen, würde ich nie jemanden von irgendetwas
überzeugen. Das hat Haymitch sehr deutlich gemacht, als
er mich nach den Spielen für das Interview vorbereitet hat.
Meine Mutter kommt herein, ein wenig schüchtern,
und sagt, Cinna habe sie gebeten, dem Vorbereitungsteam
zu zeigen, wie sie mir am Tag der Ernte das Haar frisiert
hat. Sie sind begeistert und schauen fasziniert zu, wie mei-
ne Mutter die komplizierte Frisur genau erklärt. Im Spie-
gel sehe ich, wie sie mit ernstem Gesicht jede ihrer Bewe-
gungen verfolgen und wie eifrig sie bei der Sache sind, als
sie es selbst probieren dürfen. Alle drei behandeln meine
Mutter respektvoll und freundlich, und jetzt schäme ich
mich dafür, dass ich mich ihnen immer so überlegen füh-
le. Wer weiß, wie ich wäre oder worüber ich reden würde,
62
wenn ich im Kapitol aufgewachsen wäre? Vielleicht hätte
ich dann auch nichts Schlimmeres zu bereuen, als dass die
Gäste zu meiner Geburtstagsfeier in Federkostümen ge-
kommen sind.
Als meine Frisur fertig ist, gehe ich hinunter ins
Wohnzimmer, wo ich Cinna treffe. Sein bloßer Anblick
stimmt mich ein wenig hoffnungsfroher. Er sieht aus wie
immer, einfache Kleider, kurze braune Haare, nur ein
Hauch goldener Eyeliner. Wir umarmen uns und um ein
Haar wäre ich mit der Geschichte über Präsident Snow
herausgeplatzt. Aber nein, ich habe beschlossen, es zuerst
Haymitch zu erzählen. Er wird am besten wissen, wen
ich damit belasten kann. Aber es ist so leicht, mit Cinna
zu reden. In letzter Zeit haben wir oft telefoniert, denn
mit dem Haus haben wir gleichzeitig auch ein Telefon
bekommen. Es ist eigentlich ein Witz, weil praktisch nie-
mand, den wir kennen, eins besitzt. Peeta ja, aber ihn
rufe ich natürlich nicht an. Haymitch hat seins schon vor
Jahren aus der Wand gerissen. Meine Freundin Madge,
die Tochter des Bürgermeisters, hat zu Hause ein Tele-
fon, aber wenn wir uns unterhalten wollen, tun wir das
persönlich. Am Anfang wurde das Ding fast gar nicht
benutzt. Dann rief Cinna regelmäßig an, um an meinem
Talent zu arbeiten.
63
Von jedem Sieger wird erwartet, dass er ein Talent hat.
Ein Hobby, das man pflegt, da man ja weder zur Schule
gehen noch arbeiten muss. Es kann eigentlich alles sein,
alles, wovon sich in einem Interview erzählen lässt. Peeta
hat tatsächlich ein Talent, er kann malen. Jahrelang hat
er die Torten und Kekse in der Bäckerei seiner Familie
verziert. Aber jetzt, da er reich ist, kann er es sich leisten,
richtige Farbe auf Leinwand zu pinseln. Ich habe kein
Talent, mal abgesehen von illegalem Jagen, aber das gilt
nicht. Oder vielleicht Singen, was ich nicht in einer Mil-
lion Jahren für das Kapitol tun würde. Meine Mutter hat
versucht, mich für die unterschiedlichsten Hobbys von ei-
ner Liste, die Effie Trinket ihr geschickt hat, zu begeistern.
Kochen, Blumenbinden, Flötenspiel. Nichts davon hat ge-
klappt, während Prim für alle drei Talent hatte. Schließ-
lich hat Cinna sich eingeschaltet und angeboten, meine
Leidenschaft für Modedesign zu entwickeln, die wirklich
erst entwickelt werden musste, da sie bis dahin gar nicht
existierte. Aber ich habe zugestimmt, weil ich auf diese
Weise mit Cinna reden konnte, und er versprach, die gan-
ze Arbeit zu machen.
Jetzt drapiert er mein Wohnzimmer mit Kleidern, Stof-
fen und Skizzenbüchern voller Zeichnungen, die er ange-
fertigt hat. Ich nehme eins der Skizzenbücher und schaue
64
ein Kleid an, das ich angeblich entworfen habe. »Also, ich
finde mich wirklich vielversprechend«, sage ich.
»Zieh dich an, du nichtsnutziges Ding«, sagt er und
wirft mir ein Bündel Kleider zu.
Ich interessiere mich zwar nicht für Design, aber ich
liebe die Kleidung, die Cinna für mich entwirft. So wie
diese hier. Eine locker fallende schwarze Hose aus dickem,
warmem Stoff.
Ein bequemes weißes T-Shirt. Ein Pulli aus grüner,
blauer und grauer lämmchenweicher Wolle. Lederne
Schnürstiefel, die meine Zehen nicht einquetschen.
»Hab ich meine Kleider selbst entworfen?«
»Nein, es ist dein Ziel, deine eigenen Kleider zu ent-
werfen und wie ich zu sein, dein großes Mode-Idol«, sagt
Cinna. Er reicht mir einen kleinen Stapel Karten. »Das
liest du aus dem Off, während die Kleider gefilmt werden.
Lass es so klingen, als ob es dich wirklich interessiert.«
In diesem Moment kommt Effie Trinket mit kürbis-
farbener Perücke auf dem Kopf herein und mahnt alle:
»Vergesst mir nicht den Zeitplan!« Sie küsst mich auf beide
Wangen und winkt das Kamerateam herein, dann sagt sie
mir, was ich zu tun habe. Effie allein ist es zu verdanken,
dass wir im Kapitol immer pünktlich waren, also tue ich
ihr den Gefallen. Ich hüpfe herum wie eine Marionette,
65
halte Kleider hoch und sage sinnlose Sätze wie »Ist das
nicht super?«. Während ich begeistert von meinen Kar-
ten ablese, nehmen die Tontechniker mich auf, um meine
Kommentare später einfügen zu können. Dann werde ich
hinausgeworfen, damit die Kameraleute in Ruhe meine
beziehungsweise Cinnas Entwürfe filmen können.
Prim ist für das Ereignis extra früher von der Schule
nach Hause gekommen. Jetzt steht sie in der Küche und
wird von einem anderen Team interviewt. Sie sieht wun-
derschön aus in einem himmelblauen Kleid, das ihre Au-
gen zur Geltung bringt; die blonden Haare sind mit einem
Band in der gleichen Farbe zurückgebunden. Sie beugt
sich auf den Spitzen ihrer glänzenden weißen Stiefel ein
wenig vor, als wollte sie abheben wie …
Wumm! Es ist ein Gefühl, als hätte mir jemand gegen
die Brust geschlagen. Natürlich nicht wirklich, aber der
Schmerz ist so real, dass ich einen Schritt zurückweiche.
Ich mache die Augen ganz fest zu und sehe nicht Prim –
ich sehe Rue, das zwölfjährige Mädchen aus Distrikt 11,
meine Verbündete in der Arena. Sie konnte fliegen wie ein
Vogel, von Baum zu Baum, sie fand auf den zartesten Äs-
ten Halt. Rue, die ich nicht gerettet habe. Die ich sterben
ließ. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Boden liegt, den
Speer im Bauch …
66
Wen noch werde ich nicht vor der Rache des Kapitols
retten können? Wer wird noch sterben, wenn ich Präsident
Snow nicht zufriedenstelle?
Ich merke, dass Cinna versucht, mir einen Mantel an-
zuziehen, also hebe ich die Arme. Ich spüre, wie Pelz mich
umhüllt. Er stammt von einem Tier, das ich noch nie
gesehen habe. »Hermelin«, sagt Cinna, als ich über den
weißen Ärmel streiche. Lederhandschuhe. Ein knallroter
Schal. Etwas Pelziges bedeckt meine Ohren. »Du bringst
Ohrenschützer wieder in Mode.«
Ich hasse Ohrenschützer, denke ich. Mit den Dingern
kann man schlecht hören, und seit ich in der Arena bei
einer Explosion auf einem Ohr taub geworden war, ver-
abscheue ich sie noch mehr. Nach meinem Sieg hat das
Kapitol mein Ohr wiederhergestellt, aber ich merke, dass
ich es immer noch oft überprüfe.
Meine Mutter kommt herbeigelaufen, sie verbirgt et-
was in den Händen. »Als Glücksbringer«, sagt sie.
Es ist die Brosche, die Madge mir gegeben hat, bevor
ich in die Spiele gezogen bin. Ein fliegender Spotttölpel in
einem goldenen Ring. Ich wollte die Brosche Rue schen-
ken, doch sie hat sie nicht angenommen. Sie sagte, wegen
der Brosche habe sie beschlossen, mir zu vertrauen. Cinna
steckt sie am Knoten des Schals fest.
67
Effie Trinket kommt herbei und klatscht in die Hände.
»Alle mal herhören! Wir machen gleich die erste Außen-
aufnahme – die Sieger begrüßen einander zu Beginn der
wunderbaren Tour. Los, Katniss, strahlendes Lächeln bit-
te, du freust dich wahnsinnig, klar?« Es ist nicht übertrie-
ben zu sagen, dass sie mich zur Tür hinausschiebt.
Im ersten Moment kann ich nichts sehen, denn jetzt
hat es richtig angefangen zu schneien. Dann erkenne ich
Peeta, der aus der Haustür kommt. Ich habe die Anwei-
sung von Präsident Snow im Kopf: »Überzeuge mich.«
Und ich weiß, dass ich es tun muss.
Ich setze mein strahlendstes Lächeln auf und gehe auf
Peeta zu. Dann renne ich los, als könnte ich keine Sekunde
länger warten. Er fängt mich auf und wirbelt mich herum,
rutscht plötzlich aus – er hat sein künstliches Bein noch nicht
ganz in der Gewalt –, und wir fal en in den Schnee, ich auf
ihn drauf, und dann küssen wir uns, zum ersten Mal seit
Monaten. Es ist ein Kuss vol er Pelz und Schnee und Lip-
penstift, doch darunter spüre ich die Ruhe, die Peeta immer
ausstrahlt. Und ich weiß, dass ich nicht al ein bin. Sosehr ich
ihn auch verletzt habe, er wird mich vor den Kameras nicht
bloßstel en. Wird mich nicht mit einem halbherzigen Kuss
bestrafen. Er passt immer noch auf mich auf. Genau wie in
der Arena. Bei dem Gedanken würde ich am liebsten weinen.
68
Doch ich helfe ihm auf, hake mich mit meiner behandschuh-
ten Hand bei ihm unter und ziehe ihn vergnügt mit.
Der Rest des Tages ist ein verschwommenes Durchei-
nander aus dem Weg zum Bahnhof, dem Abschied von
allen, dem abfahrenden Zug, dem Abendessen mit dem
alten Team – Peeta und ich, Effie und Haymitch, Cinna
und Portia, Peetas Stylistin –, ein himmlisches Abendes-
sen, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dann
bin ich in einen Schlafanzug und einen riesigen Bademan-
tel gehüllt, sitze in meinem vornehmen Abteil und warte
darauf, dass die anderen schlafen gehen. Ich weiß, dass
Haymitch noch stundenlang wach sein wird. Er schläft
nicht gern, wenn es draußen dunkel ist.
Als im Zug alles ruhig scheint, ziehe ich meine Pan-
toffeln an und tapse zu seiner Tür. Ich muss mehrmals
anklopfen, ehe er kommt, fluchend, als wäre er überzeugt,
dass ich schlechte Neuigkeiten bringe.
»Was willst du?«, fragt er, und der Weindunst, den er
verströmt, haut mich fast um.
»Ich muss mit dir reden«, flüstere ich.
»Jetzt?«, fragt er. Ich nicke. »Hoffentlich hast du einen
guten Grund.« Er wartet, aber ich habe das Gefühl, dass
jedes Wort, das wir in einem Zug des Kapitols sagen, auf-
gezeichnet wird. »Und?«, sagt er schroff.
69
Der Zug bremst ab, und ganz kurz denke ich, Präsi-
dent Snow hat mich beobachtet und es nicht gutgeheißen,
dass ich mich Haymitch anvertraue, und deshalb hat er
beschlossen, mich auf der Stelle zu töten. Doch wir halten
nur an, weil der Zug Treibstoff braucht.
»Hier im Zug ist es so stickig«, sage ich.
Es ist ein harmloser Satz, aber ich sehe, wie Haymitch
die Augen schmal macht, er hat verstanden. »Dagegen
weiß ich was.« Er schiebt sich an mir vorbei und torkelt
durch den Gang zu einer Tür. Als er sie mühsam geöffnet
hat, schlägt uns eine Schneewolke entgegen. Er stolpert
hinaus und landet auf dem Boden.
Eine Dienerin vom Kapitol eilt herbei, um zu helfen,
doch Haymitch gibt ihr gutmütig zu verstehen, dass sie
wieder gehen kann, und taumelt weiter. »Brauch bloß ein
bisschen frische Luft. Nur einen kleinen Moment.«
»Entschuldigung. Er ist betrunken«, sage ich. »Ich hole
ihn rein.« Ich springe hinunter und stolpere hinter ihm an
den Gleisen entlang. Meine Pantoffeln werden im Schnee
klatschnass, während er mich ans Ende des Zuges führt,
damit uns niemand hören kann. Dann wendet er sich zu
mir.
»Was ist los?«
Ich erzähle ihm alles. Von dem Besuch des Präsidenten,
70
von Gale und dass wir alle sterben müssen, wenn ich
versage.
Sein Gesicht wird nüchterner, scheint im Licht der ro-
ten Schlusslichter zu altern. »Dann darfst du eben nicht
versagen.«
»Wenn du mir bloß helfen kannst, diese Tour zu über-
stehen …«, setze ich an.
»Nein, Katniss, es geht nicht nur um die Tour«, sagt er.
»Wie meinst du das?«, frage ich.
»Selbst wenn du es schaffst, kommen sie doch in ein
paar Monaten wieder und holen uns alle zu den Spielen ab.
Du und Peeta, ihr werdet Mentoren sein, jedes Jahr von
nun an. Und jedes Jahr werden sie auf die Liebesgeschich-
te zurückkommen und alle Einzelheiten deines Privatle-
bens breittreten, und du kannst nichts anderes tun, als bis
ans Ende deiner Tage mit diesem Jungen zu leben.«
Seine Worte treffen mich mit voller Wucht. Selbst
wenn ich es möchte, wird es für mich nie ein Leben mit
Gale geben. Ich werde nie allein leben dürfen. Ich muss
für immer in Peeta verliebt sein. Das Kapitol wird darauf
bestehen. Ein paar Jahre darf ich vielleicht noch mit mei-
ner Mutter und Prim zusammenwohnen, weil ich ja erst
siebzehn bin. Und dann … und dann …
»Verstehst du, was ich sagen will?«, drängt er.
71
Ich nicke. Er will sagen, dass es nur eine mögliche Zu-
kunft gibt, wenn ich dafür sorgen möchte, dass meine
Lieben und ich selbst am Leben bleiben. Ich werde Peeta
heiraten müssen.
72
4 Schweigend trotten wir zurück zum Zug.
Im Gang vor meinem Abteil klopft Hay-
mitch mir auf die Schulter und sagt: »Du könntest es viel
schlechter treffen.« Dann geht er weiter zu seinem Abteil,
die Weinfahne weht hinter ihm her.
In meinem Abteil ziehe ich die durchweichten Pantof-
feln, den nassen Bademantel und den Schlafanzug aus. In
den Schubladen sind noch mehr Schlafanzüge, doch ich
krieche einfach in Unterwäsche unter die Bettdecke. Ich
starre in die Dunkelheit und denke über das Gespräch
mit Haymitch nach. Alles, was er gesagt hat, stimmt: die
Erwartungen des Kapitols, meine Zukunft mit Peeta, so-
gar seine letzte Bemerkung. Natürlich könnte ich es viel
schlechter treffen als mit Peeta. Aber darum geht es ja ei-
gentlich nicht. Eine der wenigen Freiheiten, die wir in Di-
strikt 12 haben, ist das Recht, zu heiraten, wen wir wollen,
oder auch gar nicht zu heiraten. Und jetzt haben sie mir
selbst das noch genommen. Ich frage mich, ob Präsident
Snow wohl darauf bestehen wird, dass wir Kinder bekom-
men. Wenn wir welche bekommen, werden sie sich jedes
Jahr der Ernte stellen müssen. Und wäre das nicht ein
73
Spektakel, wenn das Kind nicht nur eines Siegers, sondern
gleich zweier Sieger für die Arena auserwählt würde? Es ist
schon öfter vorgekommen, dass Kinder von Siegern in den
Ring mussten. Dann gibt es jedes Mal große Aufregung,
und die Leute sagen, dass diese Familie wirklich kein
Glück hat. Aber es kommt so oft vor, dass es nicht nur mit
Glück zu tun haben kann. Gale ist davon überzeugt, dass
es Absicht ist; dass das Kapitol die Auslosung manipuliert,
um die Dramatik zu steigern. Wenn man bedenkt, für
wie viel Ärger ich gesorgt habe, dann dürfte jedem meiner
Kinder ein Auftritt in den Spielen garantiert sein.
Ich denke an Haymitch, der unverheiratet ist, keine
Familie hat und die Welt mit Alkohol ausblendet. Er hät-
te jede Frau im Distrikt haben können. Und wählte die
Abgeschiedenheit. Nicht Abgeschiedenheit – das klingt
zu friedlich. Eher so etwas wie Einzelhaft. Wusste er nach
seiner Erfahrung in der Arena, dass das besser war, als die
Alternative zu riskieren? Ich habe einen Vorgeschmack auf
diese Alternative bekommen, als am Tag der Ernte Prims
Name aufgerufen wurde und ich sah, wie sie zur Bühne
ging, geradewegs in den Tod. Doch als Schwester konnte
ich mich an ihrer Stelle melden, was unserer Mutter nicht
erlaubt war.
Panisch versuche ich einen Ausweg zu ersinnen. Ich
74
kann es nicht zulassen, dass Präsident Snow mich zu die-
sem Los verdammt. Und wenn ich mir das Leben neh-
men müsste. Aber vorher würde ich versuchen zu fliehen.
Was würden sie tun, wenn ich einfach abtauchen würde?
In den Wald verschwinden und nie mehr herauskommen
würde? Wäre es vielleicht sogar denkbar, alle meine Lie-
ben mitzunehmen und mitten in der Wildnis ein neues
Leben anzufangen? Höchst unwahrscheinlich, aber nicht
ausgeschlossen.
Ich schüttele den Kopf, um die Gedanken zu ordnen.
Jetzt ist nicht der richtige Moment, um wilde Fluchtpläne
zu schmieden. Ich muss mich auf die Tour der Sieger kon-
zentrieren. Das Schicksal zu vieler Menschen hängt davon
ab, dass ich eine überzeugende Vorstellung liefere.
Das Morgengrauen kommt vor dem Schlaf und dann
klopft auch schon Effie an meine Tür. Ich ziehe die erst-
besten Sachen an, die auf der Kommode liegen, und
schleppe mich in den Speisewagen. Ich verstehe nicht,
weshalb ich früh aufstehen soll, da es ohnehin ein Reisetag
ist, aber dann erfahre ich, dass die Verschönerung gestern
nur für den Weg zum Bahnhof war. Heute macht sich das
Vorbereitungsteam noch mal richtig an die Arbeit.
»Wozu? Bei der Kälte sieht man doch sowieso nichts«,
murre ich.
75
»In Distrikt 11 ist es aber nicht kalt«, sagt Effie.
Distrikt 11. Unsere erste Station. Ich würde lieber in
einem anderen Distrikt anfangen, denn in 11 war Rue
zu Hause. Aber so läuft das nicht bei der Tour der Sieger.
Normalerweise geht es in Distrikt 12 los, dann werden
der Reihe nach alle Distrikte durchlaufen, bis die Reise
schließlich ins Kapitol führt. Der Distrikt des Siegers wird
ausgespart und kommt ganz zum Schluss dran. Sonst ver-
anstaltet Distrikt 12 immer die am wenigsten spektaku-
läre Feier – für gewöhnlich nur ein Essen für die Tribu-
te und eine Siegesfeier auf dem Platz, bei der niemand so
aussieht, als würde er sich amüsieren. In diesem Jahr wird
Distrikt 12 zum ersten Mal seit Haymitchs Sieg die End-
station der Tour sein und das Kapitol spendiert die Fei-
er, da ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir hier so
schnell wie möglich verschwinden, damit alles vorbereitet
werden kann.
Ich versuche das Essen zu genießen, wie Hazelle es mir
geraten hat. Die Leute in der Küche wollen mir offenbar
eine Freude machen. Sie haben mein Leibgericht gekocht,
Lammeintopf mit Backpflaumen, und andere Köstlichkei-
ten. Auf dem Tisch warten an meinem Platz Orangensaft
und ein Becher dampfend heißer Kakao. Ich esse eine
Menge, und das Mahl ist tadellos, aber ich kann nicht
76
sagen, dass ich es genieße. Außerdem ärgert es mich, dass
sich außer Effie und mir niemand blicken lässt. »Wo sind
die anderen alle?«, frage ich.
»Ach, wer weiß, wo Haymitch ist«, sagt Effie. Mit Hay-
mitch hatte ich sowieso nicht gerechnet, der geht wahr-
scheinlich gerade schlafen. »Cinna war gestern lange auf,
er musste einen Waggon für deine Kleider organisieren.
Er hat bestimmt über hundert für dich. Deine Abendgar-
derobe ist exquisit. Und Peetas Team schläft vermutlich
noch.«
»Muss er nicht vorbereitet werden?«, frage ich.
»Nicht so wie du«, sagt Effie.
Was soll das heißen? Es heißt, dass ich den Vormittag
damit verbringen werde, mir die Haare vom Körper rei-
ßen zu lassen, während Peeta ausschlafen kann. Ich hatte
nicht groß darüber nachgedacht, aber in der Arena haben
wenigstens einige der Jungs ihre Körperbehaarung behal-
ten, von den Mädchen dagegen kein einziges. Jetzt erin-
nere ich mich an Peetas Behaarung, als ich ihn am Bach
gewaschen habe. Sehr blond im Sonnenlicht, nachdem ich
den Schlamm und das Blut erst einmal abgespült hatte.
Nur sein Gesicht blieb vollkommen glatt. Nicht einer von
den Jungs bekam einen Bart, obwohl viele alt genug waren.
Ich frage mich, was sie wohl mit ihnen angestellt haben.
77
Wenn ich mich schon groggy fühle, so scheint mein
Vorbereitungsteam in noch schlimmerer Verfassung zu
sein. Sie stürzen den Kaffee hinunter und tauschen kleine
bunte Pillen. Soweit ich weiß, stehen sie nie vor dem Mit-
tag auf, es sei denn, es gibt eine Art nationalen Notstand,
wie zum Beispiel meine behaarten Beine. Ich war so froh,
als die Haare wieder wuchsen. Als wären sie ein Zeichen
dafür, dass alles wieder wie immer werden könnte. Ich
streiche mit den Fingern über den weichen, gekräuselten
Flaum auf meinen Beinen und überlasse mich dem Team.
Keiner von ihnen ist zu dem üblichen Geplapper aufge-
legt, deshalb höre ich, wie jedes einzelne Härchen heraus-
gerissen wird. Ich muss mich in einer Wanne mit einer
dicken, unangenehm riechenden Lotion baden, während
mein Gesicht und meine Haare mit Cremes eingekleistert
werden. Dann zwei weitere Bäder mit anderen, nicht so
ekelhaften Zusätzen. Ich werde gerupft und geschrubbt
und massiert und gesalbt, bis ich mir vorkomme wie ein
Hühnchen.
Flavius fasst mir mit einer Hand unters Kinn und
seufzt. »Es ist ein Jammer, dass Cinna gesagt hat, bei dir
darf nichts verändert werden.«
»Ja, wir könnten wirklich etwas Besonderes aus dir ma-
chen«, sagt Octavia.
78
»Wenn sie älter ist«, sagt Venia fast grimmig. »Dann
muss er es erlauben.«
Was? Dass sie meine Lippen aufspritzen wie die von
Präsident Snow? Mir die Brüste tätowieren? Meine Haut
magenta färben und mir Edelsteine einsetzen? Mir Verzie-
rungen ins Gesicht ritzen? Mir gebogene Krallen verpas-
sen? Oder Schnurrhaare? All das und noch viel mehr habe
ich bei verschiedenen Leuten im Kapitol gesehen. Wissen
sie wirklich nicht, wie abgedreht das auf andere wirkt?
Die Vorstellung, den Geschmacksverirrungen meines
Vorbereitungsteams ausgeliefert zu sein, ist nur eine wei-
tere Sorge von vielen, die mich beschäftigen – mein ge-
schundener Körper, Schlafmangel, die drohende Zwang-
sehe und der Horror, dass ich die Forderungen von
Präsident Snow nicht werde erfüllen können. Als ich zum
Mittagessen komme, wo Effie, Cinna, Portia, Haymitch
und Peeta schon ohne mich angefangen haben, bin ich zu
niedergeschlagen, um zu reden. Sie schwärmen vom Essen
und davon, wie wunderbar sie im Zug schlafen können.
Alle sind ganz aus dem Häuschen über die Tour der Sieger.
Na ja, alle bis auf Haymitch. Er hat einen Kater und knab-
bert an einem Muffin. Ich habe auch keinen großen Hun-
ger, entweder weil ich heute Morgen zu viel schweres Zeug
in mich hineingestopft habe oder weil ich so unglücklich
79
bin. Ich rühre in meiner Brühe herum und esse nur ein,
zwei Löffel davon. Ich kann Peeta – meinen zukünftigen
Mann – nicht einmal ansehen, obwohl ich weiß, dass er
keine Schuld an alldem trägt.
Die anderen merken, dass etwas nicht stimmt, und
versuchen mich ins Gespräch einzubeziehen, aber ich bin
abweisend. Irgendwann hält der Zug. Unser Kellner be-
richtet uns, dass es diesmal nicht nur wegen Treibstoff ist
– irgendein Zugteil ist defekt und muss ausgetauscht wer-
den. Es wird mindestens eine Stunde dauern. Das bringt
Effie in Rage. Sie holt ihren Plan heraus und berechnet,
wie diese Verzögerung jedes Ereignis bis zum Ende un-
seres Lebens beeinflussen wird. Schließlich ertrage ich es
nicht mehr, mir das anzuhören.
»Das interessiert doch keinen, Effie!«, sage ich schroff.
Alle am Tisch starren mich an, sogar Haymitch, der doch
auf meiner Seite sein müsste, weil Effie ihm auf die Nerven
geht. Sofort fühle ich mich in die Enge getrieben. »Absolut
keinen!«, sage ich, stehe auf und verlasse den Speisewagen.
Auf einmal kommt es mir stickig vor im Zug und mir
ist regelrecht mulmig. Ich suche den Ausgang, mache die
Tür gewaltsam auf – wobei ich irgendeinen Alarm auslöse,
den ich ignoriere – und springe hinaus in der Erwartung,
im Schnee zu landen. Doch die Luft fühlt sich warm und
80
mild auf der Haut an. Die Bäume haben noch grüne Blät-
ter. Wie weit südlich sind wir an einem Tag gereist? Ich
laufe an den Schienen entlang, blinzele ins grelle Sonnen-
licht und bereue schon, was ich zu Effie gesagt habe. Sie
kann ich kaum dafür verantwortlich machen, dass ich
in der Zwickmühle stecke. Eigentlich müsste ich zurück-
gehen und mich entschuldigen. Mein Ausbruch war der
Gipfel an schlechtem Benehmen und gutes Benehmen
ist für Effie sehr wichtig. Doch meine Füße gehen weiter
am Gleis entlang, am Ende des Zuges vorbei und immer
noch weiter. Eine Stunde Verspätung. Ich kann mindes-
tens zwanzig Minuten in eine Richtung gehen und wieder
zurück, dann habe ich trotzdem noch reichlich Zeit. Aber
nach ein paar Hundert Metern lasse ich mich auf dem
Boden nieder, bleibe dort sitzen und schaue in die Ferne.
Wenn ich Pfeil und Bogen hätte, würde ich dann einfach
weitergehen?
Nach einer Weile höre ich hinter mir Schritte. Bestimmt
Haymitch, der mich zusammenstauchen wil . Nicht, dass
ich es nicht verdient hätte, aber ich wil es trotzdem nicht
hören. »Ich bin nicht in der Stimmung für eine Lektion«,
sage ich warnend zu dem Gras vor meinen Füßen.
»Ich versuche es kurz zu machen.« Peeta setzt sich ne-
ben mich.
81
»Ich dachte, du wärst Haymitch«, sage ich.
»Nein, der kämpft immer noch mit seinem Muffin.«
Ich sehe, wie Peeta seine Prothese in die richtige Position
bringt. »Schlechter Tag, was?«
»Es ist nichts«, sage ich.
Er holt tief Luft. »Hör mal, Katniss, ich wollte schon
länger mit dir darüber reden, wie ich mich im Zug be-
nommen hab. Ich meine, im letzten Zug – der, mit dem
wir nach Hause gefahren sind. Ich wusste, dass zwischen
Gale und dir etwas war. Ich war schon eifersüchtig auf ihn,
bevor ich dich überhaupt offiziell kennenlernte. Und es
war unfair, dich auf das festzunageln, was in den Spielen
passiert ist. Das tut mir leid.«
Seine Entschuldigung überrumpelt mich. Es stimmt,
dass er mir die kalte Schulter gezeigt hat, nachdem ich
ihm gestand, dass ich ihm in der Arena etwas vorgespielt
hatte. Aber das werfe ich ihm nicht vor. In der Arena habe
ich auf Teufel komm raus den Liebesengel gespielt. Es gab
Momente, in denen ich mir nicht sicher war, was ich für
ihn empfand. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher.
»Mir tut es auch leid«, sage ich. Ich weiß nicht so recht,
was mir eigentlich leidtut. Vielleicht, dass ich ihn jetzt
möglicherweise wirklich zerstören werde.
»Dir braucht überhaupt nichts leidzutun. Du hast nur
82
versucht, uns beiden das Leben zu retten. Aber ich will
nicht, dass wir so weitermachen – dass wir uns im rich-
tigen Leben ignorieren und uns dann zusammen in den
Schnee fallen lassen, sobald eine Kamera in der Nähe ist.
Ich hab mir gedacht, wenn ich nicht mehr so, hm, verletzt
bin, dann könnten wir doch versuchen, einfach Freunde
zu werden«, sagt er.
Wie es aussieht, sind alle meine Freunde zum Sterben
verdammt, aber wenn ich Peeta zurückweise, rettet ihn
das auch nicht. »Gut«, sage ich. Nach seinem Angebot
geht es mir schon besser. Ich komme mir nicht mehr so
verlogen vor. Es wäre schön gewesen, wenn er damit frü-
her herausgerückt wäre – bevor ich erfuhr, dass Präsident
Snow anderes im Sinn hat, und die Möglichkeit, einfach
Freunde zu sein, zunichtegemacht wurde. Doch zumin-
dest freue ich mich, dass wir wieder miteinander reden.
»Also, was ist los?«, fragt er.
Ich kann es ihm nicht sagen. Ich zupfe am Unkraut.
»Dann fangen wir mit was Einfacherem an. Ist es nicht
komisch, dass ich weiß, du würdest dein Leben für mich
aufs Spiel setzen … aber deine Lieblingsfarbe nicht ken-
ne?«, sagt er.
Ein Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. »Grün. Und
deine?«
83
»Orange«, sagt er.
»Orange? Wie Effies Haare?«, frage ich.
»Ein bisschen gedeckter«, erwidert er. »Eher so wie …
der Sonnenuntergang.«
Der Sonnenuntergang. Sofort habe ich ein Bild vor Au-
gen, den Rand der untergehenden Sonne, den Himmel,
der in warmen Orangetönen gestreift ist. Wunderschön.
Ich erinnere mich an den Lilienkeks, und jetzt, da Pee-
ta wieder mit mir redet, fällt es mir schwer, nicht mit der
ganzen Geschichte von Präsident Snow herauszuplatzen.
Aber ich weiß, dass Haymitch das nicht gut fände. Ich hal-
te mich lieber an unverfängliche Themen.
»Übrigens schwärmen ja alle von deinen Bildern. Scha-
de, dass ich sie nicht gesehen habe«, sage ich.
»Ich hab einen ganzen Waggon voll.« Er steht auf und
reicht mir eine Hand. »Komm.«
Das fühlt sich gut an, seine Finger wieder mit meinen
verschränkt, nicht für die anderen, sondern aus Freund-
schaft. Hand in Hand gehen wir zurück zum Zug. An
der Tür fällt es mir ein: »Ich muss erst zu Effie und mich
entschuldigen.«
»Keine falsche Zurückhaltung«, sagt Peeta.
Als wir wieder im Speisewagen sind, wo die anderen im-
mer noch essen, entschuldige ich mich so überschwänglich
84
bei Effie, dass ich denke, es ist zu viel des Guten, doch
für sie reicht es wahrscheinlich gerade eben, um meinen
Fauxpas wieder wettzumachen. Immerhin nimmt sie die
Entschuldigung gutmütig an. Sie sagt, sie verstehe schon,
dass ich unter großem Druck stehe. Und dann redet sie
nur ganze fünf Minuten davon, dass sich ja einer um
den Zeitplan kümmern müsse. Ich bin also glimpflich
davongekommen.
Als Effie fertig ist, gehe ich mit Peeta ein paar Wagen
weiter und er zeigt mir seine Bilder. Ich weiß nicht, was
ich erwartet hatte. Größere Versionen der Blumenkekse
vielleicht. Aber das hier ist etwas vollkommen anderes.
Peeta hat die Spiele gemalt.
Manche Bilder wären für jemanden, der nicht mit
ihm in der Arena war, nicht sofort zu deuten. Wasser, das
durch die Spalten in unserer Höhle tröpfelt. Der ausge-
trocknete Tümpel. Zwei Hände, seine eigenen, die nach
Wurzeln graben. Andere Bilder würde jeder Betrachter
gleich erkennen. Das goldene Füllhorn. Clove, wie sie
Messer in ihrer Jacke verstaut. Eine der Mutationen, un-
verkennbar die blonde mit den grünen Augen, die Glim-
mer darstellt; knurrend kommt sie auf uns zu. Und da bin
ich. Ich bin überall. Wie ich hoch oben auf einem Baum
sitze. Wie ich ein Hemd an die Felsen im Bach schlage.
85
Wie ich bewusstlos in einer Blutlache liege. Ein Bild kann
ich nicht einordnen – vielleicht habe ich so ausgesehen, als
er hohes Fieber hatte –, da tauche ich aus einem silber-
grauen Nebel auf. »Wie findest du sie?«, fragt er.
»Grauenhaft«, sage ich. Ich kann beinahe das Blut rie-
chen, den Dreck, den künstlichen Atem der Mutation.
»Ich versuche die ganze Zeit, die Arena zu vergessen, und
du erweckst sie wieder zum Leben. Wie kommt es, dass
du dich so genau an alles erinnerst?«
»Ich sehe es jede Nacht«, sagt er.
Ich weiß, was er meint. Albträume – die mir schon vor
den Spielen nicht fremd waren – plagen mich jetzt immer,
wenn ich schlafe. Dagegen ist das altbekannte Bild, das
von meinem Vater, wie er in der Mine in Fetzen gerissen
wird, selten geworden. Stattdessen erlebe ich verschiedene
Variationen der Ereignisse in der Arena. Mein aussichtslo-
ser Versuch, Rue zu retten. Peeta, wie er verblutet. Glim-
mers aufgedunsener Körper, der sich unter meinen Hän-
den auflöst. Cato, dem die Mutationen ein entsetzliches
Ende bereiten. Das sind meine häufigsten Besucher. »Ich
auch. Hilft das? Wenn du sie malst?«
»Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab dadurch etwas we-
niger Angst, abends schlafen zu gehen, jedenfalls sage ich
mir das. Aber sie sind nicht verschwunden.«
86
»Vielleicht verschwinden sie nie. So wie bei Haymitch«,
sage ich. Haymitch spricht nicht darüber, aber ganz be-
stimmt ist das der Grund dafür, dass er nicht im Dunkeln
schlafen will.
»Kann sein. Aber für mich ist es besser, mit einem Pin-
sel in der Hand aufzuwachen als mit einem Messer«, sagt
er. »Findest du sie echt grauenhaft?«
»Ja. Aber sie sind außergewöhnlich. Wirklich«, sage ich.
Und das stimmt auch. Trotzdem, ich will sie nicht mehr
ansehen. »Möchtest du mal mein Talent sehen? Cinna hat
das super hingekriegt.«
Peeta lacht. »Später.« Der Zug setzt sich langsam in
Bewegung, und durchs Fenster sehe ich, wie das Land an
uns vorbeizieht. »Komm, wir sind fast in Distrikt 11. Das
schauen wir uns mal an.«
Wir gehen durch bis zum letzten Waggon. Dort gibt
es Sessel und Sofas, auf denen man sitzen kann, aber das
Beste ist, dass sich die Heckscheiben so hochschieben las-
sen, dass man im Freien fährt, an der frischen Luft, und
man kann weit in die Landschaft blicken. Endlose Felder,
auf denen Rinderherden weiden. So ganz anders als un-
sere dicht bewaldete Heimat. Der Zug verlangsamt die
Fahrt, und ich denke schon, dass wir gleich wieder halten,
als sich vor uns ein Zaun erhebt. Er ist mindestens zehn
87
Meter hoch und oben mit gemeinem Stacheldraht verse-
hen – dagegen wirkt unser Zaun in Distrikt 12 geradezu
läppisch. Schnell nehme ich den unteren Teil des Zauns
in Augenschein, der aus gewaltigen Metallplatten besteht.
Dort könnte man nicht drunter durchschlüpfen, sich nicht
davonstehlen, um zu jagen. Dann sehe ich die Wachtür-
me, sie sind in gleichmäßigem Abstand aufgestellt und mit
bewaffneten Wachen versehen. In dem Feld mit Wildblu-
men wirken sie fehl am Platz.
»Es ist ganz anders hier«, sagt Peeta.
Rue hatte mir bereits den Eindruck vermittelt, dass in
Distrikt 11 die Regeln härter durchgesetzt werden. Aber
so etwas hätte ich mir nie vorgestellt.
Jetzt fangen die Felder an, sie reichen, so weit das Auge
blicken kann. Männer, Frauen und Kinder mit Strohhü-
ten gegen die Sonne richten sich auf, drehen sich zu uns,
recken einen Moment lang den Rücken und schauen dem
vorbeifahrenden Zug nach. In der Ferne sehe ich Obst-
plantagen, und ich frage mich, ob Rue dort wohl gearbei-
tet hat, ob sie dort die Früchte von den zartesten Ästen
ganz oben im Baum gepflückt hat. Kleine Ansiedlungen
von Hütten hier und dort – im Vergleich zu ihnen sind die
Häuser im Saum nobel –, doch sie sind alle verlassen. Für
die Ernte werden wohl alle Hände gebraucht.
88
Es nimmt gar kein Ende. Ich kann kaum fassen, wie
groß Distrikt 11 ist. »Was glaubst du, wie viele Leute hier
leben?«, fragt Peeta. Ich schüttele den Kopf. In der Schule
haben wir nur gelernt, dass es ein großer Distrikt ist, mehr
nicht. Keine konkreten Bevölkerungszahlen. Aber die jun-
gen Leute, die wir jedes Jahr in den Übertragungen sehen,
wie sie auf die Auslosung der Tribute warten, können nur
ein kleiner Teil derer sein, die hier leben. Wie machen sie
das? Treffen sie eine Vorauswahl? Losen sie die Teilnehmer
im Vorhinein aus und sorgen dafür, dass sie unter den Zu-
schauern sind? Wie kam es dazu, dass Rue auf der Bühne
landete, niemand bei ihr, der ihren Platz hätte einnehmen
können, nur der Wind?
Die Weite ermüdet mich allmählich, die Endlosigkeit
der Landschaft. Als Effie kommt und sagt, wir sollen uns
umziehen, protestiere ich nicht. Ich begebe mich in mein
Abteil und lasse mich vom Vorbereitungsteam frisieren
und schminken. Cinna kommt mit einem hübschen Kleid
herein, orange mit einem Herbstblattmuster. Die Farbe
wird Peeta gefallen.
Effie ruft Peeta und mich zu sich und erklärt uns noch
ein letztes Mal den Tagesablauf. In manchen Distrikten
fahren die Sieger durch die Stadt, während die Bewohner
ihnen zujubeln. Doch in Distrikt 11 ist unser Auftritt auf
89
den Hauptplatz beschränkt – vielleicht, weil es keine nen-
nenswerte Stadt gibt, nur einzelne Siedlungen, oder viel-
leicht, weil sie während der Erntezeit nicht so viele Leute
erübrigen wollen. Der Auftritt findet vor dem Justizgebäu-
de statt, einem riesigen Marmorbau. Er muss einmal sehr
prächtig gewesen sein, aber die Spuren der Zeit sind un-
übersehbar. Selbst im Fernsehen kann man erkennen, dass
die bröckelnde Fassade von Efeu überwuchert und das
Dach eingesunken ist. Der Platz selbst ist von herunter-
gekommenen Läden gesäumt, die meisten Geschäfte sind
aufgegeben. Wo auch immer die Gutsituierten in Distrikt
11 leben, hier jedenfalls nicht.
Unsere Vorstellung wird auf dem Ding stattfinden, das
Effie als Veranda bezeichnet, einer gefliesten Fläche zwi-
schen dem Eingang und der Treppe, beschattet von einem
Säulendach. Erst sollen Peeta und ich vorgestellt werden,
dann wird der Bürgermeister von Distrikt 11 uns zu Ehren
eine Rede verlesen, und wir antworten mit einem Dank,
der vom Kapitol schon vorgefertigt wurde. Hatte ein Sie-
ger Verbündete unter den toten Tributen, wird es als guter
Stil betrachtet, ein paar persönliche Worte hinzuzufügen.
Ich müsste eigentlich etwas über Rue sagen und auch über
Thresh, doch jedes Mal, wenn ich zu Hause versucht habe,
etwas zu schreiben, starrte mich ein leeres Blatt Papier an.
90
Es fällt mir schwer, über sie zu sprechen, ohne die Fassung
zu verlieren. Zum Glück hat Peeta einen kurzen Text vor-
bereitet, der mit ein paar kleinen Änderungen für uns bei-
de gelten kann. Am Ende der Feierlichkeiten bekommen
wir irgendeine Tafel überreicht, und dann können wir uns
ins Justizgebäude begeben, wo ein Festessen gegeben wird.
Während der Zug in den Bahnhof von Distrikt 11 ein-
fährt, ändert Cinna ein paar letzte Feinheiten an meinem
Outfit. Er tauscht das orangefarbene Haarband gegen ei-
nes in Goldmetallic und steckt mir die Spotttölpelbrosche,
die ich in der Arena getragen habe, ans Kleid. Auf dem
Bahnsteig steht kein Empfangskomitee, nur eine Gruppe
von acht Friedenswächtern, die uns in den hinteren Teil
eines gepanzerten Wagens führen. Effie rümpft die Nase,
als die Tür hinter uns zuknallt. »Also wirklich, als ob wir
alle Verbrecher wären«, sagt sie.
Nicht wir al e, Effie, denke ich. Nur ich.
Auf der Rückseite des Justizgebäudes werden wir aus
dem Wagen gelassen, und dann sollen wir schnell hinein-
gehen. Ich rieche, dass ein köstliches Mahl bereitet wird,
aber das kann die Gerüche von Muff und Fäulnis nicht
ausblenden. Sie haben uns keine Zeit gelassen, uns um-
zuschauen. Während wir auf dem kürzesten Weg zum
Eingang gehen, höre ich, wie draußen auf dem Platz die
91
Nationalhymne angestimmt wird. Jemand klemmt mir
ein Mikrofon an. Peeta nimmt meine linke Hand. Der
Bürgermeister stellt uns vor, während die gewaltige Tür
ächzend aufgeht.
»Strahlendes Lächeln!«, sagt Effie und stößt uns an.
Wir bewegen die Füße vorwärts.
Jetzt. Jetzt muss ich al e überzeugen, wie verliebt ich in
Peeta bin, denke ich. Die feierliche Zeremonie ist ziemlich
straff geplant, und ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll.
Es ist nicht die passende Situation für einen Kuss, doch
vielleicht kann ich einen unterbringen.
Es gibt lauten Applaus, aber keine Jubelrufe, Jauchzer
und Pfiffe wie im Kapitol. Wir gehen über die schattige
Veranda, bis das Dach zu Ende ist und wir auf einer brei-
ten Marmortreppe in der grellen Sonne stehen. Als meine
Augen sich an das Licht gewöhnt haben, sehe ich, dass die
Häuser mit Flaggen geschmückt sind, die ihren herunter-
gekommenen Zustand ein wenig kaschieren. Es ist rappel-
voll auf dem Platz, aber das ist nur ein Bruchteil der Men-
schen, die hier leben.
Wie üblich ist unterhalb der Bühne für die Familien der
toten Tribute ein eigenes Podium errichtet worden. Auf
Threshs Seite stehen nur eine alte, bucklige Frau und ein
großes, muskulöses Mädchen, bestimmt seine Schwester.
92
Auf Rues Seite … Ich bin auf Rues Familie nicht vorberei-
tet. Ihre Eltern, die Trauer noch frisch in den Gesichtern.
Die fünf jüngeren Geschwister, die ihr so ähnlich sehen.
Der zarte Knochenbau, die leuchtend braunen Augen.
Wie ein Schwarm kleiner dunkler Vögel.
Der Applaus verebbt und der Bürgermeister hält die
Rede auf uns. Zwei kleine Mädchen kommen mit giganti-
schen Blumensträußen. Peeta sagt seine vorgefertigten Wor-
te, und ich merke, wie ich die Lippen bewege, um das Ende
zu sprechen. Zum Glück haben meine Mutter und Prim sie
mir so eingetrichtert, dass ich sie im Schlaf singen könnte.
Peeta hat seine persönlichen Kommentare auf eine Kar-
te geschrieben, aber er holt sie nicht hervor. Stattdessen er-
zählt er in seiner einfachen, gewinnenden Art, wie Thresh
und Rue unter die letzten acht gekommen sind, wie sie mir
das Leben gerettet haben – und damit auch ihm – und
dass wir das nie wiedergutmachen können. Dann zögert
er, bevor er etwas hinzufügt, das nicht auf der Karte steht.
Vielleicht, weil er dachte, dass Effie ihm nicht erlauben
würde, es zu sagen. »Auch wenn es in keiner Weise Ihren
Verlust ersetzen kann, möchten wir zum Zeichen unseres
Danks den Familien der Tribute aus Distrikt 11 zeit unse-
res Lebens jedes Jahr einen Monatsanteil unseres Preises
zukommen lassen.«
93
Unwillkürlich halten die Zuschauer die Luft an und
sprechen leise miteinander. Was Peeta getan hat, ist ohne
Beispiel. Ich weiß nicht einmal, ob es legal ist. Das weiß er
vermutlich auch nicht, deshalb hat er lieber gar nicht erst
gefragt. Die beiden Familien starren uns nur sprachlos an.
Ihr Leben hat sich für immer verändert, als sie Thresh und
Rue verloren haben, doch dieses Geschenk wird es erneut
verändern. Von dem Monatspreis eines Tributs kann eine
Familie mühelos ein Jahr lang leben. Solange wir leben,
werden sie keinen Hunger leiden.
Ich schaue zu Peeta und er lächelt mich traurig an. Ich
habe Haymitchs Stimme im Ohr: »Du könntest es viel
schlechter treffen.« In diesem Augenblick ist es unmöglich,
sich vorzustellen, wie ich es besser treffen könnte. Das
Geschenk … es ist großartig. Als ich mich auf die Ze-
henspitzen stelle und ihn küsse, wirkt das kein bisschen
gezwungen.
Der Bürgermeister kommt zu uns und überreicht jedem
von uns eine Tafel, so groß, dass ich meinen Blumenstrauß
ablegen muss, um sie zu halten. Die Zeremonie ist schon
fast vorüber, als ich merke, wie eine von Rues Schwestern
mich anstarrt. Sie muss etwa neun sein und ist fast Rues
Ebenbild, sie steht sogar genauso da, die Arme leicht abge-
spreizt. Trotz der guten Neuigkeiten über den Preis wirkt
94
sie nicht froh. Im Gegenteil, sie schaut mich vorwurfsvoll
an. Ist es, weil ich Rue nicht gerettet habe?
Nein. Es ist, weil ich ihr immer noch nicht gedankt habe,
denke ich.
Eine Welle der Scham überspült mich. Das Mädchen
hat recht. Wie kann ich stumm und tatenlos dastehen und
Peeta alles sagen lassen? Wäre Rue die Siegerin gewesen,
hätte sie meinen Tod niemals sang- und klanglos hinge-
nommen. Ich denke daran, wie ich sie in der Arena mit
Blumen bedeckt habe, wie wichtig es mir war, dass ihr
Tod nicht unbemerkt blieb. Doch diese Geste bedeutet gar
nichts, wenn ich sie jetzt nicht untermauere.
»Warten Sie!« Ich stolpere nach vorn, drücke die Tafel
an die Brust. Ich habe meine Redezeit verstreichen lassen,
doch jetzt muss ich etwas sagen. Das bin ich Rue einfach
schuldig. Selbst wenn ich meinen Preis ganz den Familien
überlassen hätte, wäre das keine Entschuldigung für mein
Schweigen am heutigen Tag. »Bitte warten Sie.« Ich weiß
nicht, wo ich anfangen soll, aber als ich erst einmal rede,
strömen mir die Worte aus dem Mund, als hätte ich sie
schon lange im Kopf gehabt.
»Ich möchte den Tributen von Distrikt 11 danken«,
sage ich. Ich schaue zu den beiden Frauen auf Threshs Sei-
te. »Ich habe nur ein einziges Mal mit Thresh gesprochen.
95
Für ihn hat das ausgereicht, um mich zu verschonen. Ich
kannte ihn nicht, aber ich hatte immer Hochachtung vor
ihm. Vor seiner Stärke. Weil er die Spiele nach seinen ei-
genen Regeln gespielt hat und sich nichts hat aufzwingen
lassen. Die Karrieros wollten ihn von Anfang an auf ihre
Seite ziehen, aber er wollte nicht. Dafür hatte er meine
Hochachtung.«
Zum ersten Mal hebt die bucklige Frau – ist sie Threshs
Großmutter? – den Kopf und ein leises Lächeln umspielt
ihre Lippen.
Im Publikum ist es jetzt still geworden, so still, dass ich
mich frage, wie das überhaupt möglich ist. Sie müssen alle
den Atem anhalten.
Ich wende mich zu Rues Familie. »Bei Rue jedoch habe
ich das Gefühl, sie zu kennen, und sie wird immer bei mir
sein. Alles Schöne erinnert mich an sie. Ich sehe sie in den
gelben Blumen, die auf der Weide an meinem Haus wach-
sen. Ich sehe sie in den Spotttölpeln, die auf den Bäumen
singen. Doch vor allem sehe ich sie in meiner Schwester,
Prim.« Meine Stimme ist wacklig, aber ich habe es fast ge-
schafft. »Ich danke euch für eure Kinder.« Ich hebe das
Kinn, als ich mich an das Publikum wende. »Und ich
danke euch allen für das Brot.«
Ich stehe da, fühle mich gebrochen und klein, zahllose
96
Blicke sind auf mich gerichtet. Sehr lange bleibt es still.
Dann pfeift jemand aus der Menge Rues Spotttölpelme-
lodie. Die vier Töne, mit denen in den Obstplantagen das
Ende des Arbeitstages eingeläutet wurde. In der Arena
bedeuteten sie Sicherheit. Als die Melodie verklingt, sehe
ich, woher der Pfiff kam: von einem hutzligen alten Mann
in einem verblichenen roten Hemd und Latzhose. Unsere
Blicke treffen sich.
Was dann passiert, ist kein Zufall. Es vollzieht sich
so vollkommen synchron, dass es unmöglich ein spon-
taner Akt sein kann. Jeder Einzelne im Publikum legt
die drei mittleren Finger der linken Hand auf die Lippen
und streckt sie dann zu mir aus. Das ist unser Zeichen
aus Distrikt 12, mein letzter Abschiedsgruß an Rue in
der Arena.
Hätte es das Gespräch mit Präsident Snow nicht gege-
ben, würde diese Geste mich womöglich zu Tränen rüh-
ren. Doch da ich seinen Befehl, die Distrikte zu beruhigen,
noch in den Ohren habe, erfüllt sie mich mit Furcht. Was
wird er von diesem öffentlichen Gruß an das Mädchen
halten, das dem Kapitol die Stirn geboten hat?
Auf einmal wird mir klar, was ich da getan habe.
Ohne dass es meine Absicht war – ich wollte nur meine
Dankbarkeit ausdrücken –, habe ich etwas Gefährliches
97
ausgelöst. Einen Akt des Widerstands in Distrikt 11. Ge-
nau das, was ich verhindern soll!
Ich überlege, womit ich das Geschehene zunichtema-
chen, es widerlegen könnte, doch da wird mit einem leich-
ten Knacken mein Mikrofon abgeschaltet, und der Bür-
germeister ergreift das Wort. Peeta und ich nehmen noch
einen letzten Applaus in Empfang. Er führt mich zurück
zur Tür, er merkt gar nicht, dass etwas nicht stimmt.
Mir ist ganz komisch und ich muss einen Augenblick
stehen bleiben. Kleine Lichtfetzen tanzen vor meinen Au-
gen. »Alles in Ordnung?«, fragt Peeta.
»Nur ein bisschen schwindelig. Die Sonne war so grell«,
sage ich. Ich sehe seinen Blumenstrauß. »Ich hab meine
Blumen vergessen«, murmele ich.
»Ich hol sie«, sagt er.
»Das mach ich schon«, sage ich.
Hätte ich die Blumen nicht vergessen, wäre ich nicht
stehen geblieben, dann wären wir jetzt wohlbehalten im
Justizgebäude. Stattdessen sehe ich von der schattigen Ve-
randa aus alles mit an.
Zwei Friedenswächter ziehen den alten Mann, der ge-
pfiffen hat, hinauf auf die Treppe. Zwingen ihn vor der
Menge auf die Knie. Und jagen ihm eine Kugel in den
Kopf.
98
5 Der Mann ist gerade erst auf dem Boden
zusammengesunken, als eine Wand aus
weißen Friedenswächtern uns die Sicht versperrt. Mehrere
Soldaten haben ihre Maschinengewehre auf uns gerichtet,
während sie uns zurück zur Tür schieben.
»Wir gehen ja schon!«, sagt Peeta und schubst den Frie-
denswächter, der mich bedrängt, weg. »Wir haben verstan-
den, okay? Komm, Katniss.«
Er legt mir einen Arm um die Schultern und führt
mich zurück ins Justizgebäude. Der Friedenswäch-
ter folgt uns im Abstand von ein oder zwei Schritten.
Kaum sind wir drin, schlägt die Tür zu, und wir hö-
ren die Stiefel des Friedenswächters, der zurück zu der
Menge geht.
Auf dem Bildschirm, der an der Wand angebracht ist,
sieht man nur ein Grieselbild. Darunter warten Haymitch,
Effie, Portia und Cinna mit ängstlichen, angespannten
Gesichtern.
»Was ist passiert?« Effie kommt schnell auf uns zu.
»Nach Katniss’ wundervoller Rede hatten wir keinen
Empfang mehr, und dann meinte Haymitch, er hätte
99
einen Schuss gehört. Ich hab gesagt, das kann nicht sein,
aber wer weiß? Es gibt ja überall Verrückte!«
»Es ist nichts passiert, Effie. Ein alter Lkw hatte eine
Fehlzündung«, sagt Peeta ruhig.
Noch zwei Schüsse. Sie werden durch die Tür kaum
gedämpft. Für wen waren die? Threshs Großmutter? Eine
von Rues kleinen Schwestern?
»Ihr beide. Kommt mit«, sagt Haymitch. Peeta und ich
folgen ihm und lassen die anderen zurück. Jetzt, da wir im
Gebäude in Sicherheit sind, interessieren sich die Friedens-
wächter, die um das Justizgebäude herum aufgestellt sind,
nicht mehr sonderlich für unser Treiben. Wir gehen eine
prächtige marmorne Wendeltreppe hinauf. Oben liegt ein
langer Flur, der mit einem abgetretenen Teppich ausgelegt
ist. Eine Flügeltür steht offen und lockt uns in das erste
Zimmer. Die Wände sind bestimmt sieben Meter hoch.
An der Decke Stuck mit Früchten und Blumen, kleine
Putten mit Flügeln schauen aus allen Ecken auf uns herab.
Vasen mit Blüten verströmen einen süßlichen Duft, von
dem mir die Augen jucken. Unsere Abendkleider hängen
an einer Garderobe an der Wand. Der Raum ist für uns
vorbereitet, doch wir haben kaum unsere Geschenke abge-
legt, als Haymitch uns die Mikrofone von der Brust reißt,
sie hinter ein Sofakissen stopft und uns weiterwinkt.
100
Soweit ich weiß, ist Haymitch erst ein Mal hier gewe-
sen, bei seiner eigenen Siegertour vor mehreren Jahrzehn-
ten. Doch entweder hat er ein bemerkenswertes Gedächt-
nis oder zuverlässige Instinkte, denn er führt uns durch
ein Labyrinth aus gewundenen Treppenhäusern und
immer schmaler werdenden Fluren. Manchmal muss er
stehen bleiben und eine Tür mit Gewalt öffnen. An dem
widerstrebenden Quietschen der Angeln merkt man, dass
die Türen lange nicht geöffnet wurden. Schließlich steigen
wir eine Leiter zu einer Falltür hoch. Als Haymitch sie zur
Seite schiebt, finden wir uns in der Kuppel des Justizge-
bäudes wieder. Sic ist riesig und vollgestopft mit kaputten
Möbeln, Bücherstapeln, Balken und rostigen Waffen. Al-
les ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt, hier ist seit
Jahren nichts passiert. Durch vier schmuddelige quadrati-
sche Fenster rund um die Kuppel versucht sich das Licht
hindurchzukämpfen. Haymitch schließt die Falltür mit
dem Fuß und schaut uns an. »Was ist los?«, fragt er.
Peeta erzählt alles, was auf dem Platz geschehen ist.
Der Pfiff, der Gruß, unser Zögern auf der Veranda, der
Mord an dem alten Mann. »Was hat das zu bedeuten,
Haymitch?«
»Das kannst besser du erzählen«, sagt Haymitch zu mir.
Das sehe ich anders. Ich glaube, es ist viel schlimmer,
101
wenn ich es erzähle. Aber ich erkläre Peeta alles, so ruhig
ich kann. Ich erzähle von Präsident Snow, von den Unru-
hen in den Distrikten. Nicht einmal den Kuss von Gale
lasse ich aus. Ich erkläre, dass wir alle in Gefahr sind, dass
das ganze Land in Gefahr ist wegen meines Beerentricks.
»Auf dieser Tour sollte ich alles wieder geraderücken. Alle,
die Zweifel hatten, sollte ich davon überzeugen, dass ich
aus Liebe gehandelt habe. Damit sich die Lage wieder
beruhigt. Stattdessen hab ich heute erreicht, dass sie drei
Menschen getötet haben, und jetzt werden alle auf dem
Platz bestraft.« Mir ist so elend, dass ich mich auf ein Sofa
setzen muss, auch wenn die Sprungfedern und die Fül-
lung herausgucken.
»Dann hab ich auch alles noch schlimmer gemacht.
Indem ich ihnen das Geld geschenkt habe«, sagt Peeta.
Plötzlich schlägt er so fest gegen eine Lampe, die wack-
lig auf einer Kiste steht, dass sie quer durch das Zimmer
fliegt. Klirrend fällt sie zu Boden. »Damit muss Schluss
sein! Auf der Stelle! Mit diesem … diesem Spiel, das ihr
beide da spielt, dass ihr euch Geheimnisse erzählt, aus de-
nen ihr mich raushaltet, als wäre ich zu unwichtig oder zu
blöd oder zu schwach, um damit fertigzuwerden.«
»So ist es nicht, Peeta …«, setze ich an.
»Genau so ist es!«, brüllt er. »Ich hab auch Menschen,
102
die mir am Herzen liegen, Katniss! Freunde und Ver-
wandte in Distrikt 12, die genauso tot sein werden wie
deine, wenn wir diese Geschichte nicht hinkriegen. Nach
allem, was wir in der Arena zusammen durchgemacht ha-
ben, hab ich da nicht wenigstens die Wahrheit verdient?«
»Bei dir kann man sich immer darauf verlassen, dass du
deine Sache gut machst, Peeta«, sagt Haymitch. »Du weißt
genau, wie du dich vor der Kamera darstellen musst. Das
wollte ich nicht stören.«
»Also, da hast du mich aber überschätzt. Denn heute
hab ich’s ja gründlich vermasselt. Was glaubst du, was jetzt
mit Rues und Threshs Familien passiert? Meinst du, sie
bekommen ihren Anteil an unserem Preis? Meinst du, ich
hab ihnen eine strahlende Zukunft gesichert? Ich glaub,
die können froh sein, wenn sie den Tag überleben!« Peeta
schleudert noch etwas durchs Zimmer, eine Skulptur. So
habe ich ihn noch nie erlebt.
»Haymitch, er hat recht«, sage ich. »Es war ein Feh-
ler, dass wir es ihm nicht gesagt haben. Auch schon im
Kapitol.«
»Selbst in der Arena hattet ihr beide schon ein spezielles
System, oder?«, fragt Peeta. Er klingt jetzt ruhiger. »Und
ich war nicht eingeweiht.«
»Nein, das stimmt nicht. Jedenfalls nicht offiziell. Ich
103
hab nur daran, was Haymitch mir geschickt oder nicht ge-
schickt hat, gemerkt, was er von mir wollte«, sage ich.
»Tja, die Chance hatte ich nicht. Mir hat er nämlich nie
irgendwas geschickt, bis du aufgetaucht bist«, sagt Peeta.
Darüber habe ich noch gar nicht groß nachgedacht.
Wie es auf Peeta gewirkt haben muss, als ich in der Are-
na auftauchte und Brandsalbe und Brot bekommen hatte,
während er, der an der Schwelle zum Tod stand, leer aus-
gegangen war. Als hielte Haymitch mich auf Peetas Kos-
ten am Leben.
»Hör mal, Junge …«, setzt Haymitch an.
»Spar dir den Atem, Haymitch. Mir ist schon klar, dass
du dich für einen von uns entscheiden musstest. Und ich
hätte selbst gewollt, dass du dich für sie entscheidest. Aber
das hier ist was anderes. Da draußen sind Menschen ge-
storben. Und wenn wir es nicht sehr geschickt anstellen,
wird es weitere Tote geben. Wir wissen alle, dass ich vor
der Kamera besser bin als Katniss. Mit mir braucht kei-
ner meine Rolle zu üben. Aber ich will wissen, worauf ich
mich einlasse«, sagt Peeta.
»Ab jetzt werde ich dich immer auf dem Laufenden
halten«, verspricht Haymitch.
»Das wil ich dir auch geraten haben«, sagt Peeta. Er
schaut mich noch nicht mal an, als er aus dem Zimmer geht.
104
Der Staub, den er aufgewirbelt hat, sinkt an anderen
Stellen hinab. Auf meine Haare, meine Augen, meine
glänzende Goldbrosche.
»Hattest du dich wirklich für mich entschieden, Hay-
mitch?«, frage ich.
»Ja«, sagt er.
»Warum? Du kannst ihn doch besser leiden.«
»Das stimmt. Aber überleg mal – bevor sie die Regeln
geändert haben, konnte ich nur darauf hoffen, einen von
euch lebend da rauszuholen«, sagt er. »Und da er ent-
schlossen war, dich zu beschützen, dachte ich mir, zu dritt
schaffen wir es vielleicht, dich nach Hause zu holen.«
»Ach so.« Mehr bringe ich nicht heraus.
»Da siehst du, was für Entscheidungen du mal treffen
musst. Wenn wir hier lebend rauskommen«, sagt Hay-
mitch. »Du wirst es noch lernen.«
Nun ja, eins habe ich heute auf jeden Fall gelernt. Das
hier ist keine größere Version von Distrikt 12. Unser Zaun
ist unbewacht und steht selten unter Strom. Unsere Frie-
denswächter sind zwar lästig, aber nicht so brutal. Die
Schwierigkeiten bei uns lösen eher Erschöpfung aus als
Wut. Hier in Distrikt 11 leiden die Menschen größere Not
und sie sind verzweifelter. Präsident Snow hat recht. Ein
Funke könnte ausreichen, um sie zu entflammen.
105
Für mich geht jetzt alles so schnell, dass ich nicht mehr
mitkomme. Die Warnung, die Schüsse, die Erkenntnis,
dass ich vielleicht etwas sehr Folgenschweres in Gang ge-
setzt habe. Das ist alles so absurd. Es wäre etwas anderes,
wenn ich geplant hätte, Unruhe zu stiften, aber so … Wie
hab ich es bloß geschafft, so ein Chaos anzurichten?
»Komm schon. Wir dürfen beim Abendessen nicht feh-
len«, sagt Haymitch.
Ich bleibe so lange unter der Dusche, bis sie mich rufen,
weil ich noch angekleidet werden muss. An dem Vorberei-
tungsteam scheinen die Ereignisse des Tages vol kommen
vorbeigegangen zu sein. Sie freuen sich al e auf das Abend-
essen. In den Distrikten sind sie wichtig genug, um dabei
sein zu dürfen, im Kapitol werden sie fast nie zu den ent-
scheidenden Partys eingeladen. Während sie darüber speku-
lieren, was es wohl zu essen gibt, sehe ich immer noch den
alten Mann vor mir, wie ihm der Kopf weggesprengt wird.
Ich achte gar nicht darauf, was sie mit mir anstel en, bis ich
fertig bin und mich im Spiegel anschaue. Ein trägerloses
zartrosa Kleid fäl t mir bis auf die Schuhe. Meine Haare
sind zurückgesteckt und kringeln sich auf meinem Rücken.
Cinna kommt von hinten zu mir und legt mir eine sil-
bern schimmernde Stola um die Schultern. Er fängt mei-
nen Blick im Spiegel auf. »Gefällt es dir?«
106
»Es ist wunderschön. Wie immer«, sage ich.
»Zeig mal, wie es mit einem Lächeln aussieht«, sagt er
freundlich. Das ist seine Art, mich daran zu erinnern, dass
gleich die Kameras wieder dabei sein werden. Ich schaffe
es, die Mundwinkel hochzuziehen. »Na also.«
Als wir uns alle treffen, um zum Essen zu gehen, mer-
ke ich, dass Effie verstimmt ist. Bestimmt hat Haymitch
ihr nicht erzählt, was auf dem Platz passiert ist. Ich wür-
de mich nicht wundern, wenn Cinna und Portia Bescheid
wüssten, doch es scheint ein unausgesprochenes Einver-
ständnis darüber zu geben, dass man schlechte Nachrich-
ten besser von Effie fernhält. Es dauert jedoch nicht lange,
bis sie von dem Problem Wind bekommt.
Sie geht den Plan für den Abend durch, dann fegt sie
das Blatt beiseite. »Und dann können wir endlich wieder
in den Zug und weg von hier«, sagt sie.
»Stimmt irgendwas nicht, Effie?«, fragt Cinna.
»Es gefällt mir nicht, wie wir hier behandelt werden.
Wie sie uns in Lastwagen pferchen und von der Bühne
drängen. Und dann hab ich mich vor etwa einer Stunde
mal im Justizgebäude umgeschaut. Ich verstehe ja eine
ganze Menge von Architektur«, sagt sie.
»Ach ja, davon hab ich schon gehört«, sagt Portia, bevor
das Schweigen zu lange andauert.
107
»Also hab ich mich ein bisschen umgeschaut, weil Dis-
triktruinen in diesem Jahr total angesagt sind. Da kamen
zwei Friedenswächter und haben mich zurück in unsere
Wohnung geschickt. Einer hat mir sogar das Gewehr an
die Brust gehalten!«, sagt Effie.
Das nehme ich als unmittelbare Reaktion darauf, dass
Haymitch, Peeta und ich uns zuvor aus dem Staub gemacht
hatten. Immerhin hat der Gedanke, dass Haymitch recht
hatte, etwas Beruhigendes. Dass niemand die verstaubte
Kuppel überwachen würde, wo wir miteinander geredet ha-
ben. Obwohl sie das ab jetzt ganz bestimmt tun werden.
Effie sieht so bekümmert aus, dass ich sie spontan um-
arme. »Das ist ja schrecklich, Effie. Vielleicht sollten wir
gar nicht zu dem Essen gehen. Wenigstens, bis sie sich ent-
schuldigt haben.« Ich weiß, dass sie nie zustimmen würde,
aber bei dem Vorschlag bessert sich ihre Laune erheblich,
sie fühlt sich ernst genommen.
»Nein, ich schaff das schon. Mit Höhen und Tiefen fer-
tigzuwerden, gehört zu meinem Job. Und ihr zwei dürft
nicht um euer Abendessen kommen. Aber danke für das
Angebot, Katniss.«
Effie stellt uns für unseren Auftritt auf. Erst die Vorbe-
reitungsteams, dann sie, die Stylisten und Haymitch. Pee-
ta und ich kommen natürlich zum Schluss.
108
Irgendwo unten fangen Musiker an zu spielen. Als die
Spitze unserer kleinen Prozession die Treppe hinuntergeht,
fassen Peeta und ich uns bei den Händen.
»Haymitch sagt, ich hätte dich nicht anbrüllen dürfen.
Du hast nur seine Anweisungen befolgt«, sagt Peeta. »Und
es ist ja nicht so, als hätte ich in der Vergangenheit nicht
auch mal etwas vor dir verborgen.«
Ich erinnere mich an den Schock, als Peeta vor ganz
Panem seine Liebe zu mir gestand. Haymitch hatte davon
gewusst und mir nichts gesagt. »Ich glaube, nach dem In-
terview damals hab ich auch das eine oder andere demo-
liert«, sage ich.
»Nur einen Blumenkübel«, erwidert er.
»Und deine Hände. Aber jetzt haben wir das nicht
mehr nötig, oder? Unaufrichtig zueinander zu sein«, sage
ich.
»Nein«, sagt Peeta. Wir stehen oben auf der Treppe
und lassen Haymitch fünfzehn Stufen Vorsprung, wie Ef-
fie gesagt hat. »War es wirklich das einzige Mal, dass du
Gale geküsst hast?«
Ich bin so perplex, dass ich ihm antworte. »Ja.« Hat ihn
diese Frage tatsächlich gequält, nach all dem, was heute
passiert ist?
»Fünfzehn. Los jetzt«, sagt er.
109
Ein Scheinwerfer trifft uns und ich setze mein breites-
tes Lächeln auf.
Wir gehen die Treppe hinunter und begeben uns in den
Sog aus immer gleichen Abendessen, Festlichkeiten und
Zugfahrten. Jeden Tag dasselbe. Aufwachen. Anziehen.
Durch jubelnde Menschenmengen fahren. Eine Rede auf
uns anhören. Mit einer Dankesrede antworten, aber nur
mit der, die das Kapitol vorgegeben hat, keine persönli-
chen Worte mehr. Manchmal eine kleine Rundfahrt: ein
kurzer Blick auf das Meer in dem einen Distrikt, riesige
Wälder in einem anderen, hässliche Fabriken, Weizen-
felder, stinkende Raffinerien. Abendgarderobe anziehen.
Festessen. Zum Zug.
Während der Feierlichkeiten sind wir immer ernst
und respektvoll, aber ständig in Kontakt, mit den Hän-
den oder mit den Armen. Beim Abendessen sind wir halb
wahnsinnig vor Liebe zueinander. Wir küssen uns, wir
tanzen, lassen uns dabei erwischen, wie wir uns zu zweit
davonstehlen wollen. Im Zug leiden wir stumm, während
wir uns unsere Wirkung ausmalen.
Selbst ohne persönliche Ansprachen, die das Volk auf-
rühren könnten – überflüssig zu erwähnen, dass unsere Re-
den in Distrikt 11 vor der Ausstrahlung herausgeschnitten
wurden –, ist zu spüren, dass etwas in der Luft liegt, wie
110
das Brodeln in einem Topf, der jeden Moment überzuko-
chen droht. Nicht überal . Mancherorts macht das Publi-
kum den Eindruck einer müden Viehherde, wie er auch in
Distrikt 12 bei den Siegesfeierlichkeiten für gewöhnlich vor-
herrscht. Doch anderswo – besonders in den Distrikten 8, 4
und 3 – zeigt sich Begeisterung in den Gesichtern der Men-
schen, als sie uns sehen, und unter der Begeisterung lauert
Wut. Wenn sie meinen Namen skandieren, ist das eher ein
Ruf nach Rache als ein Jubeln. Wenn die Friedenswächter
einschreiten, um die aufmüpfige Menge zu beruhigen, leis-
tet sie eher Widerstand, als dass sie sich zurückzieht. Und
ich weiß, dass ich dagegen machtlos bin. Kein Liebestheater,
und wäre es noch so glaubwürdig, könnte diese Wel e auf-
halten. Wenn es ein Akt des zeitweiligen Wahnsinns von
mir war, Peeta diese Beeren hinzuhalten, dann sind diese
Leute auch zum Wahnsinn bereit.
Cinna muss meine Kleider um die Taille herum enger
machen. Das Vorbereitungsteam ist besorgt wegen der
Ringe unter meinen Augen. Effie gibt mir Schlaftablet-
ten, doch sie helfen nicht. Jedenfalls nicht gut genug. Ich
döse ein, um aus Albträumen aufzuschrecken, die häufi-
ger und schlimmer geworden sind. Einmal hört Peeta, der
nachts durch den Zug wandert, mich schreien, während
ich mich aus dem Schleier der Medikamente zu kämpfen
111
versuche, die die schlimmen Träume nur verlängern. Er
schafft es, mich wach zu rütteln und zu beruhigen. Dann
kommt er zu mir ins Bett und hält mich in den Armen,
bis ich wieder eingeschlafen bin. Von da an weigere ich
mich, die Tabletten zu schlucken. Aber ich lasse ihn jede
Nacht in mein Bett. Wir überstehen die Dunkelheit wie
in der Arena, aneinandergeschmiegt, immer auf der Hut
vor Gefahren, die überall lauern können. Weiter passiert
nichts, aber schon bald wird im Zug über unser Arrange-
ment geklatscht.
Als Effie mir davon erzählt, denke ich: Gut so. Viel eicht
dringt es ja bis zu Präsident Snow durch. Ich sage ihr, wir
würden versuchen, ein wenig diskreter zu sein, aber wir
denken gar nicht daran.
Die Auftritte in Distrikt 2 und dann in 1 sind auf ihre
ganz eigene Weise grauenhaft. Cato und Clove, die beiden
Tribute aus Distrikt 2, hätten es beide nach Hause schaf-
fen können, wenn Peeta und ich nicht gewonnen hätten.
Das Mädchen aus Distrikt 1, Glimmer, und den Jungen
habe ich persönlich umgebracht. Während ich versuche,
seine Familie nicht anzusehen, erfahre ich, dass er Marvel
hieß. Wie ist es möglich, dass ich das nicht wusste? Wahr-
scheinlich habe ich vor den Spielen nicht darauf geachtet
und hinterher wollte ich es gar nicht mehr wissen.
112
Als wir im Kapitol ankommen, sind wir verzweifelt.
Wir haben endlose Auftritte vor einem Publikum, das uns
anhimmelt. Hier besteht keine Gefahr eines Aufstands,
hier bei den Privilegierten, bei denen, deren Namen zur
Ernte nie in die Lostrommel wandern, deren Kinder nie
für die vermeintlichen Verbrechen sterben, die vor Gene-
rationen begangen wurden. Im Kapitol brauchen wir nie-
manden von unserer Liebe zu überzeugen, wir klammern
uns nur an die schwache Hoffnung, ein paar Zweifler in
den Distrikten zu erreichen. Was wir auch tun, es kommt
uns zu wenig vor, zu spät.
Als wir wieder in unserem alten Quartier im Trainig-
scenter sind, mache ich den Vorschlag mit dem öffentli-
chen Heiratsantrag. Peeta ist einverstanden, aber danach
verschwindet er für lange Zeit in seinem Zimmer. Hay-
mitch sagt, ich soll ihn in Ruhe lassen.
»Ich dachte, er wollte es sowieso«, sage ich.
»Aber nicht so«, sagt Haymitch. »Er wollte, dass es echt
ist.«
Ich gehe in mein Zimmer und lege mich ins Bett, ich
versuche, nicht an Gale zu denken, und denke doch an
nichts anderes.
An diesem Abend quasseln wir uns auf der Bühne vor
dem Trainingscenter durch einen ganzen Fragenkatalog.
113
Caesar Flickerman in seinem glitzernden nachtblauen An-
zug, die Haare, Lider und Lippen immer noch taubenblau
gefärbt, führt uns fehlerfrei durch das Interview. Als er
uns nach der Zukunft fragt, kniet Peeta nieder, schüttet
mir sein Herz aus und bittet mich, ihn zu heiraten. Natür-
lich nehme ich seinen Antrag an. Caesar ist außer sich, das
Publikum im Kapitol flippt aus, Aufnahmen von Men-
schen überall in Panem zeigen ein Volk im Glück.
Präsident Snow höchstpersönlich macht einen Über-
raschungsbesuch, um uns zu gratulieren. Er drückt Peeta
die Hand und klopft ihm anerkennend auf die Schulter.
Er umarmt mich, hüllt mich in den Geruch aus Blut und
Rosen und drückt mir einen schmatzigen Kuss auf die
Wange. Als er sich zurückzieht, die Finger in meinen Arm
gräbt und mir ins Gesicht lächelt, wage ich es, die Brau-
en zu heben. Sie stellen die Frage, die ich nicht über die
Lippen bringe. Habe ich es geschafft? Hat es gereicht? Hat
es gereicht, dass ich dir al es gegeben habe, dass ich das Spiel
weitergespielt und versprochen habe, Peeta zu heiraten?
Zur Antwort schüttelt er fast unmerklich den Kopf.
114
6 In dieser winzigen Bewegung erken-
ne ich das Ende der Hoffnung, die be-
ginnende Zerstörung all dessen, was mir lieb ist auf der
Welt. Ich habe keine Ahnung, wie meine Strafe ausfällt,
wie weit das Netz ausgeworfen wird, doch am Ende wird
höchstwahrscheinlich nichts mehr übrig sein. Also soll-
te man meinen, dass ich in diesem Moment am Boden
zerstört sein müsste. Aber es ist ganz merkwürdig. Ich
empfinde vor allem eine Art Erleichterung. Dass ich das
Spiel aufgeben kann. Dass die Frage, ob ich dieses Un-
ternehmen gewinnen kann, beantwortet ist, selbst wenn
die Antwort ein dröhnendes Nein ist. Und wenn verzwei-
felte Zeiten verzweifelte Maßnahmen erfordern, dann
kann ich mich so verzweifelt aufführen, wie ich will.
Allerdings nicht hier, noch nicht jetzt. Das Wichtigs-
te ist, dass ich zurück in den Distrikt 12 komme, denn
zu meinem Plan werden auf jeden Fall meine Mutter und
meine Schwester, Gale und seine Familie gehören. Und
Peeta, wenn ich ihn überreden kann mitzukommen. Auch
Haymitch setze ich auf die Liste. Das sind die Menschen,
die ich mitnehmen muss, wenn ich in die Wildnis fliehe.
115
Wie ich sie überzeugen soll, wo wir im tiefsten Winter hin-
können, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, das sind
unbeantwortete Fragen. Aber wenigstens weiß ich jetzt,
was zu tun ist.
Anstatt also weinend zu Boden zu sinken, merke ich,
dass ich so aufrecht und selbstbewusst dastehe wie seit
Wochen nicht. Mein Lächeln ist zwar etwas idiotisch, aber
nicht gezwungen. Und als Präsident Snow das Publikum
zum Schweigen bringt und sagt: »Was halten Sie davon,
wenn die beiden hier im Kapitol ihre Hochzeit feiern?«,
da verwandle ich mich mühelos in das Mädchen, das vor
Freude fast ausrastet.
Caesar Flickerman fragt den Präsidenten, ob er schon
einen Termin ins Auge gefasst habe.
»Oh, ehe wir uns auf einen Termin festlegen, sollten
wir uns lieber mit Katniss’ Mutter einigen«, sagt der Prä-
sident. Das Publikum grölt und der Präsident legt einen
Arm um mich. »Wenn alle im Land es ganz fest wollen,
dann kommst du vielleicht unter die Haube, bevor du
dreißig bist.«
»Wahrscheinlich müssen Sie dafür ein neues Gesetz er-
lassen«, sage ich kichernd.
»Wenn’s weiter nichts ist«, sagt der Präsident mit einem
verschwörerischen Grinsen.
116
Ach, wie wir zwei uns miteinander amüsieren.
Das Fest, das im Bankettsaal von Präsident Snows An-
wesen stattfindet, sucht seinesgleichen. Die weit über zehn
Meter hohe Decke ist in einen Nachthimmel verwandelt
worden und die Sterne sehen genauso aus wie zu Hause.
Vom Kapitol aus sehen sie vermutlich auch so aus, aber wer
weiß? In der Stadt ist immer zu viel Licht, um die Sterne
zu sehen. Irgendwo in der Mitte zwischen dem Fußboden
und der Decke schweben die Musiker auf etwas, das aus-
sieht wie bauschige weiße Wolken, aber ich kann nicht er-
kennen, was sie in der Luft hält. Statt der großen Tische
sind überall im Saal Sofas und Sessel gruppiert, einige um
Kamine herum, andere an duftenden Blumengärten oder
Teichen mit exotischen Fischen, und die Gäste können in
aller Bequemlichkeit essen und trinken und tun, was ih-
nen gefällt. In der Mitte des Saals ist eine große geflieste
Fläche, die zum Tanzen, als Bühne für die unterschied-
lichsten Künstler und einfach als Treffpunkt für die extra-
vagant gekleideten Gäste dient.
Doch der eigentliche Star des Abends ist das Essen.
Tafeln voller Köstlichkeiten sind an den Wänden entlang
aufgebaut. Alles, was man sich nur vorstellen kann, steht
dort bereit, Speisen, die man sich nie hätte träumen lassen.
Ganze gebratene Rinder, Schweine und Ziegen, die sich
117
noch am Spieß drehen. Riesige Platten mit Geflügel, ge-
füllt mit herrlichen Früchten und Nüssen. Meerestiere, die
mit Soßen beträufelt sind oder darauf warten, in würzige
Dips getunkt zu werden. Zahllose Käsesorten, verschie-
dene Brote, Gemüse, Desserts; Kaskaden von Wein und
Ströme von Spirituosen, auf denen die Flammen züngeln.
Mit meinem Kampfgeist ist auch mein Appetit wie-
der erwacht. Nachdem ich wochenlang vor lauter Sorgen
kaum essen konnte, habe ich jetzt einen Riesenhunger.
»Ich will alles probieren, was es gibt«, sage ich zu Peeta.
Ich sehe ihm an, dass er versucht, meine Miene zu
deuten, den Wandel nachzuvollziehen. Er weiß ja nicht,
dass ich in den Augen von Präsident Snow versagt habe,
deshalb kann er nur schlussfolgern, dass ich glaube, wir
hätten es geschafft. Vielleicht sogar, dass ich mich über
unsere Verlobung wirklich ein bisschen freue. Seine Ver-
wirrung spiegelt sich in seinem Blick, aber nur kurz, denn
wir werden gefilmt. »Dann lass es lieber langsam angehen«,
sagt er.
»Na gut, nicht mehr als einen Bissen von jedem Ge-
richt«, sage ich. Ich werde meinem Vorsatz schon an dem
ersten Tisch mit rund zwanzig Suppen untreu, als ich eine
cremige Kürbissuppe mit geraspelten Nüssen und kleinen
schwarzen Samen probiere. »Die könnte ich den ganzen
118
Abend essen!«, rufe ich. Aber das tue ich nicht. Bei einer
klaren grünen Brühe, deren Geschmack sich nur mit dem
Wort »frühlingshaft« beschreiben lässt, werde ich erneut
schwach, und dann noch einmal, als ich ein rosafarbenes,
mit Himbeeren getupftes Schaumsüppchen koste.
Gesichter tauchen auf, Namen werden ausgetauscht,
Fotos geknipst, Küsschen auf Wangen gehaucht. Meine
Spotttölpelbrosche hat anscheinend eine neue Mode ins Le-
ben gerufen, mehrere Leute kommen zu mir, um mir ihre
Accessoires zu zeigen. Der Vogel ist auf Gürtelschnal en zu
sehen, auf Seidenrevers gestickt, sogar an intimen Stel en
eintätowiert. Al e wol en das Zeichen der Siegerin tragen.
Ich kann nur ahnen, wie das Präsident Snow zur Weißglut
bringen muss. Aber was kann er tun? Die Spiele sind so gut
angekommen, hier, wo die Beeren nur für das verzweifelte
Mädchen stehen, das den Geliebten retten wil .
Peeta und ich suchen keine Gesellschaft, ganz von
selbst kommen die Leute zu uns. Wir sind die Hauptat-
traktion auf dem Fest. Ich tue so, als wäre ich hocherfreut,
aber die Leute vom Kapitol interessieren mich kein biss-
chen. Sie lenken mich nur vom Essen ab.
Jeder Tisch hält neue Verlockungen bereit und selbst
mit der Al es-nur-einmal-probieren-Regel werde ich schnell
satt. Ich nehme mir einen kleinen gebratenen Vogel, beiße
119
hinein und Orangensoße breitet sich auf meiner Zunge aus.
Köstlich. Doch den Rest dränge ich Peeta auf, weil ich noch
mehr probieren möchte, und die Vorstel ung, Essen wegzu-
werfen, wie es hier so viele Leute gedankenlos tun, ist mir
ein Graus. Nach etwa zehn Tischen bin ich satt, dabei ha-
ben wir nur einen kleinen Teil der Gerichte durchprobiert.
Genau in dem Moment kommt mein Vorberei-
tungsteam auf uns zugestürmt. Sie sind ganz außer sich
von dem Alkohol und vor Begeisterung darüber, bei so ei-
ner großen Sache dabei zu sein.
»Warum isst du nichts?«, fragt Octavia.
»Hab ich schon, jetzt kriege ich nichts mehr runter«,
sage ich. Alle lachen, als wäre es das Albernste, was sie je
gehört haben.
»Davon lässt man sich doch nicht abhalten!«, sagt Fla-
vius. Sie führen uns zu einem Tisch, auf dem kleine Wein-
gläser stehen, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt sind.
»Trinkt das!«
Als Peeta ein Glas nimmt, um einen Schluck zu trin-
ken, flippen sie aus.
»Doch nicht hier!«, schreit Octavia.
»Du musst es da drin trinken«, sagt Venia und zeigt auf
eine Tür, die zu den Toiletten führt. »Sonst landet doch
alles auf dem Boden!«
120
Peeta schaut wieder auf das Glas, bis er begreift. »Du
meinst, dass ich mich davon übergeben muss?«
Mein Vorbereitungsteam lacht hysterisch. »Na klar, da-
mit du weiteressen kannst«, sagt Octavia. »Ich war schon
zweimal dadrin. Alle machen das, wie soll man so ein
Festessen sonst genießen?«
Ich bin sprachlos, ich starre auf die hübschen kleinen
Gläser und denke an Octavias Worte. Peeta stellt sein
Glas mit einer Präzision zurück, als könnte es explodieren.
»Komm, Katniss, wir tanzen.«
Musik dringt durch die Wolken herab, während er
mich von dem Team und dem Tisch wegführt und mit
mir zur Tanzfläche geht. Von zu Hause kennen wir nur
wenige Tänze, solche, die zu Fideln und Flöten passen
und für die man ziemlich viel Platz braucht. Doch Effie
hat uns einige Tänze gezeigt, die im Kapitol beliebt sind.
Die Musik ist langsam und traumgleich, also zieht Peeta
mich in seine Arme, und wir drehen uns im Kreis, fast
ohne Schritte. Diesen Tanz könnte man auf einem Kuch-
enteller tanzen. Eine Weile schweigen wir. Dann spricht
Peeta mit gepresster Stimme.
»Da macht man mit, denkt sich, man kommt damit klar
und viel eicht sind sie doch nicht so übel, und dann …« Er
verstummt.
121
Ich muss an die ausgemergelten Kinder auf unserem Kü-
chentisch denken, an meine Mutter, die das verschreibt, was
die Eltern nicht haben. Mehr zu essen. Jetzt, da wir reich
sind, wird sie ihnen einiges mit nach Hause geben. Aber
damals hatten wir oft nichts, was sie ihnen hätte geben kön-
nen, und häufig kam für das Kind ohnehin jede Hilfe zu
spät. Und hier im Kapitol übergeben sich die Leute, um sich
die Bäuche nur zum Spaß erneut vol schlagen zu können.
Nicht weil sie körperlich oder seelisch krank wären, nicht
weil das Essen verdorben wäre. Das macht man eben so auf
einem Fest. Es wird erwartet. Gehört zum Vergnügen dazu.
Einmal, als ich bei Hazelle vorbeiging, um ihr Wild zu
bringen, war Vick mit einem schlimmen Husten zu Hause.
Da der Kleine zu Gales Familie gehört, bekommt er mehr
zu essen als neunzig Prozent der Bevölkerung von Dist-
rikt 12. Trotzdem redete er eine Viertelstunde davon, dass
sie eine Dose Maissirup vom Pakettag aufgemacht hätten,
dass jeder einen Löffel voll aufs Brot bekommen habe und
dass es im Laufe der Woche vielleicht noch mehr geben
werde. Und Hazelle hatte gesagt, sie könne ihm vielleicht
ein bisschen Sirup in den Tee tun gegen den Husten, aber
er fand das ungerecht, wenn die anderen nicht auch etwas
bekämen. Wenn es schon bei Gale so zugeht, wie muss es
dann erst in den anderen Häusern sein?
122
»Peeta, die bringen uns her, damit wir uns zu ihrer Un-
terhaltung bis auf den Tod bekämpfen«, sage ich. »Im Ver-
gleich dazu ist das hier doch gar nichts.«
»Ich weiß. Ich weiß ja. Aber manchmal halte ich es ein-
fach nicht mehr aus. Bis … bis ich nicht mehr weiß, was
ich tun werde.« Er schweigt, dann flüstert er: »Vielleicht
haben wir einen Fehler gemacht, Katniss.«
»Was meinst du?«, frage ich.
»Vielleicht hätten wir nicht versuchen sollen, die Unru-
hen in den Distrikten zu unterdrücken«, sagt er. Schnell
schaue ich nach links und rechts, doch niemand scheint
es gehört zu haben. Die Kameraleute haben sich an einen
Tisch mit Meeresfrüchten locken lassen, und die tanzen-
den Paare um uns herum sind entweder zu betrunken oder
zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um etwas zu merken.
»Tut mir leid«, sagt er. Richtig so. Hier ist nicht der Ort,
um solche Gedanken auszusprechen.
»Spar dir das für zu Hause auf«, sage ich.
In diesem Moment kommt Portia mit einem großen
Mann an, der mir vage bekannt vorkommt. Sie stellt ihn
als Plutarch Heavensbee vor, den neuen Obersten Spiel-
macher. Plutarch fragt Peeta, ob er mich für einen Tanz
entführen dürfe. Peeta hat jetzt wieder sein Kamerage-
sicht aufgesetzt und reicht mich freundlich weiter, warnt
123
den Mann jedoch, mich nicht zu sehr in Beschlag zu
nehmen.
Ich will nicht mit Plutarch Heavensbee tanzen. Will
nicht seine Hände spüren, eine an meiner Hand, eine auf
meiner Hüfte. Ich bin es nicht gewohnt, angefasst zu wer-
den, außer von Peeta oder meiner Familie, und Spielma-
cher rangieren bei mir, was meinen Wunsch nach Körper-
kontakt angeht, irgendwo unter Maden. Immerhin scheint
er das zu spüren und hält mich auf Armeslänge von sich,
während wir uns auf dem Tanzboden drehen.
Wir plaudern über das Fest, über die Unterhaltung, das
Essen, und dann macht er einen Witz darüber, dass er seit
dem Training einen weiten Bogen um Punsch mache. Ich
verstehe nicht, was er meint, bis mir klar wird, dass er der-
jenige ist, der rückwärts in eine Schüssel mit Punsch ge-
stolpert ist, als ich während des Trainings einen Pfeil auf
die Spielmacher abgeschossen habe. Eigentlich nicht auf
die Spielmacher. Ich habe ihrem Spanferkel den Apfel aus
dem Maul geschossen. Aber ich habe sie erschreckt.
»Ach, Sie sind das …« Ich lache bei der Erinnerung da-
ran, wie er in den Punsch geplatscht ist.
»Ja. Und es wird Sie freuen zu hören, dass ich mich im-
mer noch nicht richtig davon erholt habe«, sagt Plutarch.
Ich würde gern erwidern, dass zweiundzwanzig tote
124
Tribute sich auch nicht mehr von den Spielen erholen wer-
den, an deren Planung er beteiligt war. Doch ich sage nur:
»Gut. Dann sind Sie dieses Jahr also der Oberste Spielma-
cher? Das ist ja bestimmt eine große Ehre.«
»Unter uns gesagt, gab es nicht viele Kandidaten für
den Job«, sagt er. »So eine große Verantwortung für den
Ausgang der Spiele.«
Ja, und der letzte Verantwortliche ist tot, denke ich. Na-
türlich weiß er Bescheid über Seneca Crane, aber er wirkt
ganz ungerührt. »Planen Sie schon das Jubel-Jubiläum?«,
frage ich.
»Oh ja. Die Vorbereitungen laufen selbstverständlich
schon seit Jahren. Arenen werden nicht an einem Tag er-
baut. Doch über die besondere Würze der Spiele, wenn
wir es einmal so nennen wollen, wird jetzt entschieden.
Ob Sie es glauben oder nicht, heute Nacht habe ich eine
Strategiebesprechung«, sagt er.
Plutarch tritt einen Schritt zurück und zieht eine gol-
dene Taschenuhr aus der Westentasche. Er klappt den
Deckel auf, und als er sieht, wie spät es ist, runzelt er die
Stirn. »Ich muss gleich gehen.« Er dreht die Uhr so herum,
dass ich das Zifferblatt sehen kann. »Um Mitternacht geht
es los.«
»Das ist aber spät für …«, setze ich an, doch da fällt mir
125
etwas auf. Plutarch fährt mit dem Daumen über das Kris-
tallglas der Uhr und ganz kurz flackert ein Bild auf. Es ist
ein Spotttölpel. Genau wie die Brosche an meinem Kleid.
Nur dass dieser wieder verschwindet. Plutarch klappt die
Uhr zu.
»Das ist eine sehr schöne Uhr«, sage ich.
»Oh, sie ist mehr als schön. Sie ist einmalig«, sagt er.
»Falls jemand nach mir fragen sollte, sagen Sie bitte, ich
sei zu Bett gegangen. Die Besprechungen sollen geheim
bleiben. Doch ich dachte mir, Ihnen könnte ich davon
erzählen.«
»Ja. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben«, sage
ich.
Als wir uns die Hände reichen, verbeugt er sich leicht,
eine übliche Geste hier im Kapitol. »Nun denn, wir sehen
uns im nächsten Sommer bei den Spielen, Katniss. Alles
Gute für Ihre Verlobung und viel Glück mit Ihrer Mutter.«
»Das kann ich brauchen«, sage ich.
Plutarch verschwindet, und ich schlendere auf der Su-
che nach Peeta durch die Menge, während fremde Men-
schen mir gratulieren. Zu meiner Verlobung, zu meinem
Sieg bei den Spielen, zur Farbe meines Lippenstifts. Ich
antworte ihnen, doch in Wirklichkeit denke ich daran,
wie Plutarch mir stolz seine schöne, einmalige Taschenuhr
126
gezeigt hat. Irgendetwas daran war merkwürdig. Fast
heimlichtuerisch. Aber warum? Vielleicht denkt er, je-
mand könnte seine Idee klauen, einen Spotttölpel auf einer
Uhr aufblitzen zu lassen. Ja, wahrscheinlich hat er ein Ver-
mögen dafür bezahlt, und jetzt kann er sie keinem zeigen,
weil er befürchtet, dass jemand ein billiges Imitat anferti-
gen lässt. Nur im Kapitol kann er sie sehen lassen.
Als ich Peeta finde, bewundert er gerade einen Tisch
mit kunstvoll dekorierten Torten. Die Bäcker sind extra
aus der Küche gekommen, um mit ihm über Zuckerguss
und Co. zu fachsimpeln; sie überschlagen sich fast, um
seine Fragen zu beantworten. Auf seine Bitte hin stellen
sie eine Auswahl kleiner Torten zusammen, die er mit
nach Distrikt 12 nehmen kann, um ihre Arbeit in Ruhe
zu studieren.
»Effie sagte, wir müssen um eins im Zug sein. Ich fra-
ge mich, wie spät es wohl ist«, sagt er und schaut in die
Runde.
»Kurz vor Mitternacht«, sage ich. Ich nehme eine Scho-
koladenblume von einer Torte und knabbere daran, über
Manieren mache ich mir jetzt gar keine Gedanken.
»Es ist Zeit, Danke und Auf Wiedersehen zu sagen«,
flötet Effie an meiner Seite. In einem Moment wie die-
sem liebe ich sie für ihre zwanghafte Pünktlichkeit. Wir
127
sammeln Cinna und Portia ein, und Effie führt uns her-
um, damit wir uns von den wichtigen Leuten verabschie-
den können, dann scheucht sie uns zur Tür.
»Müssen wir uns nicht bei Präsident Snow bedanken?«,
fragt Peeta. »Schließlich ist es sein Haus.«
»Ach, er ist nicht so ein Partylöwe. Zu beschäftigt«,
sagt Effie. »Ich habe schon dafür gesorgt, dass er morgen
die nötigen Karten und Geschenke bekommt. Da seid ihr
ja!« Effie winkt zwei Dienern des Kapitols zu, die einen
alkoholisierten Haymitch in ihrer Mitte haben.
In einem Wagen mit getönten Scheiben fahren wir
durch die Straßen des Kapitols. Die Vorbereitungsteams
folgen uns in einem anderen Wagen. Die Scharen der fei-
ernden Menschen sind so dicht, dass wir nur langsam vo-
rankommen. Doch Effie hat alles bis ins Kleinste geplant
und um Punkt eins sind wir wieder im Zug und verlassen
den Bahnhof.
Haymitch wird in seinem Abteil abgelegt. Cinna be-
stellt Tee, und wir setzen uns alle an den Tisch, während
Effie mit ihren Zeitplänen raschelt und uns daran erinnert,
dass wir uns immer noch auf der Tour befinden. »Wir
müssen an das Erntefest in Distrikt 12 denken. Daher
schlage ich vor, dass wir jetzt unseren Tee trinken und
dann direkt ins Bett gehen.« Niemand widerspricht.
128
Als ich die Augen wieder öffne, ist es früher Nachmit-
tag. Mein Kopf ruht auf Peetas Arm. Ich kann mich nicht
daran erinnern, dass er letzte Nacht hereingekommen ist.
Ich drehe mich um, vorsichtig, um ihn nicht zu stören,
aber er ist schon wach.
»Keine Albträume«, sagt er. »Was?«, frage ich.
»Letzte Nacht hattest du keine Albträume«, sagt er.
Das stimmt. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit habe
ich durchgeschlafen. »Aber ich habe etwas geträumt«, er-
widere ich und versuche mich zu erinnern. »Ich bin einem
Spotttölpel durch den Wald gefolgt. Ganz lange. In Wirk-
lichkeit war er Rue. Als er sang, hatte er ihre Stimme.«
»Wohin hat sie dich geführt?«, fragt Peeta und streicht
mir die Haare aus der Stirn.
»Ich weiß nicht. Wir sind nicht angekommen«, sage ich.
»Aber ich war glücklich.«
»Du hast auch geschlafen, als ob du glücklich wärst«,
sagt er.
»Peeta, wieso merke ich es nie, wenn du einen Alb-
traum hast?«, frage ich.
»Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich weine oder
um mich schlage oder so. Ich wache einfach auf und bin
wie gelähmt vor Panik«, sagt er.
»Dann weck mich doch«, sage ich und denke daran,
129
dass ich ihn in meinen schlechten Nächten oft zwei- oder
dreimal wecke. Und dass es dann oft ganz lange dauert,
bis ich mich wieder beruhigt habe.
»Das ist nicht nötig. Meine Albträume handeln meis-
tens davon, dass ich dich verliere«, sagt er. »Wenn ich mer-
ke, dass du da bist, geht es mir schon wieder gut.«
Uff. Peeta sagt so etwas einfach dahin und es trifft
mich wie ein Schlag in den Magen. Er hat mir nur eine
ehrliche Antwort auf meine Frage gegeben. Er drängt
mich nicht, darauf etwas zu erwidern, irgendeine Liebes-
erklärung zu machen. Trotzdem fühle ich mich schreck-
lich, als hätte ich ihn gemein ausgenutzt. Habe ich das?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir zum ersten
Mal unmoralisch vorkommt, ihn hier in meinem Bett zu
haben. Was schon paradox ist – schließlich sind wir jetzt
offiziell verlobt.
»Wenn wir erst zu Hause sind und ich wieder allein
schlafe, wird das schlimmer«, sagt er.
Stimmt ja, wir sind fast zu Hause.
Für Distrikt 12 steht heute ein Abendessen im Haus
von Bürgermeister Undersee auf dem Programm und mor-
gen während des Erntefests eine Siegesfeier auf dem Platz.
Das Erntefest wird immer am letzten Tag der Tour gefei-
ert, doch normalerweise bedeutet es ein Essen zu Hause
130
oder mit ein paar Freunden, wenn man es sich leisten
kann. Dieses Jahr wird es eine öffentliche Veranstaltung
sein, und da das Kapitol alles spendiert, wird sich der gan-
ze Distrikt den Bauch vollschlagen können.
Die Vorbereitung wird zum größten Teil im Haus des
Bürgermeisters stattfinden, denn jetzt müssen wir uns für
die Auftritte im Freien wieder in Pelze hüllen. Am Bahn-
hof bleiben wir nur kurz, wir lächeln und winken, wäh-
rend wir uns ins Auto zwängen. Nicht einmal unsere Fa-
milien bekommen wir vor dem Abendessen zu Gesicht.
Ich bin froh, dass das Essen beim Bürgermeister statt-
findet und nicht im Justizgebäude, wo die Gedenkfeier für
meinen Vater abgehalten wurde und wo ich mich nach der
Ernte so qualvoll von meiner Familie verabschieden muss-
te. Das Justizgebäude ist zu sehr mit Trauer verbunden.
Das Haus von Bürgermeister Undersee dagegen gefällt
mir, besonders seit seine Tochter Madge und ich Freun-
dinnen sind. In gewisser Weise waren wir das schon im-
mer. Offiziell wurden wir es, als sie sich persönlich von
mir verabschiedet hat, bevor ich in die Spiele ziehen muss-
te. Da hat sie mir die Spotttölpelbrosche als Glücksbrin-
ger gegeben. Als ich wieder zu Hause war, haben wir uns
hin und wieder getroffen. Es stellte sich heraus, dass auch
Madge viele leere Stunden füllen muss. Am Anfang war
131
es ein bisschen krampfig, weil wir nicht wussten, was wir
machen sollten. Andere Mädchen in unserem Alter habe
ich über Jungs reden hören oder über andere Mädchen
oder über Mode. Madge und ich tratschen nicht gern und
Kleider finde ich sterbenslangweilig. Doch nach einigen
missglückten Anläufen begriff ich, dass sie für ihr Leben
gern in den Wald wollte, also habe ich sie ein paarmal
mitgenommen und ihr gezeigt, wie man mit Pfeil und Bo-
gen umgeht. Sie versucht mir Klavierspielen beizubringen,
aber ich höre lieber zu, wenn sie spielt. Manchmal esse ich
bei ihr zu Hause oder sie bei mir. Madge gefällt es bei mir
besser. Ihre Eltern scheinen nett zu sein, aber ich glaube
nicht, dass Madge sie oft zu Gesicht bekommt. Ihr Vater
hat als Oberhaupt von Distrikt 12 jede Menge zu tun, und
ihre Mutter leidet häufig unter heftigen Kopfschmerzen,
die sie tagelang ans Bett fesseln.
»Vielleicht solltet ihr sie mal ins Kapitol bringen«, sagte
ich einmal, als es wieder so schlimm war. An dem Tag
spielten wir nicht Klavier, denn selbst über zwei Stockwer-
ke hinweg war das Geräusch für ihre Mutter schmerzhaft.
»Die würden sie wieder hinkriegen, jede Wette.«
»Ja. Aber ins Kapitol geht man nicht, außer man ist
eingeladen«, sagte Madge unglücklich. Auch die Privilegi-
en eines Bürgermeisters sind begrenzt.
132
Als wir zum Haus des Bürgermeisters kommen, kann
ich Madge nur kurz drücken, bevor Effie mich in den
zweiten Stock scheucht, damit ich mich umziehe. Nach-
dem ich zurechtgemacht und in ein langes Silberkleid
gehüllt bin, muss ich immer noch eine Stunde bis zum
Abendessen totschlagen, also stehle ich mich davon, um
Madge zu suchen.
Ihr Zimmer liegt im ersten Stock, wo sich auch meh-
rere Gästezimmer und das Arbeitszimmer ihres Vaters
befinden. Ich strecke den Kopf zur Tür des Arbeitszim-
mers hinein, um ihrem Vater Guten Tag zu sagen, doch
er ist nicht da. Der Fernseher läuft vor sich hin und ich
sehe Bilder von Peeta und mir auf dem Fest im Kapitol
gestern Abend. Wie wir tanzen, essen und uns küssen.
Das läuft in diesem Moment in jedem Haushalt von Pa-
nem. Den Zuschauern muss das tragische Liebespaar aus
Distrikt 12 schon zum Hals raushängen. So geht es mir
jedenfalls.
Ich gehe aus dem Zimmer, als ich plötzlich ein Piep-
sen höre. Ich drehe mich um und sehe, wie der Bild-
schirm des Fernsehers schwarz wird. Dann blinken die
Worte »AKTUELLER BERICHT AUS DISTRIKT 8«
auf. Ich weiß instinktiv, dass das nicht für meine Augen
bestimmt ist, sondern nur für die des Bürgermeisters. Ich
133
müsste jetzt gehen. Und zwar schnell. Stattdessen trete ich
näher an den Fernseher heran.
Jetzt erscheint eine Sprecherin, die ich noch nie gese-
hen habe. Sie hat grau meliertes Haar und eine heisere,
herrische Stimme. Sie sagt, dass die Zustände sich ver-
schlimmern und dass Alarmstufe 3 ausgerufen wurde. Zu-
sätzliche Truppen würden nach Distrikt 8 geschickt, die
gesamte Textilproduktion sei eingestellt worden.
Dann ein Schnitt von der Sprecherin zum zentralen
Platz von Distrikt 8. Ich erkenne ihn, weil ich vor einer
Woche noch dort war. Von den Dächern wehen immer
noch Flaggen mit meinem Gesicht darauf. Darunter spielt
sich ein Riesenchaos ab. Schreiende Menschen sind auf
dem Platz, die Gesichter hinter Tüchern und selbst ge-
machten Masken versteckt, sie werfen mit Ziegelsteinen.
Häuser stehen in Flammen. Friedenswächter schießen in
die Menge, töten wahllos.
Ich habe so etwas noch nie gesehen, aber es kann nur
eins bedeuten. Ich sehe das, was Präsident Snow einen
Aufstand genannt hat.
134
7 Ein Lederbeutel mit Essen und eine Ther-
moskanne mit heißem Tee. Ein Paar mit
Fell gefütterte Handschuhe, die Cinna dagelassen hat.
Drei Zweige, von den kahlen Bäumen abgebrochen, lie-
gen im Schnee und zeigen in die Richtung, in die ich
gehen werde. Diese Sachen hinterlasse ich Gale am ers-
ten Sonntag nach dem Erntefest an unserem Treffpunkt.
Ich bin immer weiter durch die kalten, nebligen Wäl-
der gelaufen, auf einem Weg, den Gale nicht kennen wird,
der für meine Füße jedoch leicht zu finden ist. Er führt
zum See. Ich vertraue nicht mehr darauf, dass unser übli-
cher Treffpunkt Abgeschiedenheit bietet, doch genau das
und noch mehr brauche ich, um Gale heute mein Herz
auszuschütten. Aber wird er überhaupt kommen? Wenn
nicht, habe ich keine Wahl, dann muss ich mitten in der
Nacht zu ihm gehen. Es gibt etwas, das er wissen muss …
Er muss mir helfen, es zu verstehen …
In dem Moment, als ich begriff, was ich bei Bürger-
meister Undersee im Fernsehen sah, ging ich zur Tür und
durch den Flur. Gerade rechtzeitig, denn kurz darauf kam
der Bürgermeister die Treppe hoch. Ich winkte ihm zu.
135
»Suchst du Madge?«, fragte er freundlich.
»Ja. Ich möchte ihr mein Kleid zeigen«, sagte ich.
»Na, du weißt ja, wo du sie findest.« In dem Augenblick
kam wieder das Piepsen aus seinem Büro. Seine Miene
wurde ernst. »Entschuldige mich bitte«, sagte er. Er ging
in sein Arbeitszimmer und machte die Tür fest hinter sich
zu.
Ich wartete im Flur, bis ich mich wieder gefasst hatte.
Erinnerte mich daran, dass ich mich normal benehmen
musste. Dann ging ich zu Madge. Sie saß in ihrem Zim-
mer an der Kommode vor einem Spiegel und kämmte sich
das blond gewellte Haar. Sie trug dasselbe hübsche wei-
ße Kleid wie am Tag der Ernte. Sie sah mich im Spiegel
und lächelte. »Schau dich an. Als kämst du direkt von den
Straßen im Kapitol.«
Ich trat näher. Meine Finger berührten den Spotttöl-
pel. »Selbst meine Brosche passt jetzt. Spotttölpel sind im
Kapitol total angesagt, durch dich. Willst du die Brosche
wirklich nicht zurückhaben?«, fragte ich.
»Quatsch, ich hab sie dir geschenkt«, sagte Madge. Sie
band die Haare mit einem festlichen Goldband zurück.
»Woher hast du sie eigentlich?«, fragte ich.
»Sie hat meiner Tante gehört«, sagte sie. »Aber ich glau-
be, sie ist schon lange im Familienbesitz.«
136
»Merkwürdig, ausgerechnet ein Spotttölpel«, sagte ich.
»Ich meine, wegen der Rebellion. Da haben die Schnatter-
tölpel dem Kapitol doch einen Strich durch die Rechnung
gemacht.«
Die Schnattertölpel waren Mutationen, genetisch ver-
änderte männliche Vögel, die das Kapitol erschaffen hat-
te, um Rebellen im Distrikt auszuspionieren. Die Vögel
konnten sich viele Wörter merken und sie wiederholen,
deshalb wurden sie in die aufständischen Gebiete ge-
schickt, damit sie dem Kapitol berichten konnten, was
dort geredet wurde. Die Rebellen bekamen das spitz und
setzten die Schnattertölpel gegen das Kapitol ein, indem
sie ihnen lauter Lügen erzählten. Als das herauskam, ließ
man die Schnattertölpel aussterben. Binnen weniger Jahre
kamen sie in der Wildnis nicht mehr vor, doch zuvor hat-
ten sie sich mit weiblichen Spottdrosseln gepaart und eine
ganz neue Art erschaffen.
»Aber Spotttölpel sind nie als Waffe eingesetzt worden«,
sagte Madge. »Sie sind nur Singvögel. Oder?«
»Ja, das stimmt wohl«, sagte ich. Aber dem ist nicht so.
Eine Spottdrossel ist nur ein Singvogel. Ein Spotttölpel ist
ein Tier, das es nach dem Willen des Kapitols gar nicht
geben dürfte. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass der
streng überwachte Schnattertölpel so schlau sein würde,
137
sich an die Wildnis anzupassen, seinen genetischen Code
weiterzugeben, sich in neuer Gestalt weiterzuentwickeln.
Sie hatten nicht mit seinem Lebenswillen gerechnet.
Während ich jetzt durch den Schnee stapfe, sehe ich
die Spotttölpel, wie sie von Zweig zu Zweig hüpfen, wäh-
rend sie die Melodien anderer Vögel aufschnappen, sie
nachahmen und in etwas Neues verwandeln. Wie immer
erinnern sie mich an Rue. Ich denke an den Traum, den
ich letzte Nacht im Zug hatte, als ich sie in Gestalt eines
Spotttölpels sah und ihr folgte. Hätte ich doch noch ein
wenig länger geschlafen und herausgefunden, wohin sie
mich führen wollte.
Zum See ist es ein ganz schöner Marsch, keine Fra-
ge. Wenn Gale sich überhaupt entscheidet, mir zu folgen,
wird er sich darüber ärgern, dass er so viel Energie ver-
schwendet, die er besser auf die Jagd verwenden könn-
te. Es war auffällig, dass zu dem Festessen im Haus des
Bürgermeisters seine Familie gekommen ist, er selbst aber
nicht. Hazelle sagte, er sei krank, das war offensichtlich
gelogen. Beim Erntefestival konnte ich ihn auch nicht
entdecken. Vick hat mir erzählt, er sei auf der Jagd. Das
stimmte wahrscheinlich.
Nach einigen Stunden komme ich zu einem alten Haus
nah am Ufer des Sees. »Haus« ist vielleicht übertrieben. Es
138
besteht nur aus einem Zimmer, ungefähr vier Quadratme-
ter groß. Mein Vater meinte, dass es hier vor langer Zeit
viele Häuser gab – man kann noch Teile der Fundamente
sehen – und dass die Leute herkamen, um am See zu spie-
len und zu fischen. Dieses Haus hat die anderen überlebt,
weil es aus Beton erbaut wurde. Der Boden, das Dach, die
Decke. Nur eines der vier Glasfenster ist erhalten, es ist
mit der Zeit wellig und trüb geworden. Strom und flie-
ßend Wasser gibt es nicht, aber der Kamin funktioniert
noch, und in einer Ecke ist Holz aufgestapelt, das mein
Vater und ich vor Jahren gesammelt haben. Ich zünde
ein kleines Feuer an, der Nebel dürfte den verräterischen
Rauch verbergen. Während das Feuer anfangt zu brennen,
fege ich den Schnee weg, der sich unter den Fenstern ohne
Scheiben angesammelt hat; ich benutze dafür einen Rei-
sigbesen, den mein Vater mir gemacht hat, als ich unge-
fähr acht war und hier Vater-Mutter-Kind gespielt habe.
Ich setze mich auf die kleine Betonplatte des Kamins, las-
se mich am Feuer auftauen und warte auf Gale.
Überraschend schnell taucht er auf. Er trägt einen Bo-
gen über der Schulter und an seinem Gürtel hängt ein to-
ter Truthahn. Gale steht in der Tür, als überlegte er, ob er
hereinkommen soll oder nicht. Er hält den ungeöffneten
Lederbeutel mit Essen in den Händen, die Thermoskanne,
139
Cinnas Handschuhe. Geschenke, die er nicht annehmen
will, weil er so wütend auf mich ist. Ich weiß genau, wie es
in ihm aussieht. Habe ich nicht dasselbe mit meiner Mut-
ter gemacht?
Ich schaue ihm in die Augen. Seine Wut kann nicht
ganz überdecken, wie verletzt er ist, wie verraten er sich we-
gen meiner Verlobung mit Peeta fühlt. Dieses Treffen heute
ist meine letzte Chance, Gale nicht für immer zu verlieren.
Ich könnte ihm stundenlang al es erklären und selbst dann
noch könnte er mich zurückweisen. Stattdessen komme ich
direkt zum Hauptpunkt meiner Verteidigung.
»Präsident Snow hat mir persönlich damit gedroht,
dich töten zu lassen«, sage ich.
Gale hebt die Augenbrauen, aber richtig ängstlich oder
überrascht sieht er nicht aus. »Sonst noch jemanden?«
»Nun ja, er hat mir nicht direkt eine Liste überreicht.
Aber wir können wohl davon ausgehen, dass unsere beiden
Familien betroffen sind«, sage ich.
Jetzt kommt er doch zum Kamin. Er hockt sich vor das
Feuer und wärmt sich auf. »Es sei denn?«
»Kein ›es sei denn‹, so, wie es jetzt aussieht«, sage ich.
Das müsste ich natürlich genauer erklären, aber ich weiß
nicht, wo ich anfangen soll, also sitze ich nur da und starre
bedrückt ins Feuer.
140
Nach einer Weile bricht Gale das Schweigen. »Tja, dan-
ke für die Warnung.«
Ich drehe mich zu einer schroffen Erwiderung um, als
ich das Funkeln in seinen Augen sehe. Ich hasse mich da-
für, dass ich lächeln muss. An der Situation ist nichts Ko-
misches, aber es ist wohl ein bisschen viel auf einmal. Sie
werden uns alle auslöschen, ganz gleich, was passiert. »Ich
hab einen Plan, weißt du.«
»Ja, der ist bestimmt klasse«, sagt er. Er schmeißt mir
die Handschuhe auf den Schoß. »Da. Ich will keine abge-
legten Handschuhe von deinem Verlobten haben.«
»Er ist nicht mein Verlobter. Das ist Teil der Komödie.
Und die Handschuhe sind auch nicht von ihm. Sie haben
Cinna gehört«, sage ich.
»Dann gib sie wieder her«, sagt er. Er zieht die Hand-
schuhe an, bewegt die Finger und nickt anerkennend.
»Wenigstens werde ich mit warmen Händen sterben.«
»Sehr optimistisch. Du weißt ja gar nicht, was passiert
ist«, sage ich.
»Lass hören«, sagt er.
Ich fange mit dem Abend an, als Peeta und ich zu den
Siegern der Hungerspiele gekrönt wurden und Haymitch
mich vor dem Zorn des Kapitols warnte. Ich erzähle von
der Sorge, die mich nicht losließ, selbst als ich schon zu
141
Hause war, von Präsident Snows Besuch, den Morden in
Distrikt 11, den Spannungen in der Bevölkerung, dem al-
lerletzten Rettungsversuch durch die Verlobung, der An-
deutung des Präsidenten, dass es nicht gereicht hat, von
meiner Überzeugung, dass ich werde büßen müssen.
Gale unterbricht mich kein einziges Mal. Während
ich erzähle, steckt er die Handschuhe in die Tasche und
bereitet aus dem Essen im Lederbeutel eine Mahlzeit für
uns. Er röstet Brot und Käse, entkernt Äpfel, legt Kasta-
nien zum Rösten ins Feuer. Ich beobachte seine Hände,
seine schönen, geschickten Finger. Narbig, so wie meine
waren, ehe im Kapitol meine Haut geglättet wurde, aber
stark und flink. Diese Hände sind kräftig genug, Kohle zu
hauen, und fein genug, komplizierte Fallen zu bauen. Es
sind Hände, denen ich vertraue.
Ich halte inne und trinke einen Schluck Tee aus der
Thermoskanne, ehe ich von meiner Heimkehr erzähle.