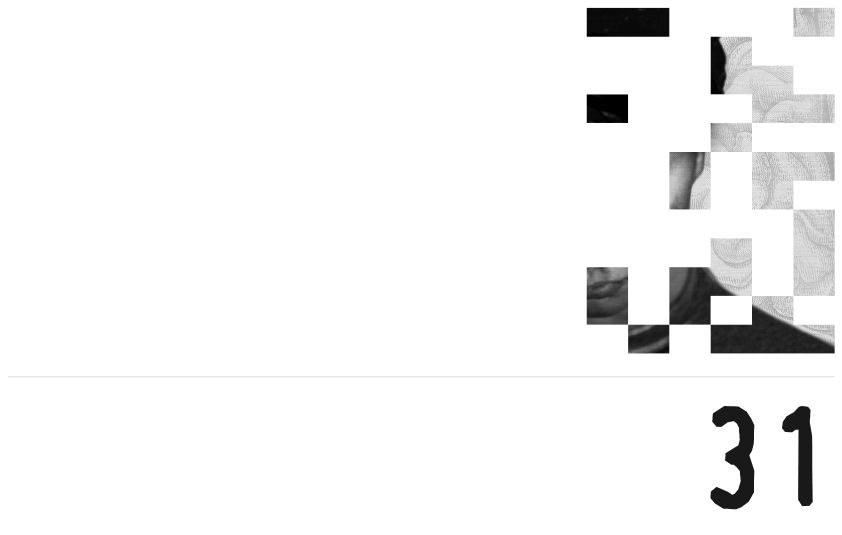
Thomas war entsetzt. Der Blick von Rothemd hatte etwas Sadistisches an sich, und Thomas sah schnell wieder weg und hinunter auf den infizierten Mann, dessen Füße gerade von dem blauen Gel eingeschlossen wurden. Er lag jetzt völlig bewegungslos in seiner harten Plastikhülle da. Die Frau mit der Gelkartusche, von der jetzt nur noch ein leerer Beutel übrig war, stand auf. Sie faltete ihn zusammen und steckte ihn in die Tasche ihres grünen Overalls.
»Schaffen wir ihn raus«, sagte sie.
Als die vier Arbeiter nach dem Infizierten fassten und ihn hochhoben, warf Thomas dem Rothemd einen schnellen Blick zu, der den anderen beim Abtransport des Gefangenen zusah. Was in aller Welt hatte er damit gemeint, er würde Thomas mitnehmen? Wohin? Und warum? Wenn er nicht eine Schusswaffe gehabt hätte, wäre Thomas weggerannt.
Als die Arbeiter in Grün zur Tür heraus waren, tauchte Minho wieder auf. Er wollte gerade das Café betreten, da zog Rothemd die Pistole.
»Stehen bleiben!«, schrie der Mann. »Verschwinde!«
»Aber wir gehören zu ihm.« Minho zeigte auf Thomas. »Und wir müssen dringend los.«
»Dein Kumpel muss nirgendwohin.« Er machte eine Pause, als denke er scharf nach. Er sah Thomas an, dann wieder Minho. »Einen Augenblick. Seid ihr Knilche etwa auch Munis?«
Panik überkam Thomas, aber Minho war schnell. Er zögerte keine Sekunde und raste davon.
»Stopp!«, brüllte Rothemd und sprintete zur Tür.
Thomas sprang zum Fenster. Er sah gerade noch Minho, Brenda und Jorge, wie sie über die Straße rannten und um die nächste Ecke verschwanden. Rothemd gab die Verfolgung schon direkt vor dem Café auf, wo er sich umsah und dann wieder hereinkam. Mit auf Thomas gerichteter Pistole.
»Am liebsten würde ich dir in den Hals schießen und zugucken, wie du verblutest, für das, was dein kleiner Freund sich da gerade geleistet hat. Du hast Glück, dass ihr Munis so kostbar seid. Sonst würde ich es tun, nur um meine Laune etwas aufzubessern. War ein Scheißtag heute.«
Thomas konnte nicht fassen, dass er nach allem, was er schon überstanden hatte, jetzt in eine derart absurde Situation geraten war. Es war einfach nur frustrierend. »Bei mir läuft es auch nicht gerade toll«, brummte er.
»Du bringst mir einen schönen Batzen Kohle. Alles andere ist mir egal. Und nur damit du’s weißt: Ich kann dich nicht leiden. Seh ich auf den ersten Blick.«
Thomas setzte ein Lächeln auf. »Da sind wir uns ja zum Glück mal einig.«
»Bist du komisch. Sehr witzig, ha ha. Warten wir mal ab, ob dir heute Abend immer noch zum Scherzen zu Mute ist. Komm schon.« Er zeigte mit seiner Waffe auf die Tür. »Und glaub’s mir, meine Geduld ist am Ende. Bei der geringsten falschen Bewegung wirst du von hinten erschossen. Der Polizei sage ich dann einfach, du hättest dich wie ein Infizierter verhalten und wärst weggerannt. Null-Toleranz-Politik. Für so was werde ich noch nicht mal verhört. Da kräht kein Hahn danach.«
Thomas stand ratlos da. Die Ironie der Situation war ihm mehr als bewusst: Er war ANGST entkommen, nur um jetzt von einem stinknormalen Angestellten der Stadt Denver gefangen genommen zu werden.
»Ich sag’s nicht noch mal«, warnte ihn Rothemd.
»Wohin gehen wir?«
»Das wirst du dann schon sehen. Und ich werde verdammt reich! Los jetzt.«
Zweimal war Thomas schon angeschossen worden; er wusste also genau, wie teuflisch weh das tat. Wenn er das nicht noch einmal erleben wollte, hatte er wohl keine andere Wahl, als mit dem Kerl mitzugehen. Er funkelte den Mann böse an und ging auf die Tür zu.
»Wo lang?«, fragte Thomas.
»Nach links. Geh immer schön langsam geradeaus, an der dritten Ecke biegen wir nach links ab. Da wartet ein Auto auf uns. Muss ich dich noch mal warnen, was passiert, wenn du irgendwelche krummen Dinger versuchst?«
»Nein, brauchen Sie nicht. Sie jagen einem unbewaffneten Jugendlichen von hinten eine Kugel in den Kopf. Völlig klar.«
»Ihr Munis seid echt zum Kotzen. Los, geh.« Er drückte Thomas den Pistolenlauf ins Kreuz, und Thomas ging die Straße hinunter.
Als sie an der dritten Straßenkreuzung angekommen waren, bogen sie nach links ab, ohne ein Wort zu wechseln. Die Luft war schrecklich schwül, und Thomas war von Kopf bis Fuß schweißbedeckt. Als er die Hand nach oben nahm, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, zog Rothemd ihm mit dem Pistolengriff eins über.
»Hey, lass das«, kommandierte der Mann. »Sonst werd ich nervös und puste dir ein Loch ins Hirn.«
Thomas musste all seine Willenskraft aufwenden, um nichts darauf zu erwidern.
Die Straße war wie ausgestorben, überall flog Müll herum. Sämtliche Wände waren mit Plakaten zugekleistert – manche warnten vor Dem Brand, andere zeigten Kanzlerin Paige – alle klebten in Schichten übereinander und waren vollgesprüht. Als sie an eine Kreuzung kamen und mehrere Autos durchlassen mussten, sah Thomas sich ein noch gut leserliches Plakat genauer an – wahrscheinlich war es ganz neu, da noch kein Graffiti darauf prangte. Er las sich die Warnung durch:
Öffentliche Bekanntmachung
!!!Der Brand muss gestoppt werden!!!
HELFEN SIE MIT. STOPPEN SIE DIE WEITERE AUSBREITUNG DES BRANDS. ERKENNEN SIE DIE SYMPTOME AN SICH SELBST, BEVOR SIE IHRE NACHBARN UND ANGEHÖRIGEN INFIZIEREN.
Der Brand ist der Brandvirus (VC321xb47), eine hoch ansteckende, künstlich erzeugte Krankheit, die während des Chaos zu Zeiten der Sonneneruptionen versehentlich freigesetzt wurde. Der Brand löst eine ständig fortschreitende, degenerative Erkrankung des Gehirns aus, die zu unkontrollierten Bewegungen, emotionaler Verwirrung und geistiger Desorientierung führt. Diese hat sich zur Brand-Pandemie ausgeweitet.
Mittlerweile sind die klinischen Versuchsreihen fast abgeschlossen, aber es gibt gegenwärtig noch keine zugelassene Behandlungsmethode für Den Brand. Die Erkrankung verläuft im Allgemeinen tödlich und kann durch die Luft übertragen werden.
Alle Bürger sind zur Zusammenarbeit aufgerufen, um die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Indem Sie erkennen, wann Sie selbst oder andere eine Virale Ansteckungsgefahr (VAG) darstellen, unternehmen Sie den ersten Schritt im Kampf gegen Den Brand.*
* Alle verdächtigen Personen sind umgehend zu melden.
Auf dem Plakat stand noch mehr, über die fünf- bis siebentägige Inkubationszeit und die Symptome – Reizbarkeit und Gleichgewichtsstörungen als frühe Warnsignale, gefolgt von Demenz, Verfolgungswahn und später extremen Aggressionen. Da Thomas schon oft genug mit Cranks zu tun gehabt hatte, kannte er die Symptome nur zu gut.
Rothemd versetzte Thomas einen kleinen Schubs, und sie gingen weiter. Thomas konnte nicht aufhören, über die grausigen Informationen auf dem Plakat nachzudenken. Dass die Krankheit von Menschen künstlich erzeugt worden war, bedrückte ihn nicht nur, sondern erinnerte ihn an irgendetwas, auch wenn er nicht richtig den Finger drauflegen konnte. Instinktiv wusste er, dass diese Aussage nicht die ganze Wahrheit darstellte. Zum ersten Mal seit Tagen wünschte er sich, er hätte einen Zugang zu seinen Erinnerungen, und wenn es noch so kurz war.
»Da wären wir.«
Die Stimme von Rothemd holte ihn zurück in die Gegenwart. Am Ende des Blocks parkte an die zwanzig Meter entfernt ein kleiner weißer Pkw. Verzweifelt versuchte Thomas, noch irgendeine Fluchtmöglichkeit zu finden – wenn er erst einmal in dem Auto saß, war womöglich alles vorbei. Aber wollte er wirklich riskieren, angeschossen zu werden?
»Du wirst dich jetzt ganz brav auf den Rücksitz setzen, und keine Fisimatenten«, sagte Rothemd. »Da liegt ein Paar Handschellen, die du dir selbst anlegst, und ich guck zu. Kriegst du das hin, ohne irgendwelchen Mist zu bauen?«
Thomas gab keine Antwort, sondern hoffte bloß, dass Minho und die anderen in der Nähe waren und irgendeinen Plan hatten. Er brauchte irgendetwas, um seinen Entführer abzulenken.
Sie gelangten ans Auto, und Rothemd zog eine Schlüsselkarte heraus, die er auf der Beifahrerseite an die Windschutzscheibe drückte. Die Schlösser gingen klickend auf, und er öffnete die hintere Tür, wobei er die ganze Zeit die Pistole auf Thomas gerichtet hielt.
»Steig ein. Immer schön sachte.«
Thomas zögerte und blickte suchend um sich. Da war nichts, niemand, die Gegend war wie ausgestorben. Doch aus dem Augenwinkel bemerkte er eine Bewegung: ein Flugobjekt, fast so groß wie ein Auto. Eine Polizeimaschine war zwei Häuserblocks entfernt um die Ecke geschwebt und kam jetzt auf sie zu. Das Brummen wurde beim Näherkommen lauter.
»Ich sagte, du sollst einsteigen«, wiederholte Rothemd. »Die Handschellen sind in der Ablage in der Mitte.«
»Da kommt eine Polizeimaschine«, wandte Thomas ein.
»Ja, na und? Die ist nur auf Patrouille. Die Autoritäten sind auf meiner Seite, nicht deiner. Pech gehabt, Kumpel.«
Thomas seufzte – einen Versuch war es wert gewesen. Wo waren bloß seine Freunde? Er blickte sich ein letztes Mal um, trat dann an die offene Wagentür und rutschte hinein. Im selben Augenblick ertönte auf einmal donnernder Schusslärm. Rothemd stolperte abgehackt zuckend vom Wagen zurück. Kugeln trafen seine Brust, Funken flogen, als sie die Metallmaske trafen. Er ließ seine Waffe fallen, und die Maske glitt herunter, als er gegen die Wand des nächsten Gebäudes krachte. Thomas sah mit sprachlosem Grauen, wie der Mann in sich zusammensackte und auf die Seite fiel.
Der Kugelhagel hörte mit einem Schlag auf. Thomas saß wie erstarrt da und wartete darauf, als Nächster erschossen zu werden. Er hörte den durchgehenden Brummton des Gleiters, der direkt neben seiner offenen Autotür schwebte, und ihm wurde klar, dass der Angriff von der Polizeimaschine gekommen war: Sie war zwar unbemannt, aber schwer bewaffnet. Auf dem Dach hatte sie einen Lautsprecher, aus dem jetzt eine Stimme drang.
»Steig sofort aus, Thomas.«
Thomas fuhr zusammen. Diese Stimme war unverwechselbar.
Es war Janson. Der Rattenmann.