Regel Nr. 10: Zu viel Vertraulichkeit schadet nur
Wenn man zu viel Zeit an einem Ort verbringt, wird man sorglos und geht das Risiko ein, entdeckt zu werden. Geh weiter. Bleib in Bewegung.
Strider, sein geliebtes Alter Ego. Sie hatten so viel zusammen durchgestanden. Mitchell konnte den Gedanken kaum ertragen, dass das alles jetzt zu Ende sein sollte. Er hatte die Superheldenidee nie wirklich umgesetzt, aber jetzt, wo er Zeit hatte, darüber nachzudenken, wurde ihm bewusst, dass er tatsächlich vieles mit seinen Comichelden gemein hatte: die schwierige Kindheit, die tragische Jugend, interessante Superkräfte, geheime Identitäten, dass er Unschuldigen half, die Bösen ausschaltete und die Welt rettete, ohne dafür Dank zu erwarten. Und jetzt hatte er sogar noch einen Erzfeind. Der Salesman hatte ihn angelogen. Der einzige Mensch, der wirklich wusste, zu was er fähig war, hatte ihn verraten.
Die ganze Zeit hatte Strider den Code entwickelt. Er hatte die Regeln geschliffen, die der Salesman ihm nahegelegt hatte, hatte seinen moralischen Rahmen angepasst und seine Methoden entsprechend der vom Salesman definierten Parameter entwickelt. Und nun musste er erkennen, dass der Salesman der Schlimmste von allen war – der Anführer von Black Flag. Bedeutete das etwa, dass Strider unwillentlich für diese Bande gearbeitet hatte? War der Code nichts als eine Lüge? War er wirklich nur ein Zahnrad in der finsteren Organisation des Salesman gewesen?
Ihm wurde ganz anders. Er weigerte sich, das zu glauben. Er war Strider. Er besaß Macht und Wissen. Er machte die Welt zu einem besseren Ort, und jetzt wollten sie ihn aufhalten. Der Salesman hatte den Code gebrochen. Das würde Strider ihm niemals vergeben.
Er ging auf dem Flur seiner Wohnung auf und ab und spürte den alten Holzfußboden unter seinen nackten Füßen. Er brauchte dieses Gefühl. Er durfte die Bodenhaftung nicht verlieren. Es gab noch sehr viel zu tun. Sie würden ihn jagen, aber sie wussten nicht, wer er war, noch wo er wohnte. Dafür war er viel zu clever.
Bereute er es, Sheila Davies ermordet zu haben? Nein. Die gute alte »Selma« hatte es nicht anders verdient. Er hätte nur gern mehr Zeit gehabt, um ihr zu folgen, insbesondere nach dem, was er jetzt wusste, aber er war sich nicht sicher, ob er je alles über sie herausgefunden hätte. Hätte er ihre Verbindung zum Salesman entdeckt? Und wenn ja – hätte das irgendetwas geändert?
Eines war sicher: Sheila Davies’ Aktivitäten hatten sich nicht auf die Leitung von Teddybärs Picknicknetzwerk beschränkt. Sie und Prince hatten Black Flag geholfen – und er, Mitchell, hatte es nicht erkannt. Er hatte es nicht gesehen, weil er von seinem früheren Mentor geblendet gewesen war. Nun fragte er sich, ob noch mehr Menschen, die er kannte, mit denen er zusammenarbeitete oder die er beobachtete, zum Netzwerk des Salesman gehörten. Gab es da draußen noch mehr sogenannte Freunde, die in Wahrheit zu Black Flag gehörten und ihn beobachteten?
Mitchell stand am hohen Fenster am Ende des Flurs und blickte hinunter auf die Straße. Dort waren zahllose Menschen unterwegs, die ihren Geschäften nachgingen und nicht auf ihn achteten. Oder sollte er das nur denken? Wollte man ihn nur in trügerischer Sicherheit wiegen?
Er bemerkte einen unscheinbaren weißen Van, der auf der anderen Straßenseite parkte. Der Fahrer lehnte sich an die Motorhaube und telefonierte. Wartete der Mann auf ihn, Strider? Er versuchte, das Nummernschild zu erkennen, aber es war zu schmutzig. Seltsam. Wer hatte mitten in der Stadt ein total verdrecktes Nummernschild?
Dann fiel ihm ein Mann auf, der von Tür zu Tür ging und etwas in jeden Briefkasten steckte. Und da war eine Frau, die mit ihrem Hund Gassi ging. Sie blieb stehen und schaute zu ihm hinauf. Mitchell trat rasch vom Fenster weg und presste sich mit dem Rücken an die Wand. Die Frau beobachtete ihn.
Zum ersten Mal im Leben hatte Mitchell das Bedürfnis, sämtliche elektronischen Geräte loszuwerden. Aber er wusste auch, dass er ohne sie nicht leben konnte. Und wenn er um sein Leben kämpfen wollte, konnte er es nur in der Arena tun, die ihm vertraut war: online. Dort war er als Strider in Sicherheit, aber wenn er als Mitchell durch die Tür nach draußen ging, war er nur ein ganz normaler Mann.
Würden sie wissen, wer er war? Musste Mitchell den Preis für Striders Taten bezahlen? Er hatte es immer genossen, sein sogenanntes normales Leben mit seinem virtuellen Leben auszugleichen. Vielleicht musste er das normale Leben opfern, um im virtuellen Raum zu überleben. Würde jemand bemerken, wenn Mitchell einfach verschwand?
Als er die Antwort auf diese Frage fand, traf es ihn wie ein Blitzschlag. Der Salesman hatte gesagt, Strider sei jetzt ganz alleine, aber das stimmte so nicht: Er hatte noch Mitchell – ein Mann, der Teil eines Teams war. Und dieses Team jagte Black Flag. Natürlich würde man bemerken, wenn Mitchell verschwand. Seine Kollegen bei der NCCU hatten gerade erst Sheila Davies verloren und waren dabei, einen potenziellen Angriff durch Terroristen abzuwehren, daher brauchten sie jede Hilfe, die sie bekommen konnten.
Nein, Mitchell konnte nicht einfach verschwinden. Wenn er nicht zur Arbeit ging, noch dazu mitten in einer solchen Krise und an dem Tag, an dem Sheila Davies gestorben war, würde er alle Blicke auf sich ziehen. Und das dufte nicht geschehen. Sie mussten Black Flag im Auge behalten.
Er holte sein Arbeitshandy heraus und schaute nach, ob er Anrufe verpasst hatte. Doch es wurde nur die Nummer der NCCU-Zentrale angezeigt, über die um kurz nach neun jemand angerufen hatte. Wer hatte versucht, ihn zu erreichen? Sheila Davies war die Einzige, die ihn je außerhalb der Arbeitszeit angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, was in der Abteilung los war.
Wieder kochte die Enttäuschung über ihren Verrat in ihm hoch. Sie hatte ihn benutzt. Sie hatte ihm das Gefühl vermittelt, auf seiner Seite zu stehen, hatte ihm Rückendeckung gegeben und ihn vor Franklins Misstrauen verteidigt, damit er mit jeder Information immer zuerst zu ihr kam. Er dachte daran, wie oft er ihr Daten über die Mitglieder von Black Flag oder deren Aktivitäten vorgelegt hatte, die jedoch nie wirklich schlüssig gewesen waren. Sie musste sich innerlich totgelacht haben, wenn er wieder mit neuen Beweisen vor ihr stand.
Tja, jetzt lachte sie nicht mehr.
Vielleicht war es gut, dass Sheila gewusst hatte, wer ihr Mörder war. In ihren letzten Minuten hatte sie definitiv nicht gelacht. »Dafür wirst du bezahlen«, hatte sie gesagt und würde möglicherweise recht behalten: Sie waren hinter ihm her, doch er würde bereit sein. Er musste seine Stärken ausspielen, und seine größte Stärke war Mitchell. Sein Mann vor Ort. Mitchell würde eine Reihe von Fortschritten im Kampf gegen Black Flag erzielen – und mit ein wenig Hilfe konnte die NCCU dieses Mal vielleicht sogar siegen.
Er drückte die Rückruftaste. Als die Rezeptionistin der NCCU in der Zentrale sich meldete, war er bereit, seine Rolle zu spielen.
»Sheila Davies bitte, hier spricht Mitchell«, sagte er.
»Warten Sie bitte«, erwiderte die Rezeptionistin mit erstickter Stimme.
Mitchell verbrachte ein paar Sekunden in der Warteschleife und hörte Digitalmusik, bis er ein Klicken vernahm.
»Mitchell?« Es war Franklin.
»Ja.«
»Hier Franklin. Wo stecken Sie? Wir rufen Sie seit Stunden an.«
»Tut mir leid, aber ich bin Spuren in der Prince-Sache nachgegangen und habe darüber offenbar die Zeit vergessen. Ich wollte Selma gerade Bescheid sagen, dass ich unterwegs bin. Ich habe einiges herausgefunden, das Sie sich ansehen müssen.« Er gab sich größte Mühe, sich nichts anmerken zu lassen und wegen seines »Durchbruchs« ein wenig Erregung in seine Stimme zu legen.
»Mitchell«, sagte Franklin betrübt. »Es gab einen Autounfall. Sheila Davies … sie ist tot. Sie müssen sofort herkommen.«
»Sheila ist tot?« Mitchell klang ungläubig. »Wie? Ich meine …«
»Ein Autounfall. Heute Morgen.«
Mitchell wusste, dass er darauf nur mit Schweigen reagieren konnte. Er wartete, bis Franklin wieder etwas sagte.
»Wie schnell können Sie hier sein?«, wollte er wissen.
»Ich … bin schon unterwegs«, erwiderte Mitchell mit verstörter Stimme.
Franklin legte auf, ohne noch etwas zu sagen.
Mitchell stellte sich vor, wie es gerade im Büro der NCCU zuging. Er malte sich die schockierte Stille aus, während Sheilas Freunde und Kollegen versuchten, die Nachricht von ihrem Tod zu verarbeiten. Er stellte sich ihre Kommentare hinsichtlich des Zeitpunkts vor, und die vielen Fragen. Sie würden nicht begreifen, wieso es passiert war – das taten die Leute nie.
Mitchell wusste, dass er von dem Moment an, in dem er das Büro betrat, auf der Hut sein musste. Er musste den Schock und die Fassungslosigkeit der anderen teilen, zugleich aber zu demjenigen werden, der ihnen die Augen öffnete, wer Sheila Davies wirklich gewesen war.
Es wird Zeit, dass die NCCU alles über Black Flag herausfindet, überlegte er. Na ja, fast alles.
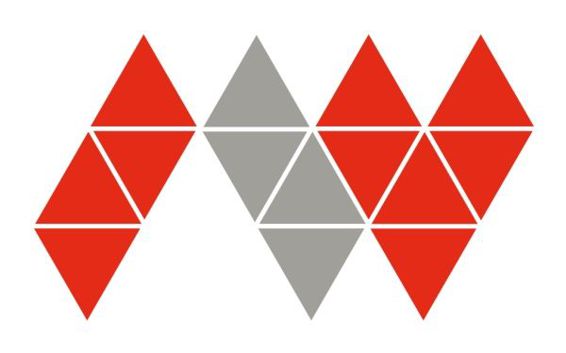
Rebecca und Roche waren zufrieden. In der kurzen Zeit im Kraftwerk hatten sie getan, was sie konnten, um sicherzustellen, dass keine direkte Gefahr durch einen Cyberangriff mehr drohte. Um die Mittagszeit fuhren sie in Roches kleinem Mietwagen los. Rebecca hatte ihren Sitz so weit wie möglich nach hinten geschoben, aber ihre Knie drückten noch immer gegen das Handschuhfach. Sie musste lächeln, als Roche mit dem Schaltknüppel kämpfte und vom zweiten in den dritten Gang wechselte, woraufhin der Wagen einen Satz machte, als Roche von der Kupplung ging.
»Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt«, zog sie ihn auf.
»Sehr witzig. Ich fahre sonst Automatik«, erwiderte er, schien ihr die Stichelei aber nicht übel zu nehmen.
»Das ist nicht Ihr Ernst«, entgegnete sie.
An diesem Morgen war ihr klar geworden, dass man mit Roche tatsächlich Spaß haben konnte, wenn man ebenso taktlos war wie er. Inzwischen musste sie Mitchell beipflichten: Roche war okay, wenn man ihn erst besser kennengelernt hatte.
Wieso dachte sie schon wieder an Mitchell? Seit sie am Vorabend in den Zug nach Selby gestiegen war, hatte sie öfters an ihn denken müssen. Nun bereute sie es, ihn nicht nach seiner Telefonnummer gefragt zu haben. Sie hätte zu gern gewusst, welche Beweise er auf Prince’ Laptop gefunden hatte und was die NCCU inzwischen über Prince’ Verbindung zu Black Flag herausgefunden hatte.
»Haben Sie Franklin noch erreicht?«, erkundigte sie sich in beiläufigem Tonfall.
»Ich hab’s nicht noch mal versucht«, antwortete Roche. »Ich hab ihm eine Nachricht hinterlassen. Wenn er was von mir will, soll er mich anrufen.«
»Finden Sie nicht, wir sollten ihm sagen, was wir herausgefunden haben?« Rebecca wurde bewusst, dass sie sich wie ein Kind anhörte, das keinen Ärger mit seinem Lehrer haben wollte, aber sie wusste nicht, wie die Hierarchie bei der NCCU funktionierte. Roche musste das Team doch bestimmt über die neuen Erkenntnisse informieren, oder? Sie war überzeugt, dass die Verbindung zwischen Bacchus Enterprises, den verschwundenen Containern, dem Nebengleis und dem Lagerhaus von Prime Logistics für einen Durchsuchungsbefehl reichte.
»Wir haben nichts herausgefunden«, stellte Roche klar. »Noch nicht.«
»Ich bin immer noch der Ansicht, dass wir nicht zu dem Lagerhaus fahren sollten«, beharrte Rebecca. »Jedenfalls nicht alleine. Was ist, wenn wir sie auf frischer Tat ertappen? Das sind Verbrecher. Diese Leute könnten uns umbringen.«
»Sie schauen sich zu viele Gangsterfilme an.« Roche grinste. »Außerdem werden wir das Lagerhaus ja nicht betreten, wir fahren nur daran vorbei. Okay, kann sein, das ich ein bisschen langsamer fahre, oder wir fahren sogar ran und vertreten uns am Straßenrand ein wenig die Beine. Leute, die lange unterwegs sind, tun das nun mal. Besonders, wenn sie in einem so kleinen Karren sitzen wie dem hier.«
Er setzte den Blinker, worauf es im Wagen laut klickte, und fuhr von der doppelspurigen Schnellstraße auf eine Bundesstraße.
»Okay. Aber ich bleibe im Wagen. Und um es noch mal zu sagen: Ich halte das für eine dumme Idee«, betonte sie. Doch insgeheim war sie gespannt darauf, ob sie nicht doch etwas fanden, das der NCCU helfen konnte, diese Leute festzunageln. So etwas kannte Rebecca sonst nicht. Sie kam sich ein bisschen so vor wie im Film, als wären sie unterwegs, um sich die Bösen zu schnappen, ohne Verstärkung und unbewaffnet. Ohne Verstärkung und unbewaffnet … war das in Filmen nicht immer der klassische Fehler?
Die ganze Sache war völlig verrückt. Was dachten sie sich nur dabei?
»Ich finde, wir sollten Franklin wenigstens informieren, dass wir auf dem Rückweg sind«, sagte sie. »Wir könnten erwähnen, dass wir etwas Verdächtiges in Bezug auf das Gleis herausgefunden haben und dort vorbeifahren, um es uns es anzuschauen.« Rebecca versuchte, nüchtern und praktisch zu argumentieren, fragte sich aber, ob sie nicht eher naiv wirkte.
»Wenn es Sie glücklich macht«, erwiderte Roche, fischte sein Handy aus der Hosentasche und reichte es ihr. »Franklin ist unter ›Boss‹ gespeichert. Stellen Sie auf Lautsprecher, okay?«
Rebecca nahm das Handy, fand die Nummer und wählte.
»Roche?« Franklins Stimme klang müde.
»Sir, wir wollten Sie nur kurz über unsere Lage hier informieren.«
»Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten.«
»Es ist nicht so schlimm, wie wir dachten, falls es Sie beruhigt«, meinte Roche fröhlich.
»Lassen Sie hören.«
»Wir sind bald im Kraftwerk fertig.« Roche zwinkerte Rebecca zu und bezog sie damit in die Lüge ein. »Sie sind dort so sicher, wie es nur geht, bis sie alle Systeme aktualisiert haben. Zumindest ist die Gefahr jetzt nicht mehr größer als vor dem Diebstahl der Datenbank.«
»Ist das Ihre Version einer guten Neuigkeit?«, fragte Franklin spitz.
»Wir konnten mehrere Verbindungen aufdecken, Sir, die unserer Meinung nach weitere Nachforschungen erfordern.«
Rebecca hielt ihm das Handy unter das Kinn, während er den Wagen lenkte.
»Ist es etwas Dringendes?«, erkundigte Franklin sich angespannt. »Mir stehen hier momentan nicht gerade viele Ressourcen zur Verfügung.«
»Nein, das kann warten. Wir wollten Sie nur darüber informieren, dass wir eine Verbindung zwischen einigen Containern am Hafen und einem Lagerhaus entdeckt haben. Wir dachten, wir sehen uns das mal an, da wir ohnehin in der Nähe sind.«
»Ich brauche Sie hier, Roche.«
»Wir fahren da wirklich nur vorbei, Sir, und sehen uns die Sache mal an«, erwiderte er abwehrend.
»Jetzt halten Sie mal den Mund, und hören Sie zu!«, fauchte Franklin.
Rebecca zog die Augenbrauen hoch, doch Roche schwieg.
»Sheila Davies hatte heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall«, fuhr Franklin fort. »Sie ist tot, Roche. Ich brauche meine Leute hier.«
»Großer Gott! Sind Sie sicher?«
Als Reaktion auf Roches dumme Frage herrschte Schweigen. Rebecca starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Sheila Davies war tot?
»Ja, Roche, überraschenderweise bin ich mir sicher.«
»Tut mir leid, Sir. Aber … du meine Güte.«
»Wir sind hier unterbesetzt, Roche. Ich brauche Sie hier, also gondeln Sie nicht in der Gegend herum. Führen Sie Ihre Arbeit im Kraftwerk zu Ende, und schwingen Sie Ihren Hintern wieder hierher. Haben Sie verstanden?«
»Ja, Sir. Wir sind morgen früh wieder im Büro.«
Franklin verabschiedete sich nicht, sondern legte einfach auf. Rebecca blickte Roche an und versuchte einzuschätzen, wie sehr ihn die Nachricht von Sheila Davies’ Tod getroffen hatte.
»Großer Gott«, sagte er erneut, dieses Mal deutlich leiser.
Sie reichte ihm das Handy zurück. »Standen Sie sich nahe?«
»Nein, natürlich nicht«, erwiderte er. »Selma war eine Hexe. Aber trotzdem … Sie war noch da, als wir losgefahren sind, und jetzt ist sie tot. Das ist ganz schön krass.«
Sie fuhren einige Zeit, ohne dass einer von ihnen etwas sagte. Rebecca war erleichtert, dass sie Roche nicht trösten musste; sie hätte nicht gewusst, wie sie es anstellen sollte. Sie überlegte, ob sie das Radio einschalten sollte, um die gedrückte Stimmung ein wenig zu heben. Stille machte sie stets nervös, besonders in der Gegenwart Fremder.
»Das muss es sein«, sagte Roche plötzlich aufgeregt.
Rebecca schaute in die Richtung, in die er blickte. Ein Stück von der Straße entfernt stand ein großes, mit Metallplatten verkleidetes Lagerhaus einsam auf den grünen Feldern von Yorkshire. Doch es war kein Schild zu sehen, das einen Hinweis auf den Eigentümer des Lagerhauses gab.
Roche setzte den Blinker. Offenbar wollte er auf die Straße abbiegen, die zum Lagerhaus führte.
»Ist das nicht zu offensichtlich?«, erkundigte sich Rebecca.
Roche ignorierte sie und bog ab.
»Sie können doch nicht bis vor die Tür fahren«, protestierte Rebecca. »Das ist doch verrückt.«
»Wieso? Heutzutage leiten einen die Navis über die merkwürdigsten Strecken.«
»Sie haben kein Navi.«
»Das wissen die aber nicht.«
Er fuhr jetzt sehr langsam. Rebecca befürchtete, dass sie dadurch noch auffälliger wurden. Ungefähr zwanzig Meter vom Tor des Lagerhauses entfernt verringerte Roche die Geschwindigkeit noch mehr, fuhr an den Straßenrand und stellte den Motor ab.
»Was tun Sie?«, fragte Rebecca verwirrt.
»Vertrauen Sie mir einfach, okay? Ich habe so etwas schon mal gemacht.« Er lehnte sich nach hinten, hob seinen Laptopkoffer hoch und nahm seinen Ausweis heraus.
»Wirklich?«
»Nein«, erwiderte er mit frechem Grinsen. »Aber ich wollte es schon immer mal tun. Sie bleiben hier.«
Er öffnete die Tür und stieg aus, bevor sie einen Ton herausgebracht hatte.
»Roche!«, protestierte sie. »Wir wollten doch nur am Lagerhaus vorbeifahren!« Doch er hatte die Tür schon zugeknallt. Rebecca schäumte vor Wut. Was für ein Idiot, ging es ihr durch den Kopf.
Roche drehte sich noch einmal zu ihr um, reckte den Daumen in die Luft und marschierte dann auf das Tor zu. Rebecca fragte sich beunruhigt, was er vorhatte. Sie sah, wie er dem Wachmann, der ans Tor gekommen war, seinen NCCU-Ausweis zeigte. Dann unterhielten sich die beiden. Rebecca hätte zu gerne gewusst, was Roche erzählte. Er hielt seinen Ausweis noch immer auf Augenhöhe.
Sie konnte durch die Windschutzscheibe erkennen, dass vor dem Lagerhaus und auf der asphaltierten Fläche dahinter Container gestapelt waren. An einem Ende waren zwei gelbe Kräne zu sehen. Rebecca vermutete, dass dort auch die Bahngleise verliefen.
Nach kurzer Diskussion öffnete der Wachmann das kleinere Tor, das in das größere eingelassen war, und ließ Roche hinein. Die beiden Männer wechselten noch ein paar Worte, dann folgte Roche dem Wächter, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Kurz bevor sie aus ihrem Blickfeld verschwanden, drehte Roche sich zu Rebecca um und nickte entschlossen.
War das ein Signal? Wollte er ihr damit zu verstehen geben, dass sie die Gelegenheit nutzen und sich umsehen sollte? Wo, zum Teufel, ging er hin?
Rebecca wartete kurz, aber dann gewann ihre Neugier die Oberhand.
»Ach, verdammt«, murmelte sie, stieg aus und ging langsam auf das Tor zu. Das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Das ist lächerlich, sagte sie sich. Warum hast du Angst? Das ist doch nur ein Lagerhaus.
Oder nicht?
Sie eilte zum Tor und ging durch den schmalen Durchlass, während sie sich nach Roche und dem Wachmann umsah. Die beiden Männer näherten sich gerade zwei Standard-Containern, die neben dem Lagerhaus standen, und drehten sich nicht um.
Rebecca betrat den Platz vor dem Lagerhaus und schaute zu der Glastür hinüber, die in die Wellblechwand eingelassen war. Auf einem kleinen weißen Sticker auf der Innenseite war das Logo von Prime Logistics zu sehen. Also waren sie wenigstens am richtigen Ort. Rebecca ging auf die Tür zu und schaute ins Innere des Lagerhauses, konnte aber nur einen verlassenen Schreibtisch sehen. Offensichtlich empfing man hier keine Kunden. Rasch lief sie um die Seite des Gebäudes herum zu der Stelle, an der sie die Kräne gesehen hatte.
Als sie um die Ecke bog, stellte sie fest, dass hier reges Treiben herrschte. Ein Hubwagen lud Container von drei Lkws auf einen wartenden Zug, und die riesigen Ladetüren in der Rückwand des Lagerhauses standen offen. Rebecca konnte von der Stelle, an der sie stand, nicht richtig hineinschauen und ging ein Stück weiter vor. Sie drückte den Rücken flach an die Wand, damit man sie vom Hubwagen aus nicht sehen konnte. Nach zwei weiteren Schritten konnte sie direkt ins Lagerhaus blicken, musste jedoch enttäuscht feststellen, dass es nur voller Container war. Sie wusste selber nicht, was sie erwartet hatte.
Am anderen Ende der Verladerampe war eine Tür zu sehen, die in einen anderen Bereich führte, aber Rebecca wollte das Lagerhaus auf keinen Fall betreten. Irgendwo tief im Inneren des riesigen Gebäudes konnte sie ein Läuten wie von einer Fahrradklingel hören. Von dem, was jenseits der Rampe passierte, war nichts zu sehen. Rebecca zog ihr Smartphone hervor und schoss rasch ein paar Fotos vom Zug, den aufgeladenen Containern, dem Inneren der Verladerampe und der kleinen Tür dahinter.
Ein lautes, metallisches Geräusch ließ sie zusammenfahren. Der Hubwagen hatte einen Container angehoben, der sich jetzt direkt über ihrem Kopf befand. Das gefiel ihr gar nicht. Sie sollte überhaupt nicht hier sein. Rasch drehte sie sich um und hoffte, unbemerkt wieder nach draußen schlüpfen zu können, aber es war zu spät. Ein Mann in einer gelben Sicherheitsweste kam auf sie zu.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er mit abweisender Stimme.
Rebecca hielt die Hände hoch, als würde er mit einer Waffe auf sie zielen.
Aus und vorbei, schoss es ihr durch den Kopf. Sie war beim Herumschnüffeln erwischt worden und hatte es vermasselt.
»Ich suche … äh, meinen Partner«, antwortete sie ausweichend.
»Sie dürften gar nicht hier sein«, sagte der Mann ungehalten, nahm ihren Arm und führte sie um die Gebäudeecke. Als Rebecca das Tor und ihren kleinen gelben Wagen sah, wäre sie am liebsten losgerannt, aber sie riss sich zusammen.
In diesem Moment kam ein kleiner, hässlicher Kerl mit Glatze durch die Glastür nach draußen gerannt.
»He, Sie!«, rief er und kam auf sie zu.
Rebecca zuckte zusammen. Der Glatzkopf kam schnell näher. Er sah wütend aus. Ohne nachzudenken, riss Rebecca den Arm aus dem Griff des Wachmannes und rannte los. Sofort hörte sie die Schritte der Männer hinter sich, als sie die Verfolgung aufnahmen. Eigentlich war Rebecca eine gute Läuferin, aber sie hatte die falschen Schuhe an. Sie würde es nicht schaffen. Als sie einen gehetzten Blick über die Schulter warf, hatte der Glatzkopf sie fast schon erreicht. Er stürzte sich auf sie, und sie ging schreiend zu Boden.
Der Mann überwältigte sie, hielt ihre Arme hinter ihrem Rücken fest und zerrte sie auf die Beine. Ein stechender Schmerz zuckte ihr durch einen Arm.
»Lassen Sie mich los!«, rief sie und wehrte sich gegen seinen festen Griff. Aber der Mann war viel zu kräftig. Rebecca schrie vor Schmerz, als er ihre Hand noch weiter nach oben drückte. Er würde ihr den Arm brechen.
»Bewegung«, sagte der Glatzkopf barsch und schob sie auf die schmale Glastür zu.
»Das können Sie nicht machen«, protestierte Rebecca. Ihr Herz raste, und ihr stieg das Blut ins Gesicht. Sie hatte Angst. Der Mann drückte sie mit seinem Körper gegen die Wand, während er seinen Ausweis durch das Lesegerät neben der Tür zog. Ein mechanisches Summen gab ihm zu verstehen, dass die Tür offen war. Er stieß sie mit dem Fuß auf und schob Rebecca rücksichtslos hindurch. An der nächsten Tür tat er dasselbe, nur dass er dort einen Code über ein silbernes Tastenfeld eingeben musste.
Er führte Rebecca in einen dunklen Korridor aus Fertigbauwänden, der sich über die gesamte Länge des Lagerhauses erstreckte. Auf beiden Seiten befanden sich identische Türen. Wieder, ganz leise, konnte Rebecca eine Fahrradklingel hören. Was für ein seltsames Geräusch für ein industriell genutztes Gebäude. In den Jahren, die sie für PrinceSec arbeitete, hatte sie viele Lagerhäuser und Fabriken von innen gesehen. Ihr Job erforderte häufig, dass sie herumgeführt wurde, damit sie dafür sorgen konnte, dass die elektronischen Systeme effektiv arbeiteten. Viele Gebäude, die sie gesehen hatte, enthielten zur Hälfte Büros, während die andere Hälfte als Lager genutzt wurde.
Doch als sie nun den Gang betraten, spürte Rebecca den Unterschied. Hier, im hinteren Teil der Halle, hatte sie nicht mehr das Gefühl, sich in einem Lagerhaus für Container zu befinden. Stattdessen hatte der Gang mit den vielen identischen, nicht gekennzeichneten Türen etwas Bedrückendes an sich. Rebecca bereute, dass sie aus dem Auto ausgestiegen war. Warum hatte Roche auch darauf bestanden, dass sie hierherfuhren?
Der Geruch, der hier vorherrschte, erinnerte sie an die Jugendherbergen, in denen sie während ihrer Kindheit so oft gewesen war: muffig und leicht süßlich. Ein Geruch nach vielen Menschen, die auf engem Raum zusammenlebten. Rebecca vermutete, dass einige Arbeiter hier untergebracht waren, vielleicht die, die offiziell gar nicht hier arbeiteten. Illegale. So etwas hatte sie früher schon gesehen.
Was würde der Glatzköpfige hier drin mit ihr anstellen? Panik erfasst Rebecca. Sie versuchte, die Absätze in den Boden zu stemmen und sich mit aller Macht gegen ihn zu wehren, als er sie durch den Korridor schob, aber sie war ihm nicht gewachsen. Unbarmherzig drängte er sie weiter. Sein Atem, der nach kaltem Rauch roch, wehte feucht und heiß gegen ihre Wange.
Endlich hatten sie die letzte Tür auf dem Gang erreicht. Wieder drückte der Mann Rebecca gegen die Wand, als er aufschloss. Kaum war die Tür offen, schnappte Rebecca vor Schreck nach Luft. In dem Raum saß Roche zusammengesunken auf zwei Stühlen, die Hände gefesselt. Er schien bewusstlos zu sein, und sein Gesicht war voller Blut.
Wieder schrie Rebecca, auch wenn sie wusste, dass es sie nicht retten würde.
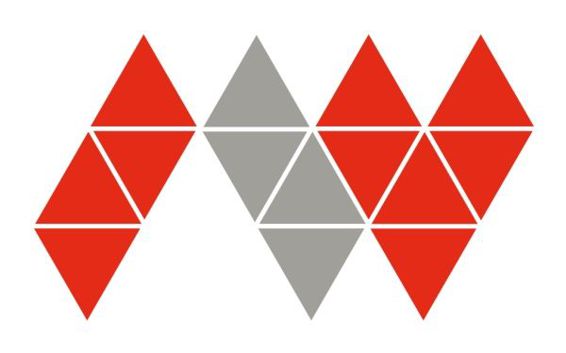
Willis ließ sich auf das Sofa in Franklins Büro sinken. Es war bereits Nachmittag, und er hatte seit der Beweissicherung an der Unfallstelle an diesem Morgen durchgearbeitet. Schließlich wollte er Franklin möglichst bald Antworten liefern, damit sein Team weiterarbeiten konnte. Aber Willis war immer nur auf neue Fragen gestoßen.
Seufzend zog er seinen Aktenkoffer auf den Schoß, nahm mehrere Ordner heraus und stapelte sie neben sich. »Wie geht es Ihnen, Oscar?«, fragte er dabei. Er wusste nur zu gut, wie der Tod eines Teammitglieds die Moral beeinflussen konnte, insbesondere, wenn das Team ohnehin schon unter Stress stand.
»Ehrlich gesagt erscheint mir das alles ziemlich unwirklich«, antwortete Franklin. »Ich glaube, die meisten von uns haben es noch gar nicht richtig begriffen. Nicht mal das halbe Team ist heute hier, deshalb kommt es mir hier ohnehin schon wie auf einem Geisterschiff vor. Was haben Sie für uns?« Ohne sein sonstiges Gehabe wirkte Franklin viel kleiner, unscheinbarer.
Willis hob den ersten Ordner hoch und hielt ihn kurz auf seinem Schoß fest. »Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen, Oscar«, begann er. »Aber es könnte nicht ganz einfach für Sie werden.«
Franklin setzte sich ihm gegenüber und strich sich mit den Händen übers Gesicht. Er wirkte verstört. »Inwiefern?«, wollte er wissen.
»Ich habe einige Probleme mit der Unfallstelle, die ich mit Ihnen durchgehen wollte, bevor ich Ihnen sage, was ich denke«, antwortete Willis. »Ist das okay für Sie?« Er schaute Franklin fragend an. Als dieser nickte, legte Willis die Fotos vom Tatort auf den niedrigen Tisch zwischen ihnen. Franklin schaute sich jedes Bild an. Die Fotos waren aufgenommen worden, nachdem man die Leiche abtransportiert hatte; Willis wollte Franklin die Sache nicht noch schwerer machen, als sie ohnehin schon war.
»Mein erstes Problem ist das Timing«, erklärte Willis. »Und damit meine ich nicht, dass Sheila keine zwei Tage nach Prince’ Flugzeugabsturz einen tödlichen Autounfall hatte. Solche Zufälle gibt es, das ist mir klar. Aber das hier geschah heute Morgen vor sechs Uhr.« Er blickte Franklin an, der noch immer stirnrunzelnd auf die Fotos starrte.
»Es war so gut wie kein Verkehr, und eilig wird sie es auch nicht gehabt haben«, fuhr Willis fort und legte ein körniges Schwarz-Weiß-Foto zu den anderen Bildern. »Die Radarfalle hat sie mit fünfundsechzig Meilen pro Stunde geblitzt. In einer Dreißigerzone. Warum sollte sie um sechs Uhr früh so schnell fahren?«
»Vielleicht, weil sie es konnte.«
»Tja, Sie kannten Sheila besser als ich«, erwiderte Willis. »Aber ich bin häufiger mit ihr mitgefahren. Sie hat auf mich nie den Eindruck einer Raserin gemacht.« Er zog weitere Fotos aus dem Ordner neben sich und drehte sich wieder zum Tisch um.
»Okay, lassen wir das mal außen vor und konzentrieren wir uns auf etwas anderes.« Er unterstrich jedes seiner nächsten Worte, indem er ein kleines eckiges Bild nach dem anderen auf den Tisch legte, immer schön nebeneinander. »Bei einer Geschwindigkeit von über fünfundsechzig Sachen schert der Wagen auf einmal nach links aus. Sehen Sie das? Als hätte etwas im Weg gestanden. Aber sie tritt erst zwei oder drei Sekunden später auf die Bremse. Das ist doch seltsam, finden Sie nicht? So etwas bekommen wir nicht allzu häufig zu sehen. Wenn einem etwas vor den Wagen läuft, tritt man eigentlich sofort auf die Bremse und reißt das Lenkrad herum. Aber hier kommt erst der Schlenker und später das Bremsen. Können Sie mir so weit folgen?«
»Ich glaube schon. Nur weiter«, sagte Franklin.
»Dann wäre noch das hier.« Willis reichte ihm ein Foto von den Blutspritzern auf den Glasscherben unter dem Fenster auf der Fahrerseite. »Blutstropfen auf dem Glas unterm Fenster. Genau, wie zu erwarten war. Größe und Form der Tropfen deuten auf eine schwächer werdende Blutung hin, daher können wir davon ausgehen, dass ihr Herz stehen geblieben ist, kurz nachdem der Wagen zum Stillstand gekommen war. Aber jetzt kommt das Seltsame. Wenn man sich den Tatort von oben ansieht, kann man deutlich Spuren in den Glassplittern rings um das Fahrzeug erkennen. Ich würde sagen, es handelt sich um Fußspuren. Hier ist eine Draufsicht.« Er legte drei weitere Bilder vor Franklin auf den Tisch: die Szene von oben und zwei Nahaufnahmen der Glassplitter.
»Sehen Sie das?« Willis deutete auf drei einzelne, kaum erkennbare Punkte rings um den Wagen. Franklin starrte mit zusammengekniffenen Augen auf die Fotos.
»Weder mein Team noch der erste Zeuge oder die Rettungssanitäter sind um den Wagen herumgegangen. Aber wie kommen die drei einzelnen Glassplitter mit dem Blut darauf auf die Beifahrerseite? Ich bin der Ansicht, dass sie unbeabsichtigt an einem Schuh dorthin getragen wurden.«
»An wessen Schuh?«
»Das weiß ich nicht, aber sehen Sie sich das an«, fuhr Willis fort. »Diese beiden Bilder zeigen etwas, das eine Reifenspur am Rand der Glassplitter sein könnte. Wir wissen mit Sicherheit, dass keine Fahrzeuge in den Tunnel gefahren sind, nachdem der Taxifahrer uns benachrichtigt hatte. Er hat den Tunnel mit seinem Wagen blockiert, bis der Einsatzwagen vor Ort war, und der ist nicht bis an die Unfallstelle herangefahren.«
Willis lehnte sich zurück und beobachtete Franklin, der eines der Fotos aufnahm, um es sich genauer anzuschauen.
»Was hat das zu bedeuten, Jack?«, fragte er.
»Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist noch jemand vor dem Taxi an der Unfallstelle gewesen und hat sich dort umgesehen, hatte aber keine Lust, es zu melden. Das würde bedeuten, dass es einen möglichen Zeugen gibt. Oder, was ich für wahrscheinlicher halte, es war zur Unfallzeit noch jemand auf dieser Straße. Möglicherweise hat diese Person irgendetwas getan, das den Wagen überhaupt erst ins Schleudern gebracht hat. Als der Betreffende sah, was er angerichtet hatte, kam er möglicherweise zurück und wollte seine Hilfe anbieten, ist dann aber abgehauen, als ihm klar wurde, dass Sheila tot war. Parker hat sich gefragt, ob sie vielleicht jemanden verfolgt hat. Das würde die hohe Geschwindigkeit erklären.«
Willis blickte Franklin an und wartete auf eine Reaktion.
Franklin zuckte mit den Achseln. »Das ist durchaus möglich, wenn Sie mich fragen«, sagte er. »Aber es passt eigentlich nicht zu Sheila. Sie war keine Frau, die sich mit jemandem eine Verfolgungsjagd liefert. Sie hätte sich eher die Autonummer aufgeschrieben und den Fahrer angezeigt.«
»Und das alles erklärt noch nicht, wie die Glassplitter auf die Beifahrerseite kommen.« Willis nickte. »Aber wir müssen davon ausgehen, dass sich zur Unfallzeit noch jemand im Tunnel aufgehalten hat. Wir haben die Aufnahmen aller Überwachungskameras von den Straßen angefordert, die von beiden Seiten in den Tunnel führen. Die meisten Gebäude und Läden in der Nähe werden kameraüberwacht. Mindestens die Hälfte dieser Kameras war aktiviert. Deshalb sollte es kein großes Problem sein, die geheimnisvolle Person ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit würde ich mir gerne Sheilas Telefonverbindungen ansehen und mich mit den Leuten in ihrem Apartmenthaus unterhalten. Vielleicht bekomme ich so ein besseres Bild davon, was ihr heute Morgen durch den Kopf gegangen ist. Irgendetwas passt bei der ganzen Sache nicht zusammen. Vielleicht ist es nur das Timing, aber ich bin misstrauisch geworden.« Willis versuchte, vorsichtig vorzugehen, aber irgendetwas machte ihm zu schaffen.
»Dann glauben Sie nicht, dass es ein Unfall war?«, fragte Franklin.
»Ich will jedenfalls nichts ausschließen. Aber im Grunde suche ich nur nach Antworten. Selbst wenn es ein Unfall war, müssen wir herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Wenn sich zu diesem Zeitpunkt noch jemand im Tunnel aufgehalten hat, wie ich glaube, gibt es einige Fragen, auf die ich gerne Antworten hätte. Es ist mein Job, immer nach dem Ungewöhnlichen zu suchen. Vermutlich kommt dabei nichts heraus, aber wir sind es Sheila Davies schuldig, diese Untersuchung mit Sorgfalt vorzunehmen. Finden Sie nicht auch?«
»Natürlich. Genauso hätte sie es selbst gehandhabt.«