Regel Nr. 9: Schlaf ist dein einziger Freund
Wenn du Zeit findest, dich auszuruhen, dann nutze sie. Deine Wachsamkeit leidet, wenn du müde bist.
Um kurz vor zehn erwachte Scott Mitchell. Er hatte wieder nur wenige Stunden geschlafen, doch zum ersten Mal seit Tagen war es ein tiefer, friedlicher Schlaf gewesen, sodass er erfrischt und ausgeruht erwachte. Brown Bear war tot, und er hatte mehr Informationen denn je über die restlichen Mitglieder von Teddybärs Picknicknetzwerk. Jetzt bestand kein Grund zur Eile mehr, da er sie alle ausfindig machen konnte. Keiner von ihnen würde davonkommen. Er würde aufräumen – langsam, aber sicher.
Bei diesem Gedanken fühlte Mitchell sich lebendig. Er lag entspannt auf dem Rücken, spürte das weiche, warme Bettzeug auf der Haut und genoss das wohlige Gefühl. Er wusste, dass man ihn bei der NCCU brauchte, bei der er als Sonderberater arbeitete, aber er beschloss, sie warten zu lassen. Er wollte nicht da sein, wenn sie von Sheila Davies’ »Unfall« erfuhren.
Er dachte daran, was er im Tunnel erlebt hatte.
Augenblicke vor ihrem Tod hatte Sheila Davies erkennen müssen, dass er sie durchschaut hatte. Sie hatte gewusst, dass er, Mitchell, sie töten würde. Aber sie würde nie erfahren, wie gut er wirklich war, und irgendwie ärgerte ihn das. Sie hatte ihn in ihren letzten Augenblicken »Mitchell« genannt. Indem sie seinen Namen aussprach, hatte sie die Illusion zerstört, dass es sich bei Mitchell und Strider um zwei verschiedene Personen handelte. Selbst wenn sie in Mitchells Augen weiterhin unterschiedlich waren, so waren seine beiden Persönlichkeiten durch Sheilas Tod vereint worden. Ihm war, als würden die Regeln erneut geändert, und das beunruhigte ihn.
Es war dasselbe Gefühl der Veränderung, das er bereits beim letzten Mal gespürt hatte, als er aus der Nähe einen Menschen hatte sterben sehen – bei seinem ersten Mord. Auch damals hatte er die Zielperson seit langer Zeit persönlich gekannt, was den schmerzhaften Eindruck, verraten worden zu sein, für den Betreffenden noch gesteigert hatte. Bei beiden Opfern hatte Mitchell dasselbe empfunden; es war zu etwas Persönlichem geworden, weil es diesen Menschen gelungen war, ihn zu täuschen. Beide Male hatte er ihnen in die Augen geschaut, ohne zu finden, wonach er gesucht hatte. Das hatte ihm seine eigene Fehlbarkeit bewiesen. Mitchell durfte sich Schwächen gestatten, Strider nicht.
Beim ersten Mord war er noch kein so erfahrener Hacker gewesen wie jetzt. Der Tod seiner Zielperson war gar nicht beabsichtigt gewesen. Er hatte den Mann nur warnen wollen – ihm zeigen, dass er, Mitchell, wusste, was passiert war, und dass er ihn bloßstellen würde. Doch als er den Mann vor sich sah, der seine Eltern getötet hatte und der jetzt seinen letzten, qualvollen Atemzug tat, war ihm klar geworden, dass nur der Tod dieses Mannes seinen Zorn besänftigen konnte. Hätte er den Mann laufen lassen, hätte er nicht diese unglaubliche Macht gespürt wie in diesem Augenblick. Mitchell musste ihn sterben sehen, um sich selbst neu zu erschaffen.
So war Strider entstanden, Mitchells anderes Ich.
Damals war er siebzehn Jahre alt gewesen. Die Fähigkeiten, die er als Hacker entwickelt hatte, und seine unablässige Suche nach Informationen über die Nacht, in der seine Eltern gestorben waren, hatten es ihm ermöglicht, sich genauestens über den Brand zu informieren, bei dem sie ums Leben gekommen waren. Polizeiberichte, Zeugenaussagen, E-Mails, Telefonmitschnitte – er kannte jedes Detail über die letzte Nacht seiner Eltern und die Ereignisse, die vorangegangen waren. Der Gerichtsmediziner hatte eine »unbekannte Todesursache« festgestellt, obwohl im Bericht eines Feuerwehrmannes eindeutig stand, dass das Feuer im Wohnzimmer gelegt worden war – gezielt und mit Absicht. Die Lage der Leichen, die Aussagen von Nachbarn und Kollegen über Spannungen in der Ehe und dass sie sich vor dem Brand gestritten hätten – und natürlich die Petroleumspuren, die ebenfalls im Polizeibericht erwähnt wurden -, dies alles deutete darauf hin, dass Mitchells Vater das Feuer absichtlich gelegt und seine Frau während eines Streits versehentlich getötet hatte.
Für die Außenwelt war das eine tragische, aber plausible Erklärung, doch für den jungen Scott Mitchell passten einige wichtige Details nicht ins Bild. Da war die Tatsache, dass er bei einem Freund übernachten sollte, weil seine Eltern zum Essen ausgehen wollten. Außerdem hatten sie sich in den Wochen vor dem Brand nie gestritten. Und dann war da noch die schlichte Tatsache, dass Scott Mitchell wusste, sein Vater würde niemals Selbstmord begehen und erst recht nicht die Liebe seines Lebens umbringen.
Doch Scotts Einwände wurden ignoriert. Schließlich war er ein Kind, das um seine Eltern trauerte und nach Antworten suchte. Aber er hatte von Anfang an gewusst, dass in dieser Nacht noch mehr passiert sein musste – und er hatte recht behalten, auch wenn es Jahre gedauert hatte, bis er die Wahrheit herausfand. Mithilfe verschiedener Datenpakete hatte er erfahren, dass das kleine, aber erfolgreiche Familienunternehmen, in dem sein Vater arbeitete, in große finanzielle Probleme geraten war. Mitchells Vater hatte herausgefunden, dass sein Geschäftspartner Gelder unterschlagen hatte, gewaltige Summen. Es war zu Streitigkeiten zwischen beiden Männern gekommen. Die Auseinandersetzung war eskaliert – bis hin zum Mord an Mitchells Eltern.
Es gab allerdings keine Zeugen, die den Mörder beim Betreten oder Verlassen des Hauses gesehen hatten, und niemand außer Mitchell junior glaubte, dass sich das Ganze so abgespielt hatte. Ein Nachbar hatte das Feuer schließlich gemeldet. Doch als eine halbe Stunde später die Polizei erschienen war und der Sache nachgehen wollte, brannte das Haus bereits lichterloh. Man hatte niemanden mehr aus dem Gebäude retten können.
Doch Scott Mitchell wusste, dass seine Eltern zu diesem Zeitpunkt längst tot gewesen waren. In den darauffolgenden Wochen war es dem Geschäftspartner seines Vaters nicht nur gelungen, sich als völlig unschuldig hinzustellen – er hatte es sogar geschafft, Mitchell senior dessen eigene Verfehlungen anzuhängen.
Scott hatte immer schon geahnt, dass auch sein alter Herr keine weiße Weste hatte. Dennoch ärgerte er sich, dass es dem Geschäftspartner seines Vaters gelungen war, ihn zu täuschen. Und die freundlichen Worte bei der Beerdigung, die Hilfsangebote, die Geburtstagsgeschenke jedes Jahr bei Scotts verschiedenen Pflegeeltern – dies alles sprach für die Schuldgefühle des Mannes. Doch Mitchell hatte das erst Jahre später begriffen.
Als er schließlich die Wahrheit herausfand, hatte er den Mann zur Rede stellen wollen. Er hatte sich dem geheimnisvollen Salesman anvertraut, den er damals gerade erst kennengelernt hatte – sein Mentor und Mittelpunkt der virtuellen Welt junger, talentierter Hacker. Der Salesman hatte ihm geraten, zu warten und sich angemessen zu rächen. Schließlich verfügte er über die entsprechenden Mittel. Also hatte Mitchell gewartet und Informationen über seine Zielperson gesammelt, bis er alles wusste, was es zu wissen gab.
Eine Routineoperation, bei der ein Gallenstein entfernt werden sollte, war die perfekte Gelegenheit. Da Mitchell wusste, dass das Thiopental, das als Narkosemittel verwendet wurde, auch als sogenanntes »Wahrheitsserum« eingesetzt werden konnte, schmiedete er entsprechende Pläne. Es war sein erster »direkter Zugang«, und wegen des hohen Risikos hatte er alles genau geplant. Die Technologie würde sein Schutz und seine Waffe sein.
Und es war alles glattgegangen. Kurz nachdem die Krankenschwester die erste Injektion gesetzt hatte, war sie wegen eines akuten Notfalls aus dem Zimmer gerufen worden, sodass eine jüngere Aushilfskrankenschwester unbemerkt ins Zimmer kommen und dem Mann noch etwas von dem Mittel injizieren konnte. Mitchell war in diese Rolle geschlüpft und hatte sich entsprechend verkleidet, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Den »akuten Notfall« hatte er vorprogrammiert; der Alarm war durch einen einfachen Hack der Überwachungsgeräte ausgelöst worden.
Mitchell hatte sich durch Onlinerecherchen vergewissert, dass die Dosis ausreichte, dass ihn der Mann nicht anlügen konnte. Endlich würde er die Wahrheit erfahren.
Und er hatte recht behalten – sowohl in Bezug auf die Dosis als auch im Hinblick auf den Tod seiner Eltern. Allerdings hatte er nicht erwartet, dass der Mann an der zweiten Injektion starb, doch er hatte auch nichts dagegen unternommen. Bevor die Monitore die Flatline anzeigten – die letzte, flache Linie des Todes – und ein weiterer Alarm auf der Station ertönte, hatte der Mörder seiner Eltern gewusst, dass er sterben musste, und den Grund dafür gekannt. Mitchell war entkommen, bevor das Krankenhauspersonal mitbekommen hatte, was geschehen war. Das war sein erster Mord gewesen und zugleich das letzte Mal, dass jemand, der im Sterben lag, seinen richtigen Namen aussprach.
Bis zu diesem Morgen.
Als er jetzt im Bett lag und das blasse Frühlingslicht durch die Vorhänge schimmern sah, fragte er sich, ob man sich auch so fühlte, wenn man herausfand, dass einen der Partner betrog. Er kam sich schmutzig vor, als wäre das Vertrauen, das er Sheila Davies geschenkt hatte, missbraucht worden. Er erinnerte sich an viele Unterhaltungen, die sie vor seiner Rekrutierung geführt hatten, und an Gespräche während ihrer gemeinsamen Zeit bei der NCCU. Er dachte an die langen Nächte zurück, in denen er mit dem Code gekämpft hatte, bis ihm ein Durchbruch gelungen war – und das alles nur, um Sheilas Vertrauen in ihn zu rechtfertigen. Er ging jede Auseinandersetzung, die sie zu seiner Verteidigung mit Franklin geführt hatte, noch einmal durch.
Ob Franklin gutheißen würde, was er getan hatte, wenn er wüsste, wer Sheila in Wirklichkeit gewesen war? Oder würde er sie beide als faule Äpfel ansehen?
Mitchell dachte lange an die Nacht zurück, als die Beweise über Teddybärs Picknicknetzwerk verloren gegangen waren. Sheila hatte den Pub zusammen mit ihm verlassen, hatte ihm zu seinem Durchbruch gratuliert. Sie hatten darüber gewitzelt, dass es nur die Spitze des Eisbergs sei, und sich damit getröstet, dass sie beide die Party früher verließen.
Mitchell hatte geglaubt, Sheila wäre sehr zufrieden mit ihm gewesen. Doch offensichtlich hatte sie das alles nur gespielt, um ihn von den Servern fernzuhalten, bevor er die Beweise finden konnte, die sie, Sheila, mit Teddybärs Picknicknetzwerk in Verbindung brachten. Sie hatte ihn zum Narren gehalten, und er war darauf hereingefallen.
Doch es ärgerte ihn nicht so sehr, dass sie ihn belogen hatte, sondern vielmehr, dass es ihm so lange nicht aufgefallen war. Er hatte sich jeden im Team der NCCU angeschaut und nach Hinweisen gesucht, um den Verräter zu entlarven, doch irgendwie hatte er Sheila Davies dabei übergangen. Er würde noch lange darüber nachgrübeln, wie ihr das gelungen war. Sie musste gewusst haben, dass er Teddybärs Picknicknetzwerk weiter im Auge behielt; vermutlich war ihr deshalb klar gewesen, dass er zuerst auf Prince’ Laptop nach Hinweisen auf dieses Netzwerk suchen würde. Er erinnerte sich noch genau, wie sie erst am gestrigen Nachmittag neben ihm gestanden und ihn gefragt hatte, ob er etwas gefunden habe. Bei der Gelegenheit hatte sie ihn auch an sein vorheriges Versagen erinnert.
Er hätte zu gern gewusst, wie Sheila Black Flag in der Vergangenheit geholfen hatte. Wie oft hatte sie den Verbrechern geholfen? Wie sehr? Gab es noch mehr Beweise, die sie diesen brutalen Kriminellen wegen hatte verschwinden lassen? Hatte sie Informationen über die Fälle, die Black Flag betrafen, weitergegeben? Hatte sie je mit Prince darüber gesprochen?
All diese Details hätte Mitchell normalerweise über eine Zielperson in Erfahrung gebracht, bevor er sie ermordete, aber dieses Mal hatte er einfach zu schnell handeln müssen.
Vielleicht hatte Sheila nicht geglaubt, dass er, Mitchell, es als Nächstes auf sie abgesehen haben würde. Sie musste gewusst haben, dass es Beweise auf Prince’ Laptop gab, hatte aber möglicherweise geglaubt, sie wäre klug genug und würde nicht auffliegen. Oder hatte sie gewusst, dass Mitchell es auf sie abgesehen hatte, und andere gewarnt? Dieser Gedanke erfüllte ihn mit Besorgnis. Hatte er zu früh zugeschlagen? War er zu voreilig gewesen?
Und noch etwas: Hatte Prince den Namen »Strider« gegenüber Sheila erwähnt? Kannte sonst jemand diesen Namen?
Aber das war eigentlich unwichtig. Mitchell war überzeugt, dass niemand diesen Namen mit ihm in Verbindung bringen konnte.
Er war sich nicht sicher, ob der Rest des Netzwerks bereits wusste, was geschehen war. Wie würden sie darauf reagieren, dass zwei ihrer Mitglieder innerhalb einer Woche ums Leben gekommen waren? Würden sie wissen, dass man es auf sie abgesehen hatte, oder würden sie Sheila Davies’ Tod für einen Unfall halten? Abgesehen vom Timing hatte Mitchell dafür gesorgt, dass nichts daran verdächtig wirkte. Selbst wenn man herausfand, dass Sheila ermordet worden war – was konnte man deswegen schon unternehmen? Sie konnten schließlich nicht zur Polizei gehen – jedenfalls nicht, ohne sich selbst zu belasten. Also würde ihm auch nichts passieren. Oder?
Mitchell schlug die Bettdecke zurück und stand auf. Wenn er noch länger hier herumlag und sich das Hirn zermarterte, drehte er durch.
Das Arbeitszimmer in seiner Wohnung war viel besser ausgestattet als sein Arbeitsplatz bei der NCCU. Er hatte alles genau auf seine Ansprüche abgestimmt und fühlte sich beim Anmelden häufig so, als würde er in eine andere Realität eintauchen, in der er und der Rechner Teil desselben Wesens waren. In dieser Welt erwachte Strider zum Leben. Mitchell bedauerte, dass es keine Möglichkeit gegeben hatte, Brown Bear zu beseitigen, ohne dass Sheila Davies sterben musste. Aber damit würde er jetzt leben müssen. Er durfte einfach nicht mehr an das blubbernde Blut in ihrem Mund und an ihre ersterbende, krächzende Stimme denken, als sie ihn gewarnt hatte: »Dafür wirst du bezahlen.«
Nun – was das anging, hatte er seine Zweifel. Schließlich wussten sie nicht, wer er war. Er war in Sicherheit. Hier würde ihn niemand finden.
Nun musste er unbedingt online nachsehen, was letzte Nacht geschrieben worden war, das seine Überwachungsprogramme übersehen hatten. Vorher aber duschte er, rasierte sich und zog sich an. Während er einen Schluck Kaffee trank, fuhr er den Computer hoch. Seine Finger schwebten bereits über den Tasten. Sobald das Fenster geöffnet war, begann er mit seiner Suche. Er hatte recht: Die Foren waren in den Stunden nach Brown Bears Tod regelrecht überflutet worden.
Die Reaktionen waren schnell gekommen. Die erste Ankündigung war zwei Stunden, nachdem er sich von Sheila Davies’ Leiche entfernt hatte, erschienen. Die Ankündigung war in einem allgemeinen Forum im Deep Web veröffentlicht worden, einem Community-Forum, in dem Tipps und Hacks ausgetauscht und allgemeine Fragen gestellt und beantwortet wurden. Hier erschienen auch immer zuerst die Neuigkeiten über Todesfälle und Verhaftungen in der Hacker-Community. Die Nachricht stammte von einem anonymen User und lautete schlicht:
R.I.P. Brown Bear
Der darauf folgende Aufschrei setzte sich in Foren und Chatrooms des Deep Web fort, aber keines der Mitglieder von Teddybärs Picknicknetzwerk hatte sich zu Wort gemeldet – offensichtlich wussten sie, wie unklug es war, zu diesem Zeitpunkt etwas zu kommentieren. Die Reaktion auf einen gefallenen Kameraden war stets interessant, und Mitchell war jedes Mal amüsiert, wenn Leute, die keine Ahnung hatten, wer ein Hacker war, seinen Untergang lautstark bedauerten, sobald sie von seinem Tod erfuhren. Wurden sie auf diese Weise daran erinnert, dass jeder fehlbar war? Oder lag es an ihrem verzweifelten Wunsch, zum Klub dazuzugehören? Es kam häufig vor, dass die Leute sich nach einem solchen Ereignis bemühten, eine Verbindung zu der bedeutenden Person herzustellen. Nach der Verhaftung eines Hackers sah es jedoch anders aus – da plauderte man online darüber, welche Fehler er gemacht hatte oder was für eine Enttäuschung er war. Mit einem Hacker, den man erwischt hatte, wollte niemand in einem Atemzug genannt werden.
In der halben Stunde, die Mitchell die Kommentare und Nachrichten durchsuchte, stellte er zu seiner Beruhigung fest, dass nirgendwo von Mord oder Manipulation die Rede war. Natürlich wusste er, dass die Hacker-Öffentlichkeit nicht die öffentliche Meinung repräsentierte, aber selbst in den exklusiveren Foren gab es keinerlei Verdächtigungen. Doch er fand zahlreiche Leute, die behaupteten, Brown Bear persönlich gekannt zu haben, und die ihn als »netten Kerl« bezeichneten. Mitchell grinste – darüber hätte Sheila Davies sich garantiert schwarz geärgert.
Er griff auf die Daten des Notrufs aus den letzten sechs Stunden zu, entdeckte aber nur den Bericht über einen »Verkehrsunfall mit einem weiblichen Todesopfer«. Die Geschwindigkeit beim Aufprall auf die Wand wurde ebenfalls erwähnt. Die Tote war in die Leichenhalle eines nahen Krankenhauses gebracht worden, wo auch der Alkohol im Blut untersucht werden sollte. Ein Verkehrsbericht bestätigte, dass der Tunnel zwei Stunden lang geschlossen gewesen war, damit die Unfallstelle untersucht werden konnte. Nirgendwo war die Rede von zweifelhaften Umständen. Und was noch viel wichtiger war: In keinem der Berichte wurde ein Motorrad erwähnt. Der Unfall war von einem Taxifahrer gemeldet worden, der ihn – wie von Strider vorhergesagt – von der anderen Straßenseite aus entdeckt hatte.
Nachdem Mitchell sich vergewissert hatte, dass für ihn keine unmittelbare Gefahr bestand, konnte er sich in Kürze ausloggen und zur Arbeit fahren. Vorher musste er allerdings noch eine Unterhaltung führen – mit seinem ehemaligen Mentor, dem Salesman.
In all den Jahren, die sie jetzt schon miteinander kommunizierten, hatte er nie die Stimme des Salesman gehört. Sie hatten sich immer online unterhalten. Anfangs hatten sie sich in Foren getroffen und ausgetauscht, später in privaten Chats. Normalerweise initiierte der Salesman den Chat und schickte eine Nachricht, die stark verschlüsselt im Äther hing, bis Strider sich anmeldete und sie fand. Strider war der Einzige, der sie entschlüsseln konnte; außerdem hatte niemand anders die Möglichkeit, sie überhaupt zu finden. Es bestand nie das Risiko, dass sie einander identifizieren konnten. Wenn jemand im Deep Web davon wusste, dass Strider in Brown Bears Unfall oder Prince’ Tod verwickelt war, dann der Salesman. Er achtete grundsätzlich auf sein Team. Wenn der Salesman etwas nicht wusste, dann wusste es niemand.
Als Mitchell die direkte URL für den privaten Chat eingab, den sie häufig benutzten, wartete bereits eine Nachricht auf ihn:
Rede mit mir.
Ein wenig beklommen begann er zu tippen.
Strider: Ich bin da.
Er wartete eine gefühlte Ewigkeit, starrte auf den Bildschirm, trank einen Schluck Kaffee und hoffte, dass der Salesman noch online war.
Endlich war ein Piepton zu hören, als die Antwort kam.
Salesman: Bist du alleine?
Strider: Ja.
So fingen ihre Gespräche meist an, wenn der Salesman herausfinden wollte, ob Strider für einen Auftrag verfügbar war.
Salesman: Ich suche Informationen. Vielleicht kannst du mir helfen.
Strider: Schieß los.
Salesman: Anthony Prince’ Flugzeugabsturz. Das warst du, nicht wahr?
Der Salesman hatte sich noch nie so direkt nach Striders Aktivitäten erkundigt. Prince war ein privates Ziel gewesen, auf das Strider es abgesehen hatte. Woher wusste der Salesman davon? Natürlich, von der Webseite. Von dem Link, den er Prince geschickt hatte. Er hatte mit »Strider« unterschrieben, und zwei Personen hatten darauf zugegriffen.
Bevor Mitchell etwas schreiben konnte, kam schon die nächste Nachricht.
Salesman: Wir hatten vereinbart, dass deine privaten Aktionen mir nie in die Quere kommen.
Was meinte er damit? Der Salesman konnte doch unmöglich mit etwas so Abscheulichem wie Kinderpornografie zu tun haben, dazu war er zu anständig.
Strider: Das war nicht beabsichtigt.
Salesman: Ich habe dich rekrutiert. Ich habe dich zu dem gemacht, der du bist. Du bist mein Mann. Deshalb könntest du mir wenigstens mitteilen, wenn du vorhast, einen meiner Männer zu liquidieren.
Mitchell starrte die Worte auf dem Bildschirm an, und in seiner Magengrube zog sich alles zusammen. Ihre Nachrichten waren im Allgemeinen von einer verspielten, kryptischen Art, als wollten sie sich gegenseitig von ihrer Intelligenz und Überlegenheit überzeugen. Dieses Spielchen spielte der Salesman eigentlich gerne, aber heute war ihm nicht danach. Offensichtlich war ihm überhaupt nicht nach Spielen zumute.
Strider: Tut mir leid, wenn ich dir in die Quere gekommen bin.
Salesman: Zwei meiner besten Leute wurden in den letzten achtundvierzig Stunden ausgeschaltet, und ich weiß, dass du in wenigstens einem der Fälle der Verantwortliche bist. Verärgerung beschreibt nicht mal ansatzweise das, was ich fühle.
Mitchell erstarrte und las die Worte immer wieder. Zwei seiner Leute? Zwei? Das ergab keinen Sinn.
Salesman: Prince hättest du haben können. Das Timing war schlecht, aber ich hätte es verkraftet.
Strider: Hast du die Datenbank geklaut?
Salesman: Du solltest so etwas nicht fragen. Aber da wir gerade bei Enthüllungen sind: Ja, meine Leute haben auf die Datenbank zugegriffen.
Strider hatte häufig den Eindruck, dass der Salesman während ihrer Unterhaltungen eine Stimmerkennungssoftware benutzte, statt zu tippen. Jetzt glaubte er beinahe, die Stimme dieses rätselhaften Mannes hören zu können.
Strider: Warum? Was hast du vor?
Salesman: Auch das solltest du lieber nicht fragen.
Strider saß in der Klemme. Wenn er weiter nachhakte, ging er das Risiko ein, Mitchell zu enttarnen, aber wenn er nicht fragte, würde er die Antwort wohl nie erfahren. Doch er bekam nicht die Gelegenheit, da schon die nächste Frage auf dem Bildschirm auftauchte.
Salesman: Hast du mit dem Unfall letzte Nacht zu tun?
Strider: Ich weiß nicht, was du meinst.
Salesman: Lüg mich nicht an, Strider. Für wen arbeitest du? Wer hat dich dafür bezahlt, sie umzubringen?
Strider: Mich hat niemand bezahlt. Es war etwas Persönliches. Ich habe Informationen erhalten, die mich zu den Teddybären führten, und habe entsprechend gehandelt. Ich habe keinen Grund gesehen, das erst mit dir zu besprechen.
Salesman: Dummerweise hättest du das aber tun sollen. Hättest du mir gesagt, was du beabsichtigst, hätte ich dich davor gewarnt. Aber das hast du nicht getan. Es war eine Menge Arbeit, mein Team zusammenzustellen, und ich kann leider nicht zulassen, dass zwei meiner besten Leute ausgeschaltet werden, auch nicht von einem meiner Lieblinge. Du hast mich verraten, Strider. Das war deine letzte Tat.
Strider: Ich kann dir nicht folgen.
Seine Hände zitterten leicht. Er musste an Sheila Davies’ letzte Worte denken: »Dafür wirst du bezahlen.« Hatte sie das damit gemeint?
Salesman: Wenn man der Hydra einen Kopf abschlägt, wachsen zwei neue nach. Ich habe dich immer gewarnt und dir gesagt, du sollst das Ganze nicht aus den Augen lassen, aber du konzentrierst dich weiterhin auf Details. TPN ist viel größer, als du glaubst. Du hast Prince getötet, aber der war nur lästig. Durch den Mord an Brown Bear jedoch bist du zu meinem Feind und zum Feind von Black Flag geworden. Und glaub ja nicht, dass du dich vor uns verstecken kannst.
TPN – Teddybärs Picknicknetzwerk. Mitchell überlief es eiskalt. Der Salesman war der mächtigste Mann, den er in der geheimen Welt des Deep Web je kennengelernt hatte. Seine Macht und seine Verbindungen überspannten Kontinente.
Strider: Du gehörst zu Black Flag?
Salesman: Deine Naivität enttäuscht mich. Was hast du denn gedacht? Habe ich dir nicht immer gesagt, du sollst das Ganze sehen? Ich werde dir meine besten Leute auf den Hals hetzen. Bis eben warst du der Beste, deshalb dürfte das ein interessanter Kampf werden. Aber ich bezweifle, dass du ihn gewinnen wirst. Ich kann dich nicht retten, selbst wenn ich es wollte. Was für ein Beispiel würde ich damit setzen?
Strider: Was hat Brown Bear dir bedeutet?
Salesman: Sie war mein bester Lieutenant. Und jetzt leb wohl, Strider. Hat Spaß gemacht mit dir. Schade, dass es so enden muss, aber gute Lieutenants sind nun mal schwer zu finden.
Mitchell starrte noch lange, nachdem der Salesman sich abgemeldet hatte, auf den Bildschirm. Seine Welt war soeben auseinandergebrochen. Reglos, wie erstarrt saß er auf seinem selbst gebauten Stuhl. Am liebsten wäre er davongelaufen, aber wohin? Hier war seine Zuflucht.
Würden sie ihn hier finden können? Wusste irgendjemand, dass er Strider war? Er war davon überzeugt, dass nicht einmal Sheila Davies es gewusst hatte. Aber das spielte keine Rolle mehr – jetzt, wo er wusste, dass sein Mentor zu Black Flag gehörte.
Alles andere war ohne Belang.
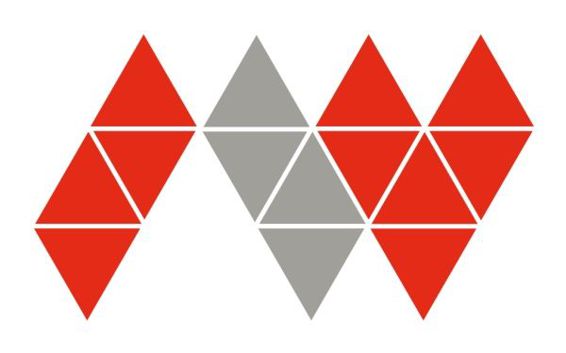
Rebecca MacDonald erschauderte, als sie sich in dem Kontrollraum des Materialumschlagbereichs des Drax-Kraftwerks über den Computer beugte. Es war gerade mal zehn Uhr, und sie war schon seit drei Stunden hier. Sie wusste, dass ihr die Kälte so zu schaffen machte, weil sie noch immer müde war. Aber es war auch nicht gerade hilfreich, dass sie sich für einen Arbeitstag in einem schönen warmen Büro in London angezogen hatte und nicht für einen Kontrollraum in einem Kraftwerk in Yorkshire. In der Nacht zuvor hatte sie den letzten Direktzug von London nach Selby erwischt und war zu spät hier angekommen, um sich mit einem der leitenden Ingenieure des Kraftwerks treffen zu können. Daher hatte sie sich ein Zimmer in einem Hotel in der Nähe genommen und ein paar Stunden geschlafen. Sie war seit jeher stolz darauf, mit wenig Schlaf auszukommen, spürte nun aber die Nachwirkungen der durchgearbeiteten Nacht.
Das Kraftwerk war riesig, ja überwältigend mit seinen insgesamt elf SCADA-Systemen, die auf dem Gelände verteilt waren. Sechs davon steuerten die ebenfalls sechs Dampfturbinengeneratoren, zwei weitere die Wasserversorgung, die anderen drei die restlichen Anlagen innerhalb der Materialversorgung. Die einzigen SCADA-Systeme, auf denen bereits die Sicherheitssoftware Cryptos installiert war – der Stolz von PrinceSec, die Firma, bei der Rebecca als Sicherheitsexpertin arbeitete -, befanden sich in der Materialversorgung. Auf diese drei konzentrierte Rebecca sich als Erstes. Es war eine Erleichterung gewesen, dass die Prozesse, die am meisten gefährdet waren, nicht als kritisch eingestuft werden mussten. Zwar wäre jede Störung des Kraftwerks, die eine geringere Produktion zur Folge hatte, eine ziemliche Katastrophe, aber ein Angriff auf einen oder mehrere Turbinengeneratoren hätte eine viel verheerendere Wirkung. Die SCADA-Systeme, die die Generatoren steuerten, waren zwar noch nicht außer Gefahr, weil sie noch nicht aktualisiert worden waren, aber man konnte davon ausgehen, dass sie nicht das Hauptziel der Hacker darstellten, die die Datenbank an sich gebracht hatten.
Bisher hatte Rebecca die Ingenieure und Softwarespezialisten des Kraftwerks als hilfsbereit erlebt. Einer von ihnen hatte ihr eine große fluoreszierende Jacke gebracht, die sie bei der Arbeit tragen konnte. Außerdem hatte man ihr mitgeteilt, dass sämtliche Vorgänge gründlich überwacht wurden, seitdem sie von PrinceSec die Warnung hinsichtlich der Datenbanksicherheit erhalten hatten. Man hatte sogar die Schichten verstärkt, damit keines der Systeme unbeaufsichtigt blieb. Sämtliche Angestellten waren über eingetroffene E-Mails befragt worden, auch die von Freunden und Familienangehörigen. Außerdem waren alle Softwareupdates bereits installiert. Rebecca hatte als erste Amtshandlung dafür gesorgt, dass die installierte Cryptos-Version auf den neuesten Stand gebracht und dass der von ihr mitgeschriebene Patch installiert wurde.
Roche, der NCCU-Agent, hatte sie vor einiger Zeit angerufen und ihr mitgeteilt, dass er von Newcastle zu ihr fahren und ihr helfen würde, herauszufinden, ob es bereits einen Zugriff gegeben hatte. Häufig wurde ein Wurm über ein harmlos aussehendes Softwareupdate oder einen Link in einer E-Mail in ein System eingeschleust, wo er dann unentdeckt lauerte, bis er aktiviert wurde. Rebecca rätselte noch immer, was Black Flag dadurch gewinnen würde, das Kraftwerk abzuschalten, aber sie wusste auch, dass diese Gruppe eine Vorliebe für schlichte, altmodische Störmanöver hatte.
In der Vergangenheit waren viele ihrer Angriffe rein anarchischer Natur gewesen, und häufig gingen sie gegen große Unternehmen oder nationale Einrichtungen vor, nur um zu beweisen, dass die Gruppe deren Sicherheitssysteme knacken konnte. Doch bei manchen Angriffen war es ihnen darum gegangen, sich politische oder finanzielle Vorteile zu verschaffen, und dann zeigten sie, was sie wirklich konnten. Erst im letzten Jahr hatten sie erfolgreich eine Großbank infiltriert und langsam und diskret mehr als fünfundvierzig Millionen Pfund von Geschäftskonten im ganzen Land abgezweigt. Erst nach fast sechs Monaten war das Leck entdeckt worden, und die Auswirkungen für die Bank waren sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf das Vertrauen ihrer Kunden katastrophal gewesen.
Rebecca war froh, dass Roche sie unterstützen würde. Er war zwar ein seltsamer Kerl, aber ein effizienter Agent; das hatte sie an ihrem ersten Tag im »Schweinestall« gesehen, wie man den kleinen Konferenzraum nannte, in dem die Besprechungen der Abteilungsleiter der NCCU stattfanden. Natürlich konnte man ihn nicht mit Mitchell vergleichen. Rebecca bezweifelte, dass sie je einen zweiten Coder wie Mitchell kennenlernen würde. Dafür hatte Roche schon einmal mit Black Flag zu tun gehabt, sodass sie es nicht alleine mit dieser Gruppe aufnehmen musste.
Als die letzten Updates installiert waren, ließ Rebecca ein spezielles Diagnoseprogramm laufen, das sie geschrieben hatte, um herauszufinden, ob auf dem Rechner irgendwelche unbekannten oder unerwünschten Programme installiert waren. Das Programm arbeitete im Prinzip wie eine Virenschutzsoftware und fertigte einen detaillierten Scan des Rechners an, wobei es nach Codefragmenten suchte, die es entweder nicht erkannte oder die bereits als schädlich bekannt waren. Es würde etwa eine halbe Stunde dauern, bis die Suche abgeschlossen war, also beschloss Rebecca, in dieser Zeit nach draußen zu gehen und frische Luft zu schnappen.
Nun stand sie auf dem Treppenabsatz und wollte gerade die Tür hinter sich schließen, als sie einen kleinen gelben Wagen auf der Straße sah, der sich dem Kraftwerk näherte. Der Farbtupfer sah in der grauen Industrielandschaft irgendwie deplatziert aus, und sie musste unwillkürlich lächeln. Dann beobachtete sie, wie der Wagen an einer Schranke hielt, wo der mürrische alte Wachmann aus seinem Häuschen geschlurft kam, um mit dem Fahrer zu reden. Der Wachmann reichte ein Klemmbrett durch das Fenster auf der Fahrerseite und stand dann wartend da, während der Papierkram erledigt wurde. Als er das Klemmbrett wieder in der Hand hielt, deutete der Wachmann auf die andere Seite des Parkplatzes zu jener Stelle, an der Rebecca stand.
Nachdem der Wachmann wieder in sein Häuschen marschiert war und die Schranke hochgelassen hatte, machte das kleine Fahrzeug einen Satz nach vorn und blieb stehen, da der Fahrer offenbar von der Kupplung abgerutscht war. Schon jetzt hatte Rebecca die ganze Sache sehr amüsant gefunden, aber es wurde noch viel witziger, als sie sah, dass es sich bei dem Fahrer, der aus dem schief geparkten gelben Wagen stieg, um Roche handelte.
Er sah auf, bemerkte, dass Rebecca ihn beobachtete, und winkte ihr zu. Sie lächelte und winkte zurück. Roche nahm seine Taschen aus dem Kofferraum und kam über den Parkplatz auf sie zu.
»Wie läuft’s?«, rief er.
»Was fahren Sie da für einen Wagen?«, fragte sie lachend.
»Ich musste mir einen Mietwagen nehmen. Meiner ist gestern auf dem Weg nach Newcastle liegen geblieben. Diese DS war alles, was sie noch dahatten«, erwiderte Roche und kam die Treppe hinauf zu ihr. Ohne Umschweife reichte er ihr einen Laptopkoffer und eine der Taschen.
»DS?«, hakte sie nach.
»Dreckschleuder«, erklärte er, als wäre sie begriffsstutzig. »Hier rein?«
Rebecca ging hinter ihm durch die Tür zurück in den Kontrollraum.
»Was haben Sie in Newcastle herausgefunden?«, wollte sie wissen, nachdem er sich Platz verschafft und seinen Laptop aus dem Koffer genommen hatte.
»Eine Menge«, antwortete er ausweichend.
»War es dann gut, dass Sie so schnell wieder wegmussten?« Wenn er kritische Angriffe auf eines der Systeme am Hafen gefunden hatte, war es möglicherweise verkehrt gewesen, ihn zu bitten, sie hier zu unterstützen.
»Nun ja, ich hab eine Menge einfacher Viren und diesen dämlichen Mikrowurm aus dem letzten Jahr gefunden«, antwortete Roche. »Aber es war nichts dabei, was die Sicherheit gefährden könnte – sofern man die Tatsache außer Acht lässt, dass sie dort anscheinend kaum mal eine Virenprüfung durchführen. Aber Sie hatten vollkommen recht, es gibt viele Verbindungen zu diesem Kraftwerk. Mir ist das Ganze noch nicht richtig klar, deshalb dachte ich mir, wir könnten es uns mal zusammen ansehen, wenn wir hier fertig sind. Wie weit sind Sie?«
Rebecca wurde noch immer nicht schlau aus diesem Mann. Er wirkte freundlicher und weniger unheimlich als in London, war aber weiterhin ziemlich kühl, beinahe schroff. Vielleicht hatte sie ja ihren Wert bewiesen, indem sie die Verbindung zum Kraftwerk gefunden hatte.
»Gibt es hier irgendwo Kaffee?«, erkundigte er sich, bevor sie seine Frage beantworten konnte. »Ich habe eine verdammt lange Fahrt hinter mir.«
»Auf dem Flur steht ein Automat, aber der Kaffee schmeckt wie Spülwasser«, entgegnete sie.
»Großartig. Und?«
»Was – und?«
»Wie weit sind Sie hier?«
»Ach so.« Rebecca klärte ihn über ihre Fortschritte auf. Er war sichtlich erfreut, dass sie einen Großteil der Software bereits aktualisiert hatte. Ihr war bereits am ersten Tag aufgefallen, dass Roche nicht die Geduld hatte, Versionen zu überprüfen und Software zu installieren; er schien erst dann richtig lebendig zu werden, wenn es an die Ermittlungsarbeit ging. Sie konnte es ihm nicht verdenken, da sie selbst in den vergangenen Tagen Spaß an den Ermittlungen gehabt hatte.
»Haben Sie am Hafen irgendwas Besonderes gefunden, das uns einen Hinweis geben könnte, wo wir anfangen sollten?«, erkundigte sie sich. »Es gibt hier ziemlich viele Computer, und ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben werden, um sie alle unter die Lupe zu nehmen.«
Roche zog die Augenbrauen hoch und grinste, als hätte er eine Überraschung auf Lager.
»Tja, da Ihr Instinkt Sie hierhergeführt hat, sollten wir auch genauso weitermachen«, sagte er. »Ich habe eine Liste mit allen bekannten Verbindungen zwischen den Prozessen hier, denen im Port of Tyne und den Informationen erstellt, die wir über Black Flag haben. Zu unserem Glück beginnen und enden die meisten dieser Verbindungen hier in der Materialversorgung. Da hatten Sie einen guten Riecher, aber ich bezweifle, dass dieser Ort überhaupt ein Ziel für die Gruppe ist. Das soll aber nicht heißen, dass hier alles in Butter ist. Wir sollten auf jeden Fall gründlich vorgehen. Es sind viele Möglichkeiten aufgetaucht, die nicht alle wichtig sein müssen – aber es ist eine Liste, und ich mag Listen.«
»Ich auch. Ich kann ohne Listen nicht leben.«
Roche ließ sich seufzend auf einen Plastikstuhl vor seinem Laptop sinken und schaute zu Rebecca hoch. Überrascht stellte sie fest, wie jung er aussah. Die Brille mit dem dunklen Rahmen, die formlose Strickjacke und das ungekämmte Haar verschleierten sein Alter ziemlich gut, aber er hatte glatte Haut, und der Flaum auf seinen Wangen deutete darauf hin, dass er sich nicht oft rasieren musste. Er grinste sie verschwörerisch an.
»Und? Was sind die wichtigsten Punkte?«, fragte sie, da sie spürte, wie gern er seine Erkenntnisse mit ihr teilen wollte.
»Meiner Ansicht nach«, sagte Roche und zeigte ihr eine handgeschriebene Liste in seinem Notizbuch, »ist das Hauptziel Prime Logistics – das Unternehmen, das für den Frachtverkehr zwischen dem Kraftwerk und dem Hafen zuständig ist und das einen neuen Vertrag mit Bacchus Enterprises abgeschlossen hat, dem Spediteur. Sie holen die Frachtcontainer von den Schiffen und bringen sie zum Lagerhaus von Bacchus in Humberside. Daran ist nichts Seltsames, ich weiß, aber es war ihre Containerregistrierung bei der Hafenbehörde, die bei mir die Alarmglocken schrillen ließ. Augenblick, ich habe Kopien.«
Er schloss das Trackpad an seine Tastatur an und rief ein Fenster mit einer Liste von Ordnern auf. Nach einigen weiteren Klicks hatte er mehrere Seiten einer Datenbank geöffnet.
»Jeder Container auf jedem Schiff, das den Hafen ansteuert oder verlässt, hat eine einzigartige Trackingnummer, nicht wahr? Man meldet sie an und wieder ab. Schauen Sie sich die Liste mit den letzten drei Lieferungen für Bacchus Enterprises an. Alle wurden ordentlich an- und abgemeldet, jeweils gesammelt pro Lieferung.«
»Okay«, meinte Rebecca. »Und was hat das zu bedeuten?«
»Darauf kommen wir gleich.« Mit einem weiteren Klick rief Roche einen Scan handgeschriebener Unterlagen auf. »Zum Glück hat der Hafen noch nicht alle Prozesse automatisiert. Das hier sind die Abmeldeberichte für jede Lieferung. Sie werden entweder von den Torwächtern abgezeichnet, wenn sie per Lkw rausgehen, oder vom Controller, wenn sie mit dem Zug transportiert werden. Und jetzt kommt das Interessante.« Er streckte den Arm aus und deutete auf die Scans. »Es hat sich herausgestellt, dass bei jeder der Lieferungen für Bacchus ein Container noch in der Nacht, in der die Lieferung eintrifft, mit einem Lkw abgeholt wird, während der Rest später mit dem Zug über dasselbe Nebengleis transportiert wird, das auch hierherführt.«
»Was ist daran so interessant?« Rebecca begriff noch immer nicht, worauf er hinauswollte, doch für ihn schien es offenbar Sinn zu ergeben.
»Tja, die Container, die am Tor abgezeichnet werden – was man hier auf den Unterlagen gut erkennen kann -, scheinen nie in der Containerdatenbank der Hafenbehörde aufzutauchen. Da es unmöglich ist, dass ein Container in den Hafen kommt oder ihn verlässt, ohne auf dieser Liste zu stehen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Container von der Liste entfernt werden, nachdem sie abgeholt wurden.«
»Augenblick mal, müsste das nicht auffallen, wenn jedes Mal ein Teil der Lieferung fehlt?«
»Ja, aber nur, wenn man es auch sehen will. Verstehen Sie? Wenn man jedes Mal einen Container verschwinden lassen will, wäre es doch sehr praktisch, ein geheimes Hintertürchen in der Datenbank zu haben, um das zu vertuschen.«
»Äußerst interessant«, meinte sie. »Aber was hat das mit unserem Problem zu tun? Das Kraftwerk wird nicht per Lkw beliefert.«
»Nein, aber denken Sie daran, dass der Zug, der die Biomasse hierherbringt, automatisch gesteuert wird, sodass er dank der SCADA-Systeme nur aus der Ferne überprüft werden muss, und«, fügte er triumphierend hinzu, »dass der Zug von Prime Logistics geladen und gesteuert wird. Es hat sich herausgestellt, dass das Nebengleis an einem Lagerhaus vorbeiführt, das Prime gehört. Der Zug hält häufig dort, um weitere Container aufzunehmen, die zum Hafen müssen. Diese Phantomcontainer von Bacchus Enterprises, die den Hafen per Lkw verlassen, werden immer wieder mit dem Zug zurück in den Hafen gebracht, wo sie erneut in den Kreislauf kommen, wie man hier in den Unterlagen sieht. Ich vermute, dass wir mehr als Biomasse finden würden, wenn wir diesem Lagerhaus einen Besuch abstatten.«
Roche sah sehr zufrieden aus. Rebecca konnte es ihm nicht verdenken. Seitdem er gestern nach Newcastle gefahren war, hatte er offensichtlich ganze Arbeit geleistet.
»Haben Sie Franklin schon informiert?«
»Noch nicht. Ich konnte ihn bisher nicht erreichen. Was meinen Sie?«
»Das klingt faszinierend. Es wäre auf jeden Fall ein Grund, die Datenbank zu stehlen. Ich denke, wir sollten hier dennoch alles durchgehen. Der letzte Materialverarbeitungsprozess wurde vor zwei Wochen mit Cryptos aktualisiert. Wenn jemand zusätzliche Ladung rein- oder rausschmuggelt, müsste er auf jede Verbindung in der Kette zugreifen, um keinen Alarm auszulösen. Nach Prince’ Tod hätte man mit der Datenbank alle dafür erforderlichen Details.«
»Dann sollten wir uns das Lagerhaus mal ansehen, oder?« Roche klang aufgeregt.
»Ich bin Softwareingenieurin«, erwiderte Rebecca. »Ich gehe nirgendwohin.« Sie hatte nicht vorgehabt, ihm einen Dämpfer zu verpassen, aber es ließ sich nicht ändern. Auch wenn sie zu gerne herausgefunden hätte, was in dem Lagerhaus vor sich ging, und Roche eine ziemlich plausible Theorie hatte, konnten sie beide nicht einfach dort auftauchen. Falls Black Flag die Prime Logistics und die Werkseisenbahn des Kraftwerks nutzte, um Schmuggelware ins Land oder außer Landes zu schaffen, wollte Rebecca nicht diejenige sein, die in das Lagerhaus marschierte und sie dieses Vergehens beschuldigte.
»Ich bin Agent der NCCU und kann gehen, wohin ich will, sobald ein Tatverdacht besteht«, erwiderte er trotzig.
»Sie sollten es Franklin erzählen«, beharrte sie. »Wir können da nicht einfach reinstürmen. Wir könnten da mehr Schaden als Nutzen bewirken.«
»Ach, kommen Sie. Ich will doch bloß wissen, was da los ist. Wir könnten auf dem Rückweg daran vorbeifahren. Wir müssen ja nichts unternehmen. Aber es wäre gut, mal zu sehen, wie es da überhaupt aussieht.«
»Lassen Sie uns erst hier unsere Arbeit machen«, wiegelte Rebecca ab, da ihr klar war, dass Roche sich das Lagerhaus auf jeden Fall anschauen würde, ob sie nun mitkam oder nicht.