Regel Nr. 7: Kümmere dich ums Geschäft
Völlige Anonymität ist unerlässlich. Wer sich nach deiner Identität erkundigt, will dir schaden. Schlage zuerst zu.
Strider ging gern nachts durch die Stadt, am liebsten in den frühen Morgenstunden, wenn die Betrunkenen nach Hause getorkelt waren und alles schlief. Dann glich die City einer Geisterstadt; man konnte kaum glauben, dass man sich mitten in London befand.
Für Strider war das ein einzigartiger Teil dieser Stadt – voller Geschichte und voller Geheimnisse, aber auch seltsam seelenlos. Er war schon häufig durch die Häuserschluchten geschlendert, wenn in den Büros über ihm die Nachtschicht arbeitete, während die Stadt dunkel und leer war. Er kannte jede gewundene Straße auf der Karte und jede kleine Gasse, die es ihm erlaubte, schnell und unbemerkt in den Schatten zu verschwinden. Das Leben schien sich zu dieser Zeit abseits der Straßen abzuspielen, was Strider sehr gelegen kam, denn hier gab es vor allem Geschäfte und Firmen; die Wohnungen lagen viel höher in riesigen Wohngebäuden oder über den Läden und Restaurants. Er hasste es, an den Alltag seiner Zielpersonen erinnert zu werden, und die City lenkte ihn davon ab.
Diesmal war Strider diese Ablenkung besonders willkommen. Er wollte auf gar keinen Fall an den Menschen erinnert werden, den er schon seit Jahren kannte und der jetzt seine Zielperson war – Brown Bear. Strider nannte seine Ziele nicht »Opfer«; dieses Wort implizierte Unschuld und Ungerechtigkeit. Die Menschen, die er tötete, waren schlicht und einfach Zielpersonen.
Sollte man ihn je erwischen, würde man ihn als Soziopathen einstufen. Vielleicht stimmte das sogar. In diesem Fall war er immer schon ein Soziopath gewesen. Man konnte nicht so lange Zeit einem solchen Job nachgehen, ohne auf irgendeine Weise soziopathisch zu sein. Aber Strider hatte das Gefühl, dass noch mehr in ihm steckte. Oder besser gesagt, weniger. Bisweilen gab es in seinem Inneren eine Leere, die darauf wartete, gefüllt zu werden. So auch jetzt wieder.
Wenn Strider seinem Job nachging, fühlte er sich für kurze Zeit, als wäre diese Leere gefüllt, doch nach wenigen Tagen kehrte sie zurück, und ihn überkam erneut das Verlangen, auf die Jagd zu gehen. Die Jagd war das Beste an der ganzen Sache. Meist genoss er es, sich langsam an seine Beute heranzupirschen, bevor er zuschlug. Er sammelte in Ruhe Informationen, brachte in Erfahrung, wie seine Zielperson dachte, wie sie sich bewegte. Es war erstaunlich, wie viel er allein anhand des Suchverlaufs über einen Menschen herausfinden konnte.
Er genoss es auch, sich zu überlegen, auf welche Art die Zielperson sterben sollte und wie er am besten den Anschein erwecken konnte, als wäre sie einen tragischen Unfalltod gestorben – durch einen Flugzeugabsturz, eine Drogenüberdosis, einen Elektroschock, durch Ersticken, einen Autounfall, einen Herzinfarkt. Es gab viele Möglichkeiten, und alle waren endgültig. Wenn man es richtig anstellte, ließ sich alles Nötige aus der Ferne bewerkstelligen, mithilfe moderner Technik. Und es musste fast immer aus der Ferne geschehen.
Normalerweise kannte Strider seine Zielpersonen nur online. Wahrscheinlich kannte er diese Leute besser als die meisten Menschen, die ihnen nahestanden. Aber er wahrte stets eine gewisse Distanz. Gut, es war Teil seines Rituals geworden, ihnen kurz vor ihrem Tod einmal persönlich zu begegnen, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er die Leute deswegen kannte.
Bei seiner heutigen Zielperson war das allerdings anders. Sie hatten schon zusammen Kaffee getrunken, hatten gemeinsam gelacht, und der eine hatte den anderen getäuscht. Irgendwie beruhigte es Strider, dass sie sich gegenseitig etwas vorgespielt hatten.
Eigentlich musste er gar nicht so nah an seine Zielperson heran. Man nannte es »direkter Zugang«, wenn ein Hacker körperlich anwesend sein musste, um den Hack zu beenden. Aber das war heutzutage kaum erforderlich. Strider jedenfalls zog es vor, sich hinter der schützenden Technologie zu verstecken, wenn er tötete. Das lag vor allem daran, dass er das Blut und die anderen Körperflüssigkeiten nicht sehen wollte. Darauf konnte er gut verzichten. Das war ihm zu persönlich und ließ ihn schlecht schlafen.
Es war bereits nach halb fünf, und er war fast am Ziel. In gewisser Weise freute es ihn, dass der Morgen so kalt war, denn so verbarg sein langer schwarzer Mantel seine Bikerjacke, und er schwitzte nicht zu heftig unter der Kurzhaarperücke. Schließlich musste er sich verkleiden, falls er seiner Zielperson vorzeitig begegnen sollte. Sein Motorrad hatte er in einem der vielen unterirdischen Parkhäuser Londons abgestellt, für das er eine Zugangskarte besaß, die auf einen anderen Namen ausgestellt war. Den Rest des Weges wollte er zu Fuß zurücklegen. Er ließ sein Motorrad nicht gerne auf der Straße stehen, das war zu verdächtig. Die schwere Maschine fiel auf.
Vom Parkplatz gelangte Strider nach kurzem Fußweg durch mehrere enge Straßen zur Wohnung seiner Zielperson. Er musste sich nicht beeilen, da er ihre Wege beim Betreten und Verlassen des Hauses dank einer frei zugänglichen digitalen Aufzeichnung der Schlüsselkartenaktivierungen kannte. Die Bewohner konnten die Lobby und den Fahrstuhl nur mithilfe ihrer persönlichen Schlüsselkarte betreten; dank der laschen Sicherheitsmaßnahmen hatte Strider auf das WLAN-Netz des Gebäudes zugreifen und herausfinden können, wann seine Zielperson im letzten Monat das Haus betreten und verlassen hatte. Strider wusste überdies, dass die Zielperson bereits wach war und in einer halben Stunde aus dem Haus gehen würde. Die Zeit war knapp, aber er würde es schaffen.
Dennoch fühlte er sich ein wenig unter Zeitdruck, und das hasste er. Man fiel immer auf, wenn man sich beeilte, besonders zu dieser Tageszeit. Also ging er bewusst langsam, setzte einen Fuß vor den anderen und schaute über die Schulter. Die Straße war menschenleer, wie er es geahnt hatte. Trotzdem war er angespannt.
Sein Atem ließ kleine weiße Wölkchen vor seinem Gesicht kondensieren. Hätte jemand ihn beobachtet, hätte er ihn für einen Mann gehalten, der früh zur Arbeit ging, den Mantelkragen gegen die Kälte hochgeschlagen hatte und sein Gesicht dahinter verbarg. An ihm war nichts Besonderes. Es erstaunte Strider immer wieder, dass man in aller Öffentlichkeit nahezu unsichtbar werden konnte, indem man sich einfach nur normal benahm. Er war ein ganz normaler Mann, der an einem kalten Frühlingsmorgen zur Arbeit ging.
Strider hatte seine Kleidung so gewählt, dass er aussah wie jeder andere, der zu dieser frühen Stunde unterwegs war. Seine Zielperson lebte in der City, da war es nicht ungewöhnlich, dass die Banker schon früh ins Büro gingen. Er wollte so aussehen wie alle anderen Passanten. Er musste unsichtbar sein, konnte sich keinen Fehler erlauben. Niemand durfte ihn hier sehen, niemand durfte wissen, dass seine Zielperson ermordet worden war. Die ganze Sache durfte auf gar keinen Fall mit der Prince-Ermittlung in Verbindung gebracht werden.
Es gab noch viel zu tun, und die Uhr tickte.
Strider wusste, dass seine Besessenheit, was Teddybärs Picknicknetzwerk betraf, gefährlich war. Er befürchtete sogar, dass er deswegen unnötige Risiken einging, aber er konnte es nicht ändern. Seit er mit der Arbeit an diesem Fall begonnen hatte, konnte er nicht mehr aufhören. Das war seine Art, einen Gegner zur Rechenschaft zu ziehen, ihn bezahlen zu lassen für das, was er getan hatte. Er musste Brown Bear beseitigen. Dann würde er eine Zeit lang den Ball flach halten und sich darauf konzentrieren, der NCCA zu helfen, Black Flag auszuschalten. Diese Verbrechertruppe hatte seine Aufmerksamkeit ebenfalls verdient.
Sein Ziel tauchte vor ihm auf, war in der Dunkelheit aber noch nicht richtig zu erkennen. In den oberen Etagen brannten ein paar Lichter, sodass die Fenster aussahen wie Zahnlücken. Als Strider das Gebäude aus den Schatten heraus beobachtete, spürte er das vertraute Kribbeln. Es war fast so weit. Nachdem er ein paar Stunden geschlafen hatte, war er kurz vor Mitternacht als Motorradkurier verkleidet zu dem Gebäude gefahren. Er hatte die Lobby betreten, ohne den Helm abzunehmen, hatte dabei eine abgenutzte, von Londoner Dreck verschmutzte Kurierjacke getragen und dem Wachmann ein Päckchen gegeben, das an seine Zielperson adressiert war. Mit einem leicht osteuropäisch angehauchten Akzent hatte er erklärt, es sei keine dringende Lieferung. Er wusste, dass seine Zielperson sich bereits im Penthouse aufhielt, da er gesehen hatte, wie das Licht aufflammte, aber ihm war auch klar, dass der Wachmann häufig Post entgegennahm und dass er es nicht wagen würde, einen Bewohner nach Mitternacht zu stören, sofern es nicht sehr wichtig war.
Als Strider an den hohen Fenstern der Lobby vorbeiging, stellte er zufrieden fest, dass das Päckchen noch immer auf dem Tresen lag, wo er es zurückgelassen hatte. Er ging um das Gebäude herum, überzeugte sich, dass die Luft rein war, und öffnete dann die Tür des Notausgangs, durch die er in das unterirdische Parkhaus gelangte. Er hatte an diesem Abend ein paar Stunden gebraucht, bis er die Baupläne des Gebäudes gefunden hatte und wusste, was er deaktivieren musste, um unbemerkt hineinzukommen. Anders als in manchen Filmen, in denen Hacker als digitale Safeknacker dargestellt wurden, die in Netzwerke einbrachen, brauchte man für einen erfolgreichen Angriff oft eine Täuschung und die unwissentliche Unterstützung des Opfers, was Strider natürlich wusste. Wenn das Opfer nicht bereitwillig von dem leckeren Apfel abbiss, den man ihm reichte, musste man die Frucht jemandem in dessen Nähe anbieten.
Ein schneller Scan der Onlineaktivitäten aus dem Gebäude hatte ihn auf den gelangweilten Wachmann gebracht, dessen Namen er dank der Auslieferung des Päckchens kannte. Der Mann twitterte fröhlich über sein Smartphone, das natürlich im WLAN-Netz angemeldet war. Binnen weniger Sekunden hatte Strider die E-Mail-Adresse des Mannes ermittelt und ihm eine Mail geschickt. Der Wachmann, das wusste Strider, würde sie unbedingt lesen wollen, nur ließ die Mail sich nicht auf seinem Smartphone öffnen, sodass er seine Webmail über seinen Arbeitscomputer abrufen musste.
Der Trick funktionierte, so wie jedes Mal. Strider lächelte. Es führten immer mehrere Wege zum Ziel.
Die E-Mail, die der Wachmann geöffnet hatte, enthielt scheinbar Fotos von seinen Freunden. Strider hatte die Bilder aus der Freundesliste des Mannes bei Facebook entliehen und die Mail vorsichtshalber so aussehen lassen, als käme sie vom Freund eines Freundes und nicht von einem direkten Kontakt. Wie leicht die Leute sich manipulieren ließen! Sobald der Wachmann das erste Foto anklickte, übergab er die Kontrolle über das Gebäude unwissentlich an Strider. Noch während er die anderen Bilder betrachtete, machte Strider sich bereits an die Arbeit.
Da der Alarm am Notausgang deaktiviert worden war und die Überwachungskameras immer wieder dieselbe Aufnahme des leeren Parkplatzes abspielten, konnte Strider ungestört ins Gebäude, seinen Job erledigen und wieder verschwinden. Er überprüfte kurz, ob sich die Kameras bewegten oder ein kleiner roter Punkt anzeigte, dass der stille Alarm ausgelöst worden war, aber dem war nicht so.
Jetzt konnte es losgehen. Er schaute auf die Uhr. Er hatte noch ungefähr fünfzehn Minuten, also Zeit genug, um zu tun, was er tun musste, und wieder zu seinem Motorrad zurückzukehren, bevor die Jagd begann.
Seine Zielperson war verlockend nahe. Als er die Beifahrertür ihres Wagens öffnete, erhaschte er einen Hauch des Chanel-Parfums, das sie immer benutzte. Coco. Sie war ständig bemüht, gleichzeitig mächtig und sexy zu wirken, zumindest hatte dieser Duft ihm das immer vermittelt. Sie war nie sexy, machte auf andere jedoch den Eindruck, mächtig zu sein.
Ja, sie hatte alles richtig gemacht, aber Strider hatte sie durchschaut. Und jetzt hasste er sie. Hasste sie so sehr, dass …
Hör auf damit, rief er sich zur Ordnung.
Er durfte sich nicht ablenken lassen. Schließlich ging es in die entscheidende Phase. Er liebte diese letzten Augenblicke, bevor er zuschlug. Bevor die Zielperson begriff, dass es zu spät war, um wegzulaufen oder sich zu verstecken. Die Augenblicke vor jenem glorreichen Moment, wenn die Zielperson begriff, dass ihr schmutziges kleines Geheimnis ans Licht gekommen war und dass sie die Nacht nicht überleben würde.
Strider beugte sich in den Prius und öffnete die Plastikabdeckung, hinter der sich der OBD-Anschluss des Wagens befand.
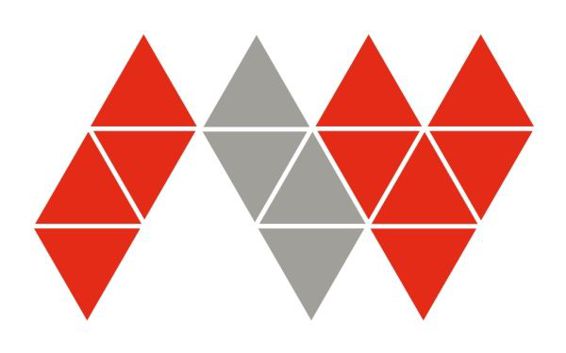
Die Frau in dem engen schwarzen Hosenanzug ging durch das Foyer ihres Apartmenthauses. Ihre Absätze klackten auf dem gebohnerten Marmorfußboden. Sie wohnte gerne hier, da die Umgebung sie stets an das erinnerte, was sie im Leben erreicht hatte. Alle anderen, die hier wohnten, hatten äußerst gut bezahlte Jobs in der City und waren jedes Mal aufs Neue entrüstet, dass jemand wie sie die Penthousesuite bewohnte. Sie tat ihr Möglichstes, den Eindruck zu erwecken, als würde sie nicht hierhergehören, und spürte jedes Mal eine gewisse Zufriedenheit, wenn einer ihrer Mitbewohner die Nase rümpfte, weil er sie rauchend vor der Lobby stehen sah. Natürlich konnte sie auch in ihrer Wohnung rauchen, aber wo blieb da der Spaß?
Ihr war klar, dass es Spekulationen darüber gab, woher sie so viel Geld hatte, aber bisher hatte sie noch niemand gefragt, und es würde auch nie jemand erfahren. Sollten die anderen doch neidisch sein – umso besser.
Sie begrüßte Martin, der in der Lobby hinter seinem Tresen saß, mit einem kurzen Winken. Er war wie immer am Telefon. Martin winkte zurück und versuchte vergeblich, sein Smartphone zu verstecken. Ihr war es egal, da sein Job bestimmt ziemlich langweilig war, insbesondere in einem Haus wie diesem, in dem nichts Schlimmeres passierte, als dass ein paar Bewohner des Nachts betrunken aus einem Klub kamen.
Sie umklammerte die Thermoskaffeetasse und drückte mit dem Fingerknöchel auf die Ruftaste, um mit dem Fahrstuhl ins Parkhaus zu fahren. Ohne ihren Morgenkaffee konnte sie nicht aus dem Haus, und an diesem Morgen war ihr Bedürfnis nach Kaffee besonders stark, da sie einen harten Tag und eine lange Nacht hinter sich hatte. Sie hatte telefoniert, hatte nervöse Spekulanten beruhigt und ihre Kontakte besänftigt. Prince’ Tod hatte viele Leute beunruhigt. Ihr Kontaktmann hatte ihr versichert, alles sei unter Kontrolle; außerdem hätten sie bereits einen Namen, dem sie nachgehen konnten.
Das war alles, was sie interessierte. Prince’ Tod hatte ihnen ziemlich viel Sand ins Getriebe gestreut, und sie wollte, dass jemand dafür bezahlte. So lief das nun mal.
Sie zuckte zusammen, als hinter ihr Martins Stimme ertönte.
»Ach ja … Ma’am!«, rief er. Er hielt einen mittelgroßen gepolsterten Umschlag in die Höhe. »Das hier ist letzte Nacht für Sie gekommen. Per Kurier. Es war nach Mitternacht, und der Mann sagte, es sei nicht wichtig, deshalb wollte ich Sie nicht stören und hab lieber gewartet, bis Sie heute früh bei mir vorbeikommen.«
Sie ging zurück zum Tresen, nahm Martin das Päckchen ab und betrachtete es mit gefurchter Stirn.
»Danke«, sagte sie, als der Fahrstuhl sich mit einem Ping ankündigte.
Sie begutachtete den Umschlag und betrat die Kabine. Er war von Hand adressiert, nur ihr Name stand darauf. Eigentlich erwartete sie nichts, aber sie bekam häufiger Päckchen aus dem ganzen Land. Das gehörte dazu. Sie drehte den Umschlag um, weil sie sich einen Hinweis auf den Absender erhoffte, aber es stand nichts darauf. Als sie vorsichtig auf den Umschlag drückte, stellte sie fest, dass sich etwas Weiches darin befand.
In dem Moment, als sie aus dem Fahrstuhl in das unterirdische Parkhaus trat, sah sie, dass die Tür des Notausgangs einen Spalt offen stand. Zorn erfasste sie. Wieso zahlte man für einen Wachmann und einen gesicherten Parkplatz, wenn die Hintertür nicht abgesperrt war? Darüber musste sie mal ein ernstes Wörtchen mit Martin reden. Vielleicht würde sie sogar die anderen Hausbewohner informieren.
Sie schob sich das Päckchen unter den Arm, knallte die Tür mit der freien Hand zu und legte den Riegel vor, damit sie wieder fest verschlossen war. Dann ging sie zu ihrem Prius und öffnete die Tür mit dem Funkautoschlüssel. Das Warnblinklicht leuchtete in der Dunkelheit auf, und der Wagen piepte zweimal. Sie zog das Kabel aus der Ladestation, stieg ein und warf ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Ein Hybridauto war eigentlich nicht ihre erste Wahl, aber es gehörte zu ihrer Ablenkungstaktik: Menschen, die einen Prius fuhren, gingen nach allgemeiner Einschätzung kein Risiko ein. Der Wagen war sicher, aber langweilig, und genauso wollte sie es haben: Man sollte auch sie für sicherheitsbewusst, aber langweilig halten.
Sie steckte den Kaffeebecher in den Halter auf der Mittelkonsole und hielt das Päckchen mit beiden Händen fest. Noch einmal drückte sie vorsichtig darauf. Es war zu weich und nachgiebig, als dass Sprengstoff darin sein konnte. Kurz entschlossen riss sie es auf und schaute hinein.
Als sie den Inhalt sah, stockte ihr das Herz.
Sie griff hinein und holte einen kleinen braunen Teddybären heraus. In der Dunkelheit des Parkhauses starrte sie das Spielzeug an und drehte es langsam in den Händen, um nach Hinweisen zu suchen. Das war die wohl deutlichste Nachricht, die sie je erhalten hatte.
Jemand wusste, wer sie war.
Sie drehte den Umschlag um und schaute sich noch einmal die Handschrift an. Ihr Name stand in sauberen Blockbuchstaben da. Nichts weiter. Kein Hinweis. Sie warf den Bären wieder in den Umschlag und kramte in ihrer Handtasche nach dem Handy. Als sie es herauszog, stellte sie fest, dass sie im Untergeschoss kein Signal hatte. Sie würde unterwegs telefonieren müssen. Wer immer sie bedrohte, wusste nicht, mit wem er sich anlegte!
Der Motor war kalt, sprang aber sofort an. Sie legte den Rückwärtsgang ein und blickte über die Schulter, als sie zurücksetzte. Dann fuhr sie aus dem Parkhaus und bog nach rechts ab. Es war noch sehr früh, deshalb herrschte wenig Verkehr. Sie wusste, wo auf dem Weg zur Arbeit sich die Radarfallen befanden, und achtete immer darauf, genau mit der richtigen Geschwindigkeit daran vorbeizufahren. Die Digitalanzeige auf dem Armaturenbrett ließ sie erkennen, dass sie sich genau innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen bewegte. Manchmal musste man sich eben an die Regeln halten.
Als sie an der ersten roten Ampel stehen blieb, versuchte sie es noch einmal mit ihrem Mobiltelefon, hatte aber noch immer keinen Empfang. Sie stellte die Heizung ein, damit es im Wagen etwas wärmer wurde, und trank noch einen Schluck Kaffee, während sie darauf wartete, dass die Ampel auf Grün schaltete. Es ärgerte sie jedes Mal, dass das Intervall der Ampeln rund um die Uhr gleich war, obwohl nachts deutlich weniger Verkehr herrschte als tagsüber.
Sie seufzte wohlig, als warme Luft aus dem Gebläse kam. Für einen Frühlingsmorgen war es bitterkalt, aber sie war sich ziemlich sicher, dass ihre Hände unter den gegebenen Umständen auch im Hochsommer gezittert hätten.
Sie stippte eine Zigarette aus der Schachtel, die auf der Mittelkonsole lag, schob sie sich zwischen die Lippen und wartete, dass der Zigarettenanzünder heraussprang.
Hinter ihr hielt ein Motorrad, dessen Scheinwerfer sie blendete, sodass sie den Innenspiegel verstellte. Als die Ampel auf Grün sprang, zündete sie sich die Zigarette an und fuhr los. Dann drückte sie den Knopf, um das Fenster auf der Fahrerseite herunterzulassen, aber es tat sich nichts. Sie versuchte es noch einmal. Immer noch nichts.
»Scheißding«, murmelte sie. Nacheinander drückte sie sämtliche Fenstertasten, aber keines ließ sich öffnen. »In dieser blöden Kiste funktioniert aber auch gar nichts«, schimpfte sie und legte die Zigarette im offenen Aschenbecher unter dem Armaturenbrett ab.
Gereizt fuhr sie über die nächsten Kreuzungen, kurz bevor die Ampeln auf Rot umsprangen. Ihr fiel auf, dass das Motorrad dasselbe tat. Das Dröhnen des Motors blieb ständig hinter ihr.
Seltsam, dachte sie. Warum überholst du nicht einfach?
Sie schüttelte den Kopf. Wieso blieb der Biker hinter ihr? Sie fuhr auf der rechten Spur einer zweispurigen Straße. Sonst nutzten die Motorradfahrer die morgendliche Ruhe, um mit Höchstgeschwindigkeit durch die Stadt zu brettern.
Ihr Magen verkrampfte sich, als ihr ein Gedanke kam. Folgte der Biker ihr etwa?
Als sie das Tempo absichtlich verlangsamte, überholte er immer noch nicht. Sie beschleunigte ein wenig – er tat es ihr nach. Schließlich klappte sie den Innenspiegel zurück, um den Biker in Augenschein zu nehmen. Es war ein großes, schweres Motorrad, also war der Fahrer kein Kurier, aber mehr konnte sie nicht erkennen, das Licht blendete zu sehr.
»Arschloch«, murmelte sie genervt.
Als sie zu der langen Unterführung kamen, die unter der City hindurch verlief, fuhr das Motorrad auf die äußere Spur und verschwand in der Dunkelheit des Tunnels. Sie sah ihm nach, als es an ihr vorbeiraste, aber es fuhr viel zu schnell, sodass sie auch diesmal keine Einzelheiten erkennen konnte. Sie wusste, dass es in der Unterführung eine Radarfalle gab, und hoffte, dass das Motorrad hineintappte, aber sie sah keinen Lichtblitz.
»Schade«, sagte sie grimmig, schaute auf den digitalen Tachometer und stellte fest, dass auch sie ein wenig zu schnell fuhr. Doch als sie den Fuß vom Gas nahm, reagierte der Wagen nicht. Stattdessen wurde er schneller. Die Tachonadel stand inzwischen bei achtzig Stundenkilometern und stieg weiter.
Um Himmels willen, was ist das?
Als sie in den dunklen Tunnel raste, wurde das Licht automatisch eingeschaltet, und ganz kurz sah sie das Motorrad auf dem Mittelstreifen stehen, während sie vorüberhuschte. Inzwischen fuhr sie neunzig Stundenkilometer und wurde immer schneller.
Sie trat so fest auf die Bremse, wie sie konnte. Nichts. Als sie an der Radarfalle vorbeikam, zeigte der Tacho 100 Sachen. Die Kamera blitzte. Wieder trat sie auf die Bremse und zog gleichzeitig die Handbremse, aber der Wagen reagierte noch immer nicht. Panik erfasste sie. Sie beschloss, aus dem fahrenden Auto zu springen, auch wenn sie dabei das Risiko einging, sich sämtliche Knochen zu brechen. Sie schnallte sich ab und wollte die Tür öffnen, aber die Zentralverriegelung war aktiviert.
Verdammt, die Tür geht nicht auf!
Mit 120 Stundenkilometern näherte sie sich der Biegung im Tunnel. Als sie das Lenkrad packte und versuchte, den Wagen um die Kurve zu manövrieren, reagierte die Steuerung nicht mehr.
Ihr war klar, dass sie gegen die Tunnelwand rasen würde, konnte aber nichts dagegen unternehmen. Verzweifelt riss sie das Lenkrad nach links – und genau in diesem Moment hatte sie wieder die Kontrolle über das Fahrzeug, was dazu führte, dass der Wagen sich wild in der Mitte des Tunnels drehte. Verzweifelt trat sie auf die Bremse, die dieses Mal funktionierte, sodass der Wagen auf die Seite geschleudert wurde. Das Fenster auf der Fahrerseite zerbrach mit einem lauten Knall. Sie schrie auf.
Der Wagen drehte sich wie ein Kreisel. Metall kreischte, Funken sprühten. Dann knallte das Fahrzeug mit schrecklicher Wucht gegen die Tunnelwand, wobei sich die Karosserie verzog und das Sicherheitsglas zerbarst. Da sie sich bereits abgeschnallt hatte, wurde sie wie eine Stoffpuppe im Wageninneren herumgeschleudert. Sie spürte, wie ihre Rippen brachen, als sie gegen das Lenkrad stieß, aber der Schrei blieb ihr im Hals stecken, als etwas Spitzes ihre Lunge durchbohrte. Der Wagen prallte von der Tunnelwand ab und kam auf den Reifen zu stehen, wodurch sie aus dem Fahrersitz geschleudert und zur Seite geworfen wurde, sodass ihr Kopf aus dem zertrümmerten Fenster auf der Fahrerseite ragte. Sie spürte die kalte Morgenluft auf ihrem glühenden Gesicht. Aus ihrer Nase und dem Mund liefen Ströme von Blut, das bei jedem Atemzug, zu dem ihre gerissene Lunge noch fähig war, scheußlich blubberte.
Als sie ihre letzten Atemzüge tat, hörte sie, wie das Motorrad langsam näher kam und hielt. Der Motor tuckerte im Leerlauf.
Sie versuchte, die Augen zu öffnen – vielleicht waren sie schon offen -, aber sie konnte nichts erkennen außer undurchdringlicher Dunkelheit. Ihr Atem ging flach.
Dann hörte sie eine Männerstimme direkt neben ihrem Ohr: »Ich weiß, was Sie getan haben. Ich weiß alles. Sie mussten sterben. Der Code verlangt es so.«
Sie erkannte die Stimme auf Anhieb. Die Wut, die wie heiße Lava in ihr hochschoss, war stärker als der allmählich nachlassende Schmerz. Sie spürte, wie der Mann sich abwandte.
»Mitchell«, krächzte sie, während das Blut in ihrer Lunge blubberte. »Dafür wirst du bezahlen. Du wirst …«
Sie verstummte, denn sie hatte keine Luft mehr in den Lungenflügeln. Mitchell sah, wie sie vergeblich zu atmen versuchte. Sekunden später war es vorbei.
Sheila Davies war tot.
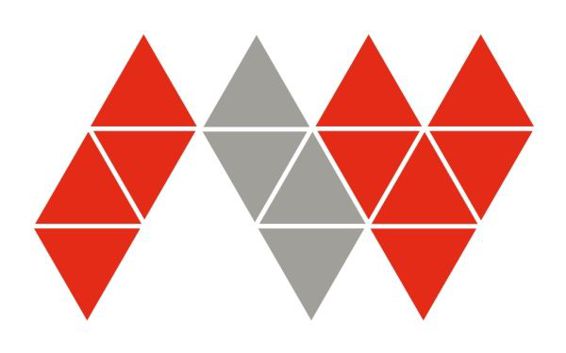
Strider beobachtete, wie das Licht in Davies’ Augen erlosch. Sein aufflackerndes Mitleid wurde verdrängt, als er sich in Erinnerung rief, wer diese Frau wirklich war und was sie getan hatte. Sie hatte pornografische Bilder von Kindern an Leute wie Prince verkauft. Sie hatte ihre Position missbraucht, um wichtige Beweise zu vernichten. Außerdem hätte sie in Kürze herausgefunden, wer Strider wirklich war. Und da sich das Netz um ihn herum zuzog, hatte er keine andere Wahl gehabt, als sie zu beseitigen.
Nun fühlte er sich schmutzig. Sheila Davies hatte ihn Mitchell genannt – aber nicht Mitchell hatte sie getötet, sondern Strider. Und Strider wusste, dass sie es nicht besser verdient hatte.
Jetzt musste er sich beeilen, da es noch einiges zu tun gab, bevor er vom Tatort verschwinden konnte. Schließlich befand er sich in London, und obwohl es noch sehr früh war, konnte jede Sekunde jemand vorbeikommen. Bisher hatte er alles richtig gemacht. Nun war er kurz davor, wieder in den Schatten zu verschwinden.
Rasch ging Strider zur Beifahrertür und öffnete sie. Die zerbeulte Aufhängung quietschte laut im leeren Tunnel. Er kauerte sich hin und entfernte das Gerät, das er mit dem OBD-Anschluss verbunden hatte, um vorübergehend die Kontrolle über den Wagen zu erlangen. Es war eine einfache Vorrichtung, aber er musste sie überarbeiten, damit sie in Zukunft zuverlässiger reagierte. Noch konnte er sich höchstens dreihundert Meter von dem Fahrzeug entfernen, das er mittels dieser Vorrichtung kontrollierte. Deshalb war es riskant gewesen, sie im Tunnel einzusetzen, aber die Wände hatten die Genauigkeit sogar noch verbessert.
Strider steckte das Gerät in die Jackentasche und brachte die Plastikabdeckung wieder an. Er hatte keine Spuren hinterlassen.
Schließlich nahm er den Umschlag mit dem Teddybären vom Rücksitz und schob ihn ebenfalls in die Jacke. Er schloss die Beifahrertür und ging zu seinem Motorrad zurück. Der Motor tuckerte noch immer im Leerlauf, als er auf die schwere Maschine stieg. Langsam fuhr er an und entfernte sich von der Unfallstelle. Er hatte es geschafft.
Als er die Unterführung verließ, sah er ein Taxi, das in die andere Richtung fuhr. Vermutlich hatten die Insassen ihn nicht gesehen, aber sie würden den »Unfall« wahrscheinlich als Erste entdecken, da die Fahrbahnen im Tunnel nur durch Säulen und nicht durch Wände voneinander getrennt waren.
Strider fuhr in eine Seitenstraße und behielt ein paar Minuten lang eine normale Geschwindigkeit bei, bis er den Fluss erreichte. An der Blackfriars Bridge hielt er neben einem Gehweg und stieg ab.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, duckte er sich, entfernte die aufgeklebten Nummernschilder von seinem Motorrad und knüllte sie zusammen. Anschließend zog er die Plastikabdeckung vom Tank, um aus dem blauen Motorrad wieder eine rote Maschine zu machen. Auch diese Plastikfolie knüllte er zusammen und warf sie in den Abfalleimer am Flussufer. Dann zog er den Reißverschluss seiner Jacke herunter, holte das Päckchen heraus und nahm den Teddybären aus dem Umschlag. Aufmerksam blickte er sich um. Niemand zu sehen. Er warf das Spielzeug in den Fluss. Er durfte nicht zu viele Hinweise hinterlassen.
Strider wickelte das Steuergerät, das er aus dem Prius ausgebaut hatte, in den Umschlag und schob es zurück in seine Jacke. Danach stieg er wieder auf seine Maschine, schaltete den Motor ein und lächelte unter dem Helm.
Das ist das Problem mit diesen intelligenten Autos, dachte er, als er losfuhr. Sie können ein Eigenleben entwickeln.