Mädchen 219
Sofiya schreckte hoch und war schlagartig wach. Sie hatte Angst, und das Herz schlug ihr bis zum Hals. In der Ferne konnte sie ein leises Läuten hören. Es klang wie eine Fahrradklingel. Sie wusste nicht, wo sie war, aber es war dunkel und kalt, und es roch wie auf einer Tankstelle.
Wenigstens war sie nicht mehr in der seltsamen Kiste gefangen. Als sie zum ersten Mal aufgewacht war, hatte sie sich in der bedrückenden Enge kaum bewegen können. Diesmal lag sie auf einer weichen Matratze und konnte frei atmen. Sie fühlte sich besser. Vielleicht war sie ja doch noch in der Wohnung und hatte nur schlecht geträumt. Sie hatte oft schlimme Träume.
Sofiya versuchte, den Arm zu bewegen, und stellte erleichtert fest, dass es ihr diesmal gelang. Sie war nicht mehr gefesselt. Aber es ging ihr noch lange nicht gut. Ihre Arme fühlten sich eigenartig an, seltsam schwer und taub. Außerdem war ihr schummrig, und vom vielen Schreien tat ihr die Kehle weh.
Sofiya erinnerte sich, wie ihre Mutter sie und ihre kleine Schwester Anja gestern Abend in der Wohnung ins Bett gebracht hatte. Sie hatte ihnen eine Geschichte vorgelesen; dann hatte sie gesagt, Sofiya solle ein braves Mädchen sein und auf ihre Schwester aufpassen, denn sie, Mom, würde zum Essen nach unten zu Onkel Louie und Tante Renata gehen. Sofiya müsse nur rufen, dann käme sie sofort zu ihr hinauf.
Und Sofiya hatte gerufen – in dem Moment, als sie in der Kiste aufgewacht war. Aber ihre Mutter war nicht gekommen. Sofiya hatte geschrien, bis sie heiser war. Irgendwann war ein hässlicher, glatzköpfiger Mann aufgetaucht und hatte den Deckel der Kiste angehoben. Das Licht hinter ihm war hell gewesen und hatte Sofiya in den Augen gebrannt. Wieder hatte sie zu schreien angefangen.
»Sei still!«, hatte der Mann sie angebrüllt. Vor Angst hatte Sofiya gehorcht. Der Mann hatte sie losgebunden, aus der Kiste gehoben und sie in einer Ecke des Raumes auf einen kalten Metallstuhl gesetzt. Sie befanden sich in einem fensterlosen Zimmer, aber vor der Tür konnte Sofiya Stimmen hören. Sie fragte sich, ob ihre Mutter da draußen war. Vielleicht war ihr im Schlaf irgendetwas passiert, und sie war wieder im Krankenhaus. Sofiya fand, dass der Raum tatsächlich wie ein Krankenzimmer aussah; sie fühlte sich sogar wie damals, als sie wegen einer Operation im Hospital gewesen war. Damals hatte Mom ihr gesagt, sie müsse ein tapferes Mädchen sein, und hatte ihr die Hand gehalten, bis sie eingeschlafen war.
Nach dem Aufwachen war Sofiya schwindlig gewesen. Sie erinnerte sich, dass sie eine Nadel im Arm gehabt hatte. Ein Arzt war bei ihr gewesen und hatte gesagt, sie könne Wackelpudding und Eis zum Abendessen haben. Sofiya wünschte sich, sie könnte jetzt auch Pudding und Eis bekommen. Zwar hatte der hässliche Mann ihr zuvor schon etwas Süßes gegeben, aber das hatte gegen ihren Hunger nichts ausrichten können. Sofiya fragte sich, ob er ihr jetzt wieder eine Süßigkeit geben würde. Aber noch viel mehr wünschte sie sich, ihre Mutter würde kommen.
Langsam streckte sie die Hand aus und berührte ihr Gesicht. Sie spürte, dass ihr Haar nass war von Tränen. Sie hätte nicht weinen sollen. Ihre Mutter sagte immer, große Mädchen weinen nicht. Doch Sofiya spürte, dass ihr schon wieder die Tränen kamen.
Langsam und vorsichtig setzte sie sich auf. Sofort wurde ihr wieder schwindlig, deshalb blieb sie ganz still sitzen und riss die Augen auf, wie die Ärzte es ihr beigebracht hatten, bis sie sich wieder ein wenig besser fühlte. Sie atmete tief durch die Nase, aber der Geruch in diesem Raum war scheußlich. Er erinnerte Sofiya daran, wie ihr einmal im Auto schlecht geworden war; als sie dann zum Tanken anhielten, hatte sie sich auf ihren Schoß erbrochen. Ihre kleine Schwester Anja hatte sie ausgelacht.
Anja, schoss es Sofiya durch den Kopf. Hoffentlich ist sie nicht auch hier. Dann hätte sie schreckliche Angst, noch mehr als ich.
Sofiya rutschte vorsichtig vom Bett und versuchte, stehen zu bleiben, während sie sich an der Bettkante festhielt. Sie hörte ein Klingeln draußen vor der Tür. Es klang wie von einem Fahrrad. War das möglich? Das hier wäre ein seltsamer Ort, um Fahrrad zu fahren.
Der Boden unter ihren nackten Füßen war kalt, sodass sie noch heftiger zitterte. Sie wollte ihre Kleidung suchen, weil sie fror und nicht gerne nur im Slip schlief. Vorsichtig machte sie ein paar Schritte über den kalten Boden und streckte die Arme vor sich in der Dunkelheit aus, um nach etwas zu tasten, woran sie sich festhalten konnte. Als sie hörte, wie ein Schlüssel im Schloss gedreht wurde, erstarrte sie. Hoffnung keimte in ihr auf. Vielleicht war ihre Mutter endlich da.
Die Tür wurde geöffnet, und Licht fiel ins Zimmer. Sofiya hob eine Hand, um die Augen abzuschirmen.
»Mom …«, setzte sie an, verstummte dann aber. Enttäuschung überfiel sie. Es war nicht ihre Mutter. Es war wieder der hässliche Mann. Er hielt ein Tablett in den Händen, auf dem eine Schüssel und ein Saftpäckchen standen.
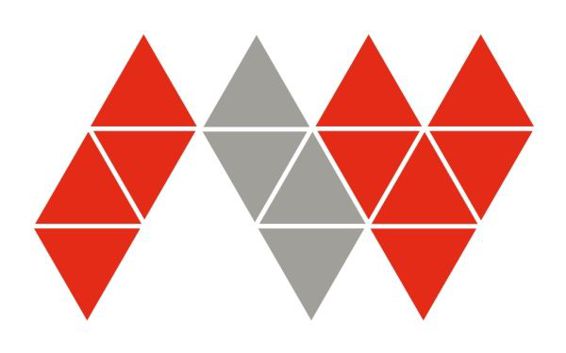
Miguel ging zurück zum Kontrollraum. Das neue Mädchen war wieder wach, aber wenigstens schrie es nicht mehr. Als es zum zweiten Mal bewusstlos gewesen war, hatte er es untersucht. Es hatte eine kleine, saubere Narbe an einer Seite des Brustkorbes, die jedoch nicht frisch zu sein schien. Ansonsten machte es einen gesunden Eindruck. Der Boss würde zufrieden sein.
Miguel inspizierte alle Kinder, die sie einsammelten, mit derselben Leidenschaftslosigkeit. Sie waren für ihn eine Ware. Wie Vieh. Natürlich musste man sie gut behandeln, sonst gab es Ärger mit dem Boss, aber sie brauchten auch keine Sonderbehandlung. Gleich zu Beginn hatte er klargestellt, dass er weder Babysitter noch Arzt war. Es interessierte ihn nicht, ob die Kinder unglücklich oder verängstigt waren oder ob sie Heimweh hatten. Welchem Rinderzüchter machte es schon etwas aus, ob seine Kühe sich vor dem Schlachthof fürchteten oder nicht?
In dem Raum, den Miguel als Büro benutzte, hatte er einen Schreibtisch vor einer Reihe von Monitoren aufgebaut, die Bilder aus jeder Arrestzelle zeigten. Es war spät, und die meisten Kinder schliefen. Er achtete darauf, ihre Medizin so zu dosieren, dass sie alle zur gleichen Zeit schliefen, dann kam er besser mit ihnen klar und hatte nicht so viel Arbeit. Hier wurden zwar nie mehr als sechs Kinder gleichzeitig festgehalten, aber selbst das war Miguel fast schon zu viel. Mit den Neuzugängen von heute waren es wieder sechs, aber er wusste, dass zwei dieser Kinder nächste Woche verschwinden würden.
Er lehnte sich zurück und beobachtete eines der neuen Mädchen. Die Kleine saß in der Dunkelheit auf ihrem Bett. Das Leuchten auf Miguels Monitoren stammte von den Nachtsichtkameras, mit denen er die Kinder überwachte. Sie sollten nichts sehen, weil die Älteren häufig Ärger machten, wenn das Licht brannte. Miguel hatte das Gefühl, dass das Mädchen, das er nun beobachtete, auch zu denen gehören würde, mit denen er kein leichtes Spiel hatte. Die kleine Nervensäge hatte ihn bereits mit ihrem Geschrei wütend gemacht, als er sie hergebracht hatte. Zum Glück gab es hier in der Nähe niemanden, der sie hören konnte, also brauchte er sich deswegen keine Sorgen zu machen. Er war hier draußen alleine – von den Kindern abgesehen.
Miguel war es völlig egal, was mit den Bälgern geschah. Er wusste, dass sie für Sex, unbezahlte Arbeit oder beides gedacht waren. Manchmal kamen sie auch direkt in die Klinik, wo man ihnen ein oder mehrere Organe entnahm, die einem anderen Kind eingesetzt wurden. Ein Kind, das geliebt wurde, um das sich jemand kümmerte. Das Eltern hatte, die verzweifelt und vernarrt genug waren, dass sie nicht mehr warten konnten, sondern für eine Niere, eine Leber oder ein anderes, schwer zu beschaffendes Organ, das dann ihrem eigenen kostbaren Sprössling implantiert wurde, ein Vermögen bezahlten.
Aber das interessierte Miguel nicht. Letzten Endes waren sie alle Tiere. Einige überlebten, andere nicht. Na und? Die Kinder in den Arrestzellen weckten keinerlei Gefühle in ihm. Eines Tages würden sie alle verschwunden sein. Wohin, spielte für Miguel keine Rolle.
Mädchen 219, wie sie genannt wurde, solange sie hier war, saß auf ihrem Bett und schaufelte stupide das Fleisch, den Reis und das Gemüse aus der Schüssel auf ihrem Schoß in ihren Mund. Es gefiel Miguel, dass sie so gründlich vorging. Sie ließ nicht ein Reiskorn fallen. Er wusste, dass ihr das Essen Kraft gab, da es perfekt darauf abgestimmt war, ein Kind ihres Alters mit Nährstoffen zu versorgen, aber er wusste auch, dass sie dank des Schlafmittels, das er in ihren Saft gemischt hatte, bald wieder einnicken würde. Das war Teil seines Jobs. Er sorgte dafür, dass die neuen Kinder ständig ruhiggestellt waren. Dem Boss gefiel das nicht, aber der musste ja auch nicht hier sein, wenn sämtliche Bälger wach waren. Auch wenn es nur sechs waren, ging Miguel der Lärm, ihr ständiges Schreien und Weinen gehörig auf die Nerven.
Innerhalb weniger Tage gewöhnten die meisten Kinder sich an den Gedanken, dass niemand kam, um sie zu retten, und entspannten sich so weit, dass Miguel die Schlafmitteldosis verringern konnte. Danach ging es nur noch darum, ihnen jede Erinnerung an Familie oder Liebe zu nehmen. Bei denen, die ohnehin in die Klinik kamen, musste man keine Zeit für die Umprogrammierung einplanen. Die anderen bekamen regelmäßig Besuch von einem Mann – ein unheimlicher Typ, der sogar Miguel Angst einjagte. Dieser Mann verbrachte viel Zeit mit den Kindern, die er im Verlauf der nächsten Wochen in kleine Roboter verwandelte. Miguel wusste nicht, was der Mann zu ihnen sagte; er saß da, sprach ruhig auf sie ein und hielt ihre Hände in dem schwach beleuchteten Raum, den er »Spielzimmer« nannte, auch wenn es dort kein Spielzeug gab und auch niemand dort spielte.
Nach einigen Wochen teilte der Mann Miguel mit, die Kinder seien bereit und könnten verlegt werden. Dann überließ er sie der Eskorte, die der Boss schickte. Es wurden keine Fragen gestellt.
Der Boss kam nie hierher. Miguel war ihr – ja, der Boss war eine Frau – auch erst einmal begegnet. Es hatte ihn überrascht, dass es eine Frau war, aber das hatte sich schnell gelegt. Sie schien kein Herz zu haben, und Miguel war froh, dass er nicht viel mit ihr zu tun hatte. Sie hatte ihm klargemacht, dass er sich keinen anderen Job suchen musste, wenn er seine Pflichten vernachlässigte, sondern direkt in einem Sarg landete.
Zum Glück wusste Miguel genau, worin seine Pflichten bestanden, und er hatte in den drei Jahren, die er jetzt hier arbeitete, kein einziges Mal versagt. Die Frau überließ es ihm, alles so zu regeln, wie er es für richtig hielt – Hauptsache, er lieferte die Ware, wann und wie sie es verlangte.
Jedes Kind bekam eine Nummer zugewiesen, damit alles seine Ordnung hatte. Als Miguel die Zahl des neuen Mädchens, 219, auf ein Stück Klebeband schrieb, das er über dem Monitor befestigte, versuchte er, sich an die Kinder zu erinnern, für die er bereits gesorgt hatte. Sein erstes Kind war ein Junge gewesen, Nummer 32. Die Kinder waren in einem schlechten Zustand gewesen, als Miguel hier angefangen hatte – sein Vorgänger hatte sie vernachlässigt, nachdem eins von ihnen krank geworden war. Damals waren sie alle zusammen untergebracht, sodass ansteckende Krankheiten sich schnell ausbreiten konnten. Keines der Kinder hatte damals überlebt.
Miguel wusste nicht mehr, wie sie ausgesehen hatten, erinnerte sich aber noch genau daran, wie er die erste Nummer aufgeschrieben hatte, als der neue Junge hergekommen war.
Aber das spielte keine Rolle. Letzten Endes waren sie alle dasselbe: Sie waren Vieh.