


Die Flüchtlinge
Es war kurz vor Tagesanbruch. Der Morgenstern leuchtete wie eine kleine goldene Flamme über dem immer heller werdenden östlichen Horizont.
Ein schwacher Morgenwind kräuselte die Oberfläche der Meerenge zwischen den beiden Inseln, die sich wie dunkle, unförmige Massen aus dem tropischen Meer erhoben.
Ceysén, die größere dieser Inseln, war ganz mit Wald bedeckt. An ihren Ufern wuchsen Mangrovenbüsche; an mehreren Stellen drangen sie bis in das seichte Wasser vor. Nach dem Innern der Insel hin waren die Bäume größer und dichter beieinander: Zaragocillabäume, rote Mangroven und Divi-divis kämpften mit den schlanken Palmen um den Lebensraum. Unweit der Mitte der Insel reckte ein mächtiger Ceibabaum seine kuppelförmige Krone in den Himmel.
Auf der kleineren Insel, die noch nicht einmal einen Namen hatte, gab es nur einige kleine knorrige Bäume, eine Anzahl Strandtraubenbüsche und weiße Mangroven. Sonst bestand der Boden aus feinstem Muschelsand, weiß und weich wie Kreidestaub, wo er nicht mit allzuviel Schneckenhäusern und Muschelschalen vermengt war. Rauhe graue Korallenfelsen ragten zwischen den Sandstellen empor.
Die ganze Insel war nur etwa zweihundert Schritt lang und vielleicht halb so breit, während die Oberfläche von Ceysén wenigstens zehnmal so groß war.
In den Büschen und Baumwipfeln hingen flache, kunstlos zusammengefügte Reisighaufen. Es waren Vogelnester, und in einigen davon saßen große schwarze Fregattvögel mit roten Kehlsäcken und brüteten. Es waren Männchen. Bei den Fregattvögeln wärmt das Männchen das Ei, während das Weibchen ausfliegt und Fische herbeischafft. Im Nordosten, etwa fünf Kilometer entfernt, lag eine zweite kleine Inselgruppe. Weiter ostwärts waren noch mehrere schwach zu erkennen. Sie schienen gleichsam aufs Geratewohl mitten ins Meer hineingestreut zu sein.
Wenn man jedoch an einem sehr klaren Tag auf einen der höchsten Bäume von Ceysén geklettert wäre, hätte man von dessen Wipfel aus eine diesige blaue Linie erkennen können, die wie ein Rauchschwaden über dem südlichen und südöstlichen Horizont lag.
Diese Linie war eine niedrige Bergkette des Festlands, der Nordküste von Südamerika, etwa in der Mitte zwischen der Darienbucht und der Mündung des Magdalenaflusses gelegen.
Diese Namen gab es jedoch noch nicht. Sie wurden der Bucht und dem Fluß von den weißen Männern gegeben, und es sollte noch ein halbes Menschenalter dauern, bis die ersten spanischen und portugiesischen Schiffe den Weg nach den Küsten des neuen Erdteils fanden. Noch ungestört und unbetreten lagen die Inseln in dem tropenblauen Meer, im Licht des anbrechenden Tages, das ständig zunahm. Seeschwalben, Baßtölpel und Fregattvögel waren ihre einzigen Bewohner.
Eine Anzahl dunkler Gegenstände trieb langsam vom Festland her auf die beiden Inseln zu.
Es waren Flöße aus langen, dicken Stämmen des leichten Balsaholzes. Die entrindeten Baumstämme waren mit Stricken aus starken Schlingpflanzen zusammengebunden und dazu mit Querriegeln und Klammern von knochenhartem Suribioholz aneinander befestigt.
An die vierzig Menschen befanden sich auf den sechs Balsaflößen. Es waren Indianer, Arowaken von einem der Bocaná-Stämme, die drüben an der Küste wohnten.
Fast alle waren wohlgestalte Menschen mit dunkelbrauner Haut, hohen und breiten Wangenknochen und glänzend blauschwarzem Haar, das ihnen in glatten Strähnen auf die Schultern fiel. Die Männer waren breitschultrig und kräftig gebaut, wenn auch nicht von besonders hohem Wuchs. Die Frauen dagegen waren untersetzter und hatten weichere, rundlichere Gesichter mit mandelförmigen Augen. Sie trugen eine Art langes Baumwollhemd ohne Ärmel, während die Männer nur kurze Hüfttücher aus festem Stoff umgebunden hatten. Alle trugen Halsketten von Porzellanschnecken, Tierzähnen, fein geschnitzten Knochenstücken oder hübschen Samenkörnern verschiedener wild wachsender Pflanzen.
Die Gruppe bestand aus elf erwachsenen Männern und vierzehn erwachsenen Frauen. Die übrigen waren Kinder und Jugendliche.
Die Erwachsenen und einige der größeren Kinder ruderten — oder richtiger: paddelten — mit kurzen, breitblättrigen Hölzern. Alle sahen müde und niedergeschlagen aus. Mehrere der kleinen Kinder weinten, aber meist lautlos, wie es die Art der Indianerkinder ist.
Die Flöße waren mit Hausrat beladen: mit Körben, Tonkrügen, Töpfen und Schalen verschiedener Größen und Formen. Auf den Stämmen der Flöße lagen fest angebunden Ballen von Stoffen und Baumrinde, Bündel von Fischspeeren und Harpunen und dazu eine Menge unbearbeitete Holz- und Knochenstücke, aus denen man Werkzeuge und Waffen schnitzen konnte, sobald man wieder Zeit zur Arbeit hatte. Am Heck des ersten Floßes saß ein stattlicher Indianer mit einem scharfen Raubvogelgesicht. Er hieß Sägefisch und war der Häuptling der Schar. Trotz seiner Würde hatte er jedoch nicht das entscheidende Wort zu sagen, vor allem, wenn es sich um wichtige und ernste Beschlüsse handelte.
Der Mann, der wirklich regierte und bestimmte, war sein Großvater väterlicherseits, der neben ihm sitzende Medizinmann.
Der alte Medizinmann hieß eigentlich „Stehender Bär", aber da man den wirklichen Namen eines Medizinmannes nicht unnötig auszusprechen pflegte, nannten ihn alle „Großvater Mummel". Die Kinder hatten damit den Anfang gemacht, und als die anderen sahen, daß er es nicht übelnahm, begannen sie sich auch dieses Kosenamens zu bedienen. Er war ein freundlicher Mann, wenn sicher auch viele meinten, er habe recht komische Ansichten.
Dicht neben diesen Männern auf dem großen Floß paddelten zwei junge Burschen, denen man das Haar noch nicht im Nacken abgeschnitten hatte — die also noch keine voll erwachsenen Männer des Stammes waren.
Der eine von ihnen war fast ebenso groß wie der Häuptling, obwohl er dessen kräftige Statur noch nicht hatte. Er war der Schnellste des Stammes, daher wurde er „Läufer" genannt. Sein kluges, aufgewecktes Gesicht war ungewöhnlich fein geschnitten.
Der andere war kleiner und untersetzter, er hatte ein breites Gesicht und schwere Schultern. Vor einigen Jahren hatte ihm jemand einmal einen Stein ins Gesicht geworfen. Seine Nase war nach dem Wurf noch lange Zeit dick und geschwollen, und so hatte man ihm den Namen „Stumpfnase" angehängt. Diesen Namen wurde er nicht wieder los, er mußte ihn behalten, bis er seinen richtigen Männernamen bekam.
Die Bocaná-Arowaken waren friedliche und freundliche Menschen. Solange sich jemand von ihnen entsinnen konnte, und darüber hinaus, hatten sie in ihren kleinen Dörfern an der Küste und an den Flußmündungen gewohnt. Alte Leute erzählten freilich auch, ihre Vorfahren hätten ihre Wohnstätten vor vielen Menschenaltern an den großen Schilfseen gehabt, die im Innern des Landes zwischen der weiten Meeresbucht und dem Sinú-Fluß lagen.
An den Lagunen war es ihnen gut gegangen, bis eine schwere Krankheit unter ihnen ausbrach und viele starben. Da hatte sich der Stamm geteilt, und viele waren an die Küste übergesiedelt, wo es genügend fruchtbaren Boden gab.
Sie bauten dort Mais, Maniokwurzeln und Bataten, Ananas und Baummelonen sowie viele andere Feldfrüchte an. Außerdem waren sie geschickte Weber und Töpfer.
Dazu fischten sie ausgiebig von ihren Balsaflößen und gingen in den Urwäldern auch ein wenig der Jagd nach; aber die Jagd war nicht ihr eigentlicher Erwerb. Das hing wohl damit zusammen, daß sie noch nicht daraufgekominen waren, wie man lange Bogen und Blasrohre anfertigte, wie sie von den anderen Indianern gebraucht wurden, sondern nur Lanzen, Wurfspeere und Harpunen mit Knochenspitzen oder solche aus hartem Holz benutzten.
Mit ihren Nachbarn an der Küste und im Innern des Landes lebten sie im allerbesten Einvernehmen. Oft machte ein Trupp von ihnen einen Besuch in irgendeinem Nachbardorf, und dann veranstalteten ihre Gastgeber Festessen, Tänze und Wettkämpfe im Laufen, Schwimmen und Speerwerfen.
Feinde hatten sie nicht, und sie wußten nicht einmal, was Krieg war, bis das große Unglück über sie kam.
In letzter Zeit war ein fremder Menschenschlag die Küste entlanggefahren gekommen. Er kam aus dem Osten, und die Bocanás hatten schreckenerregende Gerüchte über diese Menschen vernommen, schon lange, ehe diese da waren.
Sie waren kleiner und dunkler als die Arowaken und paddelten keine Flöße, sondern große Kanus, die aus gehöhlten Baumstämmen angefertigt waren.
Pfeil und Bogen waren ihre hauptsächlichsten Waffen, außerdem hatten sie große, schwertförmige Keulen aus hartem, schwerem Holz, an deren Kanten Reihen von Haifischzähnen saßen.
Man nannte sie das „Keb-Volk" — das „Jaguarvolk" — oder gewöhnlich „Kariben", und sie waren so grundverschieden von den BocanáArowaken, wie man sich nur denken kann.
Trotz allem hätte man diese seltsamen Dinge wohl übersehen und die Neuankömmlinge freundlich aufnehmen können, wenn sie nur sonst einigermaßen manierliche Menschen gewesen wären.
Die Kariben hatten jedoch andere und schwerere Fehler. Sie hielten sich für besser als alle anderen Indianer und waren kriegslüstern und raubgierig. Sie liebten es, Jungen und Mädchen aus anderen Stämmen gefangenzunehmen und zur Sklavenarbeit zu zwingen. Die Ärmsten mußten alle schwereren und unangenehmen Arbeiten verrichten, während ihre Herren nur Krieg führten, auf die Jagd gingen oder faulenzten.
Von Dorf zu Dorf wurde flüsternd weitererzählt, die Kariben hätten außerdem die schauerlichste Angewohnheit, die man sich denken könne. Das Gerücht wollte wissen, daß sie — oder doch wenigstens ihre Medizinmänner — Kannibalen seien und Menschen äßen, obwohl niemand mit Sicherheit sagen konnte, ob das stimmte.
Sobald die Kariben herausbekommen hatten, wie friedlich und wehrlos die Bocaná-Arowaken waren, überfielen sie ein Dorf nach dem anderen, um zu rauben, zu plündern und Gefangene zu machen.
Der Schrecken vor den Neuankömmlingen verbreitete sich von Flußmündung zu Flußmündung um die ganze Meeresbucht. Bald lebten
die Menschen in den kleinen Küstendörfern in einer furchtbaren Spannung und warteten nur noch darauf, daß die Kariben kommen und sie auffressen würden.
Die Schar auf den Flößen war mit knapper Not einer solchen Räuberbande entronnen, die ihre drei langen Kriegskanus in der Mündung
einer Lagune versteckt hatte — etwa zehn Kilometer von ihrem Dorf entfernt — und dann durch den Uferwald herangeschlichen war, um das Dorf zu umzingeln und unmittelbar vor dem Morgengrauen zu überfallen, wenn alle am tiefsten schliefen.
Hätten sich der Häuptling und Läufer nicht an einem versumpften See im Walde aufgehalten, um nach Sumpfschildkröten zu sehen, und hätten sie die Karibenkrieger nicht zufällig gesehen, als diese sich auf der anderen Seite des Sumpfes in einer langen Reihe durch das Buschwerk bewegten, dann wäre es ihnen wohl übel ergangen.
Sägefisch sandte Läufer sogleich in das Dorf voraus, um die Leute zu warnen, und der Junge rannte wie noch nie in seinem Leben. In größter Eile luden die Männer und Frauen alle unentbehrliche Habe auf ihre Fischerflöße, und als der Häuptling eintraf, konnten sie abfahren.
Drei Nächte und zwei Tage waren sie nun zu den Inseln unterwegs, die einst ein Fischer ihres Stammes entdeckt hatte, als er vom Wind weit auf das Meer hinausgetrieben worden war.
Nach zwei Tagen und Nächten hatte einige von ihnen Zweifel beschlichen, ob es diese Inseln überhaupt gab; aber gestern abend, als die Sonne gerade untergehen wollte, hatten die Indianer sie verschwommen am Horizont entdeckt. Der Medizinmann hatte den Kurs genau nach den Sternen berechnet, und so waren sie die ganze Nacht hindurch weitergepaddelt. Nun, da der Tag anbrach, mußten sie höchstens noch fünf Kilometer zurücklegen.
Der Häuptling erhob sich von seinem Platz.
Er hielt die Hand über die Augen und spähte über die vom Wind gekräuselte Wasserfläche.
„Wir müssen etwas weiter nach Westen steuern", sagte er. „Hier weht nicht nur der Wind, sondern hier ist auch eine Strömung. Seht dort den treibenden Baumstamm, wie er sich von unserm Kurs entfernt hat! Wenn wir zu weit abkommen, werden wir es nicht schaffen, gegen den Strom nach der Insel zu paddeln. Es sind übrigens zwei Inseln. Eine große und eine kleine. Bei der großen handelt es sich wohl um diejenige, die der alte Fischer Ceysén genannt hat. Er behauptete, es gäbe dort Trinkwasser."
Der Medizinmann nickte. „Du hast scharfe Augen, Sägefisch", sagte er. „Es ist gut für uns, daß wir dich als Häuptling haben. Wenn du die Karibenkrieger nicht rechtzeitig entdeckt und nicht Läufer geschickt hättest, um uns zu warnen, dann wäre es uns wahrhaftig übel ergangen. Es ist dein Verdienst, daß wir noch rechtzeitig fliehen konnten." „Mag sein", antwortete der Häuptling mit einer abwehrenden Gebärde. „Aber dann ist es ebenso ein Verdienst des Jungen. Er ist diesmal gerannt wie ein gejagter Hirsch. Vor allem aber sind wir entkommen, weil uns die Feinde nicht in ihren schnellen Kanus angriffen, sondern den Landpfad entlanggelaufen kamen. Wie denkst du, Großvater: dürfen die Kinder und die Paddler jetzt ein wenig Wasser trinken?"
Der Alte sah in einen großen Tonkrug, der dicht neben ihm stand.
In diesem und einem weiteren Krug befand sich der Rest des Süßwassers.
„Alle dürfen Wasser trinken, jeder eine Muschelschale voll", sagte er. „Dann aber wollen wir nicht eher wieder trinken, als bis wir sicher sind, daß es auf einer der Inseln genießbares Wasser gibt." Die meisten hielten die Wasserzuteilung wohl für recht knapp bemessen, aber sie waren gewohnt, nicht unnötig zu jammern und den Klügsten bestimmen zu lassen. Jeder von ihnen trank seine Wasserration sehr langsam, in kleinen Schlucken, und behielt den Rest noch lange im Munde.
Sie feuchteten ihre trocknen Lippen mit der Zunge an, und ihre müden Augen bekamen neues Leben.
Eine der Frauen wollte ihre Ration den Kindern geben, aber der Medizinmann sah es und verbot es ihr.
„Die Kinder brauchen deine Kräfte nötiger als diese Wassertropfen, meine Tochter", sagte er freundlich. Kaurischnecke nickte wortlos und trank den Rest, wobei ihr Tränen in den Augen standen.
Mit frischen Kräften begannen alle in die Richtung zu paddeln, die der Häuptling ihnen wies.
Drei Stunden später waren die Flöße in dem engen Sund zwischen der größeren und der kleineren Insel.
„Wir legen zuerst an der kleinen Insel an," sagte Sägefisch.
„Dort dürfte es wohl kaum Trinkwasser geben?" meinte zweifelnd eine der Frauen.
„Nein, das wohl nicht, aber wir können uns dort überzeugen, ob eine Gefahr lauert. Sobald ihr anderen an Land seid, nehmen Läufer, Stumpfnase und ich das kleinste von den Flößen und paddeln zu der großen Insel hinüber, um nachzuschauen, wie es dort aussieht. Stumpfnase bleibt auf dem Floß und hält es außer Wurfweite vom Ufer, bis wir anderen zurückkommen. Hier auf der kleinen Insel halten Lange Lanze und Fregattvogel Wache. Sollten wir angegriffen werden, dann müßt ihr selbst bestimmen, was ihr tut — ob ihr bleibt und kämpft oder ob ihr auf eine andere Insel zu gelangen sucht. Aber kommt nicht hinüber, um uns zu helfen, was immer auch geschehen mag!"

Man sah es den Männern an, daß sie von seinen letzten Worten nicht erbaut waren, aber sie nickten zustimmend.
Sie zogen die Flöße aufs Ufer. Das kleinste wurde entladen. Hierauf steckten die drei Kundschafter ihre Steinäxte in die Gürtel von Agavenfasern, prüften die Spitzen ihrer Knochendolche, nahmen ihre besten Jagdspeere mit scharfen Knochenspitzen an sich und bestiegen das Floß.
Etwa fünfzig Meter von der großen Insel entfernt stellten sie auf ein Zeichen Sägefischs das Paddeln ein. Lange saßen sie reglos auf dem Floß, spähend und lauschend. Schließlich sagte Sägefisch: „Ich kann nichts Gefährliches sehen oder hören, aber es kann ja trotzdem Gefahr auf der Insel lauern. Setz uns da drüben an der Korallenbank an Land, Stumpfnase, und halte scharf Ausschau, bis wir zurückkommen."
Der Junge gehorchte ohne Widerrede. Die beiden Kundschafter sprangen ins Wasser, als dieses ihnen nur noch ein kleines Stück über die Knie reichte, und wateten langsam auf das Ufer zu. Sie hielten die Speere wurfbereit.
Währenddessen trieb Stumpfnase das Floß wieder ins tiefere Wasser.
Als der Häuptling und Läufer glücklich an Land waren, verschwanden sie in den Wald und glitten wie zwei Schatten von Baum zu Baum. Ihre nackten Füße bewegten sich fast lautlos.
Zuerst gingen sie ihren Weg gemeinsam, aber als sie die Insel durchquert hatten und am jenseitigen Ufer das Meer durch die Mangrovendickung schimmern sahen, begaben sie sich auf getrennten Wegen zurück. Ungefähr dreißig Schritt hinter dem Uferdickicht bewegten sie sich ganz langsam und wichen oft zur Seite, um sich einen Gegenstand genauer anzusehen.
Eine halbe Stunde später war Sägefisch fast genau wieder an der Stelle, wo sie den Wald erstmalig betreten hatten. Er stand zwischen zwei dicken Baumstämmen verborgen und ließ so etwas wie ein leises Zischeln vernehmen.
Fast im gleichen Augenblick bekam er Antwort. Läufer war ebenfalls zurück.
„Nun, was hast du gesehen?" fragte der Häuptling.
„Keine Spur von Menschen oder gefährlichen Tieren. Keine Schlangen, kein Wild, überhaupt keine Landtiere außer kleinen Eidechsen. Doch Spuren großer Seeschildkröten draußen auf den Sandbänken. Es sieht so aus, als kämen diese in der Nacht dorthin, um ihre Eier zu legen. Ein Teil der Spuren war noch ganz frisch."
Läufer kratzte sich heimlich auf dem Rücken und sagte noch: „Ziemlich viele Moskitos und Sandfliegen."
Sägefisch nickte.
„Ich habe das gleiche gesehen wie du", sagte er, „auch einen kleinen Teich mit Regenwasser zwischen einigen Korallenklippen. Reines, süßes Wasser. Es ist nicht viel, aber es dürfte für uns alle reichen, wenn es hier ebenso oft regnet wie auf dem Festland."
„Du hast das Beste gefunden, Häuptling", sagte Läufer. „Wollen wir nun zurückgehen?"
Gemeinsam wateten sie in das seichte Wasser und winkten Stumpfnase, damit er das Floß näher heranpaddelte.
Von der kleinen Insel her war ein Freudenschrei zu vernehmen.
Es war ja klar, daß keinerlei Gefahr drohte, wenn der Häuptling das Floß bis an den Strand herankommen ließ.
Der Jubel wurde noch lauter, als Sägefisch die Hände wie ein Horn geformt vor den Mund hielt und ein einziges Wort rief: „Ti!" Das bedeutete in der Sprache der Bocaná-Arowaken soviel wie „Süßwasser".
Der alte Großvater Mummet betrat das größte Floß, und ihm folgten die meisten Frauen und Mädchen mit soviel Tonkrügen und Kalebassenflaschen, wie sie nur hatten. Viele Kinder schlossen sich ihnen an, um ihren Durst einmal so richtig zu stillen.
Sägefisch zeigte ihnen den Weg zu dem Süßwasserteich, aber als der Medizinmann ihn erblickte, schüttelte er den Kopf und sagte: „Gut, Häuptling, aber wir müssen mit dem Süßwasser haushalten und unser Essen wenigstens zum Teil in Meerwasser kochen, sonst haben wir vielleicht nicht genug zu trinken, wenn eine lange Trockenzeit eintritt. Und es wird wohl das beste sein, wir bleiben vorerst noch auf der kleinen Insel, denn von ihr aus können wir leicht nach allen Seiten Ausschau halten. Sollten Feinde kommen, dann werden wir sie rechtzeitig sehen und können uns noch in Sicherheit bringen."
Läufer sah den Alten fragend an. Man merkte deutlich, daß er etwas auf dem Herzen hatte.
Jetzt wagte er damit noch nicht herauszurücken, aber als die Frauen mit dem Wasser zurückgefahren waren, näherte er sich zögernd dem Alten.
„Sag doch, Großvater, warum muß denn unser Volk immer vor den Kariben fliehen?" fragte er. „Warum können wir nicht bleiben und kämpfen, so daß ihnen die Lust vergeht, uns zu verfolgen?"
„Du redest, wie du es verstehst, Bürschlein!" fauchte der Alte verdrossen. „Sie haben ihre schnellen Kanus, und wir haben nur Flöße, die sich schwer paddeln lassen. Sie haben Bogen und Pfeile, die auf viel größere Entfernungen töten, als wir den Jagdspeer schleudern können."
Läufer schwieg eine Zeitlang und überlegte.
„Sei mir jetzt bitte nicht böse, Großvater", bat er schließlich. „Ich möchte nur wissen, warum wir nicht auch Kanus und Bogen und Pfeile anfertigen, so daß wir uns verteidigen könnten?"
Der alte Medizinmann setzte eine nachdenkliche Miene auf. Er hielt nicht viel von Veränderungen, sondern sah es am liebsten, wenn alles so blieb, wie er es gewohnt war. Aber gleichzeitig war er gerecht, und er mußte ja zugeben, daß in Läufers Worten viel Vernünftiges lag.
„Kanus vielleicht — könnte sein —, das wäre eine gute Sache — wenn wir nur dahinterkommen würden, wie sie gemacht sind. Aber Bogen und Pfeile? Auf keinen Falll Wir wissen ja nicht einmal, was das für Dinger sind, denn keiner von uns hat sie je aus der Nähe gesehen. Vielleicht können diese nur die bösen Zauberer der Kariben machen. Nein, Taj bewahre uns davor, daß wir uns mit solchen Künsten befassen!"
Läufer gebärdete sich nicht eigensinnig, sondern schwieg und ging seines Weges.
Alten Leuten widersprach man nicht, und erst recht nicht dem Medizinmann. Das war bei den Bocaná-Arowaken nicht üblich und auch bei den anderen Stämmen nicht. Vor allem aber dann nicht, wenn man noch ein Junge war, der noch nicht einmal seinen richtigen Namen bekommen hatte.
Aber denken — das durfte man doch wohl auf jeden Fall? Sich Gedanken über etwas zu machen war übrigens eine der Lieblingsbeschäftigungen Läufers.
Wenn er bloß dahinterkommen könnte, wie die Kariben verfuhren, wenn sie einen Bogen anfertigten! Aber Großvater Mummel hatte schon recht: die Arowaken, die einem Karibenkrieger so nahe gekommen waren, daß sie sehen konnten, wie sein Bogen beschaffen war — die waren nicht zurückgekehrt, um es den anderen zu erzählen.
Das Gerede von der Zauberei nahm Läufer nicht weiter ernst. Natürlich glaubte er an Beschwörungen und Zauberformeln, an Geistertänze und den Tod aus der Ferne. Aber darauf verstanden sich nur große Medizinmänner, und die elenden Kariben konnten ja doch nicht alle Medizinmänner sein!
Soweit war er gerade mit seinen Gedanken gelangt, als er den alten Großvater Mummel nach der kleinen Insel zurückpaddelte.
Als sie getrunken hatten, rief Sägefisch: „Nun machen sich alle daran, etwas zu essen herbeizuschaffen! Die Männer fischen, die Frauen sammeln Muscheln und backen Casabebrot, die Kinder tragen Holz zusammen 1"
Da kam Bewegung in die Indianer. Nun, da sie ihren Durst gelöscht hatten, merkten sie plötzlich, wie hungrig sie nach der langen Fahrt eigentlich waren.
Einige Männer standen bald bis an die Hüften im Wasser und angelten. Ihre Angelhaken bestanden aus Knochen oder Muschelschalen, und die Leinen aus fein gezwirnten Agavenfasern. Als Köder nahmen sie Muscheln oder Krabben, die sie in Tümpeln am Strand gefunden hatten, oder die drolligen Einsiedlerkrebse, die in den Korallenklippen in Löchern lebten.
Die Frauen füllten ihre Körbe mit einer Art der Strombus-Schnecken, die es schon in einer Tiefe von einem Meter zu Hunderten gab. Nachdem sie die Schnecken an Land getragen hatten, zerschlugen sie die Gehäuse mit Keulen und schnitten den Schneckenfuß heraus, der dick und fleischig war. Er wurde alsdann mit Knüppeln mürbe geklopft und lange mit Sorgfalt gewaschen, damit er völlig frei von Sand war. Darauf kochten einige Frauen aus den Schnecken sowie den Bataten und anderen Wurzelknollen, die sie vom Festland mitgebracht hatten, eine Suppe. Sie würzten dieselbe mit getrockneten Kräutern. Andere brieten Fische auf der Glut oder an kleinen Holzspießen, sie räucherten Fische auf Rosten von Zweigen, auf die sie eine Schicht großer Blätter gelegt hatten.
Einige von den Frauen hatten Körbe mit Maniokwurzeln mitgebracht. Sie schälten nun die Wurzeln und rieben sie auf einer Art von Reibeholz. Mit einer Hebelvorrichtung preßten sie den Saft aus der geriebenen Wurzelmasse. Darauf spülten sie diese im Wasser und preßten sie nochmals aus. So entfernten sie den bitteren, giftigen Saft. Nicht alle Maniokarten sind giftig, aber diese war es.
Schließlich trieben sie die Masse zu dünnen Fladen aus, die sie in flachen Tonformen oder auf flachen Steinen am Rande der Feuerstätte buken. Daraus wurde das Casabebrot, und dieses Brot bildete einen Teil der gewohnten Speise der Indianer.
Feuer machte man, indem man einen Stab aus hartem Holz in einem weicheren Holzstück bohrend drehte. Man ließ den Stab äußerst schnell zwischen den Handflächen tanzen, und seine Spitze stand in einem Loch des weichen Holzes. Von diesem Loch führte eine Rinne an den Rand des Holzstücks, und in dieser lag trocknes Holzpulver. Wenn man einige Zeit gebohrt hatte, fing der Rand des Bohrlochs an zu rauchen, und bald bildete sich Glut, die dann Gras oder fein zerpflückten Holzschwamm entzündete.
Es war dies natürlich eine ziemlich beschwerliche Art, Feuer zu machen. Es gehörte große Übung dazu, und außerdem mußte man die richtigen Holzsorten haben. Aber da die Bocaná-Indianer keine andere Art des Feuermachens kannten, mußten sie sich mit dieser begnügen. Gewöhnlich führten sie glühende Holzstücke und ein „Bett". von Holzkohlen mit, wenn sie sich auf einer längeren Reise befanden, aber diesmal war die Warnung vor den Kariben so plötzlich gekommen, daß keine von den Frauen Zeit genug gehabt hatte, den „Feuertopf" richtig fertigzumachen. Die Feuergluten bekamen während der langen Paddelfahrt Meerwasserspritzer ab und waren erloschen, da alle zu müde und zu durstig gewesen waren, um sie richtig zu warten und dem Feuer rechtzeitig neue Nahrung zu geben.
Am frühen Nachmittag war das Essen fertig, und nun holten die Indianer nach, was sie entbehrt hatten. Fast drei Tage und drei Nächte hatten sie nichts Richtiges mehr gegessen, die kleinen Kinder ausgenommen, so daß sie jetzt großen Hunger hatten.
Sehr langsam und vorsichtig begannen sie zu essen, immer nur einige Rissen, damit sie nicht krank wurden. Dann warteten sie ein Weilchen, um dann richtig mit dem Essen zu beginnen.
Alle, außer dem Häuptling, dem Medizinmann und einigen anderen Männern, stopften sich allmählich voll mit Fischen, Schnecken und Casabebrot. Sie aßen nicht hastig oder gierig, aber sie aßen gründlich.
Hierauf legten sich die meisten von ihnen in den warmen weißen Sand unter den Mangrovenbüschen, um zu schlafen. Manche knüpften Hängematten zwischen die stärkeren Bäume. Auf der Insel gab es davon nur einige wenige. Sonst bestand sie aus Buschland, Korallen-I eisen und freien Sandflächen.
Von dem jungen Volk hielt nur Läufer kein Mittagschläfchen. Er hatte auch bei weitem nicht soviel gegessen wie die anderen.
Jetzt ging er quer über die Insel an das andere Ufer hinüber, setzte sich an der Wasserlinie auf einen Korallenblock und schaute über das Meer, in die Richtung, in der das Festland lag.
Man sah es seiner gefurchten Stirn an, daß er über ein schweres Problem nachdachte.
Es war nun einmal so mit Läufer, daß er über alles grübeln mußte. Die meisten Menschen finden sich damit ab, die Dinge mehr oder weniger so hinzunehmen, wie sie kommen, aber das war ihm nicht gegeben. Er gehörte zu den Menschen, die alles durchdenken mußten und stets zu ergründen suchten, warum etwas so und nicht anders war, und die sich ständig fragten, ob man dies oder jenes nicht anders und besser machen könne.
Nach einiger Zeit sprang er von dem Block und fing an, zwischen den Treibholzstücken herumzusuchen, die die Wogen an den Strand geworfen hatten. Ein Holzstück nach dem anderen wandte er um und betrachtete es von allen Seiten.
Die meisten warf er daraufhin wieder weg, aber einige legte er nebeneinander auf eine flache Felsenklippe.
Nach einiger Zeit ging er zurück und sah sich das Holz immer wieder an. Zuweilen schloß er die Augen und stand völlig reglos da, als versuche er, sich an etwas zu erinnern oder sich etwas vorzustellen.
Vor einigen Monaten hatte er nach einem schweren Sturm fünf Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt auf einer Sandbank das angetriebene Wrack eines Kariben-Kanus gefunden. Es war unbrauchbar und wies am Boden zwei gähnende Löcher auf, aber die Form hatte es noch, und die Form war es ja gerade, die er suchte.
Den ganzen Abend und die halbe Nacht hatte er damals wach gelegen, nach dem Palmenblätterdach der Hütte gestarrt und zuweilen die Augen geschlossen und das Kanu so zu sehen versucht, wie es sein mußte. Schließlich war er eingeschlafen und hatte von einem fertigen Kanu geträumt — und war von der Brandung geweckt worden, die draußen wie Donner dröhnte.
Er spürte den Herzschlag bis zum Halse, als er zu der Sandbank gerannt war, wo der Schatz gelegen hatte.
Doch die Sanddüne gab es nicht mehr, und das Meer hatte seine Leihgabe zurückgenommen. Mächtige Brecher schlugen weit den Strand herauf.
Aber die Form war Läufer im Gedächtnis haftengeblieben, und nun galt es nur noch, ihr Ausdruck zu geben, etwas Wirkliches aus ihr zu machen.
Jenes weiche Stück Caracoliholz, das er eben auf die Felsklippe gelegt hatte, ähnelte dieser Form. Wenn er ein bißchen daran herumschnitzte, würde sich die Form vielleicht zeigen und so gestalten lassen, wie sie sein mußte.
Läufer begann nach einer scharfen Muschelschale zu suchen, die er als Messer verwenden konnte. Eine solche fand er bald, und er begann damit an dem Holz zu schnitzen. Die Muschel war jedoch dünn und ließ sich nur mit Mühe festhalten. Er konnte dem Schnitt keine Kraft verleihen. Nun, dann mußte er eben einen Griff daran machen, um richtig schnitzen zu können.
Nachdem er einige Schnitte an einem elastischen Mangrovenzweig angebracht hatte, gelang es ihm, diesen abzubrechen. Es war guter Werkstoff, hart und zäh. Er bog ihn um die Muschel und begann ihn mit einer Faserschnur festzubinden. Auf diese Art pflegten die Arowaken ihre Steinäxte am Stiel zu befestigen.
Er war so in seine Beschäftigung vertieft, daß er dabei am Strand auf und ab zu gehen begann, ohne zu grübeln.
Da ertönte dicht über seinem Kopf ein scharfer Schrei.
Läufer wandte den Blick nach oben. Eine Raubseeschwalbe, die ihre Jungen am Strand zwischen Muscheln und Treibholz versteckt hatte, stieß wütend auf ihn herab. Unwillkürlich wich er zur Seite.
Im selben Augenblick geschah etwas. Die halbfertige Umwicklung löste sich, als er den Daumen von ihr nahm. Der federnde Zweig rich tete sich gerade und schleuderte die Muschelschale mehrere Meter weit.
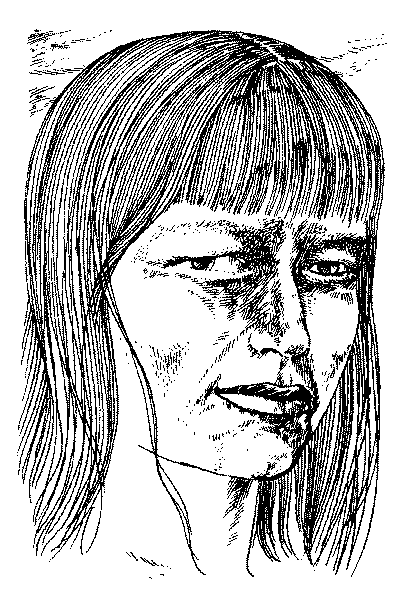
Läufer tat einen Schritt nach der Schale, um sie aufzuheben. Doch da blieb er unvermittelt stehen. Ein neuer Gedanke schoß ihm durch den Kopf. Lange starrte er schweigend der fortgeflogenen Muschel nach, als habe er ein Gespenst gesehen.
Ein federnder Zweig, eine straff gespannte Faserschnur — und ein leichter, scharfer Gegenstand, der fortgeschnellt werden konntel Das war die Antwort auf eine wichtige Frage, die er sich seit langem stellte. Jetzt kannte er das Geheimnis der Kariben.
Oftmals hatte er Zweige zurückschnellen sehen, wenn er selbst oder ein anderer sie losließ, aber noch nie hatte er darüber gründlicher nachgedacht. Nun schien es, als sei auch in ihm etwas zurückgeschnellt. Er kniff die Lippen zusammen, suchte eine schärfere Muschelschale und begann eifrig noch mehr Zweige abzuschneiden.
In diesem Augenblick kam Sägefisch aus den Uferbüschen und trat zu ihm.
„Was machst du da, Junge?" fragte er. „Willst du einen Korb machen?"
Läufer sah von seiner Arbeit auf und begegnete dem Blick des Häuptlings.
„Ich denke mir gerade etwas aus, das wir wahrscheinlich dringender brauchen als alles andere", antwortete er ernst. „Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen muß, damit es brauchbar wird. Häuptling, würdest du mich nach der größeren Insel hinüberfahren und einige Zeit dort bleiben lassen — ganz allein?"
Sägefisch furchte die Stirn.
Wäre ihm irgendein anderer von den Burschen mit einem solchen Verlangen gekommen, dann hätte der Häuptling wohl mit einem Nein geantwortet. Jetzt, wo man soviel zu tun hatte, war nicht die rechte Zeit, jemanden zu beurlauben. Mußte man doch Lebensmittelvorräte beschaffen, Regendächer bauen, Fischfanggeräte herstellen und vieles andere mehr.
Ganz zu schweigen davon, daß man scharf Ausschau halten mußte, ob etwa Kriegskanus der Feinde nahten.
Aber andrerseits war Läufer kein Faulpelz, sondern ein geschickter und williger Junge. Es konnte ja sein, daß er wirklich etwas Wichtiges vorhatte. Wenigstens schien er es selbst zu glauben.
Der Häuptling nickte nachdenklich.
„Ja, ich gebe dir Urlaub, wenn du meinst, daß es irgendwie nützlich für uns sein kann. Worum handelt es sich?"
Läufer schaute über das weite Meer und zögerte mit der Antwort. Er wußte selbst nicht recht, woher er den Mut nahm, so mit dem Häuptling zu reden.
„Würdest du mir die Antwort ersparen, bis ich meiner Sache ganz sicher bin?" fragte er schließlich mit verhaltener Stimme.
Sägefisch sah ihn scharf an.
„Wie du willst", sagte er. „Ich verlasse mich auf dich, Junge l"
Früh am nächsten Morgen paddelte Läufer über den Sund nach der großen Insel hinüber.
Er hatte Feuer mitgenommen und einen kleinen Tontopf, eine Steinaxt, einige Schaber aus Sandstein und Muschelschalen, sein gesamtes Fischgerät und den Wurfspeer; dazu eine ganze Menge Stöcke, Stäbe und Holzstücke — Material für Speere und Harpunenschäfte.
Einiges hatte er von Sägefisch erhalten, manches andere selbst vom Festland mitgebracht; und drei lange, gerade Stücke feines schwarzes Palmenholz hatte er bei Habichtfeder gegen zwei seiner schönsten Halsbänder — eins aus Kaurischnecken und eins aus Krokodilzähnen eingetauscht.

Der Erfinder
Die Arowaken wohnten nun schon fast vier Wochen auf der kleinen Insel im Korallenmeer.
Irgendwelche feindliche Kanus hatten sie nicht gesehen. Das Wetter war die ganze Zeit schön gewesen, und der Fischfang hatte sich recht gut für sie angelassen, aber trotzdem waren sie mit ihrem Dasein nicht recht zufrieden.
Alle hatten ihre mitgebrachten Feldfrüchte bereits in den ersten Tagen aufgebraucht, noch ehe sie richtig dazu gekommen waren, sich ihre Nahrung aus dem Meer zu beschaffen. Es wäre auch sinnlos gewesen und hätte nichts genützt, wenn sie versucht hätten, sparsam mit den Vorräten umzugehen. Maniokwurzeln und Süßkartoffeln halten sich nicht lange.
Das einzige, was sie von den mitgebrachten Lebensmitteln noch besaßen, war etwas Mais, den man zu einer Art grobem Mehl zerstoßen und dann geröstet hatte. Er wurde in Beuteln aufbewahrt, die man in den Rauch der Kochfeuer hängte.
Dieser Mais war der Notproviant, den man nicht anrühren durfte, solange es etwas anderes zu essen gab.
Die Indianer waren gewohnt gewesen, fast jeden Tag Maissuppe, Casabekuchen und geröstete Bataten zu essen, ganz zu schweigen von dem Salat aus Iraca-Schößlingen und verschiedenen Arten von Bohnen, kleinen gelben Tomaten und saftigen Früchten.
All dies mußten sie jetzt entbehren. Die einzigen eßbaren Früchte, die es auf den Inseln gab, waren die runden schwarzen Beeren der Strandtraubenbüsche, und die waren nur gut für den Durst, den Magen füllten sie nicht.
Daher war es gar nicht so verwunderlich, daß die Arowaken manchmal mürrisch waren und meinten, das Essen sei zu einförmig.
„Brrrl" machte Lange Lanze, als er in ein und derselben Woche zum fünftenmal Seebarsch zum Frühstück bekam. „Fische und Muscheln und Muscheln und Fische, niemals etwas anderes! Wenn man doch bloß mal ein richtiges Stück fetten, saftigen Hirschbraten und eine große Schüssel Maisbrei oder frisch gekochte Bohnen essen könnte!" Seine Frau dachte sicher genau wie er, aber sie ärgerte sich doch so sehr, daß sie fast weinte.
„Das mußt du dem sagen, der das Essen heimbringt!" entgegnete sie zornig. „Warum paddelst du nicht hinüber zum Festland und holst ein paar Körbe Mais und Wurzelknollen von unseren Feldern? Und wenn es nur das Essen wäre, dann wollte ich noch nicht einmal etwas sagen. Aber auf diesem elenden kleinen Inselflecken gibt es ja auch keine Baumwollsträucher, so daß ich weder spinnen noch weben kann, keine Agaven, um Gürtel davon zu machen, und kein Sumpfgras mit starken Fasern. Wenn wir lange hierbleiben, werden wir am Ende alle nackt herumlaufen wie diese widerlichen Kariben, die mehr Kobolde als Menschen sind. Und dann werden wir mit der Zeit wohl auch Menschenfresser — wenigstens einige von uns. Das würde dir wohl passen, du widerliches, gefräßiges Untier!"
Lange Lanze hütete sich, ihr zu antworten. Er wußte aus langer Erfahrung, daß es keinen Zweck hatte, verständig mit Kaurischnecke zu reden, wenn sie so gelaunt war. Er mußte warten und versuchen, sie auf andere Weise wieder zu besänftigen.
Am selben Abend fuhren er, Fregattvogel und Habichtfeder mit einigen von den Jungen nach der größeren Insel hinüber und legten sich im Ufergebüsch auf die Lauer. Sie wurden von den Mücken und den kleinen Sandfliegen grausam gebissen und zerstochen und mußten doch geduldig warten; aber als der Vollmond seinen höchsten Stand am Himmel erreicht hatte, wurde ihre Geduld belohnt.
Eine große grüne Suppenschildkröte krabbelte auf eine lange Sandbank, um dort ihre Eier zu legen.
Als die Indianer aus dem Gebüsch stürzten und ihr den Rückweg zum Wasser verlegten, zog die Schildkröte nur Kopf und Beine in ihren Panzer zurück, so weit sie konnte. Das war ihre Art, Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen; aber diesmal war es vergebens.
Die Indianer schoben zwei dicke Hebelstangen zwischen ihren Bauchpanzer und den Erdboden und wälzten sie auf den Rücken. Da lag sie, griff mit den Schwimmbeinen plump in die Luft und war völlig hilflos. Diesen Trick kann man nicht bei allen Schildkröten anwenden, denn manche Arten können sich wieder in die richtige Lage bringen, aber bei der großen Suppenschildkröte macht er sich gut.
Alle im Lager aßen Schildkrötensuppe, Schildkrötenbraten und Schildkröteneier, die man in der heißen Asche gebraten hatte. Der Schmaus dauerte zwei Tage, dann galt es wieder mit Fischen und Muscheln vorliebzunehmen.
Es war übrigens ganz gut, daß die Schildkröte so rasch aufgezehrt wurde, denn von allen Gerichten ist Schildkröte wohl dasjenige, das man am schnellsten überbekommt, wenn man nichts anderes zur Abwechslung hat.
Die Bocaná-Arowaken waren sicher eins von den friedlichsten Völkern, die man sich nur denken kann; aber das einförmige Essen begann sich bei den meisten allmählich bedrückend auf die Stimmung auszuwirken.
Eines schönen Tages wurden ihre Gedanken jedoch auf etwas anderes gelenkt.
Einige von den Frauen waren wie gewöhnlich ins Meer hineingewatet, um große Strombus-Schnecken und Muscheln vom Meeresboden aufzusammeln. Davon gab es jetzt nicht mehr soviel wie vor einigen Wochen. Die Frauen mußten deshalb etwas weiter vom Ufer weggehen, um die größten und besten zu finden. Sie mußten sich nur davor hüten, auf einen der schwarzen Seeigel zu treten, die hier und da in großen Haufen lagen und ihre langen, nadelspitzen, giftigen Stacheln nach allen Seiten spreizten. Es schmerzt kaum etwas so sehr wie ein Stich von einem Seeigelstachel.
Strandlilie, Kaurischnecke und zwei weitere Frauen waren gerade dabei, eine Anzahl großer Schnecken an einer Stelle heraufzuholen, wo das Wasser ungefähr einen Meter tief war. Das bedeutete, daß sie jedesmal richtig untertauchen mußten, da sie ja nicht besonders groß waren.
Zuweilen bekam eine von ihnen das Übergewicht, wenn sie eine Schnecke vom Meeresboden heraufholen wollte, und kam mit den Beinen nach oben. Das machte ihnen jedoch nicht das geringste aus,• denn sie alle konnten schwimmen wie Ottern.
Sie lachten bloß über ihre nassen Purzelbäume und rangen das Meerwasser aus ihrem langen schwarzen Haar.
Da sah die Schwägerin des Häuptlings, Lachauge, einige besonders große und schöne Schnecken, die im tieferen Wasser lagen. Die wollte sie natürlich gern haben, um diese dann oben auf die anderen im Korb legen zu können.
Lachauge stieß sich mit den Beinen ab und tauchte weit hinaus.
Durch das kristallklare Wasser konnten die anderen Frauen sehen, wie sie mit jeder Hand eine riesengroße Schnecke packte.
Im selben Augenblick stieß Strandlilie einen lauten Schrei aus: „Barracuda!"
Ein langer, schmaler Fisch kam aus dem tieferen Wasser herangeschossen, geradewegs auf die tauchende Frau zu. Alle sahen, daß es ein Barracuda war, einer von den großen Pfeilhechten mit den dunklen Querstreifen, die wohl die gefräßigsten und raubgierigsten aller Fische des Meeres sind.
Ein ausgewachsener Barracuda kann dem Menschen ebenso gefährlich werden wie ein Hai, und dieser war wenigstens zwei Meter lang. Die Frauen schrien aus Leibeskräften und schlugen mit den Handflächen auf die Wasseroberfläche, daß es klatschte, um den Raubfisch zu vertreiben. Aber der Barracuda ist nicht feige und nicht so leicht zu erschrecken wie die meisten Haie. Er ließ sich nicht verjagen, sondern machte eine jähe Wendung und grub seine langen, scharfen Zähne in das eine Bein der Tauchenden.
Mehrere Männer hatten das Schreien gehört und kamen mit erhobenen Harpunen angerannt. Einer von ihnen stürzte sich ins Wasser und bekam das Mädchen am Arm zu fassen, als dieses in einem Strudel blutigen Schaums an die Oberfläche kam.
Der Barracuda riß und zerrte an seinem armen Opfer wie ein ausgehungerter Wolf.
Mit vereinten Kräften gelang es zwei Männern, die Verletzte in flacheres Wasser zu ziehen. Erst dann ließ sie der große Raubfisch los und schwamm ins tiefe Wasser hinaus.
Steinmesser und Habichtfeder schleuderten ihm ihre Harpunen nach, aber sie trafen ihn nicht.
Lachauge war sehr böse zerbissen. Sie hatte mehr als zwanzig tiefe Wunden, die ihr die furchtbaren wie derbe Nägel aussehenden Hauzähne geschlagen hatten. Aus der einen Wade war ein großes Stück Fleisch herausgerissen.
Der Medizinmann lief so schnell herbei, wie ihn seine alten Beine trugen, murmelte Beschwörungen und legte Verbände von Heilkräutern auf die Wunden. Schließlich gelang es ihm, das Blut zu stillen; aber die arme Lachauge kam bei diesem Abenteuer nur mit knapper Not mit dem Leben davon.
Aber damit nicht genug.
Als einige Frauen und zwei Männer am nächsten Morgen hinaus-wateten, um Schnecken zum Frühstück zu holen, kam der Barracuda wie ein Speer angeschossen, noch ehe sie eine Tiefe von einem Meter erreicht hatten.
Glücklicherweise erblickten sie ihn rechtzeitig, so daß sie sich auf eine Sandbank retten konnten; aber das Untier wollte sich nach seinem mißglückten Überfall nicht davonmachen. Die Indianer sahen, wie der Barracuda im tieferen Wasser hin und her schwamm, als warte er nur auf eine neue Gelegenheit.
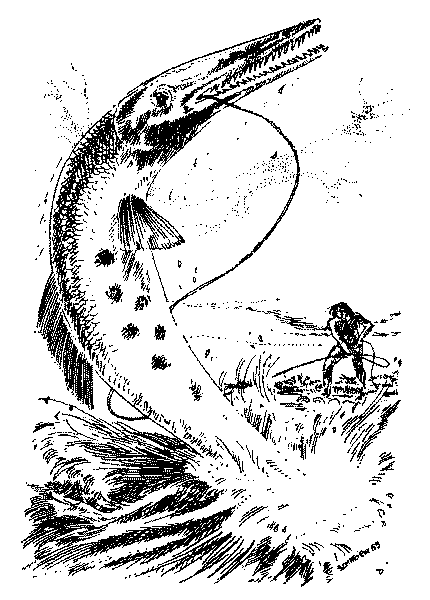
Sägefisch und Habichtfeder fuhren auf einem kleinen Floß hinaus und nahmen ihre besten Harpunen mit, aber der Barracuda schien zu ahnen, daß sie gefährlich waren, und zeigte sich nie in Wurfweite. Er schwamm jedoch viel schneller hin und her, als die Männer das schwerfällige Floß hantieren konnten.
Stumpfnase nahm eins von den anderen Flößen und versuchte ihn mit seinem besten Knochenhaken und einem lebenden Fisch als Köder zu angeln.
Zuerst schien der große Fisch argwöhnisch zu sein, aber als der Köder weit genug von dem Floß des Anglers fortgetrieben war, schoß der Barracuda plötzlich heran und schnappte nach ihm. Er hätte den Indianerjungen beinahe kopfüber ins Wasser gerissen, als er mit dem Haken im Rachen davonschnellte. Vorsorglich hatte Stumpfnase das freie Ende der Angelschnur an einen der Floßstämme gebunden, und so brauchte er die Schnur nur behutsam anzuziehen und wieder loszulassen, so daß der Barracuda sich selbst müde arbeitete.
Trotz seiner Jugend war Stumpfnase ein geschickter und erfahrener Angler, der schon große Fische gefangen hatte.
Lange war die Schnur gespannt wie eine Geigensaite, und das Floß wurde hin und her gezogen, während der Barracuda sich bald oben an der Wasseroberfläche tummelte und meterhoch heraussprang, um sich loszureißen, bald in die Tiefe hinabstieß und sich am Meeresboden zwischen den Korallenfelsen zu verstecken suchte.
Der Indianerjunge zog und nickte aus Leibeskräften an der Schnur, aber zunächst war der Fisch noch stärker als er.
Plötzlich fiel die gespannte Schnur schlaff zurück. Stumpfnase holte sie mit finsterer Miene ein. Er ahnte, was geschehen war.
Der Haken war fort. Die scharfen Zähne des Barracuda hatten die Schnur unmittelbar über dem Knoten abgebissen.
Wie der Fisch sich dann von dem knöchernen Haken befreien konnte, ist schwer zu sagen. Vielleicht gelang es ihm, diesen an einem Korallenast auszubrechen. Jedenfalls war er während der nächsten zwei bis drei Stunden verschwunden. Dann kam er wieder.
Nun biß er nicht mehr auf Köder, aber man brauchte nur einige Meter vom Strand ins Wasser zu waten, um ihn wie einen Blitz heranschießen zu lassen. Es sah fast so aus, als sei er entschlossen, sich wegen des Fangversuchs zu rächen.
Der Medizinmann schaute bekümmert drein. Die wichtigsten Bestandteile der täglichen Nahrung hatten sie ja doch gerade dadurch gewonnen, daß die Männer hinauswateten und angelten oder die Frauen verschiedene Arten von Tieren vom Meeresboden auflasen.
Nun war das nicht mehr möglich. Es war lebensgefährlich, in tieferes Wasser hinauszuwaten oder -zuschwimmen, solange sich dieses Untier in der Nähe befand.
Die Männer konnten natürlich auch weiterhin Fische von den Flößen aus angeln und harpunieren. Aber für etwa vierzig Menschen brauchte man schon große Mengen von Fischen. Das Essen wurde noch einförmiger, als man nicht mehr nach Muscheln, Schnecken und Krebsen zu tauchen wagte.
Der Fischfang war ebenfalls ungewöhnlich schlecht. Er sah aus, als ob der raubgierige Barracuda nicht nur die Menschen bedrohte, sondern auch die der Ernährung dienenden Fische aus der Nähe der Insel vertrieb.
So lagen die Dinge, als Sägefisch nach Ceysén hinüberpaddelte, um nach Läufer zu sehen.
Sie hatten nicht wieder miteinander gesprochen, seitdem sie sich vor mehreren Wochen am Strand getrennt hatten. Der Junge war wie vom Erdboden verschluckt, niemand auf der kleinen Insel hatte ihn auch nur flüchtig gesehen oder bemerkt, wenn man von dem Rauch seines Kochfeuers absah.
Nun wollte der Häuptling wissen, was aus seinem geheimnisvollen Plan geworden war.
Es dauerte nicht lange, und er hatte den Jungen gefunden. Läufer hatte ein kleines Feuer angebrannt und war gerade dabei, sich aus Strandmuscheln eine Suppe zu kochen, als Sägefisch aus dem dichten Gebüsch trat und sich ihm gegenüber auf den Stamm eines umgefallenen Baums setzte.
Beide schwiegen eine Zeitlang.
„Nun", fragte endlich der Häuptling, „hast du gefunden, was du gesucht hast?"
Läufer antwortete nicht sogleich, aber er hob den Kopf. Nun sah der Häuptling, daß er sich sehr verändert hatte. Innerhalb so kurzer Zeit
fast in einem erschreckenden Grade. Er war so abgemagert, daß ihm die Rippen herausstanden wie Weiden aus einem Korb. Das lange schwarze Haar hing ihm struppig und ungekämmt um die Schultern. Das Hüfttuch bestand nur noch aus Fetzen auf dem Leibe, als habe er versucht, Faden um Faden herauszuziehen.
Am meisten hatte sich jedoch der Ausdruck seines Gesichts verändert. Es war jetzt nicht mehr eifrig und jungenhaft, sondern hatte einen Zug von stillem Ernst bekommen.
„Ja", antwortete er nach einigen Minuten, „es sieht so aus. Ich habe so etwas wie eine Antwort erhalten. Mit der Zeit wird das sicher noch besser werden, aber für den Notfall taugt es schon so, wie es jetzt ist."
Er hielt die Hände vor sich hin und sah sie an. Sie waren voller Schwielen und Reibwunden; sie zeugten von harter Arbeit.
„Wenn das alles ist, was du mir zu zeigen hast, dann ist es wohl am besten, du kommst mit mir zurück", sagte Sägefisch mit sorgenvoller Miene. „Die Schwester meiner Frau wurde vorgestern von einem großen Barracuda angegriffen. Wir konnten sie noch retten, aber nun schwimmt das Untier von einem Fisch den ganzen Tag am Strand hin und her, als ob es uns bewacht. Viele beginnen schon zu glauben, dieser Barracuda sei gar kein richtiger Fisch, sondern ein böser Wassergeist, den die elenden Zauberer der Kariben hergeschickt haben, um uns Schaden zuzufügen. Er kommt nie in die Reichweite einer Harpune, und er beißt nicht am Haken an. Da wir unsere Nahrung nun nicht mehr vom Meeresboden auflesen können, muß jeder Mann und jeder Junge im Dorf von den Flößen beim Angeln helfen."
„Ein Barracuda, der Menschen frißt, hast du gesagt, Häuptling?" Läufer erhob sich so voller Freude, als hätte man ihm anstatt schlechter Nachrichten eine recht gute überbracht. „Dann komm, wir wollen ihn gleich aus dem Meer ziehen, damit wir ihn noch zum Mittagessen zubereiten können!"
„Glaub mir, das ist nicht so leicht getan. Ich sagte dir doch schon, er beißt auf keinen Köder und scheint genau zu wissen, wie weit wir einen Speer werfen können."
„Sicher ist es so, wie du sagst, Häuptling. Aber ich glaube kaum, daß er weiß, was ich für ihn bereithalte — mag ihn getrost ein böser Medizinmann geschickt haben."
Läufer trat an einen alten, schräg geneigten Baum und steckte die Hand in dessen hohlen Stamm.
„Sieh ihn dir an, Häuptling!"
Er wandte sich um und hielt einen leicht gekrümmten Stab in die Höhe, der auf der einen Seite glatt und auf der anderen halb gerundet war und an beiden Enden Einkerbungen hatte. Der Stab war genauso lang wie er selber.
Läufer drückte ein Knie gegen den Stab und bog ihn stärker. Als er krumm genug war, spannte er einen Strang aus gewachsten Fasern zwischen die beiden Einkerbungen.
Dann entnahm er dem Versteck einen Pfeil, setzte das Pfeilende auf die Mitte des Strangs und spannte den starken Bogen mit einem langen, sehnigen Zug.
„Siehst du den großen grauen Fleck da drüben an dem Baumstamm?" fragte er.
Und schon ließ er den Pfeil fliegen. Dieser schlug in den Baumstamm und blieb dort zitternd einige Finger breit neben dem Ziel stecken. Sägefisch sprang von seinem Platz auf und stürzte an den Baum, in dem der Pfeil stak. Er streckte die Hand aus und berührte ihn, als traue er seinen Augen nicht.
„Ein richtiger Bogen!” sagte er schließlich. „Und du kannst auch damit schießen. Aber mir scheint, irgendwie ist er anders als die Bogen der Kariben, obwohl ich diese natürlich nur von weitem gesehen habe."
„So soll es ja auch sein, er soll anders sein als die Bogen der Kariben!" erwiderte Läufer heftig. „Dies ist ein arowakischer Bogen. Unser Bogen, Häuptling! Nimm diesen hier, er soll dir gehören. Ich habe noch einen Bogen und mehrere Pfeile hier in dem Baum, und ich werde noch viel mehr anfertigen, sobald ich kann. Wenn du willst, können wir ja Zielschießen auf den Barracuda machen, da werden wir ja sehen, ob karibische Zauberfische arowakischen Pfeilen gewachsen sind!" Er hielt einige Pfeile aus leichtem, festem Mangeletaholz in die Höhe. Jeder von ihnen war mit einer furchtbaren Spitze versehen,woran sich zwei Reihen von Widerhaken befanden, angefertigt aus den Stacheln, die der Stachelrochen an seinem Schwanz hat.
Eine lange, kräftige Faserschnur war am Schaftende eines jeden Pfeils angebunden.
„Eben diese hier habe ich zum Schießen von Fischen angefertigt", nahm Läufer das Gespräch wieder auf. „Wenn du einverstanden bist, Häuptling, dann können wir beide auf dem kleinen Floß hinausfahren. Wir nehmen Schildkrötenfleisch mit und binden es an ein Stück leichtes Holz, so daß es nicht ins Wasser sinkt. Sehen wir den Barracuda kommen, dann werfen wir die Lockspeise ins Meer. Er wird vermutlich nicht danach schnappen, aber sicher einmal an die Oberfläche heraufkommen, um sich das Fleisch näher anzusehen, und dann schießen wir. Vielleicht ist es am besten, wenn du dich erst ein wenig im Bogenschießen übst, Häuptling? Nein, nimm keinen von diesen Pfeilen. Die Spitze könnte abgehen, und ich habe keine Rochenstacheln mehr. Nimm lieber den hier mit der Spitze aus Schwarzpalmenholz, er fliegt ungefähr genauso weit und ist gut zum Üben."
Läufer hielt jäh inne und schnappte ein paarmal nach Luft Es geschah selten, daß er so lange redete. Aber noch seltener kam es vor, daß ein Indianerjunge den Stammeshäuptling unterweisen mußte.
Sägefisch betrachtete fast demütig den Bogen und den Pfeil in seinen Händen.
„Glaubt mein Bruder wirklich, daß auch ich mit solch einem Ding schießen lerne?" fragte er.
Läufer fuhr zusammen, als er die Worte „mein Bruder" hörte. So redeten sich erwachsene Männer an, besonders bei feierlichen Anlässen.
„Aber ja, mein Vater", erwiderte er. „Viel besser als ich, denn mein Vater ist ein großer Häuptling, und ich bin nur ein kleiner Junge. Wenn mein Vater übt, wird er bald ein besserer Bogenschütze werden als irgendein Karibe."
Sägefisch ließ es sich nicht zweimal sagen, er begann sich sogleich im Gebrauch der neuen Waffe zu üben.
Die ersten Versuche fielen natürlich ungeschickt aus, aber nachdem er es ein dutzendmal probiert hatte, kam er der Sache auf die Spur, und im Lauf einer weiteren Stunde schoß er für einen Anfänger schon recht gut.
„Nun sollte mein Vater die Arme vielleicht ein Weilchen ruhen lassen", riet ihm sein junger Kamerad. „Wenn wir den Barracuda in Schußweite haben, müssen wir versuchen, ihn gleich mit den ersten Pfeilen richtig zu treffen. Wenn wir ihn nur streifen oder verwunden, merkt er, daß wir gefährlich sind, und dann wird es vielleicht schwer werden, auf richtige Schußweite an ihn heranzukommen." Er überlegte einen Augenblick und fuhr dann fort: „Da ist etwas, das ich nicht ganz verstehe. Als ich neulich auf einen Fisch im Wasser schoß, mußte ich mindestens eine Handbreit unter ihn zielen, um ihn zu treffen. Kommt das daher, daß das Wasser die Richtung des Pfeils verändert?"
Der Häuptling hielt die Lider gesenkt und warf ihm einen Seitenblick zu. Ein kluger Junge, dachte er. Hat soeben das Beste zustande gebracht, das je einer aus dem ganzen Stamm geschaffen hat, und ist doch nicht aufgeblasen.
„Woher kriegen wir Schildkrötenfleisch?" fragte Sägefisch.
„Ich habe heute nacht eine Karettschildkröte gefangen”, antwortete Läufer, „aber ich hatte noch nicht die Zeit, sie zu schlachten. Ich habe ihr nur die Beine zusammengebunden, nachdem ich sie auf den Rükken gedreht hatte. Ich wollte morgen zu der kleinen Insel zurückfahren und die Schildkröte mitbringen. Welches Stück soll ich als Köder nehmen?"
„Nimm die Leber, die riecht wohl am stärksten."
Die Schildkröte war bald geschlachtet, und kurz darauf paddelten die beiden Bogenschützen das Floß über den schmalen Sund und über die Schneckenbänke. Dort zogen sie die Paddel ein und ließen das Floß treiben.
Lange Lanze und Fregattvogel, die auf einem hohen Korallenfelsen standen und Ausschau hielten, riefen und zeigten mit den Händen. Sie hatten den Barracuda soeben wieder vorbeistreichen sehen. Läufer nahm die Schildkrötenleber, die fest um einen kleinen Schwimmer von Balsaholz gebunden war. Er warf sie einige Meter vom Floß entfernt ins Wasser und fragte Sägefisch flüsternd: „Ist mein Vater soweit?"
Sie spannten ihre Bogen zur Hälfte und warteten dann reglos. Der Köder schwamm kaum einige Minuten auf dem Wasser, als der Barracuda auch schon wie ein Torpedo herangeschossen kam. Der Blutgeruch schien ihn angelockt zu haben. Ein paarmal strich er dicht an der Lockspeise vorbei. Dann machte er eine jähe Wendung und schnappte zu. Für einen Augenblick war sein Rücken über dem Wasser zu sehen.
„Jetzt!"
Zwei Bogensehnen klatschten gegen das Holz, zwei lange Pfeile flogen durch die Luft. Sägefischs Pfeil kratzte den großen Fisch nur am Rücken und riß ihm ein paar Schuppen aus, die im Wasser langsam zu Boden tanzten. Aber Läufer war geübter und hatte besser gezielt. Sein Pfeil fuhr dem Fisch tief in die Seite, ungefähr eine Handbreit hinter der Kiemenspalte.
Der Barracuda sprang senkrecht in die Luft und fiel mit einem gewaltigen Geplätscher wieder ins Wasser zurück. Dann versuchte er davonzuschießen, aber das ging nicht so schnell wie sonst.

Der Pfeilschaft ragte aus dem Wasser heraus und wirkte wie eine Bremse, so daß er nur in großen Kreisen herumschwimmen konnte, und die Schnur hielt ihn in der Nähe des Floßes.
„Am besten, wir ziehen den Pfeil heran und schießen wieder, sobald der Fisch an die Oberfläche kommt", flüsterte Läufer voll Eifer. Der Häuptling war einverstanden. Er war jetzt genauso bei der Sache wie der Junge. Als der Barracuda zum zweitenmal in der Nähe des Floßes auftauchte, bekam er den Pfeil des Häuptlings in den Rücken, und nun war er nahezu hilflos. Nach einigen Minuten lag er längsseits an dem Floß und biß tückisch um sich.
Läufer schlug ihn mit der Steinaxt auf den Kopf. Dann zogen sie ihn auf das Floß.
Gab das einen Jubel auf der Insel, als die beiden Bogenschützen den langen Fischkörper an Land schleiften!
Alle wollten sich nun die neuen Waffen genauer ansehen, und alle lobten Sägefisch und seinen jungen Kameraden.
Schließlich kam auch der Medizinmann hinunter an den Strand. Er hob einen Zweig auf, berührte damit den Barracuda; dann warf er den Zweig ins Meer. Wenn die bösen Zauberer der Feinde den Fisch geschickt hatten, dann war der Zauber jetzt gebrochen.
„Dieser Fisch kann gegessen werden", sagte er ruhig. Dann wandte er sich an die Fänger.
„Hast du also doch karibische Bogen gemacht, du Schlingel!" sagte er und drohte Läufer mit seinem Stock. Er versuchte eine empörte Miene aufzusetzen, was ihm jedoch nicht ganz gelang.
„Nein, Großvater", antwortete der Häuptling, „das hier sind ganz und gar arowakische Bogen und Pfeile."
„Hm, hm", sagte der Medizinmann, „was für ein Unsinn! Wer hat je von arowakischen Bogen und Pfeilen gehört? Kannst du mir eine ordentliche Antwort auf diese Frage geben?"
„Das hier sind natürlich die ersten", räumte Sägefisch ein. „Aber du siehst doch selber, Großvater, daß sie ganz anders sind als die Bogen der Kariben — (Das war natürlich nicht ganz überzeugend, denn weder der Häuptling noch der Medizinmann wußten, wie ein karibischer Bogen aussah.) —, und da sie von einem Arowaken erfunden und angefertigt worden sind, so ... Übrigens hat Großvater Mummel ja selber gesehen, wie gut man damit Fische schießen kann, sogar karibische Zauberfische."
„Hm, hm, mag schon sein, wie du sagst. Aber nun soll Läufer selber antworten und sich nicht hinter dem Rücken des Häuptlings verkriechen. Was hast du dir denn noch ausgedacht, Junge?"
Der Bursche zögerte mit der Antwort, aber schließlich mußte er doch sagen, was er noch auf dem Herzen hatte.
„Großvater, hast du vor einiger Zeit nicht selbst gesagt, daß es gut wäre, wenn es ein arowakisches Kanu gäbe?"
„Ein arowakisches Kanu, Junge? Hm, wie sollte so ein Ding denn aussehen?"
Läufer begann in dem Bastbeutel zu suchen, den er an seinem Gürtel hängen hatte. Da waren Fadenreste, einige Angelhaken aus Muschelschalen, in einen Fetzen Tuch eingewickelt, und Wachs- und Harzbrocken. Aber schließlich fand er, was er suchte: ein Päckchen, eingehüllt in ein Stück Baumwollstoff, das er von seinem Hüfttuch abgerissen hatte.
Vorsichtig öffnete er das Päckchen und zeigte ein Kanumodell, das er aus einem Stück Treibholz geschnitzt hatte.
„So soll es aussehen, Großvater", sagte er ruhig.
Sein Gesicht zeigte jetzt keine Spur von Zaghaftigkeit oder Schüchternheit mehr. Er war ein Mann, der mit einem Mann redete.
Der Medizinmann nahm das kleine Modell vorsichtig in seine alten, runzligen Hände und ging an einen kleinen Tümpel zwischen den Felsen, der von der Flut zurückgeblieben war.
Dort setzte er das Kanu auf das Wasser und sah, wie gut es schwamm. Nach einer Weile belud er es mit einigen kleinen Korallenstücken, doch auch durch die Belastung kenterte es nicht.
Schließlich erhob er sich und reichte das Modell zurück. Alle sahen, wie seine schwarzen Augen vor Zufriedenheit funkelten und wie es um seine Mundwinkel zuckte.
„Geh du hin und bau dein arowakisches Kanu! Je früher, je besser", sagte er. „Wenn du einige Männer als Gehilfen brauchst, dann kann Sägefisch das wohl regeln, denn die Sache ist wichtig."
Nun wandte sich der Medizinmann um und ging. Als er einige Schritte zurückgelegt hatte, blieb er stehen und erklärte: „Aber das eine sag ich dir ein für allemal: arowakische Kannibalengötter erfindest du mir nicht! Merk dir das, Junge!“

Der Bau des Kanus
Der Bau des arowakischen Kanus war jedoch wesentlich schwieriger als die Herstellung des arowakischen Bogens.
Zunächst einmal mußte man ja einen geeigneten Baum finden, und das war auf den Inseln im Meer nicht leicht, denn der größte Teil der Vegetation bestand dort nur aus verschiedenen Mangrovenarten. Diese Bäume werden selten so stark, daß man sie zu Booten aushöhlen kann. Ihr Holz erweist sich beim Behauen als knochenhart, und außerdem ist es viel zu schwer, um als Holz für ein Kanu zu dienen: es versinkt im Wasser.
Die einzige Möglichkeit, ein Kanu zu bauen, bestand darin, daß man einen großen Baumstamm aushöhlte. Die Indianer besaßen ja keine Baumsägen, auch keine Hobel oder Nägel — sie wußten nicht einmal, was für Dinge das waren. Dazu gehörten sie einem Stamm an, der die Verwendung von Metallen noch nicht kannte. Aus diesem Grunde vermochten sie kein Wasserfahrzeug aus Bohlen zu bauen.
Bretter mit der Hand zurechtzuschnitzen wäre zudem noch mühsamer und schwieriger gewesen, als einen großen Baumstamm auszuhöhlen. Der einzige Baum, dessen Holz für ein Kanu in Frage kam, war der riesige Ceiba, der in der Mitte der größeren Insel auf einem niedrigen Hügel stand.
Der Ceiba war fast zu groß. Vier Männer waren nötig, um den Stamm unmittelbar über den breiten, plankenförmigen Wurzeln zu umspannen, sie konnten gerade noch ihre Fingerspitzen berühren.
„Wie in aller Welt sollen wir diesen Riesen fällen?" fragte Stumpfnase nachdenklich und sah bald an dem gewaltigen Baum hinauf und bald auf seine kleine Steinaxt hinab, die er in der Hand hielt. „Es wird wohl mindestens ein Jahr dauern, bis wir es geschafft haben." „Du redest, wie du es verstehst, Junge!" antwortete der Häuptling. „Wir nehmen natürlich Feuer zu Hilfe."
Sie befolgten die Anweisung von Sägefisch, aber trotzdem ging es recht langsam voran.
Zuerst klopften sie die Rinde von dem Baumstamm und schälten ihn, soweit sie hinauflangen konnten. Dann trugen sie große Mengen dürrer Äste zusammen, schichteten sie um die Wurzeln des Baumes und brannten sie an.
Als das Feuer niedergebrannt war, hatte es die äußerste Schicht des Baumstammes einige Meter hoch verkohlt. Sie konnte abgekratzt oder abgeschlagen werden. Sobald das getan war, wurde erneut Holz gesammelt und Feuer angebrannt.
Mit dem Feuer wagten die Arowaken allerdings nur an windigen Tagen zu arbeiten, an denen keine hohe Rauchsäule von der Insel aufsteigen und der Besatzung irgendeines karibischen Kriegskanus verraten konnte, wo die Flüchtlinge sich niedergelassen hatten.
Die kleinen Kochfeuer auf der kleinen Insel waren nicht so gefährlich. Um diese zu unterhalten, verwandte man nur in der Sonne getrocknetes Brennholz, und das entwickelte nur schwachen Rauch, den die Brise sogleich zerteilte. Aber mit dem Feuerbrand um den Baum und die rauhe Außenschicht des Stammes war es anders.
Tag um Tag verging, und anfangs schien es den Männern, als machten sie nur sehr geringe Fortschritte. Aber mit der Zeit wurde es besser. Von dem vielen Feuer wurde der Ceibabaum nach und nach dürr, und bald mußten die Indianer vorsichtiger mit den Feuerbränden umgehen, um nicht mehr zu verbrennen, als sie wollten.
Die Gefahr, einen Waldbrand zu verursachen, bestand nicht. Die Inseln lagen im tropischen Regengebiet, und Regenwald kann nicht brennen, solange er im Boden wurzelt.
An einem frühen Nachmittag kam ein schweres Unwetter auf, so daß die Indianer eilends nach der kleinen Insel zurückpaddeln mußten, ehe die Wogen im Sund zu hoch gingen.
Sie kamen gerade noch rechtzeitig nach Hause.
Der Sturm wurde immer heftiger. Es war ein Glück, daß sich die wildesten Sturzseen an dem Korallenriff unmittelbar vor der Insel brachen. Sonst wären sie wohl über die ganze Insel hinweggerollt und hätten die Menschen und ihre Habe mit sich gerissen.
Es war jedoch so schon schlimm genug. Die Leute mußten arbeiten wie die Biber, um alles aus der Reichweite der Sturzseen zu bringen. Die beiden größten Flöße, die zu schwer waren, als daß man sie über Land schleifen konnte, mußten auseinander genommen werden. Ihre Stämme verwendete man als Rollen, um die kleineren Wasserfahrzeuge hoch auf den Strand hinaufzuziehen.
Schließlich war alles so sicher wie nur möglich, und unter dem Sturzregen schlotternd krochen die Indianer in ihre kleinen Hütten, die mitten auf der Insel im Buschwerk standen.
Kurz nach Mitternacht wurde die ganze Schar von einem scharfen Krachen geweckt, das durch das Heulen des Sturms und das Dröhnen der Wogen drang.
Die Männer nahmen Feuerfackeln und liefen hinaus, um nachzusehen, ob eine ungewöhnlich schwere Sturzsee die Flöße mit sich gerissen hatte, obwohl diese weit aufs Land hinaufgezogen und an Bäumen festgebunden waren.
Alle Flöße lagen an ihrer Stelle, aber als es tagte, sahen die Indianer, daß sich die Krone des großen Ceibabaums nicht mehr über die anderen Baumwipfel von Ceysén erhob.
Die Dünung ging den ganzen Tag immer noch zu hoch, als daß sie es hätten wagen können, ein Floß zu Wasser zu bringen. Der Boden erzitterte förmlich, wenn die Wogen der Dünung über das Riff rollten und die Insel hinaufschäumten.
In den Abendstunden begann sich das Meer zu beruhigen, und am nächsten Morgen zogen die Männer noch in der Dämmerung zwei der kleinsten Flöße an den Sund.
Alle brannten darauf, zu sehen, was mit dem Kanubaum geschehen war, auf den sie soviel Arbeit verwandt hatten.
Sie fanden ihn umgeworfen. Der Sturm hatte den gewaltigen Stamm genau an der Stelle abgebrochen, wo sie ringsum die tiefe Kerbe eingebrannt und eingehauen hatten.
Im Fallen hatte der Urwaldriese eine ganze Anzahl kleinerer Bäume umgeschlagen. Um seine Krone, aus der nach allen Seiten lange, knorrige Äste herausragten, war im Walde eine regelrechte Lichtung entstanden.
„Da haben wir tüchtige Hilfe bekommen", sagte Läufer, nachdem er sich überzeugt hatte, daß der Stamm bei seinem gewaltigen Aufprall
auf den Erdboden ohne größere Risse geblieben war. „Die Mächte sind uns gnädig gewesen. Hier haben wir nun das Holz, das für ein sehr großes Kanu, ein halb so großes und ein kleines ausreicht."
Er hielt drei Finger in die Höhe.
„Dies alles kann uns auf mehr als eine Weise nützlich sein", sagte der Häuptling und strich sich nachdenklich das Kinn. „Seht, das Unwetter hat uns außerdem ein Stück Land gerodet. Wenn die umgestürzten Bäume hier richtig trocken geworden sind, können wir einen Teil von ihnen als Brennholz verwenden. Das übrige verbrennen wir an Ort und Stelle und säen Mais und Bohnen in die Asche."
Die anderen fanden ebenfalls, dies sei ein guter Gedanke, und so begannen sie mit dem Bau der Kanus.
Zuerst schälten sie alle Rinde von dem Ceibabaum. Dann maß Läufer den großen Stamm mit Stöcken, brachte seine Zeichen an und erklärte den anderen, wie er sich den weiteren Gang der Arbeit dachte.
Einigen von den erwachsenen Männern kam es — besonders am Anfang — sicher ein bißchen sonderbar vor, von einem so jungen Burschen angeleitet und unterwiesen zu werden, der noch nicht einmal einen richtigen Männernamen hatte, sondern noch seinen Jungennamen trug. Aber bei den meisten stand Läufer bereits in hohem Ansehen, seitdem er die Bogen angefertigt hatte, und sie mußten alle zugeben, daß seine Worte einleuchtend waren.
Außerdem hielten der Häuptling und auch der Medizinmann zu ihm, und da konnten ihm die anderen nicht gut widersprechen.
Sie machten sich mit Schwung an die Arbeit — mit Steinaxt, Feuer und Sandsteinreibe. Bald begannen die drei Kanus Gestalt anzunehmen, und da wurde die Arbeit noch schöner. Die Männer waren bald derart von ihrem Kanubau in Anspruch genommen, daß sie sich kaum noch die Zeit zum Fischen nehmen wollten.
Die Frauen waren ziemlich verschnupft, als ihre Männer den Fischfang vernachlässigten, so daß das Essen zuweilen ziemlich knapp bemessen war. Bei den Bocaná-Arowaken hatten die Frauen ganz erheblich mitzureden, und so gingen sie zum Häuptling und sagten ihm ihre Meinung.
Sägefisch und Habichtfeder erzählten ihnen von der neuen Rodung, die beabsichtigt war, um sie wieder aufzumuntern, denn die Frauen liebten den Ackerbau über alles.
„Ja, das klingt ja alles schön und gut", sagte Maisfrau, die Gattin des Häuptlings. „Aber woher kriegen wir den Samen und die Pflanzen, wenn wir das Land mit Brand gerodet haben?'
„Ja, diese Dinge holen wir natürlich mit den neuen Kanus", entgegnete ihr Mann.
Da mußten auch die Frauen einsehen, daß der Bau der Kanus wirklich notwendig war.
Das kleine Kanu wurde zuerst fertig. Es war gerade groß genug für drei Männer; im Notfall konnte es ihrer vier aufnehmen. Läufer hatte es zuerst bauen wollen, um feststellen zu können, ob Änderungen oder Verbesserungen an den größeren Booten nötig waren oder ob das Modell schon in seinem jetzigen Zustand verwandt werden konnte.
Vorsichtig legten die Männer das fertige Kanu auf Baumstammrollen und zogen es an den Sund hinab. Dort waren alle Männer, Frauen und Kinder versammelt, um zuzusehen, wenn das neue Gefährt ins Wasser gebracht wurde.
Es war ein spannender Augenblick. Jetzt würde man sehen, was die neue Erfindung wert war. Hatte Läufer nur Glück gehabt, als er die Bogen anfertigte, oder würde ihm auch sein neuer Plan gelingen?
Jetzt schwamm das Kanu auf dem Wasser. Jeweils mit einem Paddel versehen, stiegen der Häuptling und Läufer an Bord und fuhren hinaus auf das Wasser.
Heißa I — das war nun freilich ein anderes Fahren als mit dem schwerfälligen Floß! Mit einem einzigen Paddelschlag kam man mehrere
Meter weit, und man konnte auch gegen den Wind fahren. Das neue Fahrzeug schwamm wie ein Stück Balsaholz, es schaukelte auf den Wellen wie ein schwimmender Seevogel, und es kam kein Tropfen Wasser über Bord.
Noch war jedoch die Feinarbeit nicht getan, aber das war nur eine Frage der Zeit.
Nach einigen kurzen Proberunden kehrten die beiden Paddler zurück und zogen das Boot unmittelbar vor der Schar der interessierten Zuschauer auf den Sandstrand.
Der Häuptling trat vor den Medizinmann und verneigte sich. Alle anderen lauschten atemlos.
„Was sagt mein Großvater Stehender Bär dazu?" fragte Sägefisch ehrerbietig.
„Ich sage, das Kanu ist gut", erwiderte der alte Medizinmann. „Ich sage, Läufer hat mit dieser Erfindung große Ehre gewonnen. Beim nächsten Neumond sollen ihm alle Erwachsenen ein großes Fest bereiten. Außerdem soll dieses erste Kanu ihm und keinem anderen gehören. Das nächste gehört dem Häuptling, wie es recht und billig ist, und das letzte und größte soll Eigentum des ganzen Stammes sein. Später müssen wir dann zusehen, daß wir noch mehr Kanus bauen. Der Tag wird sicher kommen, an dem jede Familie ihr eigenes Kanu haben wird. Dieses hier gehört jedoch einzig und allein Läufer, und ohne seine Erlaubnis darf keiner damit hinauspaddeln oder zum Fischfang fahren. Jungen wir er können mit der Zeit große Häuptlinge oder weise Medizinmänner werden."

Läufer hielt das Haupt gesenkt und hörte alle diese Worte. Er war so glücklich, daß es ihm fast Schmerzen bereitete.
Man denke nur — das erste Kanu des Stammes sollte ihm gehören! Er konnte damit zum Fischen fahren, wann immer es ihm gefiel, und er konnte es seinen Freunden borgen.
Der Medizinmann hatte ihn vor dem ganzen Stamme gelobt, und was das Schönste von allem war: Beim nächsten Vollmond würde sein Fest gefeiert werden. Das konnte nur bedeuten, daß er einen neuen Namen erhalten, für erwachsen erklärt und mit allen Rechten eines Mannes ausgestattet werden sollte.
Der Häuptling trat zu ihm und klopfte ihm freundlich auf die Schulter.
„Nun wissen wir, wie wir es machen müssen, wenn wir die anderen Kanus bauen", sagte er. „Nimm einen guten Kameraden mit und fahr hinaus zum Fischen. Du hast in letzter Zeit hart gearbeitet und wirst eine Abwechslung brauchen können."
Läufer winkte Stumpfnase, und beide begannen im flachen Wasser nach Krabben zu suchen. Als sie genügend gefunden hatten, fuhren sie hinaus ans Riff, um sich dort hinzusetzen und zu angeln.
Nach einigen Stunden befanden sie sich wieder auf der Rückfahrt, nun mit so viel Fischen versehen, daß sie dem ganzen Lager als Mahlzeit dienen konnten. Mit dem schnellen Kanu war es leicht, an die besten Angelstellen zu gelangen.
Als sie in die Meerenge hereingepaddelt kamen, hörten sie von der größeren Insel regelmäßige Schläge der Steinäxte herüberhallen. „Ja", sagte Stumpfnase, „nun bist du bald ein Mann und wirst nicht mehr Läufer genannt werden. Und dann wirst du wohl kaum noch mit einem Jungen wie mir hinausfahren und fischen."
„Jetzt redest du Unsinn", antwortete Läufer ein wenig verärgert. „Wir zwei bleiben immer gute Freunde, was auch geschieht. Gewiß wirst du auch bald etwas Nützliches tun, dann einen richtigen Männernamen erhalten und zum Ima tule erklärt werden — zum erwachsenen Mann."
„Das sagt sich leicht", erwiderte Stumpfnase. „Aber es wird nicht leicht werden, nachdem du zwei so große Dinge wie den Bogen und das Kanu erfunden hast. Jetzt genügt es sicher nicht mehr, wenn man mit irgendeiner Kleinigkeit kommt. Es muß nun schon etwas wirklich Nützliches sein, und so etwas kann ich mir sicher nicht ausdenken." „Natürlich kannst du das!" ermutigte ihn Läufer. „Was ich getan habe, war eigentlich gar nichts Besonderes. Ich hatte ja gesehen, wie die Bogen und die Kanus der Kariben ungefähr aussahen, als ich mit Sägefisch nach ihnen Ausschau hielt. Dann habe ich bloß nachgedacht, warum sie so sein mußten, und darauf brauchte ich nur noch etwas Ähnliches zu versuchen. Das war alles. Dir wird sicher auch mal ganz unvermutet ein guter Einfall kommen. Dann mußt du dich nur daran hängen wie ein Schildfisch an eine grüne Schildkröte, und ehe du dich versiehst, ist die Sache fertig."
Stumpfnase starrte seinen Kameraden einen Augenblick mit weit aufgerissenen Augen an.
„Wie ein Schildfisch an eine grüne Schildkröte — hat mein großer Bruder das gesagt?" fragte er langsam und mit einer kleinen Pause nach jedem Wort.
„Ja, warum?" erwiderte Läufer verwundert.
Stumpfnase lachte herzhaft. Dann wurde er jedoch plötzlich wieder ernst und begann erneut aus Leibeskräften zu paddeln.
Läufer sah ihn erstaunt an.
„Worüber hast du gelacht?" fragte er.
„Ich mußte nur an etwas denken", erwiderte Stumpfnase ausweichend. „So ist das, wenn man mit klugen Leuten im Kanu ausfahren darf." Während des ganzen folgenden Abends war kein vernünftiges Wort aus ihm herauszukriegen, aber früh am nächsten Morgen bat er Läufer, ihm für kurze Zeit das Kanu zu leihen, er wolle einige Stachelrochen harpunieren.
Das durfte er natürlich, und einige Zeit später kam er zurück und gab Läufer einen stattlichen Rochenstachel, fast doppelt so lang wie ein Finger und spitzer als der spitzeste Feuerstein. So eine Pfeilspitze mußte man suchen.
„Ich danke dir für das Geschenk", sagte Läufer. „Sobald ich gutes Material habe, werde ich für meinen Bruder Stumpfnase einen Bogen machen."
„Das wäre ein großes Geschenk für ein kleines, aber es wissen ja alle, daß Läufer gern viel für wenig gibt", erwiderte Stumpfnase. „Darum sagen wohl auch so viele, er habe das Zeug zu einem Häuptling. Wollen wir morgen hinausfahren und fischen, ganz früh?"
„Ja, gern. Aber wohin fahren wir diesmal? Wieder hinaus an das große Korallenriff?"
„Nein, ich habe eine neue Angelstelle entdeckt, die bis jetzt noch keiner kennt. Sie liegt drüben an der anderen Seite von Ceysén."
„Gut, dann fahren wir dorthin."
Es war fast noch dunkel, als Stumpfnase vom Strand heraufgeschlichen kam und Läufer mit einem kleinen Zweig an der Fußsohle zu kitzeln begann.
Er vermied es, seinen Kameraden jäh aufzuwecken. Das war bei ihrem Volk nicht üblich. Die Indianer glaubten, wenn man schlafe, befinde sich die Seele auf Reisen, und man erwache, wenn sie zurückgekehrt sei.
Sie meinten, daß jeder Mensch zwei Seelen besaß, eine kleine und eine große. Die große Seele begab sich auf Reisen, wenn man schlief, und die Träume waren Abenteuer, die die Seele erlebte, wenn sie sich vom Körper getrennt hatte. Daher hielten die Indianer auch Träume für eine Art Wirklichkeit und machten keinen großen Unterschied zwischen der wachen Wirklichkeit und dem Traumgeschehen.
Wurde man zu jäh geweckt, dann konnte es geschehen, daß die kleine Seele die große nicht mehr rechtzeitig zurückrufen konnte; erwachte man, ehe die große Seele zurück war, dann vermochte diese nicht mehr in den Körper einzugehen und fuhr sonstwohin. Allein gefiel es dann der kleinen Seele nicht mehr im Körper, sie wollte ebenfalls hinausfliegen, um die große Seele zu suchen. Dann wurde man krank und starb, so glaubten die Indianer.
Daher weckten sie einen schlafenden Menschen immer sehr langsam und vorsichtig, damit seine kleine Seele genügend Zeit fand, die große zurückzurufen.
'Stumpfnase kitzelte also seinen Freund weiter mit dem Zweig an den Füßen, bis Läufer erwachte und sich aufrichtete. Er reckte die Arme und gähnte.
„Es ist Zeit, aufs Meer zu fahren!" sagte Stumpfnase.
„Es ist ja noch finster!"
„Siehst du nicht die Tochter der Sonne? Sie ist schon aufgestanden, um Maisbrot für ihren Vater zu backen. Es ist bald Morgen, wenn sie sich zeigt."
Stumpfnase wies nach der Venus, die in strahlender Klarheit über dem ersten bleichen Streifen Tageslicht im Osten stand.
Läufer ließ sich überzeugen und rieb sich den Schlaf aus den Augen. „Dann wird es wohl das beste sein, wenn wir gleich nach Ködern suchen", sagte er. „Aber so früh findet man wohl nur Sandmuscheln." „Mach dir keine Sorgen wegen der Köder", erwiderte Stumpfnase lächelnd. „Das habe ich schon gestern geregelt."
„Dann können wir ja losfahren."
Die beiden Freunde banden die Leine los, setzten Rollen von Balsa-holz unter das Kanu und zogen es hinunter ans Wasser. Dann ging Stumpfnase nach einem kleinen Gezeitentümpel zwischen den Korallenfelsen und nahm etwas aus ihm heraus.
Läufer konnte nicht sehen, was es war, Stumpfnase packte es in nasse Mangrovenzweige. Darauf tauchte er das ganze Bündel ins Meer und hielt es einige Minuten unter Wasser, um es dann ins Kanu zu legen.
„Na, und wo ist nun deine neue Angelstelle?" fragte Läufer.
„Da drüben, auf der anderen Seite der großen Insel. Hast du deine beste Harpune und eine feste Leine mitgenommen?”
„Natürlich."
„Dann können wir losfahren."
Die Sonne wollte gerade aufgehen, als das Kanu die äußerste Landzunge umrundete und zwischen den Sandbänken dahinglitt, die auf der anderen Seite von Ceysén lagen.
„Leg nun dein Paddel ins Kanu, wir wollen uns ein Weilchen treiben lassen", schlug Stumpfnase vor.
Läufer sah ins Wasser.
„Hier ist doch Sandboden?" sagte er.
„Gewiß ist hier Sandboden. Was ist denn dabei?"
„Besser beißen die Fische ja über Klippen und am allerbesten über Korallen."
Stumpfnase verzog das Gesicht zu einem breiten Grinsen.
„Nicht bei dieser Art", sagte er und sah ins Wasser. „Leg dich lang ins Kanu und mach die Augen auf. Siehst du, was da unten auf dem Meeresboden liegt?"
„Es sieht aus wie eine Schildkröte."
„Es ist auch eine Schildkröte, eine von den großen grünen. Halte deine Harpune bereit!"
„Bist du denn ganz närrisch geworden? Glaubst du, ich könnte sie vier Klafter tief harpunieren?"
„Halte die Harpune bereit, hab ich gesagt! Hier hab ich jemand, der es machen wird, daß die Schildkröte in Reichweite deiner Harpune kommt."
Stumpfnase steckte die Hand in das Bündel nasser Zweige und holte einen großen, schleimigen Schildfisch heraus, einen schwarzen Burschen von häßlichem Aussehen, der verzweifelt nach Luft — oder richtiger, nach Wasser schnappte. Der Indianerjunge band seine haltbarste Angelschnur um den Schwanz des Fisches, und zwar etwas vor der Schwanzflosse. Dann ließ er seinen Gefangenen vorsichtig ins Wasser.
Der lange, schmale Fisch sank langsam auf den Boden. Es sah aus, als wäre er tot oder doch wenigstens nicht ganz bei Kräften.
Plötzlich schlug er jedoch mit den Flossen, brachte sich wieder in die richtige Schwimmlage und begann langsam im Kreise zu schwimmen, mit jedem Kreis ein Stück tiefer hinunter.
Schließlich richtete er seinen Kurs geradeswegs auf die Schildkröte, als habe er im Wasser eine Spur gefunden.
Als er die Schildkröte erreicht hatte, begann er sich zwischen ihrem Bauchpanzer und dem Meeresgrund einzuwühlen, bis nur noch die Schwanzflosse hervorsah.
„Halte die Harpune bereit, denn sie wird gleich kommen!" flüsterte Stumpfnase.
Er wartete eine Minute, zwei, drei Minuten — noch länger. Es fiel ihm schwer, seinen Eifer zu zügeln, aber der Schildfisch mußte ja Zeit haben, um sich richtig festzusaugen.
Als der Indianerjunge mit Sicherheit wußte, daß der Fisch wie angeleimt am Panzer der Schildkröte saß, begann er an der Angelschnur zu ziehen, ruhig und gleichmäßig, ohne zu reißen.
Verblüfft sah Läufer, wie die große Schildkröte langsam vom Meeresgrund gehoben und durch das Wasser gezogen wurde, erst mit der einen Seite nach oben, dann auf dem Rücken liegend. Sie schien nicht die geringste Gefahr zu ahnen, sondern schwenkte nur träge ihre breiten Schwimmbeine, um wieder mit dem Rücken nach oben zu kommen. Währenddessen zog Stumpfnase sie herauf und immer näher an das Kanu heran.
Läufer kniete, die Harpune wurfbereit in der Hand. Genau im richtigen Augenblick jagte er seine Waffe ins Wasser. Die Knochenspitze mit den langen, scharfen Widerhaken traf die Schildkröte in den Hals, genau vor der Kante des Rückenpanzers.
Läufer griff nach der Harpunenleine und begann sie aus Leibeskräften zu ziehen.
Anfangs stemmte sich die große Schildkröte mit aller Kraft dagegen. Sie zog das Kanu hinter sich her, und hätte Läufer die Harpunenleine nicht vorn am Kanu angebunden gehabt, dann wäre sie ihm wohl aus den Händen gerissen worden.
Aber die Kräfte des verwundeten Tieres ließen schnell nach. Wenig später konnten die beiden Jungen die Schildkröte in das flache Wasser über einer Sandbank ziehen. Dort sprangen sie aus dem Kanu, schlugen die Schildkröte mit ihren Äxten auf den Kopf und wälzten sie darauf mit vereinten Kräften in das Kanu.
Sie hatten beide gerade noch Platz in dem Fahrzeug. Die Bordkante lag jedoch gefährlich nahe an der Wasserfläche, als sie wieder einstiegen. Glücklicherweise war das Meer noch immer morgendlich glatt und still.
„Ein Glück, daß sie nicht größer war!" sagte Läufer vergnügt. „Das war wirklich der beste Trick, den ich je beim Fischfang gesehen habe. Warte nur, wenn das der Häuptling und der Medizinmann erfahren!" „Was glaubst du, was sie dazu sagen werden?"
Stumpfnases Stimme hatte fast einen furchtsamen Klang.
„Ich weiß schon jetzt, was sie sagen. Es werden ihrer zwei sein, die am Fest des zurückkehrenden Mondes neue Namen erhalten, du wirst sehen. Was für ein Riese von einer Schildkröte! Sie reicht gut für drei richtige Festmahlzeiten — für jeden auf der Insel. Ja. verlaß dich darauf, der alte Großvater Mummel wird mit unserem Morgenfang zufrieden sein. Schildkrötensuppe mit viel Schildkröteneiern ist das Beste, was er kennt."
„Es wäre schön, wenn du recht hättest. Aber die Anregung hatte ich ja eigentlich von dir. Und wenn du das Kanu nicht erfunden hättest, dann wäre mein kleiner Trick wohl nicht viel wert gewesen."
„Doch, auch dann. Man kann ihn ja auch von einem Floß aus anwenden, obwohl es immerhin etwas schneller geht, wenn man in einem Kanu herumfährt und Schildkröten sucht."
Nun waren sie wieder am Ufer angelangt, aber sie mußten Männer zur Hilfe herbeirufen, um die schwere Beute an Land zu bringen.
Auf der Insel fand ein großer Schildkrötenschmaus statt, und danach gingen die Männer noch eifriger an den Kanubau. Nun wollten alle so bald als möglich ausfahren und Stumpfnases neuen Trick ausprobieren.
Der Medizinmann sagte an diesem Tage noch nichts. Aber als die beiden Jungen auch am nächsten Morgen eine Schildkröte fangen konnten, nahm er sie beiseite und meinte: „Morgen früh werdet ihr beide eure Künste Fregattvogel und Lange Lanze zeigen, dann müßt ihr mit euren Vorbereitungen für das Neumondfest beginnen."
Da wußten die beiden Jungen, daß sie bald in die Gemeinschaft der erwachsenen Männer aufgenommen werden sollten, und das ist der stolzeste Augenblick im Leben eines Indianers.

Die Weihe
Die Sonne war soeben hinter dem Horizont verschwunden. Die Meeresbrise sang in den Wipfeln der Bäume. Vom Meer her drang das dumpfe Dröhnen der Dünung, die sich an rauhen Korallenklippen brach.
An der Seite der großen Insel, die von der Meerenge und den Wohnstätten des Stammes am weitesten entfernt lag, saßen Läufer und Stumpfnase auf einem umgefallenen Baum am Strand.
Sie hatten ein kleines Feuer aus Zweigen angebrannt und warfen abwechselnd Blätter und trockne Kräuter in die Flammen. Wenn die Blätter zu brennen begannen, verbreiteten sie einen stark duftenden Rauch.
Die beiden Freunde hatten sich so hingesetzt, daß der Rauch ihnen direkt entgegenwehte. Sie taten das nicht, weil ihnen der Geruch des Rauches behagte, sondern weil das Rauchbad eine der vielen Vorbereitungen war, die ein junger Indianer treffen mußte, bevor er seinen „großen Namen" erhielt.
Es ist nämlich so, daß ein Indianerjunge in diesem Teil der Welt drei verschiedene Namen hat, von denen freilich immer nur jeweils einer gebraucht wird.
Der erste ist ein Kosename, den man ihm gibt, wenn er noch ganz klein ist. Wird er dann größer, so erhält er einen Jungennamen. Mit den ersten beiden Namen sind keinerlei Feste verbunden. Man kann sie mitunter sogar umtauschen, und es kann auch geschehen, daß ein drolliger Spitzname zu einem Jungennamen wird.
Aber wenn ein Junge bewiesen hat, daß er ein ganzer Kerl ist, und besonders, wenn es ihm gelungen ist, etwas Kluges und Tüchtiges zu vollbringen, das der Familie oder dem ganzen Stamm nützlich ist, erhält er seinen richtigen oder „großen" Namen.
Dieser Name ist sehr wichtig, denn es ist der Name seiner Seele, und er trägt ihn dann das ganze Leben hindurch. Ehe er ihn bekommt — in der Regel von einem Häuptling oder einem Medizinmann —, muß er eine große Anzahl Vorbereitungen treffen, damit der neue Name Glück bringt, und zwar nicht nur ihm allein, sondern der ganzen Gruppe, zu der er gehört.
In erster Linie muß er unterrichtet werden. In einer Anzahl von Indianerstämmen unterrichtet ihn sein Vater; in anderen der Onkel mütterlicherseits. Das hängt davon ab, ob er das Totem seines Vaters oder seiner Mutter erbt, das bei den verschiedenen Völkern unterschiedlich ist.
Läufer und Stumpfnase waren Vettern, und beide waren elternlos. Fast ihre ganze Sippe war vor über zehn Jahren ertrunken, als plötzlich ein Orkan über das Land hinweggerast war und die schmale Landzunge zwischen der Küste und der Lagune fortspülte, auf der sie gewohnt hatten. Nur die beiden kleinen Jungen waren gerettet worden. Da sie keine nahen Verwandten hatten, war es die Pflicht des Häuptlings, sie zu unterweisen, zumal sie einem Zweig seines Totems angehörten, das heißt der Gruppe, die sich zu der Verwandtschaft Sägefischs zählte.
Als die Unterweisung beendet war, kamen die Reinigungszeremonien an die Reihe. Drei Tage hatten die beiden Freunde damit verbracht. Es war ein langes und strenges Programm, das sie über sich ergehen lassen mußten.
Wenn einer von ihnen während der Zeremonien auch nur einen einzigen Fehler beging oder gegen irgendeine Regel verstieß, mußte er ins Lager zurückkehren und ein volles Jahr warten, ehe er noch einmal versuchen konnte, die Vorbereitungen hinter sich zu bringen.
Dann würden ihn die Frauen auslachen, ihn Holz und Wasser schleppen, Fische säubern, Schnecken mürbe klopfen und lauter Arbeiten verrichten lassen, die nach der allgemeinen Meinung eines Mannes unwürdig waren und die kein Junge gern tat.
Die Männer würden so tun, als sähen sie ihn nicht, und die kleinen Jungen würden Spottlieder auf ihn dichten.
Lieber hielt man da schon alles nur Erdenkliche aus, als daß man sich einer solchen Schande aussetzte.
Die Proben waren ziemlich schwer.
Drei Tage lang durften die Jungen mit niemand sprechen, nicht einmal miteinander. Sie durften nichts anderes essen als gestampften und gerösteten Mais, und zwar nur zweimal eine Handvoll am Tage.
Sie durften kein Tier töten, nicht einmal eine Mücke oder eine Sandfliege, und auch ein totes Tier nicht berühren. Sie durften keine lebende Pflanze abbrechen und auch kein grünes Blatt und keine Blume abpflücken.
Tag und Nacht mußten sie ein Feuer unterhalten, durften darüber jedoch nichts kochen oder braten. Sie durften sich nicht unter ein Dach begeben, nicht einmal wenn es regnete oder stürmte. Sie durften keine Hängematte benutzen, sondern mußten auf dem nackten Ufersand schlafen, ohne Kopfunterlage.
Doch damit noch nicht genug.
Zu bestimmten Zeiten am Tage und in der Nacht mußten sie sich erheben und die Sonne und das Meer, die Erde, den Wind und die Sterne grüßen.
Mehrmals am Tage mußten sie im Meer baden, sich mit getrockneten Kräutern einreiben, die ihnen der Medizinmann gegeben hatte, sich mit Süßwasser waschen und bis zuletzt in dem Kräuterrauch des Feuers sitzen.
Es gab sogar Bestimmungen, die ihnen vorschrieben, was sie zu denken hatten. Sie durften nichts Böses oder Häßliches denken, denn dann war alles umsonst.

Während die Jungen mit diesen Vorbereitungen beschäftigt waren, durften weder Frauen noch Kinder den Fuß in den ihnen zugeteilten Bezirk setzen, der in diesem Fall die große Insel war.
Die erwachsenen Männer mußten das Wasser aus dem Teich holen, und hin und wieder schlich sich einer von ihnen in die Nähe der Jungen, um nachzusehen, ob sie wirklich alle Vorschriften erfüllten und auch nichts vergaßen.
Weihte man sie ohne ordentliche Vorbereitung zu Männern, dann würde es sicher ein Unglück geben.
Wenigstens glaubten das die Bocaná-Arowaken.
Die Gefahr, daß die Jungen vorsätzlich mogelten, bestand kaum.
Es war nicht die Art der Arowaken, zu lügen oder zu betrügen. Sie hielten das für feige und schändlich. Außerdem glaubten sie, daß ein Junge, der bei seiner Weihe zum Erwachsenen nicht alle Vorschriften genau beachtete, alle guten Geister und besonders seinen Totem-Geist reizen würde, dessen Aufgabe es war, ihn zu beschützen und ihm gute Ratschläge zu erteilen, solange er lebte.
Natürlich war keiner so dumm, daß er es mit seinem Totem verdarb. Woher sollte er dann Hilfe bekommen, wenn er einmal in Schwierigkeiten geriet?
In diesem Augenblick saßen die beiden Freunde am Strand und blickten nach Westen. Das flammende Abendrot war langsam am Erlöschen. Noch ein Weilchen, dann würde die Mondsichel erscheinen.
Auf der anderen Seite der Insel begann eine Trommel zu dröhnen. Zuerst drangen die Laute ganz schwach herüber, dann wurden sie lauter und schneller, um nach einer Weile wieder verhaltener zu werden und ganz zu verstummen.
Es schien jetzt noch stiller als zuvor. Nur das Meer murmelte dumpf wie im Schlaf.
Das Trommeln setzte wieder ein, nun lauter und deutlicher.
Eine ganze Anzahl von Fackeln begannen im Walde aufzuleuchten. Zeitweilig verschwanden sie für kurze Zeit hinter Büschen und Baumstämmen. Als sie wieder sichtbar wurden, waren sie schon viel näher. Jetzt traten die Fackelträger aus dem dichten Walde. Es waren sechs von den erwachsenen Männern des Stammes : Sägefisch, Steinmesser, Habichtfeder, Lange Lanze, Fregattvogel und Zwei Harpunen.
Sie waren von Kopf bis Fuß schwarz und rot bemalt, trugen Unmengen von Halsbändern und hatten bunte Federn in die Stirnbänder gesteckt.
Einen Augenblick verharrten sie reglos. Dann setzten sie sich wieder in Bewegung und blieben unmittelbar vor den beiden Jungen stehen, die sich erhoben hatten, um sie zu empfangen. Ohne daß ein Wort gesprochen wurde, bildeten die sechs einen Kreis um die beiden. Darauf marschierten alle acht in den Wald hinein.
Auf einer Lichtung in der Mitte der Insel brannten vier große Feuer, an jeder Ecke eins. In der Mitte war ein gewaltiger viereckiger Reisighaufen aufgeschichtet, und unmittelbar daneben saß auf einem Baumstamm der Medizinmann.
Der alte, freundliche Großvater Mummel war wie verwandelt. Noch nie hatten ihn die Jungen so gesehen. Auf dem Kopfe trug er eine hohe Krone von schneeweißen Reiherfedern, dazu einen langen Baumwollmantel mit aufgemalten magischen Figuren und viele Halsbänder aus Krallen und Zähnen. Unter seinen Füßen lag ein grinsender Krokodilschädel. Er verkörperte die bösen Mächte, die besiegt werden sollten. Quer über seinen Knien lag ein seltsamer Gegenstand — die große „Säge" vom Kopf eines Sägefischs. In der Urzeit habe ein solcher Fisch die Erde aus dem Meer gehoben, so berichtete eine Sage, und daher war er ein mächtiger Schutzgeist.
Die Männer mit den Fackeln traten zur Seite, so daß die beiden Jungen allein blieben. Schulter an Schulter standen sie unmittelbar vor dem Medizinmann. Er sah sie ernst und fast streng an.
„Hat einer von euch mit einer Handlung oder mit Worten oder mit Gedanken gegen die Regeln verstoßen?" fragte er.
Läufer und sein Freund schüttelten die Köpfe. Sie wußten genau, daß sie alles getan hatten, was die Vorschrift verlangte.
„Hast du kein Verlangen gehabt, Fleisch oder Fisch zu essen?" fragte der Medizinmann Stumpfnase und sah ihn scharf an.
„Doch!"
„Und was hast du da getan — und was hast du da gedacht?"
„Ich habe den Gedanken ans Essen vertrieben. Ich dachte, es sei wichtiger, ein richtiger Mann zu werden."
Der Alte nickte still und wandte sich an Läufer.
„Hast du kein Verlangen verspürt, wieder ins Lager zurückzukehren und mit deinen Freunden zu plaudern?"
„Ja, aber nicht als Junge."
Wieder nickte der Medizinmann.
Dann wandte er sich an den Häuptling und fragte ihn: „Sägefisch, ist der Mond schon zu sehen?"
„Nein, Stehender Bär, der Mond ist noch nicht zu sehen."
Ein kalter Schauer lief den beiden Jungen über den Rücken, als sie hörten, wie der Häuptling den Medizinmann mit seinem magischen Namen anredete. Das geschah nur bei sehr feierlichen Anlässen. Der Alte wandte den Blick von Sägefisch nach den Jungen und sagte mit tiefer Stimme: „Während wir auf den wiederkehrenden Mond warten, werde ich euch von den Mächtigen und von Taj erzählen, von dem, der da wiederkehren wird."
Die beiden Jungen standen wie aus Stein gehauen, während der Medizinmann die Legenden von der Sonne und ihrer Tochter, von der Erde und dem Meer, von den Sternen und von der heiligsten aller Sagen berichtete: vom Mond und von Tag.
Von Taj dem Ackerbauer, der vor langer, langer Zeit vom Mond kam und bei den Vorvätern der Arowaken Wohnung nahm, als sie auf den Hügeln an der großen Lagune lebten. Von Taj, der das Volk gelehrt hatte, Mais zu säen, Fäden zu spinnen und Baumwollstoff zu weben der ihnen Gesetze gegeben hatte, ehe er auf ein Floß von Schlangenhaut stieg und zum Mond zurücksegelte.
Von Taj dem Guten, der einst zu ihnen zurückkehren würde, wenn sie seinen Willen erfüllten.
„Wer das Land bebaut und Nahrung für seinen Stamm bereitet, der tut Tajs Willen. Wer in Frieden und Eintracht mit seinen Nachbarn lebt, der gehorcht Tajs Gesetzen. Wer versöhnlich, hilfsbereit und freigebig ist, der versucht Taj zu gleichen. Wer Wild oder Fische oder irgendein lebendes Wesen nicht unnötig tötet, der erfüllt Tajs Willen. Wer das Leben leichter macht und Frieden zwischen Menschen stiftet, der macht, daß Taj zu uns zurückkehrt."
Der alte Medizinmann schwieg und saß eine Zeitlang in Gedanken versunken da. Dann wandte er sich an Sägefisch und fragte ihn: „Häuptling, ist der Mond schon zu sehen?"
„Ja, Stehender Bär, jetzt ist er zu sehen."
„So zündet des Mondes Feuer an I So, wie der Mond zurückkehrt, nachdem er eine Zeitlang verschwunden war, so wird einst Taj zu seinem Volk zurückkehren, und dann wird alles Böse schwinden."
Vier der Männer steckten neue Fackeln von Palmenblättern in die vier Feuer und drehten sie in den Flammen, bis sie hell brannten. Dann sprangen sie an den großen Reisighaufen und zündeten ihn an allen vier Ecken an.
Als er entflammt war, so daß der Feuerschein die ganze Lichtung erhellte, erhob sich der Medizinmann und sagte: „Möget ihr beiden jungen Männer an Stärke und Klarheit wachsen wie der neue Mond! Möget ihr dazu beitragen, die Welt zu ordnen und besser zu machen, so daß Taj bald zu seinem Volk zurückkehrt."
Er legte Läufer seine alte, runzlige Hand auf den Kopf.
„Du, mein Sohn, hattest von allen den schärfsten Blick für die Dinge, die wir am ehesten brauchen", sagte er. „Du hast uns Flüchtlingen hier mitten im Meer die Möglichkeit geschaffen, dereinst wieder leichter zurückzukehren in unser reiches Küstenland. Das ist die Tat eines Mannes. Du bist nun ein Mann, Adlerauge!"
Die Männer mit den Fackeln stießen einen lauten Jubelschrei aus, und die Trommel dröhnte durch die Nacht.
Der Alte verharrte eine Zeitlang in Schweigen. Dann legte er die Hand auf Stumpfnases dunkles Haar.
„Du bist heiter und willig, mein Sohn", sagte er. „Du bist geduldig und hast scharfe Augen wie der große graue Reiher, unser Stammesvogel. Du hast etwas erfunden, das leicht zu tun ist und uns das Leben auf diesen Inseln erleichtert. Das ist die Tat eines Mannes. Du bist nun ein Mann, Grauer Reiher!"
Wieder dröhnte die Trommel, und wieder ertönte von den Männern her ein Freudenschrei. Sie packten die beiden jungen Männer und setzten sie mit dem Rücken gegen einen Baumstamm. Mit scharfen Feuersteinmessern schnitten sie ihnen das lange Haar im Nacken glatt ab und warfen es ins Feuer.
Es tat weh, aber die Freunde verzogen keine Miene. Jetzt waren sie ja Männer und mußten zeigen, daß sie Schmerzen ertragen konnten, ohne zu jammern. Wenn es nicht schlimmer kam, dann war es schon auszuhalten.
Nach dem „Haarschneiden" kam das Bemalen. Steinmesser wurden hervorgeholt, dazu zwei kleine Schalen. In der einen davon befand sich cine Art roter Teig, in der anderen eine dunklere Flüssigkeit. Der Häuptling tauchte dünne Holzstäbchen in die Farben und malte den beiden Neugeweihten geheimnisvolle Muster auf die Gesichter und die Arme. Es waren die Stammes- und Totemzeichen, die Manneszeichen und Figuren, die ihnen Glück bringen und die Geister freundlich für sie stimmen sollten.
Sobald sie vollständig und schön bemalt waren, durften sie sich wieder erheben. Nun drängten sich die Männer um sie, klopften ihnen auf die Schultern, hängten ihnen einige ihrer schönsten Halsbänder um und steckten ihnen Federschmuck ins Haar.
Dann verschwanden mehrere von ihnen in den Büschen und kamen mit Krügen, Tonschalen und Holztellern zurück, die voller Speisen waren — vom Besten, was die Inseln zu bieten hatten.
Es gab Schildkrötensuppe mit großen, fetten Fleischstücken, Schildkröteneier, gekochte Krabben, gewaltige Hummer ohne Scheren, am Spieß gebratene Fische, in der Schale gebackene Muscheln und eine Art Schmorspeise von Schnecken, Garnelen und fetten Fischen. Jeder Haushalt der kleinen Insel hatte zu dem Festschmaus wenigstens einen Topf Essen beigesteuert.
Die Männer setzten ihre Gerichte mitten auf die Waldlichtung und zogen die Neugeweihten mit aller Kraft heran.
„Eßt, eßt!" schrien sie. „Das Fasten ist zu Ende! Nun seid ihr Männer!"
„Hier ist ein Schildkrötenei für den Grauen Reiher!" rief Habichtfeder und hielt eine Tonschale in die Höhe. „Wir haben diese Schildkröte mit einem Schildfisch gefangen, wie Grauer Reiher es uns gezeigt hat."
„Diese große Languste soll Adlerauge haben!" rief Fregattvogel. „Ich bin von seinem Kanu aus nach ihr getaucht."
Adlerauge und Grauer Reiher setzten sich mitten in den Kreis und taten sich gütlich. Sie freuten sich, daß sie so ehrenvolle Namen erhalten hatten, noch mehr jedoch, daß sie nun richtige Männer des Stammes waren.
Mochten sie noch so hungrig sein, so hielten sie sich doch genau an die Tischsitten. Es soll ja niemand denken, daß es keine Tischsitten gibt, auch wenn man mit den Fingern ißt. Sie aßen langsam und würdig, wie es Männern zukam.
Das Fest dauerte bis lange nach Mitternacht. Die Indianer sangen, schlugen die Trommel und tanzten zwischen den Feuern — sowohl den Hirschtanz wie auch den Geier- und den Tarpon-Tanz.
Als sie vom Tanzen müde waren, aßen sie wieder, und schließlich begannen sie Sagen vom ersten Adlerauge zu erzählen, von dem Manne, der Tajs Gehilfe war, als sie den heiligen Mais aus dem Land der untergehenden Sonne holten. Auch vom ersten Grauen Reiher, der der Stammvater aller Bocaná-Indianer war und das Floß, den Angelhaken und die Harpune erfunden hatte, erzählten sie.
Der Medizinmann saß auf seinem Baumstamm, lächelte über das Gebaren der jungen Männer und rauchte eine lange Pfeife mit einem Tonkopf. Er war der einzige des Stammes, der das durfte. Die BocanáArowaken hielten den Tabak für ein Zauberkraut, und es mußte schon ein Medizinmann sein, um es ohne Schaden rauchen zu können.

Erst als der Morgen sich ankündigte, schliefen die Indianer ein paar Stunden.
Als sie erwachten, spülten sie erst einmal alle Schläfrigkeit ab, indem sie ein Stück ins Meer schwammen; und dann fuhren sie in einem Triumphzug zu der kleinen Insel zurück.
Adlerauge und Grauer Reiher fuhren auf dem ersten Floß, zusammen mit dem Häuptling und dem Medizinmann.
Als sie an Land stiegen, standen alle Jungen des Stammes dichtgedrängt am Strand und sahen die beiden voll Bewunderung und auch ein bißchen neidisch an.
Das erste, was die beiden Freunde nach dem Frühstück taten, war, sich nach einer geeigneten Stelle umzusehen, wo sie ihre Hütten bauen konnten.
Bisher hatten sie im Sand unter irgendeinem Mangrovenbusch geschlafen, wo sie sich gerade befanden. Die Sitten sahen vor, daß Adlerauge und Grauer Reiher nun ihre eigenen Hütten bauen mußten; sie waren ja nun erwachsen und konnten jederzeit heiraten.

Neue Pläne
Das zweite Kanu — das dem Häuptling gehörte — konnte bald zu Wasser gelassen werden, und das dritte sollte im Lauf von einigen Wochen fertig werden.
Es war eine langwierige Arbeit, einen so großen Ceibabaum zurechtzuformen und auszuhöhlen, aber bei gutem Willen machte die Arbeit Tag für Tag weitere Fortschritte.
Da man nun zwei Kanus zum Fischen hatte, war das Essen auch viel leichter und schneller .zu beschaffen, so daß man mehr Zeit übrig hatte.
Adlerauge konnte sich nun auch daranmachen, Bogen und Pfeile herzustellen. Er brauchte sich nicht länger mit dem Kanubau zu beschäftigen, sondern er beauftragte Steinmesser mit der Leitung, der selber nicht besonders erfinderisch war, aber gute und gewissenhafte Arbeit lieferte, wenn ihm ein anderer ein Muster gab, nach dem er sich richten konnte.
Im übrigen schien es fast so, als hätten die Erfindungen Adlerauges und des Grauen Reihers den ganzen Stamm auf die Spuren neuer Entdeckungen gebracht.
Ein neuer Gegenstand nach dem anderen wurde erprobt. Die meisten davon waren vielleicht nicht allzuviel wert, aber einige erwiesen sich doch als ziemlich brauchbar.
Fregattvogel kam auf den Gedanken, aus Haifischzähnen eine Säge anzufertigen. Ein großer, toter Haifisch war auf die Insel zugetrieben und von der Flut auf eine Korallenbank gespült worden.
Es war ein weißer Hai mit den furchtbarsten Zahnreihen, die man sich denken kann, und Fregattvogel ruhte nicht eher, als bis er den letzten Zahn aus den Kiefern des toten Ungeheuers herausgezogen hatte.
Es machte ihm nicht einmal etwas aus, daß er in einen Winkel der großen Insel verwiesen wurde, als er mitten in der Arbeit war. Der Hai roch nämlich nicht gut, und Fregattvogel roch nicht viel besser, als er sich eine Zeitlang mit ihm beschäftigt hatte.
Schließlich wurde er jedoch mit diesem Teil seines Unternehmens fertig und konnte den nächsten in Angriff nehmen.
Er befestigte die dünnen, dreieckigen Haifischzähne in langer Reihe an einem Stück Holz und bekam so eine Art von Säge. Sie wurde noch besser, als er dazu übergegangen war, die Zähne zwischen zwei dünn geschliffenen Hartholzschienen zu befestigen und diese an den beiden Enden mit Streifen nasser Haifischhaut zu umwickeln. Wenn diese Hautstreifen dann in der Sonne trockneten, schrumpften sie zusammen und drückten dabei die beiden Holzschienen so fest aneinander wie ein Schraubstock.
Das Verfahren zum Glätten der Holzschienen und anderer Dinge war eine Erfindung von Lange Lanze.
Er hatte einen großen Stachelrochen gefangen, um sich Material für eine Pfeilspitze zu beschaffen. Als er den furchtbaren Stachel aus dem Schwanz löste, streifte er mit der Rückseite der einen Hand die Rückenhaut des Rochens.
Die Haut war zwar von einer dicken Schicht zähen, klebrigen Schleims überzogen, aber Lange Lanze hatte dennoch das Gefühl, gegen etwas Rauhes zu streichen.
Seine Neugier war erwacht. Er schabte allen Schleim von dem Rücken des Rochens und rieb die nackte Haut kräftig mit einem flachen Holzstück.
Die Hautzähne hinterließen kleine Spuren in dem Holz — Rochen und Haie haben nämlich eigenartige Schuppen, die wie winzige Zähne geformt sind.
Nun zog der Indianer ein großes Stück Haut vom Rücken des Rochens, spannte es um das Blatt eines Paddels und ließ es in der Sonne trocknen. Als es völlig trocken war, versuchte er damit dasselbe noch einmal, und nun raspelte es sich viel besser.
So kam der Stamm darauf, daß man getrocknete Hautstücke von Haien und Stachelrochen gut wie Raspeln oder Sandpapier verwenden konnte, um damit Holzgegenstände zu glätten. Sie waren wesentlich besser als die alten Sandsteinraspeln. Natürlich hielten sie nicht so lange wie diese, aber sie waren viel leichter herzustellen, und außerdem ließ sich mit ihnen bedeutend schneller arbeiten.
Indes, nicht nur die Männer hielten Ausschau nach Neuem. Die Frauen und Mädchen waren wenigstens ebenso erfinderisch wie sie.
Lachauge, das junge Mädchen, das von dem Barracuda angefallen worden war, mußte ziemlich lange still liegen, während der alte Mummel ihre Wunden pflegte. Während dieser Zeit hatte sie Gelegenheit, etwas Neues und Nützliches auszudenken.
In letzter Zeit war das Essenkochen immer schwieriger geworden. Zwar hatten die Frauen eine ganze Anzahl Tontöpfe mit, als sie auf die Inseln hinausgelangten; aber Tontöpfe halten leider keine Ewigkeit, mögen sie noch so gut angefertigt sein.
Die schwarzgrauen Krüge und Töpfe der Bocaná-Arowaken waren ziemlich spröde. An den meisten ihrer einstigen Wohnstätten findet man Unmengen von Scherben, so daß es mitunter aussieht, als hätten sie auf ganzen Haufen von Steingut gewohnt.
Von den mitgebrachten Töpfen ging einer nach dem andern entzwei. Und draußen auf den Koralleninseln gab es auch nicht den kleinsten Klumpen Ton, aus dem man neue herstellen konnte. So fragten sich die Bocaná-Frauen fast verzweifelt, worin sie künftig das Essen kochen sollten. Eine Anzahl von Gerichten ließ sich natürlich auch auf andere Art zubereiten — rösten oder am Spieß braten. Aber es war hart, auf die Schneckensuppe, die gekochten Krabben und vieles andere Gute einzig deshalb verzichten zu müssen, weil man keine Kochtöpfe mehr hatte.
Einige Frauen versuchten eine Art primitiver Kochgefäße aus gehöhlten Korallenstücken anzufertigen, aber der Versuch schlug völlig fehl. Sobald die Korallen ins Feuer kamen, zerfielen sie in der Hitze zu Kalkpulver.
Lachauges Mutter war so um ihren letzten Kochtopf besorgt, als sei er ihr kostbarstes Kleinod. Er hielt auch wirklich länger als die meisten; aber schließlich zersprang auch er, und man konnte nichts dagegen tun.
Steinmesser, Lachauges Vater, war nicht erbaut, als er nur noch geröstete Speisen bekam. Aber da man nichts anderes zubereiten konnte, mußte man sich damit begnügen.
Eines Tages saß Lachauge allein am Feuer — der Vater war beim Kanubau, die Mutter zum Schneckensammeln gegangen.
Lachauge war noch nicht wieder soweit hergestellt, daß sie nach eßbaren Dingen tauchen konnte.
Da kam Grauer Reiher vom Strand. Er blieb stehen und stellte einen kleinen Korb neben dem Feuer ab, wo ihn das Mädchen leicht erreichen konnte.
„Es sind ein paar Krabben", sagte er. „Von den großen roten, die Steinmesser so gern ißt."
Lachauge dankte ihm für die Gabe, aber sie vermochte das Weinen nur schwer zu unterdrücken. Konnte sie die Krabben doch nicht mehr so kochen, wie ihr Vater sie gern aß!
„Wir sind nun arm", sagte sie. „Wir haben keinen Topf mehr." „Dann mußt du wohl etwas anderes finden, worin du kochen kannst", antwortete Grauer Reiher lächelnd. „Wirst sehen, es wird schon gehen — wo du doch so klug bist. Vielleicht kannst du in Korallen kochen."
„Korallen zerfallen zu Pulver, wenn man sie ins Feuer setzt", sagte Lachauge traurig.
„Dann setz doch das Feuer in die Koralle!” sagte Grauer Reiher scherzend und ging.
Lachauge sah ihm trübsinnig nach. Nach einer Weile erhob sie sich und hinkte eilig zur Hütte hinüber.
Dort lagen einige faustgroße Steine, mit denen man Mais zerkleinert hatte, als es noch Mais zum Zerkleinern gab, dazu eine Anzahl kleinerer, glatter Steine, die Steinmesser als Senkgewichte benutzte, wenn er angelte.
Lachauge trug sie an die Feuerstelle, die etwas von der Hütte entfernt lag, und steckte sie in die Glut.
Darauf holte sie ein großes, tief ausgebuchtetes Korallenstück herbei, das in der Nähe lag, und füllte es mit Wasser aus einer Kalebassenflasche. In das Wasser legte sie die Krabben.
Darauf band sie einige Mangrovenzweige mit einer Schnur zusammen, so daß diese ihr gleichsam als Feuerzange dienen konnten. Grünes Mangrovenholz brennt nämlich nicht.
Als die Steine glühend heiß geworden waren, nahm sie einen davon mit der Zange heraus und ließ ihn in das Wasser mit den Krabben fallen. Dann legte sie einen weiteren dazu, nahm den ersten wieder heraus und steckte ihn erneut in die Glut. Ein weiterer glühender Stein nahm seine Stelle im Krabbenwasser ein.
Dadurch wurde das Wasser immer heißer, und nach einiger Zeit begann es zu kochen. Nun mußten die Steine unaufhörlich ausgewechselt werden.
Natürlich war das eine schwierige Art, Essen zu kochen, und mit den heißen Steinen kam auch ein Teil Kohlen und Asche mit in das Wasser, aber zum Kochen von Krabben oder Langusten war das Verfahren immerhin brauchbar.
Steinmesser war sehr erfreut, als er nach Hause kam, und lobte seine Tochter.
Diese Art der Essenzubereitung war sicher nicht neu — wahrscheinlich haben die Menschen der Urzeit auf diese Weise gekocht, ehe sie lernten, wie man Gefäße aus gebranntem Ton herstellt. Aber zuweilen ist es ebenso wichtig, etwas Altes und in Vergessenheit Geratenes wiederzuentdecken, wie etwas ganz Neues zu erfinden.
Nun könnte man sich fragen, warum die Bocaná-Arowaken all diese neuen Dinge so kurz nach ihrer Ankunft auf den Inseln erfanden und warum sie nicht schon früher daraufgekommen waren.
Die Antwort darauf ist, daß sie diese Gerätschaften nicht benötigt hatten, als sie vor dem Auftauchen der Kariben auf dem Festland wohnten. Dort war der Ackerbau ihr wichtigster Ernährungszweig gewesen. Mais, Maniok und Süßkartoffeln waren ihnen viel nützlicher erschienen als Fische und Wildbret, und ein Grabstock oder eine Handmühle waren notwendigere Gegenstände als Pfeil und Bogen und Bootsbauerwerkzeuge. Niemand hatte mit heißen Steinen kochen müssen, da man ja in jeder Hütte über einen ganzen Satz von Gefäßen aus gebranntem Ton verfügte und ein neuer Topf jederzeit für einen Korb Mais eingetauscht werden konnte.
Da man sich niemals weit von den Pflanzungen entfernen konnte und den Wohnsitz nicht wechselte, benötigte man auch keine schnellen Kanus, sondern konnte sich mit Flößen behelfen, die wesentlich leichter herzustellen waren.
Als die Indianer auf die Inseln fliehen mußten, wurde alles anders. Sie konnten kaum etwas Saatgut mitnehmen, und selbst, wenn sie das gekonnt hätten, wären sie gezwungen gewesen, ausschließlich von Fischen zu leben, bis die neuen Anbauflächen gerodet und die erste Ernte herangereift war.
Die Inseln, die sie jetzt bewohnten, waren auch nicht so groß und so fruchtbar, daß sich dort ein ganzer Stamm vom Ackerbau ernähren konnte.
Um weiterleben zu können, hatten die Bocaná-Arowaken keine andere Wahl, als sich den neuen Verhältnissen anzupassen und ihnen das möglichst Beste abzugewinnen.
Außerdem ist es wohl oft so, daß gesunde, unverbrauchte Menschen, die sich plötzlich in eine neue Umgebung versetzt sehen, gleichsam aus dem Halbschlaf der alten Gewohnheiten aufgeweckt und dazu angespornt werden, etwas Neues zu schaffen. Sie werden durch den Wechsel der Umgebung verändert und verjüngt.
Es war an einem Morgen.
Sägefisch stand bis an die Knie in dem seichten Wasser und polierte den aufwärts geschwungenen Bug des Kanus mit einem Stück gut getrockneter Stachelrochenhaut.
Er rieb und putzte aus Leibeskräften. Wenn er nur genug Pflanzenfarbe gehabt hätte, dann hätte er sein neues, schönes Kanu bemalt und den Boden zum Schluß mit Harz oder zähem, hartem Wachs aus den Nestern der wilden Bienen gestrichen.
Ein Schatten fiel auf das Kanu. Sägefisch sah auf. Adlerauge war so leise herangewatet, daß ihn der Häuptling nicht gehört hatte.
„Was tut mein junger Bruder jetzt?" fragte Sägefisch. „Hast du Steinmessers Bogen schon fertig?"
„Er ist fertig und übergeben", antwortete der Bogenmacher. „Mein letztes gutes Material ist dabei zu Ende gegangen."
„Kannst du nicht irgendein Holz nehmen, das hier auf den Inseln wächst? Vielleicht von der roten Mangrove? Die sieht doch aus, als wäre sie stark und biegsam."
„Nein, Häuptling, die taugt nicht zu Bogen, denn sie verliert ihre Biegsamkeit. Ich machte einen Bogen davon, aber nach ein paar Tagen war er tot und trocken wie ein Treibholzstecken. Da ließ er sich nicht mehr biegen, sondern zerbrach, als ich ihn zu spannen versuchte." Adlerauge schwieg einige Zeit.
„Häuptling", fragte er dann, „könnten wir nicht mit deinem neuen Kanu zum Festland hinüberfahren und eine Ladung Bogenholz und Pfeilschäfte suchen, so daß alle Männer und am besten auch die größeren Jungen Bogen und Pfeile bekommen könnten?"
Sägefisch nickte bedächtig.
„Darüber habe ich auch schon nachgedacht", sagte er. „Eigentlich brauchten wir noch mehr Kanus, wenigstens noch eins oder zwei, so daß der ganze Stamm auf einmal fahren und auf die schwerfälligen Flöße verzichten könnte. Bald brauchen wir auch Saatgut für eine Anpflanzung, Ton für neue Töpfe und gerade Stöcke für Harpunen-schäfte — und noch vieles andere. Aber ich denke, wir wagen uns vorläufig noch nicht auf gut Glück zum Festland hinüber."
„Und wohin sollten wir deiner Meinung nach fahren?"
„Dort, zu den Inseln da drüben." Der Häuptling zeigte auf eine kleine Inselgruppe, die ungefähr zehn Kilometer von ihrem Lagerplatz entfernt war. „Es sieht aus, als ob die eine von ihnen bedeutend größer ist als die beiden hier zusammen, und sie scheinen mir beträchtlich höher über dem Wasser zu liegen. Wenn wir Glück haben, finden wir dort vielleicht so mancherlei von dem, was wir brauchen."
„Wann gedenkst du mit uns dorthinüber zu fahren?"
„Sobald wir Fische für drei oder vier Mahlzeiten getrocknet haben. Wir müssen einen beträchtlichen Teil Nahrungsmittel hier auf der Insel zurücklassen und außerdem Proviantbeutel mitnehmen. Es kann sein, daß wir da drüben ein, zwei Tage bleiben müssen, wenn stürmisches Wetter aufkommt; und dann können wir auch nicht fischen."
„Und wer soll mitfahren?"
„Du, mein junger Bruder, ich und Grauer Reiher. Die anderen Männer müssen hierbleiben, aber wir können ja zwei von den größeren Jungen mitnehmen. Frosch zum Beispiel. Er ist der beste Taucher, den wir haben. Und dann noch Dummschnut."
„Was sollen wir denn mit Dummschnut? Die Frauen sagen immer, er ist so dumm, daß er kaum Suppe zu essen versteht."
„Ja, das sagen sie. Aber er ist gehorsam und willig und ein starker
Paddler. Alle streitbaren Männer müssen hierbleiben. Wir dürfen die Frauen und Kinder nicht ohne Schutz lassen, es könnte ja immerhin
irgendein Feind mit dem Wind oder mit der Strömung herangefahren kommen. Übrigens bin ich gar nicht so sicher, daß Dummschnut wirklich so dumm ist, wie die Frauen behaupten. Er ist wohl in der Hauptsache nur etwas schüchtern und unbeholfen."
Adlerauge nickte. Der Häuptling hatte zweifellos recht. In den letzten Monaten war zwar nicht die geringste Spur von den Kariben zu entdecken gewesen. Die Arowaken hatten diese nie wieder gesehen, seitdem sie das Festland verließen — aber das bedeutete ja nicht, daß sie die Gefahr vergessen durften.

Den ganzen folgenden Tag fischten die Männer von den Kanus und den Flößen aus. Große Mengen von Fischen wurden am Rücken auseinander geschnitten und an hohen Holzgerüsten zum Trocknen aufgehängt. Am nächsten Tage wurde die Arbeit bis spät in den Nachmittag hinein fortgesetzt.
Dann war es dem Häuptling endlich genug. Er sagte zu den Männern, die er als Begleiter ausgewählt hatte, sie sollten ihre Waffen nachsehen und einige große Kalebassenflaschen mit Trinkwasser füllen.
Am nächsten Morgen, wenn das Wetter schön war, wollten sie losfahren.

Die Reise nach Titi-pán
Vor dem Morgengrauen lag das Meer glatt wie ein Spiegel da. Sägefisch und seine Begleiter, mit denen er sich auf die Reise begeben wollte, frühstückten in größter Eile. Dann brachten sie ihre Sachen in das Kanu und stießen vom Land ab. Die jungen Männer und die Jungen paddelten, der Häuptling saß am Heck und steuerte.
Als die Sonne aufging, hatten sie bereits ein Drittel ihres Weges zu der anderen Inselgruppe hinter sich gebracht.
Sägefisch band einen Angelhaken aus Perlmuschelschale an eine Angelschnur und warf ihn aus, so daß er in einiger Entfernung hinter dem Kanu hergeschleppt wurde. Die Schale war dünn geschliffen und in der Form eines Fisches ausgeschnitten, aber die Mitte der Schwanzflosse ragte heraus und bildete den eigentlichen Haken. Wenn Sägefisch von einem Floß aus angelte, pflegte er den Haken so weit hinauszuwerfen, wie er konnte, um ihn alsdann wieder einzuholen; aber jetzt ließ er ihn hinterherschwimmen.
Nach kurzer Zeit legte er plötzlich das Paddel aus der Hand, zog die Schnur ruckartig an und begann sie dann einzuholen.
Ein fast armlanger Fisch schnellte über die Kante des Kanus. Seine Seiten zeigten längliche blaugrüne Flecken, und dazwischen schimmerte er in allen Farben des Regenbogens wie Perlmutter. Der Fisch war eine „Sierra", sie wurde auch spanische Makrele genannt.
„Gutes Essen für die nächste Mahlzeit, wenn wir Feuer anmachen können,” sagte der Häuptling mit zufriedenem Lächeln. Dann tötete er den Fisch und warf den Haken wieder aus, aber nun biß kein Fisch mehr an.
Mittlerweile konnten sie sehen, daß die Gruppe vor ihnen aus vier Insel.n bestand.
Die am nahesten lag, war klein und flach, nicht größer als die heimatliche Insel, stellenweise mit Mangrovenbüschen und kurzen Bäumen bewachsen, auf deren Zweigen Hunderte von Fregattvögeln ihre Nester gebaut hatten.
Die zweite Insel war ganz mit Wald bedeckt und etwas kleiner als die, auf der sie die Kanus angefertigt hatten. Die dritte war eigentlich nur ein Haufen von dunklen Korallenklippen, eher eine Schäre als eine Insel. Sie befand sich in dem Sund zwischen den beiden größten Inseln.
Die vierte Insel sah ganz anders aus. Sie war wenigstens zwei Kilometer lang, und mitten über sie hinweg zog sich eine Anhöhe, auf der viele verschiedene Baumarten wuchsen.
Adlerauge zeigte erfreut auf die Kronen einiger mächtiger Ceibabäume, die wie runde Kuppeln über die anderen Baumwipfel hinausragten.
„Da ist Holz für unsere Kanus", sagte er.
„Es kann auf dieser Insel auch noch andere nützliche Dinge geben", erwiderte Sägefisch. „Paßt alle gut auf, ob ihr irgendwo Rauch seht! Es wäre doch merkwürdig, wenn es auf einer so großen und schönen Insel keine Menschen gäbe."
Immer näher glitt das Kanu über das morgendlich blanke Meer an die Inseln heran, aber keiner der Ruderer konnte andere Lebenszeichen erkennen als Vögel und hier und da einen springenden Fisch.
„Wir gehen zunächst auf der zweitgrößten Insel an Land", entschied der Häuptling. „Von dort aus werden wir sicher Ausschau nach der großen Insel halten können. Sehen wir am Tage keine Lebenszeichen und bei Nacht keine Feuer, dann können wir morgen früh zu ihr hin überrudern. Denkt daran: keiner darf Feuer anmachen oder sich unten am Strand sehen lassen."
Sie fuhren in einem großen Bogen um die kleinere der waldbedeckten Inseln. Als sie den Strand erreicht hatten, steuerten sie das Kanu an eine flache Sandbank, legten Baumstammrollen unter das Fahrzeug und zogen es schnell in die Büsche.
Dann nahm Grauer Reiher ihren Topf — einen von den letzten, die der Stamm noch besaß — und watete in das seichte Wasser hinaus. Er füllte den Topf mit Meerwasser und spülte die Schleifspuren des Kanus von dem Uferstreifen.
Weiter oben fegte Adlerauge den Strand mit ein paar Zweigen glatt, die er in einer Dickung abgebrochen hatte, wo es nicht auffiel. Als sie damit fertig waren, hätte ein Mensch wirklich scharfe Augen haben müssen, um zu entdecken, daß hier ein Boot gelandet war.
Grauer Reiher watete den Strand entlang, bis er an eine Stelle gelangte, wo das Buschwerk ins Wasser hineinwuchs. Dort ging er an Land und stieg von Wurzel zu Wurzel, bis er auf einige harte Korallenblöcke gelangte.
Darauf schlichen sie alle fünf nach der entgegengesetzten Seite der Insel, um einen passenden Aussichtspunkt zu suchen.
Stunde um Stunde verharrten die drei Männer dort reglos und gut verborgen, während sich die beiden Jungen im Schatten ausruhen durften. Als die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte, sagte Sägefisch zu Frosch, er solle zum Kanu zurückgehen und einige getrocknete Fische und eine Flasche Trinkwasser holen.
Wenigstens vier Stunden hielten sie Ausschau, ohne daß sie auch nur ein Zeichen wahrnahmen oder einen Laut hörten, die auf Menschen schließen ließen.
Es waren ungefähr achthundert Meter bis zur größten Insel, nicht ganz in der Mitte des Sundes lag die kleine kahle Schäre aus Korallenklippen.
„Nicht das geringste ist zu sehen", sagte Adlerauge schließlich.
„Wir müssen bis zum Abend warten", erwiderte Sägefisch. „Wenn dort Menschen wohnen, müssen sie sicher früher oder später Essen kochen, und dann sagt uns das Feuer, wo sie sich befinden."
Im selben Augenblick stieß Grauer Reiher ein leises Zischen aus. Die anderen sahen ihn fragend an.
Er zeigte nach den Korallenklippen. Zwischen den Blöcken waren zwei braune Gestalten aufgetaucht.
Jetzt liefen sie ins Wasser, warfen sich hinein und begannen geradeswegs auf die Stelle loszuschwimmen, an der sich die Arowaken verborgen hielten.
Noch ehe die Schwimmer weit gekommen waren, stieß Sägefisch einen verhaltenen Ruf aus: „Da — drüben auf der großen Insel! An der langen Landzunge — links! Kariben!"
Einige kleine Gestalten tauchten an dem offenen Strand auf. Sie zogen und zerrten etwas — es war ein großes Kriegskanu. Schließlich hatten sie es im Wasser.
Drei von ihnen sprangen hinein und begannen den beiden Schwimmern nachzupaddeln.
Diese waren unterdessen ein gutes Stück vorangekommen. Sie hatten nur noch ein Viertel der Strecke zurückzulegen. Aber das schnelle Kanu kam ihnen rasch näher. Glücklicherweise befanden sich die beiden im Windschatten der waldbedeckten Insel und wurden nicht allzu-sehr von den Wellen behindert, während die Verfolger draußen auf dem offenen Sund gegen Wind und See anpaddeln mußten.
Als die Flüchtlinge endlich im flachen Wasser angekommen waren, hatte sich ihr Vorsprung auf knapp achtzig Meter verringert.
Sie richteten sich auf und begannen halb springend zu waten, so daß das Wasser aufspritzte.
„Menschen unseres Volkes, ein Junge und ein Mädchen", flüsterte Sägefisch. „Laßt sie nur vorbeilaufen und haltet die Bogen bereit. Wenn die Kariben sie verfolgen, dann..."
Sein sonst so freundliches und ruhiges Gesicht hatte einen verbissenen, grimmigen Ausdruck angenommen.
Grauer Reiher warf einen Blick hinter sich.
„Da kommt Frosch mit dem Essen”, flüsterte er. „Psst l Versteck dich! Auch du, Dummschnut!"
Frosch verschwand in den Büschen wie ein gejagtes Kaninchen, aber Dummschnut trat nur hinter eben Baum, einige Meter vom Häuptling entfernt. In der Hand hielt er Adlerauges Jagdspeer.
Jetzt stürzten die Flüchtlinge an Land und das Ufer hinauf. Keuchend rannten sie geradeswegs in den Wald hinein. Das Mädchen kam kaum zehn Schritt von Adlerauge entfernt vorbei. Da bemerkte es die geduckte Gestalt mit dem gespannten Bogen in den Händen.
Mit einem Schrei warf es sich kopfüber zu Boden und schlug die Arme Aber den Kopf.
Nun war auch das Kanu der Kariben im seichten Wasser angelangt. Die Kariben legten die Paddel weg. Einer von ihnen nahm einen großen Stein, der mit einem Strick aus Agavenfasern am Bug angebunden war, und warf ihn über Bord, damit das Kanu festlag. Dann nahmen die drei Krieger ihre Bogen und Kriegskeulen, sprangen aus dem Kanu und rannten ans Land.
Adlerauge sah sie näher kommen und spannte mit einem heftigen Zug seinen Bogen. Er biß die Zähne zusammen, bis sein Mund aussah wie ein schmaler Strich. Es war ihm entsetzlich, auf Menschen schießen zu müssen. Aber entsetzlicher war es wohl doch noch, wenn er zuließ, daß diese wilden Männer zwei wehrlose junge Menschen seines eigenen Volkes mit der Keule erschlugen. Er mußte schießen, es gab keinen anderen Ausweg.
Einer der Kariben kam geradeswegs auf ihn zu. Jetzt waren es nur noch fünfzehn Schritte ... zehn Schritte .. . acht ...
„Taj, vergib mir l" flüsterte Adlerauge.
Dann richtete er sich auf und ließ den Pfeil fliegen.
Der Karibenkrieger stieß einen kurzen Schrei aus, ließ seine Waffen fallen und schlug in seiner ganzen Länge hin.
Adlerauge hörte die Bogensehnen seiner Kameraden gegen das Holz klatschen und sah einen der beiden anderen Kariben zu Boden fallen. Zwei Pfeilschäfte ragten ihm aus der Brust.
Der dritte Karibe brüllte rasend auf und stürzte mit erhobener Keule auf Sägefisch zu, der gerade einen neuen Pfeil auf die Bogensehne legte. Selbst wenn Grauer Reiher und Adlerauge schußbereit gewesen wären, hätten sie ihre Pfeile doch nicht abschießen können, aus Furcht, den Häuptling zu treffen.
Sägefisch sprang zur Seite, und der erste Keulenschlag des Kariben sauste an ihm vorbei, ohne zu treffen. Als Sägefisch jedoch dem nächsten Schlag ausweichen wollte, stolperte er über einen zu Boden gefallenen Baumast und stürzte.
Mit einem Satz war der Karibe über ihm und hob die Keule zum tödlichen Schlag.
Da sprang jedoch Dummschnut aus seinem Versteck dem Feind entgegen und stieß ihm den Speer in die Brust.
Der Wilde wankte, und sein Keulenschlag hatte nur noch die halbe Kraft. Sie genügte jedoch, um den Jungen zu Boden zu strecken. Wieder hob der Karibe die Keule, aber jetzt war Sägefisch kampfbereit. Er setzte den einen Fuß blitzschnell hinter das Fußgelenk des Feindes und trat ihm mit dem anderen Fuß unter das Knie, so daß er rücklings hinschlug.
Im nächsten Augenblick war der Karibe wieder auf den Beinen. Einige Sekunden verharrte er unschlüssig, gleichsam als überlege er, welchen Feind er zuerst angreifen solle.
Dieses Zögern wurde sein Verderben. Drei Pfeile trafen ihn fast gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen, und er fiel um wie ein gefällter Baum.
Sägefisch ließ den Bogen fallen und eilte zu dem niedergeschlagenen Jungen. Dummschnut hatte sich auf die Knie erhoben und hielt sich mit beiden Händen den Kopf.
Der Häuptling schlang die Arme um ihn und half ihm auf die Beine. Dummschnut blutete aus einer Schürfwunde über dem einen Ohr und einer zweiten auf der Schulter, aber sonst schien er nicht ernstlich verletzt zu sein. Der Schlag hatte ihn von der Seite getroffen, und die Keule war gleichsam abgeglitten.
Jetzt blickte er besorgt von dem einen zum andern.
„Habe ich mich wieder dumm benommen?" fragte er mit trauriger Miene.
„Dumm? Wie ein richtiger Mann hast du dich benommen!" antwortete Sägefisch. „Mag der alte Großvater Mummel sagen, was er will, aber du hast mir das Leben gerettet, und das mindeste, was ich dir dafür geben kann, ist ein ehrenvoller Name. Feuersteinherz wird gut für einen Krieger passen, der so mutig ist wie du. Ich werde den Medizinmann bitten, daß du dich für diesen Namen vorbereiten darfst, wenn wieder Neumond wird."
Dummschnut sah aus, als traue er seinen Augen und Ohren nicht. Die Frauen hatten ihn stets ausgelacht, weil er so linkisch war und immer fürchtete, er könne etwas falsch machen; darum hatte er schließlich selber geglaubt, er sei dumm und unnütz.
Nun hatte ihn der Häuptling gelobt und ihm einen neuen Namen ausgesucht.
Einen Männernamen würde er bekommen — und was für einen! Feuersteinherz — darauf durfte ein jeder stolz sein.
Adlerauge beugte sich über den letzten Kariben und nahm ihm die Waffen und den Schmuck ab.
„Dieser Mann war ein Häuptling", sagte er. „Es ist wohl recht und billig, daß Feuersteinherz seinen Bogen, seine Keule und alle seine Halsbänder bekommt. Vielleicht wird er mit der Zeit auch ein Häuptling."
Unterdessen hatte sich das Mädchen vom Boden erhoben und sah die Fremden verwundert an.
„Ist das wirklich wahr?" fragte sie mit bebender Stimme. „Seid ihr Arowaken?"
„So ist es, kleine Schwester", antwortete Adlerauge freundlich. „Wir sind Bocaná-Arowaken aus dem Dorf am Reiherfluß, doch sind wir jetzt auf diese Inseln übergesiedelt, um in Frieden vor den Kariben leben zu können. Woher kommst du, kleine Schwester?"
„Unser Dorf lag am Langen Sandstrand auf der Insel Barú", sagte das Mädchen. „Auch wir sind vor den Kariben geflohen. Unser Floß kam in der Nacht von den anderen ab und wurde vom Wind hierher-getrieben, nach Titi-pán."
Sie zeigte auf die lange Insel.
„Wir waren unser acht auf dem Floß", fuhr sie fort. „Dann wurde meine Mutter krank und starb. Der Bruder meiner Mutter, meine Schwester und ihr Mann, meine drei jüngeren Brüder und ich haben länger als eine Mondzeit auf Titi-pán gelebt. Ich weiß nicht, wo die anderen Flöße geblieben sind, aber ich glaube, sie wollten an den Mangrovensee unten im Süden. Vor zwei Tagen überfielen uns die Wilden kurz vor Morgengrauen. Sie töteten meinen Onkel und meinen Schwager. Meine Schwester und meine beiden jüngsten Brüder nahmen sie gefangen, und seitdem haben sie Schnellfuß und mich gejagt."
Sie zeigte auf den Jungen, der scheu aus dem Gebüsch hervorschaute. „Als es gestern abend dunkel geworden war, schwammen wir nach der kleinen Felseninsel und versteckten uns dort. Lieber wollten wir uns von den Haifischen fressen lassen, als Gefangene der Kariben werden. Schließlich konnten wir es auf den Felsen in der glühenden Sonne ohne Trinkwasser nicht mehr aushalten, und so schwammen wir hierher. Das übrige wißt ihr ja."
„Wie viele Kariben sind noch auf Titi-pán und bewachen die Gefangenen?" fragte der Häuptling.
„Nur zwei. Ein alter Krieger und ein Junge, ungefähr so alt wie Feuersteinherz. Sie waren ihrer sechs, als sie kamen, aber einer von ihnen wurde im Kampf erschlagen, als sie uns überfielen."
Sägefisch gab den anderen ein Zeichen, näher zu treten.
„Adlerauge", sagte er, „geh du mit Feuersteinherz, Schnellfuß und Frosch auf die andere Seite der Insel und lehre sie den Bogen zu gebrauchen. Wir haben jetzt genug Waffen." Finster blickte er auf die Bogen und Kriegskeulen der gefallenen Kariben. „Sorgt dafür, daß unsere kleine Schwester und Schnellfuß essen und trinken und sich ausruhen können. Sobald es heute abend dunkel wird, fahren wir hinüber nach Titi-pán und greifen das Lager der Kariben an. Schnellfuß wird uns den Weg zeigen."
„Warum fahren wir nicht sogleich, Häuptling ?"
„Wir können es nicht wagen, solange es hell ist. Wenn die Wilden uns kommen sähen, würden sie vielleicht ihre Gefangenen erschlagen."
Als es fast dunkel geworden war, kamen der Häuptling und Grauer Reiher an die Stelle, wo die anderen warteten.
„Die Kariben müssen sich sicher fühlen", sagte Sägefisch, „sie haben schon Feuer angezündet. Damit sie sich nicht wundern, wo ihre Kameraden bleiben, müssen wir wohl auch ein Feuer anzünden. Es wird uns dann die Richtung zeigen, wenn wir über den Sund paddeln. Der Mond geht erst nach Mitternacht auf. Sobald das Feuer brennt, bringen wir unser eigenes Kanu zu Wasser, fahren hinüber und gehen ein ziemliches Stück von ihrem Lagerplatz entfernt an Land. Denkt daran, daß wir leise paddeln müssen, damit sie uns nicht kommen hören und Verdacht schöpfen."
Das Feuer war rasch angebrannt, und zwar dicht an der Stelle, wo das Kanu der Kariben vor Anker lag. Darauf eilten alle sieben zu ihrem Kanu zurück, schoben es ins Wasser und begannen ihre Fahrt über den Sund.
Plötzlich gab der Häuptling den anderen ein Zeichen: sie sollten mit Paddeln aufhören und ihm zuhören.
„Die Strömung trägt uns an unser Ziel", flüsterte er. „Wenn wir an Land kommen, teilen wir uns in zwei Gruppen. Unsere Schwester Ibis zeigt Adlerauge und Feuersteinherz den Weg um das Lager. Wir anderen kommen von dieser Seite mit Schnellfuß, der uns den Weg weist. Wenn ich zweimal wie eine Eule schreie, antwortet Adlerauge mit einem einzigen Eulenschrei. Wie schießen die Jungen?"
„Nicht besonders", antwortete Adlerauge. „Feuersteinherz und Schnellfuß können wohl einen Pfeil abschießen, aber wohin er dann fliegt, das ist eine andere Sache. Vielleicht können sie einen Feind auf eine Entfernung von zehn Schritt treffen. Frosch kann nicht einmal den Bogen richtig spannen."
„In ein oder zwei Jahren wird das wohl besser werden. Heute nacht muß er sich mit dem Speer behelfen, wenn es notwendig werden sollte. Nun müßt ihr wieder ein wenig paddeln, damit man das Kanu steuern kann. Aber nicht plätschern !"
Lautlos wie ein Schatten glitt das Kanu über das dunkle Wasser. Meeresleuchten umspielte den Bug. Mitunter hörten sie das Geräusch eines springenden Fisches. Einmal sahen sie aus dem Meer die Rückenflosse eines jagenden Haifisches dicht neben dem Kanu auftauchen und vorbeistreichen.
Vor ihnen erhob sich eine schwarze, undeutliche Masse aus dem Meer. Sie waren bereits nahe an Titi-pán herangekommen.
Jetzt konnten sie unmittelbar unterhalb der dunklen Umrisse des Waldes einen verschwommenen helleren Streifen erkennen. Bis zum Sandstrand war es nur noch ein Bogenschuß.
Schweigend stießen sie in das flache Wasser, als es ihnen etwa bis an die Knie reichte. Sie hoben den Bug des Kanus und legten eine Rolle von Balsaholz darunter. Dann packten alle Mann die Kanten des Kanus und eilten mit ihrem Fahrzeug die Sandbank hinauf. Als es vor den Wellen sicher war, verharrten sie und blieben lange lautlos stehen. Alle lauschten in die Nacht.
Hatten die Kariben das Plätschern und das Schaben auf dem Sand gehört? Das war kaum wahrscheinlich. Ihr Lager befand sich fast einen Kilometer entfernt hinter einer Landzunge.
Ohne daß ein Wort gesprochen zu werden brauchte, teilte sich die kleine Schar in zwei Gruppen.
Die eine, die sich aus Ibis, Adlerauge und Feuersteinherz zusammensetzte, schlich sich sogleich in eine kleine Bodensenke und verschwand im Walde.
Die andere, die unter dem Befehl des Häuptlings stand, verbarg sich in den Büschen am Strand, um dort zu warten, bis die Kameraden einen genügend großen Vorprung hatten.

Der Bogen des Kriegsgottes
Dunkel stand der Wald. Es dauerte noch eine gute Weile, bis der Mond aufging.
Wie eine jagende Wildkatze schlich sich Adlerauge zu dem kleinen Lichtkreis, der vor ihm durch einen dichten Vorhang von Strandtraubenbüschen schimmerte.
Nun war es nicht mehr weit. Adlerauge verharrte, fest an einen dicken Baumstamm gedrückt, um das Lager zu überschauen.
Hinter ihm standen Feuersteinherz und das Mädchen wie Bildsäulen am Rande einer Didcung.
Nur einige wenige Schritte vom Lagerfeuer entfernt saß ein alter Karibenkrieger und rauchte eine lange Pfeife mit einem Tonkopf. Ein Junge, kaum älter als Feuersteinherz, trat aus dem Dunkel und legte einige dürre Äste in das Feuer, so daß es aufflammte und den Lichtkreis vergrößerte.
Weiter hinten sah man unter einem Baum drei reglose Bündel liegen. Das mußten die Gefangenen sein.
Lebten sie noch?
Ja — einer der kleinen Jungen jammerte.
Der junge Karibe nahm eine Tonschale, füllte sie mit Wasser aus einer Kalebassenflasche und ging zu den Gefangenen.
„Bringst du dem Arowakenpack schon wieder zu trinken?” fragte der Alte grimmig. „Man merkt, daß du ein weichherziges Halbblut und kein echter Karibe bist. Laß sie warten bis morgen!"
„Wenn wir ihnen kein Wasser geben, werden sie sterben, und dann bringen wir keine Gefangenen heim ins Dorf", wandte der andere ein.
Adlerauge verstand nicht, was in der fremden Sprache geredet wurde, aber er konnte es sich ungefähr denken.
„Es wäre besser, wir schlügen sie gleich tot, dann brauchten wir uns nicht die Mühe zu machen, sie zu bewachen", nahm der Alte das Gespräch wieder auf. „Wir sollten jetzt keine Gefangenen mitschleppen, wo wir nur noch zwei sind und den Bogen des Kriegsgottes zu bewachen haben."
Vorsichtig legte er die Hand auf ein langes, schmales Bündel, das in einen federgeschmückten Baumwollmantel eingehüllt neben ihm auf einem niedrigen Holzgestell lag.
„Klapperschlange würde nicht gerade erfreut sein, wenn wir die Gefangenen erschlügen, ohne ihn vorher gefragt zu haben", wandte der Junge dagegen ein.
„Dann hätte er sie doch selber bewachen sollen! Warum ist er denn mit den anderen noch nicht wieder zurückgekommen? Sie hätten die Arowakensklaven doch auf jeden Fall erwischen müssen. Schlafen die etwa da drüben — ihr Feuer scheint doch auszugehen?"
In diesem Augenblick ertönte von der anderen Seite des Lagers her ein Eulenschrei. Nach einigen Sekunden ein zweiter.
Adlerauge antwortete mit einem kurzen, scharfen Schrei.
Braune Gestalten mit gespannten Bogen schienen gleichsam aus dem Gebüsch zu beiden Seiten des Feuers hervorzuwachsen.
Der alte Karibenkrieger sprang auf und sah sich verblüfft um. Er riß eine schwere Karibenkeule an sich und eilte zu den Gefangenen. Doch er hatte noch nicht den halben Weg zurückgelegt, als ihn die Pfeile erreichten.
Sein junger Kamerad riß einen Bogen an sich und rannte wie ein auf gescheuchter Rehbock geradeswegs in das Dickicht hinein. Man hörte dort einen dumpfen Aufprall, als seien zwei Menschenleiber gegeneinandergerannt, und dann die Laute eines Ringkampfs.

Schließlich war die wütende Stimme des Grauen Reihers zu vernehmen: „Rühr dich nicht, Karibenschurke, oder ich dreh dir den Hals um!"
Adlerauge und Feuersteinherz eilten den Lauten nach und fanden den Grauen Reiher, wie er rittlings auf dem Rücken des überwältigten Kariben saß und ihm gerade das Gesicht auf die Erde drückte. Gemeinsam richteten sie den Gefangenen auf, stellten ihn auf die Füße und führten ihn ans Feuer, wo Sägefisch sie erwartete.
„Was machen wir mit dem?" fragte Grauer Reiher. „Schicken wir ihn über den unterirdischen Fluß, seine Kameraden zu suchen?"
„Tötet ihn nicht!" bat unvermutet eine sanfte Stimme, und die ältere Schwester von Ibis trat zu der Gruppe. „Er ist die ganze Zeit gut zu uns gewesen und hat uns Essen und Wasser gegeben, sooft er es sich vor dem alten Ungeheuer da getraute."
Sie zeigte voller Verachtung auf den toten Karibenkrieger.
Ibis und Schnellfuß hatten ihre Geschwister sofort befreit, die sich jetzt die eingeschlafenen Arme und Beine rieben. Die Kariben hatten sie mit dicken Lianen an die Wurzeln des Baumes gebunden. „Bindet den Gefangenen", sagte der Häuptling. „Dann werden wir bestimmen, was mit ihm geschehen soll. Verstehst du Arowakisch, Karibe?"
„So gut wie du", erwiderte der Gefangene keck. „Meine Mutter war eine Arowakin von einer der kleinen Inseln hinter Barú. Mein Vater raubte sie aus ihrem Dorf. Nun sind beide tot. Sie lehrte mich Arowakisch sprechen, als ich klein war."
„Dann bist du ja eigentlich mehr Arowake als Karibe", sagte Adlerauge nachdenklich. „Ich frage mich sogar, ob du nicht gar zu einer von unseren Sippen gehörst. Hat dir deine Mutter davon etwas gesagt?"
„Sie hat immer gesagt, sie gehöre zur Adler-Sippe. Bisher habe ich mit dieser Verwandtschaft nichts zu tun haben wollen, denn ich hörte die Kariben immer sagen, die Arowaken seien feige Wichte. Aber wie es scheint, gilt das doch nicht für alle."
Er fuhr plötzlich zusammen und starrte unverwandt auf den Bogen und die Halsbänder, die Feuersteinherz trug.
„Seid ihr Klapperschlange begegnet?" fragte er erstaunt. „Mir scheint, ich erkenne seinen Schmuck."
„Auf der Insel, die dieser gegenüberliegt, sind wir drei Kariben begegnet. Ihre Bogen tragen jetzt unsere Jungen."
Verblüfft starrte der Gefangene Adlerauge an.
„Wer von euch hat Klapperschlange besiegt, den Kriegshäuptling der Küstenkariben?" fragte er schließlich. Seine Worte verrieten Bewunderung.
Der Häuptling zeigte auf Feuersteinherz. Der Gefangene schwieg eine Zeitlang und sah den Jungen nachdenklich an.
„Die Prophezeiung des alten Medizinmannes scheint nun doch in Erfüllung gegangen zu sein", sagte er dann.
"Was hat er denn vorausgesagt?"
„Da ich ja ein halber Arowake bin und du mein Leben geschont hast, will ich es dir sagen. Jener Medizinmann lebte vor langer, langer Zeit. Er prophezeite, die Kariben würden sich zu den Herren des ganzen Küstenlandes machen, und es würde ihnen alles gelingen, bis sie auf einen Stamm von arowakischen Bogenschützen treffen würden, der so stark sei, daß seine Jungen unsere tapfersten Krieger niederschlagen könnten. Und das hat dieser junge Mann da ja gerade getan. Es hat ihm keine geringe Ehre eingebracht, daß er Klapperschlange tötete. Die Kariben pflegten über jene Prophezeiung zu lachen und zu sagen, ihr Glück würde ‚ewig' währen. Ich habe es auch geglaubt, aber nun bin ich dessen nicht mehr sicher. Ja, und noch etwas sagte der • Medizinmann. Von diesen Arowaken sollte einer den Bogen des Kriegsgottes spannen können."
„Den Bogen des Kriegsgottes? Was ist denn das?"
„Ein heiliger Bogen, so groß und so stark, daß kein Krieger ihn spannen kann. Da liegt er." Der Gefangene verneigte sich ehrerbietig vor dem großen Bündel auf dem Holzgestell. „Wir waren gerade mit einer Kanuladung von Bogenholz und Pfeilschäften auf dem Weg von der Insel Banú nach dem Dorf am Reiherfluß. Wir mußten doch den Bogen des Kriegsgottes mit auf die Reise nehmen, damit er einen Teil seiner Zauberkraft auf die neuen Waffen übertragen konnte. Wir kamen aber zu weit von der flachen Landzunge ab, und da erblickte Klapperschlange draußen im Meer etwas, das aussah wie eine Rauchsäule. Also ruderten wir hierher. Der Häuptling hegte den Verdacht, einige arowakische Flüchtlinge hätten Feuer auf einer der Inseln angezündet, und damit hatte er ja recht. Wer hätte jedoch gedacht, daß alles so enden würde!"
Sägefisch nahm das Bündel von dem Gestell. Es war fast doppelt so lang wie er selbst. Er befreite es von dem Mantel und begann es aufzuwickeln. Eine Fülle von Baumwolltüchern umhüllte zwei lange Futterale aus Baumrinde, rot und schwarz bemalt.
In dem einen lag ein Bogen, fast drei Meter lang und im Verhältnis zu seiner Länge sehr stark. Der gedrehte Strang von auserlesenen Fasern war so dick wie ein kleiner Finger. Der Bogen war mit mehreren Farben bemalt, mit auf Schnuren gezogenen bunten Federquasten und mit polierten Schneckenhäusern verziert.
Das andere Bündel enthielt drei Pfeile mit Spitzen aus einer schwarzen Gesteinsart, die man auf Hochglanz poliert hatte. Jeder Pfeil war so groß wie ein gewöhnlicher Jagdspeer.
„Wenn der Kriegsgott den Kariben einmal zürnt, dann nimmt er seinen Bogen und schießt einen Pfeil in ihr Lager", erklärte der Gefangene. „Das ist natürlich noch nie vorgekommen, aber die Medizinmänner sagen, wenn es einmal geschähe, dann müßten sie allen Kampf vermeiden, bis der Kriegsgott wieder versöhnt sei — und das könnte lange dauern. Sie pflegen uns damit zu drohen, wenn wir nicht alles tun, was sie wollen. Und wenn er zwei Pfeile abschießt..."
Der Gefangene schwieg plötzlich.
„Nun, erzähl schon weiter!”
„...dann ist er sehr böse. Dann müssen die Kariben ihre Töpfe fortwerfen, ihre Bogen und Pfeile in den Kochfeuern verbrennen, ihre Dörfer verlassen und alles nur Erdenkliche tun, um ihn wieder mit sich zu versöhnen."
„Hier sind drei Pfeile", sagte Sägefisch ruhig. „Was hat es zu bedeuten, wenn er alle drei abschießt?"
„Dann ist es aus mit dem Glück der Kariben", sagte der Gefangene mit vor Schrecken bebender Stimme. „Dann müssen sie alles verlassen, was sie haben, in die Kanus steigen und in ein anderes Land fahren, aus dem sie nie zurückkehren dürfen. Aber selbt Häuptlinge und Medizinmänner wagen von so schrecklichen Dingen kaum zu reden. So etwas ist ja auch noch nie geschehen."
„Bisher nicht", sagte Sägefisch, „aber sei nicht allzu sicher, daß es nicht doch noch geschehen kann."
Er legte den Bogen und die Pfeile in die Futterale zurück und wickelte diese wieder in den bunten Mantel. Dann begann er die Bündel von Bogenholz und Pfeilschäften zu untersuchen, die zu einem großen Haufen aufgeschichtet auf dem Holzgestell lagen.
„Hier sind Waffen für viele Krieger", sagte er bedächtig. „Für weit mehr Krieger, als ich Finger und Zehen habe. Wolltet ihr einen großen Kriegszug unternehmen?"
Der Gefangene zögerte eine Zeitlang, ehe er antwortete.
„Es wird behauptet, die meisten der arowakischen Flüchtlinge aus vielen Dörfern hätten sich am Auslauf des großen Mangrovensees gesammelt", sagte er schließlich. „Manche von uns glauben, sie werden sich zur Wehr setzen, darum müssen alle unsere Krieger gut bewaffnet sein."
„Wann sollte dieser Kriegszug unternommen werden?"
„In zwei Mondzeiten, in der Morgendämmerung nach der Vollmondnacht."
Sägefisch, Adlerauge und Grauer Reiher warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu.
„Da sammeln sich wohl alle karibischen Krieger an der Mündung des Reiherflusses, nur einige Stunden Kanufahrt von dem Mangrovensee entfernt?” fragte Sägefisch.
Der Halbblutjunge nickte. Er wirkte unruhig, glaubte vielleicht schon zuviel gesagt zu haben. Würden ihn die Arowaken jetzt töten, nun, da er keine weiteren Neuigkeiten zu berichten hatte?
„Wir schlagen jetzt hier unser Lager auf", sagte der Häuptling. „Bringt den toten Kariben weg. Grauer Reiher und Adlerauge wechseln sich bei der Bewachung des Gefangenen ab. Da er Gefangene unseres Stammes gut behandelt hat, werden wir dasselbe mit ihm tun. Morgen fahren wir zu unserer Insel zurück. Was wir von dieser Inselgruppe wissen müssen, wissen wir bereits zum Teil, und das übrige können uns Ibis und Schnellfuß erzählen, wenn wir nach Hause kommen."
Früh am nächsten Morgen wurden die toten Kariben begraben. Man konnte kein tiefes Grab ausheben, da die Erdschicht auf der Korallenklippe nur dünn war; aber Schnellfuß kannte eine kleine Höhle auf dem Höhenzug, der sich quer über die Insel erstreckte. In diese Höhle legte man sie und gab ihnen einen Topf, Speise und Feuer mit auf die Reise an den unterirdischen Fluß, jedoch keine Waffen. Sägefisch meinte, es sei besser, wenn sie unbewaffnet blieben, und die anderen stimmten ihm zu. Statt dessen gaben sie ihnen Angelzeug, einige Grabstöcke und etwas Samen mit, damit sie nicht als Bettler ins Land der Geister kamen. Zum Schluß wurden soviel lose Steinblöcke als möglich vor den Eingang der Höhle gewälzt.
Darauf wurden die Kanus beladen, und zwar sowohl das der Arowaken wie auch das von den Kariben eroberte. Zwei Stunden nach Sonnenaufgang befanden sie sich wieder auf der Heimfahrt.
Der Gefangene, der Haifischzahn hieß, war nicht mehr gebunden, sondern saß unter den anderen und handhabte das Paddel. Er schien sich bereits mit seinem Schicksal ausgesöhnt zu haben, und er hatte ja auch keinen Grund, über schlechte Behandlung zu klagen.

Auf der Heimfahrt geschah nichts Besonderes, höchstens daß im Lauf des Vormittags Wind aufkam. Da waren die Arowaken jedoch schon ziemlich nahe an ihrer heimatlichen Insel angelangt, und nach halbstündigem Paddeln in der immer bewegteren See kamen sie an Land, ehe die Wellen gefährlich hoch gingen.
Sie mußten sich von der Schuld lösen, die sie auf sich geladen hatten, als sie ihre Feinde töteten.
Bei den Arowaken und auch vielen anderen Indianervölkern war das eine sehr ernste Angelegenheit. Es tat nichts zur Sache, daß man in Notwehr gehandelt oder anderen das Leben gerettet hatte. Blutschuld war Blutschuld, und die mußte gesühnt werden.
Zwei volle Wochen durften sie — von den anderen abgesondert — kein Tier essen, sondern lediglich Wurzeln, Blattschößlinge und andere Pflanzengerichte. Glücklicherweise hatten sie in dem eroberten Kanu zwei Körbe voll trocknen Mais gefunden. Sonst wären sie wohl dem Verhungern nahe gewesen.
Sie durften keine Hütte betreten und nur mit ihresgleichen sprechen. Jeden Tag mußten sie im Meer, in Kräutersud, in Rauch und in Süßwasser baden. Außerdem mußten sie die ganze Zeit über zu „den Mächtigen" beten, damit diese sich der Seelen der gefallenen Feinde gut annahmen und sie nicht herumirren ließen.
Es war allgemein verbreiteter Glaube, daß bald ein Unglück geschehen würde, wenn sie dies alles unterließen. Vielleicht würden sonst die Seelen der erschlagenen Feinde zurückkehren und sich rächen, indem sie entweder Krankheiten verursachten oder in wilde Tiere eingingen und ihre Mörder anfielen.
Und das Schlimmste von allem: Es würde lange währen, bis Taj zu seinem Volk zurückkehrte. Denn eines erwarteten die Arowaken ständig voller Ungeduld: die Wiederkehr Tajs. Dann würden aller Kampf und alles Elend ein Ende haben. Alle Menschen würden froh und zufrieden leben, ihren Acker bebauen, fischen, schöne Mäntel und feine Tonkrüge anfertigen und ein gutes Leben führen. Natürlich wollten da alle ihr Bestes tun, daß diese Zeit bald kam. Wer es nicht tat, war ja ein richtiger Dummkopf, und eigentlich sollte man ihn unterweisen und zu dem armen Wicht, der keinen besseren Verstand hatte, besonders gut sein.
Das alles mußte Haifischzahn nun auch lernen. Unter den Kariben war er nicht besonders gut behandelt worden, weil er ihrer Rasse nur halb angehörte. Bei den Arowaken erging es ihm besser, und schon nach kurzer Zeit war er ihnen mehr zugetan als dem Volk seines Vaters.
Die Sühnezeit war zwar recht lang, aber schließlich kam doch der Tag, an dem die Männer den Krug zerschlagen konnten, aus dem sie gegessen hatten — auch das gehörte dazu —, und heimkehren durften. Dort gab man ihnen ihre Waffen zurück, die unterdessen von dem alten Großvater Mummel gereinigt worden waren, indem er sie in Kräutersud gebadet, in Rauch gehängt und mit Gebeten und Beschwörungen besprochen hatte.
Die Pfeile, die die Kariben getötet hatten, wurden jedoch verbrannt, und die Asche schüttete man weit von der Insel entfernt ins Meer, damit sie der Strom vom Aufenthaltsort der Bocaná-Arowaken forttrieb.
Während der ganzen Zeit hatten Steinmesser und seine Gehilfen fleißig an dem großen Kanu gearbeitet. Nun war es endlich fertig und mußte nur noch ein wenig glattgeschliffen werden, ehe man es ins Wasser schob.
Sägefisch, Adlerauge und Grauer Reiher widmeten sich nun wieder dem Kanubau, dem Angeln und dem Fang von Schildkröten. Außerdem fertigten sie aus dem neuen Material Bogen an. Aber jeden Nachmittag verschwanden sie für einige Stunden aus dem Lager. In dem kleinsten Kanu paddelten sie nach Ceysén hinüber, um zu beratschlagen. Stets nahmen sie das große Bündel mit, in dem sich der Bogen des Kriegsgottes befand.
An einem frühen Nachmittag saßen sie im Schatten einiger Saragozabäume und betrachteten den mächtigen Bogen. Adlerauge strengte sich aus Leibeskräften an, ihn zu spannen, aber es wollte ihm nicht gelingen. Er zog und zerrte, daß ihm der Schweiß vom Leibe rann, bekam jedoch den Strang bestenfalls nur einige Handbreit zurück Dann war seine Kraft erlahmt.
„Für die Arme eines Mannes ist dieser Bogen viel zu groß", sagte er schließlich und legte ihn weg. „Wenn es nicht einmal Sägefisch schafft, ihn zu spannen, dann müssen wir den Versuch wohl aufgeben." Grauer Reiher saß am Boden und machte ein nachdenkliches Gesicht. „Zu groß für die Arme eines Mannes", sagte er langsam. „Aber vielleicht..."
Plötzlich sprang er auf wie von einer Hornisse gestochen und begann den Strand abzusuchen. Nach einiger Zeit kam er mit einem Stück angetriebenem Holz zurück. Er setzte sich auf die Erde, zog die Knie an das Kinn und begann das Treibholzstück mit ein paar derben Angelschnüren quer über seine Füße zu binden.
„Was ist los?" fragte Adlerauge freundlich. „Hast du den Krampf in den Zehen?"
„Red keinen Unsinn und bring mir den Bogen!" antwortete Grauer Reiher.
Dann legte er sich auf den Rücken, zog die Knie so weit an, wie er konnte, und legte den Bogen quer über seine Fußsohlen. Hierauf packte er den Strang mit beiden Händen in der Mitte und begann die Beine zu strecken. Die Muskeln seiner Arme, Schultern, Waden und Schenkel traten wie Knoten hervor.
Dezimeter um Dezimeter krümmte sich der mächtige Bogen, bis er schließlich richtig gespannt war. Grauer Reiher hielt den Bogen mit den Fußsohlen und den Strang mit den Händen an seinem Kinn.
Er hatte sich und den Bogen des Kriegsgottes in eine neue Waffe verwandelt — in eine gewaltige Armbrust.
„Leg einen Pfeil auf den Strang, das Ende zwischen meine Daumen und die Spitze zwischen meine großen Zehen", keuchte er. „Aber mach schnell, ehe ich loslassen muß."
Adlerauge zog einen von den langen Pfeilen aus dem Futteral und legte ihn nach den Anweisungen seines Kameraden auf den Bogen. Grauer Reiher visierte an dem Pfeilschaft entlang, rückte sich ein wenig zurecht, zielte wieder und rutschte noch etwas zur Seite.
Dann ließ er den Strang los.
Mit scharfem Zischen flog der Riesenpfeil davon und schlug tief in einen fünfzig Schritt entfernten Baumstamm ein.
Der Häuptling und Adlerauge saßen wie versteinert da und starrten ihm nach, als hätten sie ein Wunder gesehen.
Grauer Reiher richtete sich in den Sitz auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Puh — das war anstrengend", sagte er. „Doch nun wissen wir jedenfalls, wie es gemacht wird. Das nächstemal binde ich mir ein Stück Holz unter die Sohlen und befestige den Bogen daran. Er hätte mir ja beinahe die Füße abgerissen."
Sägefisch machte sich auf die Suche nach zwei passenden großen, flachen Holzstücken.
„Jetzt laß es mich mal versuchen", sagte er, als er sie gefunden hatte. Fünf Minuten später saß auch sein Pfeil in dem Baumstamm, einige Handbreit unter dem, den Grauer Reiher abgeschossen hatte. Dann war Adlerauge an der Reihe und erzielte ungefähr das gleiche Ergebnis.
Die drei gingen an den Baum und holten die Pfeile. Dann blieben sie noch eine Zeitlang stehen und sahen sich wortlos an.
„Nun haben wir also herausgefunden, daß man den Bogen benutzen kann", sagte schließlich der Häuptling. „Wir wollen in den nächsten Tagen fleißig üben und prüfen, wie weit wir mit Sicherheit schießen können."
In den nächsten vierzehn Tagen sahen die Bocaná-Arowaken auf der kleinen Insel ihren Häuptling nur selten einmal. Er und seine beiden Begleiter hielten sich meist drüben auf Ceysén auf und beschäftigten sich mit dem Riesenbogen.
Bald stellte sich heraus, daß Sägefisch in dieser neuen Art des Schießens seinen Kameraden überlegen war. Er konnte einen der großen Pfeile mehr als doppelt so weit hinausjagen wie ein Schütze mit einem gewöhnlichen Langbogen.
An dem gleichen Tage, an dem das neue Kanu fertig war, beendeten die drei ihre Übungen.
Das große Boot wurde zu Wasser gelassen, probiert und für ausgezeichnet befunden. Mehr als zwanzig Männer hatten darin Platz. Nun konnte der ganze Stamm gleichzeitig reisen.
Am Abend nahm Sägefisch seine Verschworenen beiseite. Sie setzten sich weit draußen an der Nordspitze der Insel auf einige Korallenblöcke und blickten über das Meer.
Voller Spannung warteten die beiden jungen Männer auf die Worte des Häuptlings.
„Ich habe über etwas nachgedacht", sagte Sägefisch endlich. „Wir sollten unsere Stammesbrüder am Mangrovensee nicht allein mit den
Kariben kämpfen lassen. Sie ahnen noch nicht, was wir bereits wissen, daß der Karibe kein besserer Krieger ist als der Arowake. Aber es genügt nicht, daß nur wir über Waffen verfügen. Wir müssen auch Bogen und Pfeile für unsere Stammesbrüder mitnehmen."
„Bogen können wir machen", erwiderte Adlerauge. „Steinmesser und auch Fregattvogel wissen genau, wie dabei zu verfahren ist. Aber wir
brauchen Pfeile, Schäfte und auch Spitzen. Fünf oder sechs Pfeile für jeden Bogen sind das mindeste, wenn es zum Kampf kommen sollte."
„Das sind freilich viele Pfeile", sagte Sägefisch nachdenklich. „Woher sollen wir so viele Schäfte und Rochenstacheln nehmen? Hier gibt es ja sowenig Stachelrochen. Über Korallengrund fühlen sich diese Tiere nicht wohl, sie wollen Sand und Schlamm."
„Ich kenne eine Stelle, wo es massenhaft Rochen gibt", sagte Grauer Reiher, „aber sie ist weit von hier. Im nördlichen Teil der Meeresbucht, unmittelbar vor dem Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst, gibt es große Mengen von diesen Untieren. Dort ziehen sich Rinnen entlang, die genau den Grund haben, den die Rochen lieben. Ich weiß das, denn vor ein paar Jahren bin ich mit meinem Vater dort fischen gewesen."
Sägefisch saß eine Zeitlang schweigend da und sah ins Wasser, das seinen Korallenblock umspülte.
„Du meinst also, wir sollten es wagen, zum Festland hinüberzufahren?" fragte er dann. „Aber wenn man uns nun entdeckt?"
„Wir nehmen das Kanu der Kariben. Wenn sie das in großer Entfernung sehen, werden sie nicht mißtrauisch werden. Wir müssen unser sechs sein, so daß sie glauben, wir seien Klapperschlange und seine Krieger, und mit sechs guten Paddlern können wir ihnen auch entkommen, wenn es nötig sein sollte. Wenn sie uns in der Bucht sehen, verschwinden wir einfach in den Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst. Wenn wir dort ein Kanu mit Verfolgern nicht abschütteln können, dann sollten wir besser die Namen wechseln und uns allesamt Dummschnuten nennen."
Sägefisch nickte.
„Dann machen wir es so, wie du gesagt hast. Nun gilt es nur noch die Männer auszuwählen, die wir mitnehmen. Feuersteinherz natürlich und Lange Lanze auch, aber wer soll der sechste sein?"
„Haifischzahn", schlug Adlerauge vor.
„Können wir uns auf den verlassen?" fragte der Häuptling mit gedämpfter Stimme. „Vergeßt nicht, er ist Halbkaribe!"
„Das ist er freilich, und gerade darum glaube ich nicht, daß er zum Volk seines Vaters zurück möchte. Die hielten ihn ja fast wie einen Sklaven, und bei uns geht es ihm gut. Außerdem brauchen wir ihn, weil er Karibisch versteht. Er hat Feuersteinherz und mir einiges davon beigebracht, aber doch nicht genug."
„Haifischzahn wird uns nicht verraten", sagte Grauer Reiher. „Wir haben doch den Bogen des Kriegsgottes."
„Ich hoffe, du hast recht. In vier Tagen ist das Fest für Feuersteinherz vorbei, und am Tag darauf machen wir uns früh im Morgengrauen auf die Reise."

Der-Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst
Das lange, schlanke Kriegskanu kam mit dem Wind auf Mangle zugeschossen, die innere Insel, die fast in der Mitte zwischen Ceysén und dem Festland liegt. Es war jedoch ein gutes Stück vom Kurs abgekommen.
Die See zeigte sich während eines großen Teiles des Tages sehr bewegt, und die Paddler waren müde. Anstatt den direkten Kurs zu halten, waren sie gezwungen gewesen, von Insel zu Insel zu fahren, und einige Stunden hatten sie nur gegen die Wogen steuern müssen, ohne voranzukommen. Nun war bereits der Nachmittag angebrochen, und noch immer schimmerte das Festland nur wie ein schwach blauer Streifen herüber.
„Wir können von Glück sagen, daß wir nicht in ein solches Wetter geraten sind, als wir mit den Flößen davonfuhren", sagte Adlerauge, „wir wären alle umgekommen."
„Es ist wohl das beste, wir gehen hier an Land und ruhen uns aus", erwiderte der Häuptling. „Paddelt im Windschatten hinter die Insel. Dort finden wir schon eine Stelle, wo wir das Kanu an Land ziehen können. Ein Glück, daß wir die Rollhölzer mit haben."
Hinter der Insel Mangle kamen sie in ruhiges Wasser, und Sägefisch steuerte das Kanu geschickt durch die scharfen Korallenriffe dem flachen Strand zu.
Fast die ganze Insel überzog uriger, alter Wald und bildete ein vortreffliches Versteck. Sie hatte nur einen großen Fehler: Es gab hier nicht einen einzigen Tropfen Süßwasser.
„Nichts zu trinken auf der ganzen Insel!" knurrte Lange Lanze, als sie das Kanu in die Büsche gezogen und die Verhältnisse untersucht hatten. „Wir haben nur getrocknete Fische mit, und bei dieser rollenden See können wir keine fangen. Morgen werden wir wohl einen durstigen Tag erleben."
Haifischzahn grinste breit.
„Mag sein, daß die Fische bei der bewegten See nicht auf Haken beißen", sagte er, „aber wenn das Wasser über dem Grund ruhig ist, dann kann ich sicher etwas Eßbares mit dem Wurfnetz fangen."
Er holte ein großes Bündel aus dem Kanu und begann es aufzuwickeln. Die anderen umstanden ihn, um ihm dabei zuzusehen. In den letzten vierzehn Tagen hatte Haifischzahn sich damit beschäftigt, Fäden aus Fasern zu drehen und dieses seltsame Ding zusammenzuknoten; aber niemand wußte, wozu er es benutzen wollte.
Was sie nun sahen, war ein kreisrundes Netz von etwa vier Meter Durchmesser. Die Maschen gingen von einem Mittelpunkt aus, und an der Stelle, wo sie sich vereinigten, befand sich eine Leine aus dikken Fasern mit einer Schlinge an ihrem freien Ende. An der Außenkante war das Netz nach innen umgeschlagen, so daß es dort doppelt auflag, und die Saumleine wurde von Spannfäden der höher liegenden Maschen gehalten. An der Saumleine waren ringsum viele Senkgewichte angebracht.
Haifischzahn zog die Schlinge über das Handgelenk und wickelte die Leine um die Hand. Dann nahm er das Netz zusammen, so daß das Mittelteil herabhing wie eine umgekehrte Tüte, umfaßte es ungefähr fünf Handbreit über dem Boden mit seiner umgewandten Hand und klemmte eines der Senkgewichte zwischen die Zähne. Hierauf schlang cr die Saumleine um den einen Unterarm.
Endlich gab er seinen Kameraden zu verstehen, daß sie bleiben sollten, wo sie waren, hob das Netz und watete ins Wasser — auf eine Stelle zu, wo sich glatter Sandboden befand und wo man zuweilen Fische wie Schatten vorbeischießen sah.
Als Haifischzahn einige Meter von dem Sandboden entfernt bis an die Knie im Wasser stand, begann er das Netz langsam schräg nach hinten zu schwenken. Dann machte er plötzlich eine volle Drehung, schleuderte die Arme in die Luft und ließ das mit den Zähnen festgehaltene Netz los.
Das Netz entfaltete sich, flog wie eine glatte Scheibe durch die Luft und schlug sechs Schritt von dem Werfer entfernt auf die Wasseroberfläche. Die vielen Senkgewichte zogen seinen Rand so schnell nach unten, daß es sich im Wasser zu einer Glocke bildete, und alle Fische, die sich innerhalb des Kreises befanden, waren darin eingeschlossen.
Nun begann der Fischer das Netz langsam zu sich heranzuziehen. Er packte es am Leinenansatz und begann ihn zu drehen, so daß der Kreis der Senkgewichte kleiner und die Ausbuchtung der schlaffen Maschen um den Rand tiefer wurden. Als er die Senkgewichte zu einem einzigen Klumpen zusammengedreht hatte, packte er darüber das Netz, hob es hoch und watete an Land.
Mehrere Fische und einige große Krabben zappelten hilflos in den Maschen.
„Das hast du gut gemacht, Haifischzahn 1" sagte Sägefisch mit erfreuter Miene. „Willst du mir zeigen, wie man das macht?"
Haifischzahn lächelte.
„Gern, Häuptling. Ich werde es allen zeigen, die es lernen wollen, und sobald ich Faserschnüre und Senksteine habe, werde ich noch mehr solche Wurfnetze anfertigen. Aber wie du siehst, kann man sie nur über glattem Boden anwenden."
„Das genügt", sagte Adlerauge. „Eines Tages können wir vielleicht die Feinde von unseren Ufern an der Meeresbucht vertreiben, und dann können wir fischen, wo immer wir wollen; denn dort ist fast überall glatter Sandboden. Haifischzahn wird viel Ehre damit gewinnen, daß er uns etwas so Nützliches lehrt. Ich denke, wir werden ihm ein eigenes Kanu bauen, sobald wir Gelegenheit dazu haben."

Der Halbarowake sah einen nach dem anderen an.
„Nie habe ich größeres Glück gehabt als in dem Augenblick, als Grauer Reiher mich gefangennahm", sagte er schließlich. „Wer von nun an sagt, Haifischzahn wäre kein Bocaná, der . . ."
„Natürlich bist du ein Bocaná", fiel ihm Sägefisch in die Rede. „Du bist vom Geschlecht der Adleraugen, und ich ahne, daß du das Zeug
zu einem Häuptling hast. Aber jetzt ist es wohl am besten, wir fischen weiter, ehe es zu dunkel wird. Sobald wir genug für die Abendmahlzeit haben, wirst du uns zeigen, wie man es machen muß, daß das Netz richtig auf daß Wasser fällt."
Die Indianer übten den ganzen Abend, und schließlich konnten alle das Netz einigermaßen werfen, freilich nicht so weit und so geschickt wie Haifischzahn.
Als es dann so dunkel wurde, daß sie beim Fischen nicht mehr sehen konnten, brannten sie in der Mitte der Insel ein kleines Feuer an, und zwar richteten sie es so ein, daß der Feuerschein die Umgebung nur wenige Schritte weit erleuchtete. Über dem Feuer brieten sie Fische an Holzspießen und Krabben in der heißen Asche. Alsdann legten sie sich schlafen. Einer jedoch hielt Wache, für den Fall, daß in der Nacht ein feindliches Kanu landete.
Einige Stunden vor Morgengrauen waren sie wieder auf den Beinen, aßen einige Stückchen kalten Fisch und stießen bald danach von der Insel ab.
Während der Nacht hatte sich der Wind fast völlig gelegt, und das Meer war jetzt nur noch leicht bewegt.
Die Indianer paddelten schnell, um so weit als möglich an die Küste heranzukommen, ehe dort die Menschen erwachten. Aber erst am späten Nachmittag erreichten sie die flache, mangrovenbestandene Landzunge nördlich der Meeresbucht.
Dort fuhren sie durch kleine Kanäle und enge Passagen, die sich zwischen den Mangroveninseln befanden, so weit sie konnten. Dann mußten sie jedoch wieder hinaus in die offene Bucht. Inzwischen hatte sich die Tagesbrise erhoben und stand auf das Land zu, so daß sie Mitwind hatten und schnell vorankamen.
Es war nicht mehr weit bis zu einer Flußmündung, als Grauer Reiher plötzlich einen Ruf ausstieß und auf einen langen Uferstreifen zeigte, der links vom Kanu lag. Dort sah man einige Hütten und mehrere kleine Gestalten, die an den Strand hinunterliefen, wo einige Kanus an Land gezogen waren.
„Kariben", sagte Sägefisch leise. „Aber sie haben uns zu spät entdeckt. Ehe sie hier sind, haben wir den Wald-der-im-tiefen-Wasserwächst erreicht."
„Sie halten uns für Klapperschlange und seine Krieger, die von Barú kommen", meinte Haifischzahn. „Ich hoffe, wir verschwinden noch rechtzeitig, ehe sie ihren Irrtum merken. Sonst kriegen wir eine Schar von hartnäckigen Verfolgern auf den Hals."
Alle sechs stießen die Paddel ins Wasser, daß der Schaum an dem hohen Bug des Kriegskanus aufspritzte. Das Dröhnen der Dünung, die an der Flußmündung über die Sandbänke hereinbrach, wurde immer lauter.
Sägefisch, der am Heck saß, reckte den Hals und hielt nach einer Möglichkeit Ausschau, das Kanu zwischen den Brechern hindurchzusteuern, ohne daß es voll Wasser schlug. Jetzt erblickte er eine solche und änderte den Kurs.
„Volle Fahrt!"
Ein Dutzend rasche, kraftvolle Paddelschläge, dann waren sie in dem tiefen, ruhigen Wasser zwischen den Sandufern.
Der Sandstreifen draußen vor dem Meer war nur einen Bogenschuß breit und mit kleinem Gebüsch und Lilienpflanzen bewachsen. Weiter drinnen wurde der Sand dunkler und verwandelte sich allmählich in Schlamm. Dahinter glänzte tiefes, dunkles Wasser. Es war das Ufer ei nes großen Lagunensees am Unterlauf des Flusses.
Aber die Lagune war nicht offen. Eine Wand von dunklem Grün trennte sie von dem Sandstrand. Vorne befanden sich nur kleine Büsche, aber hinter diesen erhoben sich hohe Bäume mit dunklen graubraunen und schwarzgrauen Stämmen, langen, schlanken Ästen und dicken, glänzenden Blättern. Die Stämme standen auf seltsamen Gewölben von Luftwurzeln, die über dem Wasser regelrechte Höhlen von Gitterwerk bildeten.
Das merkwürdigste war, daß es dort keinen Fußbreit Land gab, nur Stämme, Äste, Wurzeln und dunkles, schlammiges, fast undurchsichtiges Wasser.
Es war ein Wald von schwarzen Mangroven — der Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst.
Grauer Reiher machte eine Kopfbewegung nach einer Sandbank, die an der Schleife des Flusses unmittelbar am Waldrande lag.
„Seht euch die nette Gesellschaft dort an!" sagte er.
Sieben oder acht große Krokodile lagen im Halbschlaf im warmen Sande. Sie waren graugrün, hatten gelbliche Unterseiten und sahen aus wie knorrige, umgefallene Bäume. Einige von ihnen klappten ihre tiefen Schlünde auf und zu und hoben ein wenig den Kopf.
„Brrr 1" sagte Adlerauge. „Das sind gefährliche Burschen."
„Ja, die großen spitznasigen Krokodile sind keinesfalls so dumm wie die kleinen Kaimane", erwiderte Sägefisch. „Der Kaiman ist nur tückisch, wenn er seine häßlichen Jungen um sich hat, aber das Krokodil ist stets gefährlich."
„Die Kariben halten sie für heilig", sagte Haifischzahn düster. „Es paßt zu ihnen, solche Untiere als Götter zu verehren."
Er spie ins Wasser.
Lange Lanze legte sein Paddel ins Kanu, richtete sich auf und sah über das Meer.
„Wonach hältst du Ausschau?" fragte der Häuptling.
„Ich wollte nur sehen, ob die Kariben, die wir vorhin sahen, ihre Kanus ausgesetzt haben", entgegnete Lange Lanze. „Es sollte mich wundern, wenn sie nicht hinter uns herkämen."
„Warum sollten sie das?" fragte Haifischzahn. „Sie haben wahrscheinlich das Kanu von Klapperschlange erkannt, und nun glauben sie, wir seien mit einer Ladung Bogenholz unterwegs zu dem Dorf am Reiherfluß. Das einzige, was sie stutzig machen könnte, wäre der Umstand, daß wir mitten am hellen Vormittag in diese Flußmündung eingefahren sind. Daher wird es wohl am besten sein, wir paddeln noch ein Stück in den Mangrovenwald hinein und verstecken uns dort."
„Dein Rat klingt gut", sagte Sägefisch. „Stachelrochen können wir sowieso erst in der Nacht fangen, darum sollten wir noch ein Stück den Fluß hinauffahren und uns dort umsehen. Glaubst du, daß es im Innern des Landes Kariben gibt, Haifischzahn?"
Der Halbarowake schüttelte den Kopf.
„Es ist nicht anzunehmen", sagte er. „Ich glaube nicht, daß sie so dicht bei ihren Krokodilgöttern wohnen möchten. Ihre Medizinmänner kommen vielleicht bei besonderen Gelegenheiten hierher, um zu opfern oder dergleichen zu tun — aber hier wohnen, nein, das würde wohl kein Karibe wagen."
Grauer Reiher, der seinen Platz ganz weit vorn am Bug hatte, erhob sich auf die Knie.
„Wir paddeln am besten langsam", sagte er, „damit wir nicht auf einen versunkenen Baumstamm auffahren. Ich möchte hier wirklich nicht schwimmen."
Langsam verschwand das Kriegskanu in dem Wald-der-im-tiefenWasser-wächst.
Es schien so, als würden sie durch eine endlose Säulenhalle fahren eine dämmrige Halle mit dunklen, seltsam gewundenen Säulen. Die Kronen der Mangrovenbäume vereinigten sich über der Flußrinne zu einem dichten Gitter, so daß man den Himmel gerade noch als kleine Lichtpunkte wahrnehmen konnte.
Die Luft war feucht und schwül, und in dem Buchenwald herrschte ständig Dämmerlicht. Es war keine grünliche Halbdämmerung wie in einem richtigen Urwald, sondern graubraune Düsternis, die unheimlich und feindselig wirkte.
Hin und wieder ließen sich Schildkröten von irgendeinem Wurzelgewölbe ins Wasser fallen. Ab und zu erhob sich ein Nachtreiher mit heiserem Schrei und flatterte wie ein riesiger Nachtfalter davon. Oft sahen die Indianer, wie Augen und Nasenspitze eines Krokodils aus dem Wasser auftauchten und nach kurzer Zeit wieder lautlos versanken.
Den Männern war nicht wohl zumute. Sie hatten das Gefühl, eine feindselige, in dem Wurzelgewölbe verborgene Macht verfolge sie ohne Unterlaß mit den Augen.
Drei Stunden waren vergangen, und die Sonne hatte ihren höchsten Stand bereits überschritten, als sie endlich einen helleren Schimmer vor sich gewahrten. Ein grüner Blattwerkvorhang hing fast bis auf das Wasser herab. In der Mitte der Flußrinne befand sich eine Öffnung, einer Pforte gleich.
Das Kanu glitt durch diese Pforte auf einen vom Wind gekräuselten See mit hellgrünen Schilfdickungen. Am jenseitigen Seeufer reckte sich hoher Urwald, und dahinter sah man blaue Berge.
Die Indianer stießen einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Ihnen war zumute, als wären sie soeben aus einem muffigen, dunklen Keller in frische Luft und Sonnenschein gekommen.
Ganze Wolken schreiender Reiher erhoben sich flügelschlagend, als das Kanu durch das Schilfröhricht dahinschoß. Ibisse, Wildenten und große weiße Störche mit schwarzen Hälsen und ebensolchen Schwungfedern flogen rechts und links von ihnen auf, während Sumpfhühner und Jacanavögel über Teppiche von Wasserrosenblättern davonliefen und im Rohr Zuflucht suchten.
Ein paarmal hörten sie es in den verfilzten Wasserpflanzen plantschen, wenn ein Krokodil oder eine große Sumpfschildkröte nur eine Lanzenlänge von dem Kanu entfernt untertauchte.
Sägefisch stand auf und hielt sich geschickt im Gleichgewicht, während er nach allen Seiten Ausschau hielt.
„Ich vermag nicht das geringste Anzeichen zu entdecken, daß sich hier Menschen befinden", sagte er. „Wir gehen an dem anderen Seeufer an Land. Dort fischen wir, kochen Essen und ruhen uns aus. Und wenn es auf den Abend zugeht, paddeln wir an die Mündung zurück. Wenn wir Glück haben, finden wir Holz, das sich für Fackeln eignet, so daß wir die Rochen beim Feuerschein speeren können."
Seine Begleiter waren einverstanden.
Als sie weiterfuhren, richtete Adlerauge den Blick auf die Wolke der schreienden Vögel.
„Wir wollen hoffen, daß hier wirklich keine Menschen wohnen", sagte er leise. „Sonst dürften diese längst wissen, daß wir in der Nähe sind bei dem Lärm, den die Vögel machen."
Als sie an einer kleinen Insel vorbeikamen, schossen plötzlich zwei lange, schmale Kanus aus dem Schilf geradeswegs auf sie zu. Sägefisch legte das Paddel aus der Hand und hielt beide Hände in die Höhe.
„Wir kommen in Frieden!" rief er auf arowakisch.
Die fremden Kanus glitten heran und hielten zu beiden Seiten der Neuankömmlinge, etwa fünfzehn Meter von ihnen entfernt. In jedem saßen acht Männer. Es waren untersetzte, kräftige Burschen, die bunte Hüfttücher und Halsbänder aus runden Schneckenhäusern trugen. Außerdem hatten alle glänzende Ringe durch die Nase gezogen. Einer von ihnen, der einen Kopfschmuck, gleich einer Krone, aus langen blauen Federn trug, sah die Männer in dem Kriegskanu scharf an.
„Woher kommt ihr?" fragte er in gebrochenem Arowakisch.
„Aus dem Dorf am Reiherfluß", antwortete der Häuptling. „Wir haben es vor einigen Mondzeiten verlassen, als die Kariben kamen." „Wenn ihr Arowaken seid — wie kommt es dann, daß ihr ein karibisches Kanu und karibische Waffen besitzt?" fragte der Mann mit dem Federschmuck weiter.
„Wir haben sie im Kampf erbeutet."
„Was sucht ihr hier?"
Sägefisch berichtete in knappen Worten vom Zweck ihrer Reise. Die fremden Indianer hörten ihm interessiert zu. Als er geendet hatte, herrschte eine Zeitlang Schweigen.
„Die Arowaken haben uns nie etwas Böses getan, und die Kariben sind unsere Feinde", sagte endlich der Mann mit dem Federschmuck. „Darum nehmen wir euch in Frieden auf. Kommt mit in unser Lager auf der Insel, dort können wir weiterreden."
Die anderen Männer redeten leise miteinander. Die Arowaken verstanden davon kein Wort, aber es klang nicht unfreundlich, außerdem hatten Sägefisch und seine Begleiter ja auch keine andere Wahl, als ihnen zu folgen. Sie waren ihrer sechs gegen achtzehn und befanden sich in dem Gebiet des Stammes. In jedem Fall hatten sie in einem Kampf nichts zu gewinnen, sondern viel zu verlieren.
Ein Kanu fuhr voraus, das zweite hinter ihnen her. Auf gewundenen Gassen im Schilf gelangten sie schließlich an das Ufer der Insel. Adlerauge, Sägefisch und die anderen betrachteten neugierig die Kanus des Lagunenvolkes. Diese waren ganz flach und so schmal, daß man gerade noch darin sitzen konnte. Die Balken, die sie vorne und hinten begrenzten, waren nicht geschwungen, sondern endeten in waagrechten, glatten Scheiben, daran waren spitze Hölzer befestigt. Das ganze Boot war so lang, daß darin acht Männer sitzen konnten.
In einem solchen Kanu mußte man sehr vorsichtig sein, um es nicht durch eine heftige Bewegung zum Kentern zu bringen; aber dafür konnte es durch das dichteste Schilf gleiten.
„Hm", sagte Grauer Reiher, „die schwächste Dünung würde diese Bohnenschalen zum Sinken bringen."
„Hier auf der Lagune gibt es keine Dünung", erklärte Sägefisch. „Und du siehst ja selbst, wie gut sie durch das Schilf gleiten können. Den Kariben würde es sehr schwerfallen, diese Kanus in den Schilfdickichten einzuholen."
Nun waren sie am Strand angelangt, sprangen aus den Kanus und banden diese mit Baststricken an einige größere Baumwurzeln. Dort lagen bereits mehrere kleinere Kanus, jeweils für zwei oder drei Mann bestimmt.
Weiter oben am Strand befand sich zwischen den Bäumen eine runde Lichtung, und dort sah man eine kreisförmige, schwarze Fläche, auf der ein Lagerfeuer gebrannt hatte.
Der Mann mit dem Federschmuck wandte den Rücken nach der Feuerstelle und kehrte den Arowaken das Gesicht zu. Darauf sagte er etwas zu einem jungen Krieger. Dieser trat vor und machte mit der Hand ein Zeichen.
„Otter, der Häuptling des Eisvogelvolkes, grüßt die Fremden!" sagte er.
Adlerauge trat einen Schritt vor und zeigte auf Sägefisch.
„Sägefisch, der Häuptling vom Reiherfluß, grüßt Otter und das Eisvogelvolk!" erwiderte er langsam und würdig.
Das war gewöhnlich die erste der Zeremonien, wenn sich zwei unbekannte Indianergruppen begegneten. Keiner durfte den eigenen
Namen nennen, sondern mußte ihn von einem anderen sagen lassen.
Sie glaubten, es könnte gefährlich sein, wenn man den eigenen Namen selbst bekanntgab. War er doch ein Teil der eigenen Seele, und wenn
sich in der anderen Gruppe ein zauberkundiger Mann befand, konnte er dem, der seinen Namen selbst nannte, dabei vielleicht Schaden zufügen. Sagte jedoch ein anderer den Namen, dann war es ungefährlich; dann folgte den Worten ja nicht die magische Kraft des eigenen Atems.
Nun, da die Namen gesagt waren, konnten die beiden Häuptlinge miteinander reden. Sie saßen sich gegenüber, und die übrigen Männer bildeten einen weiten Kreis um sie. Sie saßen unbeweglich und lauschten aufmerksam den Worten ihrer Häuptlinge.
Heimlich betrachtete Adlerauge die Waffen des Eisvogelvolkes. Sie hatten nicht Pfeil und Bogen. Dafür war jeder Mann mit einigen Wurfspeeren bewaffnet. Außerdem besaß jeder eine Art leichten, glattpolierten Stock mit einem Haken an dem einen Ende und einem Handgriff an dem anderen. Am äußersten Ende eines jeden Speerschaftes
befand sich ein Einschnitt. Die Fischharpunen mit ihren doppelten Spitzen hatten ebensolche Schäfte. Adlerauge konnte sich nicht erklären, welchem Zweck der Einschnitt diente.
Bald wurde ihm alles klar.
Einer der Eisvogelmänner, der ans andere Ufer der Insel gegangen war, erschien plötzlich. Er hatte sich zurückgeschlichen. Nun machte er den anderen ein Zeichen. Er legte die Handflächen zusammen, so daß beide Hände eine Scheibe bildeten, und bewegte sie ein paarmal auf und ab.

Sofort erhoben sich ein Dutzend Männer, nahmen ihre Waffen und folgten ihm hinüber in den Uferwald. Adlerauge und Grauer Reiher wechselten einen Blick, nahmen ihre Bogen und Pfeile und folgten den anderen. Wie Raubtiere auf der Jagd schlichen die Indianer von Busch zu Busch bis ans Wasser. Am letzten Baum verharrten sie und hielten Ausschau.
Ein merkwürdiges Tier tauchte unweit der Insel aus dem dunklen Wasser auf. Es hatte einen großen, plumpen Kopf, der fast an einen breiten Kuhkopf ohne Ohren und Hörner erinnerte, zwei große Schwimm-Vorderbeine und einen fetten, spindelförmigen Körper, der in einer runden Schwimmflosse endete.
Ab und zu tauchte das Tier unter und kam mit dem Maul voller Wasserpflanzen wieder herauf.
Die Jäger an Land rührten sich nicht. Sie hatten festgestellt, daß es sich um einen Manati handelte — eine Seekuh, wie das Tier auch genannt wurde.
Adlerauge sah, wie die Männer von der Lagune vorsichtig ihre Harpunen in die Wurfstöcke einpaßten, so daß der Haken des Stockes in den Einschnitt des Harpunenschaftes kam. Dann nahmen sie Stock und Schaft in eine Hand und führten beide über die Schulter, zum Wurf bereit.
Fünfzehn Schritt von den Indianern entfernt wälzte sich der Manati im Wasser und zeigte eine Seite an der Wasseroberfläche.
Augenblicklich flogen ein Dutzend Harpunen durch die Luft, und fast alle trafen.
Das große Tier stieß einen eigenartig prustenden Laut aus und tauchte unter. Die Eisvogelmänner hielten die Harpunenleinen mit aller Kraft. Eine oder zwei von ihnen rissen ab, aber die meisten hielten, und nach einigen Minuten kam die Seekuh wieder an die Oberfläche.
Da waren Adlerauge und Grauer Reiher schußbereit. Ihre Bogensehnen summten. Zwei lange Pfeile mit Spitzen von Stachelrochenzacken trafen Hals und Kopf des Manati.
Er tauchte wieder, aber nun waren seine Bewegungen schwächer, und er kam schon nach einem Augenblick wieder herauf. Da trafen ihn zwei weitere Pfeile. Die Seekuh rollte auf den Rücken und blieb dann ruhig liegen.
Jetzt kamen zwei lange Kanus in schneller Fahrt aus dem Schilf und hielten Kurs auf das große Tier. Die Insassen banden ihm dicke Baststricke um den Hals und den Schwanz, und dann schleppten sie es an den Strand.
Dort warteten bereits viele arbeitswillige Hände, und mit vereinten Kräften bekamen sie die Beute aufs Trockne.
Mit Feuersteinmessern, Steinäxten und scharfen Knochendolchen begannen die Männer ihr Werk, und bald war die Jagdbeute zerstückelt. Der größte Teil des Fleisches wurde in ein kleineres Kanu gepackt, das zwei Männer durch das Schilf davonpaddelten. Die Arowaken ahnten, daß sie zum Wohnplatz des Eisvogelvolkes fuhren, wo Frauen und Kinder warteten. Die kleine Insel war nur ein Jagdlager. Aber da die Gastgeber nicht von sich aus von ihrer Wohnstätte sprachen, wollten sie natürlich nicht fragen.
Das übrige Fleisch von dem erlegten Tier wurde zum größten Teil in lange Streifen geschnitten und auf Holzgestelle gelegt. Man deckte mächtige Blätter der Bijaupflanze darauf, die mit der Banane verwandt ist und die in großen Mengen rings um die Lagune wuchs. Dann zündeten die Eisvogelmänner unter den Gestellen Feuer an, sie legten stark duftendes Holz darauf, und so wurde das Fleisch geräuchert.
Einige ausgesuchte Stücke wurden in der Glut gebraten, und eine große Anzahl anderer Fleischstücke legte man mit Maniok, Bataten und anderen Wurzeln in große Tontöpfe. Daraus kochten sie eine Suppe, die sich essen ließ.
Sägefischs Begleiter halfen ihren Gastgebern bei der Arbeit. Sie zer stückelten Fleisch, holten Holz und Bijaublätter und machten sich so nützlich, wie sie nur konnten.
Als das Essen fertig war, aßen alle gemeinsam.
Es war die beste Mahlzeit, die die Arowaken seit langem zu sich genommen hatten, und Sägefisch sagte es Otter bei passender Gelegenheit.
Der Häuptling des Eisvogelstammes lächelte breit und zufrieden.
„Die Männer vom Reiherfluß haben uns Glück gebracht", sagte er freundlich. „Wir haben seit vielen Tagen keinen Manati erlegt, und nun tauchte einer gleich neben unserem Jagdlager auf. Sage mir, Sägefisch, wie gedenkst du mit deinen Männern Stachelrochen zu fangen?" „Wir werden sie in der Dunkelheit bei Fackelschein harpunieren. Das ist natürlich gefährlich, denn die Kariben könnten unsere Fischfeuer sehen, aber wir kennen keine andere Art."
Otter schüttelte den Kopf.
„Auf diese Art werdet ihr sicher nicht genug bekommen", sagte er. „Wir kennen eine Fangart, bei der man eine ganze Menge Rochen fängt, obwohl wir es nicht auf diese Fische abgesehen haben, sondern auf andere, vor allem Adlerfische. Wenn die Sonne dort steht", Otter zeigte über den Rand der Mangrovendickung, „wird das Eisvogelvolk Sägefisch helfen, viele Stachelrochen zu fangen. Aber jetzt wollen wir erst einmal ruhen und dann wieder essen. Man wird stark von dem fetten Fleisch des Manati."
Einige Stunden später kamen die Männer, die mit dem Fleisch davongefahren waren, in einem großen Kanu zurück. Sie brachten mehrere Gefährten mit, und in einem zweiten Kanu transportierten sie ein großes Netz aus Pflanzenfasern und einige lange Stricke.
Alle nahmen nun wieder eine Mahlzeit zu sich und aßen Fleisch und geröstete Bataten, und dann paddelten sie in fünf Kanus zu dem Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst.

Der Opferplatz
Eine Kette flackernder Lichtpunkte bewegte sich durch den dunklen Mangrovenwald. Das Volk der Lagune und die sechs Arowaken befanden sich auf der Fahrt nach der Flußmündung.
Am Bug eines jeden Kanus saß ein Indianer mit einer Fackel in der Hand. Der Feuerschein huschte matt über die dunklen Baumstämme und spiegelte sich in dem stillen Wasser zwischen den Wurzelgewölben. Einmal sahen sie, wie nur einige Meter über ihren Köpfen ein dicker Ast plötzlich lebendig zu werden schien und sich aus dem Lichtschein wand. Es war eine Boaschlange, die auf ihrer nächtlichen Jagd gestört worden war und die nun die Männer mit ihren kleinen, unbeweglichen, kurzsichtigen Augen anstarrte.
Zuweilen hörten sie den krächzenden Schrei eines Nachtreihers, und einmal ertönte in dem Dunkel ein schauerlich röchelndes Brüllen. Es war ein altes Krokodilmännchen.
Hin und wieder leuchteten zwei rote Punkte aus dem Wasser. Sie sahen im Dunkeln aus wie glühende Zigarren. Es waren die Augen schwimmender Kaimane oder Krokodile, die neugierig nach den Kienfackeln starrten. Kamen ihnen die Kanus allzu nahe, dann versanken sie lautlos und verschwanden, tauchten jedoch bald wieder im Kielwasser auf. Einige von ihnen folgten den Kanus eine ziemliche Strecke, als warteten sie auf etwas.
Die Arowaken fühlten sich in ihrem festen Kriegskanu zwar sicher, aber sie fragten sich, wie die Männer von der Lagune es wagen konnten, in ihren leichten Fahrzeugen bei Nacht zwischen all diesen Krokodilen dahinzufahren. Bald bekamen sie eine Antwort.
Zwei Lichtpunkte glitten unter einem Wurzelgewölbe hervor. Sie schienen ungewöhnlich groß zu sein und ziemlich weit auseinander zu liegen. Langsam und bedächtig bewegten sie sich auf das letzte Kanu zu.
Ein scharfes Pfeifsignal ertönte schneidend durch die Stille der Nacht, und augenblicklich begannen die Männer vom Schilfsee mit den nackten Fersen auf den Boden ihrer Kanus zu trommeln. Es ging in rasend schnellem Takt, und alle hielten den Rhythmus, bis der ganze Sumpfwald zu zittern schien.
Die zwei roten Lichtpunkte sanken für einen Augenblick unter die Wasseroberfläche, kamen jedoch sogleich wieder nach oben und begannen sich im Wasser zu entfernen. Die Männer trommelten weiter, und bald blieben die drohenden Augen weit hinter dem Kanu zurück.
Einer der Sumpfbewohner, der im Kriegskanu der Arowaken saß, lachte leise.
„Krokodil mag nicht dieses Trommeln", flüsterte er Adlerauge zu, der ihm am nächsten saß. „Mag nicht unter Wasser sein, wenn wir trommeln — und Krokodil oben im Wasser ist nicht gefährlich." Die Männer von den Inseln glaubten bereits die halbe Nacht unterwegs zu sein, als sie endlich an einer Stelle anlangten, die sie wiedererkannten. Sie lag nur einige hundert Meter vom Rand der Mangroven entfernt.
„Alle Fackeln außer den ersten löschen!" sagte Otter mit leiser Stimme, und der Befehl wurde von Kanu zu Kanu flüsternd weitergegeben. Vier Kienfackeln wurden ins Wasser getaucht; sie zischten auf und erloschen. Das Dunkel hüllte die Kanus ein. Nur die Fackel des ersten leuchtete wie ein gelbroter Stern.
Jetzt verließen die Fahrzeuge die offene Fahrrinne und bogen nach links ab, wo sie dann in den Wurzelgewölben untertauchten. Immer dichter schloß sich das Dach von Ästen über ihnen.
In weiter Ferne ertönte das Gelärme der Krokodile aus den dunklen Schlammlöchern des Sumpfwaldes.
Das erste Kanu hatte haltgemacht. Das zweite lag längsseits daneben, und die übrigen wurden an den beiden ersten vertäut.
Ein Mann nach dem anderen erhob sich, nahm seine Waffen und Geräte und tastete sich von Kanu zu Kanu ans Ufer. Bei den ersten Schritten schmatzte schwarzer Schlamm um ihre Füße. Dann drangen sie durch eine Reihe dichter Büsche und gelangten an den offenen Sandstrand. Frische, salzgesättigte Meeresluft wehte ihnen entgegen. Sechs Männer trugen das große Netz auf einer Trage von Ästen. Einige andere verschwanden im Strandtraubengebüsch und schleppten ein kurzes, breites Kanu heraus.
Darin verstauten sie das Netz. An ein Ende des Netzes banden sie zwei lange Leinen und stießen dann von Land. Eine Anzahl von Männern blieb am Strand und hielt die Leinen.
Der Mann, der die Kienfackel getragen hatte, löschte sie vorsichtig aus. Man brauchte sie jetzt nicht, denn in dem Licht der Sterne über dem weißen Sand und dem offenen Wasser konnte man die Gegenstände noch auf einige Schritt Entfernung ganz gut erkennen. Sägefisch berührte behutsam Otters Arm.
„Sollten wir nicht Wachen ausstellen, für den Fall, daß etwa die Kariben kommen?" fragte er mit leiser Stimme.
„Du redest klug, Häuptling", erwiderte der andere. „Wir wollen einen von deinen und einen von meinen Männern auf Wache schicken, so daß sie uns warnen können."
Feuersteinherz und einer von den Eisvogelmännern gingen ungefähr hundert Meter südwärts und verbargen sich dort im Gebüsch einer kleinen Landzunge, während Haifischzahn und ein anderer junger Mann in die entgegengesetzte Richtung geschickt wurden, um an der Flußmündung Ausschau zu halten.
„Halte eine Fackel bereit!" sagte Otter zu einem seiner Männer. „Stell dich damit direkt vor das Netz, aber brenn sie nicht eher an als notwendig!"
Der Mann nahm einen Feuertopf und eine neue Kienfackel und bezog, ein Stück von den Männern entfernt, die die Leinen hielten, seinen Posten.
In dem schwachen Licht der Sterne kam jetzt das Kanu wie ein dunkler Schatten zurück. Es ankerte einige Meter vor dem Strand. Die Besatzung stieg über Bord und watete an Land, wobei die Männer lange Zugleinen in den Händen hielten. Sie waren etwa in einem Abstand von fünfzig Metern von der anderen Gruppe gelandet.
Das Netz — oder richtiger das Schleppnetz — war in einiger Entfernung vom Ufer ausgelegt, und zwar so, daß beide Enden landwärts zeigten.
Ein halbes Dutzend Männer packten an beiden Enden die Zugleinen und begannen das Schleppnetz langsam dem Strand entgegen zu ziehen. Hin und wieder schlugen sie mit den Leinen auf das Wasser, um die Fische aufzuscheuchen, damit sie nicht zwischen den Netzenden und dem Uferstreifen entwischten.
Zuweilen hörte man klatschende Laute, wenn ein aufgescheuchter Fisch die Kette der Balsaschwimmer übersprang oder in einer der Maschen hängenblieb und aus Leibeskräften zappelte, um wieder freizukommen.
Jetzt hatten die Netzenden das Ufer erreicht. Adlerauge, der dicht neben dem Mann mit der Fackel stand, konnte hören, wie die eingeschlossenen Fische um sich schlugen und in dem seichten Wasser emporschnellten. Der Sack des Schleppnetzes, den ein paar besonders große Schwimmer markierten, kam immer näher an das Ufer heran. An der einen Seite wurde ein großer Adlerfisch herausgezogen. Mit seinen scharfkantigen Kiemendeckeln hatte er einige Maschen zerschnitten, aber als er dann versuchte, durch das Loch zu entkommen, war er steckengeblieben.
In dem anderen Arm des Schleppnetzes blinkte ein wild zappelnder Tarpon, ein Fisch, der in seinem Äußeren am ehesten an einen Hering erinnerte — nur daß er so lang war wie ein erwachsener Mann und ebenso schwer wie dieser.
Die Männer zogen noch einige Meter, und dann lag der Rest des Schleppnetzes auf dem Sand. In dem Sack befand sich ein ganzer Haufen von Fischen, die sich hin und her warfen und nach Wasser schnappten. Es waren Adlerfische, Seebarsche, kleine, breite Mojarras, tükkische Stachelwelse, große, silberschimmernde Meeräschen — und drei dunkle, platte Stachelrochen.
Der Mann mit der Fackel schwenkte diese einige Male und tauchte sie dann in den Feuertopf. Sie war mit Bienenwachs eingerieben und fing sofort Feuer. Er hielt sie über den Sack des Netzes, um seinen Kameraden zu leuchten, während sie die Fische herauslasen.
Der Teil des Fanges, der den Leuten zur Nahrung diente, wurde an den Waldrand hinaufgetragen und in einige große Körbe gelegt. Den Stachelrochen wurden die Stacheln ausgebrochen — jeder hatte einen großen und einen kleineren — dann wurden sie in die Uferbüsche geworfen. Denn sobald die Indianer mit fischen fertig waren, wollten sie den Rochen die Rückenhaut abziehen, um daraus Raspeln anzufertigen.
Als der gesamte Fang geborgen war, wurde die Fackel wieder gelöscht und das Schleppnetz erneut ausgelegt, diesmal etwas weiter entfernt. Man schaffte einige Züge in der Stunde.
Nach und nach füllten sich die Körbe, und Sägefisch hatte bald eine ganz beachtliche Anzahl von Rochenstacheln in einem Bambusfutteral. Es war zu gefährlich, sie anders zu transportieren.
Als die Fischer das Netz jedoch zum siebenten oder achten Mal auf dem Trocknen hatten, ertönte von der Flußmündung her ein Eulenschrei.
Augenblicklich ließen die Indianer alles fallen, was sie in den Händen hielten, richteten sich auf und lauschten gespannt — alle außer dem Fackelträger. Der steckte den brennenden Teil seiner Fackel in den Sand und erstickte die Flamme, indem er mit dem Fuß Sand darüber stieß.
Wieder ertönte der Eulenschrei. Er klang wachsam, eindringlich und warnend. Einen Augenblick später hörte man das erregte Pfeifen eines Eisvogelmannes.
Dann war es einen Augenblick lang still.
Doch nun waren andere Laute zu hören. Sehnen, die Pfeile abgeschossen hatten, schlugen gegen die Bogen, ein kurzer Schrei — dann noch einer.
Eifrige Hände packten die Fischkörbe, trugen sie an den Waldrand, versteckten sie im Dickicht und ergriffen nun Pfeil und Bogen, Wurfspeer, Keule und Steinaxt.
Überall auf dem Sandstrand tauchten Schatten auf: Männer, die Bogen spannten, Männer, die Speerschäfte in die Haken der Wurfstöcke einpaßten, Männer, Keulen und Steinäxte in den Händen, standen reglos und lauschten.
Otter berührte leicht den Arm von Sägefisch.
„Ich gehe zu den Wächtern und sehe nach, was es gibt. Bleib du hier!" flüsterte er.
Im nächsten Augenblick war der Häuptling vom Schilfsee im Dunkeln verschwunden, aber er ging nicht allein.
Adlerauge schlich sich am Ufer durch die Büsche, in gleicher Richtung, leise und geschmeidig wie ein Panther.
Vor ihm knirschte der Sand unter schnellen Fußtritten. Adlerauge ließ sich auf das eine Knie sinken. Mit halberhobenem Bogen starrte er nach dem Strand.
Da vorn bewegten sich mehrere Gestalten. Er konnte sie nur undeutlich erkennen. Es war unmöglich, festzustellen, wie viele es waren. Sah Otter sie nicht? Adlerauge begriff, daß der Häuptling von der Lagune die Gestalten nicht sehen konnte, weil dunkles Buschwerk hinter ihnen stand.
Jetzt blieb Otter stehen und pfiff. Zwei Gestalten rannten auf ihn zu. Waren es die Wachen? Nein, es kamen noch zwei. Alle vier stürzten sich auf Otter.
Adlerauge hörte die Laute eines heftigen Ringkampfes; dumpfe Aufschläge und keuchenden Atem von Männern. Er erhob sich und suchte ein Ziel für seinen Pfeil. Aber im selben Augenblick kam jemand mit langen, leisen Schritten durch das Gebüsch geschlichen, direkt auf ihn zu.
Leise legte der Arowake Bogen und Pfeil auf den Boden und duckte sich. Der andere sah ihn nicht, sondern schlich kaum einen Meter entfernt an ihm vorbei. Im richtigen Augenblick warf sich Adlerauge nach vorn und packte den Gegner am Bein, so daß er in die Büsche stürzte. Adlerauge war über ihm, ehe der Feind wieder auf die Beine kam.
Es kam zu einem kurzen, erbitterten Ringen, aber nach einer Viertelminute saß Adlerauge auf der Brust des anderen, die Knie auf seinen Armen, und hielt ihm die Spitze seines scharfen Knochendolches an die Kehle.
„Wenn du schreist, stirbst du, Karibe!" fauchte der Sieger.
„Wen nennst du einen Kariben?" flüsterte Haifischzahn mit halberstickter Stimme. „Laß mich los, du Dummkopf!"
Rasch waren die beiden wieder auf den Beinen, nahmen ihre Waffen auf und schlichen durch die Büsche hinunter an den Fluß.
Dort unten leuchtete eine Fackel, und zwei Kriegskanus lagen dicht am Ufer. Mehr als zehn Feinde wollten gerade an Bord steigen. Sie schleppten Otter mit sich, den sie mit Baststricken gefesselt hatten. Zwei bewaffnete Kariben standen noch am Ufer, während die anderen das Kanu abstießen und zu dem Mangrovensumpf paddelten.
Jetzt sah Adlerauge, daß eine reglose Gestalt unmittelbar am Wasserrand lag und eine zweite etwas weiter oben am Ufer.
Einer der beiden Kariben, die zurückgeblieben waren, brannte eine Kienfackel an und hielt sie hoch. Der andere beugte sich über einen der Toten und hob einige lange Pfeile auf, die neben diesem lagen. Adlerauge wartete, bis die Kanus außer Sichtweite waren, dann stieß er Haifischzahn mit dem Ellbogen an.
„Ziel auf den mit der Fackel!" flüsterte er. „Ich nehme mir den anderen vor."

Beide Bogensehnen ließen die Pfeile gleichzeitig davonschnellen. Der Fackelträger machte eine halbe Umdrehung und fiel dann steif der Länge nach ins Wasser. Der andere Karibe ließ den Bogen fallen und sank in die Knie. Mit ein paar langen Sätzen war Haifischzahn bei ihm, hob die Steinaxt und schlug zu.
Springende Schritte näherten sich oben auf der Sandbank. Sägefisch, Grauer Reiher, Feuersteinherz und mehrere Eisvogelmänner tauchten aus dem Dunkel.
„Was ist geschehen?" fragte der Häuptling erregt.
„Zwei Kanus", antwortete Haifischzahn. „Sie kamen aus dem Dickicht drüben an der Flußbiegung. Wir hielten Ausschau über die See und über den Strand. Wir konnten ja nicht ahnen, daß die Kariben vom
Sumpf her kommen würden. Daher sahen wir sie erst, als sie ganz nahe bei uns waren. Da warnten wir euch, aber sie hatten uns schon gesehen und schossen auf uns. Mein Kamerad wurde getroffen. Ich blieb ruhig stehen, bis der erste an Land sprang. Da schoß ich einen Pfeil auf ihn ab und rannte los, um euch zu warnen."
„Haifischzahn kam in den Büschen auf mich zugerannt", fuhr Adlerauge fort. „Die Kariben stießen auf Otter und nahmen ihn gefangen. Sie fuhren in zwei Kanus in die Lagune hinein und nahmen ihn und noch einen Gefangenen mit. Zwei Wachen blieben zurück Sie sind nicht mehr am Leben."
„Sind die Kanus in den Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst gefahren?" fragte einer der älteren Eisvogelmänner mit bedrückter Stimme. „Dann sehen wir unseren Häuptling niemals wieder. Dann bringen sie ihn zum Opferplatz."
Haifischzahn verharrte einige Minuten in Schweigen. Dann nickte er und sagte: „Es ist das wahrscheinlichste. Wenn wir uns beeilen, können wir noch vor ihnen dort sein."
„Das scheint mir unmöglich", stieß Sägefisch hervor. „Die Kariben haben doch einen erheblichen Vorsprung."
„Ja, aber sie müssen einen großen Bogen fahren, denn ihre Kriegskanus liegen tief und können nicht über die Sandbänke. Schnell, wir lassen uns die Kanus des Lagunenvolkes geben und machen uns auf den Weg!"
„Der junge Krieger hat recht!" sagte einer der Eisvogelmänner eifrig. „Es gibt einen kürzeren Weg, der nur mit unseren Kanus befahrbar ist. Aber wer wagt es denn, mit Kariben zu kämpfen?"
„Wir!" antwortete Sägefisch grimmig. „Otter ist der Freund der Arowaken. Kommt, Krieger! Wenn kein anderer fährt, dann fahren wir."
Die Eisvogelmänner sahen sich einen Augenblick lang an. Von sich aus hätten sie es vielleicht nicht gewagt, aber die Entschlossenheit der Arowaken verlieh ihnen Mut.
„Wir folgen dir", sagte der älteste von ihnen zu Sägefisch. „Du bist unser Häuptling, bis die Sonne aufgeht."
„Dann schnell in die Kanus!“
Einige Minuten später glitten fünf lange, schmale Kanus durch die stockfinsteren Mangroven nach dem Opferplatz der Kariben. Die Männer, die darin saßen, waren zum Äußersten entschlossen.
Der Mond war aufgegangen. Sein Licht drang hier und da durch die kleinen Ritzen in dem Dach von Zweigen und malte helle Flecken auf rauhe Baumstämme und schwarzes Schlammwasser.
Der Mangrovenwald lag in großer Dunkelheit, nur die Lichtung mit der großen Schlammbank sah man im hellen Mondschein. Sie war gute hundert Meter lang und vielleicht sechzig Meter breit. Unmittelbar am Waldrand war tieferes Wasser, und in der Mitte befand sich eine kleine, längliche Insel, die sich vielleicht zwei Handbreit über die Oberfläche des Sumpfes erhob.
Mitten auf der Insel stand ein nacktes, verwittertes Baumgerippe und reckte seine morschen Aststummel in den Himmel.
Nach waghalsiger Fahrt quer durch den Mangrovenwald langten die fünf Kanus dort an. Da sie den größten Teil der Fahrt ohne Licht zurücklegen mußten, waren sie gegen Wurzelgewölbe gerannt und über eingesunkene Stämme gerutscht; manchmal hatten sie sich durch Gewölbe von hängenden Zweigen schieben müssen. Mehrmals war ein Kanu dem Kentern nahe gewesen. Eins war halb voll Wasser geschlagen.
Nun waren sie jedenfalls am Ziel. Drei lagen auf der einen Seite des Wasserweges und zwei auf der anderen, gut hinter den Wurzelgewölben verborgen.
Die Männer wußten, daß die Kariben nur die tiefe Wasserrinne entlangkommen konnten. Ihre großen Meerkanus lagen zu tief, so daß sie nicht über die Schlammbänke gleiten konnten.
Daher hatte Sägefisch seine Schar so eingeteilt, daß sie die tiefe Wasserrinne beherrschte. Die meisten waren aus den Kanus in das Wurzelgewölbe oder auf dicke Äste gestiegen, um ungehindert Pfeile abschießen und Speere werfen zu können.
Feuersteinherz und Grauer Reiher hatten einen schräg geneigten Baumstamm unmittelbar über der Wasserrinne erklommen, und Haifischzahn saß nur einige Armlängen von ihnen entfernt auf einem Ast.
Nun warteten sie in atemraubender Spannung.
Zwei Lichtpunkte tauchten weit hinten in dem Sumpfwald auf. Langsam kamen sie näher. Die Kariben hatten keine Eile.
Die im Hinterhalt liegenden Indianer rührten kein Glied. Ihr Plan war gefährdet, wenn sie zu früh entdeckt würden.
Endlich waren die beiden Kanus bei ihnen angelangt. Eins von ihnen hielt direkt unter dem schräg liegenden Baumstamm. Die Arowaken auf dem Baum konnten nicht begreifen, wie es möglich war, daß die Kariben sie nicht sahen. Die Erklärung war ziemlich einfach. Die vier Krieger saßen in ihrem Kanu und starrten dem zweiten Gefährt nach, das seine Fahrt zu der Schlammbank fortsetzte.
Am Bug des großen Kanus stand ein runzliger alter Karibe in einem seltsamen Aufputz. Er war von Kopf bis Fuß bemalt und mit Halsketten, Knöchelketten und Armbändern von Raubtierzähnen und Raubtierklauen behängt. An seinem Gürtel baumelten trockne, raschelnde Häute von Lanzenschlangen und Klapperschlangen, und auf dem Kopf trug er eine wunderliche Haube, so bemalt und geformt, daß sie dem Kopf eines Krokodils ähnelte.
Vier weitere Kariben paddelten, einer saß am Heck und steuerte. Am Boden des Kanus lagen zwei Gefangene. Sie waren an Händen und Füßen gefesselt. Der eine davon war Otter. Der andere war groß und schlank und hatte eine hellere Haut. Er sah aus wie ein Arowake. Das Kanu hielt am Rand der großen Schlammbank. Die Füße der Gefangenen wurden von den Fesseln befreit und die Gefangenen gezwungen, aufzustehen und aus dem Kanu zu steigen. Der Schlamm ging ihnen bis über die Fußgelenke. Langsam und zögernd gingen sie höher auf die Schlammbank hinauf, wo der Boden fester war. Ihre Hände waren nach wie vor gebunden.
Der Zauberer mit den Schlangenhäuten warf den Kopf zurück und ahmte vortrefflich das Brüllen eines Krokodils nach. Es verging kaum eine halbe Minute, bis ein gleiches Gebrüll aus dem Sumpfwald antwortete.
Da wandte sich der Alte der Richtung zu, aus der die Stimme kam, und sagte so laut, daß Haifischzahn jedes Wort hören und verstehen konnte: „Der Medizinmann der Kariben grüßt die Mächtigen im Sumpf. Mögen die Mächtigen die Gaben der Kariben verschlingen und dafür ihren Kriegern Kraft und Klugheit verleihen, so daß sie alle ihre Feinde besiegen und Herren der Welt werden!"
Dann wurde das Kanu abgestoßen und kehrte in die Fahrrinne zurück.
Die beiden auf der Schlammbank zurückgelassenen Männer wechselten einige Worte. Darauf ließ sich Otter auf die Knie nieder und begann in die Handfesseln seines Kameraden zu beißen.
Das Kanu des Zauberers war soeben unter den hängenden Zweigen angelangt, da ergriffen die Krieger des zweiten Kanus die Paddel. Der Rauch der Fackeln stieg hinauf bis an das Blätterdach.
Da geschah plötzlich etwas Unerwartetes. Aus den Ästen, die sich unmittelbar über dem Kanu befanden, hörte man plötzlich jemand kräftig niesen.
Die Kariben ließen die Paddel fahren und spähten nach allen Seiten. Mehrere von ihnen griffen nach ihren Bogen.
Da ertönte aus einem Wurzelgewölbe dicht neben ihnen Sägefischs Stimme: „Los!"
Der Kampfruf der Eisvogelmänner hallte durch den Sumpfwald, und die Arowaken stimmten ein.
Ein Regen von Speeren und Pfeilen ging auf die überraschten Kariben nieder. Der Zauberer und die meisten Männer in seinem Kanu merkten davon nichts mehr.
Die Kariben im zweiten Kanu waren gelinder davongekommen. Nur einer von ihnen war tot, ein zweiter verwundet. Die beiden Unverletzten sandten ihre Pfeile aufs Geratewohl in das Dunkel. Dann griffen sie nach den Paddeln, um das Kanu in Fahrt zu bringen, aber es war zu spät. Drei schwere Körper fielen auf sie herab. Grauer Reiher, Feuersteinherz und Haifischzahn waren aus ihren Verstecken heruntergesprungen.
„Fackeln anbrennen!" donnerte Sägefischs Stimme durch das Kampfgeschrei.
Von den beiden Fackeln der Kariben war eine ins Wasser gefallen. Die andere lag im Kanu des Zauberers und brannte schwach. Jetzt flammten die Kienfackeln der Eisvogelmänner an mehreren Stellen gleichzeitig auf, und ihre langen, schmalen Boote kamen pfeilschnell aus dem Dickicht geschossen.
Der Kampf war schon vorüber. Alle Kariben waren tot, bis auf einen Krieger, den Grauer Reiher und Haifischzahn niedergeschlagen und gebunden hatten. Feuersteinherz saß am Heck des Bootes und hielt seine linke Schulter, wo ihm ein Messer eine böse Wunde beigebracht hatte. Einer der Eisvogelmänner war von einem aufs Geratewohl abgeschossenen Pfeil am Bein getroffen worden. Das waren die einzigen Verwundeten der Sieger.
Aber wo war Adlerauge? Er war nirgends zu sehen — und eins von den fünf Kanus vom Schilfsee war auch verschwunden.
Da ertönte von der kleinen Insel her ein Schrei: „Hilfe!"
Alle wandten den Blick dorthin.
Auf der höchsten Erhebung der Schlammbank standen Otter und der Fremde. Otter hatte die Hände des Fremden von den Fesseln befreit, und jetzt versuchte dieser, Otter zu helfen. Auf halbem Weg zwischen dem Wald und der kleinen Insel sahen sie Adlerauge im vermißten Kanu. Er paddelte aus Leibeskräften, so daß der Schaum aufspritzte. Aber das war nicht alles, was sie entdeckten.
Etwas, das aussah wie ein knorriger Baumstamm, bewegte sich langsam und schwerfällig in dem Schlamm am Ufer der kleinen Insel. Ein riesenhaftes Krokodil war im Begriff, an Land zu steigen.
Jetzt war das Untier auf der Insel und schob sich langsam und gemächlich auf die beiden Männer zu.
Sägefisch und seine Begleiter packten alles, womit sie nur irgendwie paddeln konnten, und steuerten, so schnell es ging, ihre Kanus auf die Insel zu. Aber würden sie dort noch rechtzeitig ankommen, um die Freunde zu retten?
Alle wußten, daß das Krokodil jeden Augenblick mit ungeahnter Schnelligkeit vorwärts schnellen und angreifen konnte.
Und das tat es auch — gerade in dem Augenblick, als Adlerauges Kanu die Schlammbank erreichte.
Otter und der Fremde sprangen zur Seite, um dem Untier auszuweichen. Dem aufgesperrten Rachen zu entgehen war nicht so schwer, aber der kräftige Schwanz des riesigen Krokodils fegte wie eine Sense nach allen Seiten und hätte fast Otters Bein gestreift. Traf ein solcher Schlag, dann genügte er, um einen Mann kampf- oder fluchtunfähig zu machen.
Das Untier hielt jäh inne, machte eine plumpe Wendung und starrte die beiden Männer mit bösartigen, fahlgrünen Augen an. Jeden Augenblick konnte es wieder angreifen.
Adlerauge sprang aus dem Kanu, spannte seinen Bogen und schoß. Der Pfeil prallte wirkungslos von einer der Hornplatten ab, die den Rückenpanzer des Reptils bildeten.
Im selben Augenblick wechselte Otter die Stellung. Es war nur eine ganz unbedeutende Bewegung, aber sie genügte, um einen neuen Angriff des Krokodils auszulösen. Wäre der Häuptling des Volkes vom Schilfsee nicht so gewandt gewesen, dann hätte er dem Tier nicht mehr ausweichen können. Seine langen Kiefer knallten kaum eine Handbreit hinter Otters Fersen zusammen.
Ein neuer Pfeil von Adlerauges Bogen traf das Krokodil in die Seite. Die scharfe Spitze drang tief in den Körper ein, aber das schien dem Untier nicht das geringste auszumachen. Als Otter einen Schritt auf den abgestorbenen Baum zu tat, erfolgte der nächste Angriff.
Um Haaresbreite wäre er dem Tier geglückt. Nun befand sich das Krokodil zwischen dem Häuptling und dem Baum.
Adlerauge begriff, daß die Frist, um Otter und dem Fremden helfen zu können, fast abgelaufen war. Er wußte nun auch, daß er mit seinen Pfeilen gegen das Krokodil so gut wie nichts ausrichten konnte. Gab es denn keine andere Waffe, die der Sumpfdrache scheute?
Doch, eine vielleicht: Feuer! Ein Tonkrug mit Glut stand im Kanu, und daneben lagen mehrere Kienfackeln.
Adlerauge sprang in das Kanu, ließ Pfeil und Bogen fallen und steckte eine Fackel in den Feuerkrug. Das Kienholz war mit schwarzem Wachs bestrichen und fing augenblicklich Feuer. Adlerauge hob die Fackel und schwenkte sie über dem Kopf, damit sie heller brannte. Dann rannte er über die Schlammbank, den Bedrängten entgegen.
Der junge Fremdling war im Augenblick nicht in Gefahr. Während das Krokodil den Häuptling des Eisvogelvolkes bedrängte, hatte er den Baum erreicht und kletterte jetzt gerade hinauf.
Mit Otter stand es schlimmer. Das Krokodil verharrte die ganze Zeit zwischen ihm und dem Baum. Bei jedem Versuch, auf den Baum zu entkommen, konnte ihn das riesige Untier packen. Fuß um Fuß glitt
das Krokodil näher an sein Opfer heran. Wenn Otter noch einige Meter zurück gedrängt wurde, dann hinderte ihn der Schlamm in seinen Bewegungen, und dann . . .
Schritt für Schritt mußte sich der Häuptling in den zähen Schlamm zurückziehen.
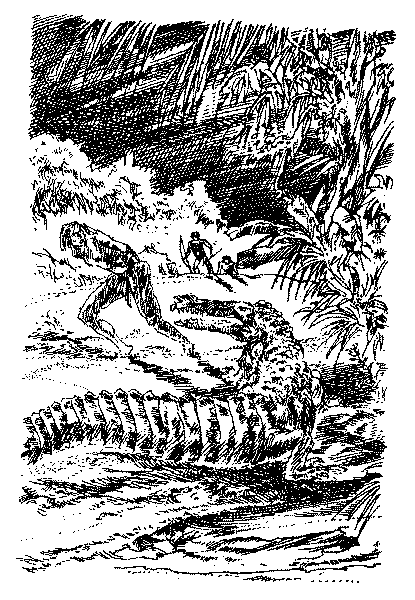
Plötzlich schoß das Krokodil vor, sperrte den riesigen Rachen auf, bewegte die kurzen Beine so schnell wie Trommelstäbe, und der Schwanz arbeitete mit Macht, um das Tempo zu beschleunigen.
In letzter Sekunde sprang Otter zur Seite, aber mit seinen gefesselten Händen konnte er das Gleichgewicht nicht richtig halten. Er rutschte mit dem einen Fuß aus und fiel in den Schlamm.
Mit bösem Grunzen begann das Krokodil sich umzudrehen. Jetzt war es seines Opfers sicher.
Aber da war Adlerauge zur Stelle, mit der brennenden Fackel in der Hand.
Er erkannte, daß er nicht warten konnte, bis das Untier erneut angriff und sein Opfer erreichte. Kein lebendes Wesen würde dies überstehen. Daher sprang er schnell auf das Krokodil zu, versetzte ihm mit der Fackel einen raschen, heftigen Schlag auf den Kopf, und als es sich mit aufgesperrtem Rachen gegen ihn wandte, stieß er ihm den flammenden Brand zwischen die Kiefer, die darauf zusammenschlugen und Adlerauge die Fackel aus der Hand rissen.
Dies war selbst für einen solchen Sumpfdrachen ein allzu unverdaulicher Bissen!
Speiend und fauchend zog sich das Krokodil zurück, während Adlerauge schleunigst Otter zu Hilfe eilte und ihm mit dem Feuersteinmesser die Fesseln zerschnitt. Beide rannten hierauf zu dem toten Baum.
Der Fremde, der in einer Astgabel saß, die sich einige Meter über dem Erdboden befand, schlang nun den einen Arm um den Stamm, streckte den anderen nach unten und zog Otter außer Reichweite des Krokodils, als dieses wieder angestürmt kam. Adlerauge sprang gewandt zur Seite, so daß sich der dicke Stamm zwischen ihm und dem Krokodil befand.
Das Krokodil verharrte und musterte die drei Männer, während es Kraft zu einem neuen Angriff sammelte. Aber nun war seine Frist abgelaufen. Inzwischen hatten Sägefisch und seine Begleiter die kleine Insel erreicht.
Hals über Kopf sprangen sie aus den Kanus und kamen mit Fackeln und Waffen in den Händen herbeigestürzt.
Pfeile und Speere pfiffen durch die Luft. Die meisten prallten oder glitten an dem Schuppenpanzer des Krokodils ab, aber es waren so viel, daß einige verwundbare Stellen zwischen den Reihen der Knochenplatten trafen. Ehe das Krokodil wußte, wie ihm geschah, war es von fast zwanzig Feinden umringt.
Schläge von allen möglichen Waffen — Steinäxten, Keulen mit Haifisch-zähnen, schweren Paddeln, brennenden Fackeln — hagelten auf das Ungeheuer nieder. Speere und Harpunen wurden ihm in die Seiten gestoßen, herausgerissen und erneut hineingerannt.
Es half dem Riesentier nichts, daß es um sich biß und gewaltige fegende Schläge mit dem Schwanz austeilte. Die Angreifer waren zu zahlreich, zu leichtfüßig und zu grimmig. Sie waren gar nicht in der Stimmung, ein menschenfressendes Krokodil schonend zu behandeln. Auf die Entfernung von drei Schritt hatten die langen Pfeile der Arowaken eine furchtbare Kraft, und es gab keine verwundbare Stelle an dem Tier, die sie nicht trafen.
Noch ehe die Gefangenen von dem Baum heruntergeklettert waren und den Kampfplatz erreichten, war die Schlacht vorbei und der Sumpfgott der Kariben tot.
Otter trat vor Sägefisch und legte ihm die Hände auf die Schultern. „Der Häuptling der Bocaná-Arowaken ist ein tapferer Kämpfer", sagte er. „Es ist gut, Sägefisch zum Freund zu haben. Er und seine Gefährten haben mir das Leben gerettet und meine Feinde besiegt. Otter und sein Stamm danken Sägefisch und seinen tapferen Männern. Sie bitten diese, als Gäste in die Dörfer des Eisvogelvolkes zu kommen. Otter spricht: Es gibt keinen Häuptling, so weise wie Sägefisch, und keinen Kämpfer, so mutig wie Adlerauge. Sagt jemand, dies sei nicht wahr, so ist er Otters Feind."
Der junge Fremde trat zu ihnen. Er verneigte sich und legte die Handfläche an die Stirn.
„Fuchs grüßt den Häuptling und dankt ihm für sein Leben", sagte er in gutem Arowakisch. „Er dankt auch dem jungen Krieger, der zur Rettung herbeigeeilt kam und der sicher einmal ein großer Häuptling werden wird. Wenn Fuchs zu seinem Volk zurückkommt, wird er seine Dankbarkeit mit mehr als Worten bezeugen."
„Es ist wenig Grund, von Dankbarkeit zu reden", erwiderte Sägefisch. „Sollten wir nicht Freunde sein und einander helfen, wenn wir die gleichen Feinde haben? Otters Einladung nehmen wir gern an. Wir haben noch nicht genug Pfeilspitzen, um zu unserem Volk zurückzukaren."
„Sagtest du Pfeilspitzen, Häuptling?" fragte Fuchs. „Ich schwöre bei den Göttern meines Volkes, daß du daran keinen Mangel haben sollst. Gewährst du uns auch das Gastrecht, Otter? Wir haben vielerlei Dinge in unseren Warenbündeln, die dein Volk brauchen kann." „Natürlich!" sagte Otter. „Wir fahren alle miteinander in unser Dorf. Dort können wir noch dieses und jenes bereden. Aber wie ich sehe, habt ihr einen Gefangenen gemacht?"
„So ist es! Haifischzahn, komm her und frag den Kariben, woher er ist und warum sie uns überfallen haben."
Die Eisvogelmänner sahen den Gefangenen verbittert an.
„Schlagt ihn doch gleich tot l" murmelte einer.
„Bindet ihn und laßt ihn hier — für seine Krokodilgötter!" rief ein anderer, und mehrere stimmten ihm zu.
Sägefisch schüttelte den Kopf.
„Heute nacht ist schon allzuviel getötet worden", sagte er. „Das mußte sein. Aber es bringt keine Ehre ein, einen waffenlosen Gefangenen zu töten. Wir nehmen ihn mit, dann werden wir weiter sehen."
Eine halbe Stunde später saß die ganze Gesellschaft in den Kanus und befand sich auf dem Weg zur Flußmündung. Dort wollte man das Netz, die Fische und das zweite Kanu holen und darauf weiterfahren in Otters Dorf.

In Otters Dorf
Otter und seine Gäste saßen im „Haus der Männer" des Eisvogeldorfes, das sich am Ufer des großen Schilfsees befand.
Sie waren bei Tagesanbruch dort angelangt, hatten gegessen und sich zum Schlafen hingelegt.
Jetzt war es Nachmittag. Vor ein paar Stunden waren sie erwacht, hatten in einem nahe gelegenen Flüßchen gebadet und dann ein Mahl eingenommen. Uhu, der Medizinmann des Stammes, kümmerte sich um die beiden Verwundeten. Er hatte ihnen Verbände von Heilkräutern auf die Wunden gelegt.
Unterdessen sahen sich Sägefisch und seine Begleiter in dem Dorf um. Da fanden sie vieles, was anders war als das ihnen Vertraute. Die Unterkünfte des Eisvogelvolkes waren keine niedrigen, viereckigen Hütten mit spitzen Dächern, wie die Arowaken sie kannten, sondern große, längliche Häuser mit Firstdächern und Fußböden aus Brettern von Palmenholz. Sie standen nicht auf dem Erdboden, sondern auf derben, festen Pfählen in einer versteckten Bucht des Schilfsees. Außer einer Hütte für jede Familie gab es noch das große Versammlungshaus, das „Haus der Männer". Die doppelte Anzahl der Männer des Dorfes hätte darin Platz gehabt. Frauen und Kindern war dort der Zutritt verboten. Dafür waren die Familienhütten Eigentum der Frauen, nicht der Männer.
Die Indianer vom Reiherfluß hatten noch nie ein so großes Gebäude gesehen wie das Versammlungshaus.
Möbel befanden sich nicht darin, aber eine Anzahl eigenartiger Hokker, die aus Balsaholz geschnitzt waren und die Formen kleiner, plumper Tierfiguren aufwiesen. Von den Dachsparren hingen Tonkrüge, Kalebassenflaschen und geflochtene Beutel herab, dazu Körbe in allen Größen und Formen.
An der einen Längswand befand sich eine offene Feuerstelle von Ton, und die ganze Decke war rauchgeschwärzt. Aber das waren die Indianer gewohnt. Für sie war dies ein Zeichen der Gemütlichkeit, und außerdem hielt eine richtig verräucherte Decke viel länger.
Alle Häuser des Dorfes standen in der Bucht über dem Wasser. Die Pfähle, die sie trugen, waren ungefähr drei Meter lang. Jetzt, in der Trockenzeit, erreichte das Wasser unter den Fußböden kaum einen Meter, aber wenn der große Regen kam und die Lagune über die Ufer trat, hätte man ohne die überall vertäut im Wasser liegenden Kanus und Flöße von Haus zu Haus schwimmen müssen.
Otter saß schweigend da und betrachtete den Streifen einfallenden Sonnenlichts, der langsam über den Fußboden wanderte.
„Nun müßte Fuchs mit den anderen Handelsleuten bald hiersein", sagte er schließlich. „Die Sonne war gerade aufgegangen, als die Kanus abfuhren, um sie zu holen."
Er hatte die Worte kaum gesprochen, als man vom Rande des Dorfes auch schon einen kurzen Ruf vernahm. Bald darauf legten einige große Kanus an der Leiter an, die zum „Haus der Männer" führte.
Fuchs trat ein, ihm folgten zwei ältere Männer in weiten Mänteln von Baumwollstoff, auf die an den Rändern schöne Muster aufgedruckt waren. Um die Arme und den Hals trugen sie Goldschmuck, aber ihre Gesichter waren nicht bemalt.
Otter und Sägefisch erhoben sich, um sie zu begrüßen.
Fuchs sagte seinen Begleitern etwas in einer seltsamen Sprache. Sie lachten und hielten die Hände mit den offenen Handflächen nach vorn und nach oben. Das war ein Zeichen, das alle Stämme verstanden. Es bedeutete Frieden.

Nun wandte sich Fuchs an die beiden Häuptlinge.
„Meine Begleiter sind Händler wie ich", erklärte er. „Sie sind nicht von meinem Stamm — den Kogis —, sondern kommen aus dem Land der Chibchas. Das liegt in den kalten Bergen jenseits des großen Flusses, der aller Ströme Mutter ist. Wir kommen in Frieden. Wir kommen, um zu kaufen und zu verkaufen. Wir kaufen die großen Meerschnecken, Perlen, kostbare Steine, Gold und Kupfer. Wir haben Salz und Stoffe und viele schöne Dinge, die wir für die Sachen eintauschen, die wir möchten."
„Setzt euch und ruht euch aus", sagte Otter. „Alle, die in Frieden kommen, sollen bei mir und meinem Volk Frieden finden, und außerdem ist ja bekannt, daß den Handelsleuten kein Mensch feindselig begegnet. Darum habe ich mich gewundert", wandte er sich an Fuchs, „daß dich die Kariben gefangengenommen hatten."
Fuchs übersetzte Otters Worte in die Chibchasprache, und der älteste der Kaufleute antwortete mit einem langen Wortschwall, von dem die Häuptlinge von der Küste nicht ein Wort verstanden.
„Er sagt, alle Menschen lassen die Kaufleute in Frieden ziehen", übersetzte der Kogi. „Nicht einmal die wilden Panches und Muzos, die ständig gegen die Chibchas Krieg führen, greifen friedliche Handelsleute an. Die Agachaes, Colimas und Cararis lassen sie in Frieden durch ihr Gebiet wandern und kaufen Salz von ihnen. Ich kam friedlich in ein Lager der Kariben und fragte, ob sie Salz und Tuche gegen Meerschnecken eintauschen wollten. Sie stahlen meine Waren und nahmen mich und meine Träger gefangen. Ich begreife nicht, was in sie gefahren ist."
„Ich kann es mir auch nicht erklären", sagte Otter. „Aber wir haben ja einen Gefangenen, den mein Bruder Sägefisch verschont hat. Haifischzahn soll ihn fragen, warum sie es taten."
„Da kann ich euch auch behilflich sein", sagte Fuchs, „denn ich kann karibisch sprechen."
„Du sprichst deine Sprache, die der Eisvogelmänner und unsere, dazu die der Chibchas und der Kariben. Sprichst du denn alle Sprachen?” fragte Sägefisch verwundert.
Der Fremde lächelte.
„Nein, nicht alle, aber einige", erwiderte er. „Es ist ja mein Beruf, mit Handelsleuten umherzuziehen, und da muß ich viele Sprachen beherrschen. Die Chibchas hier bezahlen mich für meine Hilfe, und ich kaufe und verkaufe auch, wenn es mir gefällt. Wollen die Häuptlinge, daß wir den Gefangenen jetzt gleich verhören?"
„Nein, erst sollt ihr euch ein Welchen ausruhen, essen und Maisbier trinken", sagte Otter. „Wenn wir das getan haben, können wir uns mit dem Karibenkrieger unterhalten."
Er beauftragte einige junge Männer, große Holzschüsseln mit Speisen und einige Tonkrüge mit einem säuerlichen, vergorenen Maisgetränk hereinzutragen. Die Gäste aßen und tranken.
Während der Mahlzeit wandte sich plötzlich einer der Chibchas an Fuchs und sagte ihm leise etwas. Der Kogi-Indianer übersetzte: „Er fragt, ob seine Träger in das Haus heraufkommen und ihre Lasten auf den Fußboden legen dürfen."
„Natürlich dürfen sie das. Alle, die in Frieden hierherkommen, sind Otters Gäste."
Der Händler rief etwas in seiner Sprache, und ein Dutzend Männer kamen die Leiter heraufgeklettert, mächtige Ballen auf dem Rücken. Sie legten ihre Lasten auf einen Haufen und hockten sich dann bescheiden am Eingang nieder. Ihre Herren beachteten sie nicht im geringsten, und als einige der Eisvogelmänner ein paar Schüsseln mit Fleisch, Fisch und Maisbrot vor sie hinstellten, blickten sie verwundert auf und warfen ihren Herren einen raschen, fragenden Blick zu, bevor sie zu essen begannen.
Währenddessen saßen die Häuptlinge tief in Gedanken versunken da. Sie beschäftigte dieselbe Frage.
Sägefisch hegte keine Zweifel mehr, sie, die Bocaná-Arowaken, die draußen an der offenen Küste wohnten, hatten den ersten Angriff der Kariben auffangen müssen. Für sie bestand direkte Gefahr. Sie mußten entweder einen Weg finden, sich zu verteidigen, oder weit fort ziehen, aus der Reichweite der Feinde. Aber Sägefisch wußte, die Kariben würden sie doch früher oder später ausfindig machen, auch wenn sie noch so weit wegzogen.
Aber nun hatten er und die Männer seines Volkes die Furcht vor den Kariben überwunden, und nun konnte er in Ruhe die Möglichkeiten des Entscheidungskampfes prüfen und abwägen, der seiner Meinung nach unvermeidlich war.
Für Otter stellte sich die Frage anders. Er und sein Volk hatten sich bisher im Schutz von Mangrovensümpfen und Binnenseen sicher gefühlt. Sie mußten nicht an die Küste fahren, wenn sie nicht wollten. Aber würden sich die Kariben damit begnügen, nur die Bocaná-Arowaken zu ihren Sklaven zu machen? Würde nicht auch eines Tages das Eisvogelvolk an die Reihe kommen?
Auch in Otter begann ein Entschluß heranzureifen.
Jetzt kamen zwei Männer mit dem Gefangenen, den sie in einer kleinen Hütte im Walde bewacht hatten.
Der Blick des Kariben ging flackernd in alle Richtungen, als er vor die Häuptlinge geführt wurde; dann aber setzte er eine gleichgültige Miene auf und sah zu Boden.
„Du bist Falkenhaupt", sagte Haifischzahn plötzlich. „Dein Vater war Zerbrochener Pfeil, der von einem Jaguar getötet wurde. Er war der jüngere Bruder des Häuptlings Schwarzer Habicht."
Der Gefangene nickte stumm.
„Wie kommt es, daß du nicht bei deinem Onkel bist?" fragte Haifischzahn.
„Der große Häuptling ist in dem Dorf am Reiherfluß. Er bleibt dort, bis der Kriegshäuptling zurückkommt."
„Klapperschlange meinst du, Falkenhaupt? Der kommt niemals wieder."
Der Karibe starrte den anderen verblüfft an.
„Jetzt erkenne ich dich", sagte er nach kurzem Zögern. „Du bist Haifischzahn. Wie kommt es, daß du dich bei diesen Kriegern befindest, wo du doch einer der jungen Männer warst, die mit dem Kriegshäuptling nach Banü fuhren, um Holz für Bogen zu holen?"
„Das will ich dir sagen", erwiderte Haifischzahn ruhig. „Ich wurde gefangengenommen, als sie Klapperschlange besiegten."
„Du bist also auch ein Gefangener?"
„Nein, nicht mehr. Ich wurde in ihren Stamm aufgenommen, und darauf bin ich stolz, denn es sind große Krieger und weise Männer. Haifischzahn ist jetzt Bocaná-Arowake."
Stolz warf er den Kopf zurück und legte die Hand auf die Brust. Falkenhaupt starrte ihn mit einer Miene an, die eine Mischung von Erstaunen und Verachtung ausdrückte.
„Alle wissen, daß die Bocaná-Arowaken feige sind wie graue Füchse!" sagte er schließlich.
„Dieser Meinung dürfte der Kriegshäuptling der Kariben durchaus nicht gewesen sein, als er mit den Arowaken zusammentraf." „Willst du damit sagen, daß sie Klapperschlange besiegten?" „Eben das will ich sagen. Als wir uns auf der Rückfahrt von Barü befanden, stießen wir auf sie, und es kam zum Kampf. Einer ihrer Jungen, der noch nicht einmal einen Männernamen hatte, überwältigte Klapperschlange. Die anderen erschlugen seine Krieger. Mich schonten sie, weil ich ein Halb-Arowake bin, und als ich einige Zeit bei ihnen gelebt hatte, wurde ich in eine ihrer Sippen aufgenommen." „Du bist ein Lügner!" schrie Falkenhaupt. „Alle wissen, daß die Kariben die besten Krieger der Welt sind und bald Herren über alle anderen Völker sein werden Fledermaus und auch die anderen Medizinmänner haben es gesagt."
„Haben die euch geraten, friedliche Handelsleute zu überfallen?" fragte Fuchs.
„Kaiman, der Medizinmann des großen Krokodilgottes, hat es befohlen." - „Ja, du hast ja selber gesehen, was geschehen ist", sagte Haifischzahn. „Die Arowaken und Eisvogelmänner kamen in ihren Kanus und spickten Kaiman und seine Krieger mit Pfeilen, und dann schlugen sie dem Krokodilgott den Kopf ab. Wer waren da die besseren Krieger?"
„Wir werden uns bald rächen!" Falkenhaupt war so rasend, daß er zitterte. „Jeden Tag kann Klapperschlange mit dem Bogen des Kriegsgottes ankommen, und dann werden wir die Arowaken vernichten! Weder sie noch diese Sumpfkröten hier können unseren Pfeilen widerstehen."
Haifischzahn sah den jungen Kariben ernst an.
„Mein junger Bruder redet wie ein unverständiges Kind", sagte er ruhig. „Wenn du an meinen Worten zweifelst, dann sieh dir Feuersteinherz an, der dort drüben sitzt. Siehst du nicht, daß er Klapperschlanges Halsband mit den Jaguarklauen trägt? Und der Bogen des Kriegsgottes befindet sich in diesem Hause. Sägefisch, der Häuptling der Bocaná-Arowaken, besitzt ihn. Und er kann ihn spannen!"
Sägefisch hatte nicht verstanden, worüber die beiden sprachen, doch Fuchs übersetzte ihm die Worte. Jetzt neigte der Häuptling den Kopf und lauschte, während der Händler ihm alles erklärte. Dann öffnete er das lange Baumrindenfutteral, nahm den Bogen des Kriegsgottes heraus und hielt ihn hoch, so daß ihn alle sehen konnten.
Falkenhaupt starrte den Bogen mit weit aufgerissenen Augen an. Mehrere Minuten lang war es ganz still in der Hütte.
„Glaubst du nun meinen Worten, junger Bruder?" fragte Haifisch-zahn schließlich.
„Ich sehe!" Wie es schien, fiel es Falkenhaupt schwer, die Worte hervorzubringen. „Der Arowakenhäuptling hat den Bogen des Kriegsgottes, und der junge' Krieger dort trägt Klapperschlanges Waffen und Schmuckstücke. Es ist aus mit dem Glück der Kariben. Die Prophezeiung, über die wir gelacht haben, ist in Erfüllung gegangen."
„Will mein junger Bruder sehen, wie der Häuptling den heiligen Bogen spannt?"
„Wozu? Ich sehe ja, daß ich töricht geredet habe und daß Haifischzahn nicht die gespaltene Zunge der Lanzenschlange hat, sondern die Wahrheit redet. Werdet ihr mich jetzt töten?"
Fuchs übersetzte Sägefisch die Frage. Der schüttelte den Kopf.
„Warum sollten wir ihn töten?" sagte er. „Er kann uns nicht mehr schaden."
Einer der Chibchamänner beugte sich vor und redete eifrig auf Fuchs ein, der aufmerksam zuhörte und dann sagte: „Der Handelsmann fragt, ob der Häuptling den gefangenen Kariben für eine Rolle Tuch verkauft. Er braucht Sklaven, die seine Handelswaren tragen." Sägefisch sah nach den Männern vorn an der Tür.
„Würde Falkenhaupt dann so ein armer Teufel werden wie die da?" fragte er.
Der Kogi-Indianer nickte.
„Dann sag dem Handelsmann aus den Bergen, die Bocaná-Arowaken sind keine Sklavenhändler und wünschen es auch nie zu werden. Dieser junge Mann ist ein Verwandter Haifischzahns. Darum behalten wir ihn, bis wir die Kariben besiegt haben. Dann kann er selbst entscheiden, ob er einer von uns werden oder zu den Kariben zurückkehren will. Wenn Otter seine Zustimmung gibt, halte ich es für das beste, wenn Falkenhaupt hierbleibt."
Otter, der schweigend zugehört hatte, neigte den Kopf.
„Sägefisch redet wie ein weiser Häuptling", sagte er. „Ich habe zugehört, um von ihm zu lernen, und nun habe ich auch einen Entschluß gefaßt. Wenn Sägefisch zu seinem Stamm zurückkehrt, sollen ihm soviel von den besten Kriegern des Eisvogelvolkes folgen, wie ich Finger habe. Und schon jetzt sollen sie Bogen und Pfeile für sich und andere anfertigen, so daß alles bereit ist, wenn es zum Kampfe kommt. Es wäre gut, wenn mein junger Bruder Adlerauge ihnen zeigte, wie man gute Bogen macht. Otter hat gesprochen."
Beifälliges Gemurmel der Eisvogelmänner folgte seinen Worten, und ein halbes Dutzend jüngere Leute erhoben sich, um hinauszugehen und sogleich Material für Bogen zu suchen.
Währenddessen redete Fuchs leise mit den Chibchamännern. Dann erhob er sich und begab sich an den Eingang, wo die Bündel mit den Handelswaren aufgestapelt lagen. Er löste den Strick, der um ein Bündel geschnürt war, und nahm ein Päckchen heraus. Mit diesem in der Hand trat er vor den Arowakenhäuptling.
„Kein Mensch soll sagen können, die Handelsleute wären Sägefisch und seinen tapferen Kriegern, die mich vor dem Krokodilgott erretteten, nicht dankbar", sagte er. „Darum sollen sie haben, was sie brauchen, um ihre und unsere Feinde zu besiegen."
Er öffnete das Päckchen und entnahm ihm eine Menge Pfeilspitzen mit scharfen Schneiden, die aus gelbgrauem Feuerstein hergestellt waren.
„Wir haben sie weit von hier eingetauscht", erklärte er. „Am besten verteilt sie der Häuptling selbst unter seine Männer. Für ihn und Adlerauge habe ich besondere Geschenke."
Fuchs holte ein zweites Päckchen und hielt zwei glänzende, breite Äxte in die Höhe. Sie waren aus einem Metall angefertigt, das die Küstenindianer noch nie gesehen hatten — es war Bronze.
„Weit im Süden, hinter dem Bergland, in dem das Chibchavolk wohnt, liegt ein anderes Land", erklärte er. „Ich selbst bin noch nie dort gewesen, sondern habe nur davon erzählen hören. Dort wohnen Menschen in großen Häusern von Stein, sie haben große Tiere, die ihnen gehorchen und Lasten tragen, und sie fertigen viele wunderbare Dinge an; denn die Sonne selbst hat ihnen einen ihrer Söhne als Oberhäuptling geschickt, den sie Inka nennen. Diese Äxte sollen aus dem Land des Inka stammen."
Sägefisch wandte die schwere Axt in der Hand und prüfte ihre Schneide.
„Denkt euch, aus so weiter Ferne kommt sie her — wie groß ist doch die Welt 1" sagte er nachdenklich. „Wer weiß, wie viele Berge und Flüsse zwischen uns und dem Land liegen, in dem man diese Axt anfertigte. Wie lange braucht man, um in das Land der Handelsleute zu kommen?"
„Zwei Mondzeiten, wenn man schnell reist."
„Und von dort aus in das Land, wo die Menschen in Häusern aus Stein wohnen?”
„Ich weiß es nicht. Viele Mondzeiten."
Die Indianer schüttelten den Kopf. Das vermochten sie nicht zu fassen.
Die Arowaken wollten so bald als möglich zurück auf ihre Inseln im Meer, aber es kam etwas dazwischen. Am Morgen nach der Begegnung in dem Versammlungshaus hatte Feuersteinherz hohes Fieber, und einer der Handelsleute war ebenfalls krank.
Uhu, der Medizinmann des Eisvogelvolkes, gab ihnen Kräutermedizin, aber sie schien ihnen nicht zu helfen. Und es wurde auch nicht viel besser, als der andere Chibchamann bittere Baumrinde in Quellwasser kochte und ihnen davon zu trinken gab.
Sie schwitzten furchtbar und fühlten sich eine Zeitlang wohler, aber dann kehrte das Fieber zurück.
Einige Tage vergingen, und schließlich wurden die Häuptlinge besorgt.
Sägefisch wollte mit seinen Leuten und den Hilfstruppen zurück zu seinem Volk, und Otter war nicht wohl bei dem Gedanken, kranke Fremde im Dorf zu haben.
Wer konnte denn wissen, ob die Krankheitsgeister nicht auch plötzlich das Eisvogelvolk anfielen?
Die Indianer wußten ja nicht, wodurch die Krankheiten entstanden. Sie glaubten, ein Mensch sei krank, weil ein böser Geist in ihn gefahren sei. Wenn es gelang, den Geist zu täuschen oder ihm den Aufenthalt zu verleiden, so daß er wieder ausfuhr, dann wurde der Mensch wieder gesund.
Nun versprach der Häuptling dem alten Medizinmann zwei seiner wertvollsten Halsbänder, wenn er die Kranken heilte, und Uhu wollte seine kräftigsten Zauberkünste versuchen.
Nach seinen Anweisungen bauten die jungen Männer auf hohen Pfählen eine kleine Hütte, ein ziemliches Stück vom Dorf entfernt, und auf einem zur Erde geneigten Baum unten am Fluß hängten sie an Stricken eine kleine Plattform auf.
Darauf wurden die Kranken an die neue Hütte getragen und vor dieser auf eine breite Bank gelegt.
Die Plattform auf dem Baum wurde mit großen Blättern bedeckt, und auf diesen Blättern tischte der Alte alle möglichen Leckerbissen auf: gebratenes Fleisch, geräuchertes Fleisch, geräucherte Fische, gekochte Maniokwurzeln, Maisbrötchen, Casabekuchen und Schalen mit Maisbier.
Einige junge Männer mußten in die Hütte hinaufsteigen und die Leiter nachziehen. Als sie sich dort oben in Sicherheit befanden, begann Uhu seine Beschwörungen zu murmeln.
Zuerst nahm er einige große Blätter und fegte mit diesen über die Kranken hinweg. Er begann am Kopf, dann folgte der Körper und die Beine, und schließlich fegte er über die Zehen hinaus. Dabei murmelte er fortwährend geheimnisvolle Sprüche.
Dieses Fegen mit den Blättern sollte bewirken, daß sich die Krankheitsgeister in den Kranken nicht wohl fühlten. Die Indianer glaubten, daß Krankheiten am besten da gediehen, wo sich Schmutz befand — und damit hatten sie recht. Darum mußten die Kranken zunächst einmal gereinigt werden.
Uhu ließ seinen Lehrling — einen jungen Indianer, der später selbst Medizinmann zu werden hoffte — einen großen Tonkessel mit heißem Kräuterwasser herbeitragen.
Mit diesem Wasser wusch der Medizinmann seine Patienten — es war so heiß, daß sie die Zähne zusammenbeißen mußten, um nicht laut zu schreien —, und nun waren sie endlich soweit, daß sie von den Krankheitsgeistern befreit werden konnten.
Der Alte stimmte den letzten seiner Beschwörungsgesänge an. Er sang den Geistern vor, dies sei kein guter Ort für sie. Es sei kein Dach über der Bank, Speisen seien auch nicht da, nur kaltes Wasser zum Trinken.
Während er sang, begann cr die Kranken zu umtanzen. In der einen Hand hielt er zwei Stöcke aus blankpoliertem, schwarzem Palmen-holz, die er abwechselnd auf den Erdboden stieß. Bei den Stöcken handelte es sich um Zauberstäbe, und indem er sie wie tanzende Füße bewegte, glaubte er, daß er die Geister zum Mittanzen zwang. Immer schneller tanzte der Alte, und jetzt begann er Verse zu singen. Sie handelten von einem vorzüglichen Ort, wo es eine Fülle guter Dinge zu essen gab. Dort hatte man eine schöne Aussicht über die Insel, dort befand sich eine breite Plattform, auf der man sich ausruhen konnte, und wenn man nicht mehr essen mochte, gab es dort Maisbier statt Wasser zu trinken. Ob die Krankheitsgeister nicht Lust hätten, ihm dorthin zu folgen und zu schmausen?

Mit jeder Runde stieß er nun die Stöcke schneller auf den Boden, aber er hatte sie heimlich in die andere Hand geschmuggelt, so daß er selber sich jetzt zwischen ihnen und den Kranken befand. Das bedeutete, daß er einen Zauberkreis um diese zog, so daß die bösen Krankheitsgeister nicht zu ihnen zurückkehren konnten.
Zuletzt tanzte er einen weiten Zauberring, in den er auch die Hütte einbezog, und dabei überredete er fortwährend die Geister, ihn doch zum Festmahl am Fluß zu begleiten.
Plötzlich schlug er eine andere Richtung ein und tanzte auf gewundenen Pfaden durch den dichten Wald auf den Baum am Fluß zu, wo die Plattform wartete.
Dort angekommen, stieg er den schräg geneigten Baum hinauf und bat die Geister, zuzulangen und sich gütlich zu tun. Mit den Stöcken ahmte er ihren Gang auf der Plattform nach.
Sobald die Krankheitsgeister nach seinen Berechnungen bequem Platz genommen und zu essen begonnen hatten, zog er an einer Liane und kippte die ganze Plattform in den tiefen, reißenden Fluß.
Wenn die bösen Geister nun auch nicht gerade ertranken, so riß sie die Strömung doch immerhin so weit mit fort, daß sie nur mit großer Schwierigkeit zurückfinden konnten.
Unterdessen war einer der jungen Männer aus der Hütte heruntergesprungen, hatte die Kranken in Hängematten gelegt und dem Lehrling des Medizinmannes geholfen, sie bis an den Rand des Hüttenbodens zu tragen. Die anderen jungen Leute zogen sie an Stricken
hinauf. Mit dem Holz der Bank, auf der die Kranken gelegen hatten, machten die beiden Gehilfen ein Feuer, und dann turnten sie wieder in die Hütte hinauf.
Die Leiter war schon vorher hinaufgezogen worden, so daß es fast unmöglich war, ohne Hilfe in die Hütte hinaufzuklettern. An jeden Pfosten stellte sich ein junger Mann und hielt einen mit der Spitze nach unten gekehrten Speer daran. Nun konnte dort niemand hinaufklettern.
Ein anderer von Uhus Gehilfen gab den Kranken aus großen Schalen Medizin zu trinken, die aus der bitteren Baumrinde gekocht war, und wusch sie abermals von Kopf bis Fuß mit Kräuterwasser.
Als der Medizinmann die Geister in den Fluß geworfen hatte, lief er schnell in den Wald hinein und begann seine Spuren unkenntlich zu machen, so daß ihm niemand folgen konnte. Sonst würde es vielleicht geschehen, daß ein erboster Krankheitsgeist hinter ihm herkam, um sich zu rächen!
Als er an einen Bach kam, wusch er die rote Pflanzenfarbe ab und bemalte sich statt dessen mit blauen Streifen. Er wandte die Außenseite seines Hüfttuchs nach innen und watete darauf ein großes Stück in dem fließenden Wasser, ehe er wieder Land betrat.
Dann begab er sich ruhig in seine Hütte. Kein rachgieriges Krankheitswesen vermochte ihn jetzt wiederzuerkennen.
Ob es nun dem bitteren Trank aus der Rinde des Cinchonabaumes oder etwas anderem zuzuschreiben war, ist schwer zu sagen, aber nach einigen Tagen waren Feuersteinherz und der Handelsmann wieder gesund. Zwei Tage später waren die Arowaken soweit, daß sie an die Küste zurückkehren konnten, aber im letzten Augenblick kam wieder etwas dazwischen.
Mit großer Sorgfalt hatte Otter zwanzig junge Männer ausgewählt, die Sägefisch auf seinem geplanten Kriegszug begleiten sollten. Es waren so viel, wie die beiden kürzlich eroberten Kanus aufnehmen konnten.
Sie rüsteten gerade zur Abreise, als von dem Strand nahe am Dorf ein langhallender Ruf ertönte.
Otter schickte einige junge Männer in einem schnellen Kanu hin, um nachzusehen, was dort los sei, und sie kehrten mit dem Bescheid zurück, eine Schar von Männern sei angekommen und wolle mit den Häuptlingen reden.
Otter schickte Boote aus, um sie holen zu lassen, und er selbst begab sich mit Sägefisch und den anderen Arowaken in die Ratshütte, um die Neuankömmlinge zu empfangen.
Es waren über zwanzig junge Leute. Die meisten von ihnen stammten aus einem anderen Dorf des Eisvogelvolkes, das eine Tagereise landeinwärts zwischen zwei flachen Seen lag. Einige der Männer kamen jedoch von den Kalkbergen. Es waren große, kräftige Männer, die lange Lanzen und Keulen mit Steinköpfen trugen. Einige waren Küstenarowaken, die Sägefisch in seiner Sprache begrüßten.
„Wo kommt ihr denn her?" fragte der Arowakenhäuptling verwundert.
„Wir waren Gefangene der Kariben", antwortete einer von ihnen. „Sie haben uns schlecht behandelt, und eines Tages ist es uns gelungen, landeinwärts zu fliehen. Schließlich gelangten wir in das Dorf zwischen den Seen, und dort waren die Leute freundlich zu uns und ließen uns bei sich wohnen. Vorgestern kam nun ein Mann aus Otters Dorf und erzählte uns von dem bevorstehenden Kampf gegen die Kariben. Da wollten wir auch dabeisein, und als wir es unseren Freunden sagten, kamen sie auch mit."
„Wer ist euer Häuptling?" fragte Sägefisch.
„Du bist unser Häuptling, wenn du uns mitnimmst. Wir haben keinen anderen."
Otter nickte zustimmend. Aber Sägefisch sah besorgt nach seinen Männern.
„Wohl brauchen wir Krieger”, sagte er, „aber woher bekommen wir seetüchtige Kanus für all diese Männer?"
„Daran haben wir bereits gedacht", sagte einer der neuangekommenen Arowaken. „Das Dorf, in dem man uns gefangenhielt, liegt nicht weit von hier. Es ist ganz klein, aber es liegen dort drei große Kriegskanus. Wenn einige von deinen Männern mitkommen, können wir sie holen."
Sägefisch schwieg eine Zeitlang und sah bald den einen und bald den anderen seiner Begleiter an.
„Adlerauge", sagte er schließlich, „du bist mein Unterhäuptling und übernimmst den Befehl über diese Männer. Als Begleiter kannst du dir zwei von deinen Freunden aussuchen. Wenn du diese Kanus in Besitz nehmen kannst, dann hast du unserem Volk einen weiteren großen Dienst erwiesen."
„Wie du willst, Häuptling", antwortete Adlerauge ruhig. „Wenn ich den Grauen Reiher und Haifischzahn mitnehmen kann ..."
„Das kannst du. Überlege, was zu tun ist, ich will inzwischen mit Otter reden."
Adlerauge nahm die neuangekommenen Arowaken beiseite und besprach sich lange mit ihnen. Dann trat er vor die Häuptlinge.
„Die Männer haben mir nun geschildert, wo das Dorf liegt", sagte er. „Wenn Otter uns einige Sumpfkanus und einen Führer mitgibt,
dann fahren wir morgen, sobald es hell wird. Gelingt unser Plan, dann warten wir in dem Versteck an der flachen Landzunge auf Sägefisch."
„Wenn ich früher vorbeikomme, lasse ich ein Zeichen zurück, daß ich dagewesen bin", sagte der Häuptling. „Im übrigen tust du, was du für das beste hältst."
Am nächsten Morgen, als es noch dämmrig war, stieß Adlerauges Schar von dem Dorf im Sumpf ab. Sägefisch und seine Krieger wollten am Abend desselben Tages abfahren.

Häuptling Adlerauge
Vier von den langen, schmalen Kanus des Eisvogelvolkes glitten durch den Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst. Sie waren mit bewaffneten Männern besetzt, neun in jedem Kanu.
Adlerauge saß im ersten Boot, Bogen, Pfeile und Bronzeaxt auf dem Schoß. Seine Blicke glitten von Baum zu Baum, von Lichtung zu Lichtung. Hin und wieder wandte er den Kopf, um sich zu überzeugen, ob die Kanus den richtigen Abstand einhielten.
Es konnte eine ganze Stunde vergehen, ohne daß einer der Männer ein Wort sagte. Teils sind die Indianer von Natur schweigsam, teils sind sie gute Jäger, die draußen im Gelände nicht unnötig reden. Zudem glauben sie, daß die Waldgeister die Stille lieben. Will man sich gut mit ihnen stellen, dann schweigt man am besten.
Dies alles bedeutete jedoch nicht, daß Adlerauge keine Mitteilungen mit dem Grauen Reiher austauschen konnte, der im nächsten Kanu saß. Sie konnten sich in der Zeichensprache verständigen. Aber nicht nur sie beide, sondern auch mit den Eisvogelmännern und den Indianern aus den Kalkbergen. Die Zeichensprache war so gut entwickelt, daß man mit Hilfe von Zeichen sogar ganze Geschichten erzählen konnte.
Im Augenblick hatte Adlerauge jedoch an anderes zu denken als an Geschichten. War er doch der Häuptling zahlreicher Krieger — es waren mehr als dreimal soviel, wie er Finger hatte.
Er trug eine große Verantwortung. Wenn sie in einen Hinterhalt gelockt wurden oder auf andere Art ins Unglück gerieten, mußte sich ihr Häuptling sein ganzes Leben lang schämen. Daher hieß es, gut .Ausschau zu halten und den spähenden Blicken nichts entgehen zu lassen.
Dann und wann sah der Häuptling zu einem Spalt in dem Astwerk auf. Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Auf den gewundenen Wasserwegen zwischen den Mangroven kam man nur langsam voran. Der wegkundige Führer hatte gesagt, man würde auf festen Boden gelangen, wenn die Sonne in halber Höhe über dem westlichen Horizont stehe, eine kurze Ruhepause zur Mittagszeit einberechnet. Es war jetzt an der Zeit, daß man sich ausruhte.
Vor ihnen erhob sich ein Hügel aus dem dunklen Sumpfwasser, ein langgestreckter Sandrücken, wenigstens zehnmal so hoch wie ein Mann, nicht mit dunklen, knorrigen Mangroven bedeckt, sondern mit stattlichen, geradstämmigen Guayacanbäumen bestanden.
Auf ein Zeichen des Häuptlings hielten die Kanus, während er und die Männer in seinem Kanu auf das Ufer zufuhren.
Adlerauge, Haifischzahn und einer der Krieger von den Kalkbergen nahmen ihre Waffen und gingen schweigend an Land. Dort verteilten sie sich und schlichen spähend den Hügel hinauf und in den Wald hinein.
Erst am anderen Ufer machte der Häuptling halt. Er war eine weite Strecke gegangen, ohne die Spur eines Menschen oder sonst ein Anzeichen zu sehen, das auf eine Gefahr schließen ließ.
Die Pflanzenwelt hatte sich verändert, als sie den Kamm des Hügels überschritten hatten. Hier wuchsen nur noch wenige Mangroven. Statt dessen erstreckte sich hochstämmiger Wald an einigen Stellen fast bis ins Wasser hinein, und auf kleinen Lichtungen zwischen den bewaldeten Landzungen standen Gruppen von mannshohen Grasbüscheln, so dicht und verfilzt, daß man gerade noch hindurchkam.
In diesen Grasbüscheln stieß er auf niedrige Gänge, und in den weichen, feuchten Boden waren viele Spuren von seltsamen Füßen mit drei breiten Zehen und Schwimmhäuten eingedrückt.
Adlerauge sah, daß die Spuren ganz frisch waren, und nickte kurz. Hätte er nur Zeit gehabt, dann wäre hier vielleicht gutes Jagen gewesen. Frisches Fleisch würde gut zum Maisbrot geschmeckt haben. Es raschelte im Gras, irgend etwas bewegte sich den Hügel hinauf. Der Indianer erstarrte zur Bildsäule, den Bogen halb gespannt und einen Pfeil auf der Sehne.
Das Geräusch verstummte. Eine halbe Minute verging.
Dann raschelte es wieder, diesmal war das Geräusch ganz nahe. Ein kleines Rudel seltsamer Tiere kam durch die Grasdickung heraufgetrappelt. Sie glichen am ehesten großen Meerschweinchen mit schweren, unförmigen Köpfen.
Ab und zu blieben sie stehen und sahen sich um, als fühlten sie sich von irgend etwas Gefährlichem verfolgt.
Adlerauge verzog leicht den Mund. Eben noch hatte er sich gewünscht, Zeit zum Jagen zu haben, und schon kam ihm das Wild förmlich entgegengelaufen. Er hatte gesehen, daß es Wasserschweine waren, und wußte, daß sich ihr fettes Fleisch gut essen ließ.
Die drolligen Tiere kamen immer näher.
Der Indianer wartete ruhig. Er wußte, daß die Jäger sagten, es sei schwierig, Wasserschweine zu 'schießen; man müsse sie genau an der richtigen Stelle treffen, damit sie sofort tot waren. Wenn man sie nur verwunde, dann stürzten sie sich kopfüber ins tiefe Wasser, tauchten unter und gingen verloren. Ein totes Wasserschwein sinke im Wasser sogleich nach unten.
Jetzt waren sie nur noch knappe zehn Schritt entfernt. Mit einer weichen, gleichmäßigen Bewegung spannte der Indianer den Bogen. Die Tiere bemerkten die Bewegung und verharrten einen Augenblick unschlüssig.
Im nächsten Augenblick rollte eins von ihnen über den Boden, den langen Pfeil des Arowaken im Herzen. Die anderen fegten durch das Gras davon wie riesige Fußbälle. Lang anhaltendes Plumpsen verkündete, daß sie das Wasser erreicht hatten.
Adlerauge legte einen neuen Pfeil auf die Sehne und zielte auf das gefallene Tier, aber ein Gnadenschuß war unnötig. Das Wasserschwein zuckte noch ein paarmal mit seinen kurzen, kräftigen Beinen, und dann blieb es reglos liegen.
„Vergib mir, Bruder Ti-curú!" flüsterte der Indianer. „Wir sind viele hungrige Männer, die Fleisch brauchen, um stark zu werden, und wir werden dich in unserem Lager ehren und rühmen."
Er trat an das getötete Tier heran, lehnte den Bogen, die Pfeile und die Bronzeaxt an einen Baumstumpf und zog ein kurzes Feuersteinmesser aus dem Gürtel. Wenn man ein Wasserschwein nicht sofort aufbricht und ihm die Eingeweide herausnimmt, bekommt das Fleisch oft einen unangenehmen Beigeschmack.
Adlerauge begann seine Arbeit, aber er hatte gerade den ersten Schnitt gezogen, als er plötzlich ein schwaches Geräusch hinter sich vernahm. Es klang fast wie ein heftiger Atemzug.
Das Feuersteinmesser entfiel der Hand des Indianers. Er wußte nur zu gut, was dieses Geräusch zu bedeuten hatte.
Vorsichtig streckte er den Arm nach der Axt aus. Dann richtete er sich auf und wandte sich jäh um, die Waffe zum Schlag erhoben. Zwölf Schritt von ihm entfernt stand ein Jaguar. Er hatte die Ohren nach hinten gelegt, und sein Schwanz peitschte nervös von einer Seite zur anderen.
Die beiden Jäger, der Mann und das Raubtier, maßen sich mit den Blicken.
Der Indianer verlagerte sein Gewicht auf die Zehen. Die Knie hielt er leicht durchgedrückt, und die Hände umschlossen den Stiel der Axt, so daß die Knöchel unter der braunen Haut weiß wurden. Das war das einzige sichtbare Zeichen seiner Spannung.
Der Jaguar duckte sich halb, die breiten Hintertatzen unter dem Körper. Er war bereit, wie von einer stählernen Feder geschleudert nach vorn zu schnellen und die Zähne und Krallen in das zweibeinige Geschöpf zu graben, das da zwischen ihn und seine Beute getreten war. Lange hatte der Jaguar die Wasserschweine belauert, ihn quälte der Hunger. Der Blutgeruch des toten Tieres lockte und zog ihn, aber das zweibeinige Wesen sah gefährlich aus.
Wilde Tiere pflegen sich nur selten unnötigen Gefahren auszusetzen. Dieser Jaguar war noch nie einem Menschen begegnet, und eben darum fühlte er sich nicht sicher.
Der Indianer veränderte die Stellung des einen Fußes.
Die große gefleckte Katze zuckte bei dieser Bewegung zusammen und stieß ein drohendes Knurren aus. Sie verzog die Oberlippe, so daß ihre gelblichen Zähne schimmerten.
Adlerauge verharrte reglos und wartete. Er wußte, die nächste Bewegung würde vermutlich zu einem wütenden Angriff des Tieres führen, und seine Aussichten, einem solchen unversehrtzu entgehen, waren ziemlich gering.
Das Warten wurde allmählich unerträglich. Der Indianer fühlte, wie ihm der kalte Schweiß auf die Stirn trat. Der Jaguar wechselte unruhig die Stellung. Seine Muskeln spielten unter dem kurzen, dichten Fell. Da raschelte es oben am Hang. Ein halbverfaulter Ast knackte. Einige Sekunden später raschelten ein paar welke Blätter. Eine Liane schabte an einem harten Gegenstand.
Der Jaguar und Adlerauge wandten gleichzeitig die Köpfe und warfen einen raschen Blick in die Richtung, aus der die Geräusche kamen.
In einer Lücke zwischen den mannshohen Grasbüscheln sah Adlerauge Haifischzahn. Er hielt den Bogen schußbereit in den Händen.
Mit einem einzigen Blick hatte der Halbkaribe die Situation erkannt. Er hob den Bogen, zielte und schoß.
Es war ein guter Schuß, aber ein einziger Pfeil reichte nicht aus, um einen Jaguar zu töten, wenn er nicht sofort ins Herz traf. Der Pfeil drang einige Fingerbreit zu hoch durch die Rippen des Tieres. Mit kurzem, heiserem Gebrüll fuhr die große Katze herum und stürzte sich auf den Schützen.

Haifischzahn hatte sofort den Bogen fallen lassen und die Keule an sich gerissen, aber die Bestie hatte ihn erreicht, ehe er zu einem tödlichen Schlag ausholen konnte. Das einzige, wozu ihm noch Zeit blieb, war, dem Kopf des Raubtiers einen kräftigen Schlag zu versetzen und sich dabei gleichzeitig zur Seite zu werfen, um dem Angriff auszuweichen.
In Sekundenschnelle standen sich beide wieder gegenüber. Für einen Sprung des Jaguars reichte der Platz nicht aus. Er erhob sich auf die Hinterbeine und schnappte nach dem Gesicht des Jägers.
Haifischzahn hielt die Keule mit beiden Händen umfaßt und hieb damit dem Raubtier quer in den Rachen. Das harte Caimancilloholz krachte zwischen die Reißzähne. Die langen spitzen Krallen an den Tatzen der Bestie gruben sich in die Arme des Mannes.
Einen Augenblick verharrten die beiden aneinandergelehnt, jeden Muskel gespannt, um nicht hintenübergeworfen zu werden.
Der Jaguar biß wütend nach der Keule und entriß sie Haifischzahn. Der Indianer fuhr seinem Feind mit den Händen an die Gurgel. Es gelang ihm, blitzschnell seinen langen Knochendolch aus dem Gürtel zu ziehen. Die Krallen des Raubtiers gruben sich in dem Augenblick in seine Schultern.
Haifischzahn wurde es schwarz vor den Augen. Noch einen Augenblick...
Aber jetzt vernahm er Adlerauges Kriegsruf. Eine blinkende Axt pfiff durch die Luft und drang dem Jaguar tief in den Schädel. Die Pranken lockerten den Griff. Ermattet und blutend taumelte Haifischzahn rückwärts und blieb an einen Baum gelehnt stehen. Er sah, wie Adlerauge ein zweites Mal mit der Axt auf die Bestie einschlug.
Mit großer Willenskraft überwand Haifischzahn das Schwindelgefühl und richtete sich auf. Die gefleckte Riesenkatze lag reglos in dem blutigen, niedergetrampelten Gras, davor stand Adlerauge, die Axt zu einem neuen Schlag erhoben, der jedoch nicht mehr nötig war.
Zwei kleine Feuer brannten in einer Senke am Rande des großen Mangrovensumpfes, eine Wegstunde von dem Dorf der Kariben entfernt.
Adlerauge und seine Männer saßen um die Feuer. Haifischzahn lag auf einem Lager von Palmenblättern. Man hatte ihm Arme und Schultern verbunden, so gut es ging. Er fühlte sich bereits wieder besser, obwohl er von dem Blutverlust noch schwach war.
Die Kanus hatten sie in dem dichten Uferdickicht versteckt, wo selbst ein scharfäugiger Indianer diese nur durch Zufall entdecken konnte. Die Nachtbrise strich kühl durch den Wald. Grillen und Zikaden musizierten. Zahllose Feuerfliegen — leuchtende Käfer — flogen herum. Manche von ihnen leuchteten nur dann und wann ein wenig auf, andere verbreiteten ständig einen grünen Schein.
Adlerauge hockte am Boden und verfolgte nachdenklich den Flug der Käfer. Ein Gedanke nahm immer mehr Gestalt an.
Er griff nach einer großen Kalebassenflasche in einem der Körbe und hielt sie gegen den Feuerschein. Dann legte er sie wieder weg und nahm statt dessen den gesäuberten Jaguarschädel in die Hand. Unvermittelt wandte er sich an einen der jungen Männer, die der Gefangenschaft der Kariben entflohen waren.
„Wie viele Menschen sind in dem Dorf, das unser Ziel ist?" fragte er.
„Wenn die Kariben, die in dem Krokodilsumpf umkamen, aus diesem Dorf stammten — und dessen bin ich sicher —, dann werden dort kaum mehr als ein Dutzend Männer sein", antwortete der andere. „Jetzt befinden sich dort wohl in der Hauptsache Frauen und Kinder." „Sie dürften jetzt ziemlich besorgt sein, wo doch der Medizinmann und seine Begleiter nicht zurückgekehrt sind", nahm Adlerauge das Gespräch wieder auf.
„Sicher", erwiderte der andere. „Es kündet großes Unheil an, wenn der Stamm einen Medizinmann verliert, nicht wahr, Haifischzahn?" „Es ist das größte Unheil, das ihnen widerfahren kann", sagte der Verwundete und richtete sich in den Sitz auf. „Sag mir, Häuptling, wie lange gedenkst du mich hier noch liegenzulassen wie ein kleines Kind?"
„Lieg nur still und komm wieder zu Kräften, junger Bruder", antwortete der Häuptling freundlich. „Du wirst sie morgen nacht brauchen, wenn alles so geht, wie ich es mir gedacht habe; denn es hängt dabei ziemlich viel von dir ab. Aber nun laß mich erst einmal hören, was du von meinem Plan hältst."
Haifischzahn legte sich unwillig wieder hin, während der Häuptling sich über ihn beugte und mehrere Minuten lang leise mit ihm sprach. Der Halbkaribe hörte aufmerksam zu, und schließlich brach er in ein leises, herzliches Lachen aus.
„So wird 's gemacht!" sagte er. „Nun will ich auch nicht mehr unzufrieden sein. Ich werde mich deinen Anordnungen fügen, denn es ist kein Häuptling klüger als du."
Adlerauge rief den Grauen Reiher, und darauf begannen die drei alle Einzelheiten eines Plans zu besprechen, der den Kariben eine kleine Überraschung bereiten sollte.
Von den Kochfeuern des kleinen Dorfes an der Meeresbucht stieg der Rauch in den Himmel. Die Sonne wollte gerade hinter der Kimm verschwinden. Scharen weißer Reiher und bunter Baumenten strichen auf dem Weg zu ihren Schlafplätzen in den Mangroven vorbei. Eine Gruppe junger Mädchen kam mit großen Körben voller Bataten, Maiskolben, Bohnen und Früchten von den Anpflanzungen zurück. Ihre Mütter hantierten mit Töpfen und Schalen, während die Männer am Strand saßen und über das Meer schauten.
Drei große Kanus waren auf den Strand hinaufgezogen.
Der älteste der Karibenkrieger zählte etwas an den Fingern seiner Hand ab.
„Neun", sagte er nach einer Weile. „Neunmal hat die Sonne gebadet, seitdem Kaiman mit unseren jungen Männern in den Sumpf gefahren ist, um dem Krokodilgott zu opfern. Wo mögen sie nur sein?" Sein Nachbar schüttelte den Kopf.
„Wenn man das bloß wüßte!” murmelte er düster. „Mein Sohn ist auch dabei. Ist es möglich, daß der Krokodilgott ihnen zürnt? Oder hat es vielleicht unser großer Vorvater übelgenommen, daß wir einem solchen Gott Opfer bringen — der doch wohl nicht sein Freund ist?"
„Niemand kann das wissen", erwiderte der erste. „Sorgen macht man sich schon. Hier hatten wir es so gut, konnten in den Hütten der Arowaken wohnen und unsere Mahlzeiten von ihren Feldern holen. Zuerst flüchteten die Sklaven, dann blieben unsere jungen Männer aus. Und Klapperschlange ist auch nicht zurückgekehrt."
„Klapperschlange ist nie mein Freund gewesen", sagte der andere mit leiser Stimme. „Hätte er nicht den Bogen des Kriegsgottes bei sich, dann würde ich ihn nicht vermissen. Aber nun wollen wir hinaufgehen und essen. Die Frauen sind heute später fertig geworden. Es wird ganz dunkel werden, ehe wir gegessen haben."
Die Männer gingen hinauf in das Dorf und ließen sich in der Mitte eines im Freien befindlichen Platzes nieder. Sobald sie sich gesetzt hatten, kamen die Frauen und breiteten große Blätter vor ihnen aus. Darauf stellten sie Holzschüsseln und Schalen mit Gerichten. Als die Männer mit allem wohlversehen waren, aßen die Frauen und Kinder ebenfalls gemeinsam.
Der Rauch der Feuer vertrieb die Moskitos und Stechfliegen, die Sonne verschwand, und die kurze tropische Dämmerung ging in die Nacht über.
Als alle gegessen hatten, blieben sie noch ein Weilchen an den Feuern sitzen.
Schließlich erhob sich eine der Frauen, die ein kleines Kind in den Armen hielt. Sie wandte sich einer der Hütten zu und ging einige Schritte in diese Richtung. Plötzlich blieb sie jedoch stehen und blickte starr vor Entsetzen nach dem Rand des Dorfes.
In der zunehmenden Dunkelheit näherte sich dort eine Riesengestalt, die einen seltsamen grünlichen Lichtschein um sich verbreitete. Gleichzeitig fauchte am Waldrand ein Jaguar. Ein zweiter antwortete ihm etwas weiter entfernt. Vom Rande des Maisfeldes hörte man den unheimlichen Ruf eines Uhus.
Die riesige Gestalt kam näher, direkt auf die Feuer zu. Männer, Frauen und Kinder sprangen von ihren Plätzen auf und drängten sich zusammen.
Die Gestalt ging aufrecht wie ein Mensch, aber sie war größer und stärker, und ihre Haut war nicht glatt wie die eines Menschen, sondern gefleckt wie das Fell eines Jaguars. In ihren Klauen hielt sie eine glänzende Axt, und über ihrer Schulter hing ein gewaltiger Bogen — so lang und so stark, daß ihn kein Mensch mit den Armen spannen konnte.
Aber das Schauerlichste von allem war der Kopf — oder richtiger —, waren die Köpfe. Denn das Ungeheuer hatte ihrer zwei, einen über dem anderen.
Der untere Kopf glich einem gewöhnlichen, braungelben Jaguarkopf mit offenem Rachen. Nur war er größer, und die herausragenden Zähne waren so groß wie Dolche und glichen am ehesten Stoßzähnen. Der obere Kopf dagegen war furchterregend: ein hellgrauer, nackter, grinsender Raubtierschädel. Von den vielen Löchern und Rissen der Hirnschale ging ein grüner Lichtschein aus. Es war ein fahles, unbestimmtes, gespenstisches Licht, mit nichts vergleichbar, was die Kariben je gesehen hatten.
Aus dem unteren Maul kam dumpfes Knurren.
Jetzt blieb die Gestalt stehen, etwa fünfzehn Schritt von den Feuern entfernt, und stieß ein Gebrüll aus, das die Luft erzittern ließ. Vom Entsetzen gepackt, stürzten die Frauen und Kinder in die Hütten. Die Männer blieben, zu einer dichten Gruppe zusammengedrängt. Einer versuchte mit zitternden Händen den Bogen zu spannen, aber ein anderer schlug ihm die Waffe aus der Hand.
Das Gebrüll der Gestalt wurde aus dem Dunkel beantwortet. Das kurze, fauchende Angriffsgebrüll der Jaguare, das unheimliche Schreien der Pumas, das heulende Bellen der wilden Hunde drang durch die Nacht.
Es war ein Chor, der auch den mutigsten Mann zum Erbleichen bringen konnte. Zitternd vor Entsetzen trat der älteste der Kariben einen Schritt vor. Ebenso gern hätte er wohl seinen Kopf in den Rachen eines hungrigen Hais gesteckt; aber er kannte seine Pflicht und versuchte sie zu erfüllen, wenn ihm die Knie auch weich wurden.
„Geruht der Mächtige, ein Wort an seine Diener zu richten?" fragte er. „Die Söhne Kebs hören."
„Kebs Söhne haben ihren Vater verraten!" antwortete grollend eine furchtbare Stimme. „Keb kommt voller Zorn in das gestohlene Dorf, um die Verräter zu strafen, die seinen Feind verehrt haben, die Eidechse im Sumpf."
Der alte Karibe ließ den Kopf hängen.
„Möge Keb tun, was er für richtig hält", sagte er demütig. „Es ist allen wohlbekannt, daß selbst die Götter gehorchen müssen, wenn Keb befiehlt. Darum müssen alle Sterblichen den Söhnen Kebs gehorchen."
„Keb hat keine Söhne mehr!" antwortete die Gestalt mit Donnerstimme. „Keb zieht seine Hand von den Kariben zurück. Er will ihre Gesichter nicht mehr sehen. Wenn sie leben wollen, dann mögen sie in die gestohlenen Hütten gehen und dort warten, bis der Schwager Kebs dem Walde entsteigt. Und dann mögen sie sich weit von dem unheiligen Eidechsensumpf entfernen und nie zurückkehren." „Kebs Wille ist Gesetz", sagte der Alte. „Dürfen wir warten, bis unsere Söhne zurückkehren?"
„Sie werden nie zurückkehren!" Die Stimme schien vor Zorn zu stokken. „Sie haben einer elenden Eidechse geopfert, und Kebs Zorn hat sie vernichtet. Geht!"
Innerhalb einer Minute war der Platz leer.
Die Gestalt schien sich einen Augenblick umzusehen. Dann schritt sie weiter, mitten durch das Dorf und hinunter an den Strand. Keiner der Kariben hatte den Mut, ihr nachzuschauen.
Unmittelbar vor dem Dorf trat Adlerauge aus dem Busch und ging der Gestalt entgegen.
„Ist alles gut verlaufen?” fragte er.
„Ja, das ist es!" antwortete Haifischzahn aus dem Innern der Gestalt. „Aber nun hilf mir erst mal aus dem Zeug heraus, und dann schnell hinunter an die Kanus. Denn es kann ja sein, daß die Männer des Dorfes anderen Sinnes werden, wenn sie ein Weilchen nachgedacht haben."
Diesmal irrten sie sich jedoch. Keiner von den Kariben wagte sich heraus, bevor die Sonne — Kebs Schwager — in die Hütten schien. Da bemerkten sie, daß ihre Kanus verschwunden waren. An ihrer Stelle lag ein grinsender Krokodilschädel am Strand.
Erschauernd gingen sie in ihre Hütten zurück und packten die wenigen Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten.
Ungefähr zur selben Stunde lagen ihre drei Kanus vor der kleinen Insel in den Mangroven, hinter der flachen Landzunge.
Die Kanus waren mit Männern besetzt. Acht Männer waren zurückgegangen, um die Sumpfkanus in Otters Dorf zurückzupaddeln, die übrigen waren Adlerauge und seinen Gefährten an diesen Ort gefolgt.
Der junge Häuptling saß am Heck des größten Kanus und hielt einen Jaguarschädel in den Händen. Der Schädel war voller kleiner Löcher, und die untere Öffnung war mit einem Pfropfen von Balsaholz verstopft.
Vorsichtig zog Adlerauge den Pfropfen heraus, hielt die Hand unter das Loch und schüttelte den Schädel. Ein ganzer Haufen durcheinanderkribbelnder großer Leuchtkäfer fiel in seine Hand.
„Ich danke euch für eure Hilfe, kleine Brüder!" sagte der Häuptling. Dann öffnete er die Hand und ließ die Käfer fliegen.
In dem Augenblick ertönte ein lauter Ruf: „Drei Kanus auf dem Wege zu uns I Sägefisch kommt mit seinen Kriegern !"
Kurz darauf begrüßten sich die beiden Häuptlinge. Nach einer kurzen Ruhepause fuhren die sechs Kriegskanus aus den Mangroven hinaus auf die See in Richtung Ceysén.

Die Rückkehr
Die Leute auf der kleinen Insel hatten Sägefisch und seine Kameraden schon vor mehreren Tagen zurückerwartet. Als sie nun sechs lange Kriegskanus direkt auf ihre Insel zusteuern sahen, wurden sie ziemlich unruhig.
Alle Männer und Jungen holten eilends ihre Waffen und stellten sich hinter den Korallenklippen auf, so daß sie Pfeile abschießen und Speere werfen konnten, ohne den Waffen des Feindes Ziele zu bieten. Die Frauen und sogar die Mädchen ergriffen die Fischspeere und Harpunen der Männer und legten ganze Haufen von Kochsteinen und Korallenstücken zum Werfen bereit.
Wenn die Kariben kamen, wollten alle mithelfen, sie abzuschlagen. Sie waren gerade bei den letzten Vorbereitungen für die Abwehr, als von dem ersten Kanu ein weithallender Ruf ertönte. Da saß ja Sägefisch, ihr Häuptling, und winkte mit dem Bogen!
Alle Daheimgebliebenen legten ihre Waffen und Geräte beiseite und begrüßten die Krieger mit fröhlichen Willkommensrufen.
Da hub nun ein Fragen und Erzählen an, als die Männer an Land gestiegen waren. Sie mußten alle ihre Abenteuer berichten, und die kleinen Jungen lachten und schrien vor Begeisterung, als das Fell des Jaguars an den Strand gebracht wurde.
Nur der alte Medizinmann machte ein ernstes Gesicht.
„Du hast dich gut geschlagen!” sagte er zu Sägefisch. „Es ist traurig, daß wir Krieg führen müssen, aber ich sehe ja, daß es sich nicht vermeiden läßt. Und deine neuen Bundesgenossen scheinen gute Leute zu sein. Otters Großvater habe ich noch gekannt, als ich jung war, aber ich wußte nicht, daß ihr Stamm so groß geworden ist. Bedenke aber nun eins, mein Sohn : Töte nicht ohne Notwendigkeit, nicht einmal einen Kariben! Denn wenn du es tust, wird es sicher sehr lange währen, bis Taj zurückkehrt. Und nimm es nach jedem Kampf sehr genau mit der Reinigung. Es ist nicht gut, die unversöhnten Geister seiner Feinde um sich zu haben, wenn man neuen Gefahren entgegengeht."
„Ich werde mein Bestes tun, Großvater", erwiderte der Häuptling demütig. „Auch ich möchte möglichst keine Menschen töten, und darum habe ich mir einen Plan ausgedacht. Wenn Großvater ihn hören will, dann ist es das beste, wenn wir für ein Weilchen beiseite gehen." Der alte Medizinmann hob beschwichtigend die Hand.
„Nicht jetzt!" sagte er. „Erst mußt du, gemeinsam mit den anderen, alle Schuld abwaschen. Ihr habt Kariben getötet und müßt nun sehen, daß die Geister der Toten Frieden finden. Sonst kann uns nichts gelingen."
Der Häuptling nickte. Alle „schuldigen" Waffen wurden Mummel übergeben, und dann fuhren Sägefisch, seine fünf Kameraden und all die Eisvogelmänner, die an dem Kampf in den Mangroven teilgenommen hatten, nach Ceysén hinüber. Es war ihr Glück, daß sie etwas Pflanzenkost aus Otters Lager mitgebracht hatten. Diese wurde nun völlig aufgebraucht, und auf Befehl des Medizinmannes rösteten die Frauen sogar einen Teil des Maises, den die Männer zur Aussaat mitgebracht hatten.
„Mais, der in blutige Hände kommt, bringt kein Glück", sagte der Medizinmann.
Es dauerte bis zum Mondwechsel, ehe alle Reinigungszeremonien beendet waren und die Krieger auf die kleine Insel zurückkehren konnten.
Die meisten von ihnen waren unterernährt und dachten nur noch an Schneckensuppe und gebratene Fische, aber Sägefisch, Adlerauge und Grauer Reiher hielten sich abseits von ihnen.
Als sie gegessen und sich ein Weilchen ausgeruht hatten, trat Mummel zu ihnen.
„Jetzt will ich deinen Plan hören", sagte er zum Häuptling. „Sind die zwei jungen Burschen auch eingeweiht?"
„Ja, das sind sie", antwortete Sägefisch. „Ohne die beiden wird der Plan kaum gelingen."
„Dann ist es am besten, wenn sie mitkommen", sagte der Alte. Alle vier begaben sich hinaus an die Korallenklippen, die ganz vorn an der schmalen Landzunge lagen, wo kein Mensch sie hören konnte. Dort setzten sie sich. Auf ein Zeichen des Medizinmannes begann Sägefisch mit seiner Erklärung, und die brauchte ihre Zeit. Aber als er endlich fertig war, nickte der Alte zustimmend.
„Es kann schon sein, daß es glückt", sagte er. „Wir werden jedenfalls nichts verlieren, wenn wir es versuchen, denk ich."
Noch am selben Abend riefen Häuptling und Medizinmann den ganzen Stamm zusammen.
Als sich alle im Halbkreis um sie in den Sand gesetzt hatten, begann Großvater Mummel zu reden: „Meine Kinder, morgen in der Nacht werden wir diese Insel verlassen. Sobald der Mond untergegangen ist, fahren wir los, so daß wir die flache Landzunge vielleicht in zwei Nächten erreichen. Dort verbergen wir uns in einem Meeresarm in den Mangroven, ehe es zu tagen beginnt. Die Nacht darauf rudern wir über die Bucht nach dem Ausfluß des großen Sees.
Nehmt alle eure Waffen und Fischgeräte mit, auch volle Wasserkrüge und Wegzehrung für die Reise, aber laßt alles Unnötige hier. Glückt unsere Fahrt, dann können einige von uns später zurückfahren und das Zurückgelassene holen. Mißlingt sie, dann werden wir unsere Maniokreiben und unsere Weberbäume nicht mehr brauchen."
Der alte Medizinmann seufzte tief, als habe er einen schweren Ent schluß gefaßt, aber der Häuptling und die jungen Krieger sahen froh und siegesbewußt aus.
So verließen die Bocaná-Arowaken ihre Wohnstätte auf der Insel im Korallenmeer.

Der Wind flaute in dieser Nacht frühzeitig ab, und als sich die breite Mondsichel dem Horizont näherte, stiegen alle in die Kanus, und die Fahrt begann. Als der Mond untergegangen war, legten sie ihren Kurs nach den Sternen fest. Der Weiße Jaguar (Orions Gürtel) — der Rote Jaguar (Aldebaran) — der Blaue Jaguar (Sirius) — und die Tanzende Krabbe (die Plejaden) zogen über den Himmel, aber solange man das Kreuz des Südens voraus hatte, war man auf richtigem Kurs.
Die Kanus waren voller Menschen und schwer beladen. Sobald einer beim Paddeln ermüdete, löste ihn ein anderer ab. Auf diese Weise kamen sie schnell voran.
Am nächsten Tag schliefen sie auf einer Insel, die schon nahe am Festland lag. Als es dunkel geworden war, fuhren sie wieder weiter. Eine gute Stunde vor Sonnenaufgang glitten sie in eine kleine, versteckte Bucht an der flachen Landzunge. Dort verbargen sie sich und verbrachten den ganzen Tag. Sie wagten keine Kochfeuer anzubrennen, um sich nicht zu verraten. Aber es gab dort viele austernähnliche Muscheln, die an den Wurzeln der Mangrovenbüsche saßen und die man roh essen konnte.
Als der Mond hoch am Himmel stand und die Abendbrise eingeschlafen war, fuhren sie aus der Bucht heraus und richteten ihren Kurs direkt auf das Kreuz des Südens.
Diesmal hatten sie eine lange und anstrengende Paddelfahrt vor sich : quer über die Meeresbucht nach dem Ausfluß des Mangrovensees. Sie mußten sich ziemlich weit draußen auf dem Meer halten, um nicht auf Kariben zu stoßen. Aber wenn sie in kein Unwetter gerieten, würden sie ihr Ziel am nächsten Vormittag sicher erreichen.
Der Grund, weshalb sie den Kariben ausweichen wollten, war nicht Furcht vor dem Kampf. Es hätte jetzt einer größeren Anzahl Kriegskanus bedurft, um sie zu besiegen, befanden sich doch an die sechzig Bogenschützen unter ihnen. Sägefisch wollte jedoch um jeden Preis vermeiden, daß die Kariben Kunde von ihrer Fahrt bekamen und erfuhren, daß sie Meerkanus und Bogen besaßen.
Ein Teil seiner Absichten war darauf aufgebaut, daß die Feinde davon keine Ahnung hatten.

Das Wunder
Fast alle Häuptlinge und Medizinmänner der Küstenarowaken hatten sich zur Beratung versammelt. Sie saßen auf dem Sandstrand am Auslauf des großen Mangrovensees und schauten über das Meer.
Man konnte es ihnen ansehen, daß sie betrübt waren, und dazu hatten sie auch allen Grund.
Aus einem halben Dutzend von Dörfern hatten diese Menschen Hals über Kopf vor den kriegerischen Kariben fliehen müssen. Zuflucht fanden sie in diesem großen Gebiet von Brackwasser-Seen und Sümpfen, die durch einen schmalen Sund mit dem Meer verbunden waren. Hier konnten sie sich in den sich meilenweit erstreckenden Mangrovenwäldern verstecken, die größtenteils aus dem niedrigen, hellgrünen Buschwerk bestanden, das man „weiße" Mangrove nennt.
Wären die Kariben nur auf einem gelegentlichen Kriegszug vorbeigekommen, dann hätten die Arowaken hier wohnen können, bis ihre Feinde wieder davongefahren waren, um sodann in ihre Dörfer an der Küste zurückzukehren.
Aber die Kariben machten keinerlei Anstalten, weiterzufahren. Sie ließen sich in den verlassenen Dörfern nieder und blieben dort Monat für Monat wohnen.
Das machte die Lage der Arowaken immer schwieriger. Diejenigen unter ihnen, die sonst in der Hauptsache vom Ackerbau gelebt hatten, besaßen nun kein Land mehr. Das hatten ihnen die Eindringlinge weggenommen. Daher mußten sie sich nun von der Jagd und Fischerei ernähren.
Sie benötigten große Mengen von Fischen und Wildbret, um mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder satt zu kriegen. Glücklicherweise war der See unvorstellbar fischreich, und hin und wieder bekamen sie auch ein Stück Fleisch zu essen, besonders dann, wenn es den Männern gelungen war, eine Seekuh zu harpunieren. Aber viel häufiger mußten sie sich mit Fischen und Mangrovenkrabben begnügen. Es gab jedoch auch Tage, an denen sie hungrig blieben.
Sie waren eine viel zu zahlreiche Gruppe, um sich auf diese Weise zu versorgen. Wenn sie sich in etwa zwanzig kleine Gemeinschaften aufgeteilt und über das ganze Lagunengebiet verbreitet hätten, wäre es ihnen vermutlich besser ergangen. Nun wurden die nächst gelegenen Fischplätze zu häufig aufgesucht, und das Wild verzog sich. Dadurch gerieten die Arowaken in Nahrungssorgen.
Schlimmer noch war die ständige Angst, erneut überfallen zu werden. Jeden Augenblick konnten die langen Kriegskanus der Kariben in den Sund hereingefahren kommen.
Diese Besorgnis war auch der Grund dafür, daß sie zusammenblieben und sich nicht in kleinere Gruppen aufteilten. Sie fühlten sich wesentlich sicherer, wenn sie ihrer viele waren.
In den letzten Tagen hatte sich die Spannung nun so sehr gesteigert, daß sie kaum noch zu ertragen war.
Ausgesandte Späher berichteten, in dem Dorf an der Mündung des Reiherflusses, nördlich des Mangrovensees, hätten sich zahlreiche Kariben versammelt. Elf große Kanus lägen dort auf dem Strand. Jedes von ihnen könne wenigstens zehn Bogenschützen aufnehmen.
Außerdem hatte einer der Späher einige Kariben gesehen, die Ausschau über das Meer hielten, als ob sie jeden Augenblick Verstärkung erwarteten.
Es bestand also kein Zweifel: die Feinde bereiteten einen Überfall vor. Die Frage war nur, wann sie kommen würden.
Daher war es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, daß die Führer der Bocaná-Arowaken sorgenvoll dreinschauten.
Puma, der vornehmste Häuptling, erhob sich von seinem Platz und sah finster nach der Kimm hinaus.
„Weiter über das Meer können wir nicht fliehen", sagte er zu den anderen. „Wir haben nur noch zwei Möglichkeiten. Die eine besteht darin, daß wir alles, was wir nicht tragen können, hierlassen und uns landeinwärts durch die Wälder zu dem Volk begeben, das am Fuß der Kalkberge wohnt. Vielleicht läßt man uns dort ein paar Ackerstücke bestellen, die man selbst nicht braucht. Dort wären wir so weit von dem raubgierigen Karibenpack entfernt, daß wir es wagen könnten, neue Kulturen anzulegen."
„Und die andere Möglichkeit?" fragte Große Schildkröte.
„Wir bleiben hier und wehren uns, so gut wir können."
Große Schildkröte schüttelte den Kopf.
„Ja, wenn wir uns vor ihren Pfeilen schützen könnten, bis wir ihnen nahe genug wären, um unsere Speere zu werfen — dann hätten wir vielleicht eine Möglichkeit", sagte er.
„Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht", antwortete Puma. „Seht einmal her!"
Er hielt einen plumpen Schild von geflochtenen Zweigen in die Höhe, dazu eine Art Brustharnisch aus Mangrovenstecken, die mit starken Faserschnüren zusammengebunden waren.
„Wenn ein jeder von unseren Männern sich mit diesen Dingen ausrüstet, dann können wir besser den Pfeilen der Kariben widerstehen und ihnen auf den Leib rücken. Dann werden unsere Speere und Keulen das übrige tun."
Schild und Stockharnisch gingen von Hand zu Hand. Mehrere der Häuptlinge nickten zustimmend. Solche Dinge sicherten vielleicht nicht gerade den Sieg, aber sie konnten immerhin eine gute Hilfe sein. „Ich glaube, Puma hat recht", sagte Große Schildkröte schließlich. „Wenn wir landeinwärts gehen, müssen wir zunächst einmal lange Zeit Hunger leiden und kommen dann als eine Schar von Bettlern zu dem Volk an den Kalkbergen. Sie sind immer freundlich zu uns gewesen, aber vielleicht würde es ihnen nicht gefallen, wenn wir in so großer Zahl bei ihnen ankämen. Und es ist ja denkbar, daß die Kariben uns früher oder später auch dorthin folgen."
„Viele von uns würden sicherlich unterwegs verhungern. Es ist weit bis an den Fuß der Kalkberge", sagte Pelikan, der älteste der Medizinmänner. „Es wird hier einen harten Kampf geben, aber ich vermag keinen anderen Ausweg für uns zu sehen, als hierzubleiben und zu kämpfen."
„Doch, es gibt einen", wandte Waschbär ein, dem bei dem Gedanken, den Kariben entgegenzutreten, nicht wohl war. „Wir könnten mit
Flößen das Vorgebirge dort drüben erreichen, es umrunden und weiterfahren nach dem Großen Fluß. Dort werden wir eine Gegend finden, in der wir uns niederlassen können."
Puma blickte den kleinen, dicken Unterhäuptling verächtlich an.
„Glaubt Waschbär, daß die Kariben am Tage schlafen?" fragte er. „Kannst du dir nicht denken, daß sie so viele Flöße entdecken, noch
lange bevor wir über die Bucht hinweg sind? Wenn uns ihre Kanus
dort vor den Felsenzungen einholen, wo es keine einzige tiefe Bucht oder Flußmündung gibt, in der wir Schutz suchen könnten, dann machen sie uns alle nieder. Sie brauchen uns ja nur in der Entfernung eines Bogenschusses zu folgen, und wir können nichts tun, denn ihre Kanus sind wenigstens dreimal so schnell wie unsere Flöße. Übrigens brauchten die Kariben nicht einmal zu kommen. Wenn eine Sturmbö über uns hereinbricht, sind wir verloren. Nein, Waschbärs Rat ist nicht gut."
Waschbär wollte gerade den Mund zu einer Erwiderung öffnen, als ein junger Späher über den Sandstrand gerannt kam wie ein gejagter Hirsch.
Er hatte draußen auf einer Landzunge in den Wipfeln eines hohen Baumes gesessen, um Ausschau über das Meer zu halten.
„Kanus!" keuchte er und hielt neun Finger in die Höhe. „Sie kommen hierher!"
Er zeigte auf das weite Meer hinaus, wo man soeben einige kleine dunkle Punkte erkennen konnte.
Der Alarmruf ertönte. Die Frauen und Kinder eilten in den Wald, um sich dort zu verbergen, während sich die Männer in der Nähe des Strandes versammelten. Einige von ihnen hatten bereits Harnische aus Stöcken angefertigt. Andere nahmen weite, flache Körbe und banden sie wie eine Art Schild an die Unterarme.
Die Kanus auf dem Meer kamen langsam näher.
Für die Arowaken war es ein Trost, daß es nicht mehr als neun waren. Das bedeutete, daß zwei oder drei Arowaken gegen einen Feind kämpfen konnten, wenn die Kariben sie zu überfallen gedachten. „Haltet euch gut verborgen!" sagte Puma. „Sie wissen wahrscheinlich schon, daß wir hier sind, aber wenn sie uns nicht sehen, besteht die Möglichkeit, daß sie unvorsichtig werden und sich bis auf Speerweite nähern. Wenn sie sich an Land begeben, warten wir mit dem Angriff, bis sie sich ein ziemliches Stück von ihren Kanus entfernt haben. Dann werfen wir unsere Speere — und alsdann auf sie mit den Keulen, ehe sie noch dazu kommen, uns mit Pfeilen zu beschießen! Keiner wirft eine Waffe oder zeigt sich, ehe ich gerufen habe!"
Die Männer nickten ernst und umspannten ihre Jagdspeere und Harpunen fester.
Nun waren die Kanus schon ziemlich nahe.
Puma stand einige Schritte tief im Mangrovenwald und beobachtete sie durch eine Öffnung im Astwerk.
Da stimmte doch etwas nicht! Was war denn das für ein Kriegszug? Die hatten ja Frauen und Kinder mit in den Kanus! Es waren ungefähr sechzig erwachsene Männer und ungefähr halb so viele Frauen und Kinder.
Ein Mann im Schmuck eines Häuptlings erhob sich im ersten Kanu und ließ einen weithallenden Begrüßungsruf ertönen.
Die Indianer im dichten Walde trauten ihren Ohren kaum.
Der fremde Häuptling hatte auf arowakisch gerufen, und er sah aus, als gehöre er zu ihrem Volk.

Nun waren die Kanus bereits im flachen Wasser. Der Häuptling sprang über Bord und watete an Land. Er trug Pfeil und Bogen wie ein Karibenkrieger, aber es bestand kein Zweifel, daß er ein Bocaná-Arowake war.
Puma kam der Mann bekannt vor. Ja, jetzt erinnerte er sich. Der Fremde war Sägefisch, der Häuptling des Dorfes am Reiherfluß, der vor einigen Mondzeiten mit seiner ganzen Schar verschwunden war. Alle hatten geglaubt, er und sein Volk wären von den Kariben erschlagen worden oder auf der Flucht ertrunken. Und jetzt war er hier mit neun Meerkanus und sechzig Kriegern!
Das war eine große Überraschung, aber eine angenehme.
Puma legte Speer und Keule beiseite, verließ sein Versteck in den Büschen und betrat den Sandstrand, um dem Häuptling entgegenzugehen.
„Mein Bruder Sägefisch ist uns willkommen", sagte er. „Aber wie kommt es, daß mein Bruder und sein Volk in großen Meerkanus angefahren kommen?"
„Drei von ihnen haben wir selbst gebaut", erwiderte Sägefisch, „die sechs anderen haben wir den Kariben abgenommen."
„Die Bogen und Pfeile auch?"
„Mit denen verhält es sich ebenso. Einen Teil nahmen wir den besiegten Feinden ab, und die anderen haben wir und die Krieger des Eisvogelvolkes angefertigt. Wir besitzen viel mehr, als wir brauchen, dazu viele, viele Kriegspfeile — so viele, daß mehrere Männer nötig sind, um sie zu tragen. Wenn mein großer Bruder Puma will, können wir so viele von seinen jungen Männern bewaffnen, wie drei Krieger Finger haben. Und dann bleiben immer noch Bogen übrig."
Die dunklen Augen des älteren Häuptlings funkelten erfreut. Dreißig Bogenschützen zu beiden Seiten des Sundes würden einem feindlichen Kanu das Durchkommen so gut wie unmöglich machen, und unter einem solchen Pfeilregen aus einem Kanu an Land zu waten würde ein gefährliches Unternehmen sein.
Das letzte Drittel der Bogenschützen mußte zurückbleiben, um im entscheidenden Augenblick zur Überraschung des Feindes eingesetzt zu werden.
Es war nicht zuviel gesagt. Diese unerwartete Verstärkung machte die Siegesaussichten um ein Vielfaches gewisser.
Die Neuigkeit, daß es Arowaken gelungen war, Kariben zu besiegen und Kanus und Waffen von ihnen zu erobern, würde auch Pumas Kriegern neuen Mut geben, und das war mindestens ebenso wichtig. Die Neuankömmlinge verließen ihre Boote und wateten an Land; und bald wurden sie von den anderen umringt.
Die Flüchtlinge vom Mangrovensee hatten in Pfeil und Bogen bisher fast etwas Übernatürliches gesehen, etwas, was die bösen Zauberer der Feinde ersonnen hatten, um sie zu verderben. Es schien so gut wie aussichtslos, wenn sie gegen solche Künste zu kämpfen versuchten. Aber wenn nun Menschen ihres eigenen Stammes solche Geräte herstellen und dazu noch die fürchterlichen Kariben mit ihren eigenen Waffen besiegen konnten, dann war die Gefahr jener Zauberei wohl doch nicht so groß.
Puma und zwei weitere Häuptlinge übernahmen selbst Bogen, und dreißig junge Männer wurden ausgewählt, um sich von den InselArowaken im Bogenschießen unterweisen zu lassen. Das war für die Insel-Arowaken sehr anstrengend nach der langen Fahrt, aber sie wußten, daß sie keine Zeit verlieren durften, wenn ihre neuen Kameraden bereit sein sollten, den Kariben entgegenzutreten. Eine Stunde nach der Ankunft begannen einige die neuen Freunde zu unterrichten. Andere paddelten die Kanus durch den Sund und versteckten sie in den Mangroven. Alle Familien des Lagers begannen sich zu regen, um den Neuangekommenen eine zusätzliche kleine Mahlzeit zu bereiten.
Am selben Abend saßen Sägefisch, Adlerauge, Grauer Reiher, Haifischzahn und Feuersteinherz vor einem Halbkreis von ernsten Häuptlingen und Medizinmännern. Der alte Großvater Mummel hatte all seinen Schmuck angelegt. Er saß zu seiten des Oberhäuptlings.
Zuerst mußte Sägefisch die Abenteuer aller Gruppen auf den Inseln und in dem Mangrovensumpf erzählen. Dann fragte Puma die anderen der Reihe nach, wie sie über die Gefahr dachten, die ihnen durch die Kariben drohte.
Alle waren sich einig, daß sie sich verteidigen und die Kariben zurückschlagen sollten; sie konnten sich jedoch nicht einigen, wie sie es am besten beginnen sollten.
In der Ratsversammlung gab es fast ebenso viele Ansichten darüber wie Häuptlinge. Das kam vor allem daher, weil man einen Kampf zum erstenmal vorbereitete.
„Was schlägt mein Bruder Sägefisch vor?" fragte schließlich Puma. Alle schwiegen erwartungsvoll. Der Häuptling vom Reiherfluß hatte wegen seiner kühnen Taten hohes Ansehen gewonnen.
Sägefisch verharrte noch einen Augenblick schweigend, ehe er sagte: „Wir sollten tun, was die Kariben am wenigsten erwarten."
Die anderen Häuptlinge blickten sich verwundert an. Das klang zwar gut, und Sägefisch war ohne Zweifel ein großer Krieger, aber wie sollte man erraten können, was die Kariben am wenigsten erwarteten?
Sägefisch wandte sich an Haifischzahn.
„Was erwarten die Kariben jetzt von uns ?" fragte er. „Du, der du so lange unter ihnen gelebt hast, dürftest das wissen."
Haifischzahn fühlte sich geschmeichelt.
„Sie erwarten wohl zweierlei", sagte er voller Überzeugung. „Entweder daß wir die Flucht ergreifen oder daß wir hier bleiben und uns wehren."
„Also erwarten sie nicht, daß wir kommen und sie angreifen?" fragte der Häuptling.
„Nein", antwortete Haifischzahn mit erstauntem Gesicht, „das erwarten sie nicht."
Sägefisch begegnete dem Blick Pumas.
„Mein großer Bruder hat geantwortet", sagte Puma leise.
Gemurmel erhob sich bei den Versammelten. Zuerst glaubten fast alle, es handle sich um einen unmöglichen Einfall, der nur ins Verderben führen könne. Aber als sie sich die Sache nach und nach eingehender überlegten, begannen sich mehrere zu fragen, ob Sägefisch vielleicht nicht doch recht habe.
Es kam zu einer neuen Beratung, und schließlich wurde beschlossen, daß die acht großen Kanus mit jeweils zehn Bogenschützen die Kariben angreifen sollten, und zwar in der Nacht vor dem Vollmond, wenn sie ihr großes Fest feierten. Wenn kein allzustarker Wind aufkam, sollte der Angriff vom Meer aus erfolgen, sonst von der Flußmündung heraus. In jeder Kanubesatzung sollten sich zwei Männer mit schweren Keulen befinden, deren Aufgabe es war, soviel Boote des Feindes als möglich zu zerstören, während die anderen kämpften.
Der Rest der Männer sollte den Strand entlanggehen, in einiger Entfernung vor dem Lager in den Wald abbiegen und sich zwischen Dorf und Waldrand heranschleichen, bis Lärm und Kriegsrufe zu hören seien. Dann sollten sie hervorbrechen und den Kariben in den Rücken fallen. Große Schildkröte sollte diese Schar anführen, während Puma mit Sägefisch als Unterbefehlshaber die Kanuflotte befehligte.
„Vermutlich können wir nicht mit einem völligen Sieg rechnen", räumte Sägefisch ein. „Was wir als Äußerstes zu erhoffen wagen, ist, dem Feind Schaden zuzufügen und ihn so unsicher zu machen, daß er uns künftig in Ruhe läßt. Haben wir großes Glück, dann kann es sogar so kommen, daß wir gar nicht zu kämpfen brauchen. Ich habe noch einen Gedanken, aber über diesen will ich vorerst nur mit meinem Bruder Puma sprechen. Sollte dieser Plan mißlingen, dann müssen wir uns auf unsere Bogen und Speere verlassen."
Als alle anderen zu ihren Familien gegangen waren, saßen Puma und Sägefisch noch lange zusammen, in ein langes und ernstes Gespräch vertieft.
Zwei große Feuer brannten am Strand, nicht weit entfernt von der Mündung des Reiherflusses. Sie beleuchteten eine Gruppe großer, geräumiger Hütten mit Dächern von getrockneten Palmenblättern und eine Reihe langer Kriegskanus, die auf den Strand gezogen waren.
Der Feuerschein beleuchtete auch einen Kreis von Männern, die schweigend auf dem offenen Platz vor den Hütten saßen. Einige seltsame Gestalten hüpften in der Nähe des Feuers herum. Die Häuptlinge und Krieger der Kariben sahen ihren Zauberern zu, die alle Vorbereitungen für den Kriegszug trafen.
Sie wollten die Arowaken am Mangrovensee übermorgen früh überfallen, aber zuerst mußten sie ja wissen, ob ihr Kriegsgott mit ihren Plänen und bisherigen Taten einverstanden war.
Der Anführer der Medizinmänner war ein tückischer Greis, Fledermaus genannt. Dieser Name paßte gut zu seinem grinsenden Gesicht und seinen großen abstehenden Ohren.
Fast alle fürchteten ihn, und dazu hatten sie auch allen Grund. Er war genauso bösartig und widerlich wie die Vampire, die blutsaugenden Fledermäuse in der Tiefe des Urwaldes. Die ihn am besten kannten, glaubten zu wissen, daß er alle Menschen haßte.
Er war es gewesen, der seine Stammesgenossen als erster ermunterte, die friedlichen Arowaken zu überfallen. Seitdem hatte er sie zu einer Übeltat nach der anderen angespornt. Zwar ließen sich viele dazu leicht verleiten, aber es gab auch andere, die nicht seiner Meinung waren. Und nun wollte er sie dahin bringen, daß sie ihre Meinung änderten.
Fledermaus gehörte zu den Menschen, die sich nur wohl fühlen, wenn sie Macht haben und über andere bestimmen können. Aus diesem Grunde war er wohl auch Medizinmann geworden, denn er taugte weder zum Krieger noch zum Häuptling.
Nun tanzte er einen Beschwörungstanz zwischen den zwei Feuern. Er sprang und hüpfte herum, als sei er von Sinnen. Unheimlich sah er aus. Er hatte sich in das Fell eines Jaguars gehüllt und mit getrockneten Eidechsen- und Schlangenhäuten, Raubtierkrallen und scharfen gelblichen Krokodilzähnen behängt, wo immer nur Platz dafür war.
Dazu hatte er sich von Kopf bis Fuß mit schwarzen, roten und weißen Figuren bemalt, so daß er noch häßlicher wirkte als sonst.
Er brach seinen Tanz jäh ab und blieb zwischen den zwei Feuern stehen.
„Die Arowaken sind feige Wichtel" schrie er. „Die Arowaken sind alte Weiber! Es ist gerecht, daß sie Sklaven der Kariben werden. Der Kriegsgott will es. Der Kriegsgott ist zufrieden mit den Kariben!"
Er schwieg und begann erneut hin und her zu hüpfen, wobei er die nächsten Worte überlegte. Er wußte, daß er einen sehr gefährlichen Gegner hatte. Das war der Häuptling Schwarzer Habicht, der von Anfang an gegen die Kriegszüge gewesen war.
Nun mußte Fledermaus zusehen, daß er alle Kariben auf seine Seite bekam, indem er nach Möglichkeit dem Häuptling etwas Schlechtes nachsagte. Aber er mußte es vorsichtig anstellen, denn Schwarzer Habicht war als mutiger Mann bekannt und hatte viele Freunde.
Die meisten Kariben waren in letzter Zeit etwas unruhig gewesen, seitdem Kriegshäuptling Klapperschlange und seine fünf Begleiter auf der Rückfahrt von Barú spurlos verschwunden waren.
Das brauchte nicht zu bedeuten, daß sie in die Hände der Arowaken gefallen waren, es konnte ihnen ja auch irgend etwas anderes zugestoßen sein.
Das schlimmste war freilich, daß sie den Bogen des Kriegsgottes bei sich hatten. Der war nun auch verschwunden.
Das war ein großer Verlust. Viele Krieger glaubten fest daran, ihr Erfolg hänge davon ab, daß sie den Bogen des Kriegsgottes sorglich hüteten.
Es war um so beunruhigender, weil der Medizinmann Kaiman und seine zehn Krieger sek einigen Wochen ebenfalls verschollen waren. Sie hatten sich in den Wald-der-im-tiefen-Wasser-wächst begeben, um dem Krokodilgott einen Gefangenen zu opfern, und nicht ein einziger von ihnen war zurückgekehrt.
Dieses geheimnisvolle Verschwinden hatte dem Schwarzen Habicht und seinen Anhängern einiges zu denken aufgegeben. Sie betrachteten es als schlechtes Vorzeichen, als den Beweis, daß die Götter unzufrieden waren. Und während der letzten Tage hatten sich verschiedene Krieger gefragt, ob der große Häuptling nicht doch recht gehabt hatte.
Einige von ihnen hatten gehört, wie andere eine unheimliche Geschichte weitererzählten: Keb selbst, der große Jaguargeist, habe sich in einem Dorf drüben an der Küste gezeigt und in zornigem Ton zu den älteren Männern gesprochen. Wenn das zutraf, dann stand es schlecht mit ihnen.
Gerade in dem Augenblick, als der Medizinmann erneut zu tanzen begann, warf ein alter Unterhäuptling zufällig einen Blick auf das Meer.
„Sieh, da ist ja ein leeres Kanu!" sagte er zu seinem Nachbarn. „Wie seltsam es treibt!"
Mehrere Männer wandten die Köpfe und sahen hinaus auf das weite Wasser.
Das Kanu schien wirklich leer zu sein, aber trotzdem trieb es nicht hilflos auf den Wellen, sondern bewegte sich wie von unsichtbarer Hand gesteuert.
Jetzt war das Kanu etwa bis in den Lichtkreis der Feuer gelangt. Das Wasser reichte einem Mann dort etwa bis an die Schultern.
„Seht, da!" schrie Fledermaus, der das Kanu nun auch erblickt hatte. „Da kommt das Boot des Kriegsgottes. Er kommt, um uns zu sagen, daß er mit seinen Kariben zufrieden ist und ihnen einen großen Sieg über die elenden Arowaken schenken will."
Über hundert Augenpaare folgten dem fremden Kanu. Anderthalb Bogenweiten vom Strand entfernt hielt es.
Langsam schob sich etwas über den Rand des Kanus, auf der Seite, die dem Land zugekehrt war. Es sah aus wie eine dunkle Riesenhand, und sie hielt einen gewaltigen Bogen.
„Der Kriegsgott!" flüsterten die Kariben in atemloser Spannung.
Es schien, als werde der Große Bogen gespannt. Und wirklich — er streckte sich mit gewaltiger Kraft.
Ein heller Streifen kam durch den Feuerschein geflogen und schlug genau zwischen den beiden Lagerfeuern ein, nur einige Schritte von Fledermaus entfernt.
Ein Laut wie ein Keuchen oder wie ein tiefer Seufzer entstieg dem weiten Kreis der braunen Krieger.
„Der Pfeil des Kriegsgottes 1" murmelten erschrockene Stimmen. Mehrere der Medizinmänner schlichen von dem offenen Platz und verbargen sich hinter den anderen. War der Kriegsgott schlechter Laune, so bedeutete dies, daß sie etwas falsch gemacht hatten, und das war gefährlich.
Schwarzer Habicht, der vornehmste Stammeshäuptling, erhob sich würdig und wies mit fester Hand auf den langen Pfeil, der senkrecht und mit tief eingebohrter Spitze im Boden stak.
„Der Kriegsgott hat gesprochen", sagte er mit tiefer Stimme. „Er verbietet uns, die Arowaken zu überfallen."
„Nein 1" schrie Fledermaus. „Der Kriegsgott ist zufrieden mit seinem Volk. Dies ist ein Siegeszeichen, das er uns gibt1"
Schwarzer Habicht schüttelte den Kopf. Er hatte kein großes Vertrauen zu den Medizinmännern, aber an den Kriegsgott und seinen Bogen glaubte er blind, und er kannte alle damit verbundenen Sagen ebenso gut wie nur irgendeiner von den Zauberern des Stammes. „Es ist sinnlos, Fledermaus", sagte er düster. „Alle wissen, wenn der Kriegsgott einen Pfeil in unser Lager schießt, dann ist er zornig. Wenn er nur nicht ..."
Der Häuptling konnte seinen Satz nicht beenden. Draußen in dem Kanu war der große Bogen wieder gespannt worden. Jetzt hörte man den Strang knallend gegen das Holz schlagen. Scharfes Pfeifen durchschnitt die Luft. Ein neuer Pfeil kam geflogen und bohrte sich in die Erde, einige Armlängen von dem ersten entfernt.
Die Männer saßen ringsum so still da, daß man ihre Herzen förmlich gegen ihre Rippen schlagen hörte.
„Die Zeichen sind klar und deutlich", sagte Schwarzer Habicht nach einigen Minuten der Stille. Seine Stimme hatte einen Klang, als sei er plötzlich müde und alt geworden. „Der Kriegsgott ist sehr unzufrie den. Vielleicht war es ein Unrecht von uns, Krieg gegen ein Volk vom Zaun zu brechen, das uns nie etwas Böses getan hatte. In diesem Fall tragen die Medizinmänner die Schuld, und die Hauptschuld hat Fledermaus. Und das gilt auch für Klapperschlange, der den Kriegszug ausführte, und Kaiman, der Gefangene für seine Opferungen verlangte. Wären wir klug gewesen, dann hätten wir das vorher erkannt. Klapperschlange ist auf dem Meer verschwunden, als er den Bogen hierherbringen wollte. Kaiman machte einen wehrlosen Gast zum Gefangenen, und in der Nacht darauf blieb er selbst in dem Mangrovensumpf. Zweifelt noch immer jemand an dem Zorn der Götter?" „Du lügst!" kreischte Fledermaus giftig. „Du bist feige! Du taugst nicht zum Häuptling tapferer Karibenl Du fürchtest dich vor den Arowaken! All das Gerede von dem Bogen des Kriegsgottes ist doch nur eine dumme, alte Geschichte!"

Ein ganzer Chor wütender Zurufe ertönte aus dem Kreis der Männer. Aber diesmal stimmte es, was Fledermaus sagte. Die ganzen Berichte von dem Kriegsgott, seinem Bogen und seinen Pfeilen waren von den Medizinmännern erfunden worden, um die übrigen Stammesmitglieder dadurch einzuschüchtern und gefügig zu machen, aber im Lauf der Zeit war daraus etwas entstanden, woran fast kein Karibenkrieger zweifelte.
So etwas konnte man nun nicht so ohne weiteres als Unwahrheit abtun, und das hätte wohl auch Fledermaus erkannt, wäre er nicht von einer so furchtbaren Wut gegen den Schwarzen Habicht erfüllt gewesen.
Der Medizinmann hatte kaum Freunde. Außerdem waren die Männer erregt, und es ist oft nur ein kurzer Schritt von der Furcht zum Jähzorn.
„Schweig, elender Greis!" schrie ein Krieger.
„Beleidige den Kriegsgott nicht!" rief ein anderer.
Ein dritter sagte gar nichts, sondern nahm nur seinen Streitkolben mit den eingesetzten Haifischzähnen vom Boden auf und ging auf Fledermaus zu.
Die anderen Medizinmänner hatten bereits erkannt, daß ihnen Gefahr drohte, und waren von dem Ratsplatz verschwunden.
Fledermaus begriff, daß er schnell handeln mußte.
Mit erzwungener Ruhe stellte er sich zwischen die beiden Feuer, breitete die Arme aus und legte den Kopf zurück, als lausche er.
„Hört mich, Häuptlinge und Krieger!" rief er. „Eben jetzt höre ich den Kriegsgott reden. Er spricht zu seinem getreuen Volk durch seinen Diener Fledermaus. Er sagt, ihr hättet die Botschaft der Pfeile falsch verstanden. Es ist sein Wille, daß ihr die Arowaken schon morgen angreift, kurz vor Morgengrauen."
Der Kreis der empörten Krieger beruhigte sich und begann zuzuhören. Fledermaus verharrte eine halbe Minute in Schweigen, und dann fuhr er fort: „Jetzt sagt der Kriegsgott, wie ihr vorgehen sollt. Zuerst sollen sechs Kanus vom Meer aus angreifen und alle Verteidiger an den Strand locken. Unterdessen sollen die übrigen Krieger am Waldrand entlanggehen, ein Stück diesseits des Lagers in den Wald hinein abbiegen und ..."
Fledermaus verstummte jäh. Wieder fuhr ein scharfes Pfeifen durch die Luft, wieder kam von dem seltsamen Kanu ein weißer Pfeil angeflogen. Aber diesmal fuhr er nicht in den Erdboden.
Er traf den Medizinmann mitten in die Brust. Fledermaus stieß einen kurzen Schrei aus und fiel wie vom Blitz getroffen zu Boden.
Um die Feuer wurde es so still, daß man ein welkes Blatt hätte fallen hören. Die Krieger standen ratlos da und starrten entsetzt auf Fledermaus.
„Der Kriegsgott hat so gesprochen, daß ihn alle verstehen müssen", sagte endlich Schwarzer Habicht. „Nun wissen wir, was er will, und wir haben nichts anderes zu tun, als ihm zu gehorchen. Keiner rühre Fledermaus an! Es ist nicht gut, einem Menschen nahe zu kommen, den der Zorn der Götter geschlagen hat."
Damit hob er seinen Bogen, seine Pfeile und seine Kriegskeule vom Boden auf, trat an das nächste Feuer und steckte die Waffen zwischen die brennenden Zweige.
Ein Krieger nach dem anderen folgte seinem Beispiel. Dann gingen sie auseinander und begaben sich langsam und mit gesenkten Köpfen in ihre Hütten. Einer von ihnen nahm einen brennenden Zweig aus dem Feuer und schleuderte ihn auf das Dach der Hütte, in der Fledermaus gewohnt hatte.
Das dürre Palmenblätterdach flammte auf, und eine Minute später stürzten drei oder vier Gestalten heraus und stoben nach dem Wald davon.
Es waren die Zauberer, die den Stamm verließen.
Einige Krieger warfen ihnen Steine hinterher, aber die meisten blickten nur gleichgültig zu Boden.
Sie bemerkten nicht einmal, wie das Kanu des Kriegsgottes langsam wieder aufs Meer hinauszutreiben begann, der Flut und den Wellen direkt entgegen. Und wenn es einige von ihnen dennoch sahen, so waren sie doch viel zu niedergeschlagen und bedrückt, als daß sie sich tiefere Gedanken darüber machen konnten.
Sobald sich das geheimnisvolle Kanu weit genug aus dem Lichtkreis entfernt hatte, hielt es wieder. Zwei junge Männer kletterten über Bord, nahmen die Paddel vom Boden auf und begannen aufs Meer hinauszufahren.
Ein dritter erhob sich von einem Lager und zog die Füße aus einem doppelten Futteral von hartem dunklem Holz.
„Der letzte war ein richtiger Meisterschuß, Häuptling", sagte Adlerauge voll Bewunderung.
„Es war vor allem großes Glück, daß es gelang", erwiderte Sägefisch. „Nach den ersten beiden Schüssen kannte ich ja die Entfernung, und wir hatten direkten und gleichmäßigen Rückenwind, daher war es gar nicht so schwer, wie ich es mir vorstellte. Die Hauptsache war, daß ihr beide das Kanu ruhig hieltet, während ich zielte, und daß euch kein Barracuda in die Beine biß. Seht, da drüben sind unsere Kameraden."
Acht große Kanus schaukelten in der Dünung vor der Flußmündung, in ziemlicher Entfernung vom Strand. Man mußte schon ganz in ihrer Nähe sein, um sie sehen zu können, denn der Mond befand sich noch hinter einer niedrigen Wolkenbank auf der Landseite.
Die drei paddelten an das größte Kanu heran. Am hinteren Ende des Fahrzeugs erhob sich eine dunkle Gestalt.
„Sollen wir jetzt angreifen?" fragte Puma flüsternd.
„Es ist wohl besser, wir lassen es", erwiderte Sägefisch. „Die Kariben haben im Augenblick anderes zu bedenken, als einen Angriff vorzubereiten, und ich bin sicher, de beschließen, sich aus dieser Gegend zu verziehen, sobald es tagt — wenn wir de nur in Ruhe lassen. Wenn wir sie in dieser Nacht jedoch angreifen, müssen sie sich verteidigen, und da weiß man nie, wie es ausgeht."
„Bist du sicher, daß sie uns künftig in Ruhe lassen?"
„Haifischzahn!" sagte Sägefisch. „Wenn du ein Karibe wärst und wenn der Kriegsgott soeben drei Pfeile in dein Lager geschossen hätte — würdest du dann einen Kriegszug unternehmen?"
„Ebenso gern würde ich dann unbewaffnet einer Jaguarmutter mit Jungen entgegentreten !" antwortete der Halbkaribe. „Wo sind denn die Pfeile eingeschlagen?"
„Zwei fielen zwischen die Feuer. Der dritte traf den Medizinmann." „Ist er tot?"
„Ja."
„Und was haben die Kariben dann getan?"
„Es sah aus, als ob sie ihre Waffen in die Feuer warfen." Haifischzahn nickte kurz und schwieg eine Zeitlang.
„Wollen wir nun heimfahren?" fragte er dann. „Mit den Kariben wird es so lange keinen Krieg mehr geben, wie jene Häuptlinge am Leben sind."
Sägefisch überlegte einige Minuten.
„Haifischzahn hat wahrscheinlich recht", sagte er dann, „aber es ist wohl das beste, wenn wir uns vorsichtig verhalten."
„Was sollten wir deiner Meinung nach tun, mein Bruder?" fragte Puma.
„Wir werden ein Stück zurückfahren und uns in einer Flußmündung verbergen. Der Großen Schildkröte senden wir eine Botschaft, daß er und seine Krieger sich dem Dorf fernhalten sollen. Sie können ihr Lager weiter hinten an einer der Pflanzungen aufschlagen, sie sollen jedoch darauf achten, daß sie niemand sieht. Dann lassen wir einige Späher auf hohe Bäume klettern und Ausschau halten, ob sich die Kariben wirklich davonmachen. Bleiben sie hier, dann können wir sie ja morgen in der Nacht angreifen.”
„Sie werden nicht hierbleiben", sagte Haiflschzahn.
In der Morgendämmerung meldeten die Späher, in dem Dorf am Reiherfluß seien weder Rauch noch andere Lebenszeichen zu bemerken. Adlerauge nahm ein Dutzend der besten Bogenschützen mit und schlich sich vorsichtig an das Dorf heran. Noch ehe sie den halben Weg hinter sich hatten, stießen sie auf eine Schar unbewaffneter Männer, Frauen und Kinder. Es waren Arowaken, ehemalige Sklaven der Kariben.
„Die Kariben sagten, wir wären frei und könnten gehen, wohin wir wollten", erklärte einer der Männer. „Sie sind gleich nach Mitternacht in ihren großen Kanus davongefahren. Sie sagten, die Arowaken würden künftig Ruhe vor ihnen haben, sie gedächten weit, weit wegzufahren, viele Mondzeiten weit, und nie zurückzukehren."
Er zeigte hinaus aufs Meer. Dort waren die letzten Karibenboote als kleine schwarze Punkte zu sehen.
Das war das letzte, was die Arowaken an der großen Meeresbucht für viele, viele Jahre von ihren Feinden sahen.
Sie bauten ihre Dörfer rasch wieder auf und legten neue, größere Pflanzungen in den Uferwäldern an.
In ihrer schönsten Medizinhütte verwahrten sie den Bogen des Kriegsgottes. Zwei der geschicktesten Weberinnen des Stammes fertigten ein schönes Futteral dafür an, und er wurde in Ehren gehalten, weil er dem Volk zum Frieden verholfen hatte.
Adlerauge, Grauer Reiher, Feuersteinherz und Haifischzahn wurden zu Häuptlingen ernannt. Einige Jahre später teilte sich der Stamm, und die einzelnen Gruppen ließen sich an verschiedenen Stellen nieder.
Haifischzahn und seine kleine Gruppe fühlten sich draußen im Meer am wohlsten, deshalb fuhren sie auf die Inseln hinaus und wurden dort seßhaft. Aber die Inseln waren nicht groß genug, um viel darauf anzubauen; daher lebten die Bewohner größtenteils vom Fischfang. Später kehrte eine Anzahl von ihnen in Sägefischs größtes Dorf zurück, das ein Stück landeinwärts in der Nähe der großen Seen angelegt worden war. Dort wohnen sie noch heute.
Adlerauge, Grauer Reiher und Feuersteinherz nahmen einen Teil des Stammes mit sich und fuhren den großen Fluß hinauf. Man gab ihnen den heiligen Bogen mit, und dieser wurde schließlich in einem steinernen Tempel auf dem Berg der Gewittergöttin aufgehängt.
Wie der Bogen des Kriegsgottes jedoch dorthin gelangte und wie es kam, daß Adlerauge dem Volk, das Hügel baute, dem Volk, das auf Bäumen wohnte und dem Volk der Boaschlange sowie der Priesterin Pacurtú-né begegnete und wie er mit dem Ungeheuer Nusi kämpfte das ist eine andere Geschichte.
Nachschrift
Die Handlung dieses Buches spielt einige Jahre vor der ersten Reise des Kolumbus — in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts. Das Gebiet, das darin geschildert wird, liegt an der Nordküste der Republik Kolumbia, und zwar zwischen der Stadt Cartagena und der Mündung des Flusses Sinú. Die große Meeresbucht heißt jetzt Golf von Morrosquillo, der von mir genannte „Reiherfluß" ist der Strom Pechilin, und heute befindet sich dort das Dorf Tolú, wo einst die alte Wohnstätte der Bocanás war.
Die „Flache Landzunge" ist das Cabo San Bernardo, und die Inseln, zu denen die Bocanás ihre Zuflucht nahmen, gehören zu der San-Bernardo-Gruppe.
Eben in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts fanden unter den Indianerstämmen an der Küste des nördlichen Südamerikas und draußen auf den Antillen gewisse Umgruppierungen statt. Die Karibenindianer, die offenbar aus dem heutigen Venezuela und Guyana kamen, drangen an der Küste entlang von Insel zu Insel vor. Zu der Zeit vor der ersten Reise des Kolumbus hatten sie bereits Puerto Rico bevölkert, waren jedoch noch nicht über die Meerenge nach Haiti vorgedrungen.
Viele der Völker, die sich langsam vor den Kariben zurückzogen, wurden Arowaken genannt. Eine Anzahl heutiger Forscher erhebt Einspruch gegen diesen Namen; sie halten ihn aus gewissen Gründen für nicht zutreffend. Ob man die Bocaná-Indianer wirklich Arowaken nennen kann, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen; sie scheinen jedenfalls dem Kulturkreis angehört zu haben, den man gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet und zu dem vermutlich auch die Ahnen der Goajira-Indianer gehörten, ehe sie ein Hirtenvolk wurden. Die Gegend um den Golf von Morrosquillo und den Unterlauf des Flusses Sinü war offenbar eine Art Mittelpunkt und Versammlungsplatz verschiedener Indianervölker. Ausgrabungen, die von dem hervorragenden Archäologen und bekannten Erforscher der Indianer Kolumbiens, Professor Gerard Reichel-Dolmatoff, vorgenommen wurden, zeigten, daß sich in der Gegend um Tolúviejo und um das Dorf Las Piedras nicht weniger als drei Kulturen begegnet sind — nur etwa zwanzig bis dreißig Kilometer von dem heutigen Dorf Tolú entfernt. Eine Stelle in der Nähe des Momil-Sees und nahe am Unterlauf des Sinú ist, wie die Ausgrabungen zeigen, dreitausend Jahre lang so gut wie ohne Unterbrechung besiedelt gewesen. Das dürfte die längste ununterbrochene Kulturperiode sein, die man gegenwärtig in diesem Teil Südamerikas kennt. Dort kann man beobachten, wie neue Kulturelemente hinzugekommen sind, wie ein Stamm von Maniokbauern den Anbau von Mais lernte, wie man neue Geräte anzuwenden begann und so weiter.
Ich schulde Professor Reichel-Dolmatoff Dank für viele Hinweise und dafür, daß er mir großzügig Einblick in sein ungemein reichhaltiges Material gestattete und mich an mehreren seiner Forschungsreisen teilnehmen ließ, unter anderen an den Betanci-See und an den oberen Sinú. Ich muß jedoch darauf hinweisen, daß ich keinerlei Anspruch auf ethnologisches, archäologisches und ethnographisches Fachwissen erhebe und daß Fachspezialisten manches finden können, was einer Berichtigung bedarf. Einem intensiv arbeitenden Zoologen bleibt leider nicht viel Zeit für eingehendere Studien auf anderen Wissensgebieten.
Was die natürliche Umgebung angeht, besonders die Tier- und Pflanzenwelt, so mag vielleicht der Hinweis genügen, daß ich als Naturforscher insgesamt fünfzehneinhalb Jahre in diesen und den angrenzenden Gebieten tätig gewesen bin, hauptsächlich in den heutigen Departements Bolivar und Cordoba.
Was die Schilderung der Indianer und ihres täglichen Lebens betrifft, so sind meine Quellen zum großen Teil die noch heute lebenden Indianerstämme gewesen, die die wesentlichen Dinge ihrer ursprünglichen Kultur beibehalten haben. Kurz vor dem zweiten Weltkriege lebte ich zwei Jahre hintereinander als Mitglied eines Stammes der Choc6-Indianer in der Gegend um die Quellgebiete des Rio Tarazá und des Rio San Jorge, und danach habe ich verschiedentlich kürzere Perioden — von ein paar Wochen bis zu mehreren Monaten — unter den Engverá- und Tuchin-Indianern gelebt. Kontakte mit anderen Stämmen haben dabei nicht gefehlt.
Sicher ist das, was ich geschrieben habe, in hohem Grade von den eigenen Erlebnissen unter meinen indianischen Freunden geprägt und bessere Freunde als die freien Waldindianer kann man lange suchen.
Wenn die Indianer nach der Arbeit des Tages am Feuer sitzen — insbesondere in den Jagd- und Fischlagern während der Streifzüge in der Trockenzeit —, geschieht es oft, daß einer von den Älteren Geschichten und alte Sagen erzählt. Da sie nicht schreiben können, müssen sie dieses Verfahren anwenden, um den Sagenschatz einer Gruppe der ja ihre Literatur ist — durch die Jahrhunderte am Leben zu erhalten.
Wenn ein neues Stammesglied geweiht wird oder gerade die Proben für die Weihe abgelegt hat, muß ihm entweder sein Vater (oder bei einer Anzahl von Stämmen sein Onkel mütterlicherseits) oder einer von den „weisen Männern" des Stammes Unterricht in den Dingen erteilen, die ein Indianer wissen muß.
Nachdem ich sozusagen zum Choc6-Indianer „ernannt" worden war, wurden der Medizinmann Mari-gamá und sein Sohn Hai-námbi von der Boaschlangengruppe, später Do-chamá von der Eichhörnchengruppe und der Medizinmann Du-lá von der Eisvogelgruppe meine Lehrer. Vieles habe ich ihnen zu verdanken. Auch viele andere haben Sagen und Legenden erzählt. Ein Motiv, das zuweilen in diesen
Sagen auftaucht, ist der „Bogen der Macht", der in dieser Erzählung zum Bogen des Kriegsgottes Keb geworden ist. Ich hörte sie
von Du-lá erzählen, als wir eines Tages an einem kleinen Waldfluß mit Pfeil und Bogen Fische jagten. Hai-námbi, der mein „Geistesbruder" war, erzählte die Sagen von Carrauta — über die
ich in meinem nächsten Buch schreiben werde —, als wir die ganze Nacht hindurch in unserem Jagdlager oben an den Ausläufern der Westanden saßen und das Fleisch eines eben geschossenen Bären räucherten.
Wenn auch vieles in diesem Buch in der Wirklichkeit verankert ist, so beruht natürlich mancherlei auf Vermutungen. Die Personen sind mehr oder weniger nach Indianern gestaltet, die ich gekannt habe und mit denen ich befreundet war.
Als Junge las ich mit Begeisterung die Indianerbücher Coopers und anderer Verfasser. Sie waren schön, ich habe sie immer wieder gelesen. Vielleicht war das Schöne an ihnen, daß die Schreiber mit den Dingen vertraut waren, die sie schilderten. Dann kamen andere, denen ich keine Freude abgewinnen konnte, weil mir in ihren Büchern alles unwirklich vorkam. Es schienen Leute zu sein, die nie an einem Lagerfeuer im Walde oder in der Savanne gesessen, nie eine Spur in unbekanntem Gelände verfolgt und nie gefühlt hatten, wie sehr es von ihren Eigenschaften als Jäger oder Fischer abhing, ob sie heute essen oder hungrig herumlaufen würden. So entschloß ich mich schließlich, den Versuch zu unternehmen, ein Buch über die freien Indianer in ihrer natürlichen Umgebung zu schreiben, und so entstand „Adlerauge und der Bogen des Kriegsgottes". Wenn junge Menschen Freude daran finden, dann ist dies reicher Lohn für meine Mühe.
Georg Dahl
Anmerkungen
Die Inseln Die Gruppe heißt heute Islas de San Bernardo und liegt ungefähr 10° nördlicher Breite und 76° westlicher Länge vor Punta Boquerón an der Nordküste von Kolumbien.
Mangrove Gemeinsamer Name mehrerer tropischer Bäume und Büsche, die in Salzwasser gedeihen: Schwarze Mangrove (Avicennia nitida), weiße Mangrove (Laguncularia recemosa), rote Mangrove (Rhizophora mangle).
Ceiba Gemeint ist Bombax ceiba. Hoher Baum. Ziemlich leichtes Holz.
Strandtraube Coocolobis uvifera. Busch (selten Baum) mit großen runden Blättern und eßbaren Früchten.
Divi-divi Caesalpinia coriaria. Urwaldbaum. Die Früchte liefern einen Farbstoff.
Zaragocilla Baum, ähnlich der roten Mangrove. Holz sehr hart (Conocarpus erecta).
Bataten oder Süßkartofieln Ipomoea batatas. Schlingpflanze mit eßbaren Wurzelknollen.
Manioc, Manibot utilissima Pflanze mit nährstoffreichen Wurzelknollen. Der Saft ist giftig, besonders von einer der beiden angebauten Formen.
Baummelonen oder Papaya Carica papaya. Schnell wachsender Baum mit sprödem Stamm, wächst in den Tropen in einigen wenigen Monaten zu voller Größe. Die Frucht ähnelt einer länglichen Melone, ist jedoch süßer.
Caracoli Anacardium excelsum. Großer und dichtbelaubter Urwaldbaum, dessen Holz leicht zu bearbeiten ist.
Caimancillo oder Caimitillo Chtysophyllum oliviforme. Urwaldbaum mit schwerem, sehr hartem Holz.
Übersetzung aus dem Schwedischen
von A. O. Schwede
Originaltitel:
Örnöga och krigsgudens bäge
Illustrationen von Erhard Schreier
© Georg Dahl 1958
Alle Rechte vorbehalten
Printed in the German Democratic Republic
Lizenz-Nr. 304-270/45/70-(10)
Satz und Druck: Karl-Marx-Werk Pößneck V 15/30 - 1. Auflage
ES 9 D 3
Für Leser von 10 Jahren an