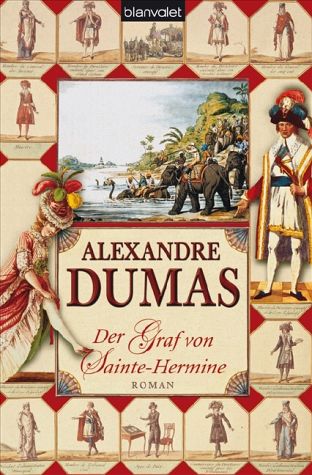
Hector de Sainte-Hermine sitzt zwischen den Stühlen: Er hat geschworen, seine Familie zu rächen, die von der Französischen Revolution ausgelöscht wurde, doch irgendwie begeistert ihn dieser Napoleon Bonaparte auch, der Frankreich nun mit großem Enthusiasmus regiert. Seine Zerrissenheit führt ihn in die entlegensten Ecken der Welt, als Freibeuter, Abenteurer und schließlich als Waffengefährte Napoleons in die Schlacht von Trafalgar. Der letzte und unvollendete Roman von Alexandre Dumas wartet mit allem auf, was man vom Großmeister der Mantel-und-Degen-Geschichten erwartet: Rasante Kampfszenarien und romantisch-sehnsüchtigen Liebesgeschichten wechseln sich ab mit politischen und philosophischen Ausführungen. Erst 1990 wurde die Manuskripte des als Fortsetzungsroman angelegten Buchs entdeckt, der französische Forscher Claude Schopp puzzelte die Einzelteile zusammen. Er versah die Erzählung dann auch mit einem Anhang, der dem scheinbar auf ewig unvollendeten Roman doch noch ein würdiges Ende setzt. Spannender Lesestoff, der bald verfilmt werden dürfte - wahrscheinlich mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Le Chevalier de Sainte-Hermine« bei Éditions Phébus, Paris.
Der Graf von Sainte-Hermine
1
Joséphines Schulden
»Da wären wir also in den Tuilerien«, sagte der Erste Konsul zu seinem Sekretär Bourrienne, als sie den Palast betraten, der die vorletzte Station Ludwigs XVI. zwischen Versailles und dem Schafott gewesen war. »Jetzt liegt es an uns, dort zu bleiben.«
Diese schicksalsträchtigen Worte fielen gegen vier Uhr nachmittags am 30. Pluviôse des Jahres VIII, dem 19. Februar 1800.
Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Einzug des Ersten Konsuls in den Tuilerienpalast beginnt unsere Geschichte, die sowohl mein Buch Les Blancs et les Bleus fortsetzt (dessen Ende, wie man sich erinnern wird, Pichegrus Flucht aus Sinnamary bildet) als auch meinen Roman Les Compagnons de Jéhu (den die Hinrichtung Ribiers, Jahiats, Valensolles’ und Sainte-Hermines beschließt).
General Bonaparte – damals noch General – ließen wir in dem Augenblick zurück, als er nach seinem Ägyptenfeldzug erstmals wieder französischen Boden betrat. Seit dem 24. Vendémiaire des Jahres VII (16. Oktober 1799) war er nicht untätig geblieben.
Zuerst hatte er den 18. Brumaire inszeniert; diesen aufsehenerregenden Prozess gewann er zwar in erster Instanz, doch ein Berufungsverfahren durch die Nachwelt ist heute noch anhängig.
Danach überschritt er die Alpen wie Hannibal oder Karl der Große.
Dann gewann er mithilfe von Desaix und Kellermann zu guter Letzt die Schlacht von Marengo, die er eigentlich verloren hatte.
Darauf schloss er den Frieden von Lunéville.
Und schließlich führte er just an dem Tag, an dem er David im Tuilerienpalast die Büste des Brutus aufstellen ließ, die Anrede »Madame« wieder ein.
Den Unbelehrbaren steht es frei, weiterhin Citoyen zu sagen, doch Citogenne sagen von nun an nur noch Rüpel und Bauernlümmel. Dass im Tuilerienpalast nur feine Leute verkehren, versteht sich von selbst.
Wir befinden uns also am 30. Pluviôse des Jahres IX, anders gesagt: am 19. Februar 1801, im Tuilerienpalast, Wohnsitz des Ersten Konsuls Bonaparte.
Wir wollen versuchen, der gegenwärtigen Generation, die bereits zwei Drittel eines Jahrhunderts von jener Epoche trennen, eine Vorstellung von diesem Kabinett zu vermitteln, in dem so viele Ereignisse ihren Anfang nahmen, und uns nach besten Kräften bemühen, mit der Feder das Porträt des sagenumwobenen Mannes zu zeichnen, der darauf sinnt, nicht allein Frankreich zu verändern, sondern die ganze Welt umzustürzen.
Das Kabinett war ein großes Zimmer, weiß gestrichen, mit vergoldeten Stukkaturen, und enthielt zwei Tische.
Der eine – ausnehmend schön – war für den Ersten Konsul bestimmt, der mit dem Rücken zum Kamin daran zu sitzen pflegte, zu seiner Rechten das Fenster. Ebenfalls zu seiner Rechten hielt sich in einem Nebenraum Duroc auf, Bonapartes persönlicher Adjutant seit vier Jahren. Durch diesen Raum gelangte man in die Schreibstube, in der Landoire arbeitete, ein treuer Bediensteter, der das Vertrauen des Ersten Konsuls genoss, und in die Prachtgemächer mit Blick in den Hof.
Wenn der Erste Konsul in seinem Sessel mit Löwenkopfornamenten, dessen rechte Lehne er so manches Mal mit dem Federmesser malträtiert, am Schreibtisch sitzt, hat er eine gewaltige Bibliothek vor Augen, von oben bis unten voller Kisten und Kartons.
Ein wenig rechts von der Bibliothek befindet sich die zweite große Flügeltür des Kabinetts. Sie führt unmittelbar in ein Paradeschlafzimmer. Aus diesem Schlafzimmer gelangt man in den großen Empfangssalon, an dessen Decke Le Brun Ludwig XIV. im Galakostüm gemalt hat. Ein zweiter Maler von fraglos geringerem Können war so frech, die Perücke des großen Königs mit einer Kokarde in den Farben der Trikolore zu verzieren, was Bonaparte so belassen hat, damit er Besucher auf diese Ungehörigkeit hinweisen und selbstgefällig äußern kann, was für Dummköpfe die Mitglieder des Konvents doch gewesen seien.
Gegenüber dem einzigen Fenster dieses großen Raumes, aus dem man in den Garten sieht, schließt sich ein Ankleideraum an, der zum Privatgemach des Konsuls führt und bei dem es sich um nichts Geringeres handelt als die persönliche Kapelle der Maria von Medici. Von dort gelangt man zu einer kleinen Treppe, die im Schlafzimmer Madame Bonapartes endet, das im Zwischengeschoss liegt.
Wie Marie-Antoinette, der sie in mehr als einer Hinsicht ähnelte, verabscheute Joséphine die großen Prunkgemächer. Deshalb hatte sie sich im Tuilerienpalast eine kleine Zuflucht geschaffen, nicht unähnlich den Privaträumen Marie-Antoinettes in Versailles.
Aus diesem Ankleideraum trat der Erste Konsul zu jener Zeit fast ausnahmslos, wenn er morgens sein Arbeitszimmer aufsuchte – fast ausnahmslos, denn hier, in den Tuilerien, ließ er sich zum ersten Mal ein eigenes Schlafzimmer einrichten, in das er sich zurückzog, wenn es zu spät wurde oder wenn Zwistigkeiten im Verlauf des Abends zu einem Disput und zu ehelichem Schmollen geführt hatten, Zwistigkeiten, wie sie sich, wenngleich noch selten, bemerkbar zu machen begannen.
Der zweite, überaus bescheidene Schreibtisch stand nahe am Fenster. Der Sekretär, der dort arbeitete, blickte auf das dichte Laub der Kastanienbäume; wenn er die Spaziergänger im Garten sehen wollte, musste er sich von seinem Stuhl erheben. Er saß mit dem Rücken zum Profil des Ersten Konsuls, so dass es nur einer leichten Kopfbewegung bedurfte, wenn Bonaparte ihm ins Gesicht sehen wollte. Da Duroc sich nur selten in seinem Kabinett aufhielt, gab der Sekretär dort seine Audienzen.
Dieser Sekretär ist Bourrienne.
Die gewandtesten Maler und Bildhauer haben darin gewetteifert, Bonapartes und später Napoleons Züge auf die Leinwand zu bannen oder in Marmor zu meißeln. Doch die Menschen aus seiner nächsten Umgebung behaupten, es gebe kein Bildnis des Empereurs von vollkommener Ähnlichkeit, obwohl sie die Züge dieses außergewöhnlichen Menschen an Statuen und Porträts sehr wohl wiedererkennen.
Zur Zeit seines Konsulats konnte man seinen auffälligen Schädel malen oder in Stein hauen, seine herrliche Stirn, seine an den Schläfen klebenden und auf die Schultern fallenden Haare, sein mageres, längliches, sonnenverbranntes Gesicht und den nachdenklichen Gesamteindruck, den er ausstrahlte.
Zur Kaiserzeit konnte man einen Kopf abbilden, der wie eine antike Medaille aussah; man konnte auf die Wangen die krankhafte Blässe auftragen, die einen vorzeitigen Tod verhieß, die Haare ebenholzschwarz färben, um die Farblosigkeit der Wangen zu betonen, doch weder Meißel noch Palette verstanden es jemals, das rastlose Feuer seiner Augen oder den düsteren Ausdruck seines Blicks auszudrücken, wenn er sich auf etwas heftete.
Dieser Blick gehorchte dem Willen des Mannes so geschwind wie ein Blitz. Im Zorn war kein Blick erschreckender, in der Güte kein Blick zärtlicher als der seine.
Man hätte meinen können, für jeden der Gedanken, die in seinem Inneren aufeinanderfolgten, hätte er einen eigenen Gesichtsausdruck gehabt. Er war von kleinem Wuchs, kaum einen Meter und siebzig, doch Kléber, der ihn um einen Kopf überragte, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: »General! Sie sind so groß wie der Größte!« Und wahrhaftig sah er aus, als wäre er einen Kopf größer als Kléber.
Er hatte ausnehmend schöne Hände; darauf war er stolz, und er pflegte sie wie eine Frau. Beim Gespräch betrachtete er sie voller Selbstgefälligkeit; er zog stets nur den linken Handschuh an und ließ die Rechte unbekleidet unter dem Vorwand, jenen, denen er die Hand reichte, eine besondere Ehre zu erweisen, in Wahrheit jedoch, um sie zu betrachten und sich mit einem Batisttaschentuch die Nägel zu polieren.
Monsieur de Turenne, zu dessen Obliegenheiten die Kleidung des Kaisers gehörte, ließ zuletzt nur noch linke Handschuhe für ihn anfertigen, wodurch er jährlich sechstausend Francs sparte.
Ruhe war ihm unerträglich; sogar in seinen Privaträumen wanderte er auf und ab. Er beugte sich dabei leicht vor, als drücke das Gewicht der Gedanken sein Haupt nieder, und hielt die Hände auf dem Rücken gefaltet, ohne zu posieren. Versunken in die Gedanken, denen er sich bei diesen Spaziergängen überließ, zuckte er oft unwillkürlich mit der rechten Schulter und verzog den Mund.
Diese nervösen Tics, eine harmlose Marotte, wurden von manchen für krankhafte Zuckungen gehalten, denn es ging das Gerücht, Bonaparte leide an epileptischen Anfällen.
Das Baden war ihm eine regelrechte Leidenschaft: Er verbrachte zwei bis drei Stunden in der Wanne, ließ sich dort die Zeitungen vorlesen und Pamphlete, die ihm die Polizei gemeldet hatte. Wenn er in der Wanne saß, ließ er ununterbrochen heißes Wasser nach, ohne sich darum zu scheren, ob die Wanne überfloss. Wenn Bourrienne es vor lauter feuchtem Wasserdampf nicht mehr aushielt, bat er darum, das Fenster öffnen zu lassen oder sich zurückziehen zu dürfen. Im Allgemeinen wurde seiner Bitte stattgegeben.
Unabhängig von allen betreffenden Gerüchten schlief Bonaparte gern; oft genug sagte er klagend zu seinem Sekretär, der ihn um sieben Uhr weckte: »Ach! Lassen Sie mich noch einen Augenblick schlafen!« Und er sagte: »Betreten Sie mein Schlafzimmer nachts so selten wie möglich; wecken Sie mich nie einer guten Nachricht wegen – gute Nachrichten sind nicht eilig; aber wecken Sie mich auf der Stelle, wenn es eine schlechte Nachricht gibt, denn dann darf man keine Zeit verlieren.«
Sobald Bonaparte aufgestanden war, rasierte und frisierte ihn sein Kammerdiener Constant. Während der Rasur las Bourrienne ihm die Zeitungen vor, wobei der Moniteur stets den Anfang machte; Aufmerksamkeit schenkte Bonaparte ohnedies nur englischen und deutschen Blättern. Wenn Bourrienne den Namen einer der zehn oder zwölf französischen Zeitungen jener Zeit nannte, sagte er: »Weiter, weiter, die drucken nur das, was ich ihnen erlaube.«
Wenn Bonaparte angekleidet war, begab er sich mit Bourrienne in sein Kabinett. Dort lagen die Briefe des Tages zum Lesen und die Berichte des Vortags zum Abzeichnen. Er las und gab an, welche Antworten er wünschte, und danach zeichnete er die Berichte ab.
Um Punkt zehn Uhr wurde die Tür geöffnet, und der Diener verkündete: »Es ist angerichtet für den Herrn General!«
Das schlichte Frühstück bestand aus drei Gängen und einem Dessert. Einer der Gänge war fast immer ein Hühnergericht mit Olivenöl und Zwiebeln, ähnlich dem Gericht, das man Bonaparte zum ersten Mal am Morgen der Schlacht von Marengo serviert hatte und das seither »Hühnchen Marengo« heißt.
Bonaparte trank wenig Wein, ausschließlich Bordeaux und Burgunder, und nach dem Frühstück und dem Diner nahm er eine Tasse Kaffee.
Wenn er nachts länger als üblich arbeitete, brachte man ihm gegen Mitternacht eine Tasse Schokolade.
Schon früh am Tag schnupfte er Tabak, beschränkte sich allerdings auf drei oder vier Prisen täglich, kleine Prisen aus sehr eleganten goldenen oder emaillierten Tabaksdosen.
An besagtem Tag war Bourrienne wie gewöhnlich um halb sieben in sein Kabinett gekommen, hatte die Briefe geöffnet und auf dem großen Schreibtisch angeordnet, die wichtigsten zuunterst, damit Bonaparte sie als letzte las und sie ihm im Gedächtnis haften blieben.
Dann, als die Wanduhr sieben Uhr schlug, sagte er sich, dass es Zeit sei, den General zu wecken.
Zu seinem großen Erstaunen hatte er jedoch Madame Bonaparte allein im Bett und in Tränen aufgelöst vorgefunden.
Es muss kaum eigens gesagt werden, dass Bourrienne einen Schlüssel zu Bonapartes Schlafgemach besaß und den Raum zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufsuchen konnte.
Als er Joséphine allein und in Tränen vorfand, wollte er sich zurückziehen. Joséphine aber, die Bourrienne gernhatte und wusste, dass sie sich auf ihn verlassen konnte, winkte ihn her und bat ihn, sich zu setzen.
Besorgt trat er näher.
»Madame«, sagte er, »ist dem Ersten Konsul vielleicht etwas zugestoßen?«
»Nein, Bourrienne, nein«, erwiderte Joséphine. »Es geht um mich, nicht um ihn...«
»Und worum, Madame?«
»Ach, mein lieber Bourrienne! Ich bin so unglücklich!«
Bourrienne konnte sich das Lachen nicht verbeißen. »Ich wette, ich weiß, worum es geht«, sagte er.
»Meine Lieferanten...«, stammelte Joséphine.
»Weigern sich, Sie weiterhin zu beliefern?«
»Ach! Wenn es weiter nichts wäre!«
»Sie sind doch nicht etwa so unverschämt zu erwarten, dass man sie bezahlt?«, fragte Bourrienne lachend.
»Sie drohen mir, mich gerichtlich zu verfolgen! Stellen Sie sich meine Ratlosigkeit vor, mein lieber Bourrienne, wenn Bonaparte eine gerichtliche Zahlungsaufforderung in die Hände fiele!«
»Das würden sie nie und nimmer wagen!«
»Ich weiß es leider besser.«
»Das kann ich nicht glauben.«
»Sehen Sie selbst!« Und Joséphine holte unter ihrem Kissen ein Blatt Papier mit dem Briefkopf der Republik hervor.
Es war eine gerichtliche Zahlungsaufforderung an den Ersten Konsul über den Betrag von vierzigtausend Francs, zahlbar für Handschuhe, geliefert an seine Ehefrau Madame Bonaparte.
Der Zufall hatte die Mahnung von ihrem Empfänger abgelenkt und der Ehefrau in die Hand gespielt. Sie war im Namen einer Madame Giraud erhoben.
»Zum Teufel!«, sagte Bourrienne. »Damit ist nicht zu spaßen! Haben Sie Ihrem gesamten Hofstaat erlaubt, sich bei dieser Dame auszustatten?«
»Nein, mein lieber Bourrienne. Diese Handschuhe für vierzigtausend Francs waren nur für mich.«
»Nur für Sie?«
»Ja.«
»Aber dann haben Sie seit zehn Jahren keine Rechnungen mehr bezahlt, oder?«
»Ich habe mich mit meinen Lieferanten geeinigt und sie alle am ersten Januar des vergangenen Jahres bezahlt, alles in allem an die dreihunderttausend Francs. Und weil ich mich so gut an Bonapartes Zornesausbruch damals erinnere, mache ich mir heute so große Sorgen.«
»Und seit dem ersten Januar vergangenen Jahres haben Sie Handschuhe für vierzigtausend Francs benötigt?«
»So scheint es zu sein, Bourrienne, wenn man diesen Betrag von mir verlangt.«
»Hm! Und was soll ich jetzt tun?«
»Wenn Bonaparte heute Morgen gute Laune hat, dann wünschte ich, Sie könnten diskret die Situation andeuten.«
»Warum ist er eigentlich nicht bei Ihnen? Hat es Streit zwischen Ihnen gegeben?«, fragte Bourrienne.
»Nein, ganz und gar nicht. Gestern Abend ging er in bester Laune mit Duroc aus, um die Stimmung der Pariser zu taxieren, wie er es nennt. Er wird spät zurückgekommen sein, und um mich nicht zu wecken, hat er in seinem Junggesellenzimmer geschlafen.«
»Und wenn er gute Laune hat und ich Ihre Schulden anspreche und er mich fragt, auf welche Höhe sie sich belaufen, was sage ich ihm dann?«
»Ach! Bourrienne!« Joséphine versteckte den Kopf unter der Bettdecke.
»Der Betrag ist also erschreckend hoch?«
»Entsetzlich hoch.«
»Und wie viel ist es?«
»Ich wage es Ihnen nicht zu sagen.«
»Dreihunderttausend Francs?«
Joséphine seufzte.
»Sechshunderttausend?«
Ein erneuter Seufzer Joséphines, ausdrücklicher als zuvor.
»Ich muss gestehen, dass Sie mir Angst machen«, sagte Bourrienne.
»Ich habe die ganze Nacht gerechnet, mit meiner Freundin Madame Hulot, die sich hervorragend darauf versteht, denn wie Sie wissen, lieber Bourrienne, verstehe ich von der Rechenkunst überhaupt nichts.«
»Und Sie schulden?«
»Mehr als zwölfhunderttausend Francs.«
Bourrienne zuckte unwillkürlich zurück. »Sie haben recht«, sagte er, diesmal ohne zu lachen, »der Erste Konsul wird vor Zorn außer sich sein.«
»Wir sagen ihm einfach nur die Hälfte«, sagte Joséphine.
»Ganz schlecht«, sagte Bourrienne und schüttelte den Kopf. »Sagen Sie ihm alles, wenn Sie es schon ansprechen, das rate ich Ihnen.«
»Nein, Bourrienne, nein, niemals!«
»Aber wie wollen Sie die zweiten sechshunderttausend Francs aufbringen?«
»Ach! Als Erstes mache ich nie wieder Schulden, denn das macht einen wirklich zu unglücklich.«
»Und die sechshunderttausend Francs?«, wiederholte Bourrienne.
»Ich werde sie nach und nach mit meinen Ersparnissen abtragen.«
»Sie irren sich. Der Erste Konsul, der auf die gewaltige Summe von sechshunderttausend Francs nicht gefasst ist, wird sich über zwölfhunderttausend Francs nicht mehr aufregen als über sechshunderttausend, ganz im Gegenteil: Je heftiger der Schlag, desto betäubter wird er sein. Er wird Ihnen die zwölfhunderttausend Francs geben, und Sie sind Ihrer Sorgen ledig.«
»Nein, nein«, rief Joséphine, »versuchen Sie mich nicht zu überreden, Bourrienne. Ich kenne ihn, er würde in einen fürchterlichen Zorn geraten, und ich kann es nicht ertragen, wenn er tobt und wütet.«
Im selben Augenblick ertönte die Klingel, mit der Bonaparte den Büroschreiber rief, zweifellos um zu erfahren, wo sich Bourrienne befand.
»Hören Sie?«, sagte Joséphine. »Er ist schon in seinem Arbeitszimmer. Gehen Sie schnell zu ihm, wenn er gute Laune hat – Sie wissen schon...«
»Zwölfhunderttausend Francs, richtig?«, fragte Bourrienne.
»Nein, sechshunderttausend Francs, um Gottes willen, keinen Sou mehr!«
»Sind Sie ganz sicher?«
»Ich flehe Sie an!«
»Wohlan.«
Und Bourrienne eilte die kleine Treppe empor, die in das Kabinett des Ersten Konsuls führte.
2
Wie es dazu kam, dass die Freie und Hansestadt Hamburg Joséphines Schulden bezahlte
Als Bourrienne in das große Kabinett zurückkehrte, sah er den Ersten Konsul neben seinem Schreibtisch die Morgenpost lesen, die Bourrienne bereits geöffnet und vorbereitet hatte.
Bonaparte trug die Uniform eines Divisionsgenerals der Republik: blauer Rock ohne Epauletten mit einem einzelnen umlaufenden goldenen Lorbeerzweig, hirschlederne Kniehose, rote Weste mit breiten Aufschlägen und Stulpenstiefel.
Als er das Geräusch der Schritte seines Sekretärs vernahm, drehte er sich halb um. »Ah, Bourrienne, Sie sind es«, sagte er. »Ich habe nach Landoire geklingelt, damit er Sie ruft.«
»Ich war zu Madame Bonaparte gegangen, weil ich Sie dort wähnte, General.«
»Nein, ich habe im Paradeschlafzimmer übernachtet.«
»Hoho!«, sagte Bourrienne. »Im Bett der Bourbonen!«
»Meiner Treu, ja.«
»Und wie haben Sie darin geschlafen?«
»Schlecht; zum Beweis bin ich hier, ohne dass Sie mich wecken mussten. Das ist alles viel zu weich für mich.«
»Haben Sie die drei Briefe gelesen, die ich für Sie beiseitegelegt habe, General?«
»Ja, die Witwe eines Feldwebels der konsularischen Garde, der bei Marengo gefallen ist, bittet mich, die Patenschaft ihres Kindes zu übernehmen.«
»Was soll ich ihr antworten?«
»Dass ich annehme. Duroc wird mich vertreten; das Kind wird Napoléon heißen, und die Mutter erhält eine Leibrente von fünfhundert Francs, übertragbar auf ihren Sohn.«
»Und der, die im Glauben an Ihr Glück drei Zahlen für die Lotterie von Ihnen genannt haben will?«
»Das ist eine Verrückte; aber da sie auf meinen Stern vertraut und davon überzeugt ist zu gewinnen, wenn ich ihr die drei Zahlen nenne, obwohl sie noch nie gewonnen hat, werden Sie ihr antworten, dass man nur an den Tagen in der Lotterie gewinnt, an denen man nicht spielt, und der Beweis besteht darin, dass sie an keinem der Tage, an denen sie gespielt hat, in der Lotterie gewonnen hat, dafür aber an dem Tag, an dem sie vergaß zu spielen, und zwar dreihundert Francs.«
»Ich schicke ihr also dreihundert Francs?«
»Ja.«
»Und der letzte Brief, General?«
»Ich begann ihn zu lesen, als Sie eintraten.«
»Lesen Sie weiter, er wird Sie interessieren.«
»Lesen Sie ihn mir vor; die Schrift ist zittrig und ermüdet mein Auge.«
Bourrienne ergriff lächelnd den Brief.
»Ich weiß, warum Sie lachen«, sagte Bonaparte.
»Oh, das glaube ich nicht, General«, erwiderte Bourrienne.
»Sie denken sich, dass jemand, der meine Schrift entziffern kann, jede Schrift lesen kann, sogar die von Katzen und Staatsanwälten.«
»Meiner Treu, da haben Sie recht.«
Bourrienne begann:
Jersey, 26. Februar 1801
General, ich hoffe, Sie nach der Rückkehr von Ihren weiten Reisen in Ihrem Alltag stören zu dürfen, ohne Ihnen lästig zu fallen, und mich Ihnen in Erinnerung zu bringen. Es wird Sie wohl überraschen, welch unbedeutende Sache Gegenstand des Briefes ist, den Ihnen zu schreiben ich die Ehre habe. Sie werden sich erinnern, General, dass Ihr Herr Vater seinerzeit, als er sich genötigt sah, Ihre Brüder aus der Schule in Autun zu nehmen, und Sie bei dieser Gelegenheit in Brienne besuchte, kein Bargeld bei sich hatte. Er bat mich um fünfundzwanzig Louisdor, die ich ihm bereitwillig lieh; nach seiner Rückkehr hatte er keine Gelegenheit, sie mir zurückzugeben, und als ich Ajaccio verließ, bot mir Ihre gnädige Frau Mutter an, Silbergeschirr zu versetzen, um mir das Geld zu geben. Dieses Angebot lehnte ich ab und sagte zu ihr, wenn sie sich in der Lage sehe, es zu erstatten, würde ich den Schuldschein Ihres Vaters Monsieur Souires überlassen, so dass sie es nach eigenem Ermessen regeln könne. Ich nehme an, dass ihr dies noch nicht möglich erschien, als die Revolution kam.
Sie werden es vielleicht befremdlich finden, General, dass ich Sie um eines so geringen Geldbetrags wegen in Ihrer Tätigkeit zu stören wage, doch meine Lebensumstände sind hart, und dieser kleine Geldbetrag ist für mich ein großer Betrag geworden. Aus meinem Vaterland vertrieben, gezwungen, auf dieser Insel Zuflucht zu suchen, die mir verhasst ist, wo alles so kostspielig ist, dass man reich sein muss, um dort zu leben, empfände ich es als große Wohltat von Ihnen, wenn Sie mir diesen kleinen Betrag anweisen ließen, der mir in früheren Zeiten gleichgültig gewesen wäre.
Bonaparte nickte zustimmend. Bourrienne sah die Kopfbewegung.
»Sie erinnern sich an diesen wackeren Mann, General?«, fragte er.
»Gewiss«, sagte Bonaparte, »so gut, als wäre es gestern gewesen: Der Betrag wurde in meiner Gegenwart in Brienne abgezählt; er heißt Durosel, wenn ich mich nicht täusche.«
Bourrienne warf einen Blick auf die Unterschrift.
»In der Tat«, sagte er, »doch er hat einen zweiten Namen, der berühmter ist als der erste.«
»Und wie lautet er?«
»Durosel Beaumanoir.«
»Wir müssen herausfinden, ob er zu den bretonischen Beaumanoirs gehört; das ist ein Name, auf den man stolz sein kann.«
»Soll ich fortfahren?«
»Selbstverständlich.«
Bourrienne fuhr fort:
Sie werden verstehen, General, dass es einen Sechsundachtzigjährigen, der seinem Vaterland nahezu sechzig Jahre lang ohne Unterbrechung gedient hat, schwer ankommt, dass man ihm überall die Tür weist und er in Jersey Zuflucht suchen muss, um dort mit den spärlichen Mitteln sein Leben zu fristen, welche die Regierung den französischen Emigranten zur Verfügung stellt.
Ich sage: französische Emigranten, weil man mich gezwungen hat zu emigrieren; nicht im Traum wäre ich darauf verfallen, und ich habe mir kein anderes Vergehen vorzuwerfen als das, der dienstälteste General des Kantons und mit dem großen Ludwigskreuz ausgezeichnet gewesen zu sein.
Eines Abends wollte man mich ermorden; die Tür wurde eingetreten, doch durch das Geschrei meiner Nachbarn gewarnt, hatte ich gerade genug Zeit zu fliehen, ohne mehr mitzunehmen als das, was ich am Leibe trug. Da ich erkannte, dass es lebensgefährlich wäre, in Frankreich zu bleiben, ließ ich alles, was ich besaß, zurück, Vermögen wie Möbel, und da ich in meinem Vaterland nicht mehr sicher war, kam ich hierher zu meinem älteren Bruder, einem Deportierten, der kindisch geworden ist und den ich um nichts in der Welt im Stich lassen würde. Meiner achtzigjährigen Schwägerin hat man das Leibgedinge, das ich ihr aus meinem Besitz zukommen ließ, unter dem Vorwand vorenthalten, mein Besitz sei beschlagnahmt, was bedeutet, dass ich bankrott sterben werde, wenn kein Wunder geschieht, was ich sehr bezweifle.
Ich muss gestehen, General, dass ich mich auf den neuen Stil nicht verstehe, doch im alten Stil verbleibe ich als
Ihr ergebener Diener
DUROSEL BEAUMANOIR
»Wohlan! General, was sagen Sie?«
»Ich sage«, erwiderte der Erste Konsul mit leicht belegter Stimme, »dass es mich zutiefst erschüttert, dergleichen zu erfahren. Diese Schuld ist eine heilige Schuld, Bourrienne. Schreiben Sie General Durosel, ich werde den Brief unterzeichnen. Sie werden ihm zehntausend Francs schicken, bis wir mehr für ihn tun können, denn das bin ich diesem Mann schuldig, der meinem Vater geholfen hat; ich werde mich um ihn kümmern... Aber apropos Schulden, Bourrienne: Ich muss mit Ihnen über eine ernste Sache sprechen.«
Bonaparte setzte sich; seine Stirn verfinsterte sich.
Bourrienne blieb neben ihm stehen.
»Ich muss mit Ihnen über Joséphines Schulden sprechen.«
Bourrienne fuhr zusammen. »Sehr wohl«, sagte er. »Und wer hat Ihnen dazu geraten?«
»Die Stimme des Volkes.«
Bourrienne verbeugte sich, als verstehe er nicht ganz, wage aber nicht nachzufragen.
»Stell dir vor, Bourrienne« (wenn Bonaparte erregt war, kam es vor, dass er sich vergaß und seinen alten Kameraden duzte), »stell dir vor, ich habe mich mit Duroc unter die Leute gemischt, um zu hören, was geredet wird.«
»Und haben Sie viel Schlechtes über den Ersten Konsul zu hören bekommen?«
»Tatsächlich«, sagte Bonaparte lachend, »hätte ich fast Prügel bezogen, weil ich Schlechtes über ihn gesagt habe; ohne Duroc und die Hiebe, die er mit seinem Knüppel verteilt hat, wären wir wahrscheinlich festgenommen und der Polizeiwache von Château-d’Eau vorgeführt worden.«
»Aber das erklärt nicht, wie mitten unter den Lobreden auf den Ersten Konsul die Rede auf die Schulden Madame Bonapartes gekommen sein kann.«
»Mitten unter den Lobreden auf den Ersten Konsul wurden sehr wenig schmeichelhafte Dinge über seine Frau geäußert. Es hieß, Madame Bonaparte ruiniere ihren Mann mit ihren Toiletten, sie mache überall Schulden, das unscheinbarste ihrer Kleider koste hundert Louisdors und der schlichteste ihrer Hüte zweihundert Francs. Ich glaube kein Wort davon, Bourrienne, das weißt du; aber kein Rauch ohne Feuer. Letztes Jahr habe ich Schulden von dreihunderttausend Francs beglichen. Man hat sich darauf berufen, dass ich aus Ägypten kein Geld geschickt hatte. Schön und gut. Aber das hier ist eine andere Sache. Joséphine erhält von mir sechstausend Francs im Monat für ihre Toilette, und ich erwarte, dass sie damit auskommt. Mit übler Nachrede dieser Art wurde die arme Marie-Antoinette dem Volk verhasst gemacht. Du musst Joséphine zur Rede stellen, Bourrienne, und Ordnung in diese Geschichte bringen.«
»Sie können sich nicht vorstellen«, erwiderte Bourrienne, »wie froh ich bin, dass Sie von sich aus dieses Thema zur Sprache bringen. Heute Morgen, als Sie mich bereits ungeduldig erwarteten, bat mich Madame Bonaparte genau darum, mit Ihnen über die missliche Lage zu sprechen, in der sie sich befindet.«
»Missliche Lage, Bourrienne! Was verstehen Sie darunter?«, fragte Bonaparte, der seinen Sekretär jetzt nicht mehr duzte.
»Ich verstehe darunter, dass ihr das Leben schwer gemacht wird.«
»Und durch wen?«
»Durch ihre Gläubiger.«
»Ihre Gläubiger! Ich dachte, ich hätte sie von ihren Gläubigern befreit.«
»Vor einem Jahr, ja.«
»Nun?«
»Nun, die Situation hat sich im Verlauf dieses Jahres grundlegend geändert. Vor einem Jahr war sie die Ehefrau des Generals Bonaparte, heute ist sie die Ehefrau des Ersten Konsuls.«
»Bourrienne, damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Ich will nie wieder solche Dinge zu hören bekommen.«
»Das ist ganz meine Meinung, General.«
»Es darf kein anderer als Sie damit befasst sein, all diese Schulden zu bezahlen.«
»Ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Geben Sie mir die erforderlichen Mittel, und die Sache wird im Handumdrehen erledigt sein, dafür lege ich die Hand ins Feuer.«
»Wie viel benötigen Sie?«
»Wie viel ich benötige? Nun, ja, hm...«
»Nun?«
»Nun! Das ist genau das, was Madame Bonaparte Ihnen nicht zu sagen wagt.«
»Wie! Was sie mir nicht zu sagen wagt? Und du?«
»Ich genauso wenig, General.«
»Du auch nicht! Dann muss es bodenlos sein!«
Bourrienne seufzte hörbar.
»Alles in allem«, fuhr Bonaparte fort, »wenn ich letztes Jahr die Schulden bezahlt habe und dir jetzt dreihunderttausend Francs gebe...«
Bourrienne schwieg. Bonaparte betrachtete ihn beunruhigt.
»Sag endlich etwas, du Dummkopf!«
»Nun denn! Mit dreihunderttausend Francs, General, geben Sie mir nur die Hälfte des geschuldeten Betrags.«
»Die Hälfte!«, rief Bonaparte und erhob sich. »Sechshunderttausend Francs! Sie muss – sechshunderttausend Francs?«
Bourrienne nickte zustimmend.
»Hat sie Ihnen diesen Betrag gestanden?«
»Ja, General.«
»Und wie soll ich diese sechshunderttausend Francs aufbringen? Vielleicht aus den fünfhunderttausend Francs, die ich als Konsul verdiene?«
»Nun ja, sie vermutet sicherlich, dass Sie hie und da ein paar hunderttausend Francs zurückgelegt haben.«
»Sechshunderttausend Francs!«, wiederholte Bonaparte. »Und zur gleichen Zeit, in der meine Frau sechshunderttausend Francs für ihre Toilette ausgibt, gebe ich der Witwe und den Waisen tapferer Soldaten, die vor den Pyramiden und bei Marengo fielen, hundert Francs Rente! Und so viel kann ich noch nicht einmal allen von ihnen geben! Ein ganzes Jahr lang müssen sie von diesen hundert Francs leben, während Madame Bonaparte Kleider für hundert und Hüte für fünfundzwanzig Louisdor trägt. Sie haben sich sicher verhört, Bourrienne, es können nicht sechshunderttausend Francs sein.«
»Ich habe mich nicht verhört, General, und Madame Bonaparte ist sich erst gestern über ihre Lage klar geworden, als sie eine Rechnung über vierzigtausend Francs für Handschuhe erhielt.«
»Was sagen Sie da?«, rief Bonaparte.
»Ich sagte, vierzigtausend Francs für Handschuhe, General. Was sollen wir tun? So ist es nun einmal. Sie hat gestern Abend mit Madame Hulot ihre Rechnungen nachgezählt. Die ganze Nacht über hat sie geweint, und heute Morgen habe ich sie in Tränen aufgelöst vorgefunden.«
»Bah! Soll sie nur weinen! Soll sie weinen vor Scham oder besser noch vor Gewissensbissen! Vierzigtausend Francs für Handschuhe! In welchem Zeitraum?«
»In einem Jahr«, erwiderte Bourrienne.
»In einem Jahr! Der Lebensunterhalt von vierzig Familien! Bourrienne, ich will alle Unterlagen sehen.«
»Wann?«
»Auf der Stelle. Es ist acht Uhr, Cadoudal hat um neun Uhr Audienz, ich habe genug Zeit. Auf der Stelle, Bourrienne, auf der Stelle!«
»Sie haben recht, General, bringen wir es zu Ende, wenn wir schon dabei sind.«
»Holen Sie mir die Rechnungen, und zwar alle, ohne Ausnahme; wir werden sie gemeinsam durchsehen.«
»Unverzüglich, General.«
Und Bourrienne lief die Treppe hinunter, die zu Madame Bonaparte führte.
Wieder allein, ging der Erste Konsul mit großen Schritten auf und ab, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und überließ sich dem nervösen Zucken von Schulter und Mund, während er murmelte: »Ich hätte bedenken sollen, was Junot mir bei den Quellen von Messoudia gesagt hat, ich hätte auf meine Brüder Joseph und Lucien hören sollen, die mir geraten haben, sie nach meiner Rückkehr nicht wiederzusehen. Aber wie soll man Hortense und Eugène widerstehen! Die lieben Kinder! Sie haben mich zu ihr zurückgeführt!
Oh, die Scheidung! In Frankreich könnte ich sie erlangen und mich von dieser Frau befreien, die mir kein Kind gebiert und mich ruiniert!«
»Nun gut«, sagte Bourrienne, der eben zurückkam, »sechshundertausend Francs werden Sie nicht in den Ruin stürzen, und Madame Bonaparte ist noch jung genug, um Ihnen einen Knaben zu schenken, der in vierzig Jahren Ihre Nachfolge als Konsul auf Lebenszeit antreten wird.«
»Du warst schon immer auf ihrer Seite, Bourrienne!«, sagte Bonaparte und zwickte seinen Sekretär schmerzhaft ins Ohr.
»Ich kann es nicht ändern, General, ich bin immer auf der Seite der Schönen, Guten und Schwachen.«
Mit unverhohlenem Zorn ergriff Bonaparte den Armvoll Papiere, die Bourrienne mitbrachte, und zerknüllte die Blätter wutentbrannt. Dann hielt er eine Rechnung aufs Geratewohl hoch und las vor: »Achtunddreißig Hüte... in einem Monat! Setzt sie etwa jeden Tag zwei Hüte auf? Reiherfedern für eintausendachthundert Francs! Und Federbüsche für achthundert Francs!«, woraufhin er die Rechnung hinwarf und sich eine andere vornahm: »Parfumeriehandlung Mademoiselle Martin; dreitausendunddreihundert Francs für Rouge, davon eintausendsiebenhundertneunundvierzig Francs allein im Monat Juni. Rouge für hundert Francs der Tiegel! Merken Sie sich diesen Namen, Bourrienne, dieses liederliche Frauenzimmer namens Mademoiselle Martin gehört nach Saint-Lazare expediert, haben Sie mich gehört?«
»Ja, General.«
»Aha, jetzt kommen die Kleider! Monsieur Leroy... Früher hatte man Schneiderinnen, heute unterhält man Damenschneider, weil das offenbar moralischer ist. Hundertfünfzig Kleider jährlich; vierhunderttausend Francs für Kleider! Aber wenn das so weitergeht, bleibt es nicht bei sechshunderttaussend Francs, sondern wir werden in kürzester Zeit bei einer Million angelangt sein, bei zwölfhunderttausend Francs.«
»Oh, General«, sagte Bourrienne schnell, »manche Rechnungen wurden bereits beglichen.«
»Drei Kleider für fünftausend Francs!«
»Ja«, sagte Bourienne, »aber es sind auch solche für fünfhundert Francs darunter.«
»Machen Sie sich über mich lustig, Monsieur?«, fragte Bonaparte mit gerunzelter Stirn.
»Nein, General, nach Scherzen ist mir nicht zumute, aber ich sage Ihnen, dass es Ihrer nicht würdig ist, einer solchen Bagatelle wegen in Rage zu geraten.«
»Ludwig XVI. war immerhin König und ist wegen solcher Dinge in Rage geraten, obwohl er fünfundzwanzig Millionen Zivilliste bezog!«
»General, Sie sind ein größerer König als Ludwig XVI. und werden es sein, wenn es Ihnen beliebt. Außerdem war Ludwig XVI. ein bedauernswerter Mann, das müssen Sie einräumen.«
»Ein wackerer Mann, Monsieur.«
»Ich frage mich, was der Erste Konsul davon halten würde, wenn die Leute ihn für einen wackeren Mann hielten.«
»Wenn diese Kleider für fünftausend Francs wenigstens Gewänder wären wie die schönen Toiletten aus der Zeit Ludwigs XVI., mit Volants, mit Reifrock, mit Schößchen, für die man fünfzig Meter Stoff benötigte, das könnte ich ja noch verstehen, aber diese Kleider, die wie Säcke aussehen oder besser wie Regenschirme im Futteral!«
»Der Mode muss man sich beugen, General.«
»Ganz genau, und das versetzt mich so in Rage. Wir bezahlen nicht für den Stoff. Wenn es so wäre, dann profitierten wenigstens die Manufakturen davon; nein, wir bezahlen für den eleganten Schnitt eines Monsieur Leroy: fünfhundert Francs für Stoff und viertausendfünfhundert Francs für den Zuschnitt. Die Mode! Heutzutage muss man sechshunderttausend Francs auftreiben, um die Mode zu bezahlen.«
»Haben wir denn nicht vier Millionen zur Hand?«
»Vier Millionen! Wie kommen Sie darauf?«
»Ich meine das Geld, das der Senat von Hamburg Ihnen dafür bezahlt hat, dass Sie die Auslieferung der beiden Iren ermöglichten, deren Leben Sie verschont haben.«
»Ach ja, Napper-Tandy und Blackwall.«
»Ich glaube, es sind sogar viereinhalb Millionen, die Ihnen der Senat unmittelbar und durch die Vermittlung des Monsieur Chapeau-Rouge ausgezahlt hat.«
»Meiner Treu«, sagte Bonaparte, der lachen musste, weil die Erinnerung an den Streich, den er der Freien und Hansestadt gespielt hatte, ihn in gute Laune versetzte, »ich weiß nicht, ob ich mit meinem Handeln nicht ein bisschen weit gegangen bin, aber ich kam gerade aus Ägypten zurück und habe die Hamburger so behandelt, wie ich es mir den Paschas gegenüber angewöhnt hatte.«
In diesem Augenblick schlug es neun Uhr.
Die Tür wurde geöffnet, und Rapp, der Dienst hatte, meldete, dass Cadoudal und seine zwei Aides de Camp im Audienzsaal warteten.
»Wohlan, einverstanden«, sagte Bonaparte zu Bourrienne, »nehmen Sie sechshunderttausend Francs aus diesem Topf und sehen Sie zu, dass ich nie wieder von dieser Sache zu hören bekomme!«
Und Bonaparte verließ das Zimmer, um dem bretonischen General Audienz zu gewähren.
Kaum war die Tür geschlossen, klingelte Bourrienne; Landoire erschien sofort.
»Sagen Sie Madame Bonaparte, dass ich eine gute Nachricht für sie habe, sie aber bitten muss, mich aufzusuchen, weil ich mein Kabinett nicht verlassen kann, da ich dort allein bin, haben Sie mich verstanden, Landoire? Da ich dort allein bin.«
Auf die Worte hin, dass es sich um eine gute Nachricht handele, eilte Landoire zur Treppe.
Jedermann liebte Joséphine abgöttisch, Bonaparte nicht ausgenommen.
3
Die Compagnons de Jéhu
Es war nicht das erste Mal, dass Bonaparte versuchte, den berüchtigten Partisanen Cadoudal der Seite der Republik zuzuführen und an sich zu binden.
Etwas, was ihm kurz nach der Rückkehr aus Ägypten widerfahren war und Folgen gezeitigt hatte, die wir nachstehend schildern werden, hatte sich seinem Gedächtnis nachdrücklich eingeprägt.
Am 17. Vendémidiaire des Jahres VIII (9.Oktober 1799) war Bonaparte an Land gegangen, ohne sich vorher der Quarantäne unterzogen zu haben, obwohl er aus Alexandria kam.
Unverzüglich hatten er und sein bevorzugter Aide de Camp Roland de Montrevel eine Postkutsche bestiegen und waren nach Paris aufgebrochen.
Gegen vier Uhr nachmittags desselben Tages erreichten sie Avignon, machten fünfzig Schritte von der Porte d’Oulle entfernt halt, vor dem Palais de l’Égalité, das nach und nach wieder seinen früheren Namen Palais-Royal annahm, den es seit Beginn des 18. Jahrhunderts getragen hatte und heute noch trägt; Bonaparte stieg aus der Postkutsche in dem dringenden Bedürfnis, das zwischen vier und sechs Uhr nachmittags alle Sterblichen verspüren, dem Bedürfnis nach einer Mahlzeit, gut oder schlecht.
Bonaparte unterschied sich von seinem Gefährten nur durch entschiedeneres Auftreten und größere Wortkargheit, doch der Gastwirt wandte sich sogleich an ihn mit der Frage, ob er allein zu speisen wünsche oder an der Wirtstafel.
Bonaparte überlegte kurz; da die Nachricht von seiner Landung sich noch nicht im Land hatte verbreiten können, jedermann ihn noch in Ägypten wähnte und er und sein Gefährte mehr oder weniger die Kleidung jener Zeit trugen, war sein stets wacher Wunsch, mit eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Ohren zu hören, stärker als seine Besorgnis, erkannt zu werden, und da ihm das Speisen an der Wirtstafel, an der soeben aufgetragen wurde, das Warten ersparen würde, erwiderte er, er wolle dort seine Mahlzeit einnehmen.
Dann wandte er sich an den Postillon, der ihn gefahren hatte: »In einer Stunde sollen die Pferde bereit sein.«
Der Gastwirt wies den Neuankömmlingen den Weg zur Wirtstafel; Bonaparte trat als Erster in den Speisesaal, Roland folgte ihm.
Die zwei jungen Männer – Bonaparte war neunundzwanzig oder dreißig Jahre alt, Roland sechsundzwanzig – setzten sich an das Tischende, mit einem Abstand von drei oder vier Gedecken zu den anderen Essensgästen.
Jeder, der gereist ist, weiß, welche Wirkung Neuankömmlinge auf eine Wirtstafel haben: Alle Blicke richten sich auf sie, sofort sind sie Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit.
Die anderen Gäste waren Stammgäste des Gasthauses sowie einige Reisende, mit der Schnellpost auf dem Weg von Marseille nach Lyon, und ein Weinhändler aus Bordeaux, der sich aus Gründen in Avignon aufhielt, die man noch erfahren wird.
Dass die Neuankömmlinge sich mit Bedacht abseits der anderen gesetzt hatten, steigerte deren Neugier nur umso mehr.
Obwohl sie gleich gekleidet waren – Stulpenstiefel und Kniehose, Gehrock mit langen Schößen, Reisemantel und breitkrempiger Hut – und den Anschein der Gleichheit zu erwecken suchten, schien der als Zweiter Eingetretene seinem Gefährten eine Ehrerbietung entgegenzubringen, die der Altersunterschied nicht rechtfertigte, sondern die einen Rangunterschied zu verraten schien. Zudem nannte er ihn Citoyen, während der andere ihn einfach Roland nannte.
Doch es geschah, was in solchen Fällen zu geschehen pflegt: Nach einer Minute ausgiebigen Beäugens der neuen Gäste wandte man den Blick von ihnen ab und widmete sich wieder den Gesprächen, die für einen Augenblick verstummt waren.
Es ging um ein Thema, das für die Reisenden von größtem Interesse war: die thermidorianische Reaktion und die neu entfachten lebhaften Hoffnungen der Royalisten; ungeniert war die Rede von einer baldigen Wiedereinsetzung des Hauses Bourbon, was höchstens noch sechs Monate auf sich warten lassen konnte, da Bonaparte in Ägypten festgehalten wurde. Lyon, eine der Städte, die während der Revolution am meisten gelitten hatten, war wie selbstverständlich das Hauptquartier der Verschwörung.
Eine wahre provisorische Regierung hatte sich gebildet, mit königlichem Rat, königlicher Verwaltung, königlichem Stab und königlichen Armeen.
Um diese Armeen zu besolden und um den unablässigen Krieg in der Vendée und im Morbihan zu bezahlen, brauchte es allerdings Geld und noch mehr Geld. England gab Geld, aber knauserig; nur die Republik konnte den Sold für ihre Gegner aufbringen. Statt jedoch einen schäbigen Handel mit ihr anzustreben, auf den sie nie und nimmer eingegangen wäre, hatte der königliche Rat Räuberbanden aufgestellt, deren Aufgabe das Entwenden von Staatseinnahmen war und das Überfallen der Kutschen, in denen öffentliche Gelder transportiert wurden. Das Bürgerkriegsdenken mit seinen lockeren Moralbegriffen betrachtete das Plündern der Schnellkutsche des Schatzamts nicht als Diebstahl, sondern als kriegerische Operation, als Waffengang.
Eine dieser Banden war auf der Straße von Lyon nach Marseille tätig, und als die Neuankömmlinge bei Tisch Platz genommen hatten, war gerade die Rede davon gewesen, dass sie eine Kutsche der Schnellpost mit sechzigtausend Francs Regierungsgeldern überfallen hatte. Dieser Überfall hatte sich am Abend zuvor zwischen Marseille und Avignon, zwischen Lambesc und Pont-Royal ereignet.
Die Räuber, wenn man die edlen Erleichterer des Staatssäckels so nennen will, hatten vor dem Kutscher, dem sie eine Quittung über den Betrag ausgehändigt hatten, kein Hehl daraus gemacht, dass das Geld das Land sicherer überqueren würde, als sein Gefährt gewährleisten konnte, und dazu bestimmt war, die Armee Cadoudals in der Bretagne zu unterstützen.
All das war neu, unerhört, ja schier unvorstellbar für Bonaparte und Roland, die Frankreich vor zwei Jahren verlassen hatten und sich nicht träumen ließen, welche unermessliche Korruption sich unter der väterlichen Regierung des Direktoriums in allen Gesellschaftsklassen breitgemacht hatte.
Der Zwischenfall hatte sich auf der Straße ereignet, auf der auch sie gekommen waren, und derjenige, der davon berichtete, war selbst ein Hauptakteur dieses Überfalls durch Wegelagerer: der Weinhändler aus Bordeaux.
Am neugierigsten auf Einzelheiten waren neben Bonaparte und seinem Begleiter, die sich mit Zuhören begnügten, die Reisenden der Schnellpost, die auf ihre Weiterreise warteten. Die anderen Gäste, die aus der näheren Umgebung stammten, waren mit solchen Katastrophen so wohlvertraut, dass sie jederzeit Einzelheiten hätten beisteuern können, statt davon zu hören. Der Weinhändler stand im Mittelpunkt der Neugier, und es muss gesagt werden, dass er sich seiner Rolle würdig erwies, denn er antwortete auf alle Fragen, die man ihm stellte, mit größter Liebenswürdigkeit.
»Sie behaupten also, Citoyen«, sagte ein dicker Mann, an den sich blass und zitternd eine hagere Frau schmiegte, deren Knochen man fast klappern zu hören vermeinte, »dieser Raubüberfall habe auf der Straße stattgefunden, auf der wir herkamen!«
»Ja, Citoyen. Ist Ihnen zwischen Lambesc und Pont-Royal eine Stelle aufgefallen, wo die Straße ansteigt und sich zwischen zwei Hügeln verengt, eine sehr steinige und felsige Stelle?«
»O ja, mein Lieber«, fiel die Frau ein und drückte den Arm ihres Mannes, »das ist mir aufgefallen, und ich habe sogar gesagt, daran erinnerst du dich doch gewiss: Was für ein unguter Ort! Da komme ich lieber tagsüber vorbei als nachts.«
»Aaah, Madaaame«, sagte ein junger Mann, der die lässige Aussprache der Zeit besonders affektiert praktizierte und der an der Wirtstafel offenbar den Ton angab, »wissen Sie denn nicht, dass es für die Herrschaften der Compagnons de Jéhu keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt?«
»Wahrhaftig«, stimmte der Weinhändler zu, »so ist es, denn man hat uns um zehn Uhr vormittags am helllichten Tag überfallen.«
»Und wie viele waren es?«, fragte der Dicke.
»Vier, Citoyen.«
»Auf der Straße unterwegs?«
»Nein, sie kamen zu Pferde, bis an die Zähne bewaffnet und maskiert.«
»Das ist ihre Aaart, das ist ihre Aaart«, sagte der junge Mann affektiert. »Und dann haben sie sicher gesagt: Wehren Sie sich nicht, es wird Ihnen kein Haar gekrümmt; wir wollen nur das Geld der Regierung.«
»Wort für Wort, Citoyen.«
»Jaaa«, fuhr der verblüffend gut informierte Zeitgenosse fort. »Zwei sind abgestiegen, haben die Zügel ihrer Pferde ihren Kumpanen zugeworfen und den Kutscher aufgefordert, ihnen das Geld auszuhändigen.«
»Citoyen«, sagte der Dicke staunend, »Sie erzählen das Ganze wahrhaftig so, als wären Sie dabei gewesen!«
»Monsieur war vielleicht dabei«, sagte Roland.
Der junge Mann bedachte den Offizier mit einem kampflüsternen Blick. »Citoyen«, sagte er, »ich weiß nicht, ob Sie beabsichtigten, unhöflich zu mir zu sein, doch das können wir nach dem Essen regeln. Jedenfalls kann ich Ihnen versichern, dass meine politischen Ansichten so beschaffen sind, dass ich Ihren Verdacht nicht als Beleidigung auffasse, solange er nicht als Beleidigung beabsichtigt gewesen sein sollte. Gestern Vormittag gegen zehn Uhr, just zu dem Zeitpunkt, als die Schnellpost vier Meilen von hier entfernt war, speiste ich hier, wie diese Herren Ihnen bestätigen können, und zwar zwischen den Herren, die links und rechts neben mir zu sitzen mir in diesem Augenblick die Ehre erweisen.«
»Und wie viele Männer«, fragte Roland den Weinhändler, »waren Sie in der Kutsche?«
»Wir waren sieben Männer und drei Frauen.«
»Sieben Männer, ohne den Kutscher zu rechnen?«, wiederholte Roland.
»Sehr wohl«, erwiderte der Mann aus Bordeaux.
»Acht Männer haben sich von vier Banditen ausrauben lassen! Ich muss Ihnen gratulieren, Monsieur.«
»Wir wussten, mit wem wir es zu tun hatten«, erwiderte der Weinhändler, »und wir hüteten uns, zur Waffe zu greifen.«
»Warum das?«, fragte Roland. »Sie hatten es doch mit Strauchdieben zu tun, mit Galgenstricken, mit Straßenräubern.«
»Aber keineswegs, denn sie haben sich ja ausgewiesen.«
»Ausgewiesen?«
»Sie haben gesagt: Wir sind keine Straßenräuber, wir sind Mitglieder der Compagnons de Jéhu. Jede Gegenwehr ist zwecklos, meine Herren; fürchten Sie sich nicht, meine Damen.«
»So ist es«, sagte der junge Mann, der das große Wort an der Wirtstafel zu führen schien, »sie geben sich immer zu erkennen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.«
»Oho«, sagte Roland, indes Bonaparte schwieg, »was ist denn dieser Jéhu für ein Zeitgenosse, dass seine Gefährten so erlesene Umgangsformen haben? Ist er ihr Anführer?«
»Monsieur«, sagte ein Mann, dessen Kleidung den ehemaligen Priester wittern ließ und der offenbar in Avignon wohnte und zu den Stammgästen der Wirtstafel gehörte, »wenn Sie in der Lektüre der Heiligen Schrift bewanderter wären, als Sie es allem Anschein nach sind, dann wüssten Sie, dass dieser Zeitgenosse namens Jéhu vor mehr als zweieinhalb Jahrtausenden das Zeitliche gesegnet hat und aus einleuchtenden Gründen heutzutage keine Schnellposten auf den Reisestraßen überfallen kann.«
»Herr Abbé«, erwiderte Roland, »trotz Ihres verschnupften Tons machen Sie mir den Eindruck eines äußerst gebildeten Mannes, und deshalb bitte ich Sie, einem armen Unwissenden nähere Auskünfte über diesen Jéhu zu erteilen, der vor mehr als zweieinhalb Jahrtausenden gestorben ist und sich dennoch der Ehre erfreut, Gefährten zu besitzen, die sich mit seinem Namen schmücken.«
»Monsieur«, fuhr der Geistliche im gleichen säuerlichen Ton fort wie zuvor, »Jéhu war ein König Israels, den Elisa salbte unter der Bedingung, dass Jéhu Ahab und seine Sippe ausrottete und Isebel erschlug und alle Priester Baals vernichtete.«
»Herr Abbé«, sagte der junge Offizier lachend, »ich danke Ihnen für die Erläuterung. Ich bezweifle nicht, dass sie zutrifft und sicherlich überaus gelehrt ist, aber ich muss gestehen, ich bin um keinen Deut klüger als zuvor.«
»Aaaber, Citoyen«, warf wieder der Stutzer ein, »begreifen Sie etwa nicht, dass Jéhu seine Majestät Ludwig XVIII. ist, auserwählt von Gott und gesalbt unter der Bedingung, dass er die Verbrechen der Republik bestraft und die Priester des Baal erschlägt, anders gesagt die Girondisten, Cordeliers, Jakobiner, Thermidorianer und alle Übrigen, die zu dem abscheulichen Zustand beigetragen haben, den man seit sieben Jahren die Revolution nennt?«
»Aha!«, sagte Roland. »Ich beginne zu verstehen; aber zählen Sie zu jenen, die von den Compagnons de Jéhu ausgerottet werden sollen, auch die tapferen Soldaten, die Frankreichs Grenzen gegen die Mächte des Auslands verteidigt haben, und die herausragenden Generäle, die ihre Armeen in Tirol, im Departement Sambre-et-Meuse und in Italien angeführt haben?«
»Aber sicherlich und mehr noch als alle anderen.«
Rolands Augen sprühten Blitze, er blähte die Nasenflügel, presste die Lippen aufeinander und erhob sich von seinem Stuhl; doch sein Gefährte zog ihn am Rock, so dass er sich wieder setzen musste und das Wort »Schlingel«, das er seinem Gegenüber ins Gesicht schleudern wollte, nicht aussprach.
Und derjenige, der soeben seine Macht über seinen Gefährten bewiesen hatte, ergriff mit ruhiger Stimme zum ersten Mal das Wort: »Citoyen, Sie müssen zwei Reisende entschuldigen, die vom anderen Ende der Welt kommen, fast wie aus Amerika oder Indien, die Frankreich seit zwei Jahren nicht gesehen haben und nichts von alldem wissen, was sich dort zugetragen hat, und die begierig darauf sind, es zu erfahren.«
»Sagen Sie, was Sie wissen wollen«, sagte der junge Mann, der die Beleidigung, die auszusprechen Roland im Begriff gewesen war, offenbar nicht recht wahrgenommen hatte.
»Ich dachte«, fuhr Bonaparte fort, »die Bourbonen hätten sich mit ihrem Exil abgefunden; ich dachte, die Polizei verhinderte, dass es Banditen oder Diebe auf den Straßen geben kann; und ich dachte, General Hoche hätte die Vendée befriedet.«
»Aber woher kommen Sie denn? Woher nur?«, rief der junge Mann und begann zu lachen.
»Ich sagte es doch, Citoyen, vom anderen Ende der Welt.«
»Nun gut! Ich werde es Ihnen erklären: Die Bourbonen sind nicht reich; die Emigranten, deren Vermögen verkauft wurde, sind ruiniert. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ohne Geld zwei Armeen im Westen zu unterhalten und in den Bergen der Auvergne eine dritte auf die Beine zu stellen. Nun, indem die Compagnons de Jéhu die Schnellpost überfallen und die Geldkassetten der Steuereintreiber plündern, erklären sie sich zu den Steuereinnehmern der royalistischen Generäle. Fragen Sie Charette, Cadoudal oder Teyssonnet.«
»Aber«, warf der Weinhändler aus Bordeaux ängstlich ein, »wenn die Herren Compagnons de Jéhu es nur auf das Geld der Regierung abgesehen haben...«
»Selbstverständlich nur auf das Geld der Regierung; sie haben noch nie einen Bürger ausgeraubt.«
»Und wie kommt es dann«, fragte der Weinhändler etwas mutiger, »dass sie außer dem Geld der Regierung einen versiegelten Geldsack mit zweihundert Louisdor entwendet haben, der mir gehört?«
»Mein werter Monsieur«, erwiderte der junge Mann, »ich sagte Ihnen, dass es sich um einen Irrtum handeln muss und dass Ihnen dieses Geld eines Tages erstattet werden wird, so wahr ich Alfred de Barjols bin.«
Der Weinhändler seufzte hörbar und schüttelte den Kopf mit der Miene eines Menschen, dessen Zweifel allen Beteuerungen zum Trotz nicht völlig ausgeräumt wurden.
Doch als hätte das Eintreten des jungen Edelmanns, der seinen Namen und damit auch seinen gesellschaftlichen Rang enthüllt hatte, das Zartgefühl jener geweckt, für die er sein Wort gegeben hatte, kam ein Pferd angaloppiert und blieb vor der Tür des Gasthauses stehen; man vernahm Schritte im Flur, die Tür zum Speisesaal wurde aufgerissen, und auf der Schwelle erschien ein maskierter und bis an die Zähne bewaffneter Mann.
Alle Blicke richteten sich auf ihn.
»Meine Herren«, sagte er in der unnatürlichen Stille, die sein unerwartetes Erscheinen ausgelöst hatte, »befindet sich unter Ihnen ein Reisender mit Namen Jean Picot, der in der Schnellpost fuhr, die von den Compagnons de Jéhu zwischen Lambesc und Pont-Royal überfallen wurde?«
»Ja«, sagte der Weinhändler in größtem Erstaunen.
»Sind das vielleicht Sie, Monsieur?«, fragte der Maskierte.
»Das bin ich.«
»Hat man Ihnen nichts entwendet?«
»O doch, man hat mir einen Geldsack mit zweihundert Louisdor entwendet, den ich dem Kutscher anvertraut hatte.«
»Und ich muss hinzufügen«, sagte Monsieur Alfred de Barjols, »dass Monsieur soeben erst davon sprach und sein Geld als verloren betrachtete.«
»Monsieur hat sich getäuscht«, sagte der maskierte Unbekannte. »Wir führen Krieg gegen die Regierung, aber nicht gegen einzelne Bürger. Wir sind Partisanen, keine Strauchdiebe. Hier haben Sie Ihre zweihundert Louisdor, Monsieur, und wenn künftig ein ähnlicher Irrtum geschehen sollte, dann fordern Sie Ihr Eigentum zurück und berufen Sie sich auf den Namen Morgan.«
Und mit diesen Worten setzte der Maskierte zur Rechten des Weinhändlers einen Geldsack ab und ging, nachdem er sich mit einer höflichen Geste von den Anwesenden verabschiedet hatte, die vor Entsetzen oder vor Verblüffung über solchen Wagemut sprachlos waren.
Im selben Augenblick wurde Bonaparte gemeldet, dass die Pferde vorgespannt waren.
Roland bezahlte den Wirt, während Bonaparte sich erhob und sich anschickte, die Kutsche zu besteigen.
Als er sich anschließend zu seinem Reisegefährten gesellen wollte, sah er sich Alfred de Barjols gegenüber.
»Verzeihen Sie, Monsieur«, sagte dieser, »aber Sie haben einen Ausruf unterdrückt, der unzweideutig mir galt; darf ich erfahren, was der Grund für diese Zurückhaltung war?«
»Oh, Monsieur«, sagte Roland, »der Grund für diese Zurückhaltung ist schlicht der, dass mein Gefährte mich am Rock gezogen hat und ich deshalb, um ihn nicht zu verärgern, darauf verzichtet habe, Sie als Schlingel zu titulieren, wie es meine Absicht war.«
»Wenn es Ihre Absicht war, mir diesen Schimpf anzutun, Monsieur, darf ich dann die Absicht für die Tat nehmen?«
»Wenn es Ihnen genehm ist, Monsieur...«
»Es ist mir genehm, denn es gibt mir Gelegenheit, Satisfaktion von Ihnen zu verlangen.«
»Monsieur«, sagte Roland, »mein Reisegefährte und ich sind in großer Eile, wie Sie unschwer sehen können; wenn Sie aber meinen, eine Stunde würde uns genügen, um unsere Meinungsverschiedenheit auszutragen, dann würde ich bereitwillig diese Stunde Verspätung auf mich nehmen.«
»Eine Stunde wird genügen, Monsieur.«
Roland salutierte und eilte zur Postkutsche.
»Aha«, sagte Bonaparte. »Du schlägst dich?«
»Ich konnte nicht anders, General«, erwiderte Roland. »Aber mein Gegner ist sehr entgegenkommend; es wird nicht länger dauern als eine Stunde. Sobald wir fertig sind, nehme ich ein Pferd und werde Sie gewiss bis Lyon eingeholt haben.«
Bonaparte zuckte die Schultern.
»Raufbold!«, sagte er; dann reichte er ihm die Hand und fügte hinzu: »Sieh zu, dass du wenigstens nicht ums Leben kommst, ich brauche dich in Paris.«
»Ach, seien Sie unbesorgt, General, zwischen Valence und Vienne werden Sie mich wiedersehen.«
Bonaparte fuhr ab.
Eine Meile hinter Valence hörte er ein Pferd im Galopp und ließ die Kutsche anhalten.
»Ach, Roland, du bist es«, sagte er. »Offenbar ist alles gut ausgegangen.«
»Ganz ausgezeichnet«, sagte Roland, der die Miete für das Pferd entrichtete.
»Hast du dich geschlagen?«
»Ja, mein General.«
»Und wie?«
»Mit Pistolen.«
»Und?«
»Ich habe ihn erschossen, mein General.«
Roland nahm wieder seinen Platz neben Bonaparte ein, und die Postkutsche folgte im Galopp ihrem Weg.
4
Der Sohn des Müllers von der Guerche
Bonaparte benötigte Roland in Paris, damit er ihm half, den 18. Brumaire zu inszenieren. Nach diesem erfolgreichen Coup kam ihm wieder in Erinnerung, was er mit eigenen Augen und Ohren an der Wirtstafel in Avignon erlebt hatte. Er beschloss, die Compagnons de Jéhu unerbittlich zu verfolgen, und bei der ersten Gelegenheit schickte er ihnen Roland mit unbeschränkten Vollmachten auf den Hals.
Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir sehen, was es mit dieser Gelegenheit auf sich hatte, ermöglicht durch eine Frau, die sich rächen wollte, nach welch fürchterlichem Kampf die vier Anführer der Vereinigung Roland in die Hände fielen, und wie sie ihr Ende fanden, ohne das Ansehen zu entehren, das sie sich geschaffen hatten.
Roland kehrte im Triumph nach Paris zurück. Nun ging es darum, Cadoudal nicht etwa gefangen zu nehmen, denn man wusste, dass dies unmöglich war, sondern zu versuchen, ihn für die Sache der Republik zu gewinnen.
Wieder wurde Roland von Bonaparte mit diesem Auftrag betraut.
Roland machte sich auf den Weg, holte in Nantes Erkundungen ein, schlug den Weg nach La Roche-Bernard ein, und nachdem er dort abermals Erkundungen eingezogen hatte, machte er sich in Richtung des Dorfs Muzillac auf.
In der Tat befand sich dort Cadoudal.
Betreten wir mit Roland das Dorf, nähern wir uns der vierten Hütte zur Rechten, heften wir unser Auge auf einen Schlitz des Fensterladens, und sehen wir uns um.
Vor uns haben wir einen Mann im Gewand der wohlhabenden Bauern des Morbihan. Kragen, Knopflöcher und Hutkrempe säumt lediglich eine fingerbreite Goldborte. Der Rock ist aus grauem Tuch gefertigt, mit grünem Kragen. Vervollständigt wird die Kleidung des Mannes durch eine bretonische Hose und lederne Gamaschen, die bis zum Knie reichen.
Auf einem Stuhl liegt sein Säbel, auf dem Tisch und in Reichweite ein Paar Pistolen. In den Läufen einiger Karabiner spiegelt sich ein lebhaftes Kaminfeuer.
Cadoudal sitzt an dem Tisch, auf dem seine Pistolen liegen; der Schein einer Lampe beleuchtet sein Gesicht und die Papiere, die er aufmerksam liest. Sein Gesicht ist das eines Dreißigjährigen: eine offene und fröhliche Miene, eingerahmt von blonden Kräusellocken, beseelt von großen blauen Augen; ein Lächeln würde zwei Reihen weißer Zähne enthüllen, die Zange oder Bürste des Zahnarztes noch nie berührt haben.
Wie Du Guesclin, dessen Landsmann er ist, hat er einen großen runden Kopf, und deshalb ist er als General Rundkopf ebenso bekannt wie als Georges Cadoudal.
Sein Vater war Landwirt in dem Kirchspiel Kerléano, und Georges hatte am Gymnasium von Vannes eine ausgezeichnete Schulbildung erhalten, als in der Vendée die ersten royalistischen Aufstände aufflackerten. Cadoudal erfuhr davon, sammelte seine Jagd- und Zechkumpane, überquerte an ihrer Spitze die Loire und bot Stofflet seine Dienste an.
Als ehemaliger Jagdaufseher Monsieur de Mauleviers hatte Stofflet seine Vorbehalte gegenüber dem Adel und noch mehr gegenüber dem Bürgertum; bevor er sich mit Cadoudal verbündete, wollte er wissen, worauf er sich einließ, und Cadoudal war begierig, sich im Kampf zu beweisen.
Schon am nächsten Tag kam es zu einem Gefecht. Als Stofflet sah, wie die Weißen vorpreschten, ohne sich um Bajonette und Kugelhagel zu scheren, sagte er unwillkürlich zu Monsieur de Bonchamps, der sich neben ihm befand: »Wenn dieser Rundkopf kein Loch in den Schädel bekommt, wird er es noch weit bringen.«
Seit dieser Zeit haftete Cadoudal der Name Rundkopf an.
Georges kämpfte in der Vendée bis zur Niederlage von Savenay, bei der die Hälfte der Aufständischen den Tod fand und die andere Hälfte sich in alle Winde zerstreute.
Nachdem er drei Jahre lang wahre Wunder an Kraft, Gewandtheit und Tapferkeit vollbracht hatte, überschritt er die Loire abermals und kehrte in das Morbihan zurück.
In seinem Geburtsland führte Cadoudal auf eigene Rechnung Krieg. Als Oberbefehlshaber, den seine Soldaten vergötterten und dem sie bedingungslos gehorchten, erfüllte er Stofflets Prophezeiung; er trat die Nachfolge eines La Rochejacquelein, d’Elbée, Bonchamps, Lescure, Charette und sogar Stofflets selbst an, und seither kann er es an Ruhm mit ihnen aufnehmen und ist ihnen an Macht sogar überlegen, da er fast der Einzige ist, der noch gegen die Herrschaft Bonapartes kämpft, der seit zwei Monaten Erster Konsul ist und im Begriff steht, die Schlacht von Marengo zu schlagen.
Vor drei Tagen hat Cadoudal erfahren, dass General Brune, der Sieger von Alkmaar und von Castricum, der Retter Hollands, zum Oberfehlshaber der republikanischen Armeen im Westen ernannt wurde und in Nantes eingetroffen ist mit dem Auftrag, ihn, Cadoudal, und seine Chouans zu vernichten, koste es, was es wolle.
Nun denn! Cadoudal muss dem Oberbefehlshaber zeigen, dass er keine Furcht kennt und dass man mit Einschüchterungsversuchen bei ihm überhaupt nichts ausrichten kann.
Müßig spielt er mit dem Gedanken an aufsehenerregende Aktionen, durch die man die Republikaner aus der Fassung bringen könnte, doch schon bald hebt er den Kopf, denn er hört ein Pferd galoppieren. Der Reiter gehört zu seinen Männern, denn er hat ungehindert die Chouans passiert, die an der Straße von La Roche-Bernard auf der Lauer liegen, und Muzillac erreicht.
Der Reiter hält vor der Tür des Häuschens, in dem Georges sich befindet, betritt die Gasse und sieht sich seinem Anführer gegenüber.
»Ah, du bist es, Branche-d’Or«, sagte Cadoudal. »Wo warst du?«
»In Nantes, General.«
»Welche Nachrichten bringst du?«
»Ein Aide de Camp General Bonapartes hat General Brune begleitet und kommt in besonderer Mission, die Ihnen gilt.«
»Mir?«
»Ja.«
»Weißt du, wie er heißt?«
»Roland de Montrevel.«
»Hast du ihn gesehen?«
»Wie ich Sie sehe.«
»Wie ist er?«
»Ein schöner junger Mann, sechs- bis siebenundzwanzig Jahre alt.«
»Wann wird er kommen?«
»Ein, zwei Stunden nach mir, nehme ich an.«
»Hast du ihm den Weg bereitet?«
»Ja, man wird ihn nicht aufhalten.«
»Wo befindet sich die Vorhut der Republikaner?«
»In La Roche-Bernard.«
»Wie viele sind es?«
»Ungefähr tausend.«
In diesem Augenblick galoppierte ein Pferd heran.
»Oha!«, sagte Branche-d’Or. »Sollte er das schon sein? Unmöglich!«
»So ist es, denn dieser Reiter kommt aus der Richtung von Vannes.«
Der Reiter hielt sein Pferd vor der Tür an und trat ein. Obwohl er in einen weiten Mantel gehüllt war, erkannte Cadoudal ihn.
»Bist du es, Cœur-de-Roi?«, fragte er.
»Ja, General.«
»Woher kommst du?«
»Aus Vannes, wohin Sie mich geschickt hatten, damit ich die Blauen überwache.«
»Und was kannst du berichten?«
»Sie stehen kurz vor dem Hungertod, und General Harty will heute Nacht die Vorratsspeicher von Grand-Champ überfallen, um an Lebensmittel zu kommen. Er wird den Überfall selbst anführen, und die Kolonne wird aus höchstens hundert Mann bestehen, damit sie beweglich genug ist.«
»Bist du müde, Cœur-de-Roi?«
»Aber nein, General.«
»Und dein Pferd?«
»Es ist schnell gelaufen, aber es kann noch drei bis vier Meilen bewältigen, bevor es umfällt. Zwei Stunden Ruhe -«
»Zwei Stunden Ruhe und eine doppelte Ration Hafer, damit es sechs Meilen schafft!«
»Es wird sie schaffen, General.«
»Du wirst in zwei Stunden aufbrechen und in meinem Namen den Befehl geben, das Dorf Grand-Champ bei Tagesanbruch zu evakuieren.«
Cadoudal hielt inne und lauschte aufmerksam.
»Aha«, sagte er, »das wird er wohl sein. Ich höre den Galopp eines Pferdes, das sich von La Roche-Bernard nähert.«
»Das ist er«, sagte Branche-d’Or.
»Wer ist es?«, fragte Cœur-de-Roi.
»Jemand, den der General erwartet.«
»Kommt, Freunde, lasst mich allein«, sagte Cadoudal. »Du, Cœur-de-Roi, begibst dich so schnell wie möglich nach Grand-Champs; du, Branche-d’Or, nimmst im Hof mit dreißig Mann Aufstellung, die du als Boten in alle Winkel des Landes aussenden kannst. Sorge dafür, dass das Beste, was man bekommen kann, als Abendmahlzeit für zwei Personen vorbereitet wird.«
»Verlassen Sie das Haus, General?«
»Nein, ich gehe nur demjenigen entgegen, der gerade ankommt. Verschwinde in den Hof, er soll dich nicht sehen!«
Cadoudal erschien auf der Türschwelle, als ein Reiter sein Pferd anhielt und sich ratlos umblickte.
»Er ist hier, Monsieur«, sagte Cadoudal.
»Wer soll hier sein?«, fragte der Reiter.
»Der, den Sie suchen.«
»Woher wollen Sie wissen, dass ich jemanden suche?«
»Das ist nicht schwer zu erraten.«
»Und wen suche ich?«
»Georges Cadoudal; das ist nicht schwer zu erraten.«
»Oh!«, sagte der junge Mann erstaunt. Er sprang vom Pferd und wollte es an einem Fensterladen anbinden.
»Werfen Sie ihm die Zügel über den Hals«, sagte Cadoudal, »und machen Sie sich keine Gedanken, Sie werden Ihr Pferd vorfinden, sobald Sie es benötigen. In der Bretagne geht nichts verloren, Sie befinden sich im Land der Ehrlichkeit«, und er wies auf die Tür: »Erweisen Sie mir die Ehre, diese ärmliche Hütte zu betreten, Monsieur Roland de Montrevel«, sagte er, »das ist der einzige Palast, den ich Ihnen heute Nacht als Dach über dem Kopf anbieten kann.«
Trotz aller Selbstbeherrschung konnte Roland seine Überraschung nicht verbergen, und im Lichtschein des Kaminfeuers, das eine unsichtbare Hand wieder entfacht hatte, sah Cadoudal ihm an, dass er vergeblich zu erraten versuchte, wie der von ihm Gesuchte von seinem Kommen hatte wissen können. Doch da Roland seine Neugier nicht über Gebühr verraten wollte, setzte er sich auf den Stuhl, den Cadoudal ihm anbot, und hielt seine Stiefelsohlen an das wärmende Feuer.
»Ist das Ihr Hauptquartier?«, fragte er.
»Ja, Oberst.«
»Es scheint mir ein wenig nachlässig bewacht zu sein«, sagte Roland, der sich umsah.
»Das sagen Sie«, erwiderte Georges, »weil Ihnen zwischen La Roche-Bernard und hier niemand begegnet ist, nicht wahr?«
»Nichts und niemand, wahrhaftig.«
»Aber das beweist doch nicht, dass die Straße nicht bewacht gewesen wäre«, sagte Georges lachend.
»Zum Henker, wenn sie nicht von den Käuzchen bewacht wurde, die mich offenbar von Baum zu Baum begleitet haben; in diesem Fall nehme ich meine Behauptung natürlich zurück, General.«
»So ist es in der Tat«, sagte Cadoudal, »die Käuzchen sind meine Schildwachen, Wachen mit scharfen Augen, denn sie haben den Menschen die Fähigkeit voraus, auch im Dunkeln zu sehen.«
»Dennoch hätte ich keine Menschenseele gefunden, die mir den Weg gezeigt hätte, wenn ich nicht so vorausschauend gewesen wäre, mir in La Roche-Bernard den Weg erklären zu lassen.«
»Sie hätten unterwegs jederzeit rufen können: ›Wo finde ich Georges Cadoudal?‹, und jederzeit hätte Ihnen eine Stimme geantwortet: ›Im Dorf Muzillac, es ist das vierte Haus auf der rechten Seite.‹ Sie haben niemanden gesehen, Oberst. Aber in ebendieser Sekunde wissen an die fünfzehnhundert Männer, dass Monsieur Roland de Montrevel, Aide de Camp des Ersten Konsuls, eine Unterredung mit dem Müller von Kerléano hat.«
»Aber wenn Ihre fünfzehnhundert Männer wissen, dass ich Aide de Camp des Ersten Konsuls bin, warum haben sie mich dann ungeschoren passieren lassen?«
»Weil sie Ordre hatten, Sie nicht nur ungeschoren zu lassen, sondern Ihnen notfalls sogar zu Hilfe zu kommen.«
»Sie wussten also, dass ich auf dem Weg zu Ihnen war?«
»Ich wusste, dass Sie auf dem Weg waren, und auch, warum.«
»Dann muss ich es Ihnen nicht eigens sagen.«
»O doch, vorausgesetzt, Sie sagen mir etwas, was ich gerne höre.«
»Der Erste Konsul wünscht den Frieden, Frieden mit allen, nicht nur mit Einzelnen. Mit Abbé Bernier, mit d’Autichamp, Châtillon und Suzannet hat er Frieden geschlossen; es schmerzt ihn, Sie allein abseitsstehen und ihm störrisch trotzen zu sehen, denn er schätzt Sie als tapferen und loyalen Gegner. Und deshalb hat er mich als unmittelbaren Unterhändler zu Ihnen geschickt. Welche Bedingungen stellen Sie für einen Friedensschluss?«
»Oh, nichts weiter«, sagte Cadoudal lachend. »Der Erste Konsul überlässt den Thron Seiner Majestät Ludwig XVIII., wird sein Kronfeldherr, sein Generalstatthalter, der Befehlshaber über seine Armeen zu Lande und zu Wasser, und ich erkläre den Waffenstillstand auf der Stelle zum Friedensabkommen und werde zu seinem ersten ergebenen Soldaten.«
Roland zuckte die Schultern. »Sie wissen, dass das unmöglich ist«, sagte er, »und dass der Erste Konsul dieses Verlangen unmissverständlich zurückgewiesen hat.«
»So ist es. Und deshalb bin ich bereit, die Kriegshandlungen wiederaufzunehmen.«
»Wann?«
»Heute Nacht. Sie kommen gerade im richtigen Augenblick, um das Schauspiel mitzuerleben.«
»Und doch wissen Sie, dass die Generäle d’Autichamp, Châtillon, Suzannet und Abbé Bernier die Waffen gestreckt haben?«
»Sie sind Generäle der Vendée und können im Namen der Vendée tun, was sie wollen. Ich bin Bretone und Chouan und kann im Namen der Bretonen und der Chouans tun, was ich will.«
»Sie überantworten dieses unselige Land also einem Vernichtungskrieg, General?«
»Ich überantworte seine Christen und Royalisten dem Martyrium.«
»General Brune befindet sich in Nantes mit den achttausend Gefangenen, die uns die Engländer ausgeliefert haben.«
»So viel Glück hätten sie bei uns nicht, Oberst. Die Blauen haben uns gelehrt, keine Gefangenen zu machen. Was die Anzahl unserer Gegner betrifft, scheren wir uns um solche Kleinigkeiten im Allgemeinen nicht.«
»Aber wenn General Brune mit seinen achttausend Gefangenen und den zwanzigtausend Soldaten, die er von General Hédouville übernimmt, nichts ausrichten kann, dann wird der Erste Konsul persönlich gegen Sie antreten – wenn es sein muss, mit hunderttausend Mann, das wissen Sie.«
»Wir werden uns der Ehre bewusst sein, die er uns damit erweist«, sagte Cadoudal, »und uns bemühen, ihm zu beweisen, dass wir würdig sind, gegen ihn zu kämpfen.«
»Er wird Ihre Städte in Schutt und Asche legen.«
»Wir werden uns in unsere Hütten zurückziehen.«
»Er wird sie verbrennen.«
»Dann werden wir in den Wäldern leben.«
»Sie werden sich eines Besseren besinnen, General.«
»Erweisen Sie mir die Ehre, vierundzwanzig Stunden mit mir zu verbringen, und Sie werden sehen, dass mein Entschluss gefasst ist.«
»Und wenn ich annehme?«
»Wäre ich überglücklich. Allerdings dürfen Sie nicht mehr verlangen, als ich Ihnen anbieten kann: ein Strohdach über dem Kopf, eines meiner Pferde als Reittier und freies Geleit, wenn Sie mich verlassen.«
»Einverstanden.«
»Und Ihr Wort, Monsieur, dass Sie sich nicht den Ordres widersetzen, die ich erteile, und meine Überraschungsangriffe nicht zu vereiteln versuchen.«
»Dafür bin ich viel zu neugierig; ich gebe Ihnen mein Wort, General.«
»Was auch immer vor Ihren Augen geschieht?«, beharrte Cadoudal.
»Was auch immer vor meinen Augen geschieht. Ich verzichte auf die Rolle des Handelnden und begnüge mich mit der des Zuschauers, denn ich will zum Ersten Konsul sagen können: Das sah ich mit eigenen Augen.«
Cadoudal lächelte. »Gut!«, sagte er. »Sie werden sehen.«
Kaum hatte er gesprochen, wurde die Tür geöffnet, und zwei Bauern trugen einen gedeckten Tisch mit einer dampfenden Terrine Kohlsuppe und Speck herein; zwischen zwei Gläsern stand ein riesiger Krug frisch gezapften schäumenden Apfelmosts. Gedeckt war für zwei Personen – eine unmissverständliche Einladung zum Abendessen an die Adresse des Obersten.
»Sehen Sie, Monsieur de Montrevel«, sagte Cadoudal, »meine Leute hoffen, dass Sie mir die Ehre erweisen werden, mit mir zu speisen.«
»Und sie täuschen sich nicht«, erwiderte Roland, »denn ich bin halb verhungert, und hätten Sie mich nicht eingeladen, wäre ich Gefahr gelaufen, mir gewaltsam etwas zu essen zu beschaffen.«
»Sie müssen verzeihen, dass ich Ihnen nur schlichte Kost anbieten kann«, sagte Cadoudal. »Ich verfüge nicht über eine Kriegskasse wie Ihre Generäle, und da Sie meine armen Bankiers auf das Schafott geschickt haben, sind mir die Nahrungsmittel knapp geworden. Ich will Ihnen das nicht zum Vorwurf machen, denn ich weiß, dass Sie ohne List und Tücke gehandelt haben und dass es ein ehrlicher Handel zwischen Soldaten war. Es gibt nichts daran zu tadeln, ganz im Gegenteil: Ich habe Ihnen für den Geldbetrag zu danken, den Sie mir aushändigen ließen.«
»Eine der Bedingungen, unter denen Mademoiselle de Fargas uns die Mörder ihres Bruders ausgeliefert hat, war die, dass das Geld, das sie in Ihrem Namen verlangt hat, Ihnen übergeben wird. Der Erste Konsul und ich haben nur unser Wort gehalten.«
Cadoudal verneigte sich; als Ehrenmann fand er das völlig selbstverständlich.
Dann wandte er sich an einen der beiden Bretonen, die den Tisch hereingetragen hatten: »Was hast du uns noch anzubieten, Brise-Bleu?«
»Ein Hühnerfrikassee, General.«
»Das ist der Speisezettel Ihres Diners, Herr von Montrevel.«
»Ein wahres Festmahl; ich befürchte nur eines.«
»Was wäre das?«
»Solange wir essen, steht nichts zu befürchten, aber wenn es ans Trinken geht...«
»Ah! Sie mögen keinen Apfelmost«, sagte Cadoudal. »Verwünscht! Das bringt mich in Verlegenheit. Apfelmost und Wasser, daraus besteht mein ganzer Weinkeller, wie ich gestehen muss.«
»Darum geht es mir nicht. Auf wessen Gesundheit werden wir trinken?«
»Das bringt Sie in Verlegenheit, Monsieur de Montrevel«, sagte Cadoudal mit unnachahmlicher Würde. »Wir werden auf die Gesundheit Frankreichs trinken, das unser beider Mutter ist. Wir dienen unserem Heimatland mit unterschiedlichen Ansichten, aber, wie ich hoffe, mit gleicher Liebe.«
»Auf Frankreich, Monsieur!«, sagte Cadoudal und schenkte ein.
»Auf Frankreich, General!«, erwiderte Roland und stieß mit Cadoudal an.
Und beide setzten sich fröhlich, beruhigten Gewissens, und machten sich mit dem gesunden Appetit junger Männer über die Kohlsuppe her.
5
Die Falle
Man wird sich denken können, dass Cadoudal weder so ausführlich noch so wohlwollend geschildert würde, wäre er nicht dazu bestimmt, eine der Hauptpersonen unserer Erzählung abzugeben, und wir begäben uns nicht in die Gefahr, uns zu wiederholen, wäre es uns nicht darum zu tun, durch ein möglichst genaues Porträt dieses außergewöhnlichen Mannes die Hochachtung, die Bonaparte für ihn hegte, verständlich zu machen.
Indem wir sein Handeln beobachten, indem wir zeigen, wie er sich zu helfen weiß, werden wir am ehesten die Avancen begreifen, einem Gegner gegenüber gemacht von jemandem, zu dessen Gepflogenheiten dies nicht einmal seinen Freunden gegenüber zählte.
Beim Ton einer Glocke, die ein Ave Maria erklingen ließ, zog Cadoudal seine Uhr.
»Elf Uhr«, sagte er.
»Ich stehe zu Ihren Diensten«, erwiderte Roland.
»Wir haben eine kriegerische Unternehmung in etwa sechs Wegstunden Entfernung vor. Wollen Sie sich vorher ausruhen?«
»Ich?«
»Ja, wenn Sie wollen, können Sie eine Stunde schlafen.«
»Danke, das ist nicht nötig.«
»Dann«, sagte Cadoudal, »brechen wir auf, sobald Sie bereit sind.«
»Und Ihre Männer?«
»Ach ja, meine Männer. Meine Männer stehen bereit.«
»Wo denn das?«, fragte Roland.
»Überall.«
»Zum Teufel! Das würde ich gerne sehen!«
»Sie werden es sehen.«
»Und wann?«
»Wenn es Ihnen beliebt. Meine Männer sind ausgesprochen diskret und lassen sich nur blicken, wenn ich sie dazu auffordere.«
»Und wenn ich sie sehen will...?«
»Werden Sie es mir sagen, ich mache ein Zeichen, und sie werden sich zeigen.«
Roland begann zu lachen.
»Glauben Sie mir nicht?«, fragte Cadoudal.
»Ganz im Gegenteil – nur... Brechen wir auf, General.«
»Brechen wir auf.«
Die beiden jungen Männer hüllten sich in ihre Mäntel und verließen das Haus.
»Zu Pferde!«, sagte Cadoudal.
»Welches ist für mich bestimmt?«, fragte Roland.
»Ich dachte mir, es wäre Ihnen recht, Ihr Pferd frisch und ausgeruht vorzufinden, und deshalb habe ich zwei meiner Pferde für diese Unternehmung bestimmt. Wählen Sie selbst, sie stehen einander in nichts nach, und in ihren Pistolenhalftern befindet sich jeweils ein exzellentes Paar Pistolen englischen Fabrikats.«
»Bereits geladen?«, fragte Roland.
»Und zwar gut geladen, Oberst, denn das ist eine Aufgabe, die ich keinem anderen anvertraue.«
»Zu Pferde dann«, sagte Roland.
Cadoudal und sein Begleiter saßen auf und schlugen den Weg nach Vannes ein. Cadoudal ritt neben Roland, und in zwanzig Schritt Entfernung folgte ihnen Branche-d’Or, der Generalstabschef der Armee, wie Georges ihn genannt hatte.
Die Armee selbst blieb unsichtbar. Die Straße, die so gerade verlief, als wäre sie mit dem Lineal gezogen, wirkte völlig verlassen.
Die zwei Reiter legten etwa eine halbe Wegstunde zurück.
Nach Ende dieser Zeit fragte Roland ungeduldig: »Zum Teufel auch, wo stecken Ihre Männer?«
»Meine Männer? Zu unserer Rechten, zu unserer Linken, vor uns, hinter uns, überall. Ich scherze nicht, Oberst. Halten Sie mich etwa für so tollkühn, dass ich mich ohne Aufklärer mitten unter derart erfahrene und wachsame Männer wie Ihre Republikaner wagen würde?«
Roland schwieg einen Augenblick und sagte dann zweifelnd: »Wenn ich mich recht erinnere, General, sagten Sie, ich brauchte es nur zu sagen, wenn ich Ihre Männer sehen wollte. Nun gut, jetzt will ich sie sehen!«
»Ganz oder teilweise?«
»Wie viele, sagten Sie, haben Sie bei sich?«
»Dreihundert.«
»Wohlan! Dann will ich hundertfünfzig von ihnen sehen.«
»Halt!«, rief Cadoudal.
Und er hielt seine Hände wie einen Trichter vor den Mund und ließ den Ruf des Käuzchens ertönen, gefolgt vom Ruf der Schleiereule, mit dem Unterschied allerdings, dass der Ruf des Käuzchens nach rechts erfolgte und der Schleiereulenruf in die linke Richtung.
Kaum waren die letzten Töne des klagenden Rufes verstummt, sah man zu beiden Seiten der Straße Gestalten auftauchen, die den Graben zwischen Straße und Unterholz überquerten und links und rechts neben den Pferden Aufstellung bezogen.
»Wer führt rechts das Kommando?«, fragte Cadoudal.
»Ich, General«, erwiderte ein Bauer, der vortrat.
»Wer bist du?«
»Moustache.«
»Und wer ist es links?«, fragte der General.
»Ich, Chante-en-Hiver«, erwiderte ein zweiter Bauer, der sich ebenfalls näherte.
»Wie viele Männer führst du an, Moustache?«
»Hundert, mein General.«
»Und wie viele Männer führst du an, Chante-en-Hiver?«
»Fünfzig.«
»Insgesamt also einhundertundfünfzig?«, fragte Cadoudal.
»Ja«, erwiderten die zwei bretonischen Anführer.
»War das Ihre Schätzung, Oberst?«, fragte Georges lachend.
»Sie können zaubern, General.«
»O nein! Ich bin ein armer Chouan, ein bedauernswerter Bretone wie jeder andere. Ich kommandiere eine Truppe, in der sich jeder Kopf darüber im Klaren ist, was er tut, in der jedes Herz für die zwei großen Grundsätze unserer Welt in den Kampf zieht: Religion und Königtum«, und an seine Männer gewandt fragte Cadoudal: »Wer befehligt die Vorhut?«
»Fend-l’Air«, erwiderten die zwei Chouans.
»Und die Nachhut?«
»La Giberne.«
»Dann können wir also unbesorgt weiterreiten?«, fragte Cadoudal seine zwei Freischärler.
»Ganz genauso, als ginge es zur Messe in Ihrer Dorfkirche«, erwiderte Fend-l’Air.
»Reiten wir also weiter«, sagte Cadoudal zu Roland, bevor er sich wieder an seine Männer wandte: »Verstreut euch, Burschen«, sagte er.
Im gleichen Augenblick sprangen alle wie ein Mann in den Graben und waren verschwunden.
Einige Sekunden lang hörte man das Rascheln von Zweigen im Unterholz, das Geräusch von Schritten im Gebüsch, dann herrschte Stille.
»Wohlan!«, sagte Cadoudal, »denken Sie, dass ich mit solchen Männern etwas von Ihren Blauen zu befürchten hätte, seien sie noch so tapfer und geschickt?«
Roland seufzte. Er teilte Cadoudals Ansicht ganz und gar.
Weiter ging es.
Eine Wegstunde von La Trinité entfernt zeigte sich auf der Straße ein dunkler Punkt, der schnell größer wurde.
Mit einem Mal veränderte er sich nicht mehr.
»Was ist das?«, fragte Roland.
»Ein Mensch«, sagte Cadoudal.
»Das kann ich sehen«, erwiderte Roland. »Aber wer ist dieser Mensch?«
»Angesichts seiner Schnelligkeit hätten Sie erraten können, dass es sich um einen Boten handelt.«
»Warum hält er inne?«
»Sicherlich deshalb, weil er drei Männer zu Pferde gesehen hat und nicht weiß, ob er näher kommen oder zurückweichen soll.«
»Was wird er tun?«
»Er wartet ab, bevor er sich entscheidet.«
»Worauf wartet er?«
»Auf ein Zeichen, zum Teufel.«
»Und auf dieses Zeichen wird er antworten?«
»Nicht allein antworten, er wird auch gehorchen. Wollen Sie, dass er näher kommt oder dass er zurückweicht? Dass er sich versteckt?«
»Ich wünsche, dass er näher kommt«, sagte Roland, »denn auf diese Weise werden wir die Nachricht erfahren, die er überbringt.«
Der bretonische Anführer ließ den Ruf des Kuckucks so täuschend echt ertönen, dass Roland sich unwillkürlich umsah.
»Das war ich«, sagte Cadoudal, »suchen Sie nicht weiter.«
»Der Bote wird also herkommen?«
»Er wird nicht kommen, er kommt gerade.«
Tatsächlich hatte der Bote sich wieder aufgemacht und näherte sich schnellen Schritts, und nach wenigen Sekunden stand er vor seinem General.
»Aha«, sagte dieser, »bist du es, Monte-à-l’Assaut?«
Der General beugte sich vom Pferd, und Monte-à-l’Assaut sagte ihm etwas ins Ohr.
»Bénédicte hatte mich bereits vorgewarnt«, sagte Georges.
Nachdem Cadoudal ein paar Worte mit Monte-à-l’Assaut gewechselt hatte, ahmte er zweimal den Ruf der Eule nach und einmal den der Schleiereule, und sofort umringten ihn seine dreihundert Gefolgsleute.
»Bald sind wir da«, sagte er zu Roland. »Jetzt müssen wir die Straße verlassen.«
Oberhalb des Dorfs Trédion ging es querfeldein, wie von Cadoudal angegeben, dann gelangten sie nach Treffléan, vorbei an Vannes zur Linken. Doch statt die Ortschaft zu durchqueren, nahm der bretonische Anführer den Umweg links um das Dorf herum, der ihn zum Saum des Wäldchens führte, das sich zwischen Grand-Champ und Larré erstreckt.
Seit dem Verlassen der Landstraße hatten seine Männer sich um ihn geschart. Cadoudal schien auf Nachrichten zu warten, bevor er sich weiter vorwagte.
In der Richtung von Treffléan und Saint-Nolff begann graues Dämmerlicht den Horizont zu färben, Vorbote des Tageslichts, doch der dichte, dampfende Nebel, der vom Erdboden aufstieg, machte es unmöglich, weiter als auf fünfzig Schritt zu sehen.
Mit einem Mal war in etwa fünfhundert Schritt Entfernung ein Hahnenschrei zu vernehmen.
Georges spitzte die Ohren; die Chouans sahen einander lachend an. Der Hahnenschrei erklang wieder, diesmal näher.
»Das ist er«, sagte Cadoudal. »Er antwortet.«
In Rolands unmittelbarer Nähe erklang Hundegeheul, so täuschend ähnlich, dass der junge Mann wider besseres Wissen mit dem Blick nach dem Tier suchte, das dieses finstere Geheul ausstieß. Im gleichen Augenblick sah man mitten im Nebel einen Mann, der sich den zwei Reitern schnell näherte.
Cadoudal trat drei Schritte vor und legte den Finger auf den Mund, um dem anderen zu bedeuten, leise zu sprechen.
»Wohlan, Fleur-d’Épine«, sagte Georges, »haben wir sie?«
»Wie die Maus in der Mausefalle. Kein Einziger wird nach Vannes zurückkehren, wenn Sie wollen, General.«
»Ausgezeichnet. Wie viele sind es?«
»Hundert Mann, befehligt von General Harty persönlich.«
»Wie viele Wagen?«
»Siebzehn.«
»Sind sie weit von hier?«
»Ungefähr eine Dreiviertelwegstunde.«
»Auf welcher Straße?«
»Auf der von Grand-Champ nach Vannes.«
»Ausgezeichnet.«
Cadoudal rief seine vier Oberleutnants herbei und gab jedem seine Befehle. Jeder von ihnen wiederum ließ den Ruf der Schleiereule ertönen und verschwand mit fünfzig Mann.
Der Nebel wurde zunehmend dichter, und in hundert Schritt Entfernung verschwanden die jeweils fünfzig Mann wie Schatten.
Cadoudal blieb mit hundert Mann und Fleur-d-Épine zurück.
»Wohlan, General«, sagte Roland, als er ihn zurückkommen sah, »verläuft alles nach Ihren Wünschen?«
»Mehr oder weniger ja«, erwiderte Cadoudal, »und in einer Viertelstunde werden Sie sich selbst ein Bild machen können.«
»Nicht wenn dieser dichte Nebel anhält.«
Cadoudal sah sich um.
»In einer halben Stunde wird er sich vollständig gelichtet haben. Wollen Sie die halbe Stunde nutzen, um etwas zu essen und einen Morgentrunk zu nehmen?«
»Meiner Treu, General«, sagte Roland, »ich muss gestehen, dass die fünf oder sechs Stunden Marschieren mir gewaltiges Magenknurren beschert haben.«
»Und ich«, sagte Georges, »gestehe gerne, dass ich vor einem Kampf so gut wie möglich zu speisen pflege. Wenn man im Begriff steht, in die Ewigkeit einzugehen, sollte man das nach Möglichkeit mit vollem Bauch tun.«
»Aha!«, sagte Roland. »Sie werden also kämpfen?«
»Deshalb bin ich hier, und da wir es mit Ihren Freunden, den Republikanern, und General Harty persönlich zu tun haben, bezweifle ich, dass sie sich ohne Gegenwehr ergeben werden.«
»Und wissen die Republikaner, dass ihnen ein Kampf mit Ihnen bevorsteht?«
»Sie ahnen nichts davon.«
»Sie bereiten Ihnen eine Überraschung?«
»Nicht ganz; sobald sich in zwanzig Minuten der Nebel lichtet, werden sie uns so deutlich sehen, wie wir sie sehen werden. Brise-Bleu«, sagte Cadoudal, »hast du ein Frühstück für uns?«
Der Chouan, der offenbar Proviantmeister war, nickte, ging in den Wald und kam mit einem Esel zurück, der zwei Körbe trug.
Im Handumdrehen war ein Mantel auf einer Erderhebung ausgebreitet, und darauf servierte Brise-Bleu ein gebratenes Hühnchen, ein Stück kaltes Selchfleisch, Brot und Buchweizenfladen; und da man sich im Feld befand, hatte er es für erforderlich gehalten, sich den Luxus einer Flasche Wein und eines Glases zu erlauben.
»Sehen Sie?«, sagte Cadoudal zu Roland.
Roland bedurfte keiner weiteren Einladung; er sprang vom Pferd und reichte den Zügel einem Chouan. Cadoudal tat es ihm gleich.
»Und jetzt«, sagte Georges, zu seinen Männern gewandt, »habt ihr zwanzig Minuten Zeit, das Gleiche zu tun, was wir tun, und diejenigen, die es versäumen, diese Zeit zu nutzen, werden mit leerem Magen in den Kampf ziehen.«
Man hätte meinen können, dass jeder der Männer nur auf diese Aufforderung gewartet hatte, um ein Stück Brot und einen Buchweizenfladen aus der Tasche zu ziehen und dem Beispiel des Generals und seines Gastes zu folgen, wenn auch ohne gebratenes Huhn.
Da sie nur ein Glas hatten, tranken beide abwechselnd daraus.
Der Tag brach an, während sie nebeneinander frühstückten, und im Morgenlicht sahen sie aus wie zwei Freunde während einer Jagdpause.
Jeden Augenblick wurde der Nebel lichter, wie Cadoudal vorausgesagt hatte.
Auf der Landstraße zwischen Grand-Champ und Plescop tauchte eine Reihe von Wagen auf, die sich im Wald verlor; die Wagen bewegten sich nicht, allem Anschein nach von einem unerwarteten Hindernis überrascht.
In der Tat waren eine halbe Viertelwegstunde vor dem ersten Wagen die zweihundert Chouans von Monte-à-l’Assaut, Chante-en-Hiver, la Giberne und Fend-l’Air zu erkennen, die den Weg versperrten.
Die knapp hundert Republikaner hatten haltgemacht und warteten darauf, dass der Nebel sich vollständig hob, um die Zahl ihrer Gegner einzuschätzen und zu sehen, mit wem sie es zu tun hatten.
Beim Anblick dieses Trüppchens, das von der vierfachen Zahl Gegner umstellt war, und beim Anblick der Uniformen, deren Farbe den Republikanern die Bezeichnung der Blauen eingebracht hatte, erhob Roland sich schnell.
Cadoudal hingegen blieb gelassen im Gras liegen und beendete seine Mahlzeit.
Ein Blick genügte, und Roland wusste, dass die Republikaner verloren waren. Cadoudal verfolgte die unterschiedlichen Gefühle, die das Mienenspiel des jungen Mannes offenbarte.
»Nun denn!«, sagte er nach einem Augenblick schweigenden Beobachtens, »finden Sie meine Aufstellung gelungen, Oberst?«
»Sie könnten sie sogar als Vorsichtsmaßnahme bezeichnen, General«, sagte Roland mit spöttischem Lächeln.
»Ist es nicht die Gepflogenheit des Ersten Konsuls«, fragte Cadoudal, »jeden Vorteil zu nutzen, den ihm der Zufall verschafft?«
Roland biss sich auf die Lippen.
»General«, sagte er, »ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, den Sie mir hoffentlich nicht verweigern werden.«
»Welchen?«
»Die Erlaubnis, mich mit meinen Kameraden umbringen zu lassen.«
Cadoudal erhob sich. »Mit dieser Bitte habe ich gerechnet«, sagte er.
»Sie gewähren sie mir also?«, sagte Roland, dessen Augen vor Freude funkelten.
»Ja, aber zuerst muss ich eine Gefälligkeit von Ihnen verlangen«, sagte der royalistische Anführer mit vollendeter Würde.
»Ich bitte darum, Monsieur.«
Und Roland wartete, kaum minder ernst und stolz als der Anführer der Royalisten.
Das alte und das neue Frankreich fanden sich in diesen zwei Männern verkörpert.
6
Der Kampf der Hundert
Roland hörte zu.
»Die Gefälligkeit, die ich von Ihnen verlange, Monsieur, ist die, dass Sie als mein Unterhändler gegenüber General Harty fungieren.«
»Zu welchem Zweck?«
»Ich habe ihm mehrere Vorschläge zu unterbreiten, bevor wir den Kampf beginnen.«
»Ich vermute«, sagte Roland, »dass zu den Vorschlägen, die in Ihrem Namen zu überbringen ich die Ehre habe, nicht etwa jener zählt, dass er die Waffen niederlegen soll?«
»Im Gegenteil, Oberst. Dieser Vorschlag hat vor allen anderen Vorrang.«
»General Harty wird nichts dergleichen tun«, sagte Roland und ballte die Fäuste.
»Das ist anzunehmen«, erwiderte Cadoudal gelassen.
»Und?«
»Dann lasse ich ihm die Wahl zwischen zwei anderen Vorschlägen, die anzunehmen ihm freisteht, ohne dass er seine Ehre beschmutzen oder seinen Ruf beschädigen würde.«
»Darf ich sie erfahren?«, fragte Roland.
»Sie werden sie rechtzeitig erfahren; haben Sie die Freundlichkeit, den ersten zuerst zu hören.«
»Nennen Sie ihn.«
»General Harty und seine hundert Mann sind von einer dreimal so großen Streitmacht umzingelt; das wissen Sie, und das können Sie ihm sagen. Ich biete an, ihnen kein Haar zu krümmen, unter der Bedingung, dass sie die Waffen niederlegen und schwören, fünf Jahre lang nicht gegen die Vendée oder die Bretagne zu kämpfen.«
»Diese Botschaft erübrigt sich«, sagte Roland.
»Es wäre aber klüger, als sich und seine hundert Mann dem sicheren Tod auszuliefern.«
»Mag sein, aber ihm wird es lieber sein, sie und sich dem sicheren Tod auszuliefern.«
»Dennoch wäre es klug, ihm zuvor diesen Vorschlag zu unterbreiten.«
»Sie haben recht«, sagte Roland. »Mein Pferd?«
Man brachte es ihm, er sprang auf und legte eilig die Strecke zurück, die zwischen ihm und dem aufgehaltenen Geleitzug lag.
Groß war das Erstaunen General Hartys, als er einen Offizier in der blauen Uniform der Republikaner herbeireiten sah. Er trat dem Unterhändler drei Schritte entgegen, und dieser wies sich aus, erzählte, wie er unter die »Weißen« geraten war, und richtete Cadoudals Vorschlag aus.
Wie der junge Offizier vorausgesehen hatte, sagte General Harty nein. Roland trieb sein Pferd wieder zum Galopp an und kehrte zu Cadoudal zurück.
»Er sagt nein!«, rief er, sobald er in Hörweite war.
»In diesem Fall«, sagte Cadoudal, »überbringen Sie ihm meinen zweiten Vorschlag; ich will mir nichts vorwerfen müssen, wenn ich es mit einem in Ehrendingen so erfahrenen Mann zu tun habe, wie Sie einer sind.«
Roland salutierte.
»Hier mein Vorschlag«, sagte Cadoudal. »General Harty sitzt wie ich zu Pferd; er soll sich mit mir auf dem freien Feld zwischen unseren Truppen treffen, mit Säbel und Pistolen bewaffnet, genau wie ich. Und dann werden wir die Sache unter uns austragen... Wenn ich ihn töte, werden seine Männer sich zu den von mir aufgeführten Bedingungen ergeben, fünf Jahre lang nicht gegen uns zu kämpfen; denn Sie verstehen sicherlich, dass ich keine Gefangenen machen kann. Wenn er mich tötet, haben seine Männer freien Abzug und können mit ihren Wagen ungehindert nach Vannes zurückkehren. So, ist das nun ein Vorschlag, den Sie annehmen können, Oberst?«
»Alles in allem ja«, sagte Roland.
»Gut; aber Sie sind nicht General Harty. Geben Sie sich also einstweilen mit der Rolle des Unterhändlers zufrieden. Und wenn dieser Vorschlag, den ich an seiner Stelle ohne zu zögern anehmen würde, ihm noch immer nicht passt, nun, dann kommen Sie wieder her, und da ich so gutmütig bin, werde ich einen dritten machen.«
Roland galoppierte davon. Die Republikaner und General Harty erwarteten ihn ungeduldig, und er richtete ihnen die Botschaft aus.
»Oberst«, sagte der General, »ich bin dem Ersten Konsul Rechenschaft für mein Betragen schuldig. Sie sind sein Aide de Camp, und Ihnen obliegt es, nach Ihrer Rückkehr in Paris für mich Zeugnis abzulegen. Wie würden Sie an meiner Stelle handeln? Was Sie tun würden, will auch ich tun.«
Roland zuckte zusammen. Tiefer Ernst trat auf seine Züge, und er überlegte.
Nach wenigen Sekunden sagte er: »General, ich würde es nicht tun.«
»Nennen Sie mir Ihre Gründe«, erwiderte Harty, »damit ich weiß, ob sie mit meinen übereinstimmen.«
»Der Ausgang eines Duells ist reine Glücksache; von einem solchen Zufall darf man das Geschick hundert tapferer Männer nicht abhängig machen; und in einer Situation wie dieser, die jeden Einzelnen auf gleiche Weise betrifft, ist es an jedem Einzelnen, sich seiner Haut so wacker wie möglich zu wehren.«
»Ist das Ihre Ansicht, Oberst?«
»Ja, bei meiner Ehre.«
»Es ist auch die meine. Überbringen Sie dem royalistischen General meine Antwort.«
So schnell, wie er zu Harty geritten war, kehrte Roland zu Cadoudal zurück.
Lächelnd vernahm Cadoudal die Antwort des republikanischen Generals. »Ich hatte es nicht anders erwartet«, sagte er.
»Wie war Ihnen das möglich, wenn ich ihm geraten habe, so zu antworten?«
»Vorhin waren Sie aber gegenteiliger Ansicht.«
»Ja, doch völlig zutreffend haben Sie mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht General Harty bin. Lassen Sie uns Ihren dritten Vorschlag hören«, sagte Roland mit leiser Verärgerung, denn allmählich ging ihm auf, dass General Cadoudal sich seit Aufnahme der Verhandlungen am längeren Hebel befand.
»Der dritte Vorschlag«, sagte Cadoudal, »ist ein Befehl, der Befehl an dreihundert meiner Männer, sich zurückzuziehen. General Harty hat hundert Mann, ich behalte nur einen. Messieurs, seit der Schlacht der Dreißig ist es Gepflogenheit der Bretonen, sich Fuß gegen Fuß, Brust gegen Brust, Mann gegen Mann zu schlagen, lieber ein Mann gegen vier als vier gegen einen. Wenn General Harty siegt, wird er über unsere Leichen hinweg nach Vannes zurückkehren, ohne dass die dreihundert Mann, die nicht an dem Kampf teilnehmen, ihm ein Haar krümmen werden, und wenn er besiegt wird, wird er nicht behaupten können, einer Übermacht erlegen zu sein. Gehen Sie, Monsieur de Montrevel, bleiben Sie bei Ihren Freunden, ich gebe Ihnen meinerseits den Vorteil, in der Übermacht zu sein, denn Sie allein sind zehn Mann wert.«
Robert lüpfte seinen Hut.
»Was sagen Sie dazu, Monsieur?«, fragte Cadoudal.
»Ich pflege zu grüßen, was Größe besitzt, und ich grüße Sie.«
»Oberst«, sagte Cadoudal, »ein letztes Glas Wein. Jeder von uns wird auf das trinken, was er liebt, was er mit Bedauern auf der Erde zurücklassen wird, was er im Himmel wiederzusehen hofft.«
Er ergriff das einzige Glas, füllte es zur Hälfte und reichte es Roland.
»Wir haben nur ein Glas, Monsieur de Montrevel; trinken Sie als Erster.«
»Warum als Erster?«
»Weil Sie erstens mein Gast sind und weil außerdem ein Sprichwort sagt, wer nach einem anderen trinke, kenne dessen Gedanken. Ich will wissen, was Sie denken, Monsieur de Montrevel.«
Roland leerte das Glas auf einen Zug und reichte es Cadoudal zurück.
Dieser füllte es abermals zur Hälfte und leerte es ebenfalls.
»Wohlan! Und nun«, fragte Roland, »kennen Sie nun meine Gedanken?«
»Helfen Sie mir«, sagte Cadoudal lachend.
»Nun gut! Was ich denke, ist Folgendes«, sagte Roland mit seiner gewohnten Offenheit, »ich denke, dass Sie ein tapferer Krieger sind, General, und dass es mir eine Ehre wäre, wenn Sie mir die Hand reichen würden, bevor wir uns im Zweikampf gegenüberstehen.«
Die zwei jungen Männer drückten einander die Hand – wie zwei Freunde, die Abschied nehmen, nicht wie zwei Gegner vor dem Kampf.
Was sich soeben ereignet hatte, war von schlichter und zutiefst würdevoller Größe. Beide salutierten.
»Viel Glück!«, sagte Roland zu Cadoudal. »Erlauben Sie mir zu hoffen, dass mein Glückwunsch vergebens ist. Ich gestehe, dass er von meinen Lippen kommt, nicht aber aus dem Herzen.«
»Gott beschütze Sie, Monsieur de Montrevel«, sagte Cadoudal, »und ich hoffe, dass mein Wunsch in Erfüllung geht, denn er ist uneingeschränkt das, was ich denke.«
»An welchem Signal werden wir erkennen, dass Sie bereit sind?«, fragte Roland.
»An einem Gewehrschuss in die Luft.«
»Einverstanden, General.«
Und im Galopp überquerte Roland zum dritten Mal den Zwischenraum zwischen dem royalistischen und dem republikanischen General.
Als er sich entfernte, streckte Cadoudal die Hand aus. »Ihr seht diesen jungen Mann«, sagte er zu seinen Chouans.
Alle Blicke folgten Roland. »Ja, General«, erwiderten die Chouans.
»Wohlan! Bei der Seele eurer Väter sei sein Leben euch heilig! Ihr könnt ihn gefangen nehmen, aber lebendigen Leibes und ohne dass ihm ein Haar gekrümmt wird.«
»Jawohl, General«, erwiderten die Chouans einfach.
»Und jetzt, meine Freunde«, fuhr Cadoudal mit lauterer Stimme fort, »vergesst nicht, dass ihr die Nachkommen der dreißig Helden seid, die zwischen Ploërmel und Josselin, zehn Wegstunden von hier entfernt, gegen dreißig Engländer kämpften und siegten! Unsere Vorfahren hat dieser Kampf der Dreißig unsterblich gemacht; seid ebenso ruhmreich wie sie in eurem Kampf der Hundert. Leider«, fügte er mit leiserer Stimme hinzu, »haben wir es diesmal nicht mit Engländern zu tun, sondern mit unseren Brüdern.«
Der Nebel hatte sich vollständig gelichtet, und die ersten Strahlen der Frühlingssonne versahen die Ebene von Plescop mit einer gelblichen Äderung; alles, was sich zwischen den zwei Truppen abspielen sollte, würde gut zu erkennen sein.
Während Roland zu den Republikanern zurückkehrte, galoppierte Branche-d’Or davon und ließ gegen General Harty und seine Blauen nur Cadoudal mit seinen hundert Mann zurück.
Die Truppen, die nicht mehr gebraucht wurden, teilten sich in zwei Hälften, deren eine nach Plumergat marschierte, die andere nach Saint-Avé. Die Straße blieb frei.
Branche-d’Or kam zu Cadoudal zurück. »Ihre Ordres, General!«, sagte er.
»Es ist nur eine«, erwiderte der General der Chouans. »Nimm acht Mann und folge mir. Wenn du siehst, dass der junge Republikaner, mit dem ich gefrühstückt habe, unter sein Pferd fällt, wirfst du dich auf ihn mit deinen acht Mann und nimmst ihn gefangen, bevor er Zeit hat, sich zu befreien.«
»Ja, General.«
»Du weißt, dass ich ihn unversehrt wiederhaben will.«
»Abgemacht, General.«
»Such dir deine Männer aus, und wenn er euch sein Ehrenwort gegeben hat, kannst du tun, was dir beliebt.«
»Und wenn er es nicht geben will?«
»Dann fesselt ihr ihn so, dass er nicht fliehen kann, und passt bis zum Ende des Kampfes auf ihn auf.«
Branche-d’Or stieß einen Seufzer aus. »Das wird eine traurige Sache sein«, sagte er, »Maulaffen feilzuhalten, während die anderen sich vergnügen.«
»Gott ist gütig«, sagte Cadoudal, »er wird für uns alle genug zu tun haben«, und als er sah, dass die Republikaner sich formiert hatten: »Ein Gewehr!«
Man reichte ihm eines.
Er schoss in die Luft.
Im gleichen Augenblick ertönten aus den Reihen der Republikaner Trommelwirbel.
Cadoudal richtete sich in den Steigbügeln auf: »Kinder«, rief er mit klangvoller Stimme, »habt ihr alle euer Morgengebet verrichtet?«
Fast alle Stimmen antworteten: »Ja, ja!«
»Wer noch keine Zeit dazu hatte oder es vergessen hat«, wiederholte Cadoudal, »soll es jetzt tun!«
Fünf, sechs Bauern knieten nieder und beteten.
Die Trommeln näherten sich schnell.
»General! General!«, riefen einige ungeduldig. »Sie kommen!«
Der General breitete die Arme aus und deutete auf die knienden Freischärler.
»Es wird Zeit«, riefen die Ungeduldigen.
Die einzelnen Betenden erhoben sich, nachdem sie ihr Gebet beendet hatten.
Die Republikaner hatten bereits ein Drittel der Strecke zurückgelegt, als der Letzte aufstand. Sie marschierten in drei Reihen zu dreißig Mann mit angelegtem Bajonett, die Offiziere als Schlussreihe. Roland ritt an der Spitze der ersten, General Harty zwischen der ersten und der zweiten Reihe; nur sie waren zu Pferde. Unter den Chouans gab es nur einen einzigen Reiter: Cadoudal. Branche-d’Or hatte sein Pferd an einen Baum angebunden, um zu Fuß mit den acht Männern zu kämpfen, die beauftragt waren, Roland gefangen zu nehmen.
»General«, sagte Branche-d’Or, »die Gebete sind verrichtet, alle Männer stehen bereit.«
Cadoudal vergewisserte sich und rief dann mit lauter Stimme: »Auf, Burschen, jetzt vergnügt euch!«
Kaum war die Erlaubnis erteilt, als die Chouans unter dem Ruf »Es lebe der König!« in die Ebene stürmten, mit der einen Hand die Hüte schwenkend, mit der anderen die Gewehre.
Doch statt eng geschlossen zu marschieren wie die Republikaner, schwärmten sie aus und bildeten einen riesigen Halbmond, dessen Mittelpunkt Georges auf seinem Pferd war.
Im Handumdrehen waren die Republikaner überrannt, und das Gewehrfeuer prasselte los. Fast alle Männer Cadoudals waren Wilderer und somit ausgezeichnete Schützen. Zudem waren sie mit englischen Karabinergewehren von der doppelten Reichweite normaler Gewehre bewaffnet.
Die Chouans hatten das Feuer auf weite Entfernung eröffnet, aber vereinzelte todbringende Kugeln fanden ihren Weg in die Reihen der Republikaner.
»Vorwärts!«, rief General Harty.
Seine Soldaten marschierten weiter mit angelegtem Bajonett, doch innerhalb weniger Sekunden war vor ihnen niemand mehr zu sehen, denn Cadoudals hundert Mann waren als Truppe verschwunden und hatten sich in Tirailleure verwandelt, in lockerer Formation zum Halbmond angeordnet.
General Harty ließ seine Männer nach rechts und nach links Aufstellung nehmen, und dann ertönte das Kommando: »Feuer!«, doch das Ergebnis war gleich null. Die Republikaner zielten auf einzelne Männer; die Chouans hingegen schossen in die Menge, so dass jeder Schuss, den sie abgaben, traf.
Roland erkannte die missliche Lage: Er sah sich um und erblickte inmitten des Rauchs Cadoudal, aufrecht im Sattel und reglos wie ein Reiterstandbild.
Der Anführer der Royalisten erwartete ihn.
Roland stieß einen Schrei aus und preschte auf ihn los.
Cadoudal trieb sein Pferd zum Galopp an, um den Weg für sein Gegenüber abzukürzen, hielt aber fünfzig Schritt von Roland entfernt an.
»Aufgepasst!«, sagte Cadoudal zu Branche-d’Or und dessen Männern.
»Seien Sie unbesorgt, General, wir sind da«, sagte Branche-d’Or.
Cadoudal zog eine Pistole aus dem Halfter und lud sie, Roland preschte mit gezücktem Säbel heran, an den Hals seines Pferdes geschmiegt. Als sie nur mehr zwanzig Schritt voneinander entfernt waren, hob Cadoudal langsam die Hand und zielte auf Roland.
Als es zehn Schritt waren, schoss er.
Das Pferd, auf dem Roland saß, hatte einen weißen Stern an der Stirn. Die Kugel traf mitten in den Stern. Das tödlich getroffene Pferd stürzte und wälzte sich mit seinem Reiter vor Cadoudals Füßen.
Cadoudal gab dem eigenen Pferd die Sporen und setzte über Pferd und Reiter hinweg. Branche-d’Or und seine Männer hielten sich bereit und stürzten sich dann wie Raubkatzen auf Roland, der unter seinem Pferd eingezwängt war.
Der junge Mann ließ seinen Säbel fallen und wollte seine Pistolen ergreifen, doch bevor er die Hand zum Halfter führen konnte, hielten zwei Männer ihn an den Armen fest, während die anderen das Pferd wegzogen.
Alles verlief so geschwind und reibungslos, dass außer Zweifel stand, dass dieses Manöver von langer Hand geplant worden war.
Roland schnaubte vor Zorn. Branche-d’Or trat zu ihm und nahm den Hut ab. »Ich ergebe mich nicht«, rief Roland.
»Es ist nicht nötig, dass Sie sich ergeben, Monsieur«, erwiderte der Chonan mit ausgesuchter Höflichkeit.
»Und warum nicht?«, fragte Roland, der seine Kräfte in einem ebenso verzweifelten wie aussichtslosen Aufbäumen erschöpfte.
»Weil Sie unser Gefangener sind, Monsieur.«
Daran gab es nichts zu deuten. Roland wusste keine Antwort.
»Dann töten Sie mich«, rief er zuletzt.
»Wir wollen Sie nicht töten, Monsieur.«
»Was wollt ihr dann?«
»Dass Sie uns Ihr Ehrenwort geben, sich nicht wieder am Kampf zu beteiligen; unter dieser Bedingung lassen wir Sie frei.«
»Niemals!«, rief Roland.
»Verzeihen Sie, Monsieur«, sagte Branche-d’Or, »aber was Sie da tun, ist nicht ehrenhaft.«
»Nicht ehrenhaft! Elender Schuft! Du wagst es, mich zu beleidigen, weil ich mich nicht wehren und dich nicht bestrafen kann.«
»Ich bin kein Schuft, und ich will Sie nicht beleidigen, Monsieur de Montrevel; ich habe nur sagen wollen, dass Sie unserem General neun Männer vorenthalten, die ihm nützlich sein könnten, wenn Sie sich weigern, uns Ihr Wort zu geben, so dass wir Sie bewachen müssen. So hat der Rundkopf nicht an Ihnen gehandelt. Er hatte dreihundert Mann mehr als Sie und hat sie weggeschickt. Und jetzt sind wir nur mehr einundneunzig gegen einhundert.«
Rolands Gesicht errötete heftig und wurde sodann totenbleich. »Du hast recht, Branche-d’Or«, sagte er. »Ich lasse mich überreden und ergebe mich; du kannst mit deinen Gefährten am Kampf teilnehmen.«
Die Chouans stießen Freudenrufe aus, ließen Roland los und stürzten sich in das Getümmel, Hüte und Gewehre schwenkend und »Es lebe der König!« rufend.
7
Weiße und Blaue
Roland verharrte einen Augenblick, aus der Umarmung der Chouans befreit, doch doppelt handlungsunfähig: körperlich durch den Sturz von seinem Pferd, moralisch durch sein Ehrenwort. Er setzte sich auf die kleine Erhebung, auf der noch der Mantel lag, der beim Frühstück als Tischtuch gedient hatte. Von dort aus konnte Roland das ganze Gefecht überblicken, und hätten nicht Tränen der Schande seine Augen verschleiert, wäre ihm keine Einzelheit entgangen.
Cadoudal saß mitten in Feuer und Rauch aufrecht auf seinem Pferd wie ein böser Geist des Krieges, unverwundbar und unerbittlich wie dieser.
Allmählich versiegten Rolands Tränen, getrocknet vom Feuer des Zorns. Inmitten der grünen Getreidehalme, die zu sprießen begannen, lagen die Leichname eines Dutzends Chouans verstreut; die Republikaner, auf der Straße zusammengedrängt, hatten bereits mehr als doppelt so viele Verluste zu beklagen. Die Verwundeten schleppten sich über das Niemandsland, bäumten sich auf wie Schlangen, denen das Rückgrat zerschlagen war, und kämpften weiter, die Republikaner mit dem Bajonett, die Chouans mit dem Messer. Verwundete, die niemanden in der Nähe hatten, mit dem sie Mann gegen Mann kämpfen konnten, luden ihr Gewehr, erhoben sich mühsam auf ein Knie, feuerten und fielen um.
Auf beiden Seiten wurde der Kampf erbarmungslos geführt, ohne Unterbrechung, unerbittlich. Geradezu spürbar ergoss der Bürgerkrieg, dieser Krieg ohne Mitleid, ohne Gnade, ohne Milde, das Gefäß seines Zorns über das Schlachtfeld.
Cadoudal umrundete zu Pferde die geschlossene Schanze der Republikaner, feuerte auf zwanzig Schritt Entfernung abwechselnd mit seinen Pistolen und einem doppelläufigen Gewehr, das er nach dem Schießen einem Chouan zuwarf und geladen entgegennahm, wenn er das nächste Mal vorbeikam. Mit jedem Schuss streckte er einen Soldaten nieder. Bei seiner dritten Umrundung erwies ihm General Harty die Ehre, ein ganzes Peloton auf ihn feuern zu lassen.
Er verschwand in Feuer und Rauch, und man sah ihn und sein Pferd zu Boden sinken wie vom Blitzschlag getroffen.
Zehn oder zwölf Republikaner sprangen hervor, doch ebenso viele Chouans traten ihnen entgegen.
Ein schrecklicher Nahkampf entbrannte; zwangsläufig waren die Chouans mit ihren Messern im Vorteil.
Unvermutet hatte Cadoudal sich aufgerichtet, in jeder Hand eine Pistole: das Todesurteil für zwei Soldaten, und zwei Soldaten fielen.
An die dreißig Chouans hatten sich zu einem Dreieck um ihn geschart. Cadoudal bildete einen spitzen Winkel des Dreiecks; er hatte das Gewehr eines toten Gegners aufgehoben und benutzte es als Keule.
Mit jedem Keulenschlag schmetterte er einen Mann zu Boden, dann durchbrach er das Bataillon, und Roland sah ihn auf der anderen Seite auftauchen. Wie ein Wildschwein sich erneut auf den Jäger stürzt, den es zu Fall gebracht hat, und ihm die Eingeweide zerfetzt, begab er sich in die klaffende Wunde zurück und riss sie noch weiter auf.
General Harty sammelte ungefähr zwanzig Mann um sich und führte mit angelegtem Bajonett einen Vorstoß auf die Chouans, die ihn umzingelten; zu Fuß ging er an der Spitze seiner zwanzig Soldaten im von Kugeln durchlöcherten Waffenrock, aus zwei Wunden blutend. Seinem Pferd war der Bauch aufgeschlitzt worden.
Zehn seiner Männer fielen, bevor die Umzingelung durchbrochen werden konnte, doch dann war es gelungen.
Die Chouans wollten den General verfolgen, Cadoudal aber rief mit Donnerstimme: »Ihr hättet ihn nicht durchlassen dürfen! Aber wenn er nun einmal durchgebrochen ist, soll er sich ungehindert zurückziehen!«
Die Chouans gehorchten ihrem Anführer gewissenhaft, wie sie all seine Anordnungen befolgten.
»Und jetzt stellt das Feuer ein!«, rief Cadoudal. »Keine Toten mehr! Nur noch Gefangene!«
Der Kampf war beendet. Die Chouans sammelten sich um den Leichenberg und die vereinzelten mehr oder weniger schwer Verwundeten, die sich unter den Toten noch regten.
Sich zu ergeben bedeutete oft genug den sicheren Tod in diesem schrecklichen Krieg, in dem Gefangene immer wieder füsiliert wurden: seitens der Blauen, weil sie Chouans und Vendéens als Strauchdiebe betrachteten, und seitens der Weißen, weil sie republikanische Gefangene nicht versorgen konnten.
Die republikanischen Soldaten warfen ihre Gewehre so weit weg wie möglich, um sie nicht ausliefern zu müssen. Als die Chouans näher kamen, zeigten sie ihnen ihre offenen Patronentaschen: Sie hatten ihre Munition bis auf die letzte Patrone verfeuert.
Cadoudal ging zu Roland.
Während des ganzen erbitterten Kampfes war der junge Mann auf der Stelle sitzen geblieben und hatte gewartet, den Blick auf das Gefecht gebannt, die Haare schweißgetränkt, die Brust wogend. Als er sah, wie vernichtend die Republikaner geschlagen wurden, hatte er das Gesicht mit den Händen bedeckt und die Stirn zu Boden gesenkt.
Cadoudal trat zu ihm, ohne dass Roland die Schritte zu hören schien. Langsam hob der junge Offizier den Kopf. Zwei Tränen rollten ihm die Wangen hinunter. »General«, sagte er, »verfahren Sie nach Belieben mit mir; ich bin Ihr Gefangener.«
»Oho!«, sagte Cadoudal lachend. »Einen Abgesandten des Ersten Konsuls nimmt man nicht gefangen, man bittet ihn um einen Gefallen.«
»Welchen? Ich stehe zu Ihren Diensten.«
»Ich habe keine Lazarette für die Verwundeten und keine Gefängnisse für die Gefangenen; übernehmen Sie die Überführung der republikanischen Soldaten, Gefangene wie Verwundete, nach Vannes.«
»Wie bitte, General?«, rief Roland.
»Ich übergebe sie Ihrer Verantwortung. Ich bedaure, dass Ihr Pferd tot ist; ich bedaure, dass auch meines tot ist, aber Branche-d’Ors Pferd ist noch da: Nehmen Sie es.«
Der junge Mann wollte widersprechen.
»Habe ich nicht zum Tausch das Pferd, das Sie in Muzillac zurückließen?«, sagte Georges.
Roland begriff, dass er der Größe seines Gegenübers am ehesten gerecht würde, wenn er sich so geradlinig und schlicht wie möglich gab. »Werde ich Sie wiedersehen, General?«, fragte er, während er aufstand.
»Das glaube ich nicht, Monsieur. Meine Operationen verlangen meine Anwesenheit bei Port-Louis, Ihre Pflicht ruft Sie in das Palais Luxembourg.«
Damals residierte dort noch Bonaparte.
»Was soll ich dem Ersten Konsul berichten, General?«
»Sie werden ihm sagen, was Sie gesehen haben, und Sie müssen ihm unbedingt ausrichten, dass ich mich durch den Besuch, den er mir verspricht, sehr geehrt fühle.«
»Nach allem, was ich gesehen habe, bezweifle ich sehr, dass Sie jemals auf meine Hilfe angewiesen sein dürften, Monsieur«, sagte Roland, »aber vergessen Sie dennoch nie, dass Sie in der engeren Umgebung General Bonapartes einen Freund haben.«
Und er reichte Cadoudal die Hand.
Der Anführer der Royalisten ergriff sie mit der gleichen Offenheit und Ungezwungenheit wie vor dem Kampf.
»Adieu, Monsieur de Montrevel«, sagte er, »und ich muss Sie gewiss nicht eigens bitten, sich für General Harty zu verwenden? Eine Niederlage wie die seine ist so ruhmreich wie jeder Sieg.«
Unterdessen hatte man Oberst de Montrevel das Pferd Branche-d’Ors gebracht. Er schwang sich in den Sattel.
Roland ließ den Blick über das Schlachtfeld schweifen, stieß einen Seufzer aus und galoppierte mit einem letzten Abschiedsgruß in Cadoudals Richtung über die Felder davon, um auf der Straße nach Vannes den Wagen mit Verwundeten und Gefangenen zu erwarten, den er zu General Harty eskortieren sollte.
Cadoudal hatte jedem seiner Männer den Betrag von zehn Francs auszahlen lassen. Roland musste unwillkürlich denken, dass der royalistische Anführer leicht großzügig sein konnte mit dem Geld des Direktoriums, das Morgan und seine bedauernswerten Gefährten um den Preis ihres Lebens in den Westen befördert hatten.
Am nächsten Tag war Roland in Vannes; in Nantes nahm er die Postkutsche, und zwei Tage später war er in Paris.
Kaum hatte Bonaparte von seiner Ankunft erfahren, ließ er ihn in sein Kabinett bringen. »Wohlan!«, sagte er, als Roland eintrat. »Wie ist dieser Cadoudal? Und war es die Mühe wert, ihn aufzusuchen?«
»General«, erwiderte Roland, »wenn Cadoudal bereit wäre, sich uns für eine Million anzuschließen, dann geben Sie ihm zwei und verkaufen Sie ihn nicht unter vier Millionen zurück.«
So beredt diese Antwort war, genügte sie Bonaparte keineswegs; Roland musste ihm in aller Ausführlichkeit seine Begegnung mit Cadoudal im Dorf Muzillac schildern, den nächtlichen Marsch, so ungewöhnlich von Chouans als Aufklärern begleitet, und schließlich das Gefecht, in dem General Harty nach wahren Wundern der Tapferkeit unterlegen war.
Männer wie Cadoudal waren ganz nach Bonapartes Sinn. Oft hatte er mit Roland über Cadoudal gesprochen, und immer wieder hatte er gehofft, eine Niederlage könnte den bretonischen Anführer dazu bewegen, der royalistischen Sache abtrünnig zu werden. Doch dann hatte Bonaparte die Alpen überquert und den Bürgerkrieg über dem Krieg im Ausland vergessen oder dem Anschein nach vergessen. Am 20. und 21. Mai hatte er den Sankt Bernhard überschritten; bei Turbigo hatte er am 31. desselben Monats das Tessin durchquert, hatte Mailand am 2. Juni betreten und die Nacht des 2. Juni in Montebello damit verbracht, sich mit General Desaix zu beraten, der aus Ägypten zurückgekommen war; am 12. Juni hatte die Armee an der Scrivia Stellung bezogen, und am 14. Juni hatte Bonaparte die Schlacht bei Marengo geschlagen, in deren Verlauf Roland, des Lebens überdrüssig, einen Munitionswagen in Brand gesetzt und sich dabei in die Luft gesprengt hatte.
Zwar gab es niemanden mehr, mit dem er über Cadoudal sprechen konnte, doch Bonaparte musste immer wieder an ihn denken. Am 28. Juni war er wieder in Lyon. Den Rest des Jahres hatte er damit verbracht, den Frieden von Lunéville auszuarbeiten.
Man schrieb bereits die ersten Tage des Jahres 1801, als der Erste Konsul von Brune einen Brief erhielt, dem folgendes Schreiben Cadoudals beigelegt war.
General,
gälte es nur gegen die fünfunddreißigtausend Mann zu kämpfen, die Sie im Morbihan aufgestellt haben, zögerte ich nicht, die Kampagne fortzusetzen, die ich seit über einem Jahr führe, und ich würde sie durch einen Scharmützelkrieg Mann für Mann vernichten. Doch andere würden an ihre Stelle treten, und Folge einer Fortdauer dieses Krieges wären unvorstellbare Schrecknisse.
Bestimmen Sie den Tag eines Gesprächs auf Ihr Ehrenwort; ich werde mich furchtlos bei Ihnen einfinden, allein oder in Begleitung. Ich werde für mich und für meine Männer verhandeln und werde Ansprüche nur für sie erheben.
GEORGES CADOUDAL
Bonaparte schrieb unterhalb der Signatur Cadoudals:
Sofort Verabredung treffen und alle Bedingungen erfüllen, vorausgesetzt, Georges und seine Leute legen die Waffen nieder.
Verlangen, dass er mich unter Ihrem sicheren Geleit in Paris aufsucht. Ich will diesen Mann aus der Nähe kennenlernen und beurteilen.
Bonaparte hatte den Brief mit eigener Hand beantwortet und sogar die Anschrift geschrieben, die lautete: »An General Brune, Oberbefehlshaber der Armee im Westen.«
General Brune hatte sein Lager auf der Straße von Vannes nach Muzillac aufgeschlagen, auf der sich die Schlacht der Hundert abgespielt hatte, die General Harty verloren und die Roland mit angesehen hatte.
Georges suchte ihn auf, von lediglich zwei Aides de Camp begleitet, die mit Rücksicht auf den feierlichen Anlass auf ihre Spitznamen verzichtet und ihre bürgerlichen Namen Sol de Grisolles und Pierre Guillemot wieder angenommen hatten.
Brune reichte ihm die Hand und führte ihn an den Rand eines Grabens, an dem alle vier sich niederließen.
Im selben Augenblick, in dem sie das Gespräch eröffnen wollten, erschien Branche-d’Or mit einem Brief von solcher Wichtigkeit, wie man ihm erklärt hatte, dass er ihn dem General unbedingt sofort überbringen musste. Die Blauen hatten ihn bis zu seinem Anführer durchdringen lassen; dieser nahm den Brief mit Brunes Erlaubnis entgegen und las ihn.
Nach der Lektüre faltete er mit unbewegter Miene den Brief zusammen, legte ihn in seinen Hut und wandte sich an Brune. »Ich höre, General«, sagte er.
Nach zehn Minuten war alles geregelt. Die Chouans kehrten alle nach Hause zurück, Offiziere wie Soldaten, unbehelligt jetzt und in Zukunft dank des Gelöbnisses ihres Anführers, dass sie die Waffen ohne seinen Befehl nicht wieder ergreifen würden.
Er für sein Teil verlangte, das Land, die Mühle und das Haus in seinem Besitz zu verkaufen, ohne irgendeine andersgeartete Entschädigung anzunehmen, um sich bereit erklären zu können, von dem so erlösten Geld in England zu leben.
Was eine Begegnung mit dem Ersten Konsul betraf, erklärte er, er betrachte dies als große Ehre und sei bereit, nach Paris aufzubrechen, sobald er sich mit einem Notar in Vannes über den Verkauf seines Besitzes und mit Brune über sicheres Geleit verständigt haben würde.
Für seine zwei Aides de Camp, die er als Zeugen für seine Unterredung mit Bonaparte nach Paris mitnehmen zu dürfen erbat, verlangte er lediglich die gleichen Bedingungen wie für die anderen: dass die Vergangenheit vergessen sei und die Zukunft unbehelligt.
Brune ließ sich Feder und Tinte bringen.
Das Abkommen wurde auf einer Trommel aufgesetzt. Man gab es Georges zu lesen, der es unterzeichnete und von seinen Aides de Camp unterzeichnen ließ. Brune unterschrieb zuletzt und versprach mit seinem persönlichen Ehrenwort, dass alles wie vereinbart ausgeführt werden würde.
Während eine Kopie des Abkommens verfasst wurde, nahm Cadoudal den Brief, den er erhalten hatte, aus seinem Hut und zeigte ihn Brune. »Lesen Sie, General«, sagte er. »Sie werden sehen, dass nicht Geldmangel mich dazu bewogen hat, Frieden mit Ihnen zu schließen.«
In der Tat verkündete der Brief, der aus England kam, ein Geldbetrag von dreihunderttausend Francs sei bei einem Bankier in Nantes hinterlegt mit der Anweisung, dieses Geld Georges Cadoudal auszuhändigen.
Cadoudal ergriff die Feder und schrieb auf die Rückseite des Briefes:
Monsieur,
schicken Sie das Geld nach London zurück. Ich habe mit General Brune Frieden geschlossen und kann daher keine Gelder annehmen, die für Kriegszwecke bestimmt sind.
GEORGES CADOUDAL
Drei Tage nach Unterzeichnung des Abkommens besaß Bonaparte eine Kopie des Schriftstücks, an deren Rand Brune die Einzelheiten vermerkt hatte, die wir dem Leser soeben unterbreitet haben.
Zwei Wochen später hatte Georges seinen Besitz veräußert und einen Betrag von sechzigtausend Francs erlöst. Am 13. Februar kündigte er Brune an, er wolle nach Paris aufbrechen, und am 18. verkündete der Moniteur in der Rubrik »Bekanntmachungen«:
Georges Cadoudal begibt sich nach Paris, um die Regierung aufzusuchen. Er ist um die dreißig, Sohn eines Müllers, liebt den Krieg, hat eine gute Erziehung erhalten und zu General Brune gesagt, man habe seine ganze Familie guillotiniert, er wünsche sich mit der Regierung zu verbünden, und man möge seine Verbindungen zu England vergessen, die er nur geknüpft habe, um sich dem Regime von 1793 zu widersetzen und der Anarchie, die im Begriff zu stehen schien, ganz Frankreich zu verschlingen.
Bonaparte hatte gewusst, warum er zu Bourrienne, der ihm die französischen Zeitungen vorlesen wollte, gesagt hatte: »Nicht nötig, Bourrienne; die drucken nur das, was ich ihnen erlaube.«
Es war nicht zu übersehen, dass die Zeitungsmeldung nicht nur aus Bonapartes Kabinett stammte, sondern auch mit seiner gewohnten Schläue verfasst war, dieser Mischung aus Voraussicht und Gehässigkeit. Aus Voraussicht malte der Erste Konsul eine Rehabilitierung Cadoudals aus und unterstellte ihm den Wunsch, der Regierung zu dienen, aus Gehässigkeit warf er ihm vor, sich gegen die Ereignisse von 1803 ausgesprochen zu haben.
Am angekündigten Tag war Cadoudal aufgebrochen, war am 16. Februar in Paris eingetroffen, hatte am 17. den Moniteur mit der Meldung über ihn gelesen und für einen Augenblick mit dem Gedanken gespielt, kehrtzumachen, ohne Bonaparte gesprochen zu haben, weil ihn die Form der Meldung kränkte, sich dann jedoch gesagt, es sei besser, die angebotene Audienz wahrzunehmen, dem Ersten Konsul den Treueid zu schwören und sich wie zu einem Duell in die Tuilerien zu begeben, nämlich in Begleitung seiner zwei Sekundanten und Offiziere Sol de Grisolles und Pierre Guillemot.
Durch Vermittlung des Kriegsministers hatte er den Tuilerienpalast von seiner Ankunft in Paris benachrichtigen lassen und umgehend die Bestätigung seiner Audienz für den nächsten Tag, den 19. Februar, um neun Uhr vormittags erhalten.
Und zu dieser Audienz begab sich der Erste Konsul Bonaparte in unserem ersten Kapitel so eilig und neugierig.
8
Die Begegnung
Die drei royalistischen Anführer warteten im großen Empfangssalon, den man offiziell weiterhin den Salon Ludwigs XIV. und inoffiziell den Salon der Kokarde nannte. Alle drei trugen die Uniform der royalistischen Heerführer, denn das hatte Cadoudal zur Bedingung gemacht.
Diese Uniform bestand aus einem weichen Filzhut mit weißer Kokarde und einem grauen Rock mit grünem Kragen, bei Cadoudal mit goldener Tresse, bei den rangniederen Offizieren mit silberner. Dazu trugen sie bretonische Hosen, lange graue Gamaschen und Westen aus weißem Pikeestoff.
Die drei Offiziere traten vor, den Säbel an der Seite.
Duroc berührte bei ihrem Anblick Bonapartes Arm, und der Erste Konsul blieb stehen und sah seinen Aide de Camp an.
»Was ist los?«, fragte Bonaparte.
»Sie haben ihre Säbel«, sagte Duroc leise.
»Und wenn schon!«, erwiderte Bonaparte. »Sie sind schließlich keine Gefangenen. Oder?«
»Schon gut«, sagte Duroc, »ich werde die Tür offen lassen.«
»Ha! Das werden Sie auf keinen Fall tun! Es sind Gegner, aber loyale Gegner. Haben Sie vergessen, was unser armer Kamerad Roland uns von ihnen erzählt hat?«
Schnellen Schritts und ohne Zögern betrat er den Salon, in dem die drei Chouans warteten, und bedeutete Rapp und zwei weiteren Offizieren, die sich zweifellos auf besondere Ordre dort aufhielten, den Raum zu verlassen.
»Aha, da sind Sie endlich!«, sagte Bonaparte, der Cadoudal zwischen seinen beiden Gefährten aufgrund der Beschreibung erkannte, die ihm gemacht worden war. »Unser gemeinsamer Freund, den wir leider in der Schlacht von Marengo verloren haben, Oberst Roland de Montrevel, hat nur das Beste über Sie berichtet.«
»Das wundert mich nicht«, erwiderte Cadoudal. »Während der kurzen Zeit, in der ich die Ehre der Bekanntschaft Monsieur Roland de Montrevels hatte, ist mir sein überaus ritterliches Betragen aufgefallen. Sie wissen, wer ich bin, General, doch es obliegt mir, Ihnen die zwei Männer vorzustellen, die mich begleiten und die Ehre Ihrer Gegenwart genießen.«
Bonaparte verneigte sich leicht, wie um anzudeuten, dass er zuhöre.
Cadoudal legte dem älteren der Offiziere die Hand auf den Arm. »Als junger Mann in die Kolonien verbannt, hat Monsieur Sol de Grisolles die Meere überquert, um nach Frankreich zurückzukehren, und dabei Schiffbruch erlitten; allein und ohnmächtig wurde er auf einer Planke mitten im Ozean aufgefischt, als die Wogen ihn zu verschlingen drohten. Unter der Revolution eingekerkert, durchbrach er die Wand seines Verlieses und konnte fliehen. Am Tag darauf kämpfte er in unseren Reihen. Ihre Soldaten waren fest entschlossen, ihn gefangen zu nehmen, koste es, was es wolle. Während der Friedensverhandlungen dringen sie in das Haus ein, das ihm als Zuflucht dient. Allein bietet er fünfzig Soldaten die Stirn; bald genug hat er keine Munition mehr und muss sich entscheiden, ob er sich ergeben oder aus einem Fenster in zwanzig Fuß Höhe springen will. Er zögert nicht, springt, stürzt mitten unter Republikaner, fällt, steht auf, tötet zwei von ihnen, verwundet drei, läuft los und entkommt im Hagel der Kugeln, die ihm um die Ohren pfeifen, ohne ihn zu treffen. Und dieser hier«, Cadoudal blickte zu Pierre Guillemot, »wurde vor einigen Tagen während einer Rast auf einem Bauernhof überrascht. Ihre Leute waren in sein Zimmer eingedrungen, bevor er zu Säbel oder Karabiner greifen konnte. Er nimmt eine Axt und spaltet dem ersten Soldaten, der ihm entgegentritt, den Kopf. Die Republikaner weichen zurück, Guillemot, der seine Axt schwingt, erreicht die Tür, pariert einen Bajonettstoß, der ihn nur ritzt, und jagt querfeldein davon; ein Schlagbaum mit Schildwache versperrt ihm den Weg, er tötet die Schildwache und läuft weiter; ein Blauer, ein schnellerer Läufer als Pierre, droht ihn einzuholen, Guillemot dreht sich um, reißt ihm mit einem Axthieb die Brust auf und entkommt als freier Mann zu mir und meinen Chouans. Was mich betrifft -«, fuhr Cadoudal mit einer bescheidenen Verbeugung fort.
»Was Sie betrifft«, unterbrach ihn Bonaparte, »weiß ich mehr über Sie, als Sie mir erzählen könnten. Sie haben die Heldentaten Ihrer Väter übertroffen, denn statt einer Schlacht der Dreißig haben Sie eine Schlacht der Hundert geschlagen, und später einmal wird man den Krieg, den Sie geführt haben, den ›Krieg der Riesen‹ nennen«, dann, indem er einen Schritt vortrat: »Kommen Sie, Georges, ich muss mit Ihnen sprechen.«
Georges folgte ihm, wenn auch zögernd. Offensichtlich wäre ihm lieber gewesen, dass seine zwei Begleiter die Worte hören konnten, die zwischen ihm und dem Oberhaupt der französischen Republik gewechselt wurden.
Stattdessen wahrte Bonaparte so lange Schweigen, bis sie außer Hörweite waren.
»Hören Sie, Georges«, sagte er, »Männer von Ihrer Tatkraft benötige ich, um das Werk zu vollenden, das ich begonnen habe. Ich hatte ein Herz aus Erz an meiner Seite, auf das ich mich wie auf mich selbst verlassen konnte. Sie kannten ihn: Roland de Montrevel. Ein Kummer, dessen Ursache ich mir nie erklären konnte, hat ihn in den Selbstmord getrieben, denn nichts anderes als Selbstmord war sein Tod. Wollen Sie einer der Meinen sein? Ich habe Ihnen den Rang eines Obersten anbieten lassen, das ist unter Ihrer Würde: Ich biete Ihnen den Rang eines Divisionsgenerals an.«
»General, ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen«, erwiderte Georges, »aber nähme ich an, müssten Sie mich verachten.«
»Und warum?«, fragte Bonaparte erzürnt.
»Weil ich den Bourbonen Treue geschworen habe und ihnen die Treue halten will.«
»Hm, hm«, sagte der Erste Konsul, »gibt es denn keinen Weg, Sie für meine Seite zu gewinnen?«
Cadoudal schüttelte den Kopf.
»Man hat mich bei Ihnen verleumdet«, sagte Bonaparte.
»General«, fragte der royalistische Offizier, »erlauben Sie mir, Ihnen alles, was ich gehört habe, zu wiederholen?«
»Warum nicht! Denken Sie, mir gebräche es am erforderlichen Gleichmut, Gutes wie Böses, was über mich geredet wird, zu ertragen?«
»Vergessen Sie nicht«, sagte Cadoudal, »dass es nicht meine Worte sind, sondern die Worte, die ich gehört habe.«
»Sprechen Sie sie aus«, sagte der Erste Konsul mit leicht beunruhigtem Lächeln.
»Es wird behauptet, Ihre glückliche Rückkehr aus Ägypten, die unterwegs von keinem einzigen englischen Geschwader gestört wurde, verdanke sich einem Abkommen zwischen Ihnen und dem englischen Kommodore Sidney Smith, und dieses Abkommen habe zum Gegenstand, dass man Sie ungehindert nach Frankreich zurückkehren ließ und Sie sich dafür verpflichteten, den Thron unserer einstigen Herrscher wiederzuerrichten.«
»Georges«, sagte Bonaparte, »Sie gehören zu denjenigen, deren Achtung mir etwas wert ist und bei denen ich mich nicht verleumdet wissen will. Seit meiner Rückkehr aus Ägypten habe ich zwei Briefe des Grafen von Provence erhalten. Wenn es dieses Abkommen mit Sir Sidney Smith wirklich gäbe, glauben Sie nicht, dass Seine Königliche Hoheit es dann wenigstens in einem der zwei Briefe erwähnt hätte, die mir zu schreiben er mir die Ehre erwiesen hat? Nun gut! Sie werden beide Briefe lesen und sich selbst vergewissern können, ob der Vorwurf, den man mir macht, begründet ist.«
Da sie sich beim Auf- und Abwandern im Gespräch wieder der Tür genähert hatten, riss Bonaparte sie auf.
»Duroc«, befahl er, »lassen Sie sich von Bourrienne in meinem Namen die zwei Briefe von Monsieur dem Grafen von Provence und meine Antwort aushändigen; sie befinden sich in der mittleren Schublade meines Schreibtischs, in der roten Mappe«, und während Duroc seinen Auftrag ausführte, fuhr er fort: »Was seid ihr Plebejer nur für ein kurioser Menschenschlag mit eurer inbrünstigen Verehrung eurer einstigen Könige! Angenommen, ich führte ihre Herrschaft wieder ein – wozu ich nicht die mindeste Neigung habe, wie ich nicht eigens betonen muss -, was hätten Sie dann davon, Ihr Blut für die Wiedereinführung dieser Herrschaft vergossen zu haben? Nicht einmal die Bestätigung des Rangs, den Sie sich verdient haben. Ein Müllerssohn als Oberst! Das wäre ja noch schöner! Und haben Sie jemals in einer königlichen Armee einen Oberst von nichtadeliger Herkunft gesehen? Haben Sie jemals erlebt, dass ein Mann es bei diesen Undankbaren aus eigenem Verdienst oder gar mittels geleisteter Dienste zu einer höheren Stellung gebracht hätte? Bei mir dagegen, Georges, können Sie alles erreichen, was Sie wollen, denn je weiter ich komme, desto weiter kommen jene, die mich begleiten. Aha! Sehen Sie, da haben wir die Briefe. Gib her, Duroc.«
Duroc reichte ihm drei Papiere. Das erste, das Bonaparte entfaltete, trug das Datum des 20. Februar 1800; wir geben den Brief des Grafen von Provence in seinem ursprünglichen, unveränderten Wortlaut wieder.
Ungeachtet des Anscheins, den ihr Betragen erwecken mag, können Männer wie Sie, Monsieur, niemals Gefühle der Besorgnis einflößen. Sie haben einen herausragenden Platz eingenommen, und ich weiß Ihnen dafür Dank. Sie wissen besser als jeder andere, was es an Kraft und Durchsetzungsvermögen erfordert, um eine große Nation glücklich zu machen. Retten Sie Frankreich vor der Selbstzerfleischung, und Sie erfüllen den inbrünstigsten Wunsch meines Herzens. Geben Sie ihm seinen König zurück, und künftige Generationen werden Ihr Andenken segnen. Der Staat wird Ihrer stets so dringend bedürfen, dass ich meine Dankesschuld und die meines Vorfahren durch keinen bedeutenden Posten begleichen könnte.
LOUIS
»Sehen Sie darin auch nur die Spur eines Abkommens?«, fragte Bonaparte.
»Mein General, ich muss Ihnen recht geben«, erwiderte Georges. »Aber Sie haben diesen Brief nicht beantwortet?«
»Ich muss gestehen, dass ich die Sache nicht für sonderlich dringend hielt und erst einen zweiten Brief abwarten wollte, bevor ich einen Entschluss fasste. Nun, ich musste nicht lange warten. Wenige Monate später erreichte mich folgender undatierte Brief:
Seit Langem, General, dürften Sie wissen, dass Sie meine Achtung erworben haben. Zweifelten Sie daran, dass ich mich dankbar zu zeigen vermöchte, nennen Sie Ihren Platz und entscheiden Sie über das Geschick Ihrer Freunde. In meinen Grundsätzen bin ich Franzose, mildtätig aus Neigung, und verstünde es aus Vernunft obendrein zu sein.
O nein, der Sieger von Lodi, von Castiglione, von Arcoli, der Eroberer Italiens und Ägyptens, kann dem Ruhm keine nichtige Berühmtheit vorziehen. Dennoch verlieren Sie kostbare Zeit: Wir können Frankreichs Ruhm gewährleisten, und ich sage »wir«, da ich dafür auf Bonaparte angewiesen bin und er es ohne mich nicht vermöchte.
General, Europa hat den Blick auf Sie gerichtet, der Ruhm harrt Ihrer, und ich wünsche mir inbrünstig, meinem Volk den Frieden zu geben.
LOUIS
Sie sehen, Monsieur«, sagte Bonaparte, »auch im zweiten keine Spur von einem Abkommen.«
»Darf ich fragen, General, ob Sie diesen Brief beantwortet haben?«
»Ich wollte ihn von Bourrienne beantworten lassen und unterschreiben, doch Bourrienne machte mich darauf aufmerksam, dass die Briefe des Grafen von Provence handschriftlich verfasst waren und es geziemender wäre, mit eigener Schrift zu antworten, sei sie noch so unleserlich. – Da es sich um keine Bagatelle handelte, habe ich mich nach Kräften bemüht und recht entzifferbar den Brief geschrieben, dessen Abschrift wir hier haben.«
Und er zeigte Georges eine Kopie seines Briefes an den Grafen von Provence, von Bourrienne geschrieben. Der Brief enthielt folgenden abschlägigen Bescheid:
Monsieur, ich habe Ihren Brief erhalten; ich danke Ihnen für die schmeichelhaften Dinge, die Sie darin äußern.
Wünschen Sie nicht, nach Frankreich zurückzukehren; Sie müssten über Berge zahlloser Leichen gehen.
Opfern Sie Ihre Wünsche dem Frieden und dem Wohlergehen Frankreichs, und die Geschichte wird es Ihnen vergelten.
Das Ihrer Familie widerfahrene Leid lässt mich nicht unberührt, und mit Freuden erführe ich, dass Sie auf nichts verzichten müssen, was Ihnen das Leben auf Ihrem Ruhesitz versüßen kann.
BONAPARTE
»Und das«, fragte Georges, »ist wahrhaftig Ihr letztes Wort, nicht wahr?«
»Mein letztes Wort.«
»Obwohl es in der Geschichte einen Fall gegeben hat -«
»In der englischen Geschichte, nicht in unserer, Monsieur«, unterbrach ihn Bonaparte. »Ich soll Moncks Rolle einnehmen? Besten Dank! Müsste ich wählen und wollte ich jemanden nachahmen, dann wählte ich lieber die Rolle Washingtons. Monck lebte in einer Zeit, in der die Vorurteile, die wir 1789 bekämpft und vom Sockel gestürzt haben, unangefochten herrschten; Monck wollte König werden, was er nicht konnte, und Diktator mit nicht mehr Erfolgsaussichten; dafür bedurfte es Cromwells überlegener Fähigkeiten. Richard, sein Sohn, konnte sich nicht im Sattel halten – ein Schwachkopf, typischer Sohn eines großen Mannes. Und dann, als Krönung des Ganzen, die Restauration unter Charles II.! Ein liederlicher Hof statt eines frömmlerischen Hofes! Er ahmte das Beispiel seines Vaters nach und zerschlug mehrere Parlamente, wollte als Alleinherrscher regieren, schuf sich ein Ministerium aus Lakaien, das ihm für seine Ausschweifungen dienlicher war als für seine Regierungsgeschäfte. In seiner Vergnügungssucht scheute er vor nichts zurück, um sich Geld zu verschaffen: An Ludwig XIV. verkaufte er Dünkirchen, das für England eine Schlüsselstellung besaß, was Frankreich betrifft; unter dem Vorwand einer erfundenen Verschwörung ließ er Algernon Sidney hinrichten, der zwar zu jenem Ausschuss zählte, der beauftragt war, Charles I. hinzurichten, doch hatte Sidney sich geweigert, an der Sitzung teilzunehmen, in der das Urteil gefällt wurde, und sich noch störrischer geweigert, das Schriftstück zu unterzeichnen, das die Hinrichtung des Königs anordnete. Cromwell starb 1685, das heißt im Alter von neunundfünfzig Jahren. In den zehn Jahren, die er an der Macht war, konnte er vieles anfangen und nur wenig vollenden. Zudem war sein Ziel eine völlige Umgestaltung: politisch durch die republikanische Regierung anstelle der Monarchie, in religiöser Hinsicht durch die Abschaffung der katholischen Religion zugunsten der protestantischen. Nun gut! Lassen Sie mich so lange leben wie Cromwell; neunundfünfzig Jahre, das ist nicht viel, oder? Ich habe noch dreißig Jahre vor mir, das Dreifache von Cromwells Lebensspanne; und bedenken Sie, dass ich nichts umstürze, sondern mich damit begnüge weiterzumachen; ich verändere nichts, sondern veredle es.«
»Sehr gut«, entgegnete Cadoudal lachend. »Und wie stand es mit dem Direktorium?«
»Das Direktorium war keine Regierung«, sagte Bonaparte. »Wie hätte auf einer so verkommenen Grundlage wie der des Direktoriums eine Regierung möglich sein sollen? Wäre ich nicht aus Ägypten zurückgekehrt, wäre es von ganz allein zusammengebrochen. Ich musste es nur anstoßen. Frankreich wollte davon nichts mehr wissen, und der beste Beweis ist der Empfang, den es mir bei meiner Rückkehr bereitet hat. Was hatten sie aus dem Frankreich gemacht, das ich so hoffnungsvoll hinterlassen hatte? Ein armes Land, allseits vom Feind bedroht, der drei seiner Grenzen bereits überschritten hatte. Ich hatte Frieden hinterlassen und fand Krieg vor; ich hatte Siege hinterlassen und fand Niederlagen vor; ich hatte die Millionen aus Italien hinterlassen und fand allerorten blutsaugerische Gesetze und Elend vor. Was geschah mit den zehntausend Soldaten, die meinen Ruhm teilten, die ich alle beim Namen kannte? Sie sind tot. Während ich Malta einnahm, Alexandria, Kairo, während ich mit der Spitze unserer Bajonette Frankreichs Namen in Thebens Pylone und die Obelisken von Karnak einmeißelte, während ich mich anschickte, am Fuß des Tabor die Niederlage des letzten Königs von Jerusalem zu rächen – was taten sie da mit meinen besten Generälen? Humbert ließen sie in Irland gefangen nehmen; Championnet ließen sie in Neapel verhaften und mit Schmutz bewerfen; mit seinem Rückzug hat Schérer die Spur des Sieges verwischt, die ich in Italien gezogen hatte; den Engländern wurde ermöglicht, die holländischen Grenzen entlang einzudringen; Raimbault wurde in Turin getötet, David in Alkmaar, Joubert in Novi. Und als ich Verstärkung von ihnen verlangte, um Ägypten zu halten, Munition, um es zu verteidigen, und Getreide, um es zu besäen, da schickten sie mir Gratulationsschreiben und teilten mir mit, die Armée de l’orient habe sich um das Vaterland verdient gemacht.«
»Sie dachten, Sie würden das alles in Akko finden, General.«
»Das war meine einzige Niederlage, Georges«, sagte Bonaparte, »und hätte ich gesiegt, dann hätte ich ganz Europa aus der Fassung gebracht, glauben Sie mir! Hätte ich gesiegt! Ich will Ihnen sagen, wie ich dann vorgegangen wäre: Ich hätte in der Stadt die Schatzkammern des Paschas geplündert und mir Waffen für dreihunderttausend Mann beschafft; ganz Syrien, das sich über Djasars Blutrünstigkeit empörte, hätte ich aufgewiegelt und bewaffnet, ich hätte Damaskus und Aleppo belagert, meine Armee hätte ich während des Vordringens im Land mit allen Unzufriedenen gefüllt, ich hätte den Völkern die Abschaffung der Knechtschaft und der Tyrannenherrschaft der Paschas verkündet, in Konstantinopel wäre ich mit bewaffneten Menschenmengen angekommen, ich hätte das Osmanische Reich gestürzt, hätte im Orient ein neues Großreich begründet, das mir einen Platz in der Nachwelt garantierte, und über Andrinopel oder Wien wäre ich nach Vernichtung des Habsburgerreichs nach Paris zurückgekehrt!«
»Cäsar, der den Krieg gegen die Parther zu führen gedenkt«, erwiderte Cadoudal unbeeindruckt.
»Ha! Ich wusste doch«, sagte Bonaparte mit unfrohem Lachen, »dass wir bei Cäsar ankommen würden. Nun denn! Sie sehen, dass ich bereit bin, Sie die Diskussion in jede Richtung wenden zu lassen, die Ihnen beliebt. Angenommen, Cäsar wäre mit neunundzwanzig Jahren, also in meinem Alter, nicht der größte Wüstling Roms und der am höchsten verschuldete Patrizier seiner Zeit gewesen, sondern der erste Citoyen seines Stadtstaates; angenommen ferner, er hätte seinen Gallischen Krieg hinter sich gehabt, seinen ägyptischen Feldzug bewältigt und seinen Krieg in Spanien glücklich zu Ende gebracht; angenommen also, er wäre zu diesem Zeitpunkt neunundzwanzig und nicht fünfzig Jahre alt gewesen – denn die Siegesgöttin liebt die jungen Sieger und lässt die alten im Stich -, denken Sie nicht, dass er dann sowohl Cäsar als auch Augustus gewesen wäre?«
»Gewiss«, erwiderte Cadoudal lebhaft, »wenn er nicht trotz alledem von den Dolchen des Brutus, des Cassius und des Casca gemeuchelt worden wäre.«
»Auf einen Meuchelmord also rechnen meine Widersacher!«, sagte Bonaparte melancholisch. »In diesem Fall wird die Sache ein leichtes Spiel sein und am allerleichtesten für Sie, denn Sie sind mein Gegner. Wer sollte Sie daran hindern, mich in diesem Augenblick niederzumachen, wie Brutus Cäsar niedermachte, wenn Sie seine Überzeugung teilen?«
»Nein«, sagte Georges. »Nein, wir rechnen nicht auf einen Meuchelmord, und ich glaube, es erforderte äußerst drastische Umstände, damit einer von uns freiwillig zum feigen Mörder würde. Aber mit den Wechselfällen des Krieges muss man rechnen.
Ein einziger Trommelschlag kann Sie all Ihres Einflusses berauben, eine Kugel kann Sie den Kopf kosten wie Marschall Berwick oder Sie tödlich verwunden wie Joubert oder Desaix. Und was soll dann aus Frankreich werden? Sie sind kinderlos, und Ihre Brüder -«
Bonaparte richtete einen durchdringenden Blick auf Cadoudal, der seinen Satz mit einem Schulterzucken beendete.
Bonaparte ballte zähneknirschend die Fäuste.
Georges hatte die Achillesferse seines Gegenübers entdeckt.
»Ich räume ein«, sagte Bonaparte, »dass Sie recht haben, wenn man es unter diesem Gesichtspunkt betrachtet; ich setze jeden Tag mein Leben aufs Spiel, und es kann mir jeden Tag genommen werden; Sie mögen nicht an die Vorsehung glauben, ich vertraue auf sie. Ich vertraue darauf, dass sie nicht ziel- und planlos wirkt. Ich bin überzeugt, sie hat es deshalb so eingerichtet, dass am 13. August 1769, auf den Tag genau ein Jahr nachdem Ludwig XV. das Edikt erlassen hatte, das Korsika an Frankreich anschloss, in Ajaccio ein Kind geboren wurde, das später einmal der Mann des 13. Vendémiaire und des 18. Brumaire sein würde, weil sie mit diesem Kind Großes im Sinn hatte. Dieses Kind bin ich, und bis heute hat die Vorsehung in allen Fährnissen ihre Hand über mich gehalten. Wenn ich eine Sendung habe, kenne ich keine Furcht, denn die Sendung ist mein Schutzpanzer; sollte ich mich aber täuschen und keine Sendung haben, sollte ich von zweiundzwanzig Messerstichen getroffen werden wie Cäsar, statt die nächsten fünfundzwanzig oder dreißig Jahre zu erleben, die ich für die Vollendung meines Werks als nötig betrachte, sollte mir der Kopf weggeschossen werden wie Berwick, sollte mir eine Kugel in die Brust beschieden sein wie Joubert oder Desaix: dann wird die Vorsehung ihre Gründe dafür haben, und sie wird wissen, was für Frankreich das Beste ist. Die Vorsehung, Georges, glauben Sie mir, die Vorsehung lässt eine große Nation nie im Stich. Wir sprachen von Cäsar, Sie führten ihn mir vor Augen, wie er zu Füßen der Statue des Pompejus zusammenbrach, ermordet von Brutus, Cassius und Casca. Als die trauernden Römer den Diktator zu Grabe trugen, als das Volk die Häuser seiner Mörder niederbrannte, als die Ewige Stadt beim Anblick des Trunkenbolds Antonius und des Heuchlers Lepidus erbebte und in allen Himmelsrichtungen der Welt nach dem genialen Kopf Ausschau hielt, der den unablässigen Bürgerkriegen ein Ende setzen würde, hätte niemand ernsthaft den Schüler aus Apollonia, den jungen Octavius, in Betracht gezogen. Wer hätte mit diesem Bankierssohn aus Velletri gerechnet, weiß bestäubt vom Mehl seiner Ahnen? Wer hätte sich um diesen schwächlichen Knaben geschert, dem alles Furcht einjagte, Hitze, Kälte, Donner? Wer hätte in ihm den künftigen Herrscher über die Welt geahnt, als er wie ein Nachtvogel bleich und mit blinzelnden Augen angehinkt kam, um Cäsars alte Kumpane vorbeidefilieren zu sehen? Nicht einmal der weitsichtige Cicero. Ornandum et tollendum, lautete seine Devise. Aber dieses Kind, das bei seinem ersten Auftreten gefeiert und bei erstbester Gelegenheit beiseitegeschafft werden sollte, dieses Kind täuschte geschickt alle Grauköpfe im Senat und regierte Rom, das Cäsar ermordet hatte, weil es keinen König wollte, fast genauso lange wie Ludwig XIV. Frankreich. Georges, Georges, stellen Sie sich nicht gegen die Vorsehung, die mich leitet, denn sonst wird die Vorsehung Sie vernichten.«
»Wohlan denn!«, sagte Georges, der sich verneigte, »dann werde ich wenigstens vernichtet, weil ich dem Weg und der Religion meiner Väter gefolgt bin, und Gott wird mir vielleicht meinen Irrtum vergeben, weil er von einem frommen Gläubigen und treuen Sohn begangen wurde.«
Bonaparte legte dem jungen Mann die Hand auf die Schulter.
»Nun gut!«, sagte er. »Aber bleiben Sie neutral. Lassen Sie die Geschehnisse ihren Lauf nehmen, lassen Sie die Throne wackeln und die Kronen fallen; üblicherweise müssen die Zuschauer bezahlen, ich aber werde Sie für das Zuschauen bezahlen.«
»Und wie viel wollen Sie mir dafür bezahlen, Citoyen Erster Konsul?«, fragte Cadoudal.
»Hunderttausend Francs jährlich«, erwiderte Bonaparte.
»Wenn Sie einem einfachen Partisanenführer hunderttausend Francs jährlich geben, wie viel bieten Sie dann dem Fürsten an, für den er gekämpft hat?«
»Nichts, Monsieur«, sagte Bonaparte ungnädig. »Sie bezahle ich für Ihren Mut, nicht für Ihre Überzeugungen; ich will Ihnen zeigen, dass für mich, den Mann meiner Taten, die anderen nur durch ihre Taten existieren. Nehmen Sie an, Georges, ich bitte Sie.«
»Und wenn ich ablehne?«
»Handeln Sie falsch.«
»Und es steht mir frei, mich an einen Ort meiner Wahl zurückzuziehen?«
Bonaparte ging zu der Tür, die ins Kabinett führte, und öffnete sie. »Duroc!«, rief er.
Duroc erschien.
»Sorgen Sie dafür«, sagte Bonaparte, »dass sich Monsieur Cadoudal und seine zwei Freunde in Paris so ungehindert bewegen können wie in ihrem Feldlager in Muzillac; und wenn sie Pässe für irgendein Land haben wollen, hat Fouché Ordre, sie ihnen auszustellen.«
»Ihr Wort genügt mir, Citoyen Erster Konsul«, sagte Cadoudal mit einer Verneigung. »Ich werde heute Abend aufbrechen.«
»Darf man fragen, wohin?«
»Nach London, General.«
»Umso besser.«
»Warum umso besser?«
»Weil Sie dort die Menschen, für die Sie gekämpft haben, aus größter Nähe erleben werden.«
»Und?«
»Und wenn Sie sie erlebt haben werden -«
»Was dann?«
»Dann werden Sie sie mit jenen vergleichen, gegen die Sie gekämpft haben. Doch sobald Sie Frankreich einmal verlassen haben, Oberst -« Bonaparte hielt inne.
»Ich höre«, sagte Cadoudal.
»Nun denn! Kehren Sie nur zurück, wenn Sie mich vorher davon verständigt haben, denn sonst muss ich Sie als Gegner behandeln.«
»Das wäre mir eine Ehre, General, denn damit würden Sie mir zeigen, dass ich jemand bin, den man fürchten muss.«
Georges salutierte und verließ den Ersten Konsul.
Am nächsten Tag stand in der Zeitung zu lesen:
Im Anschluss an die Audienz, die der Erste Konsul Georges Cadoudal gewährt hat, bat Letzterer um die Erlaubnis, sich als freier Mann nach England zurückzuziehen.
Diese Erlaubnis wurde ihm unter der Bedingung gewährt, dass er nur mit regierungsseitiger Genehmigung nach Frankreich zurückkehren wird.
Georges Cadoudal hat sein Wort gegeben, alle Rebellenführer, die auf seiner Seite gekämpft haben, von ihrem Eid zu entbinden, der durch seine Unterwerfung gegenstandslos geworden ist.
Und wahrhaftig schrieb Georges noch am Abend seines Gesprächs mit dem Ersten Konsul in alle Gegenden Frankreichs, in denen er Vertraute besaß:
Da ein fortwährender Krieg mir Frankreich ins Unglück zu stürzen und mein Land zu zerstören schien, entbinde ich Euch von dem Treueschwur, den Ihr geleistet habt und auf den ich mich nur dann erneut berufen würde, wenn die französische Regierung das Wort bräche, das sie mir gegeben hat und das ich in Eurem Namen wie in meinem Namen angenommen habe.
Sollte sich hinter einem geheuchelten Frieden Verrat verbergen, würde ich abermals an Eure Treue appellieren, und auf Eure Treue, das weiß ich mit Gewissheit, wäre Verlass.
GEORGES CADOUDAL
Den Namen jedes einzelnen Vertrauten und Anführers schrieb Cadoudal wie das ganze Rundschreiben mit eigener Hand.
9
Zwei Waffenbrüder
Während sich im Salon Ludwigs XIV. diese bemerkenswerte Begegnung ereignete, zog Joséphine im Wissen, dass Bourrienne allein war, ihren Morgenmantel an, wischte sich die geröteten Augen, puderte sich das Gesicht dick mit Reispuder, schlüpfte in die türkischen Pantoffeln aus himmelblauem Samt mit Goldstickerei und stieg schnell die Treppe hinauf, die von ihrem Schlafzimmer in die Privatkapelle der Maria von Medici führte.
Vor der Tür des Kabinetts blieb sie stehen und presste beide Hände auf ihr Herz; mit ihren anmutigen Augen sah sie sich vorsichtig um, und als sie sich überzeugt hatte, dass Bourrienne tatsächlich ganz allein war, durchquerte sie mit lautlosen Trippelschritten das Kabinett und legte ihm die Hand auf die Schulter.
Der Sekretär drehte sich lächelnd um, denn an der leichten Berührung erkannte er, wem die Hand gehörte.
»Und?«, fragte Joséphine. »War er sehr zornig?«
»Nun«, sagte Bourrienne, »ich muss gestehen, dass es ein gewaltiger Gewittersturm war, nur ohne Regen. Aber mit Donner und Blitzen wurde nicht gespart.«
»Und«, fragte Joséphine ungeduldig, denn darauf richtete sich ihr ganzes Interesse, »wird er zahlen?«
»Ja.«
»Hat er Ihnen die sechshunderttausend Francs gegeben?«
»Das hat er«, sagte Bourrienne.
Joséphine klatschte in die Hände wie ein Kind, dem man eine Strafe erlässt.
»Aber in Zukunft«, fügte Bourrienne hinzu, »machen Sie um Himmels willen keine Schulden mehr oder wenigstens vernünftige Schulden.«
»Was verstehen Sie unter ›vernünftigen Schulden‹, Bourrienne?«, fragte Joséphine.
»Wie soll ich das wissen? Am besten wäre es, nie wieder welche zu machen.«
»Sie wissen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist, Bourrienne«, erwiderte Joséphine im Brustton der Überzeugung.
»Machen Sie Schulden von fünfzigtausend, von hunderttausend Francs.«
»Aber Bourrienne, wenn meine jetzigen Schulden bezahlt sind – und Sie haben durchblicken lassen, Sie könnten mit den sechshunderttausend Francs alle Schulden bezahlen -«
»Ja, was dann?«
»Ja, dann! Dann werden die Lieferanten mir wieder Kredit gewähren.«
»Und er?«
»Er?«
»Der Erste Konsul hat beteuert, es sei das letzte Mal gewesen, dass er für Ihre Schulden aufkommt.«
»Das hat er letztes Jahr auch gesagt, Bourrienne«, sagte Joséphine mit ihrem bezaubernden Lächeln.
Bourrienne sah sie entgeistert an. »Ich bin sprachlos«, sagte er, »Sie machen mir Angst. Zwei oder drei Jahre Frieden, und die paar armseligen Millionen, die wir aus Italien mitgebracht haben, werden dahin sein. In der Zwischenzeit will ich Ihnen wenigstens einen guten Rat geben, und zwar den, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, damit seine schlechte Laune sich verflüchtigen kann, bevor Sie ihm wieder unter die Augen treten.«
»Ach! Du lieber Himmel! Sie haben völlig recht – umso mehr, als ich heute Vormittag mit einer Landsmännin aus den Kolonien verabredet bin, einer Freundin meiner Familie, der Gräfin von Sourdis mit ihrer Tochter, und nichts wäre abscheulicher, als wenn er seinem Zorn freien Lauf ließe vor diesen Damen, die ich in der eleganten Welt kennengelernt habe und die zum ersten Mal in den Tuilerienpalast kommen.«
»Was gäben Sie dafür, wenn ich ihn hier festhielte, auch zum Mittagessen, und ihn erst zum Diner zu Ihnen ließe?«
»Was Sie nur wollen, Bourrienne.«
»Nun gut. Greifen Sie zu Feder und Papier, und schreiben Sie mit Ihrer hübschen kleinen Schrift...«
»Was?«
»Schreiben Sie!«
Joséphine setzte die Feder auf das Papier.
»Ich ermächtige Bourrienne, all meine Rechnungen aus dem Jahr 1800 zu begleichen und nach eigenem Ermessen die Rechnungsbeträge um die Hälfte oder sogar um zwei Drittel zu verringern.«
»Getan!«
»Datieren Sie es.«
»19. Februar 1801.«
»Und unterzeichnen Sie es.«
»Joséphine Bonaparte. Ist es so richtig?«
»Ausgezeichnet. Und jetzt gehen Sie, kleiden Sie sich an und empfangen Sie Ihre Freundin; der Erste Konsul wird Sie nicht stören.«
»Bourrienne, Sie sind wahrhaftig ein reizender Mensch.«
Und sie reichte ihm die Spitze ihrer Fingernägel zum Handkuss.
Bourrienne küsste ehrerbietig die dargebotenen Krallen und klingelte nach dem Bürodiener, der an der Schwelle des Kabinetts erschien.
»Landoire«, sagte Bourrienne, »sagen Sie dem Hausdiener, dass der Erste Konsul heute in seinem Kabinett zu Mittag speisen wird. Er soll den Beistelltisch und zwei Gedecke bringen lassen; wir werden ihn benachrichtigen, wenn aufgetragen werden soll.«
»Und wer wird mit dem Ersten Konsul speisen, Bourrienne?«, fragte Joséphine neugierig.
»Das muss Sie nicht kümmern, solange es jemand ist, der ihn in gute Laune versetzt.«
»Aber wer ist es?«
»Wäre Ihnen lieber, er speiste mit Ihnen zu Mittag?«
»O nein, Bourrienne, o nein!«, rief Joséphine. »Er soll speisen, mit wem er will, und sich erst zum Diner blicken lassen.«
Damit entschwand sie. Eine Gazewolke rauschte vorbei, und Bourrienne war allein.
Zehn Minuten darauf wurde die Tür des Paradeschlafzimmers geöffnet, und der Erste Konsul kam zurück.
Er trat zu Bourrienne und stemmte die Fäuste auf den Schreibtisch seines Sekretärs.
»Wohlan, Bourrienne«, sagte er, »jetzt habe ich den berühmten Georges mit eigenen Augen gesehen.«
»Und welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?«
»Er ist einer der alten Bretonen aus der niederbretonischen Bretagne«, sagte er, »aus dem gleichen Granit gehauen wie ihre Menhire und Dolmen, und ich müsste mich sehr täuschen, sollte ich nicht noch mit ihm zu tun haben. Er kennt keine Furcht und hat keine Wünsche. Solche Männer sind zum Fürchten, Bourrienne.«
»Zum Glück sind sie selten«, erwiderte sein Sekretär lachend. »Sie werden es am besten wissen, denn Sie haben genug Maulhelden und Windfahnen erlebt.«
»Apropos Windfahne, hast du Joséphine gesehen?«
»Kurz bevor Sie kamen.«
»Ist sie zufrieden?«
»Ein Stein von der Größe Montmartres ist ihr von der Seele genommen.«
»Warum hat sie nicht auf mich gewartet?«
»Sie hat sich vor einer Strafpredigt gefürchtet.«
»Bah! Sie weiß, dass ihr die nicht erspart bleibt.«
»Ja, aber wenn man bei Ihnen Zeit gewinnt, hat man Aussicht auf gute Laune. Außerdem erwartete sie um elf Uhr eine Dame aus ihrem Freundeskreis.«
»Wer ist es?«
»Eine Kreolin aus Martinique.«
»Und sie heißt?«
»Gräfin von Sourdis.«
»Und wer sind diese Sourdis? Kennt man den Namen?«
»Das fragen Sie mich?«
»Gewiss doch. Kannst du etwa nicht das französische Adelsbuch auswendig aufsagen?«
»Nun gut! Es ist eine Familie mit sowohl ausgesprochen klerikaler als auch militärischer Ausrichtung, die sich bis in das 14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. An dem französischen Vorstoß nach Neapel war, wenn ich mich recht erinnere, ein Graf von Sourdis beteiligt, der in der Schlacht von Garigliano wahre Heldentaten vollbrachte.«
»Die der Ritter Bayard so vollendet verlor.«
»Was halten Sie von dem Ritter ohne Furcht und Tadel?«
»Dass er seinen Namen verdient hat und gestorben ist, wie zu sterben der Wunsch jedes Soldaten sein sollte; aber ich habe keine hohe Meinung von all diesen tapferen Schwertfechtern: Als Generäle waren sie nichts wert. Franz I. war bei Pavia ein Dummkopf und bei Marignan ein Zauderer. Aber kehren wir zu den Sourdis zurück.«
»Gut. Unter Heinrich IV. gibt es eine Äbtissin von Sourdis, in deren Armen Gabrielle stirbt; sie war Parteigängerin der d’Estrées. Außerdem gibt es einen Grafen von Sourdis, Regimentsoberst unter Ludwig XV., der in der leichten Kavallerie bei Fontenoy große Tapferkeit bewiesen hat. Danach verliere ich sie in Frankreich aus den Augen; wahrscheinlich sind sie nach Amerika ausgewandert. In Paris haben sie das alte Stadtpalais Sourdis hinterlassen, das im Marais zwischen der Rue d’Orléans und der Rue d’Anjou liegt, und die Sackgasse Sourdis, die von der Rue des Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois abgeht. Wenn ich mich nicht täusche, hat unsere Gräfin von Sourdis, die, nebenbei gesagt, sehr reich ist, vor Kurzem das schöne Stadtpalais am Quai Voltaire als Wohnsitz erworben, das man von der Rue Bourbon aus betritt und das Sie aus den Fenstern des Pavillon Marsan sehen können.«
»Bravo! Solche Antworten lasse ich mir gefallen. Diese Sourdis scheinen mir nach Madames Faubourg Saint-Germain zu tendieren.«
»Aber nicht allzusehr. Sie sind sehr eng mit Doktor Cabanis verwandt, der, wie Sie wissen, unsere politischen Ansichten teilt. Er ist sogar Taufpate des jungen Fräuleins.«
»Aha! Das rückt die Sache in ein etwas besseres Licht. Diese ganzen Witwen von Stande aus dem Faubourg Saint-Germain sind ein schlechter Umgang für Joséphine.«
In diesem Augenblick drehte er sich um und erblickte den Tisch. »Habe ich gesagt, dass ich hier zu Mittag speisen will?«, fragte er gebieterisch.
»Nein«, erwiderte Bourrienne, »ich dachte mir nur, es wäre heute besser so.«
»Und wer erweist mir die Ehre, mit mir zu speisen?«
»Jemand, den ich eingeladen habe.«
»Angesichts der Laune, in der ich mich vorhin befand, hätten Sie sich ziemlich sicher sein müssen, dass dieser Jemand mir nicht ungelegen kommt.«
»Ich war mir dessen völlig sicher.«
»Und wer ist es?«
»Jemand, der von sehr weit her kommt und gerade ankam, als Sie im Salon Georges empfingen.«
»Ich hatte keine andere Audienz als die mit Georges.«
»Der betreffende Jemand ist ohne Audienz gekommen.«
»Sie wissen, dass ich niemanden ohne Anmeldung empfange.«
»Diesen Jemand werden Sie empfangen.«
Bourrienne stand auf, trat an den Schreibtisch der Offiziere und sagte nur die vier Worte: »Der Erste Konsul ist da.«
Bei diesen Worten sprang ein junger Mann mit einem Satz in das Kabinett des Ersten Konsuls; kaum fünf- oder sechsundzwanzig Jahre alt, trug er die Dienstuniform eines Generals.
»Junot!«, rief Bonaparte voller Freude. »Zum Henker, Bourrienne, du hattest recht, dass der hier keine Anmeldung braucht, um empfangen zu werden! Her mit dir, Junot!«
Und als der junge General Bonapartes Hand ergreifen wollte, um sie zu küssen, breitete der Erste Konsul die Arme aus und drückte ihn an sein Herz.
Unter den jungen Offizieren, die ihm ihren Aufstieg verdankten, schätzte Bonaparte Junot ganz besonders. Kennengelernt hatten sie sich bei der Belagerung von Toulon.
Bonaparte hatte damals die Batterie von Sansculotten befehligt. Er verlangte jemanden mit schöner Handschrift. Junot trat vor und stellte sich vor.
»Setz dich da drüben hin«, sagte Bonaparte und deutete auf die Schulterwehr der Batterie, »und schreibe, was ich dir diktiere.«
Junot gehorchte. Als er den Brief beendete, explodierte eine von den Engländern geworfene Bombe zehn Fuß von ihm entfernt und hüllte ihn in Staub.
»Schon gut«, sagte Junot lachend, »das kommt uns zupass, auf diese Weise sparen wir uns den Streusand für die Tinte.«
Diese Worte entschieden sein Schicksal.
»Willst du bei mir bleiben?«, fragte ihn Bonaparte. »Ich sorge für dich.«
»Mit Vergnügen«, erwiderte Junot.
Beide hatten einander instinktiv erkannt.
Als Bonaparte zum General ernannt wurde, beförderte er Junot zu seinem Aide de Camp.
Als Bonaparte aus dem Dienst entlassen war, hatten die zwei jungen Männer ihr trauriges Los geteilt und von den zwei-, dreihundert Francs gelebt, die Junot monatlich von seiner Familie erhielt.
Nach dem 13. Vendémiaire hatte Bonaparte zwei weitere Aides de Camp, Muiron und Marmont, doch Junot blieb sein Liebling.
In der Funktion eines Generals nahm Junot an dem Äyptenfeldzug teil. Damals musste er sich zu seinem großen Bedauern von Bonaparte trennen. Bei der Schlacht von Foli tat er sich durch wahren Heldenmut hervor, und mit einem einzigen Pistolenschuss tötete er den Anführer der gegnerischen Armee. Als Bonaparte Ägypten verließ, schrieb er ihm:
Ich verlasse Ägypten, mein lieber Junot, und kann Dich nicht mitnehmen, weil Du uns nicht rechtzeitig erreichen würdest, bevor wir in See stechen. Ich hinterlasse Kléber jedoch die Ordre, Dich im Lauf des Monats Oktober nachzuschicken. Wo und in welcher Position ich mich auch befinden werde – verlasse Dich darauf, dass ich Dir die herzliche Freundschaft, die ich für Dich empfinde, handfest beweisen werde.
Mit freundschaftlichem Gruß, Dein
BONAPARTE
Bei der Rückkehr auf einem heruntergekommenen Transportschiff war Junot den Engländern in die Hände gefallen, und seitdem hatte Bonaparte nichts von ihm gehört.
»Ach! Da bist du endlich!«, rief der Erste Konsul, der seine Freude über Junots unverhofftes Erscheinen kaum bezähmen konnte. »Du warst also so dumm, dich von den Engländern gefangen nehmen zu lassen! Aber wie konntest du auch fünf Monate vertrödeln, statt so schnell wie möglich aufzubrechen, wie ich es dir geraten hatte?«
»Zum Henker! Weil Kléber mich festgehalten hat. Sie machen sich keine Vorstellung von seinen unermüdlichen Schikanen.«
»Vermutlich wollte er verhindern, dass ich mich mit zu vielen Freunden umgebe. Ich wusste schon immer, dass er mich nicht mag, aber ich habe ihm nicht zugetraut, dass er seine Feindseligkeit auf so elende Weise offenbart. Kennst du seinen Brief an das Direktorium? Nun, jedenfalls«, fügte Bonaparte mit frommem Augenaufschlag hinzu, »hat sein tragisches Ende all das aufgewogen, und Frankreich und ich haben in ihm einen großen Verlust zu beklagen. Ein unersetzlicher Verlust aber ist der Verlust von Desaix, mein Freund, ach! Desaix! Ein Unglück, wie es Nationen heimsuchen kann.«
Bonaparte wanderte eine Weile wortlos, ganz in seinen Schmerz versunken, auf und ab, um dann brüsk vor Junot stehen zu bleiben. »Und jetzt, was willst du jetzt tun? Ich habe dir gesagt, dass ich dir meine Freundschaft beweisen werde, wenn ich mich dazu in der Lage befinde. Was für Pläne hast du? Willst du wieder dienen?«
Und indem er ihn verstohlen beobachtete, sagte er mit gespielter Leutseligkeit: »Würde es dir gefallen, zur Rheinarmee abkommandiert zu werden?«
Röte färbte Junots Wangen. »Wollen Sie mich schon loswerden?«, fragte er, fuhr aber nach einem Augenblick fort: »Wenn Sie es befehlen, werde ich hingehen und General Moreau zeigen, dass die Offiziere der Italienarmee ihr Handwerk in Ägypten nicht verlernt haben.«
»Schon gut!«, sagte der Erste Konsul lachend. »Nicht so stürmisch, mein Freund! Seien Sie unbesorgt, Monsieur Junot, Sie werden mich nicht verlassen; General Moreau schätze ich sehr, doch nicht so sehr, dass ich ihm meine besten Freunde zum Geschenk machen würde«, und in ernsthafterem Ton und mit leicht gerunzelter Stirn fuhr er fort: »Junot, ich werde dich zum Kommandanten von Paris ernennen. Das ist ein Vertrauensposten, ganz besonders zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und eine bessere Wahl könnte ich nicht treffen. Aber« – er sah sich um, als befürchte er, man könne ihn belauschen – »du musst gut überlegen, bevor du ja sagst; wir müssen dich um zehn Jahre älter machen, denn der Kommandant von Paris muss mir treu ergeben sein und zugleich von höchster Vorsicht und größter Aufmerksamkeit für alles, was meine Sicherheit betrifft.«
»Oh, mein General«, rief Junot, »in dieser Hinsicht -«
»Halt den Mund oder sprich leiser«, sagte Bonaparte. »Wie gesagt, es geht um meine Sicherheit. Gefahren lauern allerorten. Wäre ich noch General Bonaparte, der sich in Paris mehr oder weniger durchschlägt, vor oder sogar nach dem 13. Vendémiaire, dann wäre mir nicht bange und ich könnte ihnen die Stirn bieten, denn dann wäre mein Leben meine Angelegenheit und so viel wert, wie ich befände, also nicht allzu viel. Aber jetzt bin ich nicht länger mein eigener Herr. Das kann ich nur einem Freund anvertrauen, Junot: Mein Schicksal wurde mir enthüllt, und es ist eng verbunden mit dem einer großen Nation; aus diesem Grund ist mein Leben in Gefahr. Den Mächten, die Frankreich besetzen und unter sich aufteilen wollen, bin ich bei ihrem Vorhaben im Weg.«
Nachdenklich verharrte er für einen Augenblick und fuhr sich dann mit der Hand über die Stirn, als wolle er einen unwillkommenen Gedanken verscheuchen. Mit der geistigen Beweglichkeit, die ihn zwanzig verschiedene Dinge gleichzeitig angehen ließ, sagte er dann unvermittelt: »Ich ernenne dich also zum Kommandanten von Paris; aber dafür musst du heiraten, das erfordert nicht nur die Würde des Amtes, das du ausfüllen wirst, es ist auch in deinem eigenen Interesse. Apropos – achte darauf, unbedingt eine vermögende Frau zu finden.«
»Ja, aber gefallen soll sie mir auch. Was tun? Erbinnen sind samt und sonders so hässlich wie die Sünde.«
»Nun, dann mach dich heute noch an die Arbeit, denn von heute an wirst du Kommandant von Paris sein. Suche dir ein passendes Haus, nicht zu weit vom Tuilerienpalast entfernt, damit ich dich rufen lassen kann, wenn ich dich brauche; sieh dich um und triff deine Wahl unter den Damen aus Joséphines und Hortenses Umgebung. Ich würde dir Hortense geben, aber sie scheint in Duroc verliebt zu sein, und ich will ihrer Neigung keinen Zwang antun.«
»Es ist serviert für den Ersten Konsul!«, sagte der Diener und brachte das Tablett.
»Setzen wir uns zu Tisch«, sagte Bonaparte. »Möge in acht Tagen das Haus gefunden und die Frau ausgewählt sein!«
»General«, sagte Junot, »mit den acht Tagen für das Haus bin ich einverstanden, aber für die Frau will ich fünfzehn Tage haben.«
»Gewährt«, sagte Bonaparte.
10
Zwei junge Mädchen
Im gleichen Augenblick, in dem die zwei Waffenbrüder sich zu Tisch begaben, wurden Madame Bonaparte die Gräfin von Sourdis und Mademoiselle Claire de Sourdis angekündigt.
Die Damen umarmten einander und bildeten für einen Moment ein elegantes Ensemble, indem sie sich, wie in der feinen Welt üblich, über tausenderlei Kleinigkeiten von ihrem Wohlergehen bis zum Wetter austauschten. Dann ließ Madame Bonaparte Madame Sourdis auf einer Chaiselongue neben sich Platz nehmen, während Hortense Claire entführte, die in ihrem Alter war, um ihr den Palast zu zeigen, den sie noch nicht kannte.
Die zwei jungen Mädchen bildeten einen reizenden Kontrast: Hortense war frisch wie eine Blume, samtig wie ein Pfirsich, mit goldenem Haar, das ihr gelöst bis zu den Knien reichte, Arme und Hände ein wenig mager, wie so oft bei jungen Mädchen, bevor die Natur letzte Hand an sie legt und sie zur Frau macht; in ihrer anmutigen Gestalt vereinigte sich französische Lebhaftigkeit mit kreolischer morbidezza, und blaue Augen von unendlicher Sanftmut vollendeten den liebreizenden Gesamteindruck.
Ihre Gefährtin stand ihr an Anmut und Schönheit in nichts nach; wie Hortense war auch sie Kreolin, von gleichem Liebreiz, jedoch von andersgearteter Schönheit. Claire war größer als ihre Freundin und hatte den samtigen Teint, mit dem die Natur ihre bevorzugten Schönheiten in Mittelmeerländern begünstigt, saphirblaue Augen, ebenholzschwarzes Haar, eine Taille, die man mit zwei Händen umspannen konnte, und entzückend kleine Hände und Füße.
Beide hatten eine hervorragende Erziehung genossen. Hortenses Erziehung war nach der Unterbrechung durch die erzwungene Lehrzeit und seit der Entlassung ihrer Mutter aus dem Gefängnis mit so wachem Verstand und unermüdlichem Fleiß fortgesetzt worden, dass von der Unterbrechung nichts zu merken war. Sie zeichnete gefällig, spielte ausgezeichnet Klavier und komponierte und verfasste Romanzen, von denen einige bis in unsere Tage überlebt haben, da sie ihre Beliebtheit nicht dem sozialen Rang der Verfasserin verdanken, sondern ihrem künstlerischen Wert.
Beide malten, beide musizierten, beide sprachen mehrere Fremdsprachen.
Hortense zeigte Claire ihr Atelier, ihre Kreidezeichnungen, ihr Musikzimmer, ihre Voliere.
Dann setzten sie sich in ein kleines, von Redouté ausgemaltes Boudoir neben der Voliere.
Das Gespräch kam auf die Abendgesellschaften, die zu jener Zeit prachtvoller denn je wiederauflebten, auf die Bälle, die voller Begeisterung besucht wurden, auf die schönen Tänzer – Monsieur de Trénis, Monsieur Laffitte, Monsieur d’Almivar, die zwei Messieurs de Caulaincourt. Beide beklagten bitter, dass sie auf den Bällen genötigt waren, mindestens eine Gavotte und ein Menuett zu tanzen. Und wie von allein kam es zu dem Austausch zweier Fragen.
Hortense fragte: »Kennen Sie den Citoyen Duroc, Aide de Camp bei meinem Stiefvater?« Und Claire fragte: »Begegnen Sie bisweilen dem Citoyen Hector de Sainte-Hermine?«
Claire kannte Duroc nicht, Hortense nicht Hector.
Hortense wäre fast in Versuchung geraten zu gestehen, dass sie Duroc liebte, denn ihr Stiefvater, der Duroc sehr schätzte, ermutigte diese Liebschaft.
In der Tat zählte Duroc zu jenen bezaubernden Generälen, die im Tuilerienpalast zu jener Zeit wie in einer Pflanzschule gediehen. Er war keine achtundzwanzig Jahre alt, von äußerst vornehmem Auftreten, mit großen, leicht hervorstehenden Augen, von überdurchschnittlicher Körpergröße und schlanker, eleganter Gestalt.
Ein Schatten aber lag über dieser Liebe: Bonaparte ermutigte sie, Joséphine hingegen begünstigte eine andere Verbindung. Joséphine wollte Hortense mit einem der jüngeren Brüder Bonapartes verheiraten, mit Louis.
Joséphine hatte in Bonapartes Familie zwei geschworene Feinde, Joseph und Lucien, deren Interesse an Joséphines Betragen weit über jede Indiskretion hinausging. Fast wäre es ihnen gelungen, Bonaparte nach seiner Rückkehr aus Ägypten zu einer Trennung von ihr zu bewegen. Sie drängten ihn ständig, sich scheiden zu lassen, unter dem Vorwand, ein männlicher Erbe sei für Bonapartes ehrgeizige Ziele unerlässlich, und sie hatten umso leichteres Spiel, als sie damit allem Anschein nach gegen ihre eigenen Interessen handelten.
Joseph und Lucien waren verheiratet, Joseph ehrbar und schicklich. Er hatte die Tochter eines Monsieur Clary geehelicht, eines reichen Händlers aus Marseille, und war so zum Schwager Bernadottes geworden. Eine dritte Tochter war noch zu vergeben gewesen, reizender sogar als ihre Schwestern, und Bonaparte hielt um ihre Hand an. »Meiner Treu, nein«, hatte der Vater gesagt, »ein Bonaparte in der Familie genügt mir.« Hätte er eingewilligt, wäre der ehrbare Händler aus Marseille eines schönen Tages Schwiegervater eines Kaisers und zweier Könige gewesen.
Lucien hingegen war eine Ehe eingegangen, wie man sie in der Gesellschaft als unausgewogen zu bezeichnen pflegte. 1774 oder 1795, als Bonaparte nur dafür berühmt war, Toulon erobert zu haben, wurde Lucien zum Magazinverwalter des Dörfchens Saint-Maximin ernannt. Als echter Republikaner, der sich selbst Brutus getauft hatte, konnte Lucien auf keinen Fall gestatten, dass ein Heiliger sich in seiner Umgebung aufhielt, und folglich hatte er Saint-Maximin analog zu sich selbst umgetauft, und zwar in Marathon.
Citoyen Brutus, wohnhaft in Marathon, das klang gut.
Miltiades hätte besser gepasst, aber als Lucien sich Brutus nannte, konnte er noch nicht ahnen, dass es ihn nach Saint-Maximin verschlagen würde.
Lucien-Brutus wohnte im einzigen Hotel von Saint-Maximin-Marathon. Dieses Hotel führte ein Mann, dem es niemals in den Sinn gekommen wäre, seinen Namen zu ändern, und der sich weiterhin Constant Boyer nannte.
Boyer hatte eine Tochter, ein bezauberndes Geschöpf namens Christine; es kommt vor, dass solche Blumen auf Misthaufen erblühen, solche Perlen sich im Kehricht finden.
In Saint-Maximin-Marathon gab es weder Unterhaltung noch Gesellschaft, doch weder das eine noch das andere entbehrte Lucien-Brutus, denn Christine Boyer ersetzte ihm beides.
Sie war jedoch ebenso klug wie schön; es gab keine Möglichkeit, sie zur Geliebten zu machen, und in einem Augenblick der Liebe und des Verdrusses heiratete Lucien sie, und Christine Boyer wurde nicht zu Christine Brutus, sondern zu Christine Bonaparte.
Der General des 13. Vendémiaire, der über seine Zukunft allmählich klar sah, war außer sich vor Zorn. Er schwor, dem Ehemann niemals zu verzeihen, die Ehefrau niemals kennenzulernen, und schickte das Paar nach Deutschland, wo er Lucien eine bescheidene Position gab.
Später wurde er milder, empfing die Ehefrau und hatte nichts dagegen, seinen Bruder Lucien-Brutus, der nunmehr Lucien-Antoine hieß, anlässlich des 18. Brumaire wieder in die Arme zu schließen.
Diese Brüder Bonapartes waren wie gesagt Joséphines Erzfeinde, weshalb sie Louis auf ihre Seite ziehen und als Bollwerk gegen die anderen benutzen wollte, indem sie ihn mit Hortense verheiratete.
Hortense wehrte sich gegen dieses Vorhaben mit aller Macht. Louis war zu jener Zeit ein hübscher junger Mann mit sanftem Blick und freundlichem Lächeln; er glich seiner Schwester Caroline, die vor Kurzem Murat geheiratet hatte, und war fast noch ein Kind mit seinen knapp zwanzig Jahren. Er liebte Hortense nicht, er verabscheute sie nicht, sondern tat, was man ihn hieß.
Hortense wiederum verabscheute nicht Louis, sondern liebte Duroc.
Was sie Claire de Sourdis anvertraute, machte dieser Mut, sich ihr ebenfalls zu öffnen. Leider hatte sie nicht viel zu erzählen.
Sie liebte, wenn man es so nennen will – besser gesagt, sie schwärmte für einen schönen jungen Mann von drei- oder vierundzwanzig Jahren. Er war blond, hatte schöne schwarze Augen, für einen Mann etwas zu ebenmäßige Züge, kleine Hände und Füße wie eine Frau und war alles in allem so vollendet beschaffen, von solcher Harmonie und Ausgewogenheit, dass man wohl ahnen konnte, dass diese dem Anschein nach so zerbrechliche Hülle geradezu herkulische Kräfte barg: Zu einer Zeit, als Chateaubriand und Byron noch nicht den Typus eines René oder Manfred in Mode gebracht hatten, war die bleiche Stirn des jungen Hector von einem seltsam schwermütig stimmenden Schicksal gezeichnet, denn in seiner Familie wurde von schrecklichen Überlieferungen gemurmelt, über die niemand Genaueres wusste und die sich hinter dem jungen Mann abzeichneten wie Blutspuren, obwohl er noch nie übertriebene Trauer um jene Verwandten bezeigt hatte, die der Republik zum Opfer gefallen waren, und auf jenen Bällen und geselligen Veranstaltungen, die den Grimm der Verstorbenen besänftigen sollten, noch nie seinen Schmerz und Kummer zur Schau gestellt hatte. Zudem hatte er es nicht nötig, durch exzentrisches Gebaren Blicke auf sich zu ziehen, wenn er sich in Gesellschaft begab, denn wie von allein hefteten sich aller Blicke auf ihn. Nie war es seinen Gefährten – nicht unbedingt im Vergnügen, sondern eher Jagd- und Reisegefährten – gelungen, ihn zu einer der Unternehmungen junger Leute zu verlocken, auf die sich selbst die Sprödesten wenigstens einmal im Leben einlassen, und niemand konnte sich entsinnen, ihn jemals auch nur lächeln gesehen zu haben, geschweige denn offen und fröhlich lachen.
Früher einmal waren die Sainte-Hermines den Sourdis verwandtschaftlich verbunden gewesen, und wie es in großen Häusern üblich ist, war die Erinnerung an diese Verbindung beiden Familien teuer geblieben. Und so hatte der junge Sainte-Hermine, wenn er sich zufällig in Paris aufhielt, es nie versäumt, Madame de Sourdis nach ihrer Rückkehr aus den Kolonien einen förmlichen Höflichkeitsbesuch abzustatten.
Seit einigen Monaten begegneten die jungen Leute einander in der Gesellschaft, doch außer Grüßen, wie die Etikette sie verlangte, hatten sie keine weiteren Worte gewechselt, und die knappen Begrüßungen wurden insbesondere seitens des jungen Mannes mit auffallender Nüchternheit geäußert. Blieben die Münder auch stumm, hatten die Augen doch umso beredter gesprochen. Hector hatte seine Blicke nicht annähernd so im Zaum wie seine Worte, und jedes Mal wenn er Claire begegnete, sagten seine Blicke ihr, wie schön und wie begehrenswert sie ihm erschien.
Bei den ersten Begegnungen hatten diese seelenvollen Blicke Claire im Innersten berührt, und da Sainte-Hermine ihr als vollendeter Kavalier erschien, hatte sie unwillkürlich begonnen, ihn ebenfalls selbstvergessen zu betrachten; dann hatte sie gehofft, er werde beim ersten Ball mit ihr tanzen und ein Wort oder Händedruck werde seinen so sprechenden Blicken zu Hilfe kommen. Doch merkwürdigerweise und für diese Zeit ungewöhnlicherweise war Sainte-Hermine, dieser elegante Kavalier, der sich mit Saint-Georges im Kampf übte, der mit Pistolen schoss wie Junot oder Fournier, kein Tänzer.
Dies war eine weitere Besonderheit neben all den anderen; auf den Bällen, die er besuchte, stand Sainte-Hermine kühl und unbewegt in einer Fensternische oder in einer Ecke des Salons, Gegenstand der Verwunderung aller tanzwütigen jungen Leute, die sich fragten, welches Gelübde ihnen einen so eleganten Tänzer vorenthalten mochte, der immer mit so vollendetem Geschmack nach der neuesten Mode gekleidet war.
Noch unverständlicher war Claire die halsstarrige Zurückhaltung des Grafen von Sainte-Hermine ihr gegenüber, zumal ihre Mutter den jungen Mann ganz besonders ins Herz geschlossen zu haben schien und nur Gutes über seine von der Revolution dezimierte Familie und über ihn selbst zu sagen hatte. Geld konnte kein Hindernis für eine Ehe zwischen ihnen sein. Beide waren Einzelkinder, und ihrer beider Vermögen waren ungefähr gleich groß.
Man kann sich denken, welchen Eindruck im Herzen dieses kreolischen jungen Mädchens eine solche Verbindung körperlicher und seelischer Eigenschaften bewirken musste, wie sie der geheimnisvolle schöne junge Mann besaß, dessen Bild Claires Erinnerung heimsuchte und im Begriff war, sich ihres Herzens zu bemächtigen.
Hortense hatte ihre Wünsche und Hoffnungen schnell genug offenbart: Duroc zu heiraten, den sie liebte, und Louis Bonaparte, den sie nicht liebte, nicht zu heiraten – so war das Geheimnis beschaffen, das sie ihrer Freundin anzuvertrauen hatte, was sie in wenigen Worten auch tat. Claires romantische Schwärmerei war nicht so leicht abzutun. Ausführlich schilderte sie ihrer Freundin Hectors Erscheinung und drang in das Geheimnis, das ihn umgab, so weit vor, wie sie konnte; erst als ihre Mutter zweimal nach ihr gerufen hatte und sie bereits aufgestanden war und Hortense zum Abschied umarmt hatte, sagte sie – ganz im Stil Madame de Sévignés, die der Ansicht war, das Postskriptum sei der wichtigste Teil eines Briefes – gewissermaßen als Postskriptum und als komme ihr der Gedanke in ebendiesem Moment: »Apropos, liebe Hortense, ich vergaß, Sie etwas zu fragen.«
»Und was?«
»Es heißt, Madame de Permon werde einen großen Ball geben.«
»Ja, Loulou hat mich mit ihrer Mutter besucht und hat uns persönlich eingeladen.«
»Werden Sie hingehen?«
»Aber gewiss.«
»Meine liebe Hortense«, sagte Claire im allerzärtlichsten Ton, »ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.«
»Um einen Gefallen?«
»Ja. Können Sie mir und meiner Mutter eine Einladung verschaffen? Wäre das möglich?«
»Aber sicherlich, das hoffe ich jedenfalls.«
Claire tat vor Freude einen Luftsprung.
»Oh, vielen Dank!«, sagte sie. »Wie werden Sie es anstellen?«
»Ich könnte Loulou um eine Einladung bitten, aber ich will es lieber über Eugène bewerkstelligen, denn er ist mit dem Sohn Madame de Permons eng befreundet und wird ihn um alles bitten, was Sie verlangen können.«
»Und ich werde zu dem Ball Madame de Permons eingeladen?«, rief Claire beglückt.
»Gewiss«, erwiderte Hortense; dann sah sie ihre Freundin aufmerksam an und fragte: »Wird er hingehen?«
Claire wurde kirschrot, senkte den Blick und flüsterte: »Ich glaube ja.«
»Du zeigst ihn mir, nicht wahr?«, sagte Hortense, zum vertraulichen »Du« wechselnd.
»Oh, du wirst ihn auch ohne Hilfe sofort erkennen, liebe Hortense! Habe ich dir nicht gesagt, dass man ihn in der größten Menschenmenge sofort bemerkt?«
»Wie ich es bedaure, dass er nicht tanzt!«, sagte Hortense.
»Und ich erst!«, seufzte Claire.
Die zwei jungen Mädchen umarmten einander zum Abschied, wobei Claire Hortense ermahnte, ihre Einladung nicht zu vergessen.
Drei Tage später erhielt Claire Sourdis das ersehnte Schreiben.
11
Der Ball bei Madame de Permon
Der Ball, für den sich Mademoiselle Hortenses Freundin eine Einladung erbeten hatte, war das Stadtgespräch der vornehmen Pariser Kreise jener Tage. Madame de Permon hätte ein viermal so großes Haus wie das ihre benötigt, um alle empfangen zu können, die ihren Ehrgeiz dareingesetzt hatten, an ihrer Abendgesellschaft teilzunehmen; sie hatte mehr als hundert Herren und mehr als fünfzig Damen abschlägig bescheiden müssen, doch als gebürtige Korsin, seit frühester Kindheit mit allen Mitgliedern der Familie Bonaparte engstens befreundet, erfüllte sie bereitwillig Eugènes Bitte, so dass Mademoiselle de Sourdis und ihre Mutter zwei Eintrittskarten erhielten.
Madame de Permon, deren Einladungen so begehrt waren, war trotz ihres bürgerlichen Namens eine der vornehmsten Damen der feinen Welt, denn sie stammte von den Comnènes ab, die Konstantinopel sechs Kaiser geschenkt hatten, Iraklion einen und Trabzon zehn.
Ihr Vorfahre Constantin Comnène hatte auf der Flucht vor den Muselmanen zusammen mit dreitausend treuen und ergebenen Gefolgsleuten zuerst im Taygetos-Gebirge Zuflucht gesucht und danach in den Bergen Korsikas, wo er sich dauerhaft niederließ, nachdem er dem Senat von Genua das Gebiet von Paomina, von Salogna und von Revinda abgekauft hatte.
Ungeachtet dieser kaiserlichen Herkunft hatte Mademoiselle de Comnène aus Liebe einen schönen Bürgerlichen namens Monsieur de Permon geheiratet, der vor zwei Jahren gestorben war und seine Witwe mit einem achtundzwanzigjährigen Sohn, einer vierzehnjährigen Tochter sowie zwanzig- bis fünfundzwanzigtausend Livres Rente zurückgelassen hatte.
Madame de Permons vornehme Herkunft in Verbindung mit ihrer bürgerlichen Heirat öffnete ihren Salon sowohl der alten Aristokratie als auch der entstehenden Demokratie, die sich im Kriegshandwerk, in den Künsten und in den Wissenschaften hervortat und sich auf diesen Gebieten Namen schuf, die es bald mit den berühmtesten der alten Monarchie aufnehmen sollten. In diesem Salon begegnete man einem de Mouchy, einem de Montcalm, dem Fürsten von Chalais, den beiden Brüdern de Laigle, Charles und Just de Noailles, den Montaigus, den drei Rastignacs, dem Grafen von Caulaincourt und seinen Söhnen Armand und Auguste, Albert d’Orsay und den Montbretons. Ein Sainte-Aulaire und Talleyrand sah sich in Tuchfühlung mit einem Hoche, Rapp, Duroc, Trénis, Laffitte, Dupaty, Junot, Anisson oder Laborde.
Mit ihren fünfundzwanzigtausend Livres Rente – einem Betrag, der heutigen fünfzigtausend Francs entspricht – konnte Madame de Permon sich eines der elegantesten und luxuriösesten Häuser von Paris leisten. Besonders verschwenderisch huldigte sie ihrer Vorliebe für Blumen und Pflanzen, ein damals wenig verbreiteter Geschmack. Das Haus glich einem wahren Treibhaus: Das Vestibül war mit Bäumen und Blumen so überreich ausstaffiert, dass von den Wänden nichts mehr zu sehen war, und zugleich so geschickt mit farbigem Glas beleuchtet, dass man sich in einem Feenpalast wähnte.
Zu jener Zeit versammelte man sich, um nach Herzenslust zu tanzen, und deshalb begannen die Bälle zu früher Stunde. Um neun Uhr abends waren die Empfangsräume Madame de Permons hell erleuchtet und geöffnet; die Dame des Hauses, ihre Tochter Laure und ihr Sohn Albert erwarteten die Gäste im Salon.
Madame de Permon, noch immer eine Schönheit, trug ein Kleid aus weißem Seidenkrepp, verziert mit doppelten Narzissenbüscheln. Das Kleid war im griechischen Stil geschnitten, an der Brust gekreuzt und an den Schultern mit zwei Diamantspangen gehalten; von Leroy in der Rue des Petits-Champs, dessen Kleider und Kopfbedeckungen besonders gefragt waren, hatte sie eine bauschige Toque aus weißem Krepp anfertigen lassen sowie Narzissenbüschel, ähnlich wie die an ihrem Kleid, die in ihrem jettschwarzen Haar steckten und aus den Falten der Toque hervorlugten. Vor sich hielt sie ein riesengroßes Bukett aus Narzissen und Veilchen, und als einzigen Schmuck trug sie an jedem Ohr einen Diamanten im Wert von fünfzehntausend Francs. Der Hut war von Leroy gefertigt und ihr von Charbonnier ins Haar drapiert, die Blumen stammten von Madame Roux, der hervorragendsten Pariser Floristin.
Die Toilette ihrer Tochter Laure de Permon war auffallend schlicht, denn die Mutter war der Ansicht, dass das junge Mädchen mit seinen sechzehn Jahren im Haus der Eltern nur mit der eigenen Schönheit glänzen und keinesfalls versuchen dürfe, andere durch seine Toilette auszustechen; es trug ein Kleid aus rosa Taft von gleichem Schnitt wie das Kleid der Mutter, eine Krone aus weißen wilden Narzissen, weiße Wildnarzissen am Saum des Kleides, perlenbesetzte Spangen und Perlenohrringe.
Doch die unangefochtene Schönheitskönigin dieser Abendgesellschaft, die nicht zuletzt zu Ehren der Familie Bonaparte gegeben wurde – sogar der Erste Konsul hatte versprochen zu kommen -, würde Madame Leclerc sein, Madame Laetitias Liebling und auch der ihres Bruders Bonaparte, wie es hieß; um ihren Auftritt besonders triumphal zu gestalten, hatte sie Madame de Permon gebeten, sich bei ihr ankleiden zu dürfen. Ihr Kleid war von Madame Germon geschneidert, der berühmte Friseur Charbonnier war bestellt worden und hatte bei dieser Gelegenheit auch Madame de Permon frisiert, und nun hielt Madame Leclerc sich bereit, um im richtigen Augenblick zu erscheinen: dann, wenn die Räume sich zu füllen beginnen, aber noch nicht allzu gefüllt sind.
Einige der hübschesten Frauen wie Madame Méchin, Madame de Périgord und Madame Récamier waren bereits anwesend, als um halb zehn Madame Bonaparte, ihre Tochter und ihr Sohn angekündigt wurden. Madame de Permon erhob sich und durchschritt das Esszimmer bis zur Hälfte, was sie bis dahin für niemanden getan hatte.
Joséphine trug eine Krone aus Mohnblüten und goldenen Ähren sowie ein weißes Kreppkleid mit ebensolcher Verzierung. Hortense war ebenfalls in Weiß gekleidet und trug Veilchen als einzigen Schmuck.
Fast gleichzeitig kam die Gräfin von Sourdis mit ihrer Tochter – die Mutter in einer butterblumengelben Tunika mit Vergissmeinnichtschmuck, die Tochter mit griechischer Frisur und in einer golden und purpurn bestickten Tunika aus weißem Seidentaft.
Es ist nicht zu leugnen, dass Claire in dieser Aufmachung ganz entzückend aussah und dass sich die goldenen und purpurnen Bänder in ihren schwarzen Haaren bezaubernd ausnahmen. Ihre schmale Taille umgürtete ein Strick aus goldenen und purpurnen Schnüren.
Auf ein Zeichen seiner Schwester eilte Eugène de Beauharnais zu den Neuankömmlingen, ergriff die Gräfin von Sourdis an der Hand und geleitete sie zu Madame de Permon. Diese erhob sich und hieß Madame de Sourdis zu ihrer Linken Platz nehmen; zu ihrer Rechten saß Joséphine; Hortense hatte Claire den Arm gereicht und sich mit ihrer Freundin nicht weit von ihren Müttern gesetzt.
»Und?«, fragte Hortense voller Neugier.
»Er ist da«, sagte Claire, vor Aufregung bebend.
»Wo?«, fragte Hortense noch neugieriger.
»Dort drüben«, sagte Claire, »folge meinem Blick, dort, es ist der in dem granatfarbenen Samtrock mit den engen chamoisfarbenen Beinkleidern und den Ballschuhen mit kleinen Diamantschnallen; eine größere Schnalle, aber ganz ähnlich, steckt an dem Schmuckband seines Huts.«
Hortenses Blick folgte Claires Blick.
»Oh, du hast recht!«, sagte sie. »Er ist so schön wie ein Antinoos. Aber ich muss sagen, so melancholisch, wie du ihn geschildert hast, wirkt er ganz und gar nicht; ich habe sogar den Eindruck, dass er uns ausgesprochen gewinnend zulächelt, dein schöner trauriger Fremdling.«
In der Tat zeigte die Miene des Grafen von Sainte-Hermine, der Mademoiselle de Sourdis seit ihrem Eintreten nicht aus den Augen verloren hatte, einen Ausdruck großer, stiller Freude, und als er sah, dass Claire und ihre Freundin den Blick auf ihn gerichtet hatten, trat er schüchtern, doch keineswegs linkisch auf sie zu und verneigte sich höflich.
»Mademoiselle, hätten Sie die Güte«, sagte er zu Claire, »mir den ersten Reel oder die erste Anglaise zu gewähren, die Sie tanzen werden?«
»Den ersten Reel, Monsieur, gewiss«, stammelte Claire, die kreidebleich geworden war, als der Graf sich genähert hatte, und die jetzt spürte, wie die Röte in ihre Wangen stieg.
»Von Mademoiselle de Beauharnais«, fuhr Hector fort, der sich vor Hortense verbeugte, »erwarte ich nichts als die Worte aus ihrem Mund, die mir meinen Platz unter ihren zahlreichen Bewunderern zuweisen werden.«
»Die erste Gavotte, Monsieur, wenn es Ihnen recht ist«, erwiderte Hortense, denn sie wusste, dass Duroc, im Übrigen ein gewandter Tänzer, keine Gavotte tanzte.
Graf Hector entfernte sich nach einer dankenden Verneigung und schlenderte zu dem Zirkel um Madame de Contades, die soeben eingetroffen war und deren Schönheit und Toilette alle Blicke auf sich gezogen hatten. Im selben Augenblick ging ein Murmeln der Bewunderung durch den Raum, das verkündete, dass eine Rivalin ihr die Krone der Schönheit streitig zu machen gedachte; der Wettstreit war eröffnet, denn mit dem Tanzen würde bis zur Ankunft des Ersten Konsuls gewartet werden.
Die furchterregende Rivalin, die in den Ring trat, war niemand anders als Pauline Bonaparte, von vertrauten Freunden Paulette genannt, Ehefrau des Generals Leclerc, der am 18. Brumaire Bonaparte so trefflich unterstützt hatte.
Madame Leclerc verließ das Zimmer, in dem sie sich angekleidet hatte; bewundernswert kokett zog sie erst beim Eintreten ihre Handschuhe aus, was die Schönheit ihrer runden weißen Arme mit den Armbändern aus Gold und Kameen ganz unvergleichlich zur Geltung brachte.
Ihre Frisur schmückten Bänder aus weichem Leder, gemustert wie Leopardenfell, sowie goldene Trauben: die vollkommene Nachbildung der Kamee einer Bacchantin; die Klarheit ihrer Züge verlieh ihr das Recht, sich mit der Antike zu messen, und ihr Kleid aus zartestem indischem Musselin – gewebte Luft, wie Juvenal es ausdrückt – war am Saum mehrere Fingerbreit mit einer purpurnen Girlande bestickt. An den Schultern hielten die Tunika Kameen von unschätzbarem Wert, und die kurzen, leicht plissierten Puffärmel mit schmaler Einfassung waren ebenfalls von Kameen gerafft. Der Gürtel unmittelbar unterhalb der Brust wie bei griechischen Statuen war ein flacher Ring aus bronzefarbenem Gold, dessen Verschluss ein kostbarer Edelstein bildete.
Dieser liebreizende Anblick war von so vollendeter Harmonie, dass bei Madame Leclercs Erscheinen wie gesagt ein Raunen der Bewunderung laut wurde, das sich ohne Rücksicht auf die anderen Damen in die weiteren Räume fortsetzte.
»Incessu patuit dea«, sagte Dupaty, als sie an ihm vorbeiging.
»Citoyen Dichter, was sagen Sie da Böses über mich in einer Sprache, die ich nicht verstehe?«, fragte Madame Leclerc lächelnd.
»Wie soll das angehen«, erwiderte Dupaty, »Sie als Römerin, Madame, wollen des Lateins nicht mächtig sein?«
»Ich habe es vergessen.«
»Es ist ein Vergilisches Hemistichon, Madame, über das Erscheinen der Venus vor Äneas; Abbé Delille hat es mit den Worten übertragen: Sie wandelt, und ihr Schritt verrät die Göttin.«
»Reichen Sie mir den Arm, Sie Schmeichler, und tanzen Sie zur Strafe den ersten Reel mit mir.«
Dupaty ließ sich das nicht zweimal sagen. Er hielt ihr den Arm hin, streckte das Bein und ließ sich von Madame Leclerc zu einem Boudoir führen, das sie unter dem Vorwand betrat, es sei dort weniger warm als in den Empfangsräumen, in Wahrheit aber, weil es in diesem Boudoir ein riesengroßes Kanapee gab, das der göttlichen Kokette erlaubte, nach Gutdünken ihre Toilette und ihre Person zur Schau zu stellen.
Im Vorbeigehen hatte sie einen herausfordernden Blick auf Madame de Contades gerichtet, diejenige, die bis zu ihrer Ankunft die Schönste oder wenigstens die Bezauberndste gewesen war; zu ihrer nicht geringen Genugtuung sah Madame Leclerc, dass alle Verehrer, die den Sessel Madame de Contades’ umschwärmt hatten, entfleucht waren und sich nun um ihr Kanapee scharten.
Madame de Contades biss sich die Lippen blutig. Doch in dem Köcher der Rache, den jede Frau unfehlbar zur Hand hat, fand sie wohl einen jener vergifteten Pfeile, die tödliche Wunden bohren, denn sie rief Monsieur de Noailles zu sich.
»Charles«, sagte sie, »reichen Sie mir den Arm, damit ich dieses Wunder an Toilette und Schönheit, das mir all meine Schmetterlinge abspenstig gemacht hat, aus der Nähe bestaunen kann.«
»Aha!«, sagte der junge Mann. »Sie wollen ihr wohl zeigen, dass sich unter den Schmetterlingen eine Biene versteckt hat! Stechen Sie nur zu, Gräfin, stechen Sie nur zu! Die Bonapartes sind allesamt von so neuem Adel, dass es nicht schaden kann, sie ab und zu daran zu erinnern, dass sie sich mit unserem alten Adel nicht messen können. Lassen Sie uns diese Parvenü vom Scheitel bis zur Sohle begutachten, und ich wette, Sie werden das Kainszeichen ihrer plebejischen Herkunft entdecken.«
Und der junge Mann folgte lachend Madame de Contades, die mit ihren geblähten Nasenflügeln aussah, als verfolgte sie die Fährte einer Wildbeute.
Sie erreichte die Gruppe von Bewunderern um die schöne Madame Leclerc und machte so resolut Gebrauch von Ellbogen und Schultern, dass sie bis in die erste Reihe vordrang.
Madame Leclerc lächelte beim Anblick von Madame de Contades; sie glaubte, selbst ihre Rivalin sähe sich genötigt, ihr zu huldigen. Und wahrhaftig erhob Madame de Contades ihre Stimme und stimmte in die allgemeine Bewunderung ein.
Doch mit einem Mal stieß sie einen Schrei aus, als hätte sie eine entsetzliche Entdeckung gemacht: »O Gott, wie abscheulich!«, rief sie. »Wie ist es möglich, dass eine solche Scheußlichkeit ein Meisterwerk der Natur entstellt! Sollte es also wahr sein, dass es auf Erden nichts Vollkommenes gibt? Mein Gott, wie furchtbar traurig!«
Dieses befremdliche Lamentieren bewirkte, dass sich alle Blicke auf Madame de Contades richteten, sodann auf Madame Leclerc und danach zu Madame de Contades zurückkehrten; offenbar erwartete man eine Erklärung ihres Jammerns, doch da sie weiterhin in beredten Worten die Unvollkommenheit der menschlichen Rasse beklagte, ohne Einzelheiten zu nennen, fragte ihr Kavalier schließlich: »Aber was sehen Sie denn nur, was denn?«
»Was ich sehe? Was ich sehe? Sehen Sie etwa nicht die zwei monströsen Ohren, die von diesem bezaubernden Kopf abstehen? Wenn ich solche Ohren hätte, ließe ich sie mir stutzen, und zwar gehörig, was umso leichter wäre, als sie keinen Rand besitzen.«
Madame de Contades hatte kaum ausgesprochen, als sich alle Blicke auf Madame Leclerc hefteten, diesmal nicht um sie zu bewundern, sondern um ihre Ohren zu betrachten, denen bislang niemand die geringste Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
In der Tat waren die Ohren der armen Paulette, wie ihre Vertrauten sie nannten, von ungewöhnlicher Form: Sie bestanden aus weißem Knorpel, der dem Inneren einer Auster ähnelte und den die Natur, wie von Madame de Contades bemerkt, zu säumen vergessen hatte.
Madame Leclerc versuchte gar nicht erst, sich gegen diese Impertinenz zur Wehr zu setzen. Sie stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht: unfehlbares Hilfsmittel aller Frauen in ausweglosen Situationen.[1]
In diesem Augenblick vernahm man einen vorfahrenden Wagen und die Pferde der Eskorte, und der Ruf: »Der Erste Konsul!« lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit von der sonderbaren Szene ab, die sich soeben ereignet hatte.
Doch während sich die in Tränen aufgelöste Madame Leclerc in das Zimmer flüchtete, in dem sie sich angekleidet hatte, und der Erste Konsul den Salon durch die eine Tür betrat, verließ Madame de Contades ihn durch die andere in dem Wissen, wie ungehörig ihr Triumph war, so dass sie dessen Früchte nicht zu genießen wagte.
12
Das Menuett der Königin
Madame de Permon trat vor den Ersten Konsul und begrüßte ihn voller Ehrerbietung. Bonaparte jedoch ergriff ihre Hand und küsste diese mit vollendeter Galanterie.
»Habe ich recht gehört, verehrte Freundin«, sagte er, »dass Sie den Ball nicht vor meiner Ankunft eröffnen wollten? Doch wenn ich erst um ein Uhr morgens hätte kommen können, hätten dann all diese hübschen jungen Leute um meinetwillen warten müssen?«
Er musterte den Salon mit einem schnellen Blick und sah, dass einige Damen des Faubourg Saint-Germain sich bei seinem Eintreten nicht erhoben hatten. Er runzelte die Stirn, ließ sich jedoch weiter nichts anmerken.
»Kommen Sie, Madame de Permon«, sagte er, »lassen Sie den Ball beginnen; die jungen Leute sollen sich amüsieren, und der Tanz ist nun einmal ihr liebster Zeitvertreib. Es heißt, Loulou tanze wie Mademoiselle Chameroi. Wer hat mir das gesagt? Das war Eugène, oder?«
Eugène errötete bis an die Haarwurzeln, denn er war der Verehrer der jungen Ballerina.
Bonaparte sprach weiter. »Das möchte ich unbedingt sehen. Wenn es Ihnen recht ist, Madame de Permon, werden wir den Monaco tanzen, denn andere Tänze beherrsche ich nicht.«
»Belieben Sie zu scherzen?«, erwiderte Madame de Permon. »Seit dreißig Jahren habe ich nicht mehr getanzt.«
»Jetzt scherzen Sie«, sagte Bonaparte, »denn Sie sehen heute Abend aus, als wären Sie die Schwester Ihrer Tochter«, und da er Monsieur de Talleyrand erblickte: »Ah, Talleyrand, gut, dass ich Sie sehe! Ich muss dringend mit Ihnen sprechen.« Und er verschwand in das kleine Boudoir, in dem Madame Leclerc dem Außenminister ihr Leid geklagt hatte.
Die Musik setzte ein, die Tänzer eilten zu ihren Tänzerinnen, der Ball begann.
Mademoiselle de Beauharnais tanzte mit Duroc und führte ihn zu Claire und dem Grafen von Sainte-Hermine. Alles, was ihre Freundin ihr über den jungen Mann erzählt hatte, hatte ihr lebhaftes Interesse geweckt.
Die Reels, die unseren heutigen Contredanses entsprechen, bestanden wie diese aus vier Figuren; allerdings hatte der tonangebende Tänzer jener Zeit, Monsieur de Trénis, die letzte Figur durch eine eigene Figur ersetzt, die bis zum heutigen Tag trénis genannt wird.
Monsieur de Sainte-Hermine tat sich als Tänzer nicht minder hervor als auf allen anderen Gebieten. Er war Schüler Vestris II., des legitimen Sohns des Gottes des Tanzes, und machte seinem Meister alle Ehre.
Jene, denen das traurige Los beschieden war, zu Beginn unseres Jahrhunderts zu erleben, was von den eleganten Tänzern der Zeit des Konsulats noch übrig war, können sich vielleicht am ehesten eine Vorstellung davon machen, welche Bedeutung seinerzeit ein eleganter junger Mann der Vervollkommnung der Tanzkunst beimaß. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit gegen 1812 oder 1813 die Messieurs Montbreton gesehen zu haben, die auf dem Ball Madame de Permons tanzten, den ich zu schildern versuche, und als ich sie sah, waren sie vierzig Jahre alt. Anlässlich des großen Fests von Villers-Cotterêts fand ein großer Ball statt, Treffpunkt der Aristokratie der Schönheit und der neuen Aristokratie, die in unseren Hinterwäldlerregionen zahlreicher vertreten war als der alte Adel und von jenen, deren Taten ich berichte, kaum weniger geschätzt wurde als jener. Sei’s drum! Die Messieurs de Montbreton kamen von ihrem Château de Corcy, die Messieurs de Laigle aus Compiègne, die einen aus drei, die anderen aus sieben Wegstunden Entfernung. Raten Sie, auf welche Weise. In ihrem Kabriolett? Gewiss doch, aber in dem Kabriolett saß ihr Lakai, während seine Herren sich hinten am Wagen festhielten und in ihren feinen Tanzschuhen auf dem Brett, das der Platz des Lakaien war, die ganze Fahrt über ihre raffiniertesten und zierlichsten Tanzschritte übten, bis sie pünktlich zu Ballbeginn eintrafen, sich kurz den Rock abbürsten ließen und sich in die Contredanses stürzten.
Nun gut! Beglückt hatte Mademoiselle de Beauharnais und stolz hatte Mademoiselle de Sourdis gesehen, dass der Graf von Sainte-Hermine, den man noch nie tanzen gesehen hatte, es an Können und Anmut mit den besten Tänzern unter den Anwesenden aufnehmen konnte.
Doch während Hortenses Neugier in dieser Hinsicht befriedigt war, plagte sie eine andere Ungewissheit nicht minder – hatte der junge Mann sich Claire anvertraut, hatte er ihr den Grund seiner früheren Schwermut, seines langen Schweigens und seines plötzlichen Frohsinns verraten?
Sie eilte zu ihrer Freundin und zog sie in eine Fensternische. »Was hat er dir gesagt?«, fragte sie atemlos.
»Etwas Wichtiges in Hinsicht auf das, was ich dir erzählt habe.«
»Darfst du es mir verraten?«
»Sicherlich.« Claire senkte die Stimme und sagte leise: »Er hat gesagt, er wolle mir ein Familiengeheimnis anvertrauen.«
»Dir?«
»Mir, niemandem sonst. Deshalb hat er mich gebeten, bei meiner Mutter die Erlaubnis zu erwirken, dass er als Verwandter eine Stunde lang mit mir sprechen darf, wenn nötig unter ihren Augen, doch außerhalb ihrer Hörweite. Sein Lebensglück hängt davon ab, wie er mir versichert hat.«
»Wird deine Mutter es erlauben?«
»Ich hoffe es, sie liebt mich so zärtlich. Ich habe ihm versprochen, noch heute meine Mutter um die Erlaubnis zu bitten und ihm ihre Antwort gegen Ende des Balls mitzuteilen.«
»Weißt du eigentlich, dass er sehr gut aussieht, dein Graf, und so göttlich tanzt wie Gardel?«
Die Musik stimmte eine neue Contredanse an und rief die beiden Mädchen auf ihre Plätze zurück, und es wurde noch leidenschaftlicher getanzt als zuvor.
Wie gesagt, waren die jungen Freundinnen mit den Tanzkünsten Monsieur de Sainte-Hermines hochzufrieden, doch der Reel, den er getanzt hatte, war nur eine gewöhnliche Contredanse. Tänzer, die man auf die Probe stellen wollte, mussten sich zu jener Zeit zwei Prüfungen unterziehen, der Gavotte und dem Menuett.
Hortense und Claire warteten auf die Darbietung des jungen Grafen bei der Gavotte, die er auf Verlangen der Mademoiselle de Beauharnais mit ihr tanzen würde.
Die Gavotte, die wir heute nur noch als historischen Tanz kennen, der uns zutiefst lächerlich erscheint, war unter dem Direktorium, unter dem Konsulat und sogar zur Zeit des Empire von herausragender Bedeutung. Wie sich der Schlangenleib, dem man den Kopf abgeschlagen hat, noch geraume Zeit windet, so konnte sich auch die Gavotte lange nicht zum Sterben entschließen; mit ihren höchst komplizierten und schwierig auszuführenden Figuren eignete sie sich eher für die Theaterbühne als für einen Salon. Ein Paar, das sie tanzte, benötigte viel Platz, und selbst in einem großen Ballsaal konnten kaum mehr als vier Paare gleichzeitig diesen Tanz ausführen.
Unter den vier Paaren, die in Madame de Permons großem Saal die Gavotte tanzten, erregten der Graf von Sainte-Hermine und Mademoiselle de Beauharnais den einhelligsten Beifall. Der Beifall war so laut, dass er Napoleon aus seinem Gespräch mit Monsieur de Talleyrand riss und aus dem Boudoir, in dem sie sich unterhielten, hinauslockte. Bei den letzten Tanzfiguren erschien er auf der Türschwelle und sah den Triumph Hortenses und ihres Partners.
Nach der Gavotte winkte Bonaparte Hortense herbei, die zu ihm trat und ihm die Stirn zum Kuss bot.
»Mein Kompliment, Demoiselle«, sagte Bonaparte, »man sieht, dass Sie Unterricht in diesen eleganten Künsten genossen haben und dass dieser Unterricht auf fruchtbaren Boden gefallen ist; aber wer ist der schöne junge Herr, mit dem Sie getanzt haben?«
»Ich kenne ihn nicht, General«, antwortete Hortense. »Ich habe ihn heute Abend zum ersten Mal gesehen. Er hat mich um den Tanz gebeten, als er kam, um Mademoiselle de Sourdis, mit der ich mich unterhielt, um einen Tanz zu bitten. Eigentlich hat er mich gar nicht um den Tanz gebeten, sondern gesagt, er stehe zu meinen Diensten, und ich habe erwidert, ich wolle die Gavotte tanzen und welcher Tanz es sein wird.«
»Aber seinen Namen werden Sie doch wissen?«
»Er ist der Graf von Sainte-Hermine.«
»Hm!«, sagte Bonaparte mit übellauniger Miene. »Schon wieder Faubourg Saint-Germain. Die gute Madame Permon kennt offenbar kein größeres Vergnügen, als ihr Haus mit meinen Feinden zu füllen. Beim Eintreten habe ich eine Madame de Contades in die Flucht gejagt, eine Irre, die mir nicht mehr Verdienste zugestehen will als dem einfachsten Unterleutnant meiner Armee; wenn die Rede auf meine Siege in Italien und Ägypten kommt, soll sie jedes Mal sagen, mit ihren Augen könnte sie das Gleiche ausrichten wie ich mit dem Schwert. Wie verdrießlich«, fuhr Bonaparte fort und fasste Hortenses Tanzpartner genauer ins Auge, »er gäbe einen herrlichen Husarenoffizier ab«, und dann schickte er Hortense mit einer Handbewegung zu ihrer Mutter zurück und sagte: »Monsieur de Talleyrand, Sie wissen doch so vieles, können Sie mir etwas über eine Familie Sainte-Hermine berichten?«
»Warten Sie einen Augenblick«, sagte Monsieur de Talleyrand, stützte das Kinn zwischen Zeigefinger und Daumen und legte den Kopf zurück, wie er es immer tat, wenn er nachdachte. »Im Jura, in der Gegend von Besançon, gibt es Sainte-Hermines. Ja, den Vater habe ich gekannt: ein ausgesprochen vornehmer Mann, wurde 1793 guillotiniert. Er hat drei Söhne hinterlassen. Was aus ihnen geworden ist? Ich weiß es nicht. Dieser junge Mann müsste einer der drei sein oder vielleicht ein Neffe, obwohl ich von einem Bruder des Vaters nie gehört habe. Soll ich mich eingehender erkundigen?«
»O nein, das ist die Sache nicht wert.«
»Es wäre nicht schwierig. Ich sah ihn vorhin, nein, er spricht immer noch mit Mademoiselle de Sourdis, und über ihre Mutter könnte ich ohne Weiteres -«
»Nein, nicht nötig. Vielen Dank! Und diese Sourdis, was sind das für Leute?«
»Bester Adel.«
»Das wollte ich nicht wissen. Wie denken sie?«
»Ich glaube, die Familie besteht nur noch aus zwei Frauen, die auf unserer Seite stehen oder sich nichts sehnlicher wünschen als das. Cabanis, der großen Einfluss auf sie hat, hat die Damen vor einigen Tagen erwähnt. Die junge Dame soll verheiratet werden, mit einer Million Mitgift, wenn ich mich nicht täusche. Das wäre nicht übel für einen Ihrer Adjutanten.«
»Sind Sie der Ansicht, dass Madame Bonaparte mit ihnen verkehren kann?«
»Selbstverständlich.«
»Das meinte Bourrienne auch; ich danke Ihnen. Aber was ist mit Loulou? Sie sieht aus, als wolle sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Liebe Madame de Permon, welchen Tort tun Sie Ihrer Tochter an, ausgerechnet an diesem Tag?«
»Sie soll das Menuett der Königin tanzen und weigert sich.«
Bei den Worten »Menuett der Königin« musste Bonaparte lächeln.
»Und warum weigert sie sich?«
»Was weiß ich! Eine törichte Laune! Loulou, Sie sind ein dummes Kind, denn wozu haben wir Gardel und Saint-Amand als Tanzlehrer, wenn Sie daraus keinerlei Nutzen ziehen!«
»Aber, Mama«, erwiderte Mademoiselle de Permon, »nichts täte ich lieber, als dieses Menuett zu tanzen, obwohl ich es nicht ausstehen kann, aber ich wage nicht, es mit einem anderen Partner als mit Monsieur de Trénis zu tanzen, denn ihm habe ich diesen Tanz versprochen.«
»Und warum ist er dann nicht hier?«, fragte Madame de Permon. »Es ist eine halbe Stunde nach Mitternacht.«
»Er hat uns wissen lassen, dass er zwei andere Bälle vor dem unseren besuchen muss und erst sehr spät kommen könne.«
»Oh«, sagte Bonaparte, »das freut mich aber, dass es in Frankreich einen Mann gibt, der noch beschäftigter ist, als ich es bin. Doch dass Monsieur de Trénis wortbrüchig wurde, Mademoiselle Loulou, ist kein Grund, uns des Vergnügens zu berauben, Sie das Menuett der Königin tanzen zu sehen. Er ist nicht da, Sie sind daran nicht schuld, nehmen Sie sich einen anderen Tänzer.«
»Nimm Gardel«, sagte Madame de Permon.
»Aber er ist mein Tanzlehrer«, sagte Loulou.
»Na, dann nimm Laffitte; schließlich ist er der beste Tänzer von ganz Paris nach Gardel.«
Monsieur Laffitte ließ sich im Salon sehen.
»Monsieur Laffitte, Monsieur Laffitte, kommen Sie her!«, rief Madame de Permon.
Monsieur Laffitte trat überaus nonchalant und elegant näher. Er war ausgesucht gekleidet und sah sehr gut aus.
»Monsieur Laffitte«, sagte Madame de Permon, »erweisen Sie mir den Gefallen, mit meiner Tochter das Menuett der Königin zu tanzen.«
»Wie bitte?«, rief Monsieur Laffitte. »Madame, Sie tun mir zu viel der Ehre an, weiß Gott. Das wird ein Duell mit Monsieur de Trénis«, fügte er lachend hinzu, »aber dieses Wagnis gehe ich gerne ein; allerdings rechnete ich nicht mit dieser Ehre und habe deshalb keinen Hut bei mir.«
Um die letzten Worte zu verstehen, muss der geneigte Leser wissen, dass die Verbeugung bei diesem Menuett, sein Höhepunkt, sein choreographischer Dreh- und Angelpunkt, mit einem Hut à la Ludwig XV. und mit keinem anderen Hut zu geschehen hatte.
Ein passender Hut wurde gesucht und im Handumdrehen gefunden. Das Menuett wurde unter größtem Beifall getanzt, und als Monsieur Laffitte Mademoiselle de Permon zu ihrem Platz zurückbrachte, begegnete er Monsieur de Trénis, der völlig außer Atem erschien, weil er sich verspätet hatte, seine Verabredung mit Mademosielle Laure wahrzunehmen.
Monsieur de Trénis blieb vor den beiden Tänzern stehen, verblüffter noch als erzürnt. Das Menuett, das er hatte tanzen sollen, wie jedermann wusste, war nicht nur ohne ihn getanzt worden, sondern obendrein, wie sich dem leise verebbenden Beifall entnehmen ließ, mit nicht geringem Erfolg.
»Oh, Monsieur«, sagte Mademoiselle de Permon verschämt, »ich habe bis nach Mitternacht auf Sie gewartet, sehen Sie selbst die Uhrzeit, und das Menuett war für elf Uhr angekündigt. Um Mitternacht schließlich hat meine Mutter darauf bestanden, dass ich es mit Monsieur Laffitte tanze«, fuhr sie fort und fügte kichernd hinzu: »Und der Erste Konsul hat es befohlen.«
»Mademoiselle«, sagte Trénis ernst, »wenn Madame de Permon dieses Opfer von Ihnen verlangte, war sie als Herrin des Hauses dazu befugt, und sie schuldete das Menuett ihren Gästen. Bedauerlicherweise war ich verspätet, und sie war im Recht; wenn jedoch der Erste Konsul« – und Monsieur de Trénis, der eine gute Handbreit größer war als der Erste Konsul, maß ihn verächtlich von oben herab – »befehlen lässt, einen Tanz zu beginnen, der ohne mich nicht getanzt werden kann, dann überschreitet er seine Befugnisse, und zwar bei Weitem. Ich werde ihn nicht auf den Schlachtfeldern eines Besseren belehren wollen, und er sollte es in meinen Salons genauso halten. Ich werde seine Lorbeeren nicht schmälern, und er sollte es mit den meinen ebenso halten«, und indem er stolz neben Madame de Permon Platz nahm: »Zum Glück bin ich Philosoph genug, mich darüber zu trösten, dass ich diesen Tanz nicht mit Ihnen tanzen konnte, insbesondere da das Versäumnis meine Schuld war, so dass ich Ihnen meiner Verspätung wegen nicht gram sein kann, dass Sie Ihr Wort nicht hielten; dennoch hätte dieses Menuett der Königin uns den Lorbeerkranz des Tanzens eingebracht. Ich hätte es voller Ernst und Tiefsinn getanzt, nicht traurig wie Monsieur Laffitte. Nun, es hat mir dennoch gefallen. Oh, diesen Anblick werde ich nie vergessen, nie!«
Um Monsieur de Trénis hatte sich ein großer Kreis von Zuhörern gebildet, die dem Erguss seines Kummers lauschten, darunter der Erste Konsul, dem diese Art von Sprache so neu war, dass er versucht war zu glauben, er habe es mit einem Geisteskranken zu tun.
»Monsieur de Trénis«, sagte Mademoiselle de Permon, »ich verstehe Sie nicht. Was habe ich getan, um Sie zu kränken?«
»Was Sie getan haben? Madame, Sie, die Sie so tanzen, dass es mir ein Vergnügen ist, mit Ihnen zu tanzen, Sie, die Sie Ihr Menuett mit Gardel geübt haben – oh, es lässt sich nicht in Worte fassen! Sie tanzen dieses Menuett mit jemandem, der sicherlich ein guter Tänzer ist, aber ein Tänzer, der sich für die Contredanse eignet und für mehr nicht. Jawohl, für mehr nicht! Nein, Madame, nein, nie in seinem Leben hat er je die große Reverenz mit dem Hut auszuführen verstanden! O nein, ich wiederhole es, nie in seinem Leben!«
Und als er auf manchen Mienen ein Lächeln entdeckte: »Ha! Das finden Sie komisch! Nun, ich werde Ihnen sagen, warum er noch nie verstanden hat, die große Reverenz auszuführen, die feierliche Verbeugung, die den Maßstab für die Beurteilung eines Menuetttänzers bildet: Das liegt daran, dass er nicht weiß, wie er seinen Hut aufzusetzen hat; und dieses Wissen, meine Herren, ist das Einzige, worauf es ankommt, fragen Sie nur die Damen, die ihre Hüte von Leroy anfertigen, sie sich aber von Charbonnier aufsetzen lassen! Ha! Fragen Sie nur Gardel, was es mit dem Aufsetzen des Hutes auf sich hat, er wird es Ihnen sagen können. Seinen Hut aufsetzen kann jeder, mehr oder weniger richtig, wie ich annehme. Aber die Würde, aber der Schwung, mit denen die Bewegung des Arms und des Unterarms zu erfolgen hat... Sie gestatten?«
Und Monsieur de Trénis nahm den unförmigen Dreispitz aus den Händen dessen, der ihn hielt, und trat vor einen Spiegel, wo er, gefolgt von der Hälfte der Gäste, die sich an seine Fersen geheftet hatten, die Melodie der Reverenz des Menuetts summte und mit vollendeter Anmut und unvergleichlicher Feierlichkeit salutierte; dann setzte er den Hut mit all der Förmlichkeit ab, die ein solcher Anlass zu verlangen schien.
Bonaparte, auf Monsieur de Talleyrand gestützt, war ihm gefolgt.
»Fragen Sie ihn doch«, sagte er zu Letzterem, »wie er sich mit Monsieur Laffitte versteht; nach seinem Ausfall gegen mich«, fügte er lachend hinzu, »wage ich es nicht mehr, das Wort an ihn zu richten.«
Monsieur de Talleyrand formulierte die Wünsche des Ersten Konsuls so feierlich, als erkundigte er sich nach dem Stand der Beziehungen zwischen England und Amerika seit dem letzten Krieg.
»Ach, wir verstehen uns so gut«, erwiderte Monsieur de Trénis, »wie zwei Männer von Talent wie wir uns auf so sensiblem Terrain verstehen können. Ich muss allerdings einräumen, dass er als Rivale sehr großzügig und gutherzig ist und mir meinen Erfolg nicht im Geringsten neidet. Vielleicht macht der eigene Erfolg ihn nachsichtig. Sein Tanz ist kraftvoll und lebhaft. Bei den ersten acht Schritten der Gavotte Panurge ist er mir überlegen, ganz zweifellos. Aber was die jetés betrifft, oh, da kann er mir nicht das Wasser reichen, nicht im Mindesten. In puncto Sehnigkeit übertrifft er mich fast immer, aber ich bin ihm in Sachen Geschmeidigkeit weit voraus.«
Bonaparte betrachtete ihn und lauschte ihm sprachlos vor Verblüffung.
»Nun«, fragte Monsieur de Talleyrand, »sind Sie jetzt beruhigt, Citoyen Erster Konsul? Es wird zu keinem Krieg zwischen Monsieur de Trénis und Monsieur Laffitte kommen. Ich wünschte, das Gleiche könnte ich auch von Frankreich und England sagen.«
Während der unterbrochene Ball Monsieur de Trénis Gelegenheit bot, sich über seine Theorie zum Aufsetzen des Dreispitzes zu verbreiten, verhandelte Claire mit ihrer Mutter einen Gegenstand, der ihr mindestens ebenso am Herzen lag, wie es Monsieur de Talleyrand und dem Ersten Konsul daran gelegen zu sein schien, den Frieden zwischen den zwei herausragendsten Tänzern von ganz Paris und damit den Weltfrieden zu bewahren.
Der junge Graf, der Claire nicht eine Sekunde lang aus den Augen ließ, las ihrer lächelnden Miene ab, dass ihre Verhandlungen offenbar zum gewünschten Erfolg geführt hatten, und er täuschte sich nicht.
Unter dem Vorwand, sich in einem Salon zu erfrischen, in dem sich weniger Leute aufhielten, nahm Mademoiselle de Sourdis Mademoiselle de Beauharnais am Arm, und als sie an dem Grafen vorbeiging, sagte sie leise: »Meine Mutter gestattet, dass Sie morgen Nachmittag um drei Uhr bei uns vorsprechen.«
13
Die drei Sainte-Hermines: Der Vater
Am nächsten Tag klopfte Hector de Sainte-Hermine im selben Augenblick, in dem es am Pavillon de l’Horloge drei Uhr schlug, an die Tür des Stadtpalais der Madame de Sourdis, dessen prachtvolle Terrasse mit Blick auf den Quai Voltaire Orangenbäumchen und Oleanderbüsche zierten.
Die Tür, an die Hector klopfte, öffnete sich auf die Rue de Beaune. Es war der Haupteingang. Eine kleinere Tür, unscheinbar bis zur Unkenntlichkeit, in der gleichen Farbe wie das Mauerwerk, ging auf den Quai.
Die Tür wurde geöffnet, der Türsteher fragte nach dem Namen des Besuchers und ließ ihn ein; ein Hausdiener, wahrscheinlich von Madame de Sourdis instruiert, erwartete ihn im Vorraum.
»Madame lässt sich entschuldigen«, sagte er, »sie kann nicht empfangen, aber Mademoiselle befindet sich im Garten und wird Madame vertreten.«
Er ging voran, um dem Grafen den Weg zu weisen; Hector folgte ihm zu der Tür, die in den Garten führte. »Nehmen Sie diesen Weg«, sagte der Diener zu ihm. »Mademoiselle befindet sich an seinem Ende in der Laube aus Jasmin.«
Unter den Strahlen einer milden Märzsonne sah Claire in ihrem Hermelinpelz fast aus, als wollte sie erblühen wie eine jener ersten Frühlingsblumen, deren frühes Erscheinen ihnen den Namen Schneeglöckchen beschert hat. Unter ihren Füßen lag ein Teppich aus Smyrna, um ihre himmelblauen Samtpantoffeln vor der Kälte des Bodens zu schützen.
Obwohl sie Sainte-Hermine erwartete und sicherlich die Schläge der Turmuhr vernommen hatte, färbte bei seinem Anblick ein rosiges Erröten ihre bleichen Wangen, bevor die Lilienblässe zurückkehrte. Lächelnd erhob sie sich.
Der junge Graf schritt schneller aus. Als er sie erreichte, deutete sie auf das Fenster des Salons, aus dem man in den Garten sah; hinter diesem Fenster saß ihre Mutter, die auf diese Weise ein Auge auf die jungen Leute hatte, ohne hören zu können, was gesprochen wurde.
Sainte-Hermine verbeugte sich tief zum Zeichen seines Dankes und seiner Hochachtung.
Claire wies ihm einen Stuhl und setzte sich wieder.
»Mademoiselle«, sagte er, »ich will nicht versuchen, Ihnen das Glück zu schildern, das es mir bedeutet, für einen Augenblick allein mit Ihnen sprechen zu können: Auf diesen Augenblick, den der Himmel in seiner Güte mir zuteilwerden ließ und von dem Glück oder Unglück meines künftigen Lebens abhängen wird, wartete ich seit einem Jahr, doch erst seit drei Tagen durfte ich auf ihn hoffen. Sie waren so gütig, mir bei dem Ball zu sagen, dass Ihnen meine Seelenpein aufgefallen sei, als ich die Freude und den Schmerz empfand, in Ihrer Gegenwart zu weilen, meine Seelenpein, Sie zu sehen, Schmerz und Freude, die mir das Herz zerrissen. Ich werde Ihnen den Grund nennen – vielleicht ein wenig weitschweifig, doch ich kann mich nur verständlich machen, wenn ich den Bericht, den Sie hören werden, in der Ausführlichkeit halte, die er erfordert.«
»Sprechen Sie, Monsieur«, sagte Claire. »Alles, was Sie mir sagen können, wird meine ungeteilte Aufmerksamkeit finden, dessen kann ich Sie versichern.«
»Wir entstammen – besser gesagt: ich entstamme, denn ich bin der Letzte unseres Hauses – einem angesehenen Geschlecht im Jura. Mein Vater war Stabsoffizier unter Ludwig XVI. und zählte am 10. August zu seinen Verteidigern; doch statt die Flucht zu ergreifen wie die Fürsten und Höflinge, blieb er bei ihm. Nach dem Tod des Königs hoffte er, dass noch nicht alles verloren sei und dass man die Königin aus dem Temple-Gefängnis retten könne; es gelang ihm, beträchtliche Geldmittel aufzubringen und in der Stadtverwaltung einen jungen Mann aus dem Süden Frankreichs namens Toulan ausfindig zu machen, der in die Königin verliebt war und alles für sie tun würde. Mein Vater beschloss, sich diesem Mann anzuvertrauen oder vielmehr dessen Stellung im Temple zu benutzen, um die Gefangene zu befreien.
Da mein ältester Bruder Léon de Sainte-Hermine es leid war, der Sache, an die zu glauben man ihn gelehrt hatte, nicht dienen zu können, erbat er von meinem Vater die Erlaubnis, Frankreich zu verlassen und in die Armee des Prinzen von Condé einzutreten, was er nach erfolgter Erlaubnis unverzüglich tat.
Unterdessen wurde ein Plan gefasst.
Noch immer gab es viele Neugierige, darunter auch ergebene Bediente, die von den diensthabenden städtischen Beamten, in deren Zuständigkeit dies fiel, die Gunst erbaten, die Königin zu sehen.
Da die Königin zweimal täglich hinunterkam und im Garten spazieren ging, verteilten die Beamten ihre Freunde auf dem Weg, den die hohe Gefangene nehmen musste, und wenn der Beamte wegsah, konnte man unter Umständen ein Wort mit ihr wechseln oder ihr einen Brief zustecken.
Gewiss war all das lebensgefährlich, doch es gibt Augenblicke, in denen man dem Leben keinen großen Wert beimisst.
Toulan stand in der Schuld meines Vaters; Dankbarkeit und Liebe bewegten ihn dazu, folgendem Plan zuzustimmen:
Unter dem Vorwand, die Königin sehen zu wollen, sollten meine Eltern, verkleidet als reiche Bauern aus dem Jura, die mit dem Akzent von Leuten aus der Gegen von Besançon sprachen, den Temple aufsuchen und Monsieur Toulan sprechen wollen.
Toulan würde sie an dem Spazierweg der Königin positionieren.
Zwischen den Gefangenen im Temple und ihren royalistischen Anhängern gab es eine Vielzahl von Signalen, mit deren Hilfe sie sich verständigten wie Schiffe auf dem Meer.
Am Tag des Besuchs meiner Eltern hatte die Königin beim Verlassen ihres Zimmers einen Strohhalm vorgefunden, der an der Wand lehnte, was bedeutete: ›Seien Sie wachsam, man hat Sie nicht vergessen.‹
Die Königin sah den Strohhalm nicht, aber Madame Élisabeth, weniger in Gedanken versunken, sah ihn und machte ihre Schwägerin darauf aufmerksam.
Die zwei Gefangenen bemerkten, dass Toulan an diesem Tag Dienst hatte.
Toulan war bis zum Wahnsinn in die Königin verliebt. Diese hatte im Wissen um die Liebe des unglücklichen jungen Mannes auf einen Zettel, den sie immer im Mieder verborgen bei sich trug, die Worte geschrieben: Ama poco che teme la morte! (Wenig liebt, wer den Tod fürchtet!) Als sie Toulan erblickte, steckte sie ihm das Billett zu.
Ohne zu wissen, was es enthielt, geriet Toulan vor Freude außer sich. Noch am selben Tag würde er der Königin beweisen, dass er den Tod nicht fürchtete.
Er brachte meine Eltern in das Treppenhaus des Turms, wo die Königin sie beim Vorbeigehen fast berühren musste.
Meine Mutter hielt einen großen Strauß Nelken in der Hand. Beim Anblick der Nelken rief die Königin: ›Oh, was für schöne Blumen! Und wie herrlich sie duften!‹
Meine Mutter zog die schönste Nelke aus dem Strauß und reichte sie der Königin. Diese blickte zu Toulan, um zu sehen, ob sie sie nehmen dürfe. Toulan nickte unmerklich. Die Königin nahm die Blume.
Unter gewöhnlichen Umständen wäre all dies nicht weiter schwierig gewesen, doch in jenen Tagen klopfte einem das Herz bis zum Hals und man wagte kaum zu atmen.
Die Königin begriff sogleich, dass in dem Blütenkelch der Nelke ein Billett versteckt war, und sie nahm sie und verbarg sie unter ihrem Brusttuch.
Öfter als einmal hat mein Vater uns erzählt, wie tapfer die Gräfin von Sainte-Hermine sich gehalten habe, dass ihre Gesichtsfarbe jedoch fahler gewesen sei als die Steine des Gefängnisturms.
Die Königin war so mutig, ihren gewohnten Spaziergang nicht abzukürzen. Zu ihrer gewohnten Stunde ging sie wieder hinauf, und erst als sie sich mit Schwester und Tochter allein wusste, holte sie aus ihrem Mieder die Blume hervor.
In der Tat barg der Blütenkelch ein Billett; mit feiner, aber ausgezeichnet lesbarer Schrift war auf Seidenpapier folgender tröstliche Ratschlag geschrieben:
›Übermorgen, Mittwoch, bitten Sie, in den Garten gehen zu dürfen, was man Ihnen gestatten wird, da Ordre besteht, Ihnen diese Gunst zu gewähren, wenn Sie sie erbitten. Nach drei, vier Runden stellen Sie sich müde, nähern sich der Cantine im Garten und bitten Madame Plumeau, sich zu ihr setzen zu dürfen.
Sie müssen darauf achten, diese Erlaubnis um Punkt elf Uhr vormittags zu erbitten, damit Ihre Befreier ihr Handeln mit dem Ihren abstimmen können.
Kurz darauf stellen Sie sich, als gehe es Ihnen schlechter und als würden Sie ohnmächtig. Man wird die Türen verschließen, um Ihnen zu Hilfe zu kommen, und Sie bleiben allein mit Madame Élisabeth und Madame Royale. Unverzüglich wird die Falltür zum Keller geöffnet werden. Stürzen Sie sich mit Schwester und Tochter in diese Öffnung, und Sie werden alle drei gerettet sein.‹
Das Zusammentreffen dieser drei Dinge ließ die Gefangenen Zuversicht fassen: Toulans Anwesenheit, der Strohhalm im Flur und die genauen Angaben des Billetts.
Was riskierten sie schon bei ihrem Fluchtversuch? Das Leben konnte ihnen kaum schwerer gemacht werden, als es der Fall war. Sie beschlossen, so zu handeln, wie es ihnen in dem Billett empfohlen wurde.
Am Mittwoch, dem übernächsten Tag, las die Königin hinter zugezogenen Bettvorhängen nochmals das Billett, das meine Mutter ihr in der Nelke zugesteckt hatte, um keine der Instruktionen zu übersehen, die es enthielt, zerriss es dann in winzige Schnipsel und begab sich um neun Uhr in das Zimmer der Madame Royale.
Sie verließ das Zimmer gleich darauf und rief nach den Wachen, die gerade beim Essen saßen, so dass sie zweimal rufen musste, bis eine der Wachen erschien.
›Was willst du, Citoyenne?‹, fragte die Wache.
Marie-Antoinette erklärte, dass Madame Royale mangels Bewegung erkrankt sei, dass man sie nur mittags hinauslasse, wenn die Sonne so stark brenne, dass sie nicht spazieren gehen könne, und dass sie um die Erlaubnis bitte, die Zeit ihres täglichen Spaziergangs vorzuverlegen, den sie lieber zwischen zehn und zwölf Uhr statt zwischen zwölf Uhr und zwei Uhr machen wolle; die Königin bat die Wache, ihre Bitte General Santerre vorzutragen, dem die Entscheidungsgewalt oblag, und fügte hinzu, sie werde zutiefst dankbar sein.
Die letzten Worte hatte die Königin so anmutig und bezaubernd geäußert, dass die Wache ihr nicht widerstehen konnte; der Mann lüpfte seine rote Mütze und sagte: ›Madame, der General wird in einer halben Stunde kommen, und sobald er da ist, wird man ihn um alles bitten, was Sie wünschen‹ – und wie um sich Mut zu machen, dass er im Recht sei, sich den Wünschen der Gefangenen zu fügen, dass er aus Vernunft handle und nicht aus Schwäche, wiederholte er: ›Das ist nur recht und billig! Alles in allem ist das nur recht und billig!‹
›Was ist recht und billig?‹, fragte ihn die andere Wache.
›Dass diese Frau mit ihrer kranken Tochter spazieren geht.‹
›Schon gut‹, erwiderte der andere, ›dann soll sie mit ihr auf die Place de la Révolution vor dem Temple kommen, dann kann sie dort spazieren gehen.‹
Die Königin hörte die Antwort der zweiten Wache und erschauerte, doch sie wich nicht ab von ihrem Vorhaben, die erhaltenen Instruktionen peinlich genau zu befolgen.
Um halb zehn traf Santerre ein. Dieser Santerre war kein übler Mensch, ein wenig schroff, ein wenig brutal; zu Unrecht hatte man ihn beschuldigt, den schrecklichen Trommelwirbel angeordnet zu haben, der dem König auf dem Schafott die letzten Worte abschnitt, was er nie verwunden hatte. Doch war er so unvorsichtig gewesen, sich sowohl mit der Generalversammlung als auch mit der Kommune anzulegen, was ihn beinahe den Kopf gekostet hatte.
Er erteilte die Erlaubnis, um die ersucht wurde.
Eine der Wachen ging zur Königin hinauf und teilte ihr mit, dass der General ihrer Bitte stattgebe.
›Ich danke Ihnen, Monsieur‹, sagte sie mit dem bezaubernden Lächeln, das Barnave und Mirabeau in ihr Verderben gelockt hat; dann wendete sie sich an ihren kleinen Hund, der auf die Hinterpfoten aufgerichtet hinter ihr lief: ›Komm, Black, freu dich mit mir, wir werden spazieren gehen‹, und an die Wache gewendet: ›Wir dürfen hinausgehen; um wie viel Uhr?‹
›Um zehn Uhr; war das nicht die Stunde, die Sie selbst vorschlugen?‹
Die Königin verneigte sich, die Wache verließ das Zimmer.
Die drei Frauen blieben allein zurück und wechselten Blicke, in denen sich Hoffnung und Freude mischten. Madame Royale warf sich der Königin in die Arme, Madame Élisabeth trat zu ihr und reichte ihr stumm die Hand.
›Beten wir‹, sagte die Königin, ›aber beten wir so, dass niemand uns beten sieht.‹ Alle drei beteten schweigend.
Die Uhr schlug zehn. Waffenlärm drang bis zu der Königin.
›Das ist die Wachablösung‹, sagte Madame Élisabeth.
›Dann wird man uns jetzt holen‹, sagte Madame Royale.
Die Königin sah, wie ihre Schwägerin und ihre Tochter erbleichten. ›Nur Mut‹, sagte sie, obwohl sie selbst erbleichte.
›Es ist zehn Uhr‹, hörten sie von unten rufen, ›bringt die Gefangenen herunter!‹
›Hier sind wir, Citoyens‹, erwiderte die Königin.
Die erste Tür wurde aufgeschlossen. Durch sie gelangte man in einen finsteren Flur. Dank dem Dämmerlicht konnten die Gefangenen ihre Erregung verbergen.
Der kleine Hund lief ihnen freudig voraus. Doch als er die Tür des Raums erreichte, den sein Herr bewohnt hatte, hielt er inne, schob seine Schnauze in den Schlitz unter der Tür, schnaufte heftig und ließ nach einigen kläglichen Lauten das tiefe und schmerzliche Bellen ertönen, das man gemeinhin als Totengeheul bezeichnet.
Die Königin ging schnell an ihm vorbei, sah sich jedoch einige Schritte weiter genötigt, an der Mauer Halt zu suchen. Die zwei anderen Frauen traten zu ihr und verharrten reglos. Der kleine Black lief zu ihnen.
›Was ist?‹, rief eine Stimme. ›Kommt sie herunter oder nicht?‹
›Wir kommen schon‹, antwortete die Wache, die sie begleitete.
›Gehen wir‹, sagte die Königin, die sich zusammenriss. Und es gelang ihr, die Treppe hinunterzusteigen.
Als sie den Fuß der Wendeltreppe erreicht hatte, erklang ein Trommelwirbel – nicht um die Königin zu ehren, sondern um ihr zu verstehen zu geben, dass sie sich angesichts solcher Vorsichtsmaßnahmen jeden Fluchtversuch aus dem Kopf schlagen könne.
Die schwere Tür öffnete sich langsam, ächzend und quietschend.
Die drei Gefangenen befanden sich im Hof. Schnell begaben sie sich in den Garten. Die Mauern des Hofs bedeckten Schmähinschriften und obszöne Kritzeleien, die sie zur Zielscheibe hatten und mit denen die Soldaten sich die Zeit vertrieben.
Das Wetter war herrlich, die Sonne schien noch nicht so heiß, dass es unerträglich gewesen wäre.
Die Königin ging ungefähr eine Dreiviertelstunde lang spazieren; dann, als es etwa zehn vor elf war, näherte sie sich der Cantine, in der eine Frau namens Mutter Plumeau Wurstwaren, Wein und Schnaps an die Soldaten verkaufte.
Die Königin befand sich bereits auf der Schwelle der Cantine, im Begriff, einzutreten und um Erlaubnis zu bitten, sich zu setzen, als sie sah, dass der Schuster Simon an einem der Tische saß, wo er soeben seine Mittagsmahlzeit beendete.
Unwillkürlich wich sie zurück: Simon war einer ihrer unflätigsten Widersacher. Sie trat einen Schritt zurück und rief ihren kleinen Hund zu sich, der vor ihr in den Raum gesprungen war.
Black aber war unverzüglich zu einer Falltür in den Keller gelaufen, in dem die Witwe Plumeau ihre Lebensmittel und ihre Getränke aufbewahrte. Aufmerksam beschnüffelte er den Rand der Falltür.
Zitternd, denn sie erriet, was den Hund irritierte, rief die Königin Black zu sich, doch der Hund schien sie nicht zu hören oder wollte nicht hören.
Unversehens begann er zu knurren und dann laut zu bellen.
Als der Schuster sah, mit welcher Hartnäckigkeit der kleine Hund seiner Herrin den Gehorsam verweigerte, zuckte es ihm wie eine Erleuchtung durch das Hirn. Er sprang zur Tür und rief: ›Zu den Waffen! Verrat! Zu den Waffen!‹
›Black! Black!‹, rief die Königin mit verzweifelter Stimme und tat einige Schritte in die Cantine. Doch der Hund gehorchte ihr nicht, sondern bellte immer wütender.
›Zu den Waffen!‹, schrie Simon wie am Spieß. ›Zu den Waffen! Im Keller der Citoyenne Plumeau halten sich Aristokraten versteckt, um die Königin zu retten. Verrat! Verrat!‹
›Zu den Waffen!‹, riefen die Wachen. Vereinzelte Nationalgardisten griffen zum Gewehr und liefen zur Königin, zu ihrer Tochter und ihrer Schwägerin, nahmen sie zwischen sich und führten sie zum Turm zurück.
Black rührte sich nicht von der Stelle, obwohl seine Herrin nicht mehr im Raum war; dieses eine Mal hatte der Instinkt das arme Tier getäuscht, denn es hatte die Rettung für eine Gefahr gehalten.
Ein Dutzend Nationalgardisten war in die Cantine eingedrungen. Simon zeigte ihnen voller Eifer die Kellertür, an der Black noch immer bellte.
›Dort sind sie, unter der Falltür!‹, rief Simon. ›Ich habe gesehen, wie die Falltür sich bewegt hat, das schwöre ich!‹
›Legt an!‹, riefen die Wachen.
Geräuschvoll legten die Nationalgardisten ihre Gewehre an.
›Dort!‹, rief Simon. ›Dort, dort!‹
Der Offizier ergriff den Ring der Falltür, und zwei kräftige Männer kamen ihm zu Hilfe, doch die Falltür ließ sich nicht bewegen.
›Sie halten die Falltür von innen fest!‹, rief Simon. ›Schießt durch die Tür, schießt!‹
›Und was ist mit meinen Flaschen?‹, rief die Citoyenne Plumeau. ›Sie werden meine Flaschen in Scherben schießen!‹
Simone schrie noch immer: ›Feuer!‹
›Gib endlich Ruhe, du Schreihals‹, befahl der Offizier. ›Und ihr holt Äxte und schlagt die Falltür ein.‹
Seine Leute taten wie geheißen.
›Und jetzt‹, sagte der Offizier, ›haltet euch bereit, und sobald die Falltür geöffnet wird, eröffnet ihr das Feuer.‹
Die Axt fuhr in die Bohlen, zwanzig Gewehre senkten sich der Öffnung entgegen, die sich jeden Augenblick erweiterte.
Doch niemand war dahinter zu erkennen. Der Offizier entzündete eine Fackel und warf sie in den Keller. Der Keller war leer.
›Folgt mir‹, rief der Offizier und stürzte sich in den Keller. ›Vorwärts!‹, riefen die Nationalgardisten, die ihrem Anführer folgten.
›Oh, Frau Plumeau!‹, rief Simon und drohte der Wirtin mit der Faust, ›du stellst deinen Keller den Aristokraten zur Verfügung, damit sie die Königin entführen!‹
Doch Simon beschuldigte die gute Frau zu Unrecht. Die Kellerwand war eingeschlagen; ein unterirdischer Gang von drei Fuß Breite und fünf Fuß Höhe, dessen Boden viele Füße festgetreten hatten, führte in Richtung der Rue de la Corderie.
Der Offizier eilte in diesen Gang, der wie der Eingang eines Schützengrabens aussah, doch nach zehn Schritten stand er vor einem Eisengitter. ›Halt‹, sagte er zu den Soldaten, die hinter ihm herstürmten, ›hier geht es nicht weiter. Vier Mann sollen hier Wache halten und jeden töten, der sich zu zeigen wagt. Ich werde meinen Bericht verfassen. Die Aristokraten haben versucht, die Königin zu entführen.‹
Diese Verschwörung wurde später unter dem Namen Nelkenverschwörung bekannt; ihre drei Hauptakteure waren mein Vater, der Ritter von Maison-Rouge und Toulan, und meinen Vater und Toulan hat sie auf das Schafott gebracht. Der Ritter von Maison-Rouge, der sich bei einem Gerber im Faubourg Saint-Victor versteckt hielt, entkam allen Nachstellungen.
Doch bevor er starb, verpflichtete mein Vater meinen älteren Bruder, seinem Beispiel zu folgen und wie er für die Krone zu sterben.«
»Und Ihr Bruder?«, flüsterte Claire, die sein Bericht sichtlich ergriffen hatte. »Hat er dem Wunsch Ihres Vaters gehorcht?«
»Das werden Sie erfahren«, erwiderte Hector, »wenn Sie mir gestatten fortzufahren.«
»Oh, sprechen Sie weiter! Bitte!«, rief Claire, »Ich lausche Ihnen mit Ohren und Herz!«
14
Léon de Sainte-Hermine
»Einige Zeit nach der Hinrichtung meines Vaters starb meine Mutter, die bei der Nachricht seines Todes erkrankt war.
Von diesem neuen Unglück konnte ich meinem Bruder Léon nicht berichten. Seit dem Kampf bei Berchem hatte man nicht mehr von ihm gehört; ich schrieb meinem Bruder Charles in Avignon, der sich auf der Stelle nach Besançon aufmachte.
Ich werde Ihnen berichten, was wir über die Schlacht bei Berchem und über das Los meines Bruders erfuhren, und zwar vom Prinzen von Condé, zu dem meine Mutter, die im Sterben lag, in ihrer Ratlosigkeit hatte schicken lassen; der Bote war jedoch erst nach ihrem Tod zurückgekehrt, am selben Tag wie mein Bruder.
Am 4. Dezember 1793 hatte der Prinz von Condé in Berchem sein Hauptquartier. Pichegru führte zwei Angriffe gegen ihn aus, ohne ihn von Berchem wegzudrängen oder sich dort halten zu können, nachdem er Condé weggedrängt hatte.
Nach der abermaligen Einnahme der Ortschaft durch die Emigranten vollführte Léon wahre Wunder an Mut, drang als Erster in das Dorf ein und ward nicht mehr gesehen. Obwohl seine Gefährten ihm auf dem Fuß folgten, konnten sie ihn nirgends ausmachen. Man suchte unter den Toten, fand ihn jedoch nicht. Die allgemeine Ansicht war die, dass er sich auf der Verfolgung der Republikaner zu weit vorgewagt hatte und von ihnen gefangen genommen worden war.
Die Gefangennahme kam dem Todesurteil gleich, denn jeder Gefangene, den man bewaffnet ergriff, wurde der Form halber vor ein Kriegsgericht gestellt und füsiliert.
Nichts mehr zu hören bestätigte uns in dieser schmerzlichen Überzeugung, bis man uns den Besuch eines jungen Mannes aus Besançon ankündigte, der von der Rheinarmee kam. Er war fast noch ein Kind, kaum vierzehn Jahre alt, der Sohn eines alten Freundes meines Vaters. Er war ein Jahr jünger als ich, wir waren gemeinsam erzogen worden. Sein Name war Charles N.
Ich sah ihn als Erster. Ich wußte, dass er seit drei Monaten bei General Pichegru weilte. Ich lief auf ihn zu und rief: ›Charles, du bist es! Bringst du uns Nachrichten von meinem Bruder?‹ – ›Leider ja‹, erwiderte er. ›Ist dein Bruder Charles da?‹ – ›Ja‹, antwortete ich. ›Nun‹, erwiderte er, ›lass ihn rufen, denn das, was ich dir zu sagen habe, gilt auch ihm.‹ Ich rief meinen Bruder. Er kam herbei. ›Charles ist gekommen‹, sagte ich, ›und er hat Neuigkeiten von Léon.‹ – ›Schlechte Neuigkeiten, nicht wahr?‹ – ›Ich fürchte es, denn sonst hätte er sie uns bereits gesagt.‹
Ohne darauf zu antworten, zog mein junger Freund mit traurigem Lächeln eine Polizeimütze aus seiner Weste und reichte sie meinem Bruder. ›Nunmehr sind Sie das Familienoberhaupt‹, sagte er, ›und deshalb kommt diese Hinterlassenschaft Ihnen zu.‹
›Was ist das?‹, fragte mein Bruder.
›Das ist die Mütze, die er trug, als er erschossen wurde‹, erwiderte Charles.
›Er ist also tot?‹, fragte mein älterer Bruder trockenen Auges, während ich gegen meinen Willen weinen musste.
›Ja.‹
›Und er ist tapfer gestorben?‹
›Wie ein Held.‹
›Der Herr sei gepriesen! Unsere Ehre ist unversehrt. In der Mütze ist sicherlich etwas verborgen?‹
›Ein Brief.‹
Mein Bruder betastete die Mütze, erkannte die Stelle, an der sich der Brief befand, schnitt die Naht der Mütze mit einem Taschenmesser auf und entnahm ihr den Brief, den er öffnete.
An meinen Bruder Charles.
Zuerst und vor allen Dingen verheimliche meinen Tod vor unserer Mutter so lange wie möglich.
›Ist er gestorben, ohne zu wissen, dass unsere arme Mutter ihm in das Grab vorausgegangen ist?‹, fragte mein Bruder.
›Nein‹, sagte Charles, ›ich habe es ihm gesagt.‹
Mein Bruder sah wieder auf den Brief und las weiter:
Ich wurde in Berchem gefangen genommen. Mein Pferd brach zusammen und begrub mich unter sich. Ich konnte mich nicht wehren.
Ich warf meinen Säbel weg, und vier Republikaner befreiten mich.
Man brachte mich auf die Festung Auenheim, um mich dort zu füsilieren; wenn kein Wunder geschieht, kann mich nichts mehr retten.
Mein Vater hatte dem König sein Wort gegeben, für die royalistische Sache zu sterben, und er hat es gehalten.
Ich gab meinem Vater mein Wort, für dieselbe Sache einzustehen, und werde sterben.
Du hast mir Dein Wort gegeben. Nun ist die Reihe an Dir. Wenn Du stirbst, wird Hector uns rächen.
Bete am Grab meiner Mutter.
Gib Hector einen väterlichen Kuss.
Adieu
LÉON DE SAINTE-HERMINE
P.S. Ich weiß nicht, wie ich Dir diesen Brief zukommen lassen kann, Gott wird es einrichten.
Mein Bruder küsste den Brief, reichte ihn mir, damit auch ich ihn küsste, und drückte ihn an sein Herz. Dann sagte er zu Charles: ›Und du hast seinem Tod beigewohnt?‹
›Ja!‹, erwiderte Charles.
›Nun, dann erzähle es mir in allen Einzelheiten.‹<
›Das ist nicht schwer‹, sagte Charles. ›Ich war auf dem Weg von Straßburg zum Hauptquartier des Generals Citoyen Pichegru in Auenheim, als ich kurz hinter Sessenheim von einem kleinen Trupp Infanteristen eingeholt wurde, ungefähr zwanzig Soldaten, die ein Hauptmann zu Pferde befehligte. Die zwanzig Männer marschierten in zwei Reihen.
Mitten auf der Straße ging zu Fuß ein Kavallerist, was an den Sporen seiner Armeestiefel leicht zu erkennen war; von Kopf bis Fuß war er in einen weiten weißen Mantel gehüllt, der nur seinen Kopf sehen ließ, ein junges, intelligentes Gesicht, das mir undeutlich bekannt vorkam; er trug eine Polizeimütze, was in der französischen Armee nicht üblich ist.
Der Hauptmann sah mich neben dem jungen Mann im weißen Mantel gehen, und da ich noch jünger aussehe, als ich es bin, fragte er mich wohlwollend:
„Wohin des Weges, mein junger Citoyen?“
„Zum Hauptquartier des Generals Pichegru; ist es noch weit?“
„Noch ungefähr zweihundert Schritte“, erwiderte der junge Mann im weißen Mantel. „Sehen Sie, am Ende des Weges, auf den wir eingebogen sind, befinden sich die ersten Häuser von Auenheim.“
Ich wunderte mich, dass er mir das Dorf mit einer Kopfbewegung wies statt mit einer Geste.
„Danke“, sagte ich und beeilte mich, schneller zu gehen, um ihn von meiner Gegenwart zu befreien, die ihn zu stören schien, doch er rief mich zurück.
„Meiner Treu, junger Freund“,sagte er, „wenn Sie es nicht allzu eilig haben, sollten Sie mit uns gehen, denn dann könnte ich Sie bitten, mir Neuigkeiten aus Ihrer Gegend zu berichten.“
„Aus meiner Gegend?“fragte ich überrascht.
„Zum Kuckuck!“, sagte er, „sind Sie etwa nicht aus Besançon oder zumindest aus der Franche-Comté?“
Ich sah ihn erstaunt an; seine Sprache, sein Gesicht, seine Haltung – alles weckte in mir Kindheitserinnerungen. Offenbar hatte ich diesen schönen jungen Mann früher einmal gekannt.
„Aber vielleicht wollen Sie Ihr Inkognito wahren“, sagte er lachend.
„O nein, Citoyen“, entgegnete ich. „Ich musste nur daran denken, dass Theophrast, der ursprünglich Tyrtamos hieß und den die Athener den Schönredner nannten, nach fünfzig Jahren in Athen von einer Obstverkäuferin als Mann aus Lesbos wiedererkannt wurde.“
„Sie sind ein gebildeter Herr“, sagte mein Reisegefährte; „das ist in den gegenwärtigen Zeiten ein Luxus.“
„O nein“, sagte ich wieder. „Ich bin auf dem Weg zu General Pichegru, der selbst sehr gebildet ist, und ich hoffe, dank eines Empfehlungsschreibens von ihm als Sekretär angestellt zu werden. Und du, Citoyen“, fügte ich neugierig hinzu, „gehörst du zur Armee?“
Er begann zu lachen. „Nicht genau“, sagte er.
Ich sagte: „Dann bist du der Verwaltung attachiert.“
„Attachiert“, wiederholte er lachend. „Meiner Treu, so kann man es wahrhaftig bezeichnen, Monsieur. Allerdings bin ich nicht der Verwaltung attachiert, sondern mir selbst.“
„Aber Sie siezen mich und sagen laut Monsieur zu mir“, sagte ich leise. „Befürchten Sie denn nicht, dass Sie das Ihre Stellung kosten kann?“
„Oho, Hauptmann, haben Sie das gehört?“rief der junge Mann im weißen Mantel lachend. „Der junge Citoyen befürchtet, ich könnte meine Stellung verlieren, weil ich ihn sieze und Monsieur zu ihm sage. Wüssten Sie jemanden, der meine Stellung gern hätte? Ich würde sie ihm jederzeit abtreten!“
„Armer Teufel!“murmelte der Hauptmann schulterzuckend.
„Sagen Sie, junger Mann“, fragte mein Reisegefährte, „da Sie aus Besançon kommen, denn daher kommen sie, nicht wahr?“
Ich nickte.
„Dann kennen Sie sicher eine Familie namens Sainte-Hermine.“
„Ja“, antwortete ich, „eine Witwe und drei Söhne.“
„Drei Söhne, ganz genau; ja“, fügte er seufzend hinzu, „noch sind es drei. Danke. Wann haben Sie Besançon verlassen?“
„Vor sieben oder acht Tagen.“
„Dann können Sie mir Neuigkeiten berichten?“
„Gewiss, aber traurige Neuigkeiten.“
„Erzählen Sie.“
„Am Tag vor meiner Abreise waren mein Vater und ich auf der Beerdigung der Gräfin.“
„Oh!“, rief der junge Mann und richtete den Blick zum Himmel. „Die Gräfin ist tot!“
„Ja!“
„Umso besser!“
Und aus seinen Augen rollten zwei große Tränen.
„Wie können Sie so sprechen!“, rief ich. „Die Gräfin war eine wahre Heilige!“
„Umso besser“, wiederholte der junge Mann, „dass sie ihrem Leiden erlegen ist und nicht vor Kummer sterben muss, wenn sie erfährt, dass ihr Sohn erschossen wurde.“
„Was sagen Sie da?“, rief ich. „Der Graf von Sainte-Hermine wurde erschossen? “
„Noch nicht, aber er wird erschossen werden.“
„Und wann?“
„Sobald wir das Fort von Auenheim erreicht haben werden.“
„Befindet sich dort der Graf von Sainte-Hermine?“
„Nein, er ist auf dem Weg dorthin.“
„Und man wird ihn erschießen?“
„Sobald ich angekommen sein werde.“
„Sind Sie für die Hinrichtung zuständig?“
„Nein, aber ich werde das Zeichen für das Feuer geben. Diese Gunst wird einem tapferen Soldaten, den man mit der Waffe in der Hand überwältigt hat, nicht verweigert, selbst wenn er ein Emigrant ist.“
„Großer Gott!“, rief ich voller Entsetzen. „Dann sind Sie...?“
Der junge Mann lachte schallend. „Jetzt wissen Sie, warum ich lachen musste, als Sie mir zur Vorsicht rieten. Und warum ich meine Stellung jedem abgetreten hätte, der sie haben wollen könnte, denn ich musste nicht befürchten, sie zu verlieren; wie Sie so richtig sagten, bin ich attachiert.“
Und erst da schüttelte er seinen Mantel mit einer Bewegung seiner Schultern, und ich sah, dass ihm Hände und Arme gebunden waren.
„Aber dann“, rief ich noch entsetzter als zuvor, „dann sind Sie -“
„Der Graf von Sainte-Hermine, junger Mann. Sie sehen, wie recht ich hatte, als ich sagte, dass meine Mutter gut daran getan hatte zu sterben.“
„Großer Gott!“, rief ich verzweifelt.
„Zum Glück“, sagte der Graf mit zusammengepressten Lippen, „leben meine Brüder.“‹
›O ja‹, riefen wir wie aus einem Mund, ›und wir werden seinen Tod rächen. ‹«
»Es war also Ihr Bruder, der zu seiner Hinrichtung geführt wurde?«, fragte Mademoiselle de Sourdis.
»Ja«, antwortete Hector. »Genügt Ihnen dies, oder wollen Sie erfahren, wie er starb? Die Einzelheiten, die unsere Herzen bis zum Zerspringen klopfen machten, können für jemanden, der den armen Léon nicht gekannt hat, von keinem großen Interesse sein.«
»Oh, sagen Sie mir alles, alles!«, rief Mademoiselle de Sourdis, »ersparen Sie mir nichts. War Monsieur Léon de Sainte-Hermine denn nicht mein Verwandter, und habe ich nicht das Recht, ihm bis zum Grab zu folgen?«
»Dies sagten wir auch zu Charles, der seinen Bericht fortsetzte.
›... Sie können sich denken, welche Erschütterung es für mich war, zu erfahren, dass auf diesen schönen jungen Mann in seiner Jugendblüte, der so sicheren Schrittes ging und so unbeschwert mit mir scherzte, der Tod wartete.
Zudem war er ein Landsmann von mir, Oberhaupt einer unserer vornehmsten Familien, nämlich der Graf von Sainte-Hermine.
Ich näherte mich ihm. „Gibt es kein Mittel, Sie zu retten?“, fragte ich leise.
„Ich muss gestehen, dass ich keines wüsste“, erwiderte er, „denn wüsste ich eines, ergriffe ich es, ohne zu zögern.“
„Da ich mich nicht in der glücklichen Lage sehe, Ihnen diesen Dienst zu erweisen, wäre es mir lieb, wenn ich mich von Ihnen in dem Wissen verabschieden könnte, Ihnen zu etwas nutze gewesen zu sein, dazu beigetragen zu haben, Ihnen den Tod erträglicher zu machen, Ihnen das Sterben erleichtert zu haben, wenn ich Sie schon nicht vor dem Tod bewahren konnte.“
„Seit Sie hier sind, trage ich mich mit einem Gedanken.“
„Sagen Sie ihn.“
„Es ist vielleicht nicht ganz ungefährlich, und ich fürchte, Sie könnten sich ängstigen.“
„Ich bin zu allem bereit, wenn ich Ihnen damit einen Dienst erweisen kann.“
„Ich möchte meinem Bruder Nachricht von mir zukommen lassen.“
„Ich bin bereit, sie ihm zu überbringen.“
„Es ist aber ein Brief.“
„Ich werde ihn ihm aushändigen.“
„Ich könnte ihn dem Hauptmann geben. Er ist ein wackerer Mann und würde ihn wahrscheinlich dem Empfänger überbringen lassen.“
„Bei dem Hauptmann ist es anzunehmen“, erwiderte ich, „bei mir können Sie sichergehen.“
„Dann hören Sie mir gut zu.“
Ich trat noch näher zu ihm.
„Der Brief ist schon geschrieben“, sagte er, „und in meine Polizeimütze eingenäht.“
„Gut.“
„Sie werden den Hauptmann bitten, meiner Hinrichtung beiwohnen zu dürfen.“
„Ich!“, erwiderte ich, und ich spürte, wie mir der kalte Schweiß ausbrach.
„Verschmähen Sie es nicht: Eine Hinrichtung ist immer sehenswert. Viele besuchen Hinrichtungen zum Vergnügen.“
„Nie hätte ich den Mut dazu.“
„Ach, das geht schneller, als Sie denken.“
„Niemals, niemals!“
„Lassen wir das jetzt“, sagte der Graf. „Sie werden sich damit begnügen, meinen Brüdern, wenn Sie sie zufällig sehen, zu sagen, dass Sie mir begegnet sind, als ich zur Hinrichtung geführt wurde.“
Und er begann die Melodie von Vive Henry IV zu pfeifen.
Erregt trat ich zu ihm.
„Verzeihen Sie mir“, sagte ich, „ich werde alles tun, was Sie von mir verlangen.“
„Hoppla! Sie sind ein guter Junge, ich danke Ihnen.“
„Nur...“
„Was?“
„Sie müssen den Hauptmann darum bitten, dass ich zusehe. Ich könnte es nie verwinden, wenn man glauben sollte, ich hätte aus Neugier und zum Vergnügen -“
„Gewiss, gewiss, ich werde ihn bitten, Sie als meinen Landsmann anwesend sein zu lassen; das wird er erlauben. Ich werde darum bitten, meinem Bruder etwas hinterlassen zu dürfen, was mir gehört hat, meine Mütze beispielsweise; so etwas kommt alle Tage vor; außerdem ist eine Polizeimütze nichts Verdächtiges, nicht wahr?“
„Nein.“
„In dem Augenblick, in dem ich das Feuer befehle, werde ich die Mütze fortwerfen; beeilen Sie sich nicht zu sehr, sie aufzuheben, erst wenn ich tot sein werde -“
„Oh!“, rief ich erbleichend und am ganzen Körper zitternd.
„Hat jemand einen Schluck Branntwein für meinen jungen Landsmann? “, fragte Ihr Bruder. „Ihm ist kalt.“
„Komm her, mein lieber Junge“, sagte der Hauptmann und reichte mir seine Feldflasche.
Ich nahm einen Schluck. „Danke, Hauptmann“, sagte ich.
„Gern geschehen. Einen Schluck für Sie, Citoyen Sainte-Hermine?“, rief er dem Gefangenen zu.
„Tausend Dank, Hauptmann“, erwiderte dieser, „ich trinke nie geistige Getränke.“
Ich gesellte mich wieder zu ihm.
„Und wenn ich dann tot bin“, fuhr er fort, „nehmen Sie die Mütze unauffällig an sich, als wäre es nicht weiter wichtig. Doch Sie wissen, dass mein letzter Wunsch, der Wunsch eines Sterbenden, heilig ist und dass der Brief meinem Bruder übergeben werden muss. Wenn die Mütze Ihnen beschwerlich ist, entnehmen Sie ihr den Brief und werfen Sie sie weg. Aber den Brief, den werden Sie nicht verlieren, nicht wahr?“
„Nein“, versprach ich, bemüht, meine Tränen zu unterdrücken.
„Sie werden ihn nicht aus den Augen lassen?“
„Nein, nein! Seien Sie unbesorgt!“
„Und Sie werden ihn eigenhändig meinem Bruder übergeben?“
„Ja, eigenhändig.“
„Meinem Bruder Charles, dem älteren der beiden; er hat Ihren Vornamen, das kann man sich leicht merken.“
„Ihm und niemandem sonst.“
„Setzen Sie alles daran! Nun gut! Er wird Sie ausfragen, und Sie werden ihm berichten, wie ich gestorben bin, und er wird sagen:,Nun, ich hatte einen tapferen Bruder‘, und wenn er an der Reihe sein wird, wird er sterben wie ich.“
Wir erreichten eine Weggabelung: Eine Straße führte zum Hauptquartier General Pichegrus, die andere zu dem Fort, das unser Ziel war.
Ich wollte etwas sagen, doch kein Wort drang aus meinem Mund. Bittend sah ich zu Ihrem Bruder.
Er lächelte. „Hauptmann“, sagte er, „eine Bitte.“
„Welche? Wenn es in meiner Macht steht …“
„Es ist vielleicht eine Schwäche, aber es wird ja unter uns bleiben, nicht wahr? Wenn ich sterbe, möchte ich einen Landsmann in die Arme schließen. Wir sind beide Kinder des Jura, dieser junge Mann und ich. Unsere Familien wohnen in Besançon und sind befreundet. Irgendwann wird er nach Hause zurückkehren und erzählen, wie wir einander zufällig begegnet sind und dass er mich bis zum letzten Augenblick begleitet hat.“
Der Hauptmann sah mich an; ich weinte.
„Gewiss doch!“, sagte er. „Wenn es Ihnen beiden Vergnügen bereitet! “
„Ich glaube nicht“, sagte Ihr Bruder lachend, „dass es ihm großes Vergnügen bereitet, aber mir wird es ein Vergnügen sein.“
„Wenn Sie es wünschen.“
„Sie sind einverstanden?“
„Einverstanden“, erwiderte der Hauptmann.
Ich trat zu dem Gefangenen.
„Sehen Sie“, sagte er, „bislang klappt alles ganz vorzüglich.“
Wir stiegen den Hügel hinauf, wiesen uns aus und verschwanden unter der Zugbrücke.
Im Hof warteten wir auf den Hauptmann, der dem Oberst Rapport erstattete und ihm den Befehl zur Hinrichtung überbrachte.
Nach wenigen Minuten erschien er auf der Türschwelle.
„Bist du bereit?“, fragte er den Gefangenen.
„Wann immer es Ihnen beliebt, Hauptmann“, erwiderte dieser.
„Hast du uns noch etwas mitzuteilen?“
„Nein, aber ich habe noch eine Gunst zu erbitten.“
„Alles, was ich gewähren kann, sei dir gewährt.“
„Danke, Hauptmann.“
Der Hauptmann trat zu Ihrem Bruder. „Auch wenn wir unter verschiedenen Fahnen dienen“, sagte er, „sind wir dennoch Franzosen, und tapfere Männer erkennen einander unfehlbar. Was wünschst du?“
„Zuerst dass man mir die Fesseln abnimmt, mit denen ich aussehe wie ein Strauchdieb.“
„Du hast recht; nehmt dem Gefangenen die Fesseln ab.“
Ich stürzte mich auf die Hände des Grafen und hatte ihn entfesselt, bevor einer der Soldaten sich ihm nähern konnte.
„Oh!“, sagte der Graf, streckte die Hände aus und schüttelte sich unter seinem Mantel. „Das tut gut, wieder frei zu sein.“
„Und jetzt?“, fragte der Hauptmann. „Was wünschst du jetzt?“
„Ich will das Zeichen zum Feuern geben.“
„So wird es sein. Und was weiter?“
„Ich möchte meiner Familie ein Andenken zukommen lassen.“
„Du weißt, dass wir keine Briefe von politischen Gefangenen entgegennehmen dürfen. Alles andere ja.“
„Oh, ich will niemandem Scherereien bereiten. Hier ist mein junger Landsmann Charles, der mich zu meiner Hinrichtung begleiten wird, wie Sie es erlaubt haben, und der es übernehmen wird, meiner Familie etwas mitzubringen, keinen Brief, sondern irgendetwas, was mir gehört hat, beispielsweise meine Polizeimütze.“
„Ist das alles?“, fragte der Hauptmann.
„Meiner Treu, ja“, antwortete der Graf, „es wird Zeit. Ich bekomme allmählich kalte Füße, und kalte Füße kann ich von allen Dingen am wenigsten ausstehen. Auf, Hauptmann, denn ich nehme an, Sie werden mich begleiten.“
„Das ist meine Pflicht.“
Der Graf salutierte und drückte mir lachend die Hand, als hätte er Grund zur Freude.
„Wohin?“, fragte er.
„Hierher“, sagte der Hauptmann und trat an die Spitze des Zuges.
Wir folgten ihm, vorbei an einer Poterne, und betraten dann einen zweiten Hof, auf dessen Befestigungen Wachposten patrouillierten. Am Ende des Hofs befand sich eine hohe Mauer, in Kopfhöhe von Einschüssen zernarbt.
„Aha!“, sagte der Gefangene. Und er ging aus freien Stücken zu der Mauer, vor der er stehen blieb.
Der Gerichtsschreiber verlas das Urteil.
Ihr Bruder nickte, als wolle er die Richtigkeit des Urteils bestätigen. Dann sagte er: „Wenn es Ihnen recht ist, Hauptmann, hätte ich kurz etwas mit mir zu besprechen.“
Der Hauptmann und seine Soldaten begriffen, dass er beten wollte, und traten beiseite.
Für einen Augenblick verharrte er reglos, mit gekreuzten Armen, den Kopf zur Brust gesenkt, und bewegte die Lippen, ohne dass ein Wort zu vernehmen war.
Dann richtete er den Kopf auf: Er lächelte. Er umarmte mich, und dabei sagte er mir leise ins Ohr die Worte Karls I.: „Erinnere dich.“
Weinend nickte ich.
Dann sprach der Verurteilte mit fester Stimme: „Habt Acht!“
Die Soldaten nahmen Aufstellung.
Er nahm seine Polizeimütze ab, als wolle er nicht mit bedecktem Kopf den Befehl zum Feuern geben, warf sie in die Luft, und sie fiel neben meinen Füßen nieder.
„Seid ihr bereit?“, fragte der Graf.
„Ja“, erwiderten die Soldaten.
„Aufstellung, angelegt, Feuer! Es lebe der – “
Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden; laute Schüsse waren gefallen, und sieben Kugeln hatten seine Brust durchdrungen. Er fiel mit der Stirn voran auf den Boden, und ich fiel auf die Knie und weinte so heftig, wie ich in diesem Augenblick weine.‹<
Wahrhaftig war das arme Kind in Tränen ausgebrochen, als es uns den Tod unseres Bruders berichtete. Ach, und auch wir, Mademoiselle, das kann ich Ihnen versichern, weinten bittere Tränen. Mein Bruder Charles, der nun zum Familienoberhaupt geworden war, las den Brief ein zweites Mal, umarmte Charles, streckte den Arm aus und schwor bei der heiligen Reliquie, die uns von unserem Bruder geblieben war, ihn zu rächen.«
»Oh, was für eine traurige Geschichte, Monsieur!«, sagte Claire, die sich die Tränen abwischte.
»Soll ich fortfahren?«, fragte Hector.
»Ach, ich glaube ja«, sagte das junge Mädchen. »Noch nie habe ich etwas Fesselnderes und zugleich Schmerzlicheres gehört.«
15
Charles de Sainte-Hermine (1)
Hector de Sainte-Hermine schwieg für eine kurze Weile, damit Mademoiselle de Sourdis sich beruhigen konnte, bevor er weitersprach.
»Sie sagten: ›Was für eine traurige Geschichte.‹ Aber sie wird noch trauriger werden.
Acht Tage nach der Ankunft meines jungen Freundes in Besançon und der Lektüre des Briefs unseres Bruders Léon verschwand mein Bruder Charles.
Er hinterließ mir folgenden Brief:
Ich muss Dir nicht eigens sagen, mein lieber Junge, wo ich mich aufhalte und was ich tue.
Wie Du Dir denken kannst, bin ich mit dem Werk der Rache beschäftigt, um meinen Schwur einzulösen.
Du bist nun allein; doch Du bist sechzehn Jahre alt und hast das Unglück zum Herrn; unter solchen Umständen reift man schnell zum Mann.
Was ich unter einem Mann verstehe, weißt Du: eine unerschütterliche Eiche, die in der Antike wurzelt und deren Krone in die Zukunft reicht, ein Baum, der Hitze wie Kälte die Stirn bietet, Wind wie Regen, Sturm wie Eisen und Gold.
Ertüchtige Deinen Körper ebenso wie Deinen Geist. Werde gewandt in allen körperlichen Übungen; an Lehrern und Geld wird es Dir nicht mangeln.
Gib auf dem Land für Pferde, Gewehre, Waffen, Reitlehrer und Fechtlehrer zwölftausend Francs im Jahr aus. In Paris gib das Doppelte aus, doch stets mit dem Ziel, Dich zum Mann auszubilden.
Sorge dafür, dass Du stets zehntausend Francs in Gold bei Dir trägst, die Du dem erstbesten unbekannten Boten geben kannst, der sie im Namen und mit der Unterschrift Morgans verlangen wird, indem er Dir einen versiegelten Brief überbringt, dessen Siegel ein Dolch ist.
Nur Du wirst wissen, dass es sich bei diesem Morgan um mich handelt.
Befolge treulich die Instruktionen, die ich Dir eher als Ratschläge denn als Befehle erteile.
Lies diesen meinen Brief mindestens einmal im Monat.
Halte Dich stets bereit, meine Nachfolge anzutreten, mich zu rächen und zu sterben.
Dein Bruder
CHARLES
Und jetzt, Mademoiselle«, fuhr Hector fort, »jetzt, da Sie wissen, dass Morgan und Charles de Sainte-Hermine ein und derselbe sind, muss ich Ihnen Leben und Schicksal meines Bruders nicht mehr Schritt für Schritt nachzeichnen.
Der Ruhm des Anführers der Compagnons de Jéhu hat sich durch ganz Frankreich und sogar bis ins Ausland verbreitet. Zwei Jahre lang war das Land von Marseille bis Nantua sein Reich.
Zwei weitere Briefe habe ich von ihm erhalten, mit seinem Siegel und seiner Unterschrift versehen.
Beide Male erbat er von mir den genannten Geldbetrag, und beide Male schickte ich ihm das Geld.
Der Name Morgan flößte im Süden Frankreichs ebenso Schrecken ein wie Liebe.
Alle Royalisten betrachteten die Compagnons de Jéhu als ritterliche Kämpfer für das legitime Herrscherhaus, und beleidigende Bezeichnungen wie Banditen, Strauchdiebe oder Wegelagerer konnten ihnen nichts von diesem Nimbus rauben.
Bei mehreren Gelegenheiten hatte ihr Anführer Morgan wahre Wundertaten an Kraft, Mut und Großzügigkeit verrichtet.
Die royalistischen Aufstände im Süden hatten den Charakter eines veritablen Bürgerkriegs gegen die Regierung erlangt; dort konnte man sich laut rühmen, Mitglied der Compagnons de Jéhu zu sein, ohne von den Behörden dafür belangt zu werden.
Unter dem Direktorium standen die Zeichen günstig für die Aufständischen; die Regierung war zu schwach für den Krieg gegen das Ausland und erst recht für den Krieg im eigenen Land.
Doch dann kehrte Bonaparte aus Ägypten zurück.
Der Zufall wollte, dass er in Avignon Augen- und Ohrenzeuge eines der waghalsigen Husarenstücke wurde, die den Ruf der Compagnons de Jéhu als edle und idealistische Räuber schufen.
Neben den Geldern der Regierung hatten sie versehentlich einen Betrag von zweihundert Louisdor mitgenommen, der einem Weinhändler aus Bordeaux gehörte. Der Weinhändler beklagte sich an der Wirtstafel über das Unrecht, das man ihm angetan hatte, als mitten am helllichten Tag mein Bruder das Gasthaus betrat, maskiert und bis an die Zähne bewaffnet, zur Wirtstafel schritt und vor dem Jammernden den Geldsack mit den zweihundert Louisdor absetzte, für deren versehentliches Entwenden er sich entschuldigte.
An dieser Wirtstafel speisten auch General Bonaparte und sein Adjutant Roland de Montrevel, die all dies miterlebten. Roland geriet mit Monsieur de Barjols in Streit, schlug sich mit ihm, tötete ihn und reiste Bonaparte nach Paris nach.
Bonaparte hatte begriffen, mit was für Männern er es zu tun hatte, dass sie es waren und nicht die Engländer, die für die Chouannerie verantwortlich waren, und er nahm sich vor, sie zu vernichten. Er schickte Roland mit unumschränkten Vollmachten in den Süden.
Es fand sich jedoch kein Verräter, der Roland diejenigen ausgeliefert hätte, die er vernichten wollte. Menschen, Höhlen, Wälder, Berge – sie alle hielten denen die Treue, die ihrem König die Treue hielten. Erst ein unvorhergesehener Zwischenfall brachte durch die Hand einer Frau jenen das Verderben, denen ganze Regimenter nichts hatten anhaben können.
Sie haben von den schrecklichen politischen Unruhen gehört, die Avignon einem Erdbeben gleich erschütterten. Bei einem dieser Handgemenge, in denen die Gegner einander fühllos, gnadenlos und erbarmungslos abschlachten, in denen auf den Gegner eingeschlagen wird, solange er lebt, röchelt, atmet, und weiter auf ihn eingeschlagen wird, wenn er schon lange kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, war ein Monsieur de Fargas umgekommen – ermordet, verbrannt, aufgefressen von diesen Kannibalen, die jeden Menschenfresserstamm der pazifischen Inseln weit in den Schatten gestellt haben. Seine Mörder waren Liberale.
Er hinterließ einen Sohn und eine Tochter, die dem Gemetzel entkamen und fliehen konnten. Die Natur hatte die Gemüter der Kinder vertauscht: Dem jungen Mann hatte sie das Herz des Mädchens gegeben und dem Mädchen das Herz des Mannes.
Lucien und Diana schworen, ihren Vater zu rächen; Diana musste Lucien stützen. Er trat den Compagnons de Jéhu bei. Bald darauf wurde Lucien gefangen genommen, und da er die Folter durch Schlafentzug nicht ertragen konnte, nannte er die Namen seiner Komplizen.
Um ihn vor der Rache seiner einstigen Gefährten zu schützen, verlegte man ihn aus dem Gefängnis von Avignon in das von Nantua. Acht Tage darauf wurde das Gefängnis von Nantua nachts überfallen, der Gefangene wurde entführt und in die Kartause von Seillon gebracht.
Zwei Tage später wurde der Leichnam Luciens nachts auf die Place de la Préfecture geworfen, gegenüber dem Hôtel Grottes de Ceyzériat, in dem seine Schwester Diana wohnte. Der Leichnam war nackt; in seinem Herzen steckte der wohlbekannte Dolch der Compagnons de Jéhu. An dem Dolch war ein Zettel befestigt, und auf diesem Zettel stand in Luciens Schrift geschrieben:
Ich sterbe, weil ich meinen heiligen Schwur gebrochen habe, und ich weiß, dass ich den Tod verdiene. Der Dolch, den man in meinem Herzen finden wird, bezeugt, dass ich nicht von der Hand eines feigen, hinterhältigen Meuchelmörders sterbe, sondern gerichtet durch gerechte Rache.
Bei Tagesanbruch weckte Diana der Tumult unter ihren Fenstern. Irgendetwas sagte ihr, dass dieser Lärm mit ihr zu tun habe und dass ein neues Unglück ihrer harre.
Sie warf sich einen Hausmantel über, riss das Fenster auf, ohne sich die Haare aufzustecken, die vom Schlaf gelöst waren, und lehnte sich über die Brüstung.
Kaum hatte sie einen Blick auf die Straße geworfen, stieß sie einen lauten Schrei aus, stürzte die Treppe hinunter, außer sich, aufgelösten Haares, totenbleich, warf sich auf den Leichnam, der Mittelpunkt des Auflaufs war, und rief: ›Mein Bruder! Mein Bruder!‹
Ein Fremder hatte Luciens Martertod beigewohnt. Es war ein Abgesandter Cadoudals, der verschiedene bindende Befehle mit sich führte, die ihm alle Türen öffneten. Als Ausweis diente ihm ein Brief, den ich als Abschrift bei mir habe, weil ich darin erwähnt werde.
›Mein lieber Morgan...‹ – Sie erinnern sich«, unterbrach sich Hector, »dass mein Bruder diesen Namen angenommen hatte?« Dann fuhr er fort:
Mein lieber Morgan, Sie haben gewiss nicht vergessen, dass Sie mir auf unserer Versammlung in der Rue des Postes von sich aus anboten, als mein Kassenführer zu fungieren, sollte ich den Krieg allein fortsetzen, ohne Unterstützung aus dem Landesinneren oder von außerhalb. All unsere Kämpfer sind im Gefecht gefallen oder wurden standrechtlich erschossen. D’Autichamp hat sich der Republik unterworfen; ich allein bin in meiner Überzeugung nicht wankend geworden und in meinem Morbihan unbesiegbar.
Mit einer Armee von zwei- bis dreitausend Mann kann ich das Land halten; diese Armee verlangt keinen Sold, doch sie muss ernährt, sie muss mit Waffen und Munition versorgt werden; seit Quiberon haben uns die Engländer nichts mehr zukommen lassen.
Geben Sie uns Geld, und wir geben unser Blut – nicht dass ich behaupten wollte – weiß Gott nicht! -, dass Sie mit dem Ihren geizten! O nein! Ihre Hingabe an die Sache ist am größten und übertrifft die unsere bei Weitem: denn wenn man uns fasst, werden wir nur füsiliert, Sie aber sterben auf dem Schafott. Sie schreiben mir, Sie verfügten über beträchtliche Mittel: Sorgen sie dafür, dass ich jeden Monat mit fünfunddreißigtausend bis vierzigtausend Francs rechnen kann, das wird mir genügen.
Ich schicke Ihnen unseren gemeinsamen Freund Coster Saint-Victor; sein Name genüge, auf dass Sie ihm vertrauen. Ich habe ihm die Verhaltensmaßregeln eingeschärft, die ihn bis zu Ihnen bringen werden. Geben Sie ihm die ersten vierzigtausend Francs, wenn Sie so viel entbehren können, und bewahren Sie das restliche Geld für mich auf, denn Ihnen nützt es nicht annähernd so viel wie mir. Sollten Sie in Ihrer Heimat zu großem Ungemach ausgesetzt sein und dort nicht bleiben können, durchqueren Sie Frankreich und kommen Sie zu mir.
Von fern oder nah, ich liebe Sie und danke Ihnen
GEORGES CADOUDAL,
kommandierender General der Armee der Bretagne
P. S. Sie haben, wie ich hörte, mein lieber Morgan, einen jüngeren Bruder von neunzehn oder zwanzig Jahren: Sollten Sie mich nicht als unwürdig erachten, ihn im Waffengebrauch zu unterweisen, senden Sie ihn zu mir, und er wird mein Aide de Camp sein.
»Nach Rücksprache mit all seinen Gefährten antwortete mein Bruder:
Mein lieber General,
Ihr wackerer Bote hat uns Ihren Brief überbracht. Wir haben an die einhundertfünfzigtausend Francs zur Hand und können Ihrem Wunsch entsprechen. Unser neuer Mitstreiter, den ich mit dem Namen Alkibiades bezeichnen werde, wird heute Abend aufbrechen und die ersten vierzigtausend Francs mitnehmen. Jeden Monat werden Sie bei demselben Bankhaus die Summe beziehen, die Sie benötigen. Im Falle unseres Todes oder unserer Auflösung wird das Geld an ebenso vielen verschiedenen Orten vergraben werden, wie wir Beträge von jeweils vierzigtausend Francs haben. Beigelegt finden Sie die Liste all derer, die wissen, wo sich die Beträge befinden. Bruder Alkibiades kam gerade rechtzeitig, um einer Hinrichtung beizuwohnen. Er hat gesehen, wie wir mit Verrätern verfahren.
Ich danke Ihnen, mein lieber General, für das edle Angebot, das Sie meinem jüngeren Bruder machen. Ich beabsichtige jedoch, ihn vor jeder Gefahr zu bewahren, bis es an ihm sein wird, meinen Platz einzunehmen. Mein Vater starb unter der Guillotine und vermachte meinem älteren Bruder die Aufgabe, ihn zu rächen. Mein älterer Bruder wurde füsiliert und vermachte mir seine Rache. Ich werde vermutlich auf dem Schafott sterben, wie Sie sagten, und ich werde meinem Bruder die Rache vermachen. Dann wird er den Weg beschreiten, dem wir folgten, und er wird wie wir zum Triumph der guten Sache beitragen, oder er wird sterben, wie wir gestorben sind.
Es bedarf eines so machtvollen Beweggrundes, wenn ich mir erlaube, ihm Ihren Schutz vorzuenthalten, und ich bitte Sie dennoch um Ihr Wohlwollen für ihn.
Senden Sie uns, soweit dies möglich sein sollte, unseren geliebten Freund Alkibiades wieder. Es wäre uns eine doppelte Freude, Ihnen unsere Botschaft durch diesen Boten zukommen zu lassen.
MORGAN
Wie mein Bruder sagte, hatte Coster Saint-Victor der Bestrafung beigewohnt. Lucien de Fargas war vor seinen Augen abgeurteilt und hingerichtet worden. Gegen Mitternacht hatten zwei Reiter die Kartause von Seillon durch die gleiche Pforte verlassen: Der eine, Coster Saint-Victor, machte sich auf den Weg in die Bretagne und zu Cadoudal, dem er Morgans vierzigtausend Francs überbrachte; der andere, der Graf von Ribier, hatte quer über seinem Pferd den Leichnam Lucien de Fargas’ liegen, den er auf die Place de la Préfecture werfen würde.«
Hector hielt für einen Augenblick inne.
»Verzeihen Sie«, sagte er, »aber mein anfangs schlichter Bericht nimmt allmählich ausufernde Formen an und wird zu einem wahren Roman. Ich muss dem Gang der Ereignisse folgen, doch ich will Sie nicht mit all diesen Katastrophen ermüden und werde mich so knapp wie möglich fassen, was ich schon zuvor getan hätte, hätte ich nicht befürchtet, vollends unverständlich zu klingen.«
»Kürzen Sie nichts ab, ganz im Gegenteil, ich bitte Sie darum«, sagte Mademoiselle de Sourdis. »Die Knappheit würde nur das Interesse schmälern. All Ihre Personen interessieren mich lebhaft, ganz besonders Mademoiselle de Fargas.«
»Wohlan, von ihr wollte ich gerade wieder sprechen.
Drei Tage nachdem der nächtens auf den Platz in Bourg-en-Bresse gebrachte Tote als Lucien de Fargas identifiziert worden und von seiner Schwester ehrerbietig bestattet worden war, sprach im Palais du Luxembourg eine junge Frau vor, die Citoyen Direktoriumsmitglied Barras sprechen wollte.
Citoyen Barras weilte auf einer Sitzung. Der Kammerdiener, der gesehen hatte, dass die Dame jung und hübsch war, führte sie in das rosa Boudoir, das wohlbekannt war als Schauplatz der wollüstigen Audienzen des Citoyen Direktoriumsmitglied.
Nach einer Viertelstunde kam der Kammerdiener in das Boudoir und kündigte den Citoyen und das Direktoriumsmitglied Barras an.
Barras trat mit siegesgewohntem Schritt ein, legte seinen Hut auf einen Tisch und näherte sich der Besucherin mit den Worten: ›Madame, Sie wünschen mich zu sehen, da bin ich!‹
Die junge Frau erhob sich, als Barras auf sie zukam, hob ihren Schleier und enthüllte ein Gesicht von außergewöhnlicher Schönheit.
Überwältigt blieb Barras stehen.
Dann streckte er die Hand aus, um die ihre zu ergreifen und sie zum Hinsetzen zu bewegen, doch sie hielt ihre Hände in ihrem langen Schleier verborgen und sagte: ›Verzeihung, doch ich will stehen, wie es sich für eine Bittende geziemt.‹
›Eine Bittende!‹, sagte Barras. ›O nein, eine Frau wie Sie bittet nicht, sie befiehlt – oder verlangt wenigstens.‹
›Genau darum ist es mir zu tun: Im Namen der Erde, die uns beide hervorgebracht hat, im Namen meines Vaters, der mit dem Ihren befreundet war, im Namen der geschundenen Menschheit und der missachteten Gerechtigkeit komme ich, um Rache zu verlangen.‹
›Rache?‹
›Rache‹, wiederholte Diana.
›Das ist ein hartes Wort‹, sagte Barras, ›aus einem so jungen und schönen Mund.‹
›Monsieur, ich bin die Tochter des Grafen von Fargas, der in Avignon durch die Hand der Republikaner ums Leben kam, und die Schwester des Vicomte de Fargas, der vor Kurzem in Bourg-en-Bresse von den Compagnons de Jéhu ermordet wurde.‹
›Sind Sie sich dessen sicher, Mademoiselle?‹
Das junge Mädchen reichte Barras einen Dolch und ein Blatt Papier.
›Die Form dieses Dolchs ist wohlbekannt‹, sagte sie, ›und der Brief sollte jeden Zweifel ausräumen, was den Meuchelmord und seine Hintergründe betrifft, wenn der Dolch Ihnen nichts sagt.‹
Barras betrachtete die Waffe neugierig. ›Und dieser Dolch?‹, fragte er.
›Steckte in der Brust meines Bruders.‹
›Der Dolch allein wäre noch kein Beweis‹, sagte Barras, ›man hätte ihn entwenden können oder eigens schmieden, um den Verdacht in eine falsche Richtung zu lenken.‹
›Gewiss, doch lesen Sie den Brief, von meines Bruders Hand geschrieben und von ihm unterzeichnet.‹
Barras las:
Ich sterbe, weil ich meinen heiligen Schwur gebrochen habe, und ich weiß, dass ich den Tod verdiene. Der Dolch, den man in meinem Herzen finden wird, bezeugt, dass ich nicht von der Hand eines feigen, hinterhältigen Meuchelmörders sterbe, sondern gerichtet durch gerechte Rache.
LUCIEN DE FARGAS
›Und die Schrift ist die Ihres Bruders?‹, fragte Barras.
›Ganz gewiss, ja.‹
›Und was bedeuten die Worte: »Ich sterbe nicht von der Hand eines feigen, hinterhältigen Meuchelmörders, sondern gerichtet durch gerechte Rache«?‹
›Das heißt, dass mein Bruder, nachdem er Ihren Schergen in die Hände gefallen war und von ihnen gefoltert wurde, seinem Schwur untreu wurde und die Namen seiner Komplizen offenbart hat. Ich‹, sagte Diana mit unfrohem Lachen, ›hätte mich den Verschwörern anschließen sollen, nicht mein Bruder.‹
›Wie kommt es‹, fragte Barras, ›dass ein solcher Mord unter solchen Umständen begangen wurde, ohne dass ich bisher Kenntnis davon erlangt hätte?‹
›Das spricht nicht für Ihre Polizei!‹, antwortete Diana lächelnd.
›Nun denn‹, sagte Barras, ›wenn Sie so gut unterrichtet sind, dann nennen Sie uns die Namen derjenigen, die Ihren Bruder ermordet haben, und sobald sie verhaftet sind, wird ihre Bestrafung nicht auf sich warten lassen. ‹
›Wüsste ich ihre Namen‹, erwiderte Diana, ›hätte ich mich nicht an Sie gewendet, sondern sie erdolcht.‹
›Nun gut‹, sagte Barras, ›dann suchen Sie nach Ihnen, und wir werden ebenfalls suchen.‹
›Ich soll nach ihnen suchen!‹, wiederholte Diana. ›Ist das meine Aufgabe, bin ich die Regierung, bin ich die Polizei, ist es meine Sache, über die Sicherheit der Bürger zu wachen? Man verhaftet meinen Bruder und steckt ihn ins Gefängnis; das Gefängnis gehört der Regierung, also ist diese für meinen Bruder verantwortlich; das Gefängnis öffnet seine Türen und verrät seinen Gefangenen: Die Regierung schuldet mir dafür Rechenschaft. Und da Sie das Regierungsoberhaupt sind, komme ich zu Ihnen und verlange: Geben sie mir meinen Bruder zurück.‹
›Sie haben Ihren Bruder geliebt?‹
›Abgöttisch.‹<
›Sie wollen ihn rächen?‹
›Ich gäbe mein Leben um das seiner Mörder.‹
›Und wenn ich Ihnen einen Weg anböte herauszufinden, wer ihn ermordet hat, würden Sie annehmen?‹
Diana zögerte kurz, dann sagte sie heftig: ›Ich würde annehmen.‹
›Gut‹, sagte Barras, ›helfen Sie uns, und wir werden Ihnen helfen.‹
›Was soll ich tun?‹
›Sie sind schön, sehr schön sogar.‹
›Es geht hier nicht um meine Schönheit‹, sagte Diana ohne jede Schüchternheit.
›Im Gegenteil‹, sagte Barras, ›im Gegenteil, es geht in erster Linie darum. In dem großen Kampf, den wir das Leben nennen, wurde der Frau die Schönheit gegeben, und zwar nicht bloß als Geschenk des Himmels, an dem sich das Auge eines Liebhabers oder Gatten erfreuen mag, sondern als Waffe, die gleichermaßen zum Angriff wie zur Verteidigung dient.‹
›Sprechen Sie weiter‹, sagte Diana.
›Die Compagnons de Jéhu haben vor Cadoudal keine Geheimnisse. Er ist ihr wahrer Anführer, für ihn arbeiten sie; er weiß die Namen all ihrer Mitglieder vom ersten bis zum letzten Mann.‹
›Und weiter?‹, fragte Diana.
›Weiter? Nichts einfacher als das. Sie reisen in die Bretagne, gesellen sich zu Cadoudal, gerieren sich als Opfer Ihres Eintretens für die royalistische Sache, verschaffen sich sein Vertrauen, und Sie werden leichtes Spiel haben: Cadoudal wird sich unweigerlich in Sie verlieben, und früher oder später werden Sie die wahren Namen der Männer erfahren, nach denen wir vergeblich suchen. Teilen Sie uns die Namen mit, mehr verlangen wir nicht von Ihnen, und Ihre Rache wird befriedigt werden. Und falls Ihr Einfluss so weit reicht, dass sie sogar diesen halsstarrigen Sektierer dazu bewegen können, sich wie die anderen zu unterwerfen, dann muss ich Ihnen sicherlich nicht eigens sagen, wie großzügig die Regierung -‹
Diana streckte gebieterisch die Hand aus. ›Sehen Sie sich vor, Citoyen Direktoriumsmitglied, noch ein Wort, und Sie beleidigen mich.‹
Und nach kurzem Schweigen: ›Ich bedinge mir vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit aus‹, sagte sie.
›Lassen Sie sich Zeit, Mademoiselle‹, sagte Barras. ›Ich werde Ihnen zu Diensten stehen.‹
›Morgen hier, um neun Uhr abends‹, sagte Mademoiselle de Fargas, nahm Barras ihren Dolch aus der Hand und den Brief ihres Bruders von dem Tisch, auf den sie ihn gelegt hatte, verbarg Brief und Dolch in ihrem Mieder, verneigte sich vor Barras und ging.
Am nächsten Tag kündigte man ihm um die gleiche Stunde Mademoiselle Diana de Fargas an.
Er eilte in das rosa Boudoir. ›Nun, meine schöne Nemesis?‹, fragte er.
›Ich habe mich entschieden, Monsieur; allerdings benötige ich einen Geleitbrief, mit dem ich mich vor den republikanischen Behörden ausweisen kann. In dem Leben, das ich führen werde, kann ich jederzeit bewaffnet auf Seiten der Gegner der Republikaner ergriffen werden; Sie lassen Frauen und Kinder erschießen, Sie führen einen Ausrottungskrieg: Das ist Ihre Sache, die Sie mit Gott abmachen müssen. Aber ich könnte dabei gefasst werden, und ich will auf keinen Fall füsiliert werden, bevor ich mich gerächt habe.‹
›Mit diesem Ansinnen habe ich gerechnet; und um Ihre Abreise nicht zu verzögern, habe ich bereits alle Ausweispapiere vorbereiten lassen, die Sie benötigen werden. Ordres des Generals Hédouville werden jene, vor denen Sie sich fürchten müssten, in Ihre Verteidiger verwandeln; und mit diesem Geleitbrief können Sie Bretagne und Vendée von einem Ende zum anderen bereisen.‹
›Sehr gut, Monsieur!‹, sagte Diana. ›Ich danke Ihnen.‹
›Darf ich Sie, ohne indiskret zu sein, fragen, wann Sie abzureisen gedenken? ‹
›Heute Abend noch; meine Pferde und meine Postkutsche erwarten mich am Zaun des Palais du Luxembourg.‹
›Erlauben Sie mir eine indiskrete Frage – es ist meine Pflicht, sie Ihnen zu stellen.‹
›Fragen Sie, Monsieur.‹
›Haben Sie Geld?‹
›Ich habe sechstausend Francs in Gold in dieser Kassette bei mir, was mehr als sechzigtausend Francs in Assignaten entspricht. Sie sehen, dass ich unbesorgt auf eigene Faust Krieg führen kann.‹
Barras reichte der schönen Besucherin die Hand, doch sie schien diese Aufmerksamkeit nicht zu bemerken.
Sie verneigte sich untadelig und verließ den Raum.
›Was für eine bezaubernde Viper‹, sagte Barras. ›Ich wäre nicht gern derjenige, der ihr Blut erwärmt.‹
16
Mademoiselle de Fargas
Der Zufall wollte, dass Mademoiselle de Fargas und Coster Saint-Victor sich kurz vor dem Dorf La Guerche begegneten, anders gesagt, drei Wegstunden von Cadoudals Lager entfernt.
Coster Saint-Victor, einer der elegantesten Männer jener Zeit, der mit dem Ersten Konsul Bonaparte um die Gunst mehr als einer der hübschesten Schauspielerinnen wetteiferte, hatte kaum gesehen, dass eine schöne Frau in offener Kalesche vorbeifuhr, als er die erste Gelegenheit ergriff, sich ihr zu nähern, sobald die Kalesche langsamer wurde, was ihm umso leichter fiel, als er dem Postwagen zu Pferde folgte.
Diana wollte dem Fremden zuerst in kalter Würde begegnen, doch er begrüßte sie so höflich, und seine Worte und Komplimente waren so wohlgewählt, dass sie sich nur so lange unnahbar zeigte, wie es die guten Sitten unter Reisenden erforderten.
Zudem befand sie sich in einem ihr fremden Land, in dem an jeder Wegbiegung Gefahren lauern konnten. Der Reisende, der so offenkundig ihre Bekanntschaft gesucht hatte, schien mit dem Land bestens vertraut zu sein; er konnte ihr nützlich sein, ihr beispielsweise verraten, wo Cadoudal sich aufhielt.
Beide hatten einander Falschheiten anvertraut.
Coster Saint-Victor hatte gesagt, er heiße d’Argentan und sei Steuereinnehmer der Regierung in Dinan.
Diana hatte ihm erwidert, sie heiße Mademoiselle de Rotrou und sei Postverwalterin in Vitré.
Und von falscher Auskunft zu falscher Auskunft hatten sie einander eine wahre Auskunft offenbart: dass nämlich beide auf der Suche nach Cadoudal waren.
›Kennen Sie ihn?‹, hatte d’Argentan gefragt.
›Ich habe ihn nie gesehen‹, hatte Diana erwidert.
›Dann, Mademoiselle, wäre es mir eine Ehre, Ihnen meine Dienste anzubieten‹, hatte der falsche d’Argentan gesagt. ›Cadoudal ist mein Freund, und wir sind dem Ort, an dem wir ihm begegnen sollten, so nahe, dass ich Ihnen wohl ohne Gefahr offenbaren darf, dass ich nicht der Regierung, sondern ihm als Steuereinnehmer diene. Sollten Sie eine Empfehlung benötigen, Mademoiselle, wäre ich doppelt glücklich, dass der Zufall – oder soll ich sagen: die Vorsehung? – unsere Wege einander kreuzen ließ.‹
›Ich will Ihre Offenheit erwidern‹, sagte Diana, ›und Ihnen gestehen, dass ich so wenig Postverwalterin in Vitré bin, wie Sie Steuereinnehmer in Dinan sind. Ich bin die letzte Überlebende einer vornehmen royalistischen Familie, die auf Rache sinnt und bei ihm dienen will.‹
›Und in welcher Eigenschaft?‹, fragte d’Argentan.
›In der Eigenschaft einer Freiwilligen‹, erwiderte Diana.
Coster sah sie verblüfft an und sagte dann: ›Alles in allem, warum nicht? Dumouriez hatte zwei Demoiselles de Fernig als Aides de Camp. Wir leben in einer so verrückten Zeit, dass man sich auf alles einstellen muss, selbst auf Dinge, die man nicht glauben wollte.‹
Und damit war diese Frage erledigt.
In La Guerche waren sie einer Abteilung republikanischer Soldaten auf dem Weg nach Vitré begegnet.
Beim Verlassen des Dorfes stießen sie auf gefällte Bäume, die den Weg versperrten.
›Oh, zum Henker!‹, rief Coster. ›Es nähme mich nicht wunder, wenn Cadoudal hinter diesem Hindernis steckte!‹
Er hielt an, bedeutete Dianas Kutsche, ebenfalls zu halten, und ließ einmal den Ruf des Käuzchens und einmal den der Schleiereule ertönen.
Rabengeschrei antwortete ihm.
›Unsere Freunde haben uns erkannt; bleiben Sie hier, ich werde Sie abholen. ‹
Zwei Männer erschienen, schufen einen Weg durch die Barrikade, und Diana sah, dass ihr Weggefährte sich einem der Männer in die Arme warf, der Cadoudal sein musste.
Dieser Mann näherte sich ihrem Wagen und nahm seinen Hut ab.
›Mademoiselle‹, sagte er, ›ob Sie weiterreisen oder mir die Ehre erweisen wollen, meine Gastfreundschaft anzunehmen – ich muss Ihnen raten, sich zu beeilen, denn in weniger als einer Stunde werden die Republikaner hier sein, und Sie sehen, dass wir bereit sind, sie zu empfangen.‹
Er wies auf die Barrikade.
›Ganz davon abgesehen‹, fuhr er fort, ›dass ich in den Ginsterbüschen fünfzehnhundert Männer versteckt habe, die eine Musik anstimmen werden, wie Sie sie noch nie gehört haben dürften.‹
›Monsieur‹, sagte Diana, ›ich wollte Sie um Ihre Gastfreundschaft bitten, doch ich danke dem Geschick, das mir erlaubt, ein Schauspiel zu erleben, das ich mir schon immer ersehnt habe, nämlich ein Gefecht.‹
Cadoudal verbeugte sich, machte seinen Männern ein Zeichen, woraufhin eine Schneise für die Kutsche geschaffen wurde, und Diana fand sich auf der anderen Seite der Barriere wieder.
Sie sah sich um; neben den Männern in den Ginsterbüschen, von denen Cadoudal gesprochen hatte, sah sie Tausende, die auf dem Bauch lagen, den Karabiner neben sich.
An die fünfzig Reiter hielten ihre Pferde am Zügel, im Unterholz verborgen.
›Madame‹, sagte Cadoudal zu Diana, ›verargen Sie es mir bitte nicht, dass ich mich jetzt meinen Aufgaben als Anführer widme; sobald ich sie erledigt habe, werde ich mich meinen anderen Aufgaben zuwenden.‹
›Auf, Messieurs, auf‹, sagte Diana, ›und machen Sie sich keine Sorgen meinetwegen. Wenn Sie nur ein Pferd hätten -‹
›Ich habe zwei‹, sagte d’Argentan. ›Das kleinere stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Es ist allerdings für den Kampf und für einen Mann gesattelt. ‹
›Genau das, was ich benötige‹, sagte Diana, und als sie sah, dass der junge Mann seine Satteltasche vom Pferd nahm, rief sie lachend: ›Danke, Herr Steuereinnehmer aus Dinan!‹
Dann schloss sie das Verdeck ihres Wagens.
Zehn Minuten später ertönten in einer Viertelmeile Entfernung von der Barrikade in den Bergen die ersten Gewehrsalven, und das Gefecht begann.
Bei diesen ersten Schüssen wurde die Tür der Kalesche geöffnet, und ein junger Mann entstieg ihr, elegant als Chouan ausstaffiert. Seine Jacke war aus Samt, aus seinem weißen Gürtel ragten die Griffe zweier doppelläufiger Pistolen, er trug einen Filzhut mit wehender weißer Feder und hatte einen leichten Säbel umgegürtet.
Mit einer Behändigkeit, die den geübten Reiter verriet, sprang er auf das Pferd, das der Diener Coster Saint-Victors hielt, und nahm seinen Platz unter den vierzig oder fünfzig Kavalleristen ein, die der bretonische General befehligte.
Das Gefecht werde ich überspringen«, sagte Hector. »Ich begnüge mich damit zu sagen, dass die Blauen vernichtend geschlagen wurden und sich nach mutiger Gegenwehr um ihren Oberst Hulot im Dorf La Guerche sammelten.
Dieser Kampf hatte für Cadoudal und seine Leute kein besonderes materielles Ergebnis, doch seine moralische Wirkung war unschätzbar.
Cadoudal hatte nicht nur mit seinen zweitausend Mann vier- oder fünftausend kampferprobten erfahrenen Soldaten die Stirn geboten, sondern er hatte den Gegner in die Stadt zurückgezwungen, die dieser verlassen wollte, was vier oder fünf gegnerische Tote gefordert hatte.
Diana hatte in der ersten Reihe gekämpft, immer wieder mit ihrem Karabiner geschossen und mehrmals im Nahkampf ihre Pistolen benutzt.
Coster Saint-Victor kehrte aus dem Gefecht mit einem Bajonettstich durch den Arm zurück, seine Chouanjacke über die Schulter geworfen.
›Monsieur‹, sagte die junge Frau zu Cadoudal, der das Gefecht in der ersten Reihe bestritten hatte, immer wieder vor Pulverdampf unsichtbar, ›Sie wollten mich nach dem Gefecht sprechen, um aus meinem eigenen Mund zu hören, warum ich mich Ihnen anschließen will und was ich von Ihnen wünsche: Das Gefecht ist beendet, ich wünsche, in Ihre Truppe einzutreten. ‹
›Und in welchem Rang, Madame?‹, fragte Cadoudal.
›Im Rang eines einfachen Freiwilligen: Ich habe bewiesen, dass Getöse und Rauch mir keine Angst machen.‹
Cadoudals Stirn verfinsterte sich, und seine Miene nahm einen strengen Ausdruck an.
›Madame‹, sagte er, ›dieser Vorschlag ist weniger harmlos, als es den Anschein haben mag. Ich werde Ihnen etwas Sonderbares erzählen: Da ich zuerst für eine kirchliche Laufbahn bestimmt war, habe ich alle Gelübde mit ganzem Herzen abgelegt und sie immer befolgt. In Ihnen, das bezweifle ich nicht, hätte ich einen bezaubernden Aide de Camp von unstreitiger Kühnheit. Für mich sind Frauen so tapfer wie Männer. Und von Epicharis, die sich mit den Zähnen die Zunge abbiss, um unter der Folter, der Nero sie unterziehen ließ, ihre Komplizen nicht zu verraten, bis zu Charlotte Corday, die ein Ungeheuer vom Antlitz der Welt tilgte, vor dem die Menschen erzitterten, haben sie uns in jedem Jahrhundert immer wieder Proben ihres Mutes gegeben. Doch in unseren religiösen Landgegenden, vor allem in der alten Bretagne, bestehen Vorurteile, vor deren Hartnäckigkeit der militärische Ruhm eines Charette bedeutungslos wurde, und diese Vorurteile können einen Kombattanten nötigen, auf Dienste wie die von Ihnen angebotenen zu verzichten. Manche unserer Anführer hatten Schwestern und Töchter gemeuchelter Royalisten in ihren Feldlagern, doch diesen schuldeten sie Hilfe und Schutz.‹
›Und wer sagt Ihnen, Monsieur‹, rief Diana, ›dass ich nicht Tochter oder Schwester eines gemeuchelten Royalisten bin – oder sogar beides – und dass ich nicht dieses Recht hätte, das Sie eben erwähnten?‹
›Und wie kommt es dann‹, mischte sich lächelnd d’Argentan ein, ›dass Ihr Ausweis von Barras unterzeichnet ist und Sie als Leiterin einer Poststelle in Vitré ausweist?‹
›Hätten Sie die Güte, mir Ihren Ausweis zu zeigen?‹, fragte Diana den falschen d’Argentan.
›Ha! Meiner Treu, gut gegeben‹, rief Cadoudal, den Dianas Kaltblütigkeit und Hartnäckigkeit beeindruckten.
›Und dann werden Sie mir sicherlich erklären, wie Sie dazu kommen, sich als Freund, wenn nicht gar beinahe rechter Arm General Cadoudals in Ihrer Funktion als Steuereinnehmer aus Dinan auf republikanischem Territorium frei zu bewegen?‹
›Ja, sprich‹, sagte Cadoudal, ›erkläre Mademoiselle, wie es kommt, dass du Steuereinnehmer in Dinan bist, und sie wird dir erklären, wie es dazu kommt, dass sie Postverwalterin in Vitré ist.‹
›Oh, das ist ein Geheimnis, das ich vor unserem keuschen Freund Cadoudal nicht gerne enthülle. Aber wenn Sie mich drängen, dann werde ich Ihnen auf die Gefahr hin, ihn erröten zu machen, verraten, dass er in Paris in der Rue des Colonnes nahe dem Theater Feydeau eine gewisse Demoiselle Aurélie de Saint-Amour versteckt hält, welcher der Citoyen Barras nichts abschlagen kann und die mir nichts abschlagen kann.‹
›Und‹, sagte Cadoudal, ›der Name d’Argentan in dem Ausweis meines Freundes verbirgt einen Namen, der ihm als Geleitwort bei allen Banden von Chouans, Vendéens und Royalisten mit weißer Kokarde in ganz Frankreich und im Ausland dient. Ihr Reisegefährte, Mademoiselle, der nun, da er nichts mehr befürchten muss, auch nichts mehr zu verbergen hat, ist kein Steuereinnehmer der Regierung in Dinan, sondern Sendbote zwischen General Rundkopf und den Compagnons de Jéhu.‹
Bei der Erwähnung dieses Namens zuckte Diana unmerklich zusammen.
›Ich muss gestehen‹, sagte der falsche d’Argentan, ›dass ich einer furchterregenden Hinrichtung beigewohnt habe: Der Vicomte de Fargas, der seine Bruderschaft verraten hat, wurde vor meinen Augen erdolcht.‹
Diana spürte, wie das Blut ihren Wangen entwich. Hätte sie ihren Namen genannt, würde sie ihn nennen, wäre ihr ganzes Unterfangen vergeblich gewesen. Der Schwester des von den Compagnons de Jéhu gerichteten Vicomte de Fargas würde man niemals Namen oder Aufenthalt dieser Bruderschaft verraten.
Sie schwieg daher und tat so, als warte sie darauf, dass Cadoudal wieder das Wort ergriff.
Cadoudal deutete ihr Schweigen wie erwartet und fuhr fort: ›Er heißt nicht d’Argentan, sondern Coster Saint-Victor; und hätte er bisher keinen anderen Beweis seiner Gesinnung gegeben als die Verwundung, die er heute für unsere heilige Sache erhalten hat -‹
›Wenn Sie weiter nichts als eine Verwundung zum Beweis unserer Ernsthaftigkeit verlangen‹, sagte Diana ungerührt, ›das können Sie haben.‹
›Und wie?‹, fragte Cadoudal.
›Sehen Sie selbst!‹ Mit diesen Worten zog Diana aus ihrem Gürtel den scharfen Dolch, der ihren Bruder getötet hatte, und durchbohrte ihren Arm an der gleichen Stelle, an der Coster verwundet worden war, mit einem so gewaltigen Stoß, dass die Klinge auf der anderen Seite des Arms heraustrat.
Dann zeigte sie ihren durchbohrten Arm Cadoudal und sagte: ›Sie wollen wissen, ob ich von edler Geburt bin? Sehen Sie selbst! Mein Blut ist, wie ich hoffe, nicht minder blau als das Monsieur Coster Saint-Victors. Sie wollen wissen, mit welchem Recht ich Ihr Vertrauen verlange? Dieser Dolch beweist Ihnen, dass ich mit den Compagnons de Jéhu in Verbindung stehe. Sie wollen wissen, wie ich heiße? Ich bin die Nachfahrin jener Römerin, die sich ein Messer in den Arm stach, um ihrem Ehemann zu beweisen, dass sie nicht schwach war. Ich heiße Porcia!‹
Coster Saint-Victor schrak zurück. Cadoudal, der die Heldin der Rache voller Bewunderung ansah, sagte: ›Ich kann bestätigen, dass das Messer, mit dem die junge Frau sich verwundet hat, in der Tat der Dolch der Compagnons de Jéhu ist, und zum Beweis lege ich den gleichen Dolch vor, den mir der Anführer der Bruderschaft drei Tage vor meiner Aufnahme überreicht hat.‹
Und er nahm einen Dolch aus seiner Brusttasche, völlig gleich dem Dolch, der den Arm der Mademoiselle de Fargas durchstoßen hatte.
Cadoudal reichte Diana die Hand. ›Mademoiselle, von diesem Augenblick an‹, sagte er, ›bin ich Ihr Vater, wenn Sie keinen Vater mehr haben, und wenn Sie keinen Bruder mehr haben, sind Sie meine Schwester. Da wir in einer Zeit leben, in der ein jeder gezwungen ist, seinen Namen unter einem anderen zu verbergen, werden Sie sich als die Römerin, die Sie sind, Porcia nennen. Von dieser Stunde an werden Sie zu uns zählen, Mademoiselle, und da Sie vom ersten Augenblick an Ihrem Rang als Anführerin gerecht wurden, werden Sie der Ratsversammlung beiwohnen, die ich abhalte, sobald der Wundarzt Ihre Wunde versorgt haben wird.‹
›Danke, General‹, sagte Diana. ›Was den Wundarzt betrifft, benötige ich ihn so wenig wie Monsieur Coster Saint-Victor; meine Verwundung ist nicht bedeutender als die seine.‹
Und sie zog den Dolch aus der Wunde, in der er immer noch gesteckt hatte, und zerschnitt ihren Ärmel der Länge nach, so dass ihr schöner Arm ganz zu sehen war.
Dann sagte sie zu Coster Saint-Victor: ›Kamerad, hätten Sie die Güte, mir Ihre Krawatte zu borgen?‹
Diana de Fargas blieb zwei Jahre lang in der Armée de Bretagne und in Cadoudals unmittelbarer Umgebung unter dem Namen Porcia, und niemand erfuhr ihren wahren Namen.
Zwei Jahre lang nahm sie an allen Kämpfen teil, die stattfanden, teilte alle Gefahren und alle Strapazen des Anführers, dessen Sache sie sich verschrieben zu haben schien.
Zwei Jahre lang unterdrückte sie ihren Hass auf die Compagnons de Jéhu, rühmte ihre Taten und pries die Namen eines Morgan, d’Assas, d’Adler und Montbar.
Zwei Jahre lang belagerte sie der schöne Coster Saint-Victor, dem noch nie eine Frau widerstanden hatte, vergeblich mit seiner Liebe.
Und nach diesen zwei Jahren wurde ihr langes, beharrliches Warten belohnt.
Unvermittelt brach der 18. Brumaire über Frankreich herein.
Die erste Aufmerksamkeit des neuen Diktators richtete sich auf die Vendée und die Bretagne. Cadoudal begriff, dass es zu einem echten Krieg kommen würde und dass er für diesen Krieg Geld benötigen würde – Geld, das ihm die Compagnons de Jéhu verschaffen konnten.
Coster Saint-Victor war am Oberschenkel durch einen Schuss verwundet; ihn konnte man als Geldeinnehmer nicht schicken.
Cadoudals Blick fiel auf Diana, die er nach wie vor nur als Porcia kannte: Sie hatte ihm so viele Beweise ihrer Hingabe und ihres Mutes gegeben, dass er sich neben Coster Saint-Victor niemanden sonst denken konnte, den er mit diesem Auftrag betrauen wollte.
Als Frau konnte sie ungehindert in Frankreich reisen. Und in ihrer Kutsche konnte sie beträchtliche Geldbeträge transportieren.
Cadoudal besprach sich mit dem Verwundeten, der völlig seiner Meinung war.
Diana wurde an das Bett des Verwundeten gerufen, und Cadoudal eröffnete ihr seine Absichten – dass sie sich mittels eines doppelten Schreibens Cadoudals und Coster Saint-Victors mit den Compagnons de Jéhu in Verbindung setzen und Cadoudal das Geld bringen sollte, das er dringender denn je benötigte, da die Feindseligkeiten unerbittlich wie nie zuvor zu entbrennen schienen.
Dianas Herz tat bei diesen Worten einen Freudensprung, doch mit keiner Regung verriet sie, was sich in ihrem Herzen abspielte.
›Mag die Aufgabe noch so schwierig sein‹, sagte sie, ›wird es doch mein größter Wunsch sein, sie zu erfüllen; doch außer den Briefen des Generals und Monsieur Coster Saint-Victors werde ich alle topographischen Auskünfte benötigen, alle Parolen und bindenden Befehle, die mir helfen können, in das Herz der Bruderschaft vorzudringen.‹
Coster Saint-Victor gab sie ihr. Sie reiste ab, ein Lächeln auf den Lippen und Rachedurst im Herzen.
17
Die Höhlen von Ceyzériat
Als Diana in Paris ankam, erbat sie eine Audienz bei dem Ersten Konsul Bonaparte. Es war wenige Tage nach Rolands Rückkehr von seinen Verhandlungen mit Cadoudal. Roland interessierte sich bekanntlich nicht sonderlich für Frauen. Er sah Porcia, zerbrach sich jedoch nicht weiter den Kopf über sie. Möglicherweise hielt er sie gar nicht für eine Frau, sondern für einen Chouan. Barras war entmachtet, und Diana verschwendete keinen Gedanken an ihn.
In ihrem Audienzbegehren gab sie an, sie wisse, wie man der Compagnons de Jéhu habhaft werden könne, und sie sei bereit, unter bestimmten Bedingungen, die sie mit dem Ersten Konsul persönlich auszumachen wünsche, dieses Wissen zu offenbaren.
Bonaparte verabscheute nichts mehr als Frauen, die sich in die Politik einmischten.
Er befürchtete, es mit einer Abenteurerin zu tun zu haben, und ließ ihren Brief Fouché übergeben, den er beauftragte, sich diese Mademoiselle Diana de Fargas näher anzusehen.
Kennen Sie Fouché, Mademoiselle?«, fragte Hector, der seinen Bericht unterbrach.
»Nein, Monsieur«, antwortete Claire.
»Er ist der Inbegriff der Abscheulichkeit. Augen wie aus Stein, die in verschiedene Richtungen blicken, gelbe, spärliche Haare, ein aschfarbener Teint, eine platte Nase, ein schiefer Mund voller scheußlicher Zähne, ein fliehendes Kinn und ein rötlicher Bart, der wie Schmutz im Gesicht klebt – das ist Fouché.
Das Schöne ekelt sich naturgemäß vor dem Hässlichen.
Als Fouché sich bei Diana einfand, halb unterwürfig, halb anmaßend und durchdrungen von der geheuchelten Demut des einstigen Zöglings des Priesterseminars, weckte er in ihr höchsten moralischen und physischen Abscheu.
Man hatte ihr den Polizeiminister angekündigt; dieser Titel öffnete alle Türen und hatte Fouché auch Dianas Tür geöffnet; als sie jedoch dieses Scheusal erblickte, schrak sie instinktiv auf ihrem Kanapee zurück und vergaß sogar, Fouché zum Sitzen aufzufordern.
Er nahm sich ungefragt einen Sessel; und da Diana ihn weiterhin mit unverhüllt angewiderter Miene betrachtete, sagte er: ›Nun, kleine Dame, wir haben also Enthüllungen, die wir der Polizei machen wollen, und einen Handel, den wir ihr anzubieten gedenken?‹
Diana sah sich mit solchem Erstaunen um, dass der gewandte Politiker begriff, dass diese Verwunderung nicht gespielt war. ›Wonach suchen Sie?‹, fragte er.
›Nach der Person, an die Sie sich wenden, Monsieur.‹
›Das sind Sie, Mademoiselle‹, erwiderte Fouché dreist.
›Da täuschen Sie sich, Monsieur‹, sagte Diana. ›Ich bin keine kleine Dame, ich bin eine große Dame, Tochter des Grafen von Fargas, der in Avignon ermordet wurde, und Schwester des Vicomte de Fargas, der in Bourg ermordet wurde. Ich bin nicht gekommen, um der Polizei Enthüllungen zu machen oder irgendeinen Handel anzubieten. So etwas überlasse ich denen, die in der bedauernswerten Lage sind, ihre Leiter oder Angestellten zu sein. Ich kam, um Gerechtigkeit zu verlangen‹, sagte sie und erhob sich, ›und da ich bezweifle, dass Sie mit dieser keuschen Göttin auch nur entfernt zu tun haben, wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie zu der Einsicht gelangen wollten, dass Sie sich offenbar in der Tür geirrt haben, als Sie zu mir kamen.‹
Und als sie sah, dass Fouché sich nicht von der Stelle rührte – sei es vor Verblüffung, sei es aus Dreistigkeit -, verließ sie den Salon und ging in ihr Zimmer, das sie verriegelte.
Zwei Stunden später kam Roland de Montrevel, um sie im Auftrag des Ersten Konsuls abzuholen.
Roland führte sie mit aller Höflichkeit, die ihn seine vornehme Erziehung unter der Aufsicht seiner Mutter Damen gegenüber gelehrt hatte, in den Audienzsalon, dann ging er, Bonaparte zu benachrichtigen.
Nach wenigen Minuten erschien der Erste Konsul. ›So, so!‹, sagte er, als Diana sich verneigte, was er mit einem wohlwollenden Nicken erwiderte, ›hat dieser Bauernstoffel Fouché mal wieder gedacht, er hätte es mit einer seiner Straßendirnen zu tun, und sich Ihnen gegenüber höchst unpassend aufgeführt? Sie müssen ihn entschuldigen: Was kann man anderes von einem ehemaligen Oratorianerhilfslehrer erwarten?‹
›Ich habe nichts anderes erwartet, Citoyen Erster Konsul, doch von Ihnen hätte ich einen anderen Boten erwarten dürfen.‹
›Sie haben recht‹, sagte Bonaparte, ›und Sie haben mir weiß Gott zwei Lektionen auf einmal erteilt. Da bin ich nun: Sprechen Sie; es scheint, als hätten Sie mir etwas Interessantes mitzuteilen.‹
›Sie können nicht zuhören, ohne sich zu bewegen; mir ist wichtig, dass Sie zuhören; wollen wir auf und ab gehen?‹
›Gehen wir‹, sagte Bonaparte. ›Das missfällt mir so an den Frauen: Wenn ich ihnen eine Audienz gewähre, wollen sie sitzen.‹
›Mag sein. Aber wenn man zwei Jahre lang Ordonnanz bei Cadoudal war, ist einem das Gehen selbstverständlich.‹
›Sie waren zwei Jahre lang Ordonnanz bei Cadoudal?‹
›Ja.‹
›Und wie kommt es, dass mein Aide de Camp Roland Sie weder gesehen noch von Ihnen gehört hat?‹
›Das kommt daher, dass man mich in der Bretagne nur unter dem Namen Porcia kennt und dass ich mich die ganze Zeit, die er in Cadoudals Nähe war, ferngehalten habe.‹
›Aha! Dann haben Sie sich einen Dolch durch den Arm gestoßen, um Ihre Aufnahme in die Reihen der Chouans zu bewirken?‹
›Hier ist die Narbe‹, sagte Diana und streifte den Ärmel ihres Kleides zurück.
Bonaparte warf einen Blick, der nur der Narbe galt, auf ihren herrlichen Arm. »Das ist eine merkwürdige Verwundung‹, sagte er.
›Der Dolch, der sie geschlagen hat, ist noch merkwürdiger‹, sagte Diana. ›Hier ist er.‹ Und sie zeigte dem Ersten Konsul den Eisendolch der Compagnons de Jéhu.
Bonaparte ergriff ihn und betrachtete aufmerksam das Messer, von dessen starrer Form etwas Schreckliches ausging. ›Und woher haben Sie diesen Dolch?‹, fragte er.
›Aus der Brust meines Bruders, in dessen Herzen er steckte.‹
›Erzählen Sie, aber schnell, meine Zeit ist kostbar.‹
›Nicht kostbarer als die der Frau, die seit zwei Jahren auf ihre Rache wartet.‹
›Sind Sie Korsin?‹
›Nein, aber ich spreche zu einem Korsen; er wird mich verstehen.‹
›Was wollen Sie?‹
›Ich will das Leben derer, die meinem Bruder das seine genommen haben. ‹
›Wer ist es?‹
›Ich sagte es in meinem Brief, es sind die Compagnons de Jéhu.‹
›Sie haben auch gesagt, Sie wüssten, wie man sie gefangen nehmen kann.‹
›Ich habe ihre Parolen und zwei Briefe, einen von Cadoudal, einen von Coster Saint-Victor, an ihren Anführer Morgan.‹
›Sind Sie sicher, dass Sie sie ergreifen werden?‹
›Völlig sicher, vorausgesetzt, man stellt mir einen tapferen und intelligenten Mann zur Seite, beispielsweise Monsieur Roland de Montrevel, und genügend Soldaten.‹
›Und Sie sagten, Sie würden Ihre Bedingungen nennen: Wie lauten sie?‹
›Erstens, dass ihnen keine Gnade gewährt wird.‹
›Diebe und Mörder begnadige ich grundsätzlich nicht.‹
›Zweitens, dass man mich den Auftrag, den ich auszuführen habe, auch ausführen lässt.‹
›Wie lautet er?‹
›Ich soll das Geld abholen, das Cadoudal benötigt und das der Grund ist, warum er mir seine Geheimnisse anvertraut hat.‹
›Sie verlangen, nach eigenem Gutdünken über dieses Geld zu verfügen? ‹
›Ah! Citoyen Erster Konsul‹, sagte Mademoiselle de Fargas, ›mit diesen Worten haben Sie die gute Erinnerung geschmälert, die ich mir ansonsten von unserer Unterhaltung bewahrt hätte.‹
›Was zum Teufel wollen Sie mit diesem Geld anstellen?‹
›Ich will sichergehen, dass es seiner Bestimmung zugeführt wird.‹
›Ich soll Ihnen gestatten, denjenigen Geld zu schicken, die gegen mich Krieg führen? Niemals!‹
›Dann gestatten Sie mir, mich von Ihnen zu verabschieden, General, denn wir haben nichts mehr zu besprechen.‹
›Oho! Was für ein Dickkopf!‹, rief Bonaparte.
›Nicht mit dem Kopf weist man schändliche Ansinnen zurück, sondern mit dem Herzen.‹
›Ich kann doch nicht allen Ernstes meinen Gegnern Waffen liefern!‹
›Haben Sie volles Vertrauen in Monsieur Roland de Montrevel?‹
›Ja.‹
›Und Sie wissen, dass er nichts tun wird, was Ihrer Ehre und Frankreichs Interessen abträglich sein könnte?‹
›Selbstverständlich.‹
›Nun, dann beauftragen Sie ihn mit diesem Unternehmen. Ich werde mich mit ihm darüber verständigen, wie wir es durchführen wollen, und mit ihm die Bedingungen aushandeln, unter denen ich mich daran beteilige. ‹
›Gut‹, sagte Bonaparte. Und ohne zu zaudern, wie er in allen Dingen zu handeln pflegte, rief er Roland herbei, der vor der Tür wartete: ›Komm zu uns, Roland!‹
Roland trat ein.
›Du hast unbeschränkte Vollmachten, handele im Einverständnis mit Madame, und schaffe mir endlich diese Herren Straßenräuber vom Halse, die unsere Postkutschen anhalten und ausrauben und sich dabei als untadelige Edelmänner gerieren.‹
Dann, mit der Andeutung einer Verbeugung, wandte er sich an Diana de Fargas. ›Vergessen Sie nicht‹, sagte er, ›dass ich Sie mit größtem Vergnügen wiedersehen werde, wenn Sie Erfolg haben.‹
›Und wenn ich scheitern sollte?‹
›Geschlagene kenne ich nicht.‹
Obwohl Roland nichts für Operationen übrig hatte, an denen Frauen beteiligt waren, stand Diana de Fargas ihrem Geschlecht so fern, dass er sie von Anfang an wie einen wackeren Kameraden behandelte, mit einer Vertraulichkeit, die ihr ebenso zusagte, wie ihr Fouchés Dreistigkeit widerstrebt hatte. Innerhalb von einer Stunde hatten sie alles besprochen und beschlossen, noch am Abend auf verschiedenen Wegen nach Bourg-en-Bresse aufzubrechen, wo sie ihr Hauptquartier aufschlagen wollten.
Man kann sich denken, dass Diana de Fargas, die sich wieder als Chouan gekleidet hatte und sich Porcia nannte, im Besitz aller erforderlichen Auskünfte, des bindenden Befehls, der Parolen und der Briefe Cadoudals und Coster Saint-Victors ohne Schwierigkeiten in die Kartause von Seillon eindringen konnte, in der sich die vier Anführer der Compagnons de Jéhu versammelt hatten.
Keiner von ihnen ließ sich träumen – nicht dass es sich um eine Frau handelte, was trotz der Männerkleidung leicht zu erkennen war, sondern dass es sich bei dieser Frau um Mademoiselle de Fargas handelte, die Schwester desjenigen, den sie ermordet hatten, um ihn für seinen Verrat zu bestrafen.
Da der Geldbetrag, den Cadoudal verlangte – hunderttausend Francs -, in der Abtei von Seillon nicht vollständig vorrätig war, verabredeten die Anführer sich für Mitternacht in den Höhlen von Ceyzériat, um Diana dort die fehlenden vierzigtausend Francs auszuhändigen.
Nachdem Diana Roland davon unterrichtet hatte, ließ dieser sofort den Gendarmeriehauptmann und den Dragoneroberst rufen, die in der Stadt stationiert waren.
Als sie eintrafen, wies er sich aus. In dem Dragoneroberst fand er ein passives Instrument vor; er stellte sich samt der Anzahl Soldaten, die Roland verlangen würde, zur Verfügung doch anders verhielt es sich mit dem Gendarmeriehauptmann, einem alten Haudegen voller Hass auf die Compagnons de Jéhu, die ihn, wie er sagte, seit drei Jahren zum Narren hielten.
Zehnmal hatte er sie erspäht, erblickt, verfolgt, und jedes Mal waren sie ihm entkommen, wie der alte Soldat gestehen musste, sei es, weil sie die besseren Pferde hatten, sei es, weil sie schlauer, geschickter oder strategisch überlegen waren.
Einmal war er zufällig im Wald von Seillon auf ihre Fährte gestoßen, ohne dass sie damit rechneten: Tapfer hatten sie sich dem Kampf gestellt, hatten drei seiner Männer getötet und sich mit zwei Verwundeten zurückgezogen.
Er hatte jede Hoffnung aufgegeben, ihrer jemals Herr zu werden, und hegte nur noch einen Wunsch, nämlich den, nie wieder von der Regierung gezwungen zu werden, sich mit ihnen zu befassen, als Roland ihn aus seiner Ruhe weckte oder, besser gesagt, aus dem Stupor riss, in den die Verzweiflung ihn gestürzt hatte.
Doch als Roland die Höhlen von Ceyzériat als den Treffpunkt erwähnte, der seiner Gefährtin genannt worden war, blickte der alte Hauptmann ihn nachdenklich an, nahm dann seinen Dreispitz ab, als wäre dieser dem ungehinderten Entfalten seiner Gedanken hinderlich, legte ihn auf den Tisch, blinzelte und sagte: ›Warten Sie, warten Sie! Die Höhlen von Ceyzériat, die Höhlen von Ceyzériat … die halten wir.‹
Und er setzte seinen Hut wieder auf.
Der Dragoneroberst lächelte von einem Ohr zum anderen. ›Er hält sie!‹, sagte er.
Roland und Diana wechselten einen zweifelnden Blick. Sie hatten keineswegs das gleiche Vertrauen wie der Oberst in den alten Hauptmann.
›Erklären Sie uns das‹, sagte Roland.
›Als die Demagogen die Kirche von Brou zerstören wollten‹, sagte der alte Hauptmann, ›hatte ich einen Einfall …‹
›Das wundert mich nicht‹, sagte Roland.
›Ich wollte nicht nur unsere Kirche retten, sondern auch die herrlichen Grabmale, die sich in ihr befinden.‹
›Und wie?‹, fragte Roland.
›Indem ich die Kirche zum Furagemagazin für die Kavallerie erklärte.‹
›Ich verstehe‹, sagte Roland, ›das Heu hat den Marmor gerettet. Sie haben recht, mein Freund, das ist ein Einfall.‹
›Und da die Kirche mir zugeteilt war, wollte ich sie in allen Einzelheiten erkunden.‹
›Hauptmann, wir lauschen Ihnen andächtig.‹
›Nun, am Ende der Krypta entdeckte ich eine kleine Tür, durch die man in ein Untergeschoss gelangt, und nach einem Weg von etwa einer Viertelmeile mündet dieses Untergeschoss, das mit einem Gitter verschlossen ist, in die Höhlen von Ceyzériat.‹
›Ha!‹, rief Roland. ›Ich beginne zu verstehen.‹
›Ich verstehe gar nichts‹, sagte der Dragoneroberst.
›Es ist doch sonnenklar‹, warf Mademoiselle de Fargas ein.
›Erklären Sie es dem Oberst, Diana‹, sagte Roland, ›und zeigen Sie ihm, dass Sie nicht vergebens zwei Jahre lang Aide de Camp bei Cadoudal waren. ‹
›Ja, erklären Sie es mir‹, sagte der Oberst, der die Beine spreizte, sich auf seinen Säbel stützte und die Augen weit aufriß, so dass er beim Anblick des Himmels blinzeln musste.
›Gut‹, sagte Mademoiselle de Fargas. ›Der Hauptmann durchquert mit zehn oder fünfzehn Mann die Kirche von Brou und nimmt Aufstellung am Ende des Untergeschosses. Wir greifen mit etwa zwanzig Mann vom Höhleneingang aus an. Die Compagnons de Jéhu werden durch den zweiten Zugang fliehen wollen, von dem sie wissen, und dort werden sie auf den Hauptmann und seine Männer stoßen, so dass sie in der Falle stecken.‹<
›Meiner Treu! Ganz genau! Das ist es!‹, rief der Hauptmann voller Bewunderung, dass eine Frau seinen Plan erraten hatte.
›Wie dumm von mir!‹, sagte der Dragoneroberst und schlug sich mit der Hand vor die Stirn.
Roland nickte unauffällig, aber zustimmend. Dann wandte er sich an den Hauptmann: ›Aber worauf es ankommt, Hauptmann, ist, dass Sie zuerst da sind und durch die Kirche kommen. Die Gefährten Jéhus werden sich erst in der Dunkelheit in die Höhlen begeben und zweifellos von der anderen Seite aus. Ich werde mit Mademoiselle de Fargas kommen, als Chouans verkleidet. Ich werde die vierzigtausend Francs an mich nehmen, mich mittels der Parole den zwei Wächtern nähern und sie erdolchen. Das Geld werden wir verstecken und unter Bewachung eines Gendarmen zurücklassen. Dann kehren wir in die Höhle zurück und greifen die Compagnons de Jéhu an. Sie werden zu fliehen versuchen und hinter dem Gitter auf den Hauptmann und seine Gendarmen treffen, die ihnen den Weg versperren; sie werden in der Falle sitzen und sich entweder ergeben oder bis zum letzten Mann erschießen lassen müssen.‹
›Ich werde vor Tagesanbruch auf meinem Posten sein‹, sagte der Hauptmann. ›Ich nehme Lebensmittel für den ganzen Tag mit, und am Abend geht es auf in den Kampf!‹
Er zog den Säbel, führte einen Fechthieb gegen die Mauer und steckte den Säbel wieder in die Scheide.
Roland wartete, bis die heroische Geste ausgekostet war, und klopfte dem alten Soldaten dann auf die Schulter. ›An Ihrem Plan und an meinem gibt es nichts zu verändern. Um Mitternacht werden Mademoiselle de Fargas und ich in die Höhlen eindringen, um unser Geld in Empfang zu nehmen, und eine Viertelstunde später, beim ersten Gewehrschuss, den Sie hören: Auf in den Kampf, wie Sie sagen, mein lieber Hauptmann!‹
›Auf in den Kampf!‹, rief der Dragoneroberst wie ein Echo.
Roland wiederholte nochmals alles, was man vereinbart hatte, damit jeder sich gut einprägte, was er zu tun hatte, und verabschiedete sich dann von den beiden Offizieren, die er erst am Schauplatz ihres Kampfes wiedersehen würde.
Alles ging vor sich wie vereinbart.
Diana de Fargas und Roland betraten unter dem Namen und in der Kleidung von Bruyère und von Branche-d’Or die Höhlen von Ceyzériat, nachdem sie das Passwort mit den zwei Wachen getauscht hatten, die am Fuß des Hügels und am Eingang der Höhle stationiert waren.
Doch eine unerwartete Schwierigkeit stellte sich heraus: Morgan war in dringenden Angelegenheiten abwesend. Monbart und die zwei anderen Anführer d’Assas und Adler führten in seiner Abwesenheit das Kommando.
Sie hegten keinerlei Argwohn und übergaben Diana und Roland die vierzigtausend Francs.
Den getroffenen Vorbereitungen ließ sich ablesen, dass die Compagnons de Jéhus die Nacht in der Höhle verbringen wollten.
Doch ihr Oberhaupt war nicht da.
Wenn Roland und Diana ihr Coup gelänge, wäre der Erfolg dadurch geschmälert, dass sie Morgan nicht mit den anderen zusammen einfingen. Vielleicht käme Morgan im Verlauf der Nacht zurück, aber wann?
Alles war in die Wege geleitet, und es wäre sicherlich besser, drei Anführer zu fassen, als alle vier entwischen zu lassen. Und solange der vierte nicht das Land verließ, würde man ihn als Einzelnen leichter fassen können als vier Anführer mit ihren Helfern. Vielleicht würde er sich sogar stellen, wenn er keinen Rückhalt mehr hatte.
Zwei Blicke, zwischen Roland und Diana getauscht, genügten, und sie wussten, dass sich an ihren Plänen nichts geändert hatte.
Roland näherte sich der Wache und nannte das Passwort. Nach wenigen Sekunden taumelte die Wache und fiel mit dem Gesicht zu Boden. Roland hatte sie erstochen.
Die zweite Wache fiel wie die erste ohne einen Laut.
Und dann erschienen auf das vereinbarte Signal hin der Oberst und seine zwanzig Mann. Der Oberst war kein Mann von Geist, aber ein tapferer alter Haudegen, auf den nicht weniger Verlass war als auf seinen Säbel. Diesen Säbel zog er aus der Scheide und stellte sich an die Spitze seiner Männer. Roland ging zu seiner Rechten, Diana zu seiner Linken.
Sie hatten sich keine zwanzig Schritte vorwärtsbewegt, als zwei Gewehrschüsse ertönten: einer der Wegelagerer, die Montbar nach Ceyzériat geschickt hatte, war auf Rolands Dragoner gestoßen.
Die eine Kugel traf nicht, die andere zerschmetterte einem Mann den Arm.
Dann der Ruf: ›Zu den Waffen!‹
Im nächsten Augenblick zeigte sich im Lichtschein der brennenden Fackeln in einer der Kammern links und rechts des Hauptteils der Grotte ein Mann, der mit rauchendem Gewehr in der Hand um sein Leben rannte. ›Zu den Waffen!‹, schrie er. ›Zu den Waffen! Die Dragoner kommen!‹
›Ich bin der Kommandant!‹, rief Montbar. ›Löscht alle Lichter und zieht euch in die Kirche zurück.‹
Seine Männer gehorchten so prompt, wie man es tut, wenn man die Gefahr erkannt hat.
Montbar, der mit den verschlungenen Gängen der Höhlen vertraut war, verschwand darin mit seinen Gefährten, doch mit einem Mal war ihm, als höre er keine vierzig Schritte entfernt ein leise geäußertes Kommando und danach das Klicken, mit dem Gewehre geladen werden.
›Halt!‹, flüsterte er mit ausgebreiteten Armen.
›Feuer!‹, befahl eine Stimme.
›Flach auf den Boden!‹ rief Montbar.
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, erleuchtete eine gewaltige Detonation die Höhle. Alle, die sich auf Montbars Befehl zu Boden geworfen hatten, spürten, wie die Kugeln über ihre Köpfe sausten. Zwei, drei Männer, die sich nicht rechtzeitig geduckt hatten oder den Befehl nicht verstanden hatten, wurden getötet.
In dem kurzzeitigen Lichtschein erkannten Montbar und seine Gefährten die Uniformen der Gendarmen.
›Feuer!‹, rief nun seinerseits Montbar; zwölf oder mehr Gewehrschüsse ertönten und erhellten abermals die Höhle.
Drei Compagnons de Jéhu lagen reglos da.
›Sie haben uns den Rückzug abgeschnitten‹, sagte Montbar. ›Wir müssen kehrtmachen; wenn wir überhaupt eine Chance haben, dann dem Wald entgegen.‹<
Er lief los, gefolgt von seinen Gefährten.
Eine zweite Gewehrsalve der Gendarmen war zu hören; ein Seufzen und das Geräusch eines Körpers, der zu Boden fiel, verrieten, dass sie nicht folgenlos geblieben war.
›Voran, Freunde‹, rief Montbar, ›verkaufen wir ihnen unsere Haut so teuer wie möglich!‹
Doch je weiter er vordrang, desto stärker fiel Montbar Rauchgeruch auf, der ihn beunruhigte. ›Mir scheint, diese Schufte wollen uns ausräuchern‹, sagte er.
›Das hatte ich befürchtet‹, sagte Adler.
›Sie glauben wohl, sie hätten es mit Füchsen zu tun.‹
›Unsere Krallen werden ihnen zeigen, dass wir Löwen sind.‹
Der Rauch wurde immer dichter, der Feuerschein greller. Sie erreichten die letzte Wegbiegung.
Fünfzig Schritt vor dem Höhleneingang war ein Scheiterhaufen entzündet, nicht um sie auszuräuchern, sondern um Licht zu spenden. Im Feuerschein sah man die Karabinergewehre und Säbel der Soldaten schimmern.
›Auf‹, rief Montbar, ›sterben wir, aber töten wir zuerst!‹
Und er stürzte sich als Erster in den Lichtschein und schoss beide Läufe seines Jagdgewehrs auf die Dragoner ab. Dann schleuderte er sein nutzlos gewordenes Gewehr fort, zog die Pistolen aus dem Gürtel und warf sich mit gesenktem Kopf den Dragonern entgegen.
Ich will gar nicht erst versuchen«, fuhr der junge Graf fort, »Ihnen zu schildern, was sich daraufhin ereignete; es war ein entsetzliches Handgemenge, begleitet von einem Orkan der Verwünschungen, Gotteslästerungen und Schreie der Verwundeten, als dessen Blitze Pistolenschüsse den Rauch durchzuckten; und als die Pistolen abgeschossen waren, wurde zum Dolch gegriffen.
Die Gendarmen kamen mittlerweile hinzu und mischten sich unter die Kämpfenden, über die sich roter Rauch senkte, dann hob und sich wieder senkte. Wutgeheul war zu hören, Todesröcheln, das Seufzen Sterbender.
Dieses Gemetzel währte eine Viertelstunde oder vielleicht zwanzig Minuten; dann sah man in den Höhlen von Ceyzériat zwanzig Tote liegen: dreizehn Dragoner und Gendarmen, neun Compagnons de Jéhu.
Fünf Compagnons hatten überlebt; von der Übermacht überwältigt, von Wunden bedeckt, waren sie lebendigen Leibes gefangen genommen worden. Mademoiselle de Fargas bedachte sie mit dem Blick der antiken Nemesis. Die verbliebenen Gendarmen und Dragoner umringten sie mit gezücktem Säbel.
Der alte Hauptmann hatte einen gebrochenen Arm, dem Oberst war eine Kugel durch den Oberschenkel gefahren. Roland, über und über vom Blut seiner Gegner bespritzt, hatte keinen Kratzer abbekommen.
Zwei der Gefangenen mussten auf Bahren getragen werden.
Fackeln wurden entzündet, und man machte sich auf den Weg in die Ortschaft. Als man die Landstraße erreichte, war ein galoppierendes Pferd zu vernehmen. Roland blieb stehen und versperrte die Straße. ›Geht weiter‹, sagte er zu den anderen, ›ich werde abwarten, wer der Reiter ist.‹
›Wer da?‹, rief Roland, als der Reiter keine zwanzig Schritte mehr entfernt war.
›Ein weiterer Gefangener, Monsieur‹, erwiderte der Reiter. ›Ich konnte an dem Kampf nicht teilnehmen. Aber ich will das Schafott mit den anderen teilen! Wo sind meine Freunde?‹
›Dort, Monsieur‹, sagte Roland.
›Verzeihen Sie‹, sagte Morgan zu den Gendarmen, ›ich verlange einen Platz unter meinen drei Freunden, dem Vicomte de Jahiat, dem Grafen von Valensolles und dem Marquis de Ribier. Ich bin der Graf Charles de Sainte-Hermine.‹
Die drei Gefangenen stießen einen Ruf der Bewunderung aus, und in diesen Ruf mischte sich Dianas Freudenschrei. Sie hielt ihre Beute gepackt: Keiner der vier Anführer war ihr entkommen.
Am selben Abend wurden die vierhunderttausend Francs der Compagnons de Jéhu in die Bretagne expediert, wie Roland es Cadoudal zugesagt hatte.
Rolands Auftrag war beendet; die Compagnons de Jéhu waren der Justiz überantwortet. Roland kehrte zum Ersten Konsul zurück, reiste in die Bretagne, wo er sich erfolglos bemühte, Cadoudal für die Sache der Republik zu gewinnen, kehrte nach Paris zurück, begleitete den Ersten Konsul auf seinem Feldzug in Italien und fiel in der Schlacht von Marengo.
Diana de Fargas war zu verstrickt in ihren Hass und zu rachedurstig, als dass sie darauf verzichtet hätte, diese bis zur Neige auszukosten. Der Prozess stand bevor, sollte schnell geführt und mit einer vierfachen Hinrichtung beendet werden, der sie unbedingt beiwohnen wollte.
In Besançon von der Verhaftung meines Bruders informiert, eilte ich nach Bourg-en-Bresse, wo die Geschworenen tagen würden.
Die Untersuchung nahm ihren Verlauf.
Es gab insgesamt sechs Gefangene, die fünf aus der Höhle und den, der sich freiwillig gestellt hatte. Zwei waren so schwer verwundet, dass sie innerhalb von acht Tagen nach ihrer Festnahme an ihren Verletzungen starben.
Sie hätten von einem Militärgericht abgeurteilt und zum Tod durch Erschießen verurteilt gehört, doch das verhinderte das Gesetz, dem zufolge seit Neuestem politische Verfahren von Zivilgerichten zu führen waren. Die Hinrichtungsform der Zivilgerichte war das Schafott.
Die Guillotine ist entehrend, das Füsilieren ist es nicht. Vor einem Militärtribunal hätten die Gefangenen alles gestanden; vor dem Zivilgericht stritten sie alles ab.
Unter den Namen d’Assas, d’Adler, de Montbar und de Morgan verhaftet, erklärten sie, diese Namen noch nie gehört zu haben und folgendermaßen zu heißen: Louis-André de Jahiat, geboren in Bâgé-le-Châtel, Departement Ain, siebenundzwanzig Jahre alt; Raoul-Frédéric-Auguste de Valensolles, geboren in Sainte-Colombe, Departement Rhône, neunundzwanzig Jahre alt; Pierre-Auguste de Ribier, geboren in Bollène, Departement Vaucluse, sechsundzwanzig Jahre alt, und Charles de Sainte-Hermine, geboren in Besançon, Departement Doubs, vierundzwanzig Jahre alt.
18
Charles de Sainte-Hermine (2)
Die Gefangenen gestanden, sich zusammengerottet zu haben mit dem Ziel, sich den Banden Monsieur de Teyssonnets anzuschließen, der in den Bergen der Auvergne eine Armee aufstellte; sie leugneten jedoch beharrlich, jemals das Geringste mit den Wegelagerern namens d’Assas, Adler, Montbar und Morgan zu tun gehabt zu haben. Dies konnten sie umso unbesorgter tun, als die Überfälle auf die Postkutschen stets von Maskierten verübt worden waren; nur in einem einzigen Fall war das Gesicht eines ihrer Anführer zu sehen gewesen, und das war der Fall meines Bruders.
Während des Überfalls auf eine Eilpost zwischen Lyon und Vienne hatte ein zehn- oder zwölfjähriger Knabe, der sich im Wagen des Aufsehers befand, dessen Pistole ergriffen und auf die Compagnons de Jéhu geschossen. Der Aufseher hatte aus Vorsicht keine Kugeln geladen gehabt, doch die Mutter des Knaben, die das nicht wissen konnte, war vor Angst um ihr Leben und das ihres Kindes ohnmächtig geworden. Mein Bruder hatte sich sogleich um sie gekümmert, hatte ihr Riechsalz gegeben und versucht, sie zu beruhigen. Mit einer ihrer Bewegungen hatte sie Morgan versehentlich die Maske abgestreift und das Gesicht des Grafen von Sainte-Hermine erblickt.
Doch die Sympathie, die den Angeklagten entgegengebracht wurde, war so groß, dass jedes ihrer Alibis durch Briefe und Zeugenaussagen bestätigt wurde, und auch die Dame, die das Gesicht des Banditen Morgan gesehen hatte, sagte aus, sie erkenne ihn in keinem der vier Angeklagten wieder.
In der Tat hatte nur der Staatsschatz unter ihren Überfällen zu leiden gehabt, was niemanden groß interessierte, da niemand zu sagen gewusst hätte, wem dieser gehörte.
Sie standen im Begriff, freigesprochen zu werden, als der Vorsitzende des Gerichts sich unvermutet und überraschend an die Dame wandte, die ohnmächtig geworden war, und sie fragte: ›Madame, wären Sie so freundlich, mir zu sagen, welcher dieser Herren so ritterlich war, Ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, die Ihr Zustand verlangte?‹
Überrumpelt von dieser unerwarteten Höflichkeit, in dem Glauben, während ihrer Abwesenheit seien Geständnisse erfolgt, und in der Überzeugung, durch ihre Worte nun dem Angeklagten nicht mehr zu schaden, sondern ihm vielleicht sogar zu nützen, wies die Dame auf meinen Bruder und sagte: ›Herr Vorsitzender, das war der Graf von Sainte-Hermine.‹
Da sie alle das gleiche Alibi hatten, fielen alle vier in diesem Augenblick dem Henker anheim.
›Zum Henker, Hauptmann‹, sagte Jahiat und betonte das Wort ›Hauptmann‹, ›das wird dich lehren, ritterlich zu sein.‹
Ein Freudenschrei ertönte mitten im Gerichtshof: der Schrei der Diana de Fargas, die ihren Triumph auskostete.
›Madame‹, sagte mein Bruder mit einer Verbeugung zu der Dame, die ihn wiedererkannt hatte, ›Sie haben soeben vier Köpfe auf einmal rollen lassen.‹
Als sie erkannte, was sie angerichtet hatte, warf die Dame sich auf die Knie und bat um Verzeihung.
Zu spät!
Ich war im Gerichtshof und hätte fast das Bewusstsein verloren. Meine Liebe zu meinem Bruder war der Sohnesliebe nahe.
Noch am selben Tag wurden die Gefangenen, die ihre ganze Fröhlichkeit wiedererlangt hatten und nichts mehr abstritten, zum Tode verurteilt.
Drei der Angeklagten weigerten sich, gegen das Urteil Berufung einzulegen, während Jahiat, der vierte, hartnäckig darauf beharrte und sagte, er habe einen Plan. Um von seinen Gefährten nicht verdächtigt zu werden, aus Angst vor dem Sterben so zu handeln, erklärte er ihnen, er habe zarte Bande zu der Tochter des Gefängniswärters geknüpft und hoffe, während der Frist von sechs oder acht Wochen, die ihnen die Berufung verschaffen würde, durch sie eine Fluchtmöglichkeit zu finden.
Die drei anderen machten keine Schwierigkeiten mehr und unterzeichneten ihre Berufungsgesuche.
Bei dem Gedanken an eine eventuelle Flucht klammerte sich jede dieser jungen Seelen wieder an das Leben. Nicht dass sie den Tod gefürchtet hätten, doch ein Tod auf dem Schafott bot keinen Reiz und keinen Ruhm. Also ließen sie Jahiat zum Nutzen und Frommen ihres Zirkels seinem Verführungsvorhaben nachgehen und bemühten sich, so fröhlich wie möglich zu leben.
Die Berufung, die nur ein Kassationsgesuch war, ließ ihnen keinerlei Hoffnung: Der Erste Konsul hatte sich unmissverständlich geäußert; er wollte all diese Banden um jeden Preis vernichten und ausrotten.
Zur großen Verzweiflung der ganzen Stadt waren unsere Helden, die jedermanns Sympathie hatten, dem Tod geweiht. Ich ließ nichts unversucht, um zu meinem Bruder zu gelangen, doch vergebens.
Die Sympathie, die den Angeklagten entgegengebracht wurde, konnte wahrhaftig nicht verwundern: Sie waren jung, strahlend schön, bewundernswert elegant, selbstsicher, ohne arrogant zu sein, liebenswürdig zum Publikum und höflich zu ihren Richtern, wenn auch bisweilen spöttisch. Und sie entstammten den vornehmsten Familien der Gegend.
Diese vier Angeklagten, deren Ältester keine dreißig Jahre alt war, die sich gegen die Guillotine wehrten, aber nicht gegen das Füsilieren, die den Tod verlangten, die zugaben, ihn verdient zu haben, allerdings den Tod eines Soldaten, waren bewundernswert in ihrer Jugend, ihrem Mut und ihrer Großherzigkeit.
Wie man sich denken kann, wurde die Berufung abgelehnt.
Jahiat war es gelungen, Charlotte, die Tochter des Gefängniswärters, in ihn verliebt zu machen, doch der Einfluss des schönen Kindes reichte nicht aus, um den Gefangenen einen Weg zur Flucht zu verschaffen. Nicht dass der Oberwärter, ein wackerer Mann namens Comtois, im Herzen Royalist, doch vor allem ein redlicher Mann, die Angeklagten nicht zutiefst bedauert hätte. Einen Arm hätte er geopfert, um Ungemach von ihnen abzuhalten, doch er war nicht bereit, sich mit sechzigtausend Francs bestechen zu lassen, um ihnen die Flucht zu ermöglichen.
Drei Gewehrschüsse verrieten den Verurteilten, dass ihr Urteil nicht aufgehoben worden war.
Am Abend desselben Tages brachte Charlotte jedem der Gefangenen ein Paar geladene Pistolen und einen Dolch in ihr Verlies; mehr konnte das arme Kind nicht für sie tun.
Die drei Gewehrschüsse, die den Verurteilten ihr Schicksal mitteilten, hatten den Polizeikommissar erschreckt, der alle Bewaffneten zusammenzog, deren er habhaft werden konnte.
Um sechs Uhr morgens wurde auf der Place du Bastion das Schafott errichtet; sechzig Kavalleristen hatten vor dem Gitter des Gefängnishofs Aufstellung genommen. Hinter den Kavalleristen drängten sich an die tausend Zuschauer.
Die Hinrichtung war für sieben Uhr vorgesehen. Um sechs Uhr betraten die Gefängniswärter das Verlies der Gefangenen, die sie am Abend unbewaffnet und in Ketten zurückgelassen hatten. Die Gefangenen waren ohne Fesseln und bis zu den Zähnen bewaffnet. Zudem hatten sie sich wie Athleten für den Kampf gerüstet: den Oberkörper entblößt, die Hosenträger auf der Brust gekreuzt, die breiten Gürtel um die Taille mit Waffen gespickt.
In dem Augenblick, in dem am wenigsten damit zu rechnen war, wurde Kampfgetümmel laut. Dann sah man die vier Gefangenen aus dem Kerker stürmen.
Die Menge schrie auf wie ein Mann; jeder begriff, dass etwas Schreckliches bevorstand, als man die vier erblickte, Gladiatoren gleich, die in die Arena treten.
Es gelang mir, in die erste Reihe vorzudringen.
Als sie den Hof erreichten, sahen sie, dass das riesige Eisengitter geschlossen war und hinter dem Gitter auf der Straße die reglose Reihe der berittenen Gendarmen mit den Karabinern auf den Knien ein unüberwindliches Hindernis bildete. Sie blieben stehen, traten zusammen und schienen sich kurz zu beraten.
Dann trat Valensolles, der Älteste der vier, an das Gitter und verneigte sich mit einem anmutigen Lächeln voller Noblesse vor den Kavalleristen: ›Wohlan, denn, meine Herren.‹ Dann drehte er sich zu seinen Gefährten um: ›Adieu, meine Freunde‹, sagte er. Und er schoss sich in die Schläfe. Sein Leichnam drehte sich dreimal um sich selbst und fiel mit dem Gesicht zu Boden.
Daraufhin löste sich Jahiat aus der Gruppe, trat an das Gitter, zog seine zwei Pistolen und richtete sie auf die Gendarmen. Er drückte nicht ab, doch mehrere Gendarmen, die sich bedroht wähnten, senkten ihre Karabiner und feuerten. Zwei Kugeln durchschlugen Jahiats Körper.
›Danke, meine Herren‹, sagte er. ›Ich danke Ihnen, dass ich als Soldat sterben darf.‹ Und er fiel auf den toten Valensolles.
Unterdessen hatte Ribier offenbar überlegt, auf welche Weise er sterben wollte. Nun schien er sich entschieden zu haben.
Eine Säule trug das Gewölbe; Ribier ging auf die Säule zu, zog einen Dolch aus seinem Gürtel, drückte die Dolchspitze an seine linke Brust und den Griff an die Säule, umfasste die Säule mit beiden Armen, verneigte sich zu einem letzten Gruß vor den Zuschauern und danach vor seinen Freunden und presste seinen Körper dann eng an die Säule, bis die ganze Klinge des Dolchs in seiner Brust verschwunden war. Einen Augenblick stand er noch aufrecht, dann überzog Totenblässe sein Antlitz, und seine Arme fielen herab; seine Knie gaben nach, und er sank tot am Fuß der Säule zu Boden.
Die Menge war vor Entsetzen stumm und wie erstarrt.
Die Anwesenden erfasste schier Bewunderung: Sie begriffen, dass diese heldenhaften Banditen sterben wollten, doch einen selbst gewählten Tod, wie antike Gladiatoren, in Würde, nicht schmachvoll.
Mein Bruder stand als Letzter auf den Stufen der Freitreppe; erst in diesem Augenblick gewahrte er mich unter den Zuschauern. Er sah mich an und legte einen Finger vor den Mund. Ich begriff, dass er mir Schweigen gebot. Ich nickte, doch ich konnte mir die Tränen nicht verbeißen. Er machte ein Zeichen, dass er sprechen wolle. Alle verstummten.
Gott allein weiß, mit welchem Schmerz ich auf seine Worte wartete.
Wer einem solchen Schauspiel beiwohnt, ist auf Worte ebenso begierig wie auf Taten, vor allem wenn Erstere Letztere erklären. Ohnehin konnte die Menge sich nicht beklagen: Man hatte ihr vier Köpfe versprochen, die auf die gleiche eintönige Weise fallen sollten. Stattdessen wurden ihr vier unterschiedliche Todesarten geboten, vier geradezu pittoreske, dramatische, überraschende Todeskämpfe – denn niemand zweifelte daran, dass der Anführer sich einen ebenso originellen Tod ausdenken würde wie seine Gefährten.
Charles hielt weder Pistole noch Dolch in der Hand. Beides steckte in seinem Gürtel.
Er umschritt Valensolles’ Leichnam und stellte sich zwischen Jahiat und Ribier. Von dort aus verbeugte er sich lächelnd vor den Zuschauern wie ein Artist von seinem Publikum.
Die Menge brach in Applaus aus.
So schaulustig die Menge war, wage ich dennoch zu behaupten, dass unter ihr kein Einziger weilte, der nicht einen Teil des eigenen Lebens gegeben hätte, um das Leben des letzten Compagnon de Jéhu zu retten.
›Meine Herren‹, sagte Charles, ›Sie sind gekommen, um uns sterben zu sehen; drei von uns sind bereits tot. Nun bin ich an der Reihe. Gerne will ich Ihre Neugier befriedigen, doch ich möchte Ihnen einen Tauschhandel vorschlagen.‹<
›Sprechen Sie! Sprechen Sie!‹, wurde von allen Seiten gerufen. ›Alles, was Sie verlangen, soll Ihnen gewährt werden!‹
›Bis auf Ihr Leben!‹, rief eine Frauenstimme, dieselbe, die bei der Urteilsverkündung einen Freudenschrei ausgestoßen hatte.
›Bis auf mein Leben, selbstverständlich‹, wiederholte mein Bruder. ›Mein Freund Valensolles hat sich erschossen, mein Freund Jahiat wurde erschossen, mein Freund Ribier hat sich erdolcht, und mich würden Sie gerne guillotiniert sehen. Das verstehe ich.‹
Angesichts der Kaltblütigkeit und Gelassenheit, mit der er diese sarkastischen Worte sagte, ging ein Beben durch die Menge.
›Nun‹, sagte Charles, ›gutherzig, wie ich bin, habe ich nichts dagegen, es Ihnen mit dem Sterben ebenso recht zu machen wie mir selbst. Ich bin bereit, mir den Kopf abschneiden zu lassen, aber ich will freiwillig zum Schafott gehen, wie zu einem Essen oder zu einem Ball, und ich bestehe darauf, dass mich niemand anrührt. Wer mir näher kommt‹ – und er deutete auf seine zwei Pistolen – ›auf den schieße ich. Abgesehen von Monsieur‹, sagte Charles und wies auf den Henker, ›aber das geht nur uns beide an und erfordert auf beiden Seiten nichts als gute Umgangsformen. ‹
Das schien der Menge zuzusagen, denn von überall ertönten zustimmende Rufe.
›Hören Sie das?‹, sagte Charles zu dem Gendarmerieoffizier. ›Zeigen Sie sich entgegenkommend, Hauptmann, und es wird keine Schwierigkeiten geben.‹<
Der Gendarmerieoffizier war nur zu bereit, Entgegenkommen zu zeigen. ›Wenn ich Ihnen Hände und Füße nicht fesseln lasse‹, sagte er, ›versprechen Sie dann, nicht zu entfliehen?‹
›Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort‹, sagte Charles.
›Wohlan!‹, sagte der Gendarmerieoffizier, ›dann treten Sie beiseite, und lassen Sie uns die Leichname Ihrer Gefährten mitnehmen.‹
›Das ist nur recht und billig‹, sagte Charles und dann, an die Menge gewendet: ›Sie sehen, nicht ich bin schuld an der Verzögerung, sondern diese Herren sind es.‹ Und er wies auf den Henker und seine zwei Gehilfen, die die Toten in einen Karren luden.
Ribier war noch nicht tot: Er öffnete die Augen. Sein Blick schien jemanden zu suchen. Charles dachte, er suche ihn. Er ergriff seine Hand. ›Hier bin ich, lieber Freund‹, sagte er, ›sei unbesorgt: Ich bin dabei!‹ Ribier schloss die Augen, seine Lippen bewegten sich, doch kein Ton drang aus seinem Mund. Am Rand seiner Wunde kräuselte sich rötlicher Schaum.
›Monsieur de Sainte-Hermine‹, fragte der Offizier, als die Toten und der Halbtote weggeschafft waren, ›sind Sie bereit?‹
›Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Monsieur‹, erwiderte Charles und verneigte sich mit ausgesuchter Höflichkeit.
›Dann kommen Sie.‹
Charles wollte sich unter die Soldaten einreihen.
›Wäre es Ihnen lieber, Monsieur‹, fragte der Offizier, ›den Weg im Wagen zurückzulegen?‹
›Zu Fuß, Monsieur, unbedingt zu Fuß; ich lege Wert darauf, dass man sieht, dass ich mich aus einer Grille heraus guillotinieren lasse. Führe ich im Wagen, könnte man denken, die Furcht wäre mir in die Beine gefahren.‹<
Wie ich vielleicht schon sagte, war die Guillotine auf der Place du Bastion errichtet worden; um dorthin zu gelangen, musste man zuerst die Place des Lices überqueren, die so heißt, weil in früheren Tagen dort Reiterspiele abgehalten wurden, und dann an der Mauer des Gartens des Palais Monbazon entlanggehen.
Der Karren führte den Zug an, gefolgt von einem Dutzend Dragoner. Danach kam der Verurteilte, der hin und wieder zu mir blickte. In einem Abstand von etwa zehn Schritten folgten ihm die Gendarmen unter Leitung ihres Hauptmanns.
Am Ende der Gartenmauer wendete der Zug sich nach links. Durch die Öffnung zwischen dem Garten und der Markthalle erblickte mein Bruder mit einem Mal das Schafott.
Bei diesem Anblick wurden mir die Knie weich.
›Pah!‹, sagte Charles. ›Das ist die erste Guillotine, die ich sehe; ich wusste nicht, dass sie ein so hässliches Ungetüm ist.‹
Und mit einer blitzschnellen Bewegung riss er seinen Dolch aus dem Gürtel und stieß ihn sich bis zum Heft in die Brust.
Der Gendarmeriehauptmann gab seinem Pferd die Sporen und streckte den Arm aus, doch mein Bruder zog eine seiner doppelläufigen Pistolen aus dem Gürtel und zielte auf ihn. ›Halt!‹, rief er, ›es war abgemacht, dass niemand mich berührt. Ich sterbe allein, oder wir sterben zu dritt – Sie haben die Wahl.‹
Der Hauptmann hielt inne und ließ sein Pferd einen Schritt zurück tun.
›Gehen wir weiter‹, sagte mein Bruder und machte sich tatsächlich wieder auf den Weg.
Mit Augen und Ohren hing ich an dem geliebten Opfer und ließ mir kein Wort, keine Geste entgehen; ich erinnerte mich an das, was er Cadoudal geschrieben hatte, als er mich nicht unter ihm dienen lassen wollte, da er mich zu seinem Nachfolger und Rächer bestimmt hatte. In meinem Herzen gelobte ich, alles zu tun, was er von mir verlangte.
Unterdessen ging er weiter; das Blut rann aus seiner Wunde.
Als er das Schafott erreichte, zog Charles den Dolch aus seiner Brust und stieß ihn ein zweites Mal hinein. Er stand noch immer. ›Wahrhaftig‹, rief er zornentbrannt,›man sollte meinen, meine Seele wäre an meinen Körper gefesselt!‹
Die Gehilfen des Henkers hoben Valensolles, Jahiat und Ribier von dem Karren.
Valensolles und Jahiat waren tot, und ihre Köpfe fielen unter der Guillotine, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wurde.
Ribier ließ einen Klagelaut ertönen: Er lebte noch. Als das Fallbeil seinen Kopf abtrennte, floss das Blut in Strömen, und ein Schauer lief durch die Menge.
Nun war mein armer Bruder an der Reihe; er hatte mich zuletzt fast ununterbrochen angesehen.
Die Gehilfen wollten ihm auf das Schafott helfen.
›O nein!‹, sagte er. ›Rührt mich nicht an. So war es ausgemacht.‹ Und er stieg die sechs Stufen hinauf, ohne zu straucheln.
Oben angekommen, riss er den Dolch aus seiner Brust und versetzte sich einen dritten Stich. Dann erklang ein schauriges Lachen aus seinem Mund, und aus den drei Wunden spritzte das Blut.
›Meiner Treu‹, sagte er zu dem Henker, ›mir reicht es jetzt, sieh du, wie du zurechtkommst‹, und mir rief er zu: ›Wirst du dich erinnern, Hector?‹
›Ja, Bruder‹, erwiderte ich.
Und er legte sich freiwillig auf das Brett vor dem Fallbeil.
›So‹, sagte er zu dem Henker, ›ist es so recht?‹
Die einzige Antwort war das Herabsausen des Fallbeils, doch mittels der unbezähmbaren Lebenskraft, die ihm nicht erlaubt hatte, von eigener Hand zu sterben, fiel sein Kopf nicht in den Korb wie die der anderen, sondern sprang darüber hinweg, rollte das ganze Schafott entlang und fiel dann zu Boden.
Ich zwängte mich durch die Reihe der Soldaten, die als Barriere vor der Menge standen und sie von dem Schafott fernhielten, stürzte mich auf den geliebten Kopf, bevor man mich aufhalten konnte, ergriff ihn mit beiden Händen und küsste ihn. Seine Augen öffneten sich für eine Sekunde, seine Lippen bebten unter den meinen.
Oh, ich schwöre es bei Gott, er hatte mich erkannt.
›Ja, ja, ja!‹, sagte ich zu ihm, ›sei unbesorgt, ich werde dir gehorchen.‹<
Die Soldaten wollten mich zuerst fortdrängen, doch einzelne Stimmen riefen: ›Es ist sein Bruder!‹, und man ließ mich in Ruhe.«
19
Hector de Sainte-Hermine
Seit zwei Stunden währte Hectors Bericht. Claire weinte so hemmungslos, dass Hector innehielt, unschlüssig, ob er fortfahren solle. Er schwieg und befragte sie mit dem Blick; auch in seinen Augen standen Tränen.
»Oh, fahren Sie fort, ich bitte Sie!«, sagte Claire.
»Ich würde es mir als Gnade erbitten«, sagte er, »denn von mir war noch nicht die Rede.«
Claire reichte ihm die Hand. »Wie sehr haben Sie gelitten!«, flüsterte sie.
»Warten Sie ab«, sagte er. »Sie werden sehen, es liegt in Ihrer Hand, mich für alles zu entschädigen.
Valensolles, Jahiat und Ribier hatte ich nur flüchtig gekannt, doch durch meinen Bruder, ihren Komplizen und ihren Gefährten im Tod, war ich ihr Freund. Ich erhob Anspruch auf die Leichname und ließ sie bestatten. Danach kehrte ich nach Besançon zurück; ich ordnete meine Familienangelegenheiten und wartete. Worauf ich wartete, wusste ich nicht; auf etwas mir Unbekanntes, das mein Schicksal entscheiden würde.
Ich fühlte mich nicht verpflichtet, mein Schicksal zu suchen, sondern nur, mich ihm zu unterwerfen, sobald es sich zeigte.
Ich war auf alles gefasst.
Eines Morgens wurde mir der Chevalier de Mahalin angekündigt.
Diesen Namen hatte ich noch nie gehört, doch er berührte schmerzlich eine Saite in meinem Herzen, als wäre er mir bekannt.
Es war ein Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren, von untadeliger Haltung und ausgesuchter Höflichkeit. ›Monsieur le Comte‹, sagte er zu mir, ›Sie wissen vielleicht, dass die Compagnons de Jéhu, die so empfindlich getroffen und ihrer vier Anführer beraubt wurden, im Begriff sind, sich wieder zusammenzufinden; ihr Anführer ist der berühmte Laurent, der hinter dieser volkstümlichen Bezeichnung einen der aristokratischsten Adelsnamen ganz Südfrankreichs verbirgt. Ich frage Sie im Auftrag unseres Hauptmanns, der in unserer Truppe einen hochrangigen Platz für Sie vorgesehen hat, ob Sie einer der Unseren werden und so das Wort halten wollen, das Sie Ihrem Bruder gegeben haben.‹<
›Monsieur le Chevalier‹, sagte ich, ›es hieße lügen, wollte ich behaupten, dass ich für dieses Leben eines fahrenden Ritters recht große Begeisterung aufbrächte, doch ich habe mein Wort meinem Bruder verpfändet, wie er mir das seine verpfändet hatte; ich bin bereit.‹
›Soll ich Ihnen nur den Ort unseres Sammelns nennen‹, fragte der Chevalier de Mahalin, ›oder wollen Sie mich begleiten?‹
›Ich werde Sie begleiten, Monsieur.‹
Ich hatte einen Diener, der mein Vertrauen genoss, einen gewissen Saint-Bris, der schon unter meinem Bruder gedient hatte. Ihm übertrug ich die Verwaltung des Hauses und meiner Angelegenheiten. Ich ergriff meine Waffen, bestieg mein Pferd und ritt davon.
Unser Sammelort befand sich zwischen Vizille und Grenoble.
Nach zwei Tagen hatten wir ihn erreicht.
Laurent, unser Anführer, war seines Rufes wahrhaft würdig.
Er war ein Mensch, zu dessen Taufe Feen eingeladen waren, die ihm jede eine gute Eigenschaft zum Geschenk machte, doch die eine Fee, die vergessen wurde, hatte sich mit einem Charaktermangel gerächt, der alle Tugenden aufwog. Seiner überaus südländischen und folglich überaus männlichen Schönheit – denn südländisch bedeutet schwarze Augen, schwarze Haare, schwarzer Bart -, dieser überaus südländischen Schönheit gesellte sich ein bezaubernder Ausdruck von Güte und Herzlichkeit bei. Nach einer stürmischen Jugend sich selbst überlassen, hatte er keine solide Bildung erhalten, doch er besaß Lebensart, Ungezwungenheit, die Umgangsformen des Edelmannes, die durch nichts zu ersetzen sind, und jene unwiderstehliche Anziehungskraft, der man nachgibt, ohne zu wissen, warum. Zugleich aber war er von heftiger Wesensart und so aufbrausend, dass es jeder Beschreibung spottete; seine vornehme Erziehung half ihm, diese Unbeherrschtheit eine Zeit lang zu zügeln, doch unversehens brach sie sich immer wieder Bahn, und der zornentbrannte Laurent hatte nichts Menschliches mehr an sich. Dann zirkulierten die Worte: ›Laurent ist tobsüchtig, das wird Tote geben.‹
Die Justiz hatte sich mit Laurents Bande beschäftigt, wie sie es mit Saint-Hermines Bande getan hatte. Gewaltige Streitkräfte wurden eingesetzt; Laurent und einundsiebzig seiner Männer wurden gefasst und nach Yssingeaux geschafft, wo sie sich für ihre Taten und Untaten vor einem Sondergerichtshof verantworten sollten, der eigens im Departement Haute-Loire einberufen worden war, um über sie zu richten.
Doch zu jener Zeit weilte Bonaparte noch in Ägypten, und die Macht lag in zitternden Händen. Die Kleinstadt Yssingeaux empfing eine Garnison, nicht Gefangene. Die Anklage war kleinlaut, Zeugenaussagen waren ängstlich, die Verteidigung war tollkühn.
Laurent hatte die Verteidigung übernommen, und er beschuldigte sich aller ihnen zur Last gelegten Taten. Seine einundsiebzig Gefährten wurden freigesprochen, er allein wurde zum Tode verurteilt.
Er ging so sorglos in das Gefängnis zurück, wie er es verlassen hatte. Doch die überwältigende Schönheit, mit der die Natur ihn bedacht hatte, diese körperliche Empfehlung, wie Montaigne sie nennt, hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Alle Frauen betrauerten sein Los, und bei manchen hatte sich das Mitleid zu einem zärtlicheren Gefühl gesteigert.
Die Tochter des Gefängniswärters zählte zu Letzteren, ohne dass er dies wusste; zwei Stunden nach Mitternacht wurde Laurents Verlies geöffnet wie das des Piero de Medici, und wie das Mädchen aus Ferrara flüsterte ihm das Mädchen aus Yssingeaux die süßen Worte zu: Non temo nulla, bentivoglio! (Fürchte nichts, ich liebe dich!)
Diesen rettenden Engel hatte Laurent bisher nur durch die Gitterstäbe seiner Zelle gesehen, doch Herz und Sinne des Mädchens hatte er mit der ihm eigenen Anziehungskraft bezaubert.
Wenige Worte wurden gesprochen, Ringe wurden gewechselt, und Laurent war frei. Ein Pferd wartete im Nachbardorf, wo seine Verlobte sich ihm anschließen sollte. Der Tag brach an.
Während seiner Flucht hatte Laurent in der Morgendämmerung den Henker und seine Gehilfen das schauerliche Gerüst errichten sehen.
Die Hinrichtung war auf zehn Uhr vormittags festgesetzt worden; man hatte sich mit dem Termin beeilt, denn am Tag nach dem Urteilsspruch war Markttag, und man wollte die Hinrichtung in Anwesenheit möglichst vieler Bauern aus den umliegenden Dörfern abhalten.
Und als die ersten Sonnenstrahlen die fertig aufgebaute Guillotine auf dem Platz beschienen und sich herumsprach, wer der berühmte arme Sünder war, der sie besteigen sollte, dachte niemand mehr an den Markt, sondern alle Gedanken richteten sich auf die Hinrichtung.
Unterdessen wartete Laurent im Nachbardorf voller Unruhe – nicht ob des eigenen Schicksals, sondern um derjenigen willen, die ihn gerettet hatte und die nicht kam, aufgehalten durch einen zufälligen Umstand. Laurent verlor die Geduld und erkundete zu Pferde die Gegend um Yssingeaux, wobei er sich der Ortschaft immer mehr näherte, bis er zuletzt Opfer seiner Erregung wurde, die sich nicht mehr zügeln ließ, und jede Vorsicht über Bord warf: Er glaubte, diejenige, auf die er vergeblich wartete, sei bei ihrer Flucht überrascht worden und müsse nun möglicherweise als seine Komplizin die Strafe erleiden, die für ihn bestimmt gewesen war. Er reitet in die Stadt, treibt sein Pferd zum Galopp an, vorbei an den Menschengruppen und unter den erstaunten Ausrufen all derer, die den Gefangenen, dessen Guillotinierung sie beizuwohnen gedacht hatten, frei und zu Pferde sehen, kreuzt die Gendarmen, die ihn aus dem Gefängnis holen wollten, erreicht den Platz mit der wartenden Guillotine, macht die Gesuchte ausfindig, bahnt sich einen Weg zu ihr, hebt sie unter den Achseln hoch, wirft sie hinter sich auf das Pferd und verschwindet im Galopp unter dem Beifall all jener, die sich versammelt hatten, um seine Enthauptung zu beklatschen, und nun stattdessen seine Flucht und seine Rettung beklatschen.
So war unser Anführer, so war der Nachfolger meines Bruders, so war der Mann, unter dem ich das Waffenhandwerk erlernte.
Drei Monate lang führte ich dieses aufregende Leben, schlief im Mantel, das Gewehr in der Hand, die Pistolen im Gürtel. Dann verbreitete sich das Gerücht von einem Waffenstillstand. Ich kam nach Paris, nachdem ich versprochen hatte, bei der ersten Aufforderung zu meinen Gefährten zurückzukehren. Ich hatte Sie gesehen – verzeihen Sie, dass ich mir dieses Geständnis erlaube – und musste Sie wiedersehen.
Ich sah Sie wieder; und falls Ihr Blick zufällig auf mir verharrt haben sollte, entsinnen Sie sich gewiss meiner tiefen Traurigkeit und meiner Gleichgültigkeit oder beinahe Abneigung gegenüber allen Freuden und Vergnügungen.
Wie hätte ich in meiner unsicheren Lage, in der ich nicht dem eigenen Gewissen folgte, sondern einer schicksalhaften, absoluten, unausweichlichen Bestimmung, in der ich jederzeit bei einem Überfall auf eine Eilpost getötet oder verwundet werden konnte oder, schlimmer noch, gefangen genommen – wie hätte ich mich in dieser Lage erdreisten können, zu einem stillen und sanften jungen Mädchen, einer Blume jener Welt, in der sie erblüht und deren Gesetze sie befolgt, zu einem solchen Mädchen zu sagen: ›Ich liebe Sie, wollen Sie einen Ehemann, der sich selbst für vogelfrei erklärt hat und für den das größte Glück darin bestünde, kaltblütig mit einem Gewehrschuss getötet zu werden?‹
Nein, ich begnügte mich damit, Sie zu sehen, mich an Ihrem Anblick zu berauschen, mich überall dort einzufinden, wo Sie anzutreffen waren, Gott anzuflehen, den Waffenstillstand in einen Frieden zu verwandeln, ohne zu hoffen, dass er ein solches Wunder wirken würde!
Vor wenigen Tagen nun kündeten die Zeitungen von Cadoudals Ankunft in Paris und von seiner Unterredung mit dem Ersten Konsul; am selben Abend hieß es in denselben Zeitungen, der bretonische General habe sein Wort gegeben, nicht mehr gegen Frankreich zu kämpfen, wenn der Erste Konsul seinerseits nicht mehr gegen die Bretagne und ihn kämpfen werde.
Und am Tag darauf« – Hector holte ein Blatt Papier aus der Tasche – »am Tag darauf erhielt ich diesen Rundbrief von Cadoudals eigener Hand:
Da ein fortwährender Krieg mir Frankreich ins Unglück zu stürzen und mein Land zu zerstören schien, entbinde ich Euch von dem Treueschwur, den Ihr geleistet habt und auf den ich mich nur dann erneut berufen würde, wenn die französische Regierung das Wort bräche, das sie mir gegeben hat und das ich in Eurem Namen wie in meinem Namen angenommen habe.
Sollte sich hinter einem geheuchelten Frieden Verrat verbergen, würde ich abermals an Eure Treue appellieren, und auf Eure Treue, das weiß ich mit Gewissheit, wäre Verlass.
GEORGES CADOUDAL
Stellen Sie sich meine Freude vor, als ich diese ersehnte Beurlaubung erhielt. Ich war wieder im Besitz meiner selbst und nicht mehr von meinem Vater und meinen Brüdern einem Königshaus verpfändet, das ich nur durch die Hingabe meiner Familie und die Unglücksfälle kannte, die diese Hingabe über uns gebracht hat. Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, ich besaß hunderttausend Francs Rente, ich liebte! Und dürfte ich annehmen, dass meine Liebe erwidert wird, stünde mir die Paradiespforte offen, die bis dahin der Würgeengel bewacht hatte. O Claire, Claire, deshalb sah ich so fröhlich aus auf dem Ball der Madame de Permon. Ich konnte Sie um dieses Gespräch bitten; ich konnte Ihnen gestehen, dass ich Sie liebe.«
Claire senkte den Blick und schwieg. Das war fast eine Antwort.
»Alles, was ich Ihnen soeben erzählt habe«, fuhr Hector fort, »ist über unsere Gegend hinaus nicht bekannt; in Paris weiß niemand davon. Ich hätte es Ihnen verschweigen können, doch das wollte ich nicht. Ich wollte Ihnen mein ganzes Leben erzählen, Ihnen erklären, welche Schicksalsfügung mich dazu gebracht hat, Ihnen endlich alles zu sagen und auf einen Freispruch aus Ihrem Mund zu hoffen, falls ich mich eines Vergehens oder gar eines Verbrechens schuldig gemacht haben sollte.«
»Oh, mein teurer Hector!«, rief Claire, überwältigt von der stummen Leidenschaft, die sie seit fast einem Jahr beherrschte. »O ja, ich verzeihe Ihnen, ich spreche Sie frei...«, und vergessend, dass ihre Mutter zusah: »Ich liebe Sie!«, und sie warf ihm die Arme um den Hals.
»Claire!«, rief Madame de Sourdis, weniger erzürnt als vor allem erstaunt.
»Mutter!«, erwiderte Claire errötend und vor Scham fast in den Boden versinkend.
»Claire!«, sagte Hector und ergriff ihre Hand. »Vergessen Sie nicht, dass alles, was ich sagte, nur für Ihre Ohren bestimmt war, dass es ein Geheimnis zwischen Ihnen und mir ist, dass ich von niemand anderem Vergebung erwarte, da ich niemand anderen liebe. Vergessen Sie das nie, und vergessen Sie vor allem nicht, dass ich erst dann wirklich leben werde, wenn Ihre Mutter die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, beantwortet haben wird. Claire, Sie haben gesagt, dass Sie mich lieben, und ich stelle unser Glück unter den Schutz Ihrer Liebe.«
Und er verließ das Haus, ohne jemandem zu begegnen, so frei und fröhlich wie ein Gefangener, dem das Leben geschenkt wurde.
Madame de Sourdis erwartete ungeduldig ihre Tochter. Claires Unbesonnenheit, sich dem jungen Grafen von Sainte-Hermine in die Arme zu werfen, hatte sie aufs Höchste befremdet. Sie erwartete eine Erklärung.
Die Erklärung war kurz und unmissverständlich. Als das junge Mädchen vor seiner Mutter stand, fiel es auf die Knie und sagte nur die Worte: »Ich liebe ihn!«
Die Natur bildet unseren Charakter für die Epochen, die er zu durchleben hat. Die Epoche, die soeben durchlebt worden war, lieferte dafür ein schlagendes Beispiel; dieser angeborenen Willensstärke verdankten es Charlotte Corday und Madame Roland, dass die eine zu Marat, die andere zu Robespierre sagen konnten: »Ich hasse dich«, während Claire zu Hector sagen konnte: »Ich liebe dich.«
Ihre Mutter hob sie auf, hieß sie neben sich Platz nehmen und fragte sie aus, doch sie erfuhr nur Folgendes:
»Meine geliebte Mutter, Hector hat mir ein Familiengeheimnis verraten, das er seiner Ansicht nach vor aller Welt verbergen muss, mit Ausnahme jener, die er zu seiner Frau machen will; und diejenige bin ich. Er bittet Sie um die Gunst, ihm Gehör zu schenken, damit er Sie um meine Hand bitten kann, und ich wünsche es mir so sehnlich wie er; er ist ungebunden, er hat hunderttausend Francs Rente, wir lieben einander; die Entscheidung liegt bei Ihnen, Mutter, aber eine abschlägige Antwort würde ihn und mich ins Unglück stürzen!«
Nachdem sie all das entschieden und zugleich ehrerbietig gesagt hatte, verneigte Claire sich vor ihrer Mutter und trat einen Schritt zurück.
»Und wenn ich einverstanden bin?«, fragte Madame de Sourdis.
»Oh, Mutter!« rief Claire und warf sich ihr in die Arme. »Wie gütig Sie sind und wie sehr ich Sie liebe!«
»Und jetzt, da ich dein Herz beruhigt habe, setze dich, damit wir uns vernünftig unterhalten können«, sagte Madame de Sourdis.
Sie setzte sich auf ein Kanapee, und Claire nahm ihr gegenüber auf einem Kissen Platz, die Hände in den Händen ihrer Mutter.
»Mutter, ich höre Ihnen zu«, sagte Claire selig lächelnd.
»In Zeiten wie den unseren«, sagte Madame de Sourdis, »ist es unumgänglich, der einen oder anderen Partei anzugehören. Ich vermute, dass Hector de Sainte-Hermine der royalistischen Partei angehört. Gestern unterhielten wir uns mit deinem Patenonkel Doktor Cabanis, der nicht nur ein herausragender Heilkundiger ist, sondern auch ein überaus kluger Mann. Er hat mich zu der Freundschaft beglückwünscht, die Madame Bonaparte mir bezeigt, und lässt dir empfehlen, die Freundschaft zu ihrer Tochter zu pflegen, denn dort liegt seiner Ansicht nach die Zukunft.
Cabanis ist Hausarzt des Ersten Konsuls; er hält ihn für einen Mann mit weitgesteckten Zielen, der sich nicht mit dem zufriedengeben wird, was er bisher erreicht hat. Einen 18. Brumaire wagt man nicht um den Sessel eines Konsuls willen, sondern um den Thron zu erlangen.
Jene, die sich seinem Glücksflug anschließen, bevor die Wolke zerstoben ist, die uns die Zukunft verbirgt, werden mit ihm vom Wirbel seines Geschicks großen Dingen entgegengetragen. Er hat eine Vorliebe für große, für reiche Familien, die er um sich schart; in dieser Hinsicht gibt es an Sainte-Hermine nichts auszusetzen, er hat hunderttausend Francs Rente und kann seine Herkunft bis zu den Kreuzzügen zurückverfolgen; seine ganze Familie ist für die royalistische Sache gestorben, anders gesagt: Sie muss ihn nicht mehr kümmern. Er ist im richtigen Alter, um mit den politischen Ereignissen noch nichts zu tun zu haben. Er hat sich keiner Seite verpflichtet, sein Vater und seine Brüder sind für das alte Frankreich gestorben. An ihm ist es nun, für das neue Frankreich zu leben, indem er eine Position unter dem Ersten Konsul ausfüllt. Vergiss bitte nicht, dass ich diese Schritte in eine neue Richtung seiner Gefühle keineswegs zu einer Bedingung für eure Heirat mache. Es wäre mir eine große Freude, Hector auf unserer Seite zu sehen; doch wenn er sich dem verweigert, dann weil sein Gewissen es ihm gebietet, und das Gewissen des Menschen ist nur Gott Rechenschaft schuldig; der Ehemann meines Kindes und mein geliebter Schwiegersohn wird er dennoch sein.«
»Wann darf ich ihm schreiben, Mutter?«, fragte Claire.
»Wann du willst, mein Kind«, erwiderte Madame de Sourdis.
Claire schrieb am selben Abend, und am nächsten Tag klopfte Hector kurz vor der Mittagsstunde, das heißt so früh, wie irgend schicklich war, an die Tür des Stadtpalais.
Diesmal wurde er zu Madame de Sourdis geführt, die ihm die Arme wie eine Mutter entgegenstreckte.
Er drückte sie an sein Herz, als Claire die Tür öffnete und bei dem Anblick ihrer Umarmung ausrief: »O Mutter, ich bin so glücklich!«
Madame de Sourdis öffnete abermals die Arme und hielt beide Kinder an ihr Herz gedrückt.
Die Heirat war beschlossene Sache; nun musste mit dem jungen Grafen nur noch die Frage seiner Haltung zu dem Ersten Konsul erörtert werden.
Hector setzte sich auf das Kanapee zwischen Madame de Sourdis und Claire und hielt die Rechte und die Linke seiner Schwiegermutter und seiner Verlobten.
Claire erläuterte Hector die Ansicht Cabanis’ über Bonaparte und den Vorschlag ihrer Mutter. Hector betrachtete sie mit ungeminderter Aufmerksamkeit, während sie so wortgetreu wie möglich wiederholte, was Madame de Sourdis am Vorabend zu ihr gesagt hatte.
Als sie ausgesprochen hatte, verneigte Hector sich vor Madame de Sourdis und sagte zu Claire, die er noch eindringlicher ansah als zuvor: »Claire, versetzen Sie sich nach allem, was ich Ihnen gestern erzählt habe – und ich bedaure nicht, dass ich so weitschweifig war -, ganz und gar an meine Stelle und antworten Sie Ihrer Mutter an meiner statt. Ihre Antwort wird die meine sein.«
Das junge Mädchen überlegte für einen Augenblick; dann warf sie sich ihrer Mutter in die Arme. »Ach, Mutter!«, rief sie und schüttelte den Kopf. »Er kann nicht! Das Blut seines Bruders trennt sie.«
Madame de Sourdis senkte den Kopf; unstreitig erlitt sie eine spürbare Enttäuschung. Sie hatte sich für ihren Schwiegersohn eine hohe Stellung in der Armee erträumt und für ihre Tochter eine hohe Position bei Hofe.
»Madame«, sagte Hector, »glauben Sie bitte nicht, ich zählte zu jenen, die sich damit brüsten, das alte Regime auf Kosten des neuen zu rühmen, oder dass ich für die Verdienste des Ersten Konsuls blind wäre. Bei Madame Permon sah ich ihn neulich zum ersten Mal, und ich fühlte mich von ihm angezogen und nicht etwa abgestoßen. Ich bewundere seine Feldzüge von 1796 und 1797 als Meisterleistungen moderner Strategie und Feldherrnkunst. Weniger Begeisterung bringe ich dem Ägyptenfeldzug entgegen, das muß ich gestehen, denn er konnte kein glückliches Ergebnis zeitigen und war nur die Maske, die unermessliche Ruhmsucht kaschieren sollte. Bonaparte hatte gekämpft und gesiegt, wo Marius und Pompejus gekämpft und gesiegt hatten. Er wollte ein Echo wecken, das seit den Namen Alexanders und Cäsars verstummt war, und das war verlockend, doch ein teurer Traum, der sein Land hundert Millionen und dreißigtausend Männer kostete! Der letzte Feldzug, die Schlacht von Marengo, wurde aus privatem Ehrgeiz unternommen, um den 18. Brumaire zu legitimieren und um die ausländischen Regierungen zu nötigen, die französische Regierung anzuerkennen. Jedermann weiß, dass Bonaparte sich bei Marengo nicht mit Ruhm bedeckt hat, sondern nur Glück im Spiel hatte, denn als er im Begriff stand, die Partie zu verlieren, hielt er zwei Asse in der Hand – und was für Asse! -, Kellermann und Desaix. Der 18. Brumaire wiederum war ein Handstreich, dessen Gelingen den Anstifter keineswegs rechtfertigt. Denkt man sich ein Scheitern statt des Erfolgs, wäre dieser Versuch der Regierungsumstürzung nur eine Rebellion, ein Verbrechen an der Nation, und das hätte die Familie Bonaparte mindestens drei Köpfe gekostet. Der Zufall war ihm gewogen, als er aus Alexandria zurückkehrte, der Zufall war auf seiner Seite bei Marengo, die Kühnheit war in Saint-Cloud seine Rettung; doch kein besonnener und leidenschaftsloser Mann wird drei Blitzschläge für das Morgengrauen eines neuen Tages halten, mögen sie noch strahlend leuchten. Wäre ich völlig unbelastet von meiner Herkunft, wäre meine Familie nicht zutiefst verwurzelt in royalistischer Erde, dann stünde ich nicht an, mich der Karriere dieses Mannes anzuschließen, obwohl ich in ihm nichts anderes sehe als einen kühnen Abenteurer, der ein einziges Mal für Frankreich in den Krieg zog, während er die anderen Male Krieg im eigenen Interesse führte. Und um Ihnen zu beweisen, dass ich nicht voreingenommen bin, verspreche ich Ihnen, dass ich mich bei seinem ersten Unternehmen zum Wohle Frankreichs vorbehaltlos seiner Sache anschließen werde, denn bereitwillig räume ich ein, dass ich zu meinem eigenen Erstaunen, obwohl ich seinetwegen den Tod meines Bruders beklagen muss und trotz seiner Fehler Bewunderung für ihn empfinde und ihn unwillkürlich schätze; das macht der Einfluss, den besondere Naturen auf die Menschen ihrer Umgebung ausüben und dem ich unterliege.«
»Ich verstehe«, sagte Madame de Sourdis, »doch um eine Sache will ich Sie bitten.«
»Sie können mich um nichts bitten, ich habe Ihnen zu gehorchen.«
»Gestatten Sie, dass ich die Einwilligung des Ersten Konsuls und Madame Bonapartes zu Claires Eheschließung einhole? Ich bin mit Madame Bonaparte freundschaftlich so eng verbunden, dass ich es tun muss. Alles andere wäre unhöflich.«
»Sicherlich, doch unter der Bedingung, dass wir darauf verzichten, wenn sie sie verweigern.«
»Wenn sie sie verweigern, können Sie Claire entführen, und ich werde Ihnen die Entführung verzeihen und Sie besuchen, wo Sie auch weilen mögen, doch seien Sie unbesorgt, sie werden sie nicht verweigern.«
Und so wurde Madame de Sourdis erlaubt, den Ersten Konsul und Madame Bonaparte um ihre Einwilligung zu der Heirat von Mademoiselle Claire und dem Grafen Hector de Sainte-Hermine zu bitten.
20
Fouché
Einen Mann gab es, den Bonaparte im gleichen Maße verabscheute, fürchtete und ertrug. Es ist der Mann, den wir kurz bei Mademoiselle de Fargas sahen, als sie die Bedingungen stellte, unter denen sie die Compagnons de Jéhu ausliefern wollte.
Der Abscheu, den Bonaparte empfand, rührte von dem Instinkt her, mit dem Tiere mehr noch als Menschen vor Dingen zurückscheuen, die ihnen schaden können.
Joseph Fouché, der Polizeiminister, war in der Tat sowohl hässlich als auch schädlich. Selten ist das Hässliche gütig, und Fouchés Moral oder eher Unmoral entsprach völlig seiner Hässlichkeit.
Bonaparte betrachtete Menschen nur als Mittel zum Zweck oder Hindernisse. Für den General Bonaparte war Fouché am 18. Brumaire nützlich gewesen. Für den Ersten Konsul Bonaparte konnte Fouché hinderlich werden. Wer zugunsten des Konsulats gegen das Direktorium konspiriert hatte, konnte zugunsten irgendeiner anderen Regierungsform gegen das Konsulat konspirieren. Fouché musste man also stürzen, nachdem man ihn befördert hatte, was beim gegenwärtigen Stand der Dinge nicht so leicht war. Fouché zählte zu denen, die sich bei ihrem Aufstieg an allen Unebenheiten festhalten, an alle Kanten klammern und auf allen Stufen, die sie erklommen haben, Rückhalt besitzen, weil sie keinen Halt, keine Hilfe je vergessen.
Mit der Republik verband Fouché der Tod des Königs, für den er gestimmt hatte; mit der Terreur verbanden ihn seine blutigen Taten als Konventskommissar in Lyon und Nevers, mit den Thermidorianern verband ihn seine Rolle beim Sturz Robespierres, mit Bonaparte der 18. Brumaire und mit Joséphine deren Angst vor Fouchés Erzfeinden Joseph und Lucien, während ihn mit den Royalisten wiederum die Gefälligkeiten verbanden, die er Einzelnen von ihnen als Polizeiminister erwies, nachdem er als Prokonsul ihre Klasse zerschlagen hatte. Als Herrscher über die öffentliche Meinung hatte er sich einen Teil von ihr dienstbar gemacht, und seine Polizei war weder die Polizei der Regierung noch die Polizei des Ersten Konsuls oder die Polizei aller, was sie hätte sein sollen, sondern schlicht und einfach Fouchés Polizei. In ganz Paris, in ganz Frankreich ließ er durch seine Spitzel und Agenten das Loblied auf seine Gewandtheit in den höchsten Tönen singen; überall wurde von Beweisen seiner unvorstellbaren Schläue und Geschicklichkeit gemunkelt, und der größte Beweis dieser Fähigkeiten war, dass alle an sie glaubten.
Fouché war seit dem 18. Brumaire Polizeiminister; niemand verstand, warum Bonaparte ihm so großen Einfluss zugestand, Bonaparte selbst am allerwenigsten, denn dieser Einfluss ärgerte ihn. Sobald Fouché den Raum verlassen hatte, sobald die geradezu hypnotische Wirkung nachließ, die er ausübte, sträubte sich alles in Bonaparte gegen Fouchés Macht über ihn; er sprach zornig, bitter, boshaft von ihm. Sobald Fouché erschien, kuschte der Löwe, vielleicht nicht gezähmt, aber besänftigt.
Besonders missfiel Bonaparte, dass Fouché sich für seine Pläne künftiger Größe überhaupt nicht erwärmen konnte, ganz im Gegensatz zu Joseph und Lucien, die ihn darin nicht nur unterstützten, sondern ihn dazu anstachelten. Eines Tages hatte er offen mit Fouché darüber gestritten.
»Nehmen Sie sich in Acht«, hatte der Polizeiminister gesagt, »wenn Sie das Königtum wieder einführen, werden Sie den Bourbonen in die Hand spielen, und diese werden eines schönen Tages den Thron besteigen, den Sie wiederrichtet haben werden. Niemand kann sich erdreisten, voraussagen zu wollen, welche Verkettung von Zufällen, Ereignissen und Katastrophen eintreten müsste, um zu einem solchen Ergebnis zu führen, doch es erfordert nicht mehr als gewöhnliche Intelligenz, um zu begreifen, wie lange Sie und Ihr Nachfolger mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Unter dem Ancien Régime, das Sie augenscheinlich ansteuern – wenn nicht im Grundsätzlichen, dann zumindest in der Form -, wird die Anwartschaft auf den Thron Familiensache sein und nicht eine Frage der Regierungsart. Wenn Frankreich schon auf die errungene Freiheit verzichten und sich wieder der monarchistischen Willkürherrschaft beugen soll, warum sollte es dann nicht gleich das alte Herrschergeschlecht zurückhaben wollen, das ihm Heinrich IV. und Ludwig XIV. geschenkt hat, während Sie ihm nur die Tyrannei des Schwertes gaben?«
Bonaparte hatte zugehört und sich dabei auf die Lippen gebissen, doch er hatte zugehört. Aber insgeheim hatte er beschlossen, das Polizeiministerium aufzulösen, und da er sich am selben Tag nach Mortefontaine begab, um den Montag mit seinem Bruder Joseph zu verbringen, hatte er Josephs und Luciens Drängen nachgegeben und das erforderliche Dekret unterzeichnet, hatte es eingesteckt und sich am nächsten Tag voller Zufriedenheit mit seinem Entschluss und im Wissen, welcher Schlag dies für Joséphine sein würde, nach Paris zurückbegeben. Er war besonders reizend zu ihr. Das ermutigte die arme Frau, die in Fröhlichkeit wie Traurigkeit, Übellaunigkeit wie Munterkeit ihres Mannes nur die Scheidung lauern sah; und als er in ihrem Boudoir saß und Bourrienne Anordnungen erteilte, huschte sie leise neben ihn, setzte sich ihm auf die Knie, fuhr ihm zärtlich mit den Fingern durch die Haare, verharrte mit der Hand auf seinem Mund, damit er sie küsste, und sagte, als sie auf ihrer heißen Hand den ersehnten Kuß spürte: »Warum hast du mich gestern nicht mitgenommen?«
»Wohin?«, fragte Bonaparte.
»Nun, dorthin, wo du warst.«
»Ich war in Mortefontaine, und da ich weiß, dass zwischen dir und Joseph eine gewisse Feindseligkeit besteht...«
»Oh, du kannst ruhig auch sagen: zwischen Lucien und mir. Ich sage, zwischen Lucien und mir, weil sie mich feindselig behandeln. Ich bin niemandem gegenüber feindselig. Ich würde deine Brüder nur zu gerne lieben, aber sie können mich nicht leiden. Nun denn! Du wirst verstehen, wie besorgt ich bin, wenn ich dich bei ihnen weiß.«
»Sei unbesorgt, gestern war nur von Politik die Rede.«
»Ja, von Politik wie zwischen Cäsar und Mark Anton: Sie haben dich die königliche Augenbinde anprobieren lassen.«
»Wie? So gut kennst du dich in der römischen Geschichte aus?«
»Teurer Freund, ich lese von der ganzen römischen Geschichte nur die des Cäsar, und jedes Mal, wenn ich sie lese, muss ich zittern.«
Schweigen trat ein, und Bonaparte runzelte die Stirn; doch da Joséphine begonnen hatte, sprach sie todesmutig weiter.
»Ich flehe dich an, Bonaparte«, sagte sie, »ich flehe dich an, lass dich nicht zum König ernennen. Hinter alledem steckt nur dieser garstige Lucien, höre nicht auf ihn; er stürzt uns noch alle ins Verderben.«
Bourrienne, der seinem einstigen Mitschüler oft genug den gleichen Rat gegeben hatte, erbleichte vor Furcht, dass Bonaparte in Zorn geraten könne.
Doch dieser brach ganz im Gegenteil in Gelächter aus. »Du bist verrückt, meine arme Joséphine«, sagte er. »Diese Ammenmärchen reden dir deine alten Weiber aus dem Faubourg Saint-Germain ein, deine La Rochefoucauld und wie sie alle heißen. Du langweilst mich, verschone mich mit diesem Gerede!«
Im selben Augenblick wurde der Polizeiminister angekündigt.
»Haben Sie etwas mit ihm zu besprechen?«, fragte Bonaparte.
»Nein«, erwiderte Joséphine. »Sicherlich wollte er Sie aufsuchen und hat die Gelegenheit genutzt, um mich zu begrüßen.«
»Wenn Sie fertig sind, schicken Sie ihn zu mir«, sagte Bonaparte und erhob sich, »komm, Bourrienne.«
»Wenn Sie nichts Geheimes mit ihm zu besprechen haben, empfangen Sie ihn hier, dann bleibt mir Ihre Gesellschaft länger erhalten.«
»Ich vergaß wahrhaftig«, sagte Bonaparte, »dass Fouché zu Ihren Freunden zählt.«
»Zu meinen Freunden?«, wiederholte Joséphine. »Ich erlaube mir nicht, Freunde unter Ihren Ministern zu haben.«
»Oh«, sagte Bonaparte, »das wird er nicht mehr lange sein. Nein, ich habe nichts Geheimes mit ihm zu besprechen«, und mit perfider Miene sagte er zu Constant, der Fouché angekündigt hatte: »Lassen Sie den Polizeiminister herein.«
Fouché erschien und wirkte überrascht, Bonaparte bei seiner Gemahlin anzutreffen.
»Madame«, sagte Fouché, »heute Vormittag habe ich nicht mit dem Ersten Konsul zu tun, sondern mit Ihnen.«
»Mit mir?«, fragte Joséphine erstaunt und beinahe erschrocken.
»Oho!«, sagte Bonaparte und zwickte lachend das Ohr seiner Frau, was anzeigte, dass er wieder guter Laune war. Joséphine stiegen Tränen in die Augen, denn diese Gunstbezeigung Bonapartes war fast immer, vielleicht unbeabsichtigt, ausgesprochen schmerzhaft. Doch tapfer lächelte sie weiter.
»Ich hatte gestern«, sagte Fouché, »Besuch von Doktor Cabanis.«
»Du lieber Himmel!«, sagte Bonaparte. »Und was wollte dieser Philosoph in Ihrer Räuberhöhle?«
»Er wollte wissen, ob ich glaube, dass Sie einer bevorstehenden Heirat in seiner Familie zustimmen würden, bevor man sich offiziell an Sie wendet, und wenn ja, ob Sie sich dann dafür verwenden würden, die Zustimmung des Ersten Konsuls zu erwirken.«
»Ha, ha! Siehst du, Joséphine«, sagte Bonaparte lachend, »man behandelt dich bereits wie eine Königin.«
Joséphine versuchte zu lachen und sagte: »Die dreißig Millionen Franzosen, die in diesem Land leben, können nach eigenem Gutdünken und ohne meinen Segen heiraten; wer treibt es mit der Höflichkeit mir gegenüber gar so weit?«
»Die Gräfin von Sourdis, der Sie die Ehre erweisen, sie bisweilen zu empfangen. Sie verheiratet ihre Tochter Claire.«
»Und mit wem?«
»Mit dem jungen Grafen von Sainte-Hermine.«
»Sagen Sie Cabanis«, antwortete Joséphine, »dass ich von ganzem Herzen ihrem Ehebund zustimme, und sofern Bonaparte nicht spezielle Gründe hat, dies anders zu sehen als ich...«
Bonaparte setzte eine nachdenkliche Miene auf. Dann sagte er zu Fouché: »Kommen Sie zu mir, wenn Sie bei Madame waren. Komm jetzt, Bourrienne.« Und er stieg die kleine Treppe hinauf.
Kaum waren Bonaparte und sein Sekretär gegangen, legte Joséphine Fouché die Hand auf den Arm. »Er war gestern in Mortefontaine«, sagte sie.
»Ich weiß«, sagte Fouché.
»Wissen Sie, worüber er mit seinen Brüdern gesprochen hat?«
»Ja.«
»Ging es um mich? Ging es um die Scheidung?«
»Nein, in dieser Hinsicht können Sie beruhigt sein; es ging um etwas ganz anderes.«
»Ging es um das Königtum?«
»Nein.«
Joséphine atmete auf. »Ah!«, sagte sie. »Dann kümmert mich herzlich wenig, worüber sie gesprochen haben.«
Fouché lächelte sein gewohnt spöttisch-finsteres Lächeln. »Obwohl Sie einen Ihrer Freunde verlieren werden?«, fragte er.
»Ich?«
»Ja.«
»…«
»Zweifellos, denn seine Interessen waren auch Ihre.«
»Und wer ist das?«
»Ich darf Ihnen seinen Namen nicht nennen; sein Sturz ist noch ein Geheimnis. Ich will Ihnen nur vorsorglich raten, einen neuen Freund zu suchen.«
»Und wo soll ich den finden?«
»In der Familie des Ersten Konsuls: Sie haben zwei seiner Brüder gegen sich, nehmen Sie den dritten für sich ein.«
»Louis?«
»Ganz genau.«
»Er will meine Tochter unbedingt mit Duroc verheiraten.«
»Ja, aber Duroc liegt diese Heirat keineswegs so dringend am Herzen, wie man erwarten könnte, und diese Gleichgültigkeit kränkt den Ersten Konsul.«
»Hortense bricht jedes Mal in Tränen aus, wenn die Rede darauf kommt, und ich will nicht das Ungeheuer sein, das seine Tochter opfert; Hortense behauptet, ihr Herz gehöre ihr nicht mehr.«
»Pah!«, machte Fouché. »Wer hat schon ein Herz?«
»Ach«, sagte Joséphine, »ich habe ein Herz, das gestehe ich gerne.«
»Sie?«, fragte Fouché mit seinem hässlichen Lachen. »Sie haben kein Herz, Sie haben -«
»Seien Sie auf der Hut!«, warnte Joséphine, »sonst entschlüpft Ihnen am Ende eine Impertinenz.«
»Ich schweige, als Polizeiminister schweige ich; man sollte meinen, ich stünde im Begriff, mein Berufsgeheimnis zu verraten. Aber jetzt, da ich Ihnen nichts mehr zu erzählen habe, lassen Sie mich dem Ersten Konsul eine Neuigkeit verkünden, die er aus meinem Mund ganz gewiss nicht erwartet.«
»Und welche?«
»Dass er gestern meine Amtsenthebung unterzeichnet hat.«
»Also verliere ich?«, sagte Joséphine fragend.
»Mich«, sagte Fouché.
Joséphine, die sich der Schwere dieses Verlusts in der Tat bewusst war, stieß einen Seufzer aus und fuhr sich mit der Hand über die Augen.
»Oh, seien Sie unbesorgt«, sagte Fouché und trat näher, »es wird nicht für lange sein.«
Um keine zu große Vertrautheit zu verraten, verließ Fouché Joséphines Gemächer durch die Haupttür und trat durch den Pavillon de l’Horloge wieder ein, bevor er zu Bonapartes Kabinett hinaufging.
Der Erste Konsul arbeitete mit Bourrienne. »Ah!«, sagte er, als er Fouché erblickte, »Sie werden mich aufklären, jawohl.«
»Worüber, Sire?«
»Darüber, wer dieser Sainte-Hermine ist, der meine Einwilligung erbittet, um Mademoiselle de Sourdis zu heiraten.«
»Damit wir uns richtig verstehen, Citoyen Erster Konsul: Nicht der Graf von Sainte-Hermine erbittet Ihre Einwilligung, um Mademoiselle de Sourdis zu heiraten, Mademoiselle de Sourdis erbittet Ihre Einwilligung, um Monsieur de Sainte-Hermine zu heiraten.«
»Ist das nicht ein und dasselbe?«
»Nicht ganz: Die Sourdis sind eine bedeutende Familie und freundschaftlich verbunden; die Sainte-Hermines sind eine bedeutende Familie, deren Freundschaft es zu gewinnen gilt.«
»Sie haben mir also geschmollt.«
»Mehr noch, sie haben Sie bekriegt.«
»Als Republikaner oder als Royalisten?«
»Als Royalisten; der Vater wurde 93 guillotiniert, der älteste Sohn füsiliert; der zweitälteste, den Sie kennengelernt haben, wurde in Bourg-en-Bresse guillotiniert.«
»Den ich kennengelernt habe?«
»Entsinnen Sie sich eines Maskierten, der während Ihrer Mahlzeit in Avignon einen Geldsack mit zweihundert Louisdor zurückbrachte, den man versehentlich einem Weinhändler aus Bordeaux in der Eilpost geraubt hatte?«
»Oh, gewiss doch! Ach, Fouché, solche Männer könnte ich gebrauchen.«
»Einem ersten Herrscher dient man nicht aus Hingabe, Citoyen Erster Konsul, sondern aus Eigeninteresse.«
»Sie haben recht, Fouché. Ach! Wäre ich doch mein Enkel! Nun gut. Und der Dritte?«
»Der Dritte wird Ihr Freund sein, wenn Sie wollen.«
»Und wie das?«
»Zweifellos bittet Madame de Sourdis, die gewandte Schmeichlerin, Sie mit seinem Einverständnis um Ihre Zustimmung zur Heirat ihrer Tochter, als wären Sie ein Fürst. Geben Sie Ihre Einwilligung, Sire, und Monsieur Hector de Sainte-Hermine wird nicht anders können, als sich von einem Gegner in einen Freund zu verwandeln.«
»Schon gut«, sagte Bonaparte, »ich werde darüber nachdenken«, und dann fragte er, händereibend bei dem Gedanken, dass man ihm gegenüber inzwischen Formen wahrte, als hätte man es mit einem König zu tun: »Und welche Neuigkeit bringen Sie, Fouché?«
»Nur eine, aber sie hat eine gewisse Bedeutung, vor allem für mich.«
»Und das wäre?«
»Dass Sie gestern in dem grünen Salon in Mortefontaine dem Innenminister Lucien Bonaparte meine Amtsenthebung und meine Aufnahme in den Senat diktiert und sie danach unterzeichnet haben.«
Bonaparte machte eine jedem Korsen wohlvertraute Geste, die mit zwei Bewegungen des Daumens auf der Brust ein Kreuzzeichen beschreibt, und sagte: »Wer hat Ihnen diesen Bären aufgebunden, Fouché?«
»Einer meiner Spitzel, hol’s der Teufel!«
»Er hat Sie belogen.«
»Er hat mich so wenig belogen, dass sich das Dekret dort drüben befindet, auf dem Stuhl, in der Seitentasche Ihres grauen Gehrocks.«
»Fouché«, sagte Bonaparte, »wenn Sie hinkten wie Talleyrand, wüsste ich mit Sicherheit, dass Sie der Teufel sind.«
»Sie leugnen es nicht mehr, nicht wahr?«
»Meiner Treu, nein! Außerdem ist Ihre Entlassung so ehrenvoll, wie man es sich nur wünschen kann...«
»Ich verstehe: In meinem Zeugnis wird versichert, dass während der Dauer meiner Dienstzeit kein Silbergeschirr aus Ihrem Haushalt entwendet wurde.«
»Da die Befriedung Frankreichs ein Polizeiministerium überflüssig gemacht hat, versetze ich dessen Minister in den Senat, um ihn dort jederzeit zur Hand zu haben, falls ich das Ministerium wieder einrichten will. Ich weiß wohl, mein lieber Fouché, dass Sie im Senat nicht mehr die Verwaltung des Glücksspiels leiten werden, diese unerschöpfliche Goldgrube, aber Sie besitzen bereits ein unermesslich großes Vermögen, das Sie nicht genießen können, und Ihr Landbesitz in Pontcarré, den Sie unablässig vergrößern, ist wahrhaftig groß genug für Sie.«
»Habe ich Ihr Wort«, fragte Fouché, »dass, falls es wieder einen Polizeiminister geben sollte, dieser kein anderer sein wird als ich?«
»Das haben Sie«, sagte Bonaparte.
»Danke. Darf ich jetzt Cabanis davon informieren, dass seine Nichte Mademoiselle de Sourdis Ihre Einwilligung zu ihrer Heirat mit dem Grafen von Sainte-Hermine hat?«
»Das dürfen Sie.«
Bonaparte beugte leicht den Kopf, Fouché erwiderte dies mit einer tiefen Verbegung und ging.
Der Erste Konsul wanderte eine Zeit lang auf und ab, stumm, die Hände auf dem Rücken; dann blieb er abrupt hinter dem Sessel seines Sekretärs stehen. »Haben Sie das gehört, Bourrienne?«, fragte er.
»Was, General?«
»Das, was dieser Teufel Fouché gesagt hat.«
»Ich höre nichts als das, was zu hören Sie mir befehlen.«
»Er wusste, dass ich ihn abgesetzt hatte, dass ich es in Mortefontaine getan hatte und dass das Dekret seiner Amtsenthebung in der Tasche meines grauen Gehrocks steckt.«
»Ach«, sagte Bourrienne, »das erfordert keine Hexerei, dafür muss er nur den Kammerdiener Ihres Bruders anständig bezahlen.«
Bonaparte schüttelte den Kopf. »Dennoch«, sagte er, »ist dieser Fouché ein gefährlicher Mann.«
»Gewiss«, sagte Bourrienne, »doch Sie müssen zugeben, dass ein Mann, dessen Scharfsinn Sie so verblüfft, in unseren heutigen Zeiten überaus nützlich ist.«
Der Erste Konsul sah nachdenklich drein; dann sagte er: »Ich habe ihm schließlich versprochen, dass ich ihn zurückhole, sobald es Schwierigkeiten gibt, und es ist gut denkbar, dass ich mein Wort halten werde.«
Der Bürodiener erschien.
»Landoire«, sagte Bonaparte, »sehen Sie aus dem Fenster, ob ein Wagen mit Pferden bereit ist.«
Landoire verließ den Raum und beugte sich aus dem Fenster. »Ja, General«, sagte er.
Der Erste Konsul zog seinen Gehrock an und ergriff seinen Hut. »Ich fahre in den Staatsrat«, sagte er.
Nach einigen Schritten blieb er stehen. »Apropos, gehen Sie zu Joséphine und sagen Sie ihr, dass ich nicht nur mit der Heirat Mademoiselle de Sourdis’ einverstanden bin, sondern dass Madame Bonaparte und ich sogar ihren Ehevertrag mit unterzeichnen werden.«
21
In welchem Kapitel Fouché daran arbeitet, in das Polizeiministerium zurückzukehren, aus dem er noch nicht ausgeschieden ist
Fouché verließ den Tuilerienpalast zornentbrannt. Er war ein kluger Kopf, aber ein kluger Kopf mit begrenztem Wirkungsfeld. Ohne seine Polizei war Fouché nur von zweitrangiger Bedeutung.
Er hatte ein nervöses, reizbares, ängstliches Naturell, und die Natur schien ihm schielende Augen und große Ohren verliehen zu haben, damit er gleichzeitig in verschiedene Richtungen sehen und in alle Richtungen lauschen konnte. Bonaparte hatte ihn an seiner empfindlichsten Stelle getroffen: Indem er die Polizei verlor, verlor er die Oberaufsicht über das Glücksspiel, die ihm jährlich mehr als zweihunderttausend Francs einbrachte. Unvorstellbar reich, hatte Fouché nur eines im Sinn, nämlich das Vermögen zu mehren, das zu genießen ihm nicht gegeben war, und sein Ehrgeiz, die Grenzen seines Landbesitzes in Pontcarré zu weiten, war kaum geringer als Bonapartes Ehrgeiz, Frankreichs Grenzen weit in das Ausland zu versetzen.
Er ging nach Hause, begab sich in sein Kabinett und warf sich in seinen Sessel, ohne mit einer Menschenseele ein Wort gewechselt zu haben. Seine Gesichtsmuskeln bebten wie die Meeresoberfläche bei Sturm. Nach einigen Minuten glätteten sich seine Züge: Fouché war der Einfall gekommen, den er gesucht hatte, und das matte Lächeln, das auf seine Züge trat, verriet, dass zumindest Windstille eingekehrt war, wenngleich das schöne Wetter noch auf sich warten ließ.
Er ergriff die Klingelschnur über seinem Schreibtisch und zog daran mit noch leicht bebender Hand.
Der Bürodiener erschien.
»Monsieur Dubois!«, rief Fouché.
Der Bürodiener machte eine Kehrtwendung und verschwand.
Unmittelbar darauf wurde die Tür geöffnet, und Dubois trat ein.
Dubois war ein Mann mit sanften, ruhigen Zügen und mildem Lächeln, alles andere als modisch gekleidet, aber mit größter Reinlichkeit, wie die weiße Krawatte und die Manschetten bezeigten.
Er trat näher, wobei er sich leicht in den Hüften wiegte und wie ein Tanzlehrer mit den Schuhsohlen über den Teppich glitt.
»Monsieur Dubois«, sagte Fouché, der sich in seinem Sessel zurücklehnte, »heute bin ich auf all Ihre Intelligenz und all Ihre Verschwiegenheit angewiesen.«
»Ich kann dem Herrn Minister allein meine Verschwiegenheit zusichern«, sagte Dubois. »Der Wert meiner Intelligenz bemisst sich nur in Abhängigkeit von der Ihren.«
»Schon gut, schon gut, Monsieur Dubois«, sagte Fouché etwas gereizt. »Keine Komplimente. Haben Sie in Ihrer Behörde einen Mann, dem man vertrauen kann?«
»Zuerst müsste ich wissen, wofür er benötigt wird.«
»Das ist wahr. Er soll in die Bretagne fahren und dort drei Banden von Fußbrennern ins Leben rufen: Eine, die wichtigste, soll auf der Straße von Vannes nach Muzillac operieren; die zwei anderen kann er einrichten, wo er will.«
»Ich höre«, sagte Dubois, als er sah, dass Fouché innehielt.
»Die eine soll sich ›Cadoudals Bande‹ nennen und so tun, als wäre Cadoudal selbst ihr Anführer.«
»Nach dem, was Eure Exzellenz mir sagen -«
»Dieses eine Mal lasse ich es durchgehen«, rief Fouché lachend, »insbesondere Sie mich nicht mehr lange so nennen können.«
Dubois verneigte sich, und als Fouché ihn mit einer Geste dazu aufforderte, fuhr er fort: »Nach dem, was Eure Exzellenz mir sagen, wird ein Mann gebraucht, der notfalls im zerstreuten Gefecht kämpft.«
»Der notfalls alles tut.«
Monsieur Dubois überlegte und schüttelte dann den Kopf. »So jemanden habe ich nicht unter meinen Leuten«, befand er.
Als Fouché verärgert eine Handbewegung machte, sagte er: »Warten Sie, warten Sie einen Augenblick. Gestern hat sich mir ein gewisser Chevalier de Mahalin vorgestellt, ein Bursche, der bei den Compagnons de Jéhu war und den es nur nach einer Sache gelüstet, wie er behauptet, nämlich nach gefährlichen Aufträgen, die gut bezahlt sind. Ein Spieler in der ganzen Bedeutung des Wortes, bereit, sein Leben wie sein Geld auf einen Würfelwurf zu setzen. Das ist unser Mann.«
»Haben Sie seine Adresse?«
»Nein; doch er kommt heute zwischen ein und zwei Uhr in mein Büro, und jetzt ist es eins. Er ist entweder schon dort oder wird bald eintreffen.«
»Dann holen Sie ihn und bringen Sie ihn her.«
Als Monsieur Dubois gegangen war, stand Fouché auf und holte einen Karton, dem er ein Dossier entnahm, das er auf seinen Schreibtisch legte.
Es war das Dossier über Pichegru.
Er studierte es mit größter Aufmerksamkeit, bis Monsieur Dubois in Begleitung des Mannes, über den sie gesprochen hatten, zurückkam.
Es war derselbe, der Hector de Sainte-Hermine an sein feierliches Gelöbnis erinnert und ihn in Laurents Bande eingeführt hatte. Als ihm dort die Arbeit ausgegangen war, hatte sich der wackere Edelmann anderswo nach Betätigung umgesehen.
Er mochte zwischen fünfundzwanzig und dreißig Jahren zählen, war von angenehmem Äußeren, mehr schön als hässlich, mit gewinnendem Lächeln, und man hätte ihn für durch und durch einnehmend halten können, wäre in seinen Augen nicht etwas Verstörendes, Beunruhigendes gewesen, das sich dem Gemüt jener, die mit ihm zu tun hatten, sogleich mitteilte. Im Übrigen war er nach der Mode der Zeit gekleidet, nicht schlicht, sondern eher elegant.
Fouché maß ihn mit dem Blick, mit dem er einen Menschen moralisch einzuschätzen pflegte. In diesem Mann erriet er die Liebe zum Geld, Mut in der Verteidigung, weniger beim Angriff, und den unbezähmbaren Willen, in seinen Unternehmungen erfolgreich zu sein.
Das war der Mann, den er suchte.
»Monsieur«, sagte Fouché, »man hat mir hinterbracht, Sie wollten in die Dienste der Regierung eintreten. Ist das wahr?«
»Es ist mein größter Wunsch.«
»Und in welcher Funktion?«
»In jeder Funktion, in der es Schläge zu kassieren und Geld einzustecken gibt.«
»Kennen Sie die Bretagne und die Vendée?«
»In- und auswendig. Ich war dreimal zu General Cadoudal entsendet.«
»Hatten Sie mit den anderen Anführern zu tun?«
»Mit einigen, vor allem mit einem Leutnant Cadoudals, den man seiner Ähnlichkeit mit dem General wegen Georges II. nannte.«
»Ei der Teufel!«, sagte Fouché. »Der könnte uns sehr nützlich sein. Trauen Sie sich zu, drei Banden von jeweils zwanzig Mann aufzustellen?«
»In einem Land, dessen Gemüter noch vom Bürgerkrieg erhitzt sind, kann man jederzeit drei Banden von je sechzig Mann aufstellen. Geht es um einen Zweck, den man offenbaren kann, werden die braven Bürger Ihnen Ihre sechzig Mann stellen, und Sie werden nicht viel mehr dafür benötigen als schöne Worte und hochtrabendes Gerede. Wenn es um einen etwas trüberen Zweck geht, werden Sie dafür weniger reine Gewissen und käufliche Arme finden, doch die sind natürlich kostspieliger.«
Fouché bedachte Dubois mit einem Blick, der bedeutete: »Mein Lieber, da haben Sie einen prächtigen Fund getan«, und zu dem Chevalier sagte er: »Monsieur, innerhalb von zehn Tagen benötigen wir drei Banden von Fußbrennern, zwei im Morbihan, eine in der Vendée, und alle drei sollen in Cadoudals Namen tätig werden. In einer von ihnen soll ein Maskierter sich Cadoudal nennen und so tun, als wäre er der ehemalige bretonische Anführer.«
»Nicht weiter schwierig, aber teuer, wie ich bereits sagte.«
»Genügen fünfzigtausend Francs?«
»O ja, das ist mehr als genug.«
»Dann wäre das geklärt; wenn Sie Ihre drei Banden auf die Beine gestellt haben, könnten Sie dann nach England gehen?«
»Nichts leichter als das, wenn man bedenkt, dass ich englischer Herkunft bin und Englisch wie meine Muttersprache spreche.«
»Kennen Sie Pichegru?«
»Dem Namen nach.«
»Haben Sie Mittel und Wege, sich mit ihm bekannt zu machen?«
»Ja.«
»Wenn ich Sie frage, welche Mittel -«
»Würde ich es Ihnen nicht sagen; auch ich muss meine Geheimnisse haben, sonst wäre ich wertlos für Sie.«
»Sie haben recht. Sie werden nach England reisen, Sie werden Pichegru auf den Zahn fühlen und in Erfahrung bringen, ob er gegebenenfalls nach Paris zurückkehren würde; wenn er es wollte und Geld benötigen sollte, können Sie es ihm im Namen von Fauche-Borel anbieten; merken Sie sich diesen Namen.«
»Der Name des Schweizer Buchhändlers, der ihm schon im Auftrag des Prinzen von Condé Avancen gemacht hat, ich kenne ihn; und wenn er Geld benötigen und nach Paris kommen wollen sollte, an wen habe ich mich dann zu wenden?«
»An Monsieur Fouché auf seinem Landsitz in Pontcarré, merken Sie sich das gut; auf keinen Fall an den Polizeiminister.«
»Und dann?«
»Dann kehren Sie nach Paris zurück, wo Sie weitere Anweisungen erhalten werden. Monsieur Dubois, Sie zahlen dem Chevalier fünfzigtausend Francs aus. Und noch etwas, Chevalier.«
Der Chevalier drehte sich um.
»Wenn Sie Coster Saint-Victor begegnen sollten, bringen Sie ihn dazu, nach Paris zurückzukehren.«
»Droht ihm nicht die Verhaftung?«
»Nein, es wird ihm alles erlassen werden, das dürfen Sie mir glauben.«
»Was soll ich ihm sagen, um ihn zu überzeugen?«
»Dass alle Frauen von Paris ihm nachtrauern und ganz besonders Mademoiselle Aurélie de Saint-Amour; sagen Sie ihm außerdem, seine galante Karriere wäre unvollständig, wenn er nach Barras nicht auch den Ersten Konsul zum Rivalen gehabt hätte. Das wird ihn dazu bewegen, herzukommen, es sei denn, heilige Bande hielten ihn in London fest.«
Als die Tür geschlossen war, ließ Fouché durch eine Ordonnanz folgenden Brief zu Dr. Cabanis bringen:
Mein lieber Doktor,
der Erste Konsul, den ich bei Madame Bonaparte sah, hat äußerst wohlwollend das Begehren der Madame de Sourdis hinsichtlich der Heirat ihrer Tochter aufgenommen, und er schenkt dieser Heirat seine volle Zustimmung.
Unsere liebe Schwester kann Madame Bonaparte den fraglichen Besuch machen, je eher, desto besser.
Seien Sie meiner aufrichtigen Freundschaft versichert, lieber Freund
IHR J. FOUCHÉ Am Tag darauf fand sich Madame de Sourdis in besagter Absicht im Tuilerienpalast ein und stieß auf eine vor Freude jubilierende Joséphine und eine in Tränen aufgelöste Hortense.
Hortenses und Louis Bonapartes Heirat war so gut wie beschlossen, und das war der Grund für Hortenses Kummer und Joséphines Freude.
Was war geschehen?
Als Joséphine aus Bonapartes Gebaren erraten hatte, dass er aus unerfindlichen Gründen guter Laune war, ließ sie ihn bitten, nach seiner Rückkehr vom Staatsrat zu ihr zu kommen.
Doch bei seiner Rückkehr hatte der Erste Konsul Cambacérès vorgefunden, der auf ihn wartete, um ihm Erklärungen zu einigen Punkten des Code Napoléon zu geben, die ihm noch nicht klar genug erschienen.
Sie hatten bis spät in die Nacht gearbeitet, und dann war Junot gekommen, um Bonaparte seine Hochzeit mit Mademoiselle de Permon zu melden.
Diese Heirat stimmte den Ersten Konsul nicht annähernd so zufrieden wie die der Mademoiselle de Sourdis. Zum einen war er früher einmal in Madame de Permon verliebt gewesen und hatte beabsichtigt, sie zu heiraten; Madame de Permon hatte seinen Antrag abgelehnt, und das hatte er ihr nie ganz verziehen; zum anderen hatte er Junot empfohlen, eine reiche Erbin zu ehelichen, und stattdessen hatte Junot die Tochter eines Bankrotteurs gewählt. Die Mutter entstammte einem alten byzantinischen Herrschergeschlecht, und das junge Mädchen, das Bonaparte vertraulich Loulou nannte, war eine Comnène, doch seine Mitgift betrug nicht mehr als fünfundzwanzigtausend Francs.
Bonaparte sagte Junot zu, ihm mit hunderttausend Francs unter die Arme zu greifen. Als Gouverneur von Paris würde er Einkünfte in Höhe von fünfhunderttausend Francs beziehen. Damit musste er auskommen.
Joséphine hatte den ganzen Abend ungeduldig auf ihren Ehemann gewartet, doch dieser hatte mit Junot gespeist und war mit ihm ausgegangen. Um Mitternacht sah sie ihn im Schlafrock und mit einem Seidentuch auf dem Kopf eintreten, was bedeutete, dass er erst am nächsten Morgen in sein Zimmer zurückgehen würde, und die Freude, die sie bezeigte, verriet, dass sie für ihr langes Warten entschädigt werden würde.
Während solcher nächtlichen Besuche erlangte Joséphine all ihren Einfluss auf Bonaparte wieder.
Nie zuvor hatte sie die Heirat Hortenses mit Louis Bonaparte hartnäckiger verlangt, und als der Erste Konsul zurück in seine Räume ging, hatte er so gut wie eingewilligt.
Joséphine hielt Madame de Sourdis zurück, um ihr eingehend von ihrem Glück zu berichten; Claire schickte sie zu Hortense, damit sie diese tröstete.
Claire versuchte gar nicht erst, Trost anzubieten, denn sie wusste nur zu gut, was es sie gekostet hätte, auf Hector zu verzichten.
Sie weinte mit Hortense und riet ihr zu, sich an den Ersten Konsul zu wenden, der sie gewiss zu sehr liebte, um sie in ihr Unglück zu stürzen.
Mit einem Mal kam Hortense ein eigenartiger Gedanke, den sie ihrer Freundin mitteilte – der Gedanke, mit der Erlaubnis ihrer beiden Mütter Mademoiselle Lenormand zu befragen.
Joséphine hatte sie seinerzeit aufgesucht, und es ist bekannt, was sie ihr geweissagt hat.
Und nun wollte Hortense erfahren, ob ihr Traum Wirklichkeit werden würde.
Mademoiselle de Sourdis wurde mit der Aufgabe betraut, den Wunsch der beiden vorzutragen und die Erlaubnis zu erwirken, ihn in die Tat umzusetzen.
Die Verhandlungen dauerten lange. Hortense lauschte an der Tür und unterdrückte ihr Schluchzen.
Claire kam freudig zurück: die Erlaubnis war erteilt, allerdings unter der Bedingung, dass Mademoiselle Louise, Madame Bonapartes erste Kammerfrau, die deren ungeteiltes Vertrauen genoss, den beiden jungen Damen nicht von der Seite wich.
Mademoiselle Louise wurde geholt und mit strengsten Instruktionen versehen. Sie gelobte hoch und heilig, sich daran zu halten, und die jungen Damen bestiegen tiefverschleiert den unauffälligen Wagen ohne Wappen, den Madame de Sourdis für ihre Vormittagsbesuche zu benutzen pflegte.
Der Kutscher wurde angewiesen, vor dem Haus Nummer sechs in der Rue de Tournon zu halten, ohne dass man ihm einen Namen nannte.
Mademoiselle Louise stieg wie angewiesen als Erste aus; sie wusste, dass Mademoiselle Lenormand am Ende des Hofs wohnte, dass man dort drei Stufen die Treppe hinaufgehen und dann an der rechten Tür klopfen musste.
Sie klingelte, man öffnete, ließ sie eintreten und führte sie auf Mademoiselle Louises Bitte in einen kleinen Raum, der normalerweise den Besuchern nicht zugänglich war.
Die jungen Mädchen wurden aufgefordert, nacheinander einzutreten, in der Reihenfolge der ersten Buchstaben ihres Nachnamens, denn Mademoiselle Lenormand wurde nie in Anwesenheit mehrerer Personen tätig.
So kam es, dass Hortense Beaumarchais die Erste war.
Nach einer halben Stunde des Wartens wurde sie vorgelassen.
Mademoiselle Louise war schrecklich nervös, da man ihr eingeschärft hatte, keines der jungen Mädchen aus den Augen zu lassen. Blieb sie bei Claire, entwischte ihr Hortense. Begleitete sie Hortense, entzog sich Claire ihrer Aufsicht.
Die Frage war so wichtig, dass man sie mit Mademoiselle Lenormand erörterte, die einen Vorschlag hatte, wie alles unter einen Hut gebracht werden konnte.
Mademoiselle Louise blieb bei Claire, doch die Tür zu dem Kabinett wurde nicht geschlossen, so dass Hortense sichtbar blieb, gleichzeitig aber weit genug von ihren Begleiterinnen entfernt war, dass diese die leise gemurmelten Worte der Seherin nicht vernehmen konnten.
Selbstverständlich hatte Hortense darum gebeten, dass alle Tarotkarten gelegt wurden.
Was Mademoiselle Lenormand in ihren Karten sah, schien sie stark zu beeindrucken; ihre Gesten und ihr Gesichtsausdruck kündeten von wachsendem Erstaunen.
Als sie ihre Karten abgelegt und sich die Handfläche des jungen Mädchens genau angesehen hatte, erhob sie sich und sagte nachdrücklich einen einzigen Satz zu Hortense, den diese mit sichtlich ungläubiger Miene vernahm.
Auf alle weiteren Fragen Hortenses blieb die Pythia stumm und sagte nur die Worte: »Das Orakel hat gesprochen, glauben Sie dem Orakel!«
Dann bedeutete sie ihr mit einer Handbewegung, dass sie gehen und ihrer Freundin Platz machen solle.
Obwohl Mademoiselle de Beauharnais die Idee gehabt hatte, Mademoiselle Lenormand aufzusuchen, war Claire durch das, was sie mit angesehen hatte, fast ebenso neugierig geworden wie ihre Freundin, und sie ließ sich nicht zweimal bitten, das Allerheiligste der Prophetin zu betreten.
Doch dass ihr Schicksal Mademoiselle Lenormand nicht weniger erstaunen würde als das ihrer Freundin Hortense, damit hatte Claire nicht gerechnet.
Mit der Sicherheit einer Frau, die weiß, was sie tut, und die zögert, etwas zu sagen, was völlig unwahrscheinlich klingt, mischte Mademoiselle Lenormand ihre Karten dreimal neu, betrachtete die rechte Handfläche und dann die linke, entdeckte beide Male die Linie des gebrochenen Herzens, die Glückslinie, die bis zur Herzlinie verläuft und sich bei Saturn verzweigt, und dann sprach sie so feierlich, wie sie Mademoiselle de Beauharnais geweissagt hatte, ihr Orakel für Mademoiselle de Sourdis, die daraufhin totenbleich und mit tränennassen Augen zu Mademoiselle Louise und Hortense zurückkehrte.
Solange sie unter dem Dach Mademoiselle Lenormands weilten, hatten die jungen Mädchen kein Wort gesagt und einander keine Fragen gestellt. Man hätte meinen können, sie fürchteten, ein Wort oder eine Frage müssten das Haus unweigerlich zum Einsturz bringen.
Doch sobald sie im Wagen saßen und der Kutscher seine Pferde lostraben ließ, fragten beide wie aus einem Mund: »Was hat sie Ihnen gesagt?«
Hortense, die als Erste bei der Seherin gewesen war, antwortete zuerst. »Sie hat gesagt: ›Du wirst die Frau eines Königs und die Mutter eines Kaisers, und du wirst im Exil sterben.‹ Und was hat sie dir gesagt?«, fragte sie neugierig.
»Sie hat gesagt: ›Du wirst vierzehn Jahre lang die Witwe eines Lebenden sein und dein restliches Leben lang die Gattin eines Toten!‹«
22
In welchem Kapitel Mademoiselle de Beauharnais die Frau eines Königs ohne Thron und Mademoiselle de Sourdis die Witwe eines lebenden Ehemannes werden
Sechs Wochen waren vergangen, seit die jungen Mädchen die Sibylle der Rue de Tournon aufgesucht hatten. Mademoiselle de Beauharnais hatte ungeachtet ihrer Tränen Louis Bonaparte geheiratet, und Mademoiselle de Sourdis stand im Begriff, noch am selben Abend den Heiratsvertrag mit dem Grafen von Sainte-Hermine zu unterzeichnen.
Die Abneigung, die Mademoiselle de Beauharnais dem jüngsten Bruder des Ersten Konsuls entgegenbrachte, hatte nichts mit seiner Person zu tun. Sie liebte Duroc, das war alles. Liebendes Herz, blindes Herz.
Louis Bonaparte war zu jener Zeit dreiundzwanzig oder vierundzwanzig Jahre alt, ein schöner junger Mann von etwas kühlem Äußeren, der im Übrigen seiner Schwester Caroline frappierend ähnlich sah, sehr gebildet, mit literarischen Neigungen, sehr aufrecht, sehr gütig und vor allem sehr anständig, der unwandelbaren Überzeugung, dass ein Königstitel an den Geboten und Pflichten des menschlichen Gewissens nichts ändern kann; er war der vielleicht einzige Fürst, der ein fremdes Volk regiert und in diesem Volk etwas wie Dankbarkeit und Liebe geweckt hat, ähnlich wie Desaix in Oberägypten der gerechte Sultan gewesen war.
Bevor wir uns von diesem Mann mit seinem loyalen Herzen und dem bezaubernden Geschöpf, das er heiratete, verabschieden, wollen wir erzählen, wie es so abrupt zu dieser Heirat gekommen war, für die es keinen anderen Grund gab als Joséphines ununterbrochenes und beharrliches Taktieren.
Wir erwähnten bereits, warum Joséphine gegen eine Heirat ihrer Tochter mit Duroc war.
»Duroc«, sagte sie bei jedem Anlass zu Bourrienne, »wäre mir keine Hilfe; Duroc verdankt alles der Freundschaft Bonapartes und würde es nie wagen, sich gegen die Brüder seines Beschützers zu stellen; dagegen hat Bonaparte Louis sehr gern, und Louis hat keinen Ehrgeiz und wird nie welchen haben. Louis wäre ein Gegengewicht zu Joseph und Lucien.«
Bonaparte wiederum sagte sich: »Duroc und Hortense lieben sich. Meine Frau kann sagen, was sie will, sie passen zueinander und werden heiraten; ich mag Duroc, er stammt aus gutem Hause. Habe ich denn nicht Murat Caroline und Leclerc Pauline gegeben? Ich kann Duroc Hortense geben; er ist ein tapferer Bursche und nicht weniger tüchtig als jene. Er ist bereits Divisionsgeneral; es gibt keinen ernsthaften Einwand gegen diese Ehe; und für Louis habe ich andere Pläne.«
An ebenjenem Tag, an dem die jungen Mädchen Mademoiselle Lenormand aufsuchten, hatte Hortense auf Drängen ihrer Freundin beschlossen, ihren Stiefvater noch einmal um Beistand anzuflehen, und als sie nach dem Abendessen allein waren, kniete sie vor ihm nieder mit der Anmut, die ihr eigen war, und sagte ihm unter all den Liebkosungen, die ihr so große Macht über das Herz des Ersten Konsuls verschafften, dass dieser Ehebund sie auf ewig ins Unglück stürzen würde, und ohne Louis zu schmälern, erklärte sie, dass sie Duroc liebe und dass niemand als Duroc sie glücklich machen könne.
Bonaparte hatte seinen Entschluss gefaßt. »Gut«, sagte er. »Wenn du ihn unbedingt heiraten willst, dann sollst du ihn heiraten, aber nur zu meinen Bedingungen. Nimmt Duroc sie an, dann steht deinem Glück nichts im Wege, aber wenn nicht, dann habe ich mich zum letzten Mal Joséphines Wünschen widersetzt, und du wirst Louis heiraten.«
In dem Tatendrang, den ein gefasster Entschluss auslöst, mag er noch so unerquickliche Begleitumstände mit sich bringen, begab der Erste Konsul sich sofort in sein Kabinett hinauf.
Dort angekommen, sah er sich nach Duroc um. Wie gesagt befand sich Duroc als ewiger Bummler selten auf seinem Posten.
»Wo steckt Duroc?«, fragte Bonaparte sichtlich verärgert.
»Er ist ausgegangen«, erwiderte Bourrienne.
»Und wo vermuten Sie ihn?«
»In der Oper.«
»Wenn er zurückkommt, sagen Sie ihm, dass ich ihm Hortense versprochen habe; er wird sie heiraten, und ich bestehe darauf, dass es innerhalb von zwei Tagen geschieht. Ich gebe ihm fünfhunderttausend Francs und ernenne ihn zum Kommandanten der achten Division. Am Tag nach seiner Hochzeit wird er mit seiner Frau nach Toulon abreisen und dort leben. Ich will keinen Schwiegersohn unter meinem Dach. Da ich die Sache hinter mich bringen will, sagen Sie mir heute noch, ob ihm das zusagt.«
»Oh, das kann ich mir nicht vorstellen«, erwiderte Bourrienne.
»Nun gut! Dann wird sie Louis heiraten.«
»Wird sie das wollen?«
Um zehn Uhr kehrte Duroc zurück; Bourrienne teilte ihm die Absichten des Ersten Konsuls mit, doch Duroc schüttelte den Kopf. »Der Erste Konsul erweist mir eine große Ehre«, sagte er, »aber unter solchen Bedingungen würde ich nie im Leben heiraten; da mache ich lieber einen Spaziergang zum Palais-Royal.« Und er nahm seinen Hut und verabschiedete sich mit einer Sorglosigkeit, die Bourrienne unerklärlich vorkam und die beweist, dass Hortense sich getäuscht hatte, was die Tiefe der Gefühle angeht, die der Adjutant des Ersten Konsuls ihr entgegenbrachte oder entgegenzubringen vorgab.
In dem kleinen Haus in der Rue Chantereine fand die Eheschließung von Mademoiselle Beauharnais und Louis Bonaparte statt. Ein Priester vollzog die kirchliche Trauung, und bei diesem Anlass ließ Bonaparte auch Madame Murats Ehe den Segen der Kirche erteilen.
Weit davon entfernt, wie die Hochzeit der armen Hortense unter Kummer und Tränen zu verlaufen, versprach Claires Hochzeit eitel Sonnenschein und Freude; die Liebenden ließen einander nur zwischen elf Uhr abends und zwei Uhr nachmittags aus den Augen und verbrachten die übrige Zeit miteinander. Die vornehmsten Händler, die begehrtesten Juweliere von ganz Paris hatte Hector abgesucht, um ein Brautgeschenk zu finden, das seiner Verlobten würdig war; in den feinen Kreisen sprach man davon wie von einem Weltwunder, und Mademoiselle de Sourdis erhielt sogar Briefe, in denen man darum bat, sie besuchen zu dürfen.
Madame de Sourdis hatte lediglich mit einer schriftlichen Zustimmung des Konsuls und Madame Bonapartes gerechnet, und es hatte sie aufs Höchste erstaunt, dass er sich selbst eingeladen hatte, den Ehevertrag zu unterzeichnen; solche Gunstbeweise wurden nur seinen engsten Freunden zuteil, denn zu ihnen gehörte zwangsläufig ein Geldgeschenk oder ein anderweitiges Präsent, und ohne geizig zu sein, war der Erste Konsul doch sparsam genug und warf nicht gerne Geld aus dem Fenster.
Der Einzige, der diese Gunst mit recht gemischten Gefühlen betrachten musste, war Hector de Sainte-Hermine. Bonapartes offenkundiger Wunsch, die Familie seiner Verlobten zu ehren, stimmte ihn besorgt. Wiewohl jünger als seine Brüder und daher der royalistischen Sache weniger verschrieben als diese, empfand Hector zwar eine gewisse Bewunderung für den Ersten Konsul, doch mehr nicht. Den qualvollen Tod, den sein Bruder vor seinen Augen erlitten hatte, konnte er ebenso wenig vergessen wie das blutige Geschehen, dessen Abschluss dieser Tod war. Letzten Endes war er auf Befehl des Ersten Konsuls gestorben, denn trotz lebhaftester Bitten hatte dieser weder Gnade walten lassen noch einen Aufschub gewährt. Und so kam es, dass Hector beim Anblick des Ersten Konsuls jedes Mal kalter Schweiß auf die Stirn trat, ihm die Knie zitterten und er den Blick abwenden mußte. Er fürchtete nur eines: durch seine soziale Stellung, durch sein Vermögen eines Tages genötigt zu werden, entweder in die Armee einzutreten oder das Exil zu wählen. Claire hatte er bereits gewarnt, dass er lieber Frankreich verlassen wolle, als einen militärischen Rang oder einen Beamtenposten anzunehmen. Claire hatte ihm versichert, sie werde ihm völlig freie Hand lassen; sie hatte sich von ihrem Verlobten nur versprechen lassen, dass sie ihn begleiten dürfe. Mehr verlangte dieses Herz voller Zärtlichkeit und Liebe nicht.
Claude-Antoine Régnier, der später zum Herzog von Massa erhoben werden sollte, war bei Fouchés Entlassung zum Oberrichter ernannt und zum Leiter der Polizei befördert worden. Zweimal wöchentlich arbeitete er mit Bonaparte, dem diese Art Arbeit zusagte: Er hatte Zugriff auf die Polizei über Junot, den Gouverneur von Paris, über Duroc, seinen Adjutanten, und über Régnier, den Polizeipräfekten.
An dem Tag, an dem der Erste Konsul den Ehevertrag der Mademoiselle de Sourdis unterzeichnen wollte, hatte er eine Stunde mit Régnier verbracht. Die Nachrichten klangen beunruhigend. Vendée und Bretagne waren wieder einmal Unruheherde, und diesmal nicht eines Bürgerkriegs bei Tageslicht, sondern lichtscheuer Taten von Fußbrennerbanden, die Bauernhöfe und Schlösser heimsuchten und Bauern und Landbesitzer mit den abscheulichsten Foltern dazu brachten, ihr Geld herauszurücken. In den Zeitungen war inzwischen die Rede von den Unglücklichen, denen Füße und Hände bis auf die Knochen verbrannt worden waren.
Bonaparte hatte Régnier ausrichten lassen, er solle ihm alle Unterlagen über diese Vorgänge mitbringen.
Fünf solcher Vorfälle waren in den letzten acht Tagen bekannt geworden: Der Erste hatte sich in Berric an den Quellen des Flüsschens Sulé zugetragen, der Zweite in Plescop, der Dritte in Muzillac, der Vierte in Saint-Nolff und der Fünfte in Saint-Jean-de-Brébelay.
Angeführt wurden die Banden offenbar von drei Häuptlingen, doch über diesen schien es einen Oberkommandanten zu geben. Und wenn man den Polizeispitzeln glauben wollte, handelte es sich dabei um Cadoudal, der das Bonaparte gegebene Wort nicht gehalten hatte, sich nicht nach England zurückgezogen hatte, sondern in die Bretagne zurückgekehrt war, um dort einen neuen Aufstand anzuzetteln.
Bonaparte, der sich zu Recht etwas auf seine Menschenkenntnis zugutehielt, schüttelte den Kopf, als der Oberrichter Cadoudal so niedrige Untaten zuschreiben wollte. Wie denn! Dieser Mann von überragender Intelligenz, der mit ihm die Interessen von Völkern und von Königen diskutiert hatte, ohne einen Deut von seinen Überzeugungen abzuweichen, dieser Mann so reinen Gewissens, dass er sich damit begnügte, in London von seinem Erbe zu leben, so ehrgeizlosen Herzens, dass er sich dem Rang eines Adjutanten des bedeutendsten Generals ganz Europas verweigerte, und so selbstlosen Seelenadels, dass er auf hunderttausend Francs im Jahr verzichtete, um nicht mit ansehen zu müssen, wie andere sich gegenseitig zerfleischten – dieser Mann sollte sich zu dem schändlichen Gewerbe des Fußbrenners herabgelassen haben, dem verworfensten Brigantentum, das sich denken ließ!
Unmöglich.
Dies hatte Bonaparte seinem neuen Präfekten mit größter Entschiedenheit ins Gesicht gesagt. Dann hatte er angeordnet, die gewandtesten Polizisten mit weitestreichenden Vollmachten in die Bretagne zu schicken, wo sie diese elenden Räuberbanden Tag und Nacht verfolgen sollten.
Régnier hatte versprochen, noch am selben Tag seine fähigsten Leute auf den Weg zu schicken.
Da es inzwischen schon fast zehn Uhr abends war, hatte Bonaparte Joséphine mitteilen lassen, sie solle sich bereithalten, mit ihm und dem jungen Ehepaar Madame de Sourdis zu besuchen.
Das prachtvolle Stadtpalais, das die Gräfin bewohnte, funkelte in seiner Beleuchtung; es war ein milder, sonniger Tag gewesen, und erste Blüten und Blätter schickten sich an, ihr wattiges Gefängnis zu verlassen. Sanfte Frühlingslüfte kosten die blühenden Fliederbüsche, die von den Fenstern des Hauses bis zur Terrasse reichten; in den geheimnisvollen und duftenden Laubengewölben brannten farbige Ampeln, und aus den geöffneten Fenstern drangen harmonische Klänge und süße Düfte, während sich hinter den zugezogenen Vorhängen die Schatten der Gäste bewegten.
Diese Gäste waren die eleganteste Gesellschaft von ganz Paris: Regierungsbeamte in Form des prächtigen Generalstabs aus Offizieren, deren ältester fünfunddreißig Jahre zählte: Murat, Marmont, Junot, Duroc, Lannes, Moncey, Davout – Helden in einem Alter, in dem ein gewöhnlicher Sterblicher es mit Mühe und Not zum Hauptmann gebracht hat; Dichter: Lemercier, noch berauscht vom Erfolg seines Agamemnon; Legouvé, der gerade Eteokles zur Aufführung gebracht und Le Mérite des Femmes veröffentlicht hatte, Chénier, der seit seinem Timoléon keine Theaterstücke mehr schrieb und sich wieder der Politik zugewendet hatte; Chateaubriand, der vor den Niagarafällen und unter den Kuppeln der amerikanischen Urwälder zu Gott zurückgefunden hatte; die eleganten Tänzer, ohne die kein großer Ball vorstellbar gewesen wäre: Trénis, Laffitte, Dupaty, Garat, Vestris; die glänzenden Sterne, die in der Morgenröte des Jahrhunderts aufgetaucht waren: Madame Récamier, Madame Méchin, Madame de Contades, Madame Regnault de Saint-Jean-d’Angély; und nicht zuletzt die vornehme Jugend jener Zeit: Caulaincourt, Narbonne, Longchamp, Matthieu de Montmorency, Eugène de Beauharnais, Philippe de Ségur und viele andere.
Denn sobald sich herumgesprochen hatte, dass der Erste Konsul und Madame Bonaparte nicht nur kommen würden, sondern sogar den Ehevertrag unterzeichnen wollten, hatte sich jedermann um eine Einladung bemüht. Das große Stadtpalais der Madame de Sourdis, dessen Parterre und erster Stock geöffnet waren, quoll über vor Gästen, die auf der Terrasse nach Luft schnappten und sich von der Gluthitze erholten, die in den Salons herrschte.
Um Viertel vor elf Uhr verließ die Reitereskorte mit Fackeln in den Händen die Tuilerien; sie musste nur die Brücke überqueren. Der Dreispänner mit den galoppierenden Pferden, eingerahmt von Fackellicht, sauste wie ein Wirbelwind aus Lärm und Blitzen dahin und in den Hof des Stadtpalais.
Auf der Stelle bildete sich in der dichtgedrängten Menge eine Gasse, die sich in das Haus hinein fortsetzte und im Salon zum Kreis weitete, der es Madame de Sourdis und Claire erlaubte, dem Ersten Konsul und Joséphine entgegenzugehen.
Hector de Sainte-Hermine folgte den Damen. Beim Anblick Bonapartes erbleichte er sichtlich, ging aber weiter.
Madame Bonaparte umarmte Mademoiselle de Sourdis und legte ihr ein Perlencollier um den Arm, das fünfzigtausend Francs wert war.
Bonaparte begrüßte die Damen und trat auf Hector zu.
Hector, der sich nicht vorstellen konnte, dass Bonaparte mit ihm sprechen wollte, trat beiseite, um dem Ersten Konsul den Weg freizumachen, doch dieser blieb vor ihm stehen.
»Monsieur«, sagte Bonaparte, »wenn ich nicht befürchten müsste, abgewiesen zu werden, hätte auch ich ein Geschenk für Sie mitgebracht, ein Patent für die konsularische Garde, doch ich weiß, dass es Wunden gibt, denen man Zeit lassen muss, damit sie sich schließen.«
»Niemand hat eine glücklichere Hand, solche Wunden zu heilen, als Sie, General, aber dennoch...« Hector seufzte und führte sich das Taschentuch vor die Augen. Nach einigen Sekunden hatte er seine Fassung wiedererlangt. »Verzeihen Sie, General«, sagte der junge Mann, »ich wünschte, ich wäre Ihrer Güte würdiger.«
»Das kommt davon, wenn man zu viel Herz hat, junger Mann«, sagte Bonaparte, »man wird immer im Herzen verwundet.«
Er ging zu Madame de Sourdis zurück, wechselte ein paar Worte mit ihr und machte Claire ein Kompliment.
Dann fiel sein Blick auf den jungen Vestris. »Da ist ja Vestris der Jüngere«, sagte er, »der mir letzthin eine Gefälligkeit erwies, für die ich ihm unendlich dankbar bin: Nach einer Erkrankung trat er wieder in der Oper auf, sein erster Auftritt war für den Tag vorgesehen, an dem in den Tuilerien empfangen wird, und er hat seinen Auftritt verlegt, um meinen Empfang nicht zu kompromittieren. Kommen Sie, Monsieur Vestris, krönen Sie Ihre Galanterie, indem Sie diese beiden Damen bitten, eine Gavotte für uns zu tanzen.«
»Citoyen Ereste Konsul«, erwiderte der Sohn des götteliche Vestris mit dem italienischen Akzent, den die Familie nie verloren hatte, »wir haben glückelicheweise die Gavotte, die ich für Mademoiselle de Coigny komponiert habe und die Madame Récamier und Mademoiselle de Sourdis tanze wie zweie Engel. Wir brauchen nur eine Harfe und ein Horn, wenn Mademoiselle de Sourdis das Tamburin übernimmte. Und Madame Récamier ist unvergeleichelich in ihrem Tanz mit dem Schal.«
»Kommen Sie, meine Damen«, sagte der Erste Konsul, »Sie werden Monsieur Vestris nicht seine Bitte abschlagen, der ich mich mit allen Kräften anschließe.«
Mademoiselle de Sourdis hätte auf dieses öffentliche Lob gern verzichtet, doch sie wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, sich auch nur zu zieren, wenn ihr Tanzlehrer sie aufforderte und der Erste Konsul sie bat. Ihre Toilette war für diesen Tanz wie geschaffen: Das brünette Mädchen trug ein weißes Kleid und einen Kopfschmuck aus Weinreben, von dem ihm zwei Trauben auf die Schultern hingen; auf die Tunika war rötliches Herbstlaub gestickt.
Madame Récamier trug ihre gewohnte weiße Toilette und ihren roten indischen Kaschmirschal. Der von ihr kreierte Tanz mit dem Schal war mit großem Erfolg aus den Salons auf die Theaterbühnen gelangt.
Madame Récamiers Triumphe in diesem Tanz oder besser in dieser Pantomime sind bis in unsere Tage Gesprächsstoff geblieben, und jeder weiß, dass keine Bajadere des Theaters, die sich mit Haut und Haaren der Bühne verschrieben hatte, jemals diese Mischung aus Verworfenheit und Keuschheit zu erzeugen wusste, mit der die Göttin der Salons unter dem Fließen des schmiegsamen Stoffes ihre Reize zu enthüllen und zugleich zu verbergen verstand.
Die Gavotte wurde seit etwa einer Viertelstunde unter wachsendem Applaus vorgeführt, in den auch der Erste Konsul einstimmte. Auf ein Zeichen Bonapartes brach der ganze Saal in Beifallsstürme aus, in deren Mittelpunkt Vestris zu schweben schien, wie vom Gott der Choreographie der Erde entrückt, denn die Anmut der Gesten und Bewegungen schrieb er allein sich zu.
Als der Tanz beendet war, erschien ein livrierter Lakai und sagte leise etwas zu der Gräfin von Sourdis, woraufhin diese anordnete: »Öffnen Sie den Salon.«
Daraufhin öffneten sich lautlos zwei Schiebetüren, und in einem hell erleuchteten Salon von atemberaubender Eleganz sah man an einem Tisch mit zwei Kandelabern zwei Gerichtsbeamte sitzen, vor denen der Ehevertrag in Erwartung der Unterschriften lag, die ihn bald bedecken sollten.
Nur etwa zwanzig Personen durften diesen Salon betreten, diejenigen, die den Vertrag unterzeichen würden, der allen Übrigen, die bereit waren zuzuhören, vorgelesen wurde.
Mitten während der Verlesung des Vertrags betrat ein zweiter livrierter Lakai so unauffällig wie möglich den kleinen Salon, schlich sich an den Grafen von Sainte-Hermine heran und flüsterte: »Der Chevalier de Mahalin verlangt, Sie unverzüglich zu sprechen.«
»Lassen Sie ihn warten«, sagte Sainte-Hermine, »am besten in dem kleinen Kabinett des großen Salons.«
»Herr Graf, er sagt, er müsse Sie auf der Stelle sprechen; selbst wenn Sie die Feder in der Hand hielten, bittet er Sie, sie niederzulegen und mit ihm zu sprechen, bevor Sie unterschreiben... oh, sehen Sie, dort steht er in der Tür.«
Mit einer Geste des Schmerzes, die wie eine Geste der Verzweiflung aussah, wandte der Graf sich um und verließ den Raum in Begleitung des Dieners und des Chevaliers.
Nur wenige bemerkten diesen Zwischenfall, und diejenigen, die ihn bemerkten, maßen ihm keine sonderliche Bedeutung bei.
Bonaparte, dem es stets damit eilte, zu beenden, was er begonnen hatte, die Tuilerien zu verlassen, wenn er dort weilte, und sie aufzusuchen, wenn er sie verlassen hatte, ergriff nach erfolgter Verlesung des Vertrags die Feder, die auf dem Tisch bereitstand, und unterzeichnete das Schriftstück, ohne sich darum zu scheren, ob er als Erster an der Reihe war, und so, wie er vier Jahre später dem Papst die Krone aus den Händen nehmen und sie Joséphine auf das Haupt setzen würde, drückte er ihr jetzt die Feder in die Hand.
Joséphine unterzeichnete.
Die Feder wurde von ihr an Madame de Sourdis weitergereicht, die sich mit einer gewissen instinktiven Unruhe vergebens nach dem Grafen von Sainte-Hermine umsah und, als sie ihn nirgends erblicken konnte, den Vertrag unterschrieb, um ihre Unruhe und die unerklärliche Angst, die sie überkam, vor den Anwesenden zu überspielen.
Doch nach ihr war der Graf an der Reihe, und nun suchten ihn alle Blicke vergebens.
Man musste ihn rufen. Er antwortete nicht.
Stille trat ein; die Gäste sahen einander verwundert an, außerstande, sich zu erklären, was dieses Verschwinden in einem solchen Augenblick und diese Missachtung jeglicher Formen zu bedeuten haben mochten.
Schließlich fand sich jemand, der sagte, während des Verlesens des Vertrags sei ein unbekannter junger Mann von ausgesuchter Eleganz in den Raum eingedrungen, habe dem Grafen etwas zugeflüstert und ihn mitgenommen, und der Graf sei ihm gefolgt, wie man dem Henker folgt, nicht aber einem Freund.
Aber vielleicht hatte der Graf nur den Salon verlassen und nicht das Haus.
Madame de Sourdis ließ einen Diener kommen und wies ihn an, sich mit anderen Dienern auf die Suche nach dem Grafen zu machen.
Gesagt, getan. Während einiger Minuten waren neben dem schweren Atmen sechshundert höchst überraschter Anwesender nur die Rufe der Lakaien über die Etagen hinweg zu hören.
Schließlich kam einer der Lakaien auf die Idee, die Kutscher im Hof zu befragen. Mehrere von ihnen hatten zwei junge Männer, einen davon ohne Kopfbedeckung, von der Freitreppe eilen und mit den Worten: »Zur Eilpost!« in einen Wagen springen sehen. Der Wagen war im Galopp losgefahren. Und einer der Kutscher hatte in dem jungen Mann ohne Kopfbedeckung den Grafen von Sainte-Hermine erkannt.
Die Gäste sahen einander in stummer Verblüffung an, bis eine Stimme in das Schweigen sagte: »Wagen und Eskorte für den Ersten Konsul!«
Ehrerbietig machte man Platz für Monsieur und Madame Bonaparte und Madame Louis Bonaparte, doch kaum hatten sie den Salon verlassen, als alle anderen in wilder Hast aufbrachen und hinausstürzten, als stünden die Gemächer in Flammen.
Weder Madame de Sourdis noch Claire versuchten irgendjemanden aufzuhalten, und nach einer Viertelstunde waren sie allein.
Mit einem schmerzlichen Ausruf eilte Madame de Sourdis zu ihrer Tochter, die zitterte und kurz vor einer Ohnmacht zu stehen schien.
»O Mutter, Mutter!«, rief das junge Mädchen, das in Schluchzen ausbrach und sich, der Ohnmacht nahe, in die Arme der Gräfin warf, »die Weissagung der Sibylle ist eingetreten, und meine Witwenschaft nimmt ihren Anfang!«
23
Die Fußbrenner
Erklären wir unseren Lesern das unbegreifliche Verschwinden des Verlobten von Mademoiselle de Sourdis im Augenblick der Vertragsunterzeichnung – ein Verschwinden, das die Gäste in Erstaunen, die Gräfin in Mutmaßungen unausdenklichster Art und ihre Tochter in tränenreiche Verzweiflung gestürzt hatte.
Wie erinnerlich, hatte Fouché am Tag vor der Bekanntgabe seiner Entlassung den Chevalier de Mahalin empfangen und ihn beauftragt, im Westen Banden von Fußbrennern zu gründen, damit Fouché in sein Ministerium zurückgeholt würde.
Diese Banden machten sich bald bemerkbar, und keine vierzehn Tage nach dem Aufbruch des Chevaliers aus Paris sprach sich herum, dass zwei Landgüter in Buré und in Saulnaye von den Fußbrennern verwüstet worden waren.
Furcht und Schrecken verbreiteten sich im ganzen Morbihan.
Fünf Jahre lang hatte der Bürgerkrieg in diesem bejammernswerten Land getobt, doch unter den unmenschlichsten Taten, die begangen wurden, fand sich das schändliche Treiben des Fußbrennens nicht. Um dieser Form des Folterns zu begegnen, musste man bis zu den bösen Tagen unter Ludwig XV. und den religiösen Verfolgungen unter Ludwig XIV. zurückgehen.
Banden von zehn, fünfzehn, zwanzig Männern erschienen wie der Erde entsprossen, bewegten sich wie Schatten, folgten dem Verlauf von Schluchten, stiegen über Reisigzäune, so dass der Bauer, der sich verspätet hatte und sie in der Dunkelheit vorbeiziehen sah, sich voller Schrecken hinter Bäumen versteckte oder am Fuß einer Hecke zu Boden warf; dann drangen sie unvermutet durch ein offen stehendes Fenster, eine nachlässig geschlossene Tür in einen Bauernhof oder ein Schloss ein, überraschten und würgten die Bediensteten, entfachten mitten in der Küche ein großes Feuer und zerrten den Hausherrn oder die Hausherrin zu diesem Feuer, legten ihr Opfer auf den Fußboden, führten seine Fußsohlen an das Feuer und hielten sie hinein, bis das Opfer die Schmerzen nicht mehr ertrug und verriet, wo es sein Geld versteckt hatte; manchmal ließen die Banditen dann Gnade walten, doch andere Male, wenn sie nach erfolgtem Geständnis fürchteten, man könne sie wiedererkennen, erstachen, erhängten oder erschlugen sie die von ihnen Bestohlenen.
Nach dem dritten oder vierten Überfall dieser Art, von den Behörden als Brandstiftung und Mord klassifiziert, wurde gemunkelt – erst leise, dann immer lauter, Cadoudal persönlich führe diese Banden an. Anführer und Banditen waren maskiert, doch jene, welche die stärkste dieser nächtlichen Einheiten gesehen hatten, beteuerten, in dem Kommandanten an seiner Größe, seiner Haltung und vor allem an seinem großen runden Kopf Georges Cadoudal erkannt zu haben.
Zuerst wollte niemand so etwas glauben; jeder wusste, wie ritterlich Georges war, und niemand konnte sich vorstellen, dass er sich unversehens in einen elenden, schamlosen und erbarmungslosen Anführer von Fußbrennern verwandelt haben sollte.
Dennoch verbreitete sich das Gerücht wie von allein; immer wieder wurde behauptet, man habe Georges gesehen, und schon bald verkündete Le Journal de Paris, Georges Cadoudal habe unter Missachtung seines Ehrenworts, nicht als Erster wieder zu den Waffen zu greifen, verlassen von seinen Männern, an die fünfzig Banditen zusammengetrommelt, mit denen er nun raubend und plündernd durch die Lande zog.
Le Journal de Paris wurde auch in London ausgeliefert; vielleicht wäre die Zeitung Cadoudal nie zu Augen gekommen, doch ein Freund wies ihn darauf hin. Er las darin die Anschuldigung, die gegen ihn erhoben wurde und die eine unüberbietbare Schmähung seiner Ehre und seiner Loyalität darstellte.
»Wohlan«, sagte er, »indem sie mir das vorwerfen, brechen sie das Bündnis, das wir geschlossen hatten: Mit Schwert und Gewehr konnten sie mir nichts anhaben, deshalb haben sie zur Verleumdung gegriffen. Sie wollen den Krieg? Den können sie haben.«
Und am selben Abend bestieg Georges ein Fischerboot, das ihn fünf Tage später an der Küste Frankreichs zwischen Port-Louis und der Halbinsel Quiberon absetzte.
Zur gleichen Zeit wie er machten sich zwei Männer namens Saint-Régeant und Limoëlan auf den Weg von London nach Paris, doch durch die Schlucht von Biville und durch die Normandie. Sie hatten am Tag ihrer Abreise eine Stunde mit Georges verbracht und ihre Anweisungen von ihm erhalten.
Limoëlan war mit allen Wassern des Bürgerkriegs gewaschen, und Saint-Régeant war ein ehemaliger Marineoffizier, der vor nichts zurückschreckte und Pirat zu Lande geworden war, nachdem er Pirat zur See gewesen war. Auf solche ehrlosen Gesellen anstelle eines Guillemot oder Sol de Grisolles musste Cadoudal sich bei seinen neuen Vorhaben stützen.
Zweifellos würden sie sich irgendwo vereinen, und sicherlich konnten sie unterwegs miteinander Kontakt halten; es stand außer Frage, dass sie zu ein und demselben Ziel aufgebrochen waren. Doch überstürzen wir nichts.
Im späten April 1804 ritt gegen fünf Uhr abends ein in einen Mantel eingemummter Mann in den Hof des Bauernhofs von Plescop ein, der dem reichen Bauern Jacques Doley gehörte.
Außer Jacques Doley wohnten auf dem Hof seine sechzigjährige Schwiegermutter, seine dreißigjährige Frau und ihre Kinder, ein Knabe von zehn Jahren und ein siebenjähriges Mädchen.
Ein Dutzend Landarbeiter kam hinzu, Männer und Frauen.
Der Vermummte verlangte, den Hausherrn zu sprechen, schloss sich mit ihm für eine halbe Stunde ein und ward nicht mehr gesehen. Jacques Doley kehrte allein zu seiner Familie zurück.
Während des Abendessens fielen Doleys Schweigsamkeit und Geistesabwesenheit auf. Mehrmals richtete seine Frau das Wort an ihn, ohne dass er antwortete. Nach der Mahlzeit wollten die Kinder wie gewohnt mit ihm spielen, doch er wies sie sanft ab.
Wie man weiß, speisen die Dienstboten in der Bretagne mit ihrer Herrschaft am selben Tisch; auch sie bemerkten an diesem Tag die Geistesabwesenheit und Bekümmertheit Jacques Doleys, umso mehr, als er an und für sich ein fröhlicher Mensch war.
Da wenige Tage zuvor das Schloss von Buré überfallen worden war, hatten die Tagelöhner das ganze Essen über leise von diesem Geschehen gesprochen. Doley hatte zugehört, mehrmals den Kopf erhoben, als wolle er etwas fragen, ohne den Mund aufzumachen, und weiter zugehört. Nur die alte Frau hatte sich ab und zu bekreuzigt, und gegen Ende des Berichts hatte sich Madame Doley, die sich vor Furcht nicht mehr zu helfen wusste, neben ihren Mann gesetzt.
Es war acht Uhr abends, und die Dunkelheit war hereingebrochen; zu dieser Stunde pflegten sich alle Landarbeiter zurückzuziehen, die einen in ihre Scheunen, die anderen in ihre Ställe. Doley machte den Eindruck, als wolle er sie nicht gehen lassen, denn er gab ihnen immer wieder etwas zu tun auf, was sie in seiner Nähe hielt, und immer wieder betrachtete er die zwei, drei zweiläufigen Gewehre, die neben dem Kamin hingen, als gelüste es ihn, sie im Zweifelsfall zu benutzen und nicht dort hängen zu lassen.
Nach und nach gingen alle zu Bett.
Zuletzt brachte die alte Mutter die Kinder in ihre Bettchen zwischen dem Elternbett und der Wand, kam, um Schwiegersohn und Tochter einen Gutenachtkuss zu geben, und begab sich ebenfalls zur Ruhe in eine Kammer neben der Küche.
Daraufhin verließen Doley und seine Frau die Küche und zogen sich in ihr Schlafzimmer zurück, das mit der Küche durch eine Glastür verbunden war und zwei Fenster zum Garten hatte, verschlossen mit soliden eichenen Fensterläden, an deren oberem Ende sich zwei kleine rautenförmige Öffnungen befanden, die bei geschlossenen Läden gerade genug Licht einfallen ließen, dass man sich im Zimmer zurechtfand.
Es war die Stunde, zu der sich Madame Doley für gewöhnlich auskleidete und zu Bett begab. Auf dem Bauernhof steht man früh auf und geht früh zu Bett; doch an diesem Abend, an dem Madame Doley sich von unbenennbaren Ängsten heimgesucht sah, konnte sie sich nicht dazu durchringen, sich zu entkleiden; zu guter Letzt entschied sie sich dazu, doch sie verlangte von ihrem Mann, vorher mit ihr alle Türen zu kontrollieren und sich zu vergewissern, dass sie auch abgeschlossen waren.
Doley war einverstanden, zuckte die Schultern, als hielte er diese Vorsichtsmaßnahme für übertrieben, und begann die Patrouille mit der Untersuchung der Fenster und Türen der Küche; die erste Tür, an die sie gelangten, führte in die Molkerei, doch da die Molkerei keine Außentür besaß, gab Madame Doley sich damit zufrieden, dass ihr Mann sagte: »Diesen Raum kann man nur von der Küche aus betreten, und die Küche haben wir seit dem Nachmittag nicht verlassen.«
Dann untersuchten sie die Tür zum Hof, die mit einem Eisenriegel und zwei Vorhängeschlössern versperrt war.
Das Fenster war ebenfalls zu.
Die Tür zur Backstube war mit einer Eichentür verschlossen, deren Schloss von außen nicht zu öffnen war.
Es blieb die Tür zum Garten, doch um sie von draußen zu erreichen, musste man zuerst über eine Mauer von zehn Fuß Höhe springen oder sich durch eine andere Tür Einlass verschaffen.
Madame Doley ging erleichtert zurück; ein unerklärliches Gefühl der Unruhe konnte sie dennoch nicht abschütteln.
Doley setzte sich an seinen Schreibtisch und tat so, als sähe er seine Unterlagen durch; trotz aller Selbstbeherrschung konnte er seine Besorgnis nicht verbergen, die sich durch unwillkürliche Zuckungen und durch seine Aufmerksamkeit für die geringsten Geräusche verriet.
Falls diese Besorgnis mit der Warnung vor der Gefahr zusammenhing, die ihm an diesem Tag erteilt worden war, dann war sie wohlbegründet.
Gegen ein Uhr morgens verließ den Wald von Meucon in der Nähe der Ortschaft Plescop eine Gruppe von zwanzig Mann, die sich über die Felder bewegte.
Wie eine Vorhut ritten vier Männer voraus, in die Uniform der Nationalgendarmen gekleidet; die Übrigen folgten ihnen ohne Uniform, mit Gewehren und Mistgabeln bewaffnet.
Diese Truppe gab sich größte Mühe, nicht gesehen zu werden; sie schlich Hecken entlang, stieg in Schluchten, kletterte Hügel entlang und näherte sich immer wieder Plescop, bis sie keine hundert Schritte mehr von dem Ort entfernt war.
Dann machte sie halt, um zu beratschlagen.
Als Nächstes löste einer der Männer sich aus der Gruppe und beschrieb einen Bogen, bevor er sich dem Bauernhof näherte, während die anderen warteten.
Der Aufklärer kam zurück; er hatte den Bauernhof umrundet, aber keine Stelle gefunden, an der man eindringen konnte; es wurde abermals beratschlagt, und man beschloss, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen, da es mit List nicht möglich war.
Die Bande setzte sich in Bewegung und blieb erst am Fuß der Mauer stehen.
Seit einiger Zeit war Hundegebell zu vernehmen, ohne dass man hätte sagen können, ob es von dem Bauernhaus oder von einem der benachbarten Häuser aus ertönte.
Am Fuß der Mauer wussten die Eindringlinge nicht weiter; zwischen ihnen und dem Hund lag offenbar nur die Mauer. Sie machten einige Schritte der Tür entgegen, der Hund begleitete sie jenseits der Mauer mit wütendem Gebell.
Von einem Überraschungsüberfall konnte nicht mehr die Rede sein; sie waren entdeckt.
Die als Gendarmen verkleidete Vorhut saß ab und trat an die Tür, während die übrigen Banditen sich am Fuß der Mauer verbargen.
Der Hund hatte zur gleichen Zeit die Tür erreicht und kläffte erbitterter denn je, wobei er die Schnauze in den Türspalt zu quetschen versuchte.
Die Stimme eines Mannes ertönte. »Was ist los, Blaireau? Was ist los, mein braver Hund?«
Der Hund lauschte auf die Stimme und ließ ein schmerzliches Jaulen ertönen.
Weiter weg rief eine Frauenstimme: »Du wirst doch nicht etwa die Tür aufmachen!«
»Und warum nicht?«, fragte die Männerstimme.
»Weil das Briganten sein könnten, du Dummkopf!«
Dann verstummten beide.
»Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie!«, wurde von draußen gerufen.
»Wer sind Sie, dass Sie im Namen des Gesetzes sprechen?«, fragte die Männerstimme, die dem Gärtner gehörte.
»Wir kommen von der Gendarmerie in Vannes, um den Bauernhof von Meister Doley zu durchsuchen, den man beschuldigt, Chouans zu beherbergen.«
»Hör nicht auf sie, Jean«, sagte seine Frau, »das ist eine Lüge. Begreife doch: Sie sagen das nur, damit du sie hereinlässt!«
Jean war zweifellos der Ansicht seiner Frau, denn er trug lautlos eine Leiter von einer Seite der Mauer zur anderen und stieg geräuschlos hinauf; als er oben angekommen war, sah er die vier Männer zu Pferde und die zwölf oder fünfzehn Männer, die sich am Fuß der Mauer zu verbergen trachteten.
Unterdessen riefen die als Gendarmen verkleideten Männer weiter: »Öffnen Sie im Namen des Gesetzes!«, und drei oder vier andere hieben mit ihren Gewehrkolben auf die Tür ein, um sie mit Gewalt zu öffnen.
Der Lärm dieser Hiebe war bis in das Schlafzimmer des Hausherrn gedrungen und hatte Madame Doleys Ängste ins Unermessliche gesteigert. Unter dem Eindruck des Entsetzens seiner Frau zögerte Doley an der Tür, bis der Unbekannte aus der Molkerei trat, ihn am Arm ergriff und sagte: »Worauf warten Sie? Sagte ich nicht, dass ich die Verantwortung für alles übernehme?«
»Mit wem sprichst du da?«, rief Madame Doley.
»Mit niemandem«, erwiderte Doley und wendete sich zum Garten.
Kaum hatte er die Tür geöffnet, hörte er alles, was sich zwischen dem Gärtner, dessen Frau und den Banditen abspielte. Obwohl Doley sich so wenig wie sein Gärtner von der List täuschen ließ, rief er mit gespielter Einfalt: »He, Jean, warum weigern Sie sich, den Gendarmen zu öffnen? Sie wissen doch, dass wir uns schuldig machen, wenn wir uns den Behörden widersetzen! Entschuldigen Sie ihn, meine Herren«, fuhr er fort, während er zur Tür ging, »er hat nicht in Befolgung meiner Anordnungen gehandelt.«
Jean hatte seinen Herrn erkannt und warf sich ihm jetzt in den Weg. »Oh, Meister Doley!«, rief er, »nicht ich täusche mich, sondern Sie gehen diesen Spitzbuben auf den Leim; es sind keine Gendarmen, sondern Straßenräuber, die sich als Gendarmen verkleidet haben. Bei allem, was Ihnen heilig ist, öffnen Sie ihnen nicht!«
»Ich weiß, was ich zu tun habe«, erwiderte Jacques Doley, »geh zurück in deine Wohnung und schließ dich ein oder versteck dich mit deiner Frau im Weidendickicht, denn dort werden sie nicht nach dir suchen.«
»Aber Sie! Aber Sie! Aber Sie!«
»Ich habe jemanden bei mir, der versprochen hat, mich zu verteidigen.«
»Holla, wird uns jetzt geöffnet?«, rief der Anführer draußen mit Donnerstimme, »oder muss ich erst die Tür einschlagen?«
Und die Kolbenhiebe, die unmittelbar auf seine Drohung folgten, hoben die Tür aus den Angeln.
»Aber ich habe doch gesagt, dass ich Ihnen öffne«, rief Jacques Doley, und er öffnete die Tür.
Die Banditen stürzten sich auf ihn und packten ihn am Schlafittchen.
»Oh, meine Herren«, sagte er, »vergessen Sie nicht, dass ich Ihnen aus freien Stücken geöffnet habe, vergessen Sie nicht, dass ich an die zehn Männer auf meinem Hof habe, mit deren Hilfe ich mich hätte verbarrikadieren können, so dass Sie uns nur unter großen Verlusten überwältigt hätten.«
»Du dachtest doch, du hättest es mit den Gendarmen zu tun und nicht mit uns.«
Jacques wies auf die Leiter, die an der Mauer lehnte. »Das hätte ich geglaubt, wenn Jean euch nicht von der Mauer aus gesehen hätte.«
»Und was versprechen Sie sich davon, dass Sie uns öffnen?«
»Dass Sie weniger hart sein werden: Hätte ich Ihnen nicht geöffnet, wären Sie imstande, vor Zorn meinen Hof abzubrennen.«
»Und woher willst du wissen, dass wir deinen Hof nicht vor Freude abbrennen werden?«
»Das wäre eine unnötige Grausamkeit. Ihr wollt mein Geld, ihr sollt es haben; doch meinen Ruin könnt ihr nicht wollen.«
»Wohlan«, sagte der Anführer, »dieser Mann ist wenigstens vernünftig. Und hast du viel Geld?«
»Nein, denn ich habe vor acht Tagen meine Steuern bezahlt.«
»Zum Teufel! Das sind schlechte Neuigkeiten, die du uns da auftischst.«
»Sie mögen schlecht sein, sind aber um nichts weniger wahr.«
»Dann hat man uns wohl schlecht informiert, denn wir haben gehört, wir würden bei dir ein Vermögen finden.«
»Man hat euch belogen.«
»Einen Georges Cadoudal belügt man nicht.«
Während dieses Wortwechsels hatten sie sich dem Haus genähert, und jetzt wurde Jacques Doley in die Küche geschubst. Die Fußbrenner, die so viel Kaltblütigkeit nicht gewohnt waren, betrachteten ihn mit größtem Erstaunen.
»Meine Herren, meine Herren«, sagte Madame Doley, die unterdessen aufgestanden war und sich angekleidet hatte, »wir geben Ihnen gerne alles, was wir haben, und Sie werden uns doch nichts antun, nicht wahr?«
»Na«, sagte einer der Räuber, »du kommst mir vor wie das Schwein, das quiekt, bevor es abgestochen wird.«
»Genug geplaudert«, sagte der Anführer, »her mit dem Geld!«
»Frau«, sagte Doley, »gib die Schlüssel heraus. Die Herren werden selbst suchen, dann können sie uns nicht vorwerfen, wir wollten sie betrügen.«
Die Bäuerin sah ihren Mann erstaunt an.
»Tu es«, sagte er. »Wenn ich sage: Tu es, dann tu es.«
Die arme Frau konnte nicht verstehen, warum ihr Mann tat, was die Banditen verlangten. Sie lieferte die Schlüssel aus und sah voller Schrecken, dass der Anführer sich einem ihrer Schränke aus Nussbaum näherte, in dem die Bauern alles aufbewahren, was ihnen kostbar ist, angefangen mit ihrer Wäsche.
Das Silberbesteck befand sich in einer Schublade.
Der Anführer holte es heraus und warf es auf den Küchenboden, doch zur Verblüffung der Bäuerin waren es nur sechs Bestecke statt acht.
In der zweiten Schublade befanden sich ein Beutel mit Silbergeld und ein Beutel mit Gold im Wert von insgesamt fünfzehntausend Francs, doch der Räuber konnte wühlen, so viel er wollte, er fand – zum wachsenden Erstaunen der Bäuerin – nur den Beutel mit Silber.
Die Bäuerin sah ihren Mann an, der ihren Blick nicht erwiderte, doch einer der Fußbrenner bemerkte ihn.
»Oho, Mütterchen«, sagte er, »dein edler Gatte will uns wohl hinters Licht führen?«
»O nein«, rief sie, »ich schwöre Ihnen -«
»Oder du weißt mehr als er. Dann wollen wir mit dir anfangen.«
Die Fußbrenner leerten den Schrank, fanden aber nichts weiter. Im nächsten Schrank fanden sie nichts als vier Louisdors, fünf oder sechs Münzen im Wert von sechs Francs und Kleingeld, das in einer Holzschale versteckt war.
»Vielleicht hast du recht«, sagte der Anführer zu dem Briganten, der die Bäuerin beschuldigt hatte, sie zu betrügen.
»Man hat ihn vor uns gewarnt, und er hat sein Geld vergraben«, sagte einer der Banditen.
»Tod und Teufel!«, fluchte der Anführer. »Wer wie wir die Toten aus der Erde herbeischaffen kann, der wird erst recht Geld herbeischaffen können. Los, her mit einem Bündel Reisig und einem Büschel Stroh!«
»Wozu das?«, rief die Bäuerin schreckerfüllt.
»Hast du etwa noch nie gesehen, wie man ein Schwein am Spieß brät?«, fragte der Anführer.
»Jacques! Jacques!«, lamentierte die Bäuerin. »Hörst du, was sie sagen?«
»Gewiss höre ich es«, sagte der Bauer, »aber was soll ich tun, sie haben das Sagen, wir müssen sie gewähren lassen.«
»Gnädiger Herr im Himmel!«, rief die Frau verzweifelt, als sie zwei Banditen aus der Backstube treten sah, die ein Strohbüschel und ein Bündel Ginster mitbrachten. »Und du lässt sie einfach gewähren!«
»Ich hoffe, dass Gott eine so abscheuliche Untat wie die Vernichtung zweier seiner Geschöpfe nicht zulassen wird, zweier Geschöpfe, die vielleicht nicht frei von Sünde sind, aber frei von jedem Verbrechen.«
»Ha, ha!«, sagte der Anführer der Bande. »Wird er eigens einen Engel schicken, der dir gegen uns beistehen soll?«
»Es wäre nicht das erste Mal«, sagte Jacques, »dass er ein solches Wunder wirkte.«
»Nun, das werden wir sehen«, sagte der Anführer, »und damit er Gelegenheit hat, zwei Fliegen auf einen Streich zu erlegen, wollen wir Eber und Bache gemeinsam anzünden.«
Schallendes Gelächter war die Antwort seiner Leute auf diesen grobschlächtigen Scherz.
Die Briganten stürzten sich auf Jacques Doley, rissen ihm die Schlappen von den Füßen und Hosen und Strümpfe von den Beinen, zogen seiner Frau den Unterrock aus und fesselten Mann und Frau mit den Händen auf dem Rücken; dann schoben sie beide an den Schultern dem lodernden Feuer entgegen, bis ihre Füße es fast berührten.
Bauer und Bäuerin stießen gleichzeitig einen Schmerzensschrei aus.
»Wartet!«, brüllte einer der Briganten, »ich habe die Frischlinge gefunden, die müssen mit Vater und Mutter ins Feuer!«
Und er kam herein, an jeder Hand ein Kind hinter sich herzerrend; er hatte die Kinder zitternd und weinend in der Bettritze des Elternbetts aufgestöbert.
Das war mehr, als Jacques Doley ertragen konnte. »Wenn Sie ein Mann sind, dann halten Sie jetzt Ihr Wort!«, rief er.
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als die Tür der Molkerei aufgestoßen wurde und ein Mann heraustrat, mit hängenden Armen, doch in jeder Hand eine Pistole.
»Welcher von euch nennt sich Georges Cadoudal?«, fragte er.
»Ich«, sagte der größte und dickste der Maskierten und richtete sich zu voller Größe auf.
»Du lügst«, sagte der Fremde.
Er zückte eine Pistole und schoss den anderen in die Brust. »Ich bin Cadoudal«, sagte er.
Der Tote stürzte mit voller Wucht zu Boden, und die Banditen traten erschrocken zurück, denn sie erkannten, dass ihnen tatsächlich der wahre Cadoudal gegenüberstand, den sie in England gewähnt hatten.
24
Gegenordre
Kein Mann im ganzen Morbihan hätte es gewagt, die Hand gegen Cadoudal zu erheben, oder gezögert, seine Befehle zu befolgen. Der Unteranführer der Bande, der die zwei Kinder noch an der Hand hielt, setzte sie ab und trat zu Cadoudal mit den Worten: »General, was befehlen Sie?«
»Binden Sie zuerst das bedauernswerte Paar los.«
Die Banditen stürzten sich auf Bauer und Bäuerin und lösten im Handumdrehen die Fesseln. Die Frau ließ sich in einen Lehnstuhl sinken, nahm ihre Kinder in die Arme und presste sie ans Herz. Der Mann erhob sich, ging zu Cadoudal und drückte ihm die Hand.
»Und jetzt?«, fragte der »Offizier«.
»Jetzt«, sagte Cadoudal, »will ich wissen, ob es stimmt, dass ihr drei Banden seid.«
»Ja, General.«
»Wer hat euch dazu angestiftet, euch zusammenzurotten und dieses verabscheuenswürdige Gewerbe zu betreiben?«
»Es ist jemand aus Paris gekommen, der uns versichert hat, Sie würden vor Ablauf eines Monats zu uns stoßen, und der uns in Ihrem Namen befohlen hat, uns zu sammeln.«
»Als Chouans, das würde ich ja noch verstehen, aber als Fußbrenner! Bin ich vielleicht ein Fußbrenner?«
»Man hat uns sogar gesagt, wir sollten den zum Anführer machen, der Georges II. hieß, weil er Ihnen so ähnlich sah, damit jeder glaubt, dass Sie unter uns weilen. Wie sollen wir unser Vergehen jetzt sühnen?«
»Euer Vergehen besteht darin, dass ihr geglaubt habt, ich wäre imstande, Anführer einer Bande von Fußbrennern zu werden, und dafür gibt es keine Sühne. Bringt auf der Stelle den anderen Truppen meinen Befehl, sich zu zerstreuen und vor allen Dingen mit ihrem schändlichen Treiben aufzuhören. Dann benachrichtigt alle ehemaligen Anführer, insbesondere Sol de Grisolles und Guillemot, dass sie die Waffen wieder ergreifen und sich bereithalten sollen, auf mein Geheiß erneut in den Kampf zu ziehen. Aber kein Schritt, keine Handlung ohne meinen ausdrücklichen Befehl!«
Ohne ein Wort, beinahe lautlos, zogen die Banditen sich zurück.
Der Bauer und seine Frau räumten ihre Schränke wieder ein, die Wäsche in die Fächer, das Silberbesteck in die Schubladen. Nach einer halben Stunde waren keine Spuren des Überfalls mehr zu sehen.
Madame Doley hatte sich nicht getäuscht: Ihr Ehemann hatte tagsüber seine Vorkehrungen getroffen. Er hatte den größten Teil des Silbergeschirrs, einen Teil des Bestecks und die Goldmünzen im Wert von ungefähr zwölftausend Francs in ein sicheres Versteck gebracht.
Von allen Bauern ist der Bretone der misstrauischste und vielleicht auch der vorausschauendste. Trotz Cadoudals Wort hatte Doley geargwöhnt, dass die Sache schlecht ausgehen könnte, und für diesen Fall wollte er wenigstens den größeren Teil seines Vermögens in Sicherheit wissen, was ihm auch gelungen war.
Jean und seine Frau wurden benachrichtigt, und die Türen wurden geschlossen, nachdem der Leichnam Georges’ II. hinausgeschafft worden war. Cadoudal, der seit dem Morgen nichts gegessen hatte, speiste so ungerührt zu Abend, als wäre nichts geschehen; er lehnte das Bett ab, das der Bauer ihm anbot, und schlief in der Scheune im frischen Stroh.
Am nächsten Tag kam Cadoudals einstiger Adjutant Sol de Grisolles, kaum dass Cadoudal auf den Beinen war. Sol de Grisolles wohnte in Auray, zweieinhalb Wegstunden von Plescop entfernt. Einer der Briganten hatte ihn sofort benachrichtigt, in der Hoffnung, damit Gnade vor Cadoudal zu finden.
Sol de Grisolles war nicht wenig erstaunt, Cadoudal wiederzusehen: Wie alle Welt hatte er ihn in London geglaubt.
Cadoudal erzählte ihm, was vorgefallen war; auf dem Küchenboden waren noch Ruß und Blutspuren zu sehen.
Offensichtlich hatte die Polizei ein Komplott geschmiedet, um das Abkommen mit Bonaparte zu unterminieren, indem man Cadoudal beschuldigte, es gebrochen zu haben. Falls sich das so verhielt, stand es Cadoudal frei zu tun, was er wollte; und darüber wollte er sich mit Sol de Grisolles beraten.
Als Erstes wollte er sich unmittelbar an Bonaparte wenden und ihm schreiben, dass er aufgrund des Vorgefallenen sein Wort zurücknehme; nachdem er ihm einwandfrei dargelegt hätte, dass er mit den neuen Mordbrennereien im Westen nichts zu tun hatte und ihnen sogar unter Einsatz des eigenen Lebens ein Ende bereitet hatte, würde er ihm den Krieg erklären – nicht von Herrscher zu Herrscher, denn einen solchen Krieg konnte er nicht finanzieren, sondern einen Rachefeldzug in korsischer Manier. Und Sol de Grisolles war dazu ausersehen, Bonaparte die Vendetta anzukündigen.
Sol de Grisolles sagte ohne Widerrede zu; er gehörte zu denen, die dem, was sie für ihre Pflicht halten, nie ausweichen.
Als Nächstes sollte Sol de Grisolles Laurent ausfindig machen, wo er sich auch befinden mochte, und ihn auffordern, seine Compagnons de Jéhu wieder zu sammeln und loszuschlagen, während Cadoudal keinen Augenblick verlieren und sich unverzüglich nach London zurückbegeben wollte, um von dort nach Paris aufzubrechen und seine Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Tatsächlich verabschiedete Cadoudal sich von seinen Gastgebern, nachdem er Sol de Grisolles seine Anweisungen erteilt hatte, bat sie um Verzeihung, dass ihr Haus als Schauplatz der schrecklichen Szenen hatte dienen müssen, die sich dort abgespielt hatten, stieg auf sein Pferd, und während Sol de Grisolles sich nach Vannes aufmachte, ritt Cadoudal zu dem Strand von Erdeven und Carnac, wo sein Fischerboot zu Wasser wartete.
Die Rückfahrt verlief so reibungslos wie die Herfahrt.
Drei Tage später war Sol de Grisolles in Paris und erbat sich beim Ersten Konsul einen Geleitbrief und einen Gesprächstermin wegen einer Sache von höchster Dringlichkeit.
Der Erste Konsul schickte Duroc. Sol de Grisolles entschuldigte sich mit der Höflichkeit eines Edelmanns und erklärte, nur General Bonaparte mitteilen zu können, was General Cadoudal ihm aufgetragen habe.
Duroc ging zurück und kam wieder, um Sol de Grisolles zu holen.
Sol de Grisolles fand Bonaparte empört und voller Zorn auf Cadoudal vor. Bonaparte ließ Cadoudals Abgesandten gar nicht erst zu Wort kommen. »So also«, sagte er, »hält Ihr General sein Wort! Er verspricht, sich nach London zurückzuziehen, und stattdessen verschanzt er sich im Morbihan, wo er Banden aushebt, mit denen er dem Gewerbe des Fußbrennens nachgeht und nach Herzenslust das Land unsicher macht wie ein Mandrin oder ein Poulailler! Aber ich habe meine Befehle gegeben, alle Behörden sind alarmiert, und wenn er gefasst wird, dann machen sie kurzen Prozess mit ihm wie mit dem erstbesten Hühnerdieb. Sagen Sie jetzt nicht, es sei alles nicht wahr: Le Journal de Paris hat darüber berichtet, und die Berichte stimmen mit den Auskünften meiner Polizei überein; zudem wurde er erkannt.«
»Würde der Erste Konsul mir gestatten, ihm zu antworten«, fragte Sol de Grisolles, »und ihm in wenigen Worten die Unschuld meines Freundes zu beweisen?«
Bonaparte zuckte die Schultern.
»Aber wenn Sie sich in fünf Minuten eingestehen müssten, dass Ihre Zeitungen und Polizeiberichte im Unrecht sind und dass ich recht habe, was würden Sie dann sagen?«
»Ich würde sagen... dass Régnier ein Idiot ist, weiter nichts.«
»Nun, General, die Ausgabe des Journal de Paris, in der gemeldet wurde, Cadoudal habe Frankreich gar nicht verlassen, sondern Räuberbanden im Morbihan ausgehoben, kam ihm in London in die Hände; sofort hat er ein Fischerboot bestiegen und sich zur Halbinsel Quiberon begeben. Versteckt in einem Bauernhaus, das nachts von Fußbrennern überfallen wurde, hat er sein Versteck in dem Augenblick verlassen, in dem der Anführer dieser Bande, der sich seines Namens bediente, den Bauern foltern wollte. Dieser Bauer heißt Jacques Doley, das Landgut Plescop. Cadoudal trat auf den Bandenführer zu, erschoss ihn und sagte: ›Du lügst, Cadoudal bin ich.‹
General, er hat mir aufgetragen, Ihnen auszurichten, dass Sie oder wenigstens Ihre Polizei es waren, die ihn entehren wollten, indem Sie einen Mann, der ihm täuschend ähnlich sah und den man für ihn halten konnte, zum Anführer dieser Banden machten. Er hat sich an diesem Mann gerächt; er hat ihn mitten unter seinen Leuten getötet und hat die anderen aus dem Haus verjagt, in das sie eingedrungen waren, obwohl sie zwanzig Männer waren, während er allein war.«
»Was Sie da sagen, kann unmöglich wahr sein.«
»Ich habe den Toten mit eigenen Augen gesehen, und hier ist die Bestätigung des Bauernpaares.« Sol de Grisolles reichte dem Ersten Konsul die Niederschrift dessen, was er ihm erzählt hatte, abgezeichnet von Monsieur und Madame Doley.
»Und von diesem Augenblick an«, fuhr er fort, »hat er Sie von Ihrem Wort entbunden und sich von seinem Wort entbunden, und da er Ihnen nicht den Krieg erklären kann, denn seine Verteidigungsmittel haben Sie ihm genommen, erklärt er Ihnen die korsische Vendetta, den Krieg Ihrer Heimat. Seien Sie auf der Hut! Er wird auf der Hut sein!«
»Citoyen«, rief Duroc, »haben Sie vergessen, mit wem Sie es zu tun haben?«
»Ich habe es mit einem Mann zu tun, der uns sein Wort gab, wie wir ihm unseres gaben, der gebunden war wie wir und der so wenig wie wir das Recht hatte, es zu brechen.«
»Er hat recht, Duroc«, sagte Bonaparte. »Jetzt wüsste ich nur gern, ob er auch die Wahrheit sagt.«
»General, wenn ein Bretone sein Wort gibt...«, protestierte Sol de Grisolles.
»Auch ein Bretone kann sich täuschen oder getäuscht werden. Duroc, holen Sie mir Fouché.«
Zehn Minuten später stand Fouché im Kabinett des Ersten Konsuls.
Sobald Bonaparte den ehemaligen Polizeiminister erblickte, rief er: »Monsieur Fouché, wo ist Cadoudal?«
Fouché lachte. »Ich könnte Ihnen antworten, dass ich es nicht weiß.«
»Und warum?«
»Nun, schließlich bin ich nicht mehr Ihr Polizeiminister.«
»Oh, Sie wissen sehr wohl, dass Sie es nach wie vor sind.«
»In partibus, von mir aus.«
»Keine Scherze. Jawohl, in partibus sind Sie es. Ich werde Sie als solchen behandeln; Sie führen dieselben Spitzel, und Sie sind mir für alles verantwortlich, als wären Sie noch nominell Minister. Ich habe Sie gefragt, wo Cadoudal ist.«
»Um diese Zeit müsste er auf dem Rückweg nach London sein.«
»Er hatte England also verlassen?«
»Ja.«
»Und zu welchem Zweck?«
»Um einen Bandenchef zu erschießen, der sich erdreistet hat, seinen Namen zu benutzen.«
»Und hat er ihn erschossen?«
»Mitten unter seinen zwanzig Gefolgsleuten auf dem Landgut Plescop; aber Monsieur«, und er deutete auf Sol de Grisolles, »kann Ihnen mehr darüber sagen als ich, denn er war fast Zeuge der Ereignisse. Plescop liegt, wenn ich mich nicht täusche, nur zweieinhalb Meilen von Auray entfernt.«
»Wie! Das wussten Sie alles, und Sie haben mich nicht gewarnt?«
»Monsieur Régnier ist Polizeipräfekt, und Sie zu warnen ist seine Aufgabe; ich bin nur ein Privatier, ein Senator.«
»Es ist also wahr«, rief Bonaparte ungehalten, »dass ehrbare Leute in diesem Gewerbe einfach nicht zu gebrauchen sind!«
»Danke, General«, sagte Fouché.
»Ha! Die Grille fehlte Ihnen noch, sich als ehrbaren Mann ausgeben zu wollen. An Ihrer Stelle würde ich meinen Ehrgeiz auf andere Ziele richten, weiß Gott. Monsieur de Grisolles, danke für Ihren Besuch. Als Mann und Korse nehme ich die Vendetta an, die Cadoudal mir erklärt hat. Er sei auf der Hut, wie ich auf der Hut sein werde; doch wenn er gefasst wird, dann kenne ich keine Gnade.«
»So sieht er es auch«, sagte der Bretone mit einer tiefen Verbeugung. Dann verließ er das Kabinett des Ersten Konsuls und ließ diesen mit Fouché zurück.
»Sie haben es gehört, Monsieur Fouché: Die Vendetta ist erklärt, jetzt ist es an Ihnen, mich zu beschützen.«
»Machen Sie mich wieder zum Polizeiminister, und ich werde es tun.«
»Sie sind ein rechter Einfaltspinsel, Monsieur Fouché, mögen Sie sich für noch so geistreich halten. Je weniger Sie Polizeiminister sein werden – wenigstens in den Augen der Öffentlichkeit -, desto leichter werden Sie mich beschützen können, da man sich vor Ihnen nicht in Acht nehmen wird. Außerdem kann ich das Polizeiministerium nicht ohne stichhaltige Gründe wieder einrichten, nachdem ich es vor kaum zwei Monaten aufgelöst habe. Retten Sie mich aus einer großen Gefahr, und ich gebe es Ihnen zurück. Bis dahin gewähre ich Ihnen einen Kredit von fünfhunderttausend Francs auf Geheimgelder. Tun Sie sich keinen Zwang an, und wenn der Kredit ausgeschöpft ist, sagen Sie es mir. Aber vor allem will ich, dass Cadoudal kein Haar gekrümmt wird und man ihn lebend ergreift!«
»Man wird sich bemühen, aber dafür muss er zuerst nach Frankreich zurückkehren.«
»Oh, seien Sie unbesorgt, das wird er tun! Ich erwarte, von Ihnen zu hören.«
Fouché verneigte sich vor dem Ersten Konsul, eilte zu seinem Wagen zurück, sprang hinein und rief dem Kutscher zu: »Schnell nach Hause!«
Als er ausstieg, befahl er: »Man hole sofort Monsieur Dubois und wenn möglich Victor, einen seiner fähigsten Spitzel.«
Eine halbe Stunde später befanden sich die verlangten zwei Personen in Fouchés Kabinett.
Obwohl Monsieur Dubois nunmehr dem neuen Polizeipräfekten unterstand, hatte er Fouché die Treue gewahrt, und das nicht aus Prinzipientreue, sondern aus Eigennutz: Er wusste, dass Fouché sich nie länger als vorübergehend in Ungnade befinden würde und dass er selbst gut beraten wäre, ihn nicht als Menschen, sondern als Füllhorn der Fortuna zu betrachten, dem man keinesfalls die Treue aufkündigen durfte. Folglich war er zusammen mit drei oder vier anderen der schlauesten Spitzel weiterhin Fouché ergeben geblieben, und als Fouché ihn rufen ließ, kam er unverzüglich.
Auf dem Kaminsims waren Goldstücke in zwei Säulen angeordnet, als Dubois und der Polizeispitzel Victor das Kabinett des eigentlichen Polizeiministers betraten.
Der Spitzel Victor war als Mann aus dem Volk gekleidet, denn zum Umziehen war nicht genug Zeit geblieben.
»Wir wollten keine Sekunde verlieren«, sagte Dubois, »und ich habe Ihnen einen meiner zuverlässigsten Männer in der Kostümierung mitgebracht, die er trug, als ich Ihre Nachricht erhielt.«
Ohne zu antworten, trat Fouché zu dem Spitzel und sah ihn mit seinem scheelen Blick an. »Verwünscht aber auch, Dubois!«, sagte er, »das ist der falsche Mann.«
»Was für einen Mann hätten Sie gebraucht, Citoyen Fouché?«
»Ich muss einen bretonischen Rädelsführer verfolgen lassen, vielleicht in Deutschland, mit Sicherheit in England. Ich brauche einen Mann von Stand, der ihm unauffällig in Cafés folgen kann, in Clubs, notfalls in Salons. Ich brauche einen Gentleman, und Sie bringen mir einen Limousiner Bauernlümmel!«
»Oh, da haben Sie recht«, sagte der Agent, »Cafés, Clubs und Salons sind nicht mein Wirkungsgebiet, aber wenn Sie mich in eine Kneipe schicken, auf einen volkstümlichen Ball oder in ein Musiklokal, dann würden Sie sehen, dass ich mich dort wacker schlage.«
Dubois starrte ihn mit unverhohlenem Erstaunen an, doch der Agent machte ihm ein Zeichen, und Dubois begriff.
»Sie werden mir also«, sagte Fouché, »auf der Stelle jemanden besorgen, der sich auf einem Abendempfang bei dem englischen Prinzregenten sehen lassen kann. Ich werde ihm seine Instruktionen geben.« Dann nahm er zwei Louisdors von einem dritten Stapel Münzen und sagte zu dem Polizeispitzel Victor: »Nehmen Sie das, mein Freund, als Entschädigung dafür, dass Sie bemüht wurden; sollte ich Sie für Beobachtungen im volkstümlichen Milieu benötigen, werde ich Sie benachrichtigen lassen. Aber schweigen Sie über unser Gespräch.«
»Ich schweige«, sagte der Spitzel mit seinem Limousiner Akzent, »mit Vergnügen. Sie lassen mich rufen, Sie sagen mir nichts, und Sie geben mir zwei Louis, damit ich den Mund halte. Nichts leichter als das.«
»Schon gut, schon gut, junger Mann«, sagte Fouché, »verschwinde!«
Die Besucher stiegen in ihren Wagen, und Fouché bezeigte leichte Ungeduld, doch da er nicht genau genug erklärt hatte, was für einen Polizeispitzel er benötigte, wusste er, dass die Verzögerung seine Schuld war, und schwieg.
Lange musste er nicht warten. Nach einer Viertelstunde meldete man ihm denjenigen, den er erwartete.
»Ich sagte, man solle ihn einlassen!«, rief er ungeduldig. »Herein mit ihm!«
»Bin schon da, bin schon da, Citoyen«, sagte ein junger Mann von fünf- oder sechsundzwanzig Jahren mit schwarzem Haar und Augen, die vor Geist sprühten, untadelig gekleidet, der lebhaft, aber vollendet weltmännisch den Raum betrat. »Ich habe keinen Augenblick gesäumt, und hier bin ich!«
Fouché beäugte ihn durch sein Lorgnon. »Sehr gut!«, sagte er. »Das ist mein Mann!«
Und nach kurzem Schweigen, währenddessen er seine Musterung fortsetzte: »Sie wissen, worum es geht?«
»Gewiss doch, es geht darum, einen verdächtigen Citoyen zu beschatten, mit ihm nach Deutschland zu gehen, unter Umständen nach England; nichts leichter als das, ich spreche Deutsch wie ein Deutscher, Englisch wie ein Engländer; ich werde ihn beschatten und nicht aus den Augen lassen. Sie müssen ihn mir nur zeigen oder mir sagen, wo er sich aufhält; ich muss ihn einmal gesehen haben.«
»Er heißt Sol de Grisolles und ist Cadoudals Aide de Camp; er wohnt im Hotel L’Unité in der Rue de la Loi. Möglicherweise ist er schon abgereist; in diesem Fall müssten Sie in Erfahrung bringen, welchen Weg er eingeschlagen hat, und sich ihm an die Fersen heften. Ich muss über jeden seiner Schritte Bescheid wissen. Und das ist für Sie«, fügte Fouché hinzu und nahm die zwei Stapel Goldmünzen vom Kaminsims, »um Ihnen zu erleichtern, an Auskünfte zu kommen.«
Der junge Mann streckte seine elegant behandschuhte Hand aus und steckte das Geld ein, ohne nachzuzählen. »Muss ich Ihnen jetzt die zwei Louisdor des Limousiner Bauernlümmels zurückgeben?«, fragte der junge Stutzer.
»Wie! Die zwei Louisdor des Limousiner Bauernlümmels?«, wiederholte Fouché.
»Die Sie mir vorhin gegeben haben.«
»Sie waren das vorhin?«
»Gewiss, und der Beweis: Hier sind sie.«
»Gut«, sagte Fouché, »dann gehört Ihnen auch der dritte Stapel, aber als Belohnung. Gehen Sie jetzt, verlieren Sie keine Zeit; heute Abend will ich von Ihnen hören.«
»Das werden Sie.«
Der Spitzel ging, ebenso zufrieden mit Fouché wie dieser mit ihm.
Am Abend erhielt Fouché folgendes erstes Bulletin:
Ich habe im Hotel L’Unité in der Rue de la Loi ein Zimmer neben dem des Citoyen Sol de Grisolles genommen. Vom Balkon vor unseren vier Fenstern konnte ich sein Zimmer einsehen: Es enthält ein Kanapee, das, nützlich für Gespräche, an der Trennwand zu meinem Zimmer steht; ich habe ein Loch in die Wand gebohrt, das mir ermöglicht, alles zu sehen und zu hören, ohne mich aufzudrängen. Citoyen Sol de Grisolles hat den Mann, den er sehen wollte, im Hotel Mont-Blanc nicht angetroffen, er wird im Hotel L’Unité bis um zwei Uhr morgens auf ihn warten und hat dort mitgeteilt, er erwarte den späten Besuch eines Freundes.
Ich werde als unbekannter Dritter bei diesem Besuch anwesend sein.
DER LIMOUSINER
P.S. Morgen in aller Frühe ein zweites Bulletin.
Am nächsten Tag wurde Fouché bei Tagesanbruch mit einem zweiten Bulletin geweckt, das lautete wie folgt:
Der Freund, den Citoyen Sol de Grisolles erwartete, war der berüchtigte Bandit Laurent, genannt »der schöne Laurent«, der Anführer der Compagnons de Jéhu. Der Befehl, den Cadoudals Aide de Camp für Laurent hatte, war der, alle Mitstreiter an ihr Gelübde zu erinnern. Am kommenden Samstag sollen sie ihre Überfälle wiederaufnehmen und die Schnellpost von Rouen nach Paris im Wald von Vernon überfallen. Wer sich nicht einfindet, wird mit dem Tode bestraft.
Citoyen Sol de Grisolles reist um zehn Uhr vormittags nach Deutschland ab, und ich reise mit ihm; über Straßburg werden wir uns, soweit ich weiß, nach Ettenheim begeben, wo sich der Herzog von Enghien aufhält.
DER LIMOUSINER
Diese zwei Bulletins fielen als doppelter Sonnenstrahl auf Fouchés Schachbrett, denn ihr Licht erlaubte dem Polizeiminister in partibus, Cadoudals Schachbrett zu überschauen. Cadoudal hatte keine leere Drohung ausgestoßen, als er Bonaparte die Vendetta erklärte. Während seines Aufenthalts in Paris hatte er die Compagnons de Jéhu wiedererweckt, die er nur bis auf weiteres beurlaubt hatte, und seinen Adjutanten hatte er bis zum Wohnsitz des Herzogs von Enghien vorgeschickt. Überdrüssig der Ausflüchte des Sohns des Grafen von Artois und des Grafen von Artois – die einzigen Personen königlichen Geblüts, mit denen er zu tun gehabt hatte und die ihm stets nicht nur Geld und Männer versprochen hatten, sondern auch den Schutz ihrer königlichen Persönlichkeit, und die keines ihrer Versprechen gehalten hatten -, wandte er sich nun an den letzten Erben der kriegerischen Rasse der Condés, um zu erfahren, ob dieser ihm mehr zu bieten haben würde als fromme Wünsche und Ermunterungen.
Fouché, der seine Schlingen ausgelegt hatte, wartete ruhig wie eine Spinne in ihrem Netz.
Doch die Gendarmerie von Andelys und Vernon wurde beauftragt, Tag und Nacht gesattelte Pferde bereitzuhalten.
25
Der Herzog von Enghien (1)
Der Herzog von Enghien wohnte wie gesagt in dem Schlösschen von Ettenheim im Großherzogtum Baden am rechten Rheinufer, zwanzig Kilometer von Straßburg entfernt. Er war der Enkel des Prinzen von Condé, der wiederum Sohn ebenjenes Prinzen von Condé war, genannt »der Einäugige«, der Frankreich unter der Regentschaft des Herzogs von Orléans so teuer zu stehen gekommen war. Ein einziger Condé, der jung starb, trennt diesen Condé von dem sogenannten großen Condé, der seinen Beinamen seinem Sieg bei Rocroi verdankt, der den Tod Ludwigs XIII. erhellt, der Einnahme von Thionville und der Schlacht von Nördlingen, und der hinsichtlich seines Geizes, seiner verderbten Sitten und seiner kaltblütigen Grausamkeiten der wahre Sohn seines Vaters Heinrich II. von Bourbon war. Seine Gier nach dem Thron stachelte ihn dazu an, als Erster zu enthüllen, dass die zwei Söhne Annas von Österreich, Ludwig XIV. und der Herzog von Orléans, nicht von Ludwig XIII. gezeugt seien, was alles in allem durchaus wahr sein konnte.
Heinrich II. von Bourbon, dessen Name soeben fiel, ist derjenige, mit dessen Eintritt in die Geschichte das berühmte Haus Condé einen Charakterwandel durchmacht, vom Verschwender zum Geizhals wird und melancholisch statt fröhlich.
Denn obwohl die Geschichte ihn zum Sohn Heinrichs I. von Bourbon und Prinzen von Condé erklärt, erkennt die Chronik jener Zeit diese Herkunft nicht an, sondern schreibt ihm einen anderen Vater zu. Seine Frau Charlotte de la Trémouille lebte in ehebrecherischem Verhältnis mit einem gascognischen Pagen, als nach viermonatiger Abwesenheit ihr Ehemann unerwartet und unangemeldet zurückkam. Schnell hatte die Herzogin ihren Entschluss gefasst. Die Ehebrecherin ist bereits auf halbem Weg zur Mörderin: Sie bereitete ihrem Ehemann einen königlichen Empfang. Obwohl es Winter war, besorgte sie sich prachtvolle Früchte und teilte mit ihm die schönste Birne aus dem Korb, doch sie zerteilte sie mit einem Messer, dessen Schneide auf der einen Seite vergiftet war, und reichte ihm, wie man sich denken kann, die vergiftete Hälfte.
Der Prinz starb noch in derselben Nacht.
Charles de Bourbon, der sich in dem Glauben wähnte, Heinrich IV. davon zu unterrichten, sagte zu ihm: »Das ist die Folge der Exkommunikation durch den Papst Sixtus V.«
Heinrich IV., der sich kein Bonmot verkneifen konnte, erwiderte: »Ja, die Exkommunikation hat sicherlich nicht geschadet, aber es wurde nachgeholfen.«
Eine Untersuchung wurde durchgeführt, und die belastendsten Anschuldigungen wurden gegen Charlotte de la Trémouille gesammelt, bis Heinrich IV. sich die Prozessunterlagen geben ließ und sie allesamt ins Feuer warf; als man ihn nach dem Grund für dieses befremdliche Vorgehen fragte, sagte er: »Lieber soll ein Bastard den Namen Condé erben, als dass ein so großer Name ausgelöscht wird.«
Und ein Bastard erbte den Namen Condé und führte in die von ihm begründete parasitäre Linie verschiedene Laster ein, die es in der ursprünglichen Linie nicht gegeben hatte, darunter als eines der harmloseren die Liebe zur Revolte.
Als Romancier befindet man sich in einer schwierigen Situation: Übergeht man Einzelheiten wie diese, kann der Vorwurf erhoben werden, wir verstünden von der Geschichte nicht mehr als manche Historiker; enthüllen wir sie aber, beschuldigt man uns, die königlichen Häuser in Verruf bringen zu wollen.
Doch beeilen wir uns zu sagen, dass der junge Prinz Louis-Antoine-Henri de Bourbon keines der Laster Heinrichs II. von Bourbon besaß, den nur eine dreijährige Kerkerhaft seiner Frau annähern konnte, obwohl diese das schönste Geschöpf ihrer Zeit war, keines der Laster des großen Condé, dessen Liebschaft mit seiner Schwester Madame de Longueville Paris während der Fronde erheiterte, und keines der Laster des Louis de Condé, der als Regent die Gelder Frankreichs in seine Taschen und die der Madame de Prie umleitete.
Stattdessen war er ein schöner junger Mann von dreiunddreißig Jahren, der mit seinem Vater und dem Grafen von Artois emigriert war, der 1792 in das Korps der Emigranten am Rheinufer eingetreten war, der zweifellos acht Jahre lang gegen Frankreich gekämpft hatte, aber aus Voreingenommenheit, für die seine fürstliche Erziehung und seine königlichen Vorurteile verantwortlich waren. Als die Armee Condés aufgelöst wurde, anders gesagt nach dem Frieden von Lunéville, hätte der Herzog von Enghien nach England gehen können wie sein Vater, sein Großvater, die anderen Fürsten und das Gros der Emigranten, doch eine seinerzeit geheime und erst im Nachhinein bekannt gewordene Herzensangelegenheit hatte ihn dazu bewegt, sich in Ettenheim niederzulassen.
Dort lebte er wie ein beliebiger Bürger, denn sein gewaltiges Vermögen aus den Geschenken Heinrichs IV., den Besitztümern des enthaupteten Herzogs von Montmorency und den Früchten der Raubzüge Ludwigs des Einäugigen hatte die Revolution beschlagnahmt. Die Emigranten aus der Gegend von Offenburg besuchten ihn ehrerbietig. Bisweilen veranstalteten die jungen Leute im Schwarzwald große Jagdgesellschaften, bisweilen verschwand der Prinz sechs bis acht Tage lang und war plötzlich wieder da, ohne dass jemand gewusst hätte, wo er gewesen war, und dieses Verschwinden gab Anlass zu den unterschiedlichsten Vermutungen – Vermutungen, die der Prinz keineswegs entkräftete, ohne sich jemals eine Erklärung entlocken zu lassen, mochten die Mutmaßungen noch so verwegen sein.
Eines Vormittags kam ein Mann in Ettenheim an, der sich beim Prinzen anmelden lassen wollte. Er hatte den Rhein bei Kehl überquert und war über Offenburg gekommen.
Der Prinz war seit drei Tagen abwesend. Der Mann wartete.
Am fünften Tag kam der Prinz zurück. Der Fremde nannte seinen Namen und die Namen derer, in deren Auftrag er kam; obwohl der Besucher keineswegs darauf bestand, den Prinzen zu sehen, sondern nachdrücklich darum bat, dass der Prinz nach eigenem Gutdünken verfahre, ließ dieser es sich angelegen sein, ihn auf der Stelle zu empfangen.
Der Fremde war kein anderer als Sol de Grisolles.
»Schickt Sie der wackere Cadoudal?«, fragte der Prinz. »In einer englischen Zeitung las ich, dass er London verlassen haben soll, um in Frankreich eine Ehrenkränkung zu rächen, und danach nach London zurückgekehrt sei.«
Cadoudals Adjutant berichtete alles, wie es sich ereignet hatte, ohne Ausschmückungen und ohne Auslassungen, dann erläuterte er dem Prinzen seinen Auftrag, der darin bestanden hatte, dem Ersten Konsul die Vendetta zu erklären und Laurent in Cadoudals Namen aufzufordern, die Compagnons de Jéhu wieder zusammenzurufen, die Cadoudal zerstreut hatte.
»Haben Sie mir vielleicht noch etwas zu sagen?«, fragte der Prinz.
»So ist es, mein Prinz«, sagte der Bote. »Ich habe Ihnen zu sagen, dass ungeachtet des Friedens von Lunéville ein Krieg von ungeahnter Heftigkeit gegen den Ersten Konsul geführt werden wird; Pichegru, der sich mit Majestät Ihrem Vater zuletzt verständigen konnte, beteiligt sich an diesem Krieg mit allem Hass auf die französische Regierung, den ihm sein Exil in Sinnamary eingeflößt hat. Moreau, erzürnt über die laue Aufnahme seines Sieges bei Hohenlinden und erbittert darüber, dass die Rheinarmee und ihre Generäle nicht annähernd gewürdigt werden wie die Heere und Befehlshaber in Italien, wartet nur darauf, seine immense Beliebtheit in den Dienst einer Bewegung zu stellen. Und mehr noch: Es gibt etwas, wovon so gut wie niemand weiß und was ich Ihnen enthüllen soll, Prinz.«
»Und was ist das?«
»In der Armee bildet sich gerade eine Geheimgesellschaft.«
»Die Gesellschaft der Philadelphes.«
»Sie wissen davon?«
»Ich habe davon gehört.«
»Wissen Ihre Majestät, wer der Anführer ist?«
»Oberst Oudet.«
»Haben Sie ihn kennengelernt?«
»Einmal in Straßburg, ohne dass er wusste, wer ich bin.«
»Welchen Eindruck hat er auf Ihre Majestät gemacht?«
»Er machte mir den Eindruck, ziemlich jung und ziemlich leichtfertig zu sein, wenn man bedenkt, welches gewaltige Unternehmen er sich erträumt hat.«
»Mögen Ihre Majestät sich nicht täuschen«, sagte Sol des Grisolles. »Oudet ist ein Sohn der Berge aus dem Jura, mit allen seelischen und körperlichen Vorzügen des Bergbewohners.«
»Er ist keine fünfundzwanzig Jahre alt.«
»Bonaparte hat den Italienfeldzug mit sechsundzwanzig geführt.«
»Er war zuerst einer der Unseren.«
»Ja, und in der Vendée haben wir ihn erlebt.«
»Er ist zu den Republikanern übergewechselt.«
»Anders gesagt, er war es leid, gegen Franzosen zu kämpfen.«
Der Prinz stieß einen Seufzer aus. »Ach!«, sagte er. »Auch ich bin es leid, so leid!«
»Nie zuvor, sofern Ihre Majestät einem Menschen Glauben schenken wollen, der nicht zu Schmeicheleien neigt, nie zuvor sah man so widerstrebende und zugleich naturgegebene Fähigkeiten in einem Menschen vereint. Er besitzt die Leichtgläubigkeit eines Kindes und den Mut eines Löwen, die Hingabe eines jungen Mädchens und die Unerschütterlichkeit eines alten Römers. Er ist tatkräftig und unbekümmert, faul und unermüdlich, launisch und starrsinnig, sanftmütig und streng, zartfühlend und schrecklich im Zorn. Ich kann zu seiner Ehre nur eines hinzufügen, mein Prinz: Männer wie Moreau und Malet haben sich ihm als ihrem Anführer unterworfen und sind bereit, ihm zu gehorchen.«
»Die drei Anführer der Gesellschaft sind also?«
»Oudet, Malet und Moreau, genannt Philopoemen, Marius und Fabius. Pichegru wird sich unter dem Namen Themistokles als Vierter hinzugesellen.«
»In dieser Verbindung scheinen sich mir ausgesprochen unvereinbare Elemente zu befinden«, sagte der Prinz.
»Aber wirkmächtige. Entledigen wir uns zuerst Bonapartes, und wenn sein Platz frei ist, können wir uns überlegen, welchen Mann oder welche Idee wir an seine Stelle setzen wollen.«
»Und wie wollen Sie sich Bonapartes entledigen? Doch nicht etwa durch einen Meuchelmord?«
»Nein, im offenen Kampf.«
»Sie glauben, Bonaparte würde sich auf einen Kampf der Dreißig einlassen?«, sagte der Prinz lächelnd.
»Nein, mein Prinz; wir werden ihn dazu zwingen. Dreimal wöchentlich begibt er sich auf seinen Landsitz La Malmaison, begleitet von einer vierzig- oder fünfzigköpfigen Eskorte. Cadoudal wird ihn mit der gleichen Menge Männer angreifen, und Gott wird den Gerechten siegen lassen.«
»Das wäre in der Tat kein feiger Mord«, sagte der Prinz nachdenklich, »das wäre ein Kampf.«
»Doch um dieses Vorhaben durchzusetzen, Hoheit, benötigen wir das Mitwirken eines französischen Prinzen, tapfer und angesehen, wie Eure Hoheit es sind. Die Herzöge von Berry und von Angoulême und Ihr Vater, der Herzog von Artois, haben uns so oft Versprechungen gemacht und uns so oft im Stich gelassen, dass wir nicht mehr auf sie rechnen wollen. Ich bin gekommen, Eure Hoheit, um Ihnen im Namen von uns allen zu sagen, dass wir nichts weiter erwarten als Ihre Anwesenheit in Paris, damit nach Bonapartes Tod das Volk sich eine Rückkehr zur Monarchie unter dem Prinzen aus dem Hause Bourbon wünscht, der sich als Prätendent unmittelbar des Throns bemächtigen kann.«
Der Prinz ergriff die Hand des Besuchers.
»Monsieur«, sagte er, »ich danke Ihnen von Herzen für das Ansehen, das ich bei Ihnen und Ihren Freunden genieße; ich will Ihnen persönlich beweisen, dass Sie keinen Unwürdigen gewählt haben, und Ihnen ein Geheimnis enthüllen, von dem niemand weiß, nicht einmal mein Vater. Den wackeren Kämpfern Cadoudal, Oudet, Moreau, Pichegru und Malet erwidere ich: Seit neun Jahren stehe ich im Feld, seit neun Jahren setze ich täglich mein Leben aufs Spiel, was mir nichts bedeutet, doch mich erfüllt größter Abscheu für die Mächte, die sich als unsere Verbündeten ausgeben und uns nur als Werkzeuge betrachten. Diese Mächte haben Frieden geschlossen und uns in ihrem Friedensvertrag vergessen. Sei’s drum. Ich werde mich nicht allein eines vatermörderischen Krieges schuldig machen, vergleichbar dem Krieg, in dem mein Vorfahre, der große Condé, seinen Ruhm im Blut erstickt hat. Sie können einwenden, dass er Krieg gegen seinen König führte und dass ich Krieg gegen Frankreich führe. In der Sicht der neuen Prinzipien, die ich bekämpfe und zu denen ich persönlich keine Meinung habe, wäre die Entschuldigung meines Vorfahren vielleicht die, dass er nur gegen seinen König Krieg führte. Ich habe Krieg gegen Frankreich geführt, doch nur stellvertretend: Ich habe den Krieg weder erklärt noch für beendet erklärt, ich lasse Mächte walten, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich habe zum Fatum gesagt: Du hast mich gerufen, hier bin ich, doch nun, da der Frieden geschlossen wurde, will ich nichts daran ändern. Das sind meine Worte an die Adresse unserer Freunde. Doch daneben«, sagte er, »habe ich Ihnen persönlich etwas zu sagen, Monsieur. Und Sie müssen mir schwören, dass das Geheimnis, das ich Ihnen anvertrauen werde, in Ihrer Brust verschlossen bleiben wird.«
»Ich schwöre es, Eure Hoheit.«
»Verzeihen Sie meine Schwäche, Monsieur, aber ich liebe.«
Der Bote machte eine Geste.
»Schwäche, gewiss«, wiederholte der Herzog, »zugleich jedoch Seligkeit, eine Schwäche, um derentwillen ich drei- bis viermal im Monat meinen Kopf aufs Spiel setze, wenn ich den Rhein überquere, um eine bezaubernde Frau zu besuchen, die ich vergöttere. Es geht das Gerücht, ein Zerwürfnis mit meinen Cousins oder gar mit meinem Vater hielte mich in Deutschland: O nein, Monsieur, was mich in Deutschland hält, ist eine glühende, erhabene, unbezwingbare Liebe, die stärker ist als mein Pflichtgefühl. Man fragt sich, wohin ich gehe, man wundert sich, wo ich sein mag, man hält mich für einen Verschwörer. Ach und Weh! Ich liebe, das ist alles.«
Ja, eine Himmelsmacht ist die Liebe gewiss, wenn sie sogar einen Bourbonen von seiner Pflicht abhält, dachte sich Sol de Grisolles mit leisem Lächeln, laut aber sagte er: »Lieben Sie, Prinz, lieben Sie und genießen Sie Ihr Glück! Denn das ist unser wahres Geschick, glauben Sie mir.« Dann erhob er sich, um sich von dem Prinzen zu verabschieden.
»Oh«, sagte der Herzog, »so einfach entkommen Sie mir nicht.«
»Was darf ich für Eure Hoheit tun?«
»Sie dürfen mir noch länger zuhören, Monsieur. Noch nie habe ich jemandem von meiner Liebe erzählt, aber ich ersticke schier daran. Ihnen habe ich mein Herz geöffnet, doch das war nicht genug, ich muss Ihnen noch lang und breit davon erzählen; Sie kennen jetzt die glückliche, freudige Seite meines Lebens; Ich muss Ihnen erzählen, wie schön, wie intelligent, wie ergeben sie ist. Speisen Sie mit mir zu Abend, Monsieur; nach dem Diner werden Sie mich verlassen, doch vorher werde ich zwei Stunden lang Gelegenheit gehabt haben, Ihnen von ihr zu berichten. Ich liebe sie seit drei Jahren, bedenken Sie das, und noch nie konnte ich einem Menschen von ihr erzählen.«
Grisolles blieb zum Abendessen.
Zwei Stunden lang sprach der Herzog von nichts anderem als von ihr. Er schilderte seine Liebe bis in die kleinsten Einzelheiten, lachte, weinte, drückte die Hände seines neuen Freundes und umarmte ihn zum Abschied.
Sonderbare Wirkung der Sympathie!
Von einem Tag auf den anderen hatte ein Fremder das Herz des jungen Prinzen gründlicher erobert als mancher seiner Freunde, der nie von seiner Seite gewichen war.
Am Abend desselben Tages reiste Cadoudals Bote nach England ab, und der Polizeispitzel, der Fouché über alles Bericht zu erstatten hatte, schrieb diesem:
Abgereist eine Stunde nach dem Bürger S. de G.
Ihm ununterbrochen gefolgt; hinter ihm über die Brücke bei Kehl gefahren; mit ihm in Offenburg gespeist, ohne dass er Verdacht schöpfte.
In Offenburg übernachtet. Um acht Uhr morgens mit der Post weitergereist auf eine halbe Stunde Entfernung. Im Hotel La Croix abgestiegen, Citoyen S. de G. im Hotel Rhin et Moselle.
Da man sich über mich Gedanken machen konnte, sagte ich, mich habe ein Schreiben des letzten Fürstbischofs von Straßburg hergelockt, Monsieur de Rohan-Guéménée, berühmt für seine Rolle in der Halsbandaffäre. Ich empfahl mich ihm als Emigrant, der es nicht versäumen wollte, ihm anlässlich einer Reise, die ihn über Ettenheim führte, seine Aufwartung zu machen. Da er vor Eitelkeit schier platzt, schmeichelte ich ihm gewaltig und schmeichelte mich so gut in sein Vertrauen ein, dass er mich zum Diner einlud. Diese unerwartete Intimität nutzte ich, um ihn über den Herzog von Enghien auszufragen. Die beiden sehen sich selten, doch in einer Kleinstadt wie Ettenheim mit dreieinhalbtausend Einwohnern weiß jeder über jeden Bescheid.
Der Prinz ist ein schöner junger Mann von zwei- oder dreiunddreißig Jahren, mit schütterem blondem Haar, groß gewachsen, wohlgestalt, mutig und höflich. Sein Leben ist geheimnisvoll; von Zeit zu Zeit verschwindet er, und niemand weiß, wohin. Unser kirchlicher Würdenträger vermutet allerdings, dass er sich nach Frankreich begibt, zumindest in diese Richtung, denn zweimal ist er ihm auf der Straße nach Straßburg begegnet, einmal auf dem Rückweg von Offenburg, einmal auf dem von Benfeld.
Citoyen S. de G. wurde von dem Herzog von Enghien formvollendet begrüßt und zum Diner eingeladen; zweifellos hat dieser all seinen Vorschlägen zugestimmt, denn er hat ihn zum Wagen begleitet und ihm zum Abschied herzlich die Hand gedrückt.
Citoyen S. de G. reist nach London. Er ist um elf Uhr abends aufgebrochen, ich werde ihm um Mitternacht folgen.
Eröffnen Sie mir bitte, falls ich genötigt sein sollte, in England zu bleiben, ein Bankkonto mit einem Kredit von einigen hundert Louisdor auf den Namen des Kanzlers der französischen Botschaft, damit dieser Kredit niemandem bekannt wird.
DER LIMOUSINER
P.S. Vergessen Sie bitte nicht, dass die Compagnons de Jéhu übermorgen den Kampf wiederaufnehmen und als erstes Ziel die Schnellpost nach Rouen im Wald von Vernon überfallen wollen.
Mit den vorangegangenen Erläuterungen haben unsere Leser sich das plötzliche Verschwinden Hector de Sainte-Hermines sicherlich erklären können. Durch Cadoudals Schreiben von seinem Wort befreit und durch seine Wünsche in diesem Glauben bestärkt, hatte er sich dazu entschlossen, Mademoiselle de Sourdis um ihre Hand zu bitten. Sie war ihm gewährt worden.
Wir sahen, mit welchem Prunk der Heiratsvertrag unterzeichnet werden sollte und dass Hector die Feder bereits fast in der Hand hielt, als der Chevalier de Mahalin sich seinen Weg bis zu dem Grafen gebahnt hatte, ihn unter einen Kronleuchter gezerrt und ihm dort Cadoudals Befehl an Laurent vorgelesen hatte, die Waffen zu ergreifen, und Laurents Befehl an alle Compagnons de Jéhu, sich ab sofort bereitzuhalten.
Hector hatte einen Schmerzensschrei ausgestoßen. Das ganze Gerüst seines Glücks brach zusammen, seine teuersten Träume, die er seit zwei Monaten gehegt hatte, waren zerstoben. Er konnte es nicht verantworten, den Vertrag zu unterzeichnen und Mademoiselle de Sourdis dem Schicksal auszuliefern, sich eines früheren oder späteren Tages als Witwe eines Mannes wiederzufinden, der als Straßenräuber auf dem Schafott geköpft wurde. Alles Ritterliche an diesem Unternehmen schwand in seinen Augen. Er sah seine Lage nicht mehr unter pittoreskem Gesichtspunkt, sondern ganz im Gegenteil durch das Vergrößerungsglas der Wirklichkeit. Nichts blieb ihm als die Flucht; er zögerte keine Sekunde, zerbrach seine ganze Zukunft wie Glas und sagte: »Fliehen wir.«
Und er eilte mit dem Chevalier de Mahalin aus dem Haus.
26
Der Wald von Vernon
Am nächsten Samstag ritten zwei Männer gegen elf Uhr vormittags aus dem Dorf Port-Mort und folgten dem Weg von Andelys nach Vernon, vorbei an L’Isle und Pressagny, worauf sie Vernonnet erreichten, die alte Holzbrücke überquerten, auf der fünf Mühlen standen, und dem Weg von Paris nach Rouen folgten.
Links nach dem Ende der Brücke verschwanden die zwei Reiter in der düsteren Allee, die der Wald von Bizy dort bildet, und hielten rechtzeitig an, um weiterhin beobachten zu können, was sich auf der Landstraße abspielte.
Während sie durch Pressagny ritten, machten sich zwei andere Reiter von Rolleboise am linken Seineufer auf und ritten an Port-Villez und Vernon vorbei; als sie die Stelle des Waldes erreichten, an der schon zwei Reiter verschwunden waren, schienen sie sich zu beraten, und nach einem Moment des Zauderns begaben sie sich entschlossen in den Wald.
Kaum hatten sie zehn Schritte zurückgelegt, hörten sie den Ruf: »Wer da?«
»Vernon!«, erwiderten die Neuankömmlinge.
»Versailles!«, riefen die anderen.
In diesem Augenblick kamen auf dem Weg durch den Wald, der von Thilliers-en-Vexin nach Bizy führt, zwei weitere Reiter, die sich nach Austausch der gleichen Parole zu den anderen gesellten.
Die sechs Männer wechselten wenige Worte, mit denen sie sich zu erkennen gaben, und warteten dann schweigend.
Es schlug Mitternacht.
Jeder der Wartenden zählte die zwölf Schläge mit. Fernes Räderrollen war als Nächstes zu hören. Jeder Reiter legte dem Nebenmann die Hand auf den Arm und sagte: »Horch!«
»Ja«, erwiderten alle wie aus einem Mund. Alle hatten verstanden, und in aller Herzen fand das Räderrollen seinen Widerhall.
Man hörte, wie Pistolen geladen wurden.
Plötzlich sah man an einer Wegbiegung die zwei Laternen aufleuchten, von denen die Schnellpost begleitet war.
Kein Hauch war zu vernehmen, aber Herzklopfen, das klang wie Wassertropfen, die auf einen Felsen fallen.
Die Schnellpost kam näher.
Als sie nur mehr zehn Schritte entfernt war, warfen sich zwei Reiter vor die Pferde, und vier bezogen vor den Wagentüren Stellung mit dem Ruf: »Compagnons de Jéhu, keine Gegenwehr!«
Die Schnellpost blieb stehen, dann erfolgte aus den Wagentüren eine ohrenbetäubende Musketensalve, eine Stimme rief: »Galopp!«, und die Schnellpost raste davon, so schnell die vier kräftigen Percheronpferde laufen konnten.
Zwei Compagnons de Jéhu waren auf der Strecke geblieben: Dem einen war eine Kugel von Schläfe zu Schläfe durch den Kopf gedrungen; ihm war nicht mehr zu helfen; den anderen hatte sein Pferd beim Sturz unter sich begraben, und er tastete vergebens nach seiner Pistole, die ihm beim Sturz entglitten war.
Die anderen hatten sich in den Wald und in den Fluss gerettet mit dem Ruf: »Verrat! Rette sich, wer kann!«
Vier Gendarmen kamen angaloppiert. Sie sprangen vom Pferd und ergriffen den Royalisten, der seine Pistole gefunden hatte und sich gerade erschießen wollte. Er war aus den Steigbügeln geglitten, und sein Pferd hatte sich nach dem Sturz aufgerichtet und war davongestürmt.
Als der Gefangene begriff, dass er sich nicht erschießen konnte, schien ihn alle Kraft zu verlassen. Er stieß einen Seufzer aus und wurde ohnmächtig. Sein Kopf fiel auf das Pflaster, und das Blut lief aus einer großen Wunde an der Kopfhaut.
Man brachte ihn in das Gefängnis von Vernon.
Dort kam er zu sich, und ihm war, als erwache er aus einem Traum. Im Licht einer Lampe, die dafür da war, dass von einer Öffnung in der Tür in seine Zelle gesehen werden konnte, erkannte er das Innere einer Kerkerzelle.
Da erinnerte er sich, beugte seinen Kopf in die Hände und schluchzte.
Bei diesem Geräusch wurde die Tür geöffnet; der Gefängnisdirektor trat ein und fragte den Gefangenen, ob er einen Wunsch habe.
Der Gefangene richtete sich auf, schüttelte mit einer verächtlichen Kopfbewegung die Tränen fort, die an seinen Wimpern zitterten, und sagte: »Monsieur, können Sie mir eine Pistole geben, mit der ich mir ein Loch in den Kopf schießen kann?«
»Citoyen«, erwiderte der Direktor, »du bittest mich um das Einzige, was ich dir neben der Freiheit nicht gewähren kann.«
Und nichts konnte den Gefangenen dazu bewegen, ein weiteres Wort zu äußern.
Am nächsten Tag erhielt er um neun Uhr morgens abermals Besuch in seiner Zelle.
Er saß auf dem Holzschemel, auf den er sich am Vorabend hatte fallen lassen, doch das Blut aus seiner Wunde war geronnen, so dass sein Kopf an der Wand festklebte, was verriet, dass er sich die ganze Zeit nicht von der Stelle gerührt hatte.
Der Staatsanwalt war mit dem Untersuchungsrichter gekommen, um ihn zu vernehmen.
Der Gefangene weigerte sich zu antworten und sagte: »Nur Monsieur Fouché persönlich werde ich antworten.«
»Haben Sie ihm etwas zu enthüllen?«
»Ja.«
»Geben Sie uns Ihr Ehrenwort?«
»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.«
Überall wurde inzwischen von dem Überfall auf die Eilpost und von der Wichtigkeit des Gefangenen, der gemacht worden war, gemunkelt.
Der Staatswanwalt zögerte keine Sekunde lang. Er ließ einen viersitzigen Wagen vorfahren und hieß den gefesselten Gefangenen einsteigen. Er setzte sich neben ihn, ließ zwei Gendarmen gegenüber Platz nehmen und postierte einen dritten auf dem Kutschbock neben dem Kutscher.
Der Wagen fuhr los; sechs Stunden später hielt er vor dem Stadtpalais des Citoyen Fouché.
Der Gefangene wurde in das Vorzimmer im ersten Stock gebracht. Citoyen Fouché weilte in seinem Kabinett. Der Staatsanwalt ließ den Gefangenen mit den vier Gendarmen in dem Vorzimmer und begab sich zu Citoyen Fouché.
Fünf Minuten später wurde der Gefangene geholt und in das Kabinett des Citoyen Senator Fouché aus Nantes gebracht.
Niemand ahnte, dass er noch immer der wahre Polizeiminister war; er hatte sich die Marotte zugelegt, die Herkunftsbezeichnung an seinen Namen zu heften, und sie hat sich dort so gut eingefügt, dass sie ihm wie ein Adelstitel erhalten geblieben ist.
Der Gefangene hatte unter den eng geschnürten Fesseln unterwegs sehr gelitten und litt noch immer; Fouché bemerkte es.
»Citoyen«, sagte er, »wenn du mir dein Wort gibst, während der Zeit, die du bei mir bist, keinen Fluchtversuch zu unternehmen, lasse ich dich von den Fesseln befreien, die dir großes Ungemach zu bereiten scheinen.«
»Schreckliches Ungemach«, sagte der Gefangene.
Fouché klingelte nach seinem Büroboten.
»Toutain«, sagte er zu diesem, »lösen oder schneiden Sie dem Gefangenen die Fesseln ab.«
»Was tun Sie da?«, fragte der Staatsanwalt.
»Das sehen Sie doch«, erwiderte Fouché, »ich lasse dem Gefangenen die Fesseln abnehmen.«
»Und wenn er seine Freiheit missbraucht?«
»Er hat mir sein Wort gegeben.«
»Und wenn er es nicht hält?«
»Er wird es halten.«
Der Gefangene stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und schüttelte seine blutigen Hände. Das Seil hatte sich in das Fleisch eingeschnitten.
»Gut«, sagte Fouché, »wirst du jetzt auf meine Fragen antworten?«
»Ich sagte, dass ich nur Ihnen antworten werde. Wenn wir allein sind, stehe ich Ihnen Rede und Antwort.«
»Setze dich erst einmal, Citoyen. Herr Staatsanwalt, Sie haben richtig gehört; es handelt sich nur um eine kurze Verzögerung, und da Sie den Prozess weiterhin begleiten werden, wird es Ihnen nicht an Gelegenheit mangeln, Ihre Neugier zu befriedigen.«
Er deutete mit dem Kopf eine Verneigung an, und dem Staatsanwalt blieb nichts anderes übrig, als auf der Stelle den Raum zu verlassen, wäre er auch noch so gern geblieben.
»Und jetzt, Monsieur Fouché...«
Doch dieser unterbrach den Gefangenen. »Sparen Sie sich die Mühe, Monsieur«, sagte Fouché. »Ich weiß ohnehin alles.«
»Sie?«
»Sie heißen Hector de Sainte-Hermine und entstammen einer vornehmen Familie des Jura; Ihr Vater starb auf dem Schafott, Ihr ältester Bruder wurde in der Festung Auenheim füsiliert. Ihr zweitältester Bruder wurde in Bourg-en-Bresse guillotiniert. Nach seinem Tod sind auch Sie den Compagnons de Jéhu beigetreten. Cadoudal hat Ihnen nach seiner Unterredung mit dem Ersten Konsul die Freiheit geschenkt, und Sie haben sie genutzt, um die Hand von Mademoiselle de Sourdis, die Sie lieben, zu erlangen. Als Sie im Begriff waren, den Ehevertrag zu unterzeichnen, den der Erste Konsul und Madame Bonaparte bereits unterschrieben hatten, erschien einer Ihrer Kameraden, um Ihnen Cadoudals Ordre zu überbringen; Sie verschwanden spurlos; vergeblich suchte man Sie überall, doch gestern fand man Sie nach dem Überfall auf die Eilpost von Rouen nach Paris, den Sie mit fünf Ihrer Gefährten verübt hatten, halb ohnmächtig unter Ihrem toten Pferd auf der Landstraße. Sie wollten mich sprechen, um mich zu fragen, ob ich Ihnen erlauben könne, einen anonymen Tod durch eigene Hand zu finden. Bedauerlicherweise steht das nicht in meiner Macht, denn sonst würde ich Ihnen diesen Dienst erweisen, darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort.«
Hector starrte Fouché mit einem Gesichtsausdruck der Verblüffung an, der an Schwachsinn grenzte.
Sein Blick wanderte durch den Raum und fiel auf einen Stichel auf dem Schreibtisch des Ministers, so spitz wie eine Nadel. Er wollte danach greifen, doch Fouché fiel ihm in den Arm.
»Sehen Sie sich vor, Monsieur«, sagte er, »oder wollen Sie Ihr Wort brechen, was eines Edelmanns unwürdig wäre?«
»Was wollen Sie damit sagen?«, rief der junge Graf, der sich aus Fouchés Griff zu befreien versuchte.
»Selbstmord ist Flucht.«
Sainte-Hermine ließ den Stichel los und stürzte auf den Teppich, wo er sich wie in einem Anfall zu wälzen begann.
Fouché betrachtete ihn; als er sah, dass der Schmerz seinen Höhepunkt erreichte, sagte er: »Hören Sie mir zu, ich weiß jemanden, der Ihnen verschaffen kann, was Sie verlangen.«
Sainte-Hermine stützte ein Knie auf und erhob sich halb. »Wer ist das?«, fragte er.
»Der Erste Konsul.«
»Oh!«, rief der junge Mann. »Erbitten Sie für mich von ihm, dass er mir die Gnade erweist, mich hinter einer Mauer füsilieren zu lassen, ohne dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt, ohne dass mein Name genannt wird, ohne dass jene, die mich füsilieren, jemals erfahren, wer ich bin.«
»Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie hier auf mich warten und nicht zu fliehen versuchen?«
»Sie haben mein Wort! Sie haben mein Wort, Monsieur! Aber bringen Sie mir um Himmels willen den Tod.«
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte Fouché lachend. »Ihr Wort...«
»Bei meiner Ehre!«, rief Sainte-Hermine und streckte ihm die Hand hin.
Der Staatsanwalt hatte im Nebenzimmer gewartet. »Und jetzt?«, fragte er, als Fouché eintrat.
»Sie können nach Vernon zurückfahren«, sagte Fouché. »Hier werden Sie nicht mehr benötigt.«
»Aber mein Gefangener?«
»Den behalte ich.«
Und ohne dem Beamten weitere Erklärungen zu geben, stieg Fouché eilig die Treppe hinunter und sprang mit den Worten: »Zum Ersten Konsul!« in den Wagen.
27
Die Höllenmaschine
Die Pferde, die bei diesem Befehl wieherten, galoppierten los.
Vor dem Tuilerienpalast blieben sie von allein stehen; er war ihnen als Halt wohlbekannt.
Bonaparte weilte bei Joséphine; Fouché wollte nicht dort erscheinen, weil er keine Frau in die wichtige politische Frage verwickeln wollte, die sich anbahnte, und ließ seine Ankunft durch Bourrienne ausrichten.
Sogleich kam der Erste Konsul in seine Gemächer herauf.
»Nun, Citoyen Fouché, worum geht es?«
»Citoyen Erster Konsul, es geht darum, dass ich so vieles mit Ihnen zu besprechen habe, dass ich keine Rücksicht darauf nehmen konnte, ob ich Sie störe oder nicht.«
»Sie haben recht daran getan. Gut, sagen Sie alles.«
»Vor Monsieur de Bourrienne?«, fragte Fouché sehr leise.
»Monsieur de Bourrienne ist taub, Monsieur de Bourrienne ist stumm, Monsieur de Bourrienne ist blind«, erwiderte der Erste Konsul. »Sprechen Sie.«
»Ich habe Cadoudals Mann von einem meiner fähigsten Spitzel verfolgen lassen«, sagte Fouché. »Noch am selben Abend hat er sich mit dem schönen Laurent getroffen, dem Anführer der Compagnons de Jéhu, der seine Leute umgehend zusammengerufen hat.«
»Und dann?«
»Ist er nach Straßburg abgereist, hat bei Kehl den Rhein überquert und in Ettenheim den Herzog von Enghien aufgesucht.«
»Fouché, Sie schenken diesem jungen Mann nicht genug Beachtung; er ist der Einzige aus seiner Familie, der den Mut besaß zu kämpfen, und das recht tapfer; mir wurde sogar versichert, er sei mehrere Male nach Straßburg gekommen. Man muss ihn unbedingt überwachen.«
»Seien Sie unbesorgt, Citoyen Erster Konsul, wir lassen ihn nicht aus den Augen.«
»Und weiß man, was sie getan, was sie geredet haben?«
»Was sie getan haben? Sie haben zu Abend gespeist. Was sie geredet haben, ist schwieriger zu sagen, da sie unter vier Augen blieben.«
»Und wann haben sie sich getrennt?«
»Gegen elf Uhr abends ist Citoyen Sol de Grisolles nach London aufgebrochen. Um Mitternacht hat mein Spitzel sich auf den Weg gemacht.«
»Ist das alles?«
»Nein. Das Wichtigste kommt noch.«
»Ich höre.«
»Die Compagnons de Jéhu sind wieder unterwegs.«
»Seit wann?«
»Seit gestern. Sie haben heute Nacht eine Eilpost überfallen.«
»Und sie ausgeraubt?«
»Nein. Ich wusste Bescheid und hatte die Kutsche mit Gendarmen gespickt, und bei der ersten Aufforderung anzuhalten, wurde nicht gehorcht, sondern gefeuert. Ein Compagnon de Jéhu wurde getötet, ein zweiter gefangen genommen.«
»Ein elender Strauchritter?«
»Nein«, sagte Fouché kopfschüttelnd, »ganz im Gegenteil.«
»Ein Aristokrat?«
»Aus bestem Hause.«
»Hat er geplaudert?«
»Nein.«
»Wird er plaudern?«
»Ich glaube nicht.«
»Muss man seinen Namen kennen?«
»Ich kenne ihn.«
»Er heißt?«
»Hector de Sainte-Hermine.«
»Was! Der junge Mann, dessen Ehevertrag ich unterschrieben habe und der nicht aufzufinden war, als er unterschreiben sollte?«
Fouché nickte bejahend.
»Lassen Sie ihm den Prozess machen«, rief Bonaparte.
»Frankreichs beste Namen werden kompromittiert sein.«
»Dann lassen Sie ihn hinter einer Mauer füsilieren, an einer Hecke, in einem Graben.«
»Darum soll ich Sie in seinem Namen bitten.«
»Wohlan! Seine Bitte sei ihm gewährt.«
»Erlauben Sie mir, ihm diese gute Nachricht zu überbringen.«
»Wo ist er?«
»Bei mir.«
»Wie das, bei Ihnen?«
»Oh, ich habe sein Wort, dass er nicht zu fliehen versuchen wird.«
»Er ist also ein Mann von Herz?«
»Ja.«
»Sollte ich ihn sehen?«
»Ganz wie Sie wollen, Citoyen Erster Konsul.«
»Zum Teufel, nein, ich ließe mich erweichen und würde ihn begnadigen.«
»Was unter den gegebenen Umständen das allerfalscheste Signal wäre.«
»Sie haben recht. Auf, bis morgen soll die Sache beendet sein.«
»Das ist Ihr letztes Wort?«
»Ja. Adieu.«
Fouché verneigte sich und ging.
Fünf Minuten später befand er sich in seinem Stadtpalais.
»Nun?«, fragte Hector mit gefalteten Händen.
»Gewährt«, erwiderte Fouché.
»Ohne Prozeß, ohne Aufsehen?«
»Ihr Name wird nicht genannt werden; von jetzt an existieren Sie für niemanden mehr.«
»Und wann wird man mich füsilieren, denn ich werde doch hoffentlich füsiliert?«
»Ja.«
»Wann wird man mich füsilieren?«
»Morgen.«
Sainte-Hermine ergriff Fouchés Hände und drückte sie voller Dankbarkeit.
»Ach! Danke, danke!«
»Kommen Sie jetzt.«
Sainte-Hermine gehorchte so folgsam wie ein Kind. Der Wagen wartete noch vor der Tür. Fouché hieß ihn einsteigen und stieg nach ihm ein.
»Nach Vincennes«, sagte er zum Kutscher.
Hätte der junge Graf Zweifel gehegt, hätte der Name Vincennes ihn beruhigt, denn dort fanden die standgerichtlichen Exekutionen statt.
Beide stiegen aus und wurden in die Festung geführt.
Monsieur Harel, der Festungskommandant, eilte herbei. Fouché sagte ihm einige Worte ins Ohr, und der Kommandant verbeugte sich geflissentlich.
»Adieu, Monsieur Fouché«, sagte Sainte-Hermine, »und tausendfachen Dank.«
»Auf Wiedersehen«, erwiderte Fouché.
»Auf Wiedersehen?«, rief Sainte-Hermine, »was wollen Sie damit sagen?«
»Ach, mein Gott, wer weiß!«
Unterdessen waren Saint-Régeant und Limoëlan in Paris eingetroffen und hatten sich vom ersten Tag an ihrer Aufgabe gewidmet.
Der Limousiner, wie Fouché ihn genannt hatte, weilte ebenfalls wieder in Paris und hatte Fouché von der Abreise Saint-Régeants und Limoëlans aus London und von ihrem Reiseziel benachrichtigt.
Die beiden waren Hitzköpfe, die Georges gewissermaßen als Aufklärer vorausgeschickt hatte, während er selbst sich im Hintergrund hielt und erst dann die Bühne betreten wollte, wenn die beiden mit ihren Operationen Erfolg gehabt haben würden.
Auf welche Weise sie den Ersten Konsul angreifen sollten, hätte niemand sagen können – unter »niemand« verstehen wir all jene, die um das Geheimnis ihrer Anwesenheit in Paris wussten -, und vielleicht hätten sie selbst es ebenso wenig gewusst.
Der Erste Konsul war nicht schwer zu beschatten: Abends verließ er den Palast zu Fuß, tagsüber nahm er oft allein den Wagen, dreimal wöchentlich fuhr er mit einer Eskorte von drei, vier Männern nach La Malmaison, und mit vergleichbarer Eskorte besuchte er die Comédie-Française und die Oper.
Bonaparte war kein Büchermensch: Ein Werk beurteilte er nach den Details; Corneille schätzte er, nicht seiner Verse wegen, sondern der Gedanken wegen, die sie enthielten. Wenn er unversehens französische Verse zitierte, waren die Zitate meist mehr als holperig, aber dennoch liebte er die Literatur.
Die Musik hingegen war ihm reine Erholung. Wie jedem Italiener war sie ihm ein ganz und gar sinnlicher Genuss. Seine Stimme war so ungeübt, dass er keine zwei Noten treffen konnte, doch schätzte er alle großen Komponisten wie Gluck, Beethoven, Mozart oder Spontini.
Zu jener Zeit erfreuten sich die Werke Haydns besonders großer Beliebtheit, insbesondere seine Schöpfung, die er drei Jahre zuvor vollendet hatte.
Die Lebensgeschichte des ungarischen Komponisten ist ein wahrer Roman: Sohn eines armen Wagners, der sein Einkommen damit aufbesserte, dass er sonntags als Wandermusikant in den Dörfern auf der Harfe spielte, während seine Frau dazu sang und der fünfjährige kleine Joseph auf einem Brett eine Art Begleitmusik kratzte; dem Schulmeister im benachbarten Hainburg fiel die außerordentliche musikalische Begabung des Knaben auf, er nahm ihn zu sich, unterrichtete ihn in den Grundlagen der Kompositionslehre und verschaffte ihm einen Platz im Knabenchor am Wiener Stephansdom; sieben, acht Jahre lang wurde sein Kontertenor von den Zuhörern bewundert, bis er ihn im Stimmbruch verlor; nunmehr ohne Erwerbsmöglichkeit, stand er im Begriff, in sein Heimatdorf zurückzukehren, als ein armer Perückenmacher und Musiker ihn aufnahm, beglückt, den gescheiterten Sänger zu beherbergen, dessen Stimme er jahrelang voller Freude vernommen hatte; in der Gewissheit, zumindest nicht Hungers sterben zu müssen, arbeitete Hadyn von nun an sechzehn Stunden am Tag; mit der Oper Der krumme Teufel debütierte er am Theater am Kärntnertor, und von da an war er gerettet.
Fürst Esterhazy nahm ihn auf und behielt ihn dreißig Jahre lang bei sich. Doch als der Fürst ihm zu Hilfe kam, war Haydn bereits berühmt; mitunter ist es so, dass Fürsten großen Künstlern zu Hilfe und dennoch zu spät kommen.
Was würde aus den Armen ohne die Armen?
Haydn wurde nunmehr mit Ehren überhäuft, und aus Dankbarkeit hatte er die Tochter des Perückenmachers geheiratet, die ihm, wie wir nebenbei nicht verschweigen wollen, das gleiche unerreichte Glück zu bescheren wusste, wie Xanthippe es Sokrates angedeihen ließ.
Die französische Oper hatte Haydns Oratorium auf den Spielplan gesetzt, und der Erste Konsul hatte verkünden lassen, er werde der ersten Vorstellung beiwohnen.
Um drei Uhr nachmittags sagte Bonaparte zu Bourrienne, mit dem er arbeitete: »Apropos, Bourrienne, Sie werden heute Abend nicht mit mir dinieren. Ich gehe in die Oper und kann Sie nicht mitnehmen. Ich werde schon von Lannier, Berthier und Lauriston begleitet, aber Sie können auf eigene Faust hingehen; Sie haben abends frei.«
Doch als Bonaparte aufbrechen wollte, erschöpft von der Arbeit des ganzen Tages, war er unsicher, ob er tatsächlich hingehen sollte.
Sein Zögern währte von acht Uhr bis um Viertel nach acht.
Während dieser fünfzehn Minuten des Zögerns ereignete sich in der Nachbarschaft der Tuilerien Folgendes:
Zwei Männer führten in die Rue Saint-Nicaise, eine enge Straße, die es nicht mehr gibt und durch die der Weg des Ersten Konsuls geführt hätte, ein Pferd und einen Karren mit einem Pulverfass; auf der Mitte der Straße holte einer der beiden vierundzwanzig Sous aus der Tasche und gab sie einem Mädchen, das er bat, das Pferd zu halten; der andere lief zu einer Stelle mit Sicht auf die Tuilerien, um von dort das Signal zu geben, während sein Kumpan sich bereithielt, um die Lunte des schrecklichen Mechanismus zu entzünden.
Als es Viertel nach acht Uhr schlug, rief der Mann mit Sicht auf die Tuilerien: »Da ist er!«, und der Mann an der Höllenmaschine entzündete die Lunte und rannte davon. Wie ein Wirbelwind raste der Wagen des Ersten Konsuls mit seinen vier Pferden vom Louvre her, gefolgt von einer Abteilung Grenadiere zu Pferd. Als sie in die Straße einbogen, sah der Kutscher namens Germain, den der Erste Konsul César zu nennen pflegte, das Pferd und den Karren mitten auf der Straße und rief, ohne anzuhalten oder seine Pferde zu zügeln: »Aus dem Weg!«
Er lenkte seine Pferde nach links, und das Mädchen, das befürchtete, mitsamt dem Wagen, den man ihm anvertraut hatte, über den Haufen gefahren zu werden, drückte sich auf die rechte Straßenseite. Der Wagen des Ersten Konsuls und seine Eskorte donnerten vorbei, doch sie hatten noch nicht die nächste Straßenbiegung passiert, da ertönte ein entsetzlicher Lärm, als wären zehn Artilleriegeschütze gleichzeitig abgefeuert worden.
Der Erste Konsul sagte: »Man hat mit Kartätschen auf uns geschossen. César, halten Sie an!«
Der Wagen hielt an.
Bonaparte sprang heraus.
»Wo ist der Wagen meiner Frau?«, fragte er.
Wie durch ein Wunder hatte Madame Bonaparte sich verspätet, weil sie sich mit Rapp über die Farbe eines Kaschmirschals nicht hatte einigen können, und war dem Wagen ihres Mannes nicht unmittelbar gefolgt.
Der Erste Konsul sah sich um und erblickte eine Wüste der Vernichtung: Mehrere Häuser waren bis auf die Grundmauern zerstört, von einem war keine einzige Mauer stehen geblieben, die Schreie der Verwundeten klangen schaurig, Tote bedeckten den Boden.
Im Tuilerienpalast waren alle Fenster geborsten, und sämtliche Glasscheiben der Kutschen des Ersten Konsuls und Madame Bonapartes waren in tausend Scherben zersprungen. Madame Murat hatte sich so erschreckt, dass sie nicht weiterfahren wollte und in den Tuilerienpalast zurückgebracht werden musste.
Bonaparte vergewisserte sich, dass niemand aus seiner Umgebung verwundet war. Dass Joséphines Kutsche nicht zu sehen war, bekümmerte ihn nicht; er schickte zwei Grenadiere, die ihr ausrichten sollten, er sei gesund und wohlauf und erwarte sie in der Oper.
Dann stieg er wieder in die Kutsche und rief: »Zur Oper, so geschwind wie möglich! Niemand soll denken, ich wäre tot!«
Das Gerücht von der Katastrophe hatte sich bereits bis zur Oper ausgebreitet; es hieß, die Meuchelmörder hätten ein ganzes Stadtviertel in die Luft gesprengt, und der Erste Konsul sei schwer verletzt; andere Gerüchte besagten, er sei tot. Und mit einem Mal öffnete sich der Eingang zu seiner Loge, und man sah ihn vorne Platz nehmen, ruhig und unerschütterlich wie gewohnt.
Bei seinem Anblick erhob sich ein einhelliger Ruf, der allen Herzen entsprang. Für alle, ausgenommen seine persönlichen Feinde, war Bonaparte der erzene Pfeiler, der Frankreich aufrechterhielt. Alles ruhte auf ihm: der militärische Ruhm, das nationale Wohlergehen, das allgemeine Glück und der innere Frieden Frankreichs und der Frieden der ganzen Welt.
Der Beifall verdoppelte sich, als nunmehr Joséphine erschien, bleich und zitternd, denn sie versuchte gar nicht erst, ihre Gefühle zu verbergen, einen Blick voller Besorgnis und Liebe auf den Ersten Konsul geheftet.
Bonaparte wohnte der Aufführung nur eine Viertelstunde lang bei; dann befahl er die Rückkehr in den Tuilerienpalast; er konnte es kaum erwarten, sein zornerfülltes Herz zu erleichtern; ob aus echter Überzeugung oder aus vorgetäuschtem Furor – sein ganzer Hass auf die Jakobiner war wiedererwacht und würde sich an ihnen austoben.
Befremdlich an allen Versuchen, sich als Dynastie zu etablieren, die in Frankreich nacheinander die zwei Napoleons, der ältere und der jüngere Zweig der Bourbonen und sogar unsere gegenwärtige Regierung unternommen haben, ist der fatale und zerstörerische Instinkt, der sie dazu antreibt, sich an dem unheilvollen Thron Ludwigs XVI. und dem antinationalen Königtum Marie-Antoinettes zu orientieren. Offenbar sind die Gegner dieser zwei Unseligen, die für die Untaten Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. büßen mussten, auch die Gegner aller neuen Throne, ganz gleich, wie nah oder fern sie dem alten Herrscherhaus stehen mögen. Bonapartes Trachten nach dem Thron war unklug, wenn nicht gar ein Fehler.
Da die Detonation der Höllenmaschine in ganz Paris zu vernehmen gewesen war, füllte sich der Empfangssalon im Erdgeschoss mit Sicht auf die große Terrasse im Handumdrehen mit Neugierigen.
Am Blick des Herrschers, denn das war er inzwischen, wollte man ablesen, wem man dieses neuerliche Verbrechen zuschreiben, wem man die Schuld daran geben sollte.
Der Erste Konsul hielt mit seiner Ansicht nicht hinter dem Berg, obwohl er am selben Tag eine lange Unterredung mit Fouché gehabt hatte, in deren Verlauf dieser ihm von royalistischen Umtrieben berichtet hatte. So kühl und beherrscht er in der Oper gewirkt hatte, so aufgewühlt und erregt kehrte er in den Palast zurück. Sein Vorurteil gegen die Jakobiner erfüllte ihn mit irrwitzigem Zorn.
»Diesmal, meine Herren«, sagte er beim Eintreten, »stecken weder Adelige noch Priester, noch Chouans, noch Vendée-Aufständische dahinter; es ist das Werk der Jakobiner und nur der Jakobiner, die mich ermorden wollten. Ich weiß, wo ich diesmal nach den Tätern zu suchen habe, und davon werde ich mich nicht abbringen lassen. Das sind feige September-Mörder, schmutzbesudelte Verräter, die nur ein Ziel kennen: die Dauerverschwörung, den offenen Aufruhr, den erklärten Kampf gegen Gesellschaft und Regierung, ganz gleich welche. Es ist noch keinen Monat her, dass Sie miterlebt haben, wie Ceracchi, Aréna, Topino-Lebrun und Demerville mir nach dem Leben trachteten. Nun, und das hier sind ihre Kumpane, diese September-Blutsäufer, diese Versailles-Mörder, diese 31.-Mai-Briganten, diese Prairial-Verschwörer, diese Urheber aller Verbrechen gegen jede Regierung. Wenn man sie nicht in Ketten legen kann, muss man sie vernichten, man muss Frankreich von diesem eklen Bodensatz seines Volkes säubern: Kein Erbarmen mit Verrätern. Wo ist Fouché?«
Ungeduldig klopfte er mit dem Fuß auf den Boden: »Wo ist Fouché?«, wiederholte er.
Fouché erschien. Seine Kleidung war staubig und gipsbestäubt.
»Woher kommen Sie denn?«, fragte Bonaparte.
»Dorther, woher zu kommen meine Pflicht ist«, erwiderte Fouché. »Aus Ruinen.«
»So, so! Wollen Sie immer noch behaupten, es seien Royalisten gewesen?«
»Ich werde erst etwas sagen, Citoyen Erster Konsul«, erwiderte Fouché, »wenn ich genau weiß, was ich sagen werde, und wenn ich Anklage erhebe, werde ich sie gegen die wahren Schuldigen erheben, seien Sie unbesorgt.«
»Sind die wahren Schuldigen in Ihren Augen etwa nicht die Jakobiner?«
»Die wahren Schuldigen sind jene, die das Verbrechen begangen haben, und nach ihnen werde ich suchen.«
»Paperlapapp! Die sind nicht schwer zu finden.«
»Im Gegenteil, sehr schwer sogar.«
»Ha! Ich weiß, um wen es sich handelt, ich verlasse mich nicht auf Ihre Polizei, ich bin meine eigene Polizei, ich weiß, wer dieses Verbrechen begangen hat, und ich werde diese Leute fassen und ein Exempel an ihnen statuieren. Bis morgen, Monsieur Fouché, ich harre Ihrer Entdeckungen. Bis morgen, meine Herren.«
Bonaparte begab sich in seine Gemächer hinauf.
In seinem Kabinett fand er Bourrienne vor. »Ach, Sie sind es«, sagte er. »Haben Sie gehört, was vorgefallen ist?«
»Gewiss«, sagte Bourrienne. »Zu dieser Stunde hat ganz Paris davon gehört.«
»So, so! Aber ganz Paris soll auch erfahren, wer die Täter sind.«
»Nehmen Sie sich in Acht: Paris wird diejenigen beschuldigen, die Sie nennen.«
»Die ich nenne, zum Henker! Ich werde die Jakobiner nennen.«
»Fouché ist anderer Ansicht; er behauptet, es handele sich um eine Verschwörung von höchstens zwei, drei Leuten. Verschwörungen von fünf oder mehr Tätern, sagt er, seien Sache der Polizei.«
»Fouché hat seine eigenen Gründe, nicht meiner Meinung zu sein; er hält seine schützende Hand über die Seinen – war er etwa nicht einer ihrer blutrünstigsten Anführer? Ich weiß sehr wohl, was er in Lyon und an der Loire getan hat. Ha! Lyon und die Loire, das sagt alles, was ich über ihn wissen muss. Guten Abend, Bourrienne.«
Ruhiger ging er in seine Privaträume, denn seinem Zorn hatte er nun ausreichend Luft gemacht.
Unterdessen war Fouché in die Ruinen zurückgekehrt, aus denen er gekommen war; um die Rue Saint-Nicaise herum hatte er einen Kordon von Polizisten Aufstellung nehmen lassen, damit der Schauplatz des Attentats so intakt wie möglich erhalten blieb.
Auf diesen Schauplatz hatte Fouché den Limousiner oder Victor mit den vier Gesichtern geschickt; letzteren Spitznamen bei der Polizei verdankte der Spitzel der Leichtigkeit, mit der er vier einander denkbar entgegengesetzte Rollen zu spielen verstand: die des Mannes aus dem Volk, die des feinen Herrn, die des Engländers und die des Deutschen.
Diesmal sollte er sich weder verstellen noch verkleiden, sondern nur die einzigartigen Fähigkeiten, mit denen die Natur ihn ausgestattet hatte, einsetzen, um die rätselhaftesten und verborgensten Spuren zu entdecken.
Fouché traf ihn auf einem Mauerstück sitzend an, in Gedanken versunken.
»Nun, Limousiner?«, fragte Fouché, der den Namen verwendete, mit dem er den Spitzel seinerzeit irrtümlich bezeichnet hatte.
»Nun, Citoyen, ich dachte mir, ich sollte am besten den Kutscher befragen, denn er allein konnte von seinem Kutschbock aus sehen, was sich auf der Straße befand, als er in sie einfuhr. Und César hat mir Folgendes gesagt, was ich nicht bezweifle.«
»Denkst du nicht, dass er vor Angst blind oder gar betrunken war?«
Der Limousiner schüttelte den Kopf. »César ist ein wackerer Mann«, sagte er, »der eigentlich Germain heißt und vom Ersten Konsul persönlich César getauft wurde, als dieser sah, wie er in Ägypten mit drei Arabern kämpfte, einen von ihnen tötete und einen gefangen nahm. Vielleicht würde der Erste Konsul, der niemandem etwas verdanken will, gerne behaupten, er wäre betrunken gewesen, aber er war es nicht.«
»Nun gut! Und was hat er gesehen?«, fragte Fouché.
»Er hat gesehen, wie ein Mann in Richtung der Rue Saint-Honoré weglief und eine brennende Lunte hinter sich warf, und er hat ein Mädchen gesehen, das ein Pferd am Zügel hielt; das Pferd zog einen Karren mit einem Fass. Das junge Mädchen wusste sicher nicht, was dieses Fass enthielt. Es war nämlich ein Pulverfass, und der Mann, der weglief, hatte es in Brand gesetzt.«
»Man muss das Mädchen finden und es verhören«, sagte Fouché.
»Das Mädchen?«, erwiderte der Limousiner. »Hier, da haben Sie seinen Fuß.« Und er zeigte Fouché einen abgerissenen Fuß in einem blauen Baumwollstrumpf, der noch im Schuh steckte.
»Und ist von dem Pferd etwas übrig?«
»Ein Oberschenkel und der Kopf. Der Kopf hat mitten auf der Stirn einen weißen Stern. Außerdem habe ich ein paar Fetzen Fell, genug für eine Beschreibung.«
»Und der Karren?«
»Da müssen wir abwarten; ich habe angeordnet, alle Eisenteile, die man findet, aufzusammeln. Morgen früh werde ich sie mir ansehen.«
»Mein lieber Freund, ich überlasse Ihnen diese Geschichte.«
»Sehr wohl, aber mir allein.«
»Für die Polizei des Ersten Konsuls kann ich nicht garantieren.«
»Das macht nichts, solange Ihre Polizei mir nicht ins Handwerk pfuscht.«
»Meine Polizei wird sich verhalten, als wäre nichts geschehen.«
»Dann wird es keine Schwierigkeiten geben.«
»Sie geben mir Ihr Wort?«
»Wenn ich ein Ende einer Sache habe, will ich an das andere Ende kommen.«
»Sehr gut, tun Sie das; am Tag Ihrer Ankunft erwarten Sie tausend Fünf-Franc-Stücke.«
Und Fouché machte sich auf den Nachhauseweg, überzeugter denn je, dass für dieses Attentat nie und nimmer die Jakobiner verantwortlich waren.
Am nächsten Tag wurden zweihundert Personen, deren revolutionäre Gesinnung bekannt war, festgenommen, und nachdem Bonaparte hin und her überlegt hatte, entschied er sich dafür, sie deportieren zu lassen, auf Grundlage einer Gesetzesvorlage der Konsuln, die dem Senat zur Zustimmung vorgelegt wurde.
Am Tag vor ihrer Verhaftung wurden die Verdächtigen einer nach dem anderen vier Männern vorgeführt, die wie Arbeiter oder Handwerker aussahen. Einer der vier war Rosshändler, einer war Getreidehändler, einer Wagenvermieter und einer Böttcher.
Keiner der vier erkannte unter den Vorgeführten einen der beiden Männer wieder, mit denen sie zu tun gehabt hatten; bislang deuteten die Untersuchungsergebnisse auf zwei, höchstens drei Täter hin, wobei der dritte – wenn es ihn gab – sich im Hintergrund gehalten hatte.
Wie war es zu dieser vierköpfigen Kommission gekommen? Mit bewundernswertem Scharfsinn hatte der Limousiner das Pferd aus seinen Überresten zusammengesetzt. Und am Tag nach dem Attentat konnte man in allen Zeitungen und auf Anschlägen an allen Straßenecken lesen:
Der Polizeipräfekt teilt seinen Mitbürgern mit, dass an den Karren, auf dem sich das eisengefasste Pulverfass befand, das gestern Abend um Viertel nach acht Uhr auf der Rue Saint-Nicaise vor der Einmündung der Rue Malte auf dem Weg des Ersten Konsuls explodiert ist, eine braune Stute gespannt war, Kaltblüter, struppige Mähne, langer Schwanz, fuchsfarbene Nase, Flanken und Fesseln von hellerer Färbung, Muster an der Stirn, weiße Stellen beidseits am Rücken, auffällige Stichelhaare rechts unter der Mähne, bejahrt, ungefähr einen Meter fünfzig oder vier Fuß und sechs Zoll hoch, wohlgenährt und gepflegt, ohne Kennzeichen an Schenkeln oder Hals, die den Besitzer verrieten.
Jeder, der Kenntnisse über den Besitzer dieser Stute hat oder der sie an den Karren angespannt gesehen hat, wird gebeten, dem Polizeipräfekten Auskunft zu geben, mündlich wie schriftlich. Der Präfekt hat eine Belohnung ausgesetzt für denjenigen, der hilft, den Besitzer ausfindig zu machen. Alle sind aufgefordert, der Verwesung wegen sobald wie möglich die Überreste der Stute zu besichtigen.
Dieser Anschlag rief alle Pariser Pferdehändler auf den Plan.
Schon am ersten Tag erkannte der Rosshändler, der die Stute verkauft hatte, das Tier wieder.
Er verlangte, den Polizeipräfekten zu sprechen. Man schickte ihn zu dem Limousiner.
Dem Limousiner nannte der Rosshändler Namen und Adresse des Getreidehändlers, dem er die Stute verkauft hatte.
Der Limousiner behielt den Rosshändler da und ließ den Getreidehändler holen.
Der Getreidehändler erkannte ebenfalls die Überreste der Stute und sagte aus, er habe sie an zwei Individuen verkauft, die sich als Jahrmarktshändler ausgegeben hatten. Er erinnerte sich gut an sie, da er mehrmals mit ihnen zu tun gehabt hatte, und beschrieb sie genau.
Der eine war brünett, der andere dunkelblond; der Größere der beiden mochte an die fünf Fuß und sechs oder sieben Zoll messen, der andere etwa drei Zoll weniger; der eine machte einen militärischen, der andere einen bürgerlichen Eindruck.
Tags darauf sprach ein Wagenvermieter vor und erkannte ebenfalls die Stute wieder, die einige Tage lang bei ihm untergestellt worden war. Auch er beschrieb die zwei Männer, und seine Schilderung deckte sich mit der des Getreidehändlers.
Als Letzter kam der Böttcher, der das Fass verkauft und mit Eisenreifen beschlagen hatte.
Beträchtlich erleichtert hatte dem Limousiner seine Aufgabe die allgemeine Begeisterung für den Ersten Konsul; dank ihrer hatten die Zeugen nicht darauf gewartet, vorgeladen zu werden, sondern sich freiwillig gemeldet; jeder, der zur Aufklärung dieser undurchsichtigen Sache beitragen zu können vermeinte, lief mit seinem Wissen zur Polizei, und es stand eher zu befürchten, dass die Zeugen zu dick auftrugen, als dass sie etwas verschwiegen.
Doch all das hatte nicht viel mehr ergeben, als Fouché darin zu bestätigen, dass keiner der festgenommenen Jakobiner mit dem Attentat zu tun haben konnte; keinen der Beschuldigten hatten die vier Zeugen wiedererkannt, genau wie von Fouché erwartet.
Dennoch zeitigte die Gegenüberstellung ein Ergebnis: Zweihundertdreiundzwanzig der mittlerweile inhaftierten Personen wurden aus der Haft entlassen. Die hundertdreißig verbliebenen jedoch verfolgte Bonaparte umso unerbittlicher.
Daraufhin kam es im Staatsrat zu abenteuerlichen Szenen.
Bei einem dieser Anlässe geriet der Staatsrat Réal – vormals Verwalter des Châtelet und unter der Revolution öffentlicher Ankläger, von Robespierre als Gemäßigter abgesetzt, Begründer des Journal de l’opposition und des Journal des patriotes von 1789 und nicht zuletzt Geschichtsschreiber der Republik – mit Regnault de Saint-Jean-d’Angély und mit Bonaparte aneinander. Réal vertrat die Ansicht, dass Bonaparte mit persönlichen Feinden abrechnete und nicht mit den wahren Urhebern des Attentats.
»Aber den September-Mördern will ich endlich das Handwerk legen!«, rief Bonaparte.
»September-Mörder!«, erwiderte Réal. »Wenn es sie gibt, mögen sie alle miteinander den Tod finden. Aber was verstehen wir unter einem September-Mörder? Monsieur Roederer, der morgen in den Augen des Faubourg Saint-Germain als September-Mörder gelten wird? Monsieur de Saint-Jean-d’Angély, der für die Emigranten ein September-Mörder sein wird, sobald sie wieder an der Macht sein werden?«
»Gibt es etwa keine Listen dieser Männer?«
»Oh, gewiss«, erwiderte Monsieur Réal, »gewiss gibt es Listen, und auf der ersten dieser Listen sehe ich den Namen von Baudrais, der seit fünf Jahren Richter auf Guadeloupe ist. Ich sehe auch den Namen von Pâris, dem Gerichtsschreiber des Revolutionstribunals, der vor sechs Monaten gestorben ist.«
Bonaparte wendete sich an Monsieur Roederer. »Wer zum Teufel hat diese Listen verfasst?«, fragte er. »Es gibt in Paris doch genug unbelehrbare Anhänger von Babeufs anarchistischen Hirngespinsten!«
»Pah«, sagte Réal, »auch ich stünde auf dieser Liste, wäre ich nicht Staatsrat, denn ich habe Babeuf und seine Mitangeklagten seinerzeit verteidigt.«
Bonaparte verfügte über außergewöhnliche Selbstbeherrschung. »Ich sehe«, sagte er, »dass sich persönliche Gefühle in eine Staatssache gemischt haben. Wir sollten die Erörterung ein andermal gelassen und unvoreingenommen wiederaufnehmen.«
Nicht jeder hätte Réal verziehen, vor dem gesamten Staatsrat von ihm als im Unrecht abgekanzelt worden zu sein. Doch Bonaparte, der sich nicht davon abbringen ließ, unerbittlich jene zu verfolgen, die er unbedingt unschädlich machen wollte, ließ sich von diesem ehrlichen Mann die Meinung sagen und hörte auf ihn.
Sechs Monate später wurde Réal als Minister der Polizei übergeordnet.
»Aber Turenne hat die Pfalz in Brand gesteckt!«, sagte man zu Bonaparte.
»Was macht das schon«, erwiderte er, »wenn das für seine Pläne unerlässlich war!«
Für Bonapartes Pläne war es unerlässlich, dass einhundertunddreißig Jakobiner deportiert wurden.
Was scherte es ihn, ob sie schuldig waren oder nicht?
28
Die wahren Schuldigen
Sobald Bonaparte das Komplott der unbekannten Attentäter, die ihm nach dem Leben getrachtet hatten, weidlich genutzt hatte, um die hundertdreißig Jakobiner, diese Opfer seines Hasses, die er zu Unrecht dieser Tat beschuldigte, deportieren zu lassen, war ihm zwangsläufig eine frühere Verschwörung in Erinnerung gekommen, die ihre vier Urheber Aréna, Topino-Lebrun, Ceracchi und Demerville in verschiedene Pariser Gefängnisse gebracht hatte. Als die Höllenmaschine explodierte, warteten sie noch auf ihr Urteil.
Wie jemand, der seine Geschäfte ordnen will, befahl Bonaparte die umgehende Bestrafung dieses Verbrechens, die sofortige Abwicklung des verzögerten Gerichtsverfahrens und die schnellstmögliche Hinrichtung der Täter, damit all das sich im Windschatten der neuen Ereignisse abspielte.
Und als Fouché, mittlerweile dank der Berichte seines Spitzels fest davon überzeugt, die wahren Urheber des Attentats bald in seinem Netz zappeln zu sehen, von Bonaparte wissen wollte, ob dieser irgendwelche Anordnungen für ihn habe, irgendwelche Vorkehrungen getroffen wünsche, nachdem er sein Gesetz durchgebracht hatte, das die Deportation der Jakobiner erlaubte, und nachdem die letzten Vertreter der Revolution unter den kurzsichtigen Verwünschungen des französischen Volkes das Land durchquert hatten, da trug dieser ein Gebaren zur Schau, als hätte er die Frage nicht recht verstanden, und bequemte sich nur zu der Antwort: »Verjagen Sie all diese Hinterhofkurtisanen und gefallenen Mädchen, die wie ein Fliegenschwarm die Umgebung der Tuilerien verpesten.«
In der Tat war ihm aufgefallen, dass Prostituierte und ihre übelbeleumdeten Quartiere nicht nur im Dunstkreis beinahe aller Verschwörungen, sondern fast aller Verbrechen anzutreffen waren. Seine nächsten Worte machten Fouché jedoch klar, dass der Erste Konsul weniger an seine persönliche Sicherheit dachte als an die Verschönerung der Stadt Paris.
»Um Gottes willen!«, rief Fouché, indem er sich unbeabsichtigt einer frommen Wendung bediente. »Denken Sie doch wenigstens an Ihre Sicherheit!«
»Citoyen Fouché«, sagte Bonaparte lachend, »sollten Sie etwa zufällig an Gott glauben? Das würde mich gewaltig verwundern.«
»Wenn ich schon nicht an Gott glauben sollte«, erwiderte Fouché ungehalten, »werden Sie doch aber gewiß nicht bezweifeln, dass ich an den Teufel glaube, oder? Nun, im Namen des Teufels, welch Letzterem wir, wie ich hoffe, in den nächsten Tagen die Seelen Ihrer Verschwörer überantworten werden, denken Sie an Ihre Sicherheit!«
»Pah!«, sagte der Erste Konsul mit seiner gewohnten Kaltblütigkeit. »Denken Sie, es wäre so einfach, mich umzubringen? Ich habe keine festen Gewohnheiten, keinen geregelten Tagesablauf, alles, was ich tue, unterbreche ich von einem Augenblick auf den anderen, ich verlasse das Haus so unerwartet, wie ich zurückkehre. Bei Tisch ist es nicht anders: Ich habe keine Vorliebe für bestimmte Gerichte, ich esse, was auf den Tisch kommt, koste von dem, was neben mir steht, ebenso wie von dem am anderen Ende der Tafel. Und all das tue ich nicht systematisch, das dürfen Sie mir glauben, sondern aus schierer Neigung und Vorliebe. Doch nun, mein Lieber, da Sie so klug sind und auch diesmal die Schuldigen ausfindig machen werden, wenngleich seit dem Attentat auf mich bereits ganze fünfzehn Tage verstrichen sind – treffen Sie nur Ihre Vorkehrungen und wachen Sie über mich, denn das ist Ihre Sache.«
Da Bonaparte sah, dass Fouché zu überlegen schien, ob diese Worte dem Kalkül entsprangen, die Öffentlichkeit zu beeindrucken, fügte er hinzu: »Glauben Sie nur nicht, meine Gelassenheit entspränge blindem Fanatismus oder gar meinem Vertrauen in den Fleiß Ihrer Polizei. Ein Mordkomplott gelangt zur Ausführung: Die Unkenntnis der Einzelheiten, die Ungewissheit des Ergebnisses, die notgedrungen große Unsicherheit, wie man sich dagegen wehren sollte, all das ist viel zu schemenhaft für einen so sachlichen Geist und einen so kompromisslosen Charakter, wie ich sie besitze. Angesichts greifbarer Hindernisse wachsen meine Intelligenz und mein Einfallsreichtum; doch was soll ich einer auf mich gezielten Falle entgegensetzen, einem Dolchstoß in einem Flur der Oper, einem Gewehrschuss aus einem Fenster, einer Höllenmaschine, die an einer Straßenecke explodiert? Jederzeit müsste ich alles fürchten. Sinnlose Schwäche! Sich allerorten vor allem in Acht nehmen: unmöglich! Die Gefahren, denen ich mich unablässig aussetze, muss ich mir nicht nur aus dem Sinn schlagen, ich muss mich von dem bloßen Gedanken daran befreien, indem ich sie vergesse, gründlich vergesse. Denn ich vermag«, fügte er hinzu, »meine Gedanken zu leiten oder sie wenigstens so weit zu lenken, dass ich meine Gefühle und Handlungen meinem Willen unterwerfen kann: Was ich ein für alle Mal als außerhalb meiner Mittel und meines Beliebens erachte, werde ich nie wieder mit der geringsten Aufmerksamkeit bedenken; und von Ihnen verlange ich nichts weiter, als mir meine Ruhe zu lassen, denn meine Ruhe ist meine Stärke.«
Da Fouché abermals verlangte, der Erste Konsul solle sich vorsehen, sagte er zuletzt: »Schluss jetzt, gehen Sie nach Hause. Lassen Sie Ihre Männer festnehmen, wenn Sie meinen, sie überführt zu haben, lassen Sie sie aufhängen, füsilieren, guillotinieren, nicht weil sie mich ermorden wollten, sondern weil sie Tölpel sind, die mich verfehlt haben und stattdessen zwölf Citoyens getötet und sechzig verletzt haben.«
Fouché begriff, dass angesichts Bonapartes gegenwärtiger Geistesverfassung nichts auszurichten war. Er ging nach Hause und traf dort den Limousiner an, der auf ihn wartete.
Dieser Mann, dessen Gewandtheit ihm Fouchés ganzes Vertrauen gesichert hatte, wusste inzwischen, dass seit dem Anschlag mit der »Höllenmaschine« drei Männer spurlos verschwunden waren, die von der Polizei überwacht worden waren, weil man argwöhnte, sie seien Chouans, nach Paris gekommen in der Absicht, den Ersten Konsul zu ermorden; völlig zutreffend schloss er, dass diese drei die Urheber des Verbrechens sein mussten, denn sonst wären sie nicht untergetaucht, sondern hätten nicht gezögert, sich zu zeigen, damit man sie auf keinen Fall verdächtigte. Er wusste, wer die drei waren: Limoëlan, ein alter Vendée-Kämpfer, Saint-Régeant und Carbon.
Von Limoëlan und Saint-Régeant fehlte jede Spur, doch im Faubourg Saint-Marcel entdeckte der Spitzel eine Schwester Carbons, die dort mit ihren zwei Töchtern wohnte. Er mietete ein Zimmer im selben Stockwerk und hielt sich mehrere Tage lang so auffällig wie möglich dort verborgen; am dritten Tag, besser gesagt in der dritten Nacht, schleppte er sich nach lautem Jammergeschrei, das die dünnen Wände sicherlich nicht vor den Ohren seiner Nachbarn verborgen hatten, bis vor ihre Wohnungstür, klingelte und sank an der Wand auf die Knie.
Eine der Töchter öffnete die Tür, sah ihn entkräftet dort lehnen, kaum des Sprechens fähig.
»Oh, Mama«, rief sie, »es ist unser armer Nachbar, der den ganzen Tag so gejammert hat!«
Die Mutter kam hinzu, half ihm auf die Beine, nahm ihn mit in die Wohnung und setzte ihn auf einen Stuhl; dann fragte sie, wie sie und ihre Töchter ihm trotz ihrer Armut helfen könnten.
»Ich sterbe Hungers«, erwiderte der Limousiner, »ich habe seit drei Tagen nichts gegessen. Ich wage mich nicht auf die Straße, wo es von Polizeispitzeln wimmelt, denn ich bin mir sicher, dass sie nach mir suchen.«
Carbons Schwester flößte ihm ein Glas Wein ein und reichte ihm dann ein Stück Brot, das er verschlang, als hätte er tatsächlich drei Tage lang nichts zu sich genommen. Und da die Frauen befürchteten, die Polizeispitzel seien ihretwegen unterwegs, der Schwester und der Nichten Carbons wegen, fragten sie ihren Nachbarn, was er getan habe.
Indem er sich stellte, als gäbe er ihren Fragen nach, gestand er oder gab er vor zu gestehen, dass er von Cadoudal nach Paris geschickt worden war, um sich Saint-Régeant und Limoëlan anzuschließen. Doch als er am Tag nach dem Attentat in Paris angekommen war, hatte er sich über keinen der beiden kundig machen können. Dies war umso unerfreulicher, als er um ein unfehlbares Mittel wusste, sie nach England zu bringen. An diesem ersten Tag ihrer Bekanntschaft vertrauten die alte Dame und ihre Töchter sich dem Fremden noch nicht an; sie gaben ihm jedoch Brot und eine Flasche Wein und versprachen ihm, für ihn zu sorgen, solange er auf ihrer Etage wohnte, wenn er für seine Lebensmittel bezahlte, denn sie lebten zwar nicht im Elend, doch in größter Armut.
Am zweiten Tag ihrer Bekanntschaft erfuhr er, dass Carbon der Bruder der alten Dame war und sich bis zum 7. Nivôse bei ihr aufgehalten hatte. Dann hatte eine Demoiselle de Cicé ihn im Auftrag von Limoëlans Beichtvater abgeholt und zu einem kleinen Nonnenorden von Sacré-Cœur gebracht, unter dem Vorwand, er sei ein Priester, der den Eid auf die Verfassung verweigert hatte und deshalb noch nicht nach Frankreich zurückkehren dürfe; da er nicht länger warten wolle, sei er nach Frankreich zurückgekommen, denn er rechne täglich damit, von der Liste der Emigranten gestrichen zu werden. Im Übrigen war er bei den Nonnen sicher aufgehoben, und seine Beschützerinnen, die dem Ersten Konsul für sein Einlenken ihrer Religionsausübung gegenüber dankbar waren, feierten jeden Tag eine Messe für den Erhalt seiner kostbaren Existenz, an welcher teilzunehmen Carbon niemals versäumte.
Über die Verschwörung der Attentäter mit der Höllenmaschine war die alte Dame vorzüglich unterrichtet, denn sie hatte sich unter ihren Augen abgespielt; sie zeigte dem Limousiner das letzte der zwölf Pulverfässer, mit denen das große Fass gefüllt worden war.
Das letzte Faß enthielt noch an die zwölf Pfund Pulver; der Limousiner erkannte, dass es sich um englisches Schießpulver allererster Güte handelte; die anderen Fässer waren zu Feuerholz zersägt worden, und Limoëlan hatte sogar gesagt: »Gehen Sie sorgsam damit um, meine Damen, das ist teuer erkauftes Holz!«
Sie zeigte ihm auch die Kittel, mit denen sich Limoëlan und Carbon verkleidet hatten; was aus dem Kittel Saint-Régeants geworden war, wusste sie nicht.
Nun galt es nur noch herauszufinden, in welchem Nonnenkloster Carbon sich aufhielt. Die drei Damen wussten es auch nicht, doch der vorgebliche Chouan behauptete so beharrlich, er müsse seine Flucht mit Carbon abstimmen, dass dessen Schwester zuletzt versprach, ihm Carbons Adresse am nächsten Tag zu bringen.
Da sie wusste, wo sie Mademoiselle de Cicé antreffen konnte, suchte sie diese auf und erhielt von ihr die gewünschte Auskunft.
Die Messen für das Seelenheil des Ersten Konsuls waren öffentlich, und so konnte der Limousiner mit zwei Polizisten in die Kirche eindringen. In einer Ecke des Chors sah er einen Mann, der so andächtig betete, dass es sich um niemand anderen als Carbon handeln konnte.
Der Spitzel wartete, bis fast alle gegangen waren; dann näherte er sich Carbon und nahm ihn ohne jede Gegenwehr fest, so überrascht war sein Opfer.
Carbon gab sofort alles zu. Das Geständnis war die einzige Hoffnung, die ihm blieb. Er verriet auch Saint-Régeants Versteck. Es befand sich in der Rue du Bac.
Als Saint-Régeant festgenommen wurde und erfuhr, dass sein Komplize alles gestanden hatte, machte er keinerlei Ausflüchte, sondern legte folgendes Geständnis ab, das wir dem von ihm unterzeichneten Protokoll entnehmen:
»Alles, was der Polizist Victor über den Kauf des Pferdes, das Unterstellen des Karrens bei einem Getreidehändler und den Kauf eines Fasses gesagt hat, ist wahr.
Wir mussten einen Tag bestimmen und wählten den Abend, an dem der Erste Konsul in der Oper das Oratorium Die Schöpfung besuchen sollte.
Wir wussten, dass er durch die Rue Saint-Nicaise kommen würde, eine der engsten Straßen in der Nähe der Tuilerien, und dort wollten wir unsere Bombe aufstellen. Der Wagen des Ersten Konsuls sollte um Viertel nach acht vorbeikommen. Punkt acht Uhr war ich mit dem Karren zur Stelle, während sich Limoëlan und Carbon an zwei Portalen des Louvre versteckt hielten, um mich gegebenenfalls zu benachrichtigen. Wie ich als Kärrner verkleidet, hatten sie mir geholfen, den Karren dort abzustellen, wo die Rue de Malte in die Rue Saint-Nicaise einmündet; daraufhin hatten sie ihren Posten bezogen. Fünf Minuten verstrichen. Da ich kein Zeichen erhalten hatte, verließ ich den Karren und vertraute die Zügel des Pferdes einem Bauernmädchen an, dem ich dafür vierundzwanzig Sous gab, und ging die Straße bis zu den Tuilerien entlang.
Plötzlich hörte ich Limoëlan rufen: ›Da kommt er!‹, und im gleichen Moment vernahm ich das Geräusch eines näher kommenden Wagens und einer Eskorte. Ich lief zu dem Karren zurück und dachte mir dabei: Gott im Himmel, wenn Bonaparte für Frankreichs Frieden notwendig ist, dann wende den Anschlag von seinem Haupt ab und leite ihn auf mich! Dann habe ich dem Mädchen zugerufen: ›Lauf weg!‹ und habe den Zunder entzündet, der das Pulver auf dem Karren in Brand gesetzt hat.
Wagen und Eskorte hatten mich schon eingeholt. Das Pferd eines Grenadiers hat mich an eine Häusermauer gedrückt; ich bin gestürzt, habe mich aufgerappelt und bin zum Louvre gelaufen, aber nach wenigen Schritten ohnmächtig geworden. Als Letztes sah ich den Feuerschein des Zunders funkeln und dann die Silhouette des Mädchens neben dem Karren; dann habe ich nichts mehr gesehen, gehört oder gespürt!
Als ich wieder zu mir kam, lag ich unter dem Portal des Louvre. Wie lange ich dort ohnmächtig gelegen hatte, wüsste ich nicht zu sagen. Der kühle Lufthauch hat mich zur Besinnung gebracht; ich wusste wieder, wer ich war, und erinnerte mich an alles, doch zwei Dinge verwunderten mich: dass ich noch am Leben war und dass ich mich in Freiheit befand. Blut floss mir aus Nase und Mund. Zweifellos hatte man mich für einen der vielen harmlosen Passanten gehalten, die von der teuflischen Maschine verwundet worden waren. So schnell ich konnte, lief ich zur Brücke, verknotete meinen Kittel und warf ihn in den Fluss. Ich wusste nicht, wohin; ich hatte erwartet, bei der Explosion zerfetzt zu werden, und mich nicht um einen Unterschlupf für den Fall meines Überlebens gekümmert. Ich fand Limoëlan zu Hause vor, wo wir zusammen wohnten. Als er meinen Zustand sah, holte er einen Beichtvater und einen Arzt. Der Beichtvater war sein Onkel, Monsieur Picot de Colsrivière, der Arzt ein junger Mann aus seinem Freundeskreis. Von ihnen haben wir dann erfahren, dass das Attentat gescheitert war.
›Ich war von Anfang an gegen den Zunder‹, sagte Limoëlan. ›Hättest du auf mich gehört und mit mir den Platz getauscht, dann hätte ich die Sprengladung mit einem glühenden Holzscheit entzündet. Ich wäre in Stücke gerissen worden, gewiss, aber ich hätte Bonaparte ins Jenseits befördert. ‹«
Das war alles, was aus Saint-Régeant herauszubekommen war, aber mehr benötigte man nicht.
Limoëlan, der sich schämte, bei seinem Unternehmen gescheitert zu sein, und der davon überzeugt war, dass ein politischer Attentäter entweder zu triumphieren oder umzukommen habe, kehrte nicht zu Georges Cadoudal zurück und setzte keinen Fuß mehr nach England. Da er ebenso fromm wie stolz war, sah er in seinem Handeln Gottes Willen, war nicht bereit, sich der Justiz der Menschen zu unterwerfen, und schiffte sich in Saint-Malo als einfacher Matrose ein.
Man erfuhr nur, dass er in die Fremde gegangen sei und sich von der Welt zurückgezogen habe; selbst seine engsten Verbündeten wussten nichts von seinem Schicksal. Fouché aber ließ ihn nicht aus den Augen und beobachtete noch lange das entlegene Kloster, in dem er die Priesterweihe empfangen hatte. Er stand nur mit seiner Schwester in Briefwechsel, und am Kopf eines seiner Briefe las Desmarets, der Chef der Geheimpolizei, folgende bemerkenswerte Beschwörung, die Limoëlan offenbar verfasst hatte, weil er fürchtete, englische Kreuzer könnten seine Briefe abfangen:
»O Engländer! Lasst diesen Brief seinen Bestimmungsort erreichen... er stammt von einem, der für Eure Sache viel getan und viel darum gelitten hat.«
Noch zwei weitere Royalisten waren in die Verschwörung verwickelt, doch tauchen sie nur schemenhaft im Hintergrund auf. Sie hießen Joyaut und Lahaye Saint-Hilaire.
Beide konnten wie Limoëlan die Gunst der Stunde und das Kesseltreiben gegen die Jakobiner zur Flucht nutzen; sie gingen nach England und berichteten Cadoudal vom Scheitern des letzten Attentats.
Saint-Régeant und Carbon wurden zum Tode verurteilt. Trotz seiner Aussagen und seiner Beihilfe zum Auffinden und Verhaften seines Komplizen wurde Carbon keine Strafmilderung gewährt.
Als Bonaparte auf das Gerichtsverfahren angesprochen wurde, schien er es völlig vergessen zu haben; er sagte nur: »Wenn das Urteil gefällt ist, soll es vollstreckt werden. Mich geht das nichts an.«
Am 21. April starben Carbon und Saint-Régeant auf dem Schafott, das noch von dem Blut Arénas und seiner drei Komplizen gerötet war.
Vergeblich haben wir nach Berichten über den Tod der zwei Verurteilten gesucht. Offenbar wünschte die Regierung, dass dem Sterben dieser zwei Unglückseligen keinerlei weiter gehende Bedeutung zugemessen wurde. Der Bericht ihres Todes in Le Moniteur ist nur eine Zeile lang und besagt:
»Am Tag X und zur Stunde X sind Carbon und Saint-Régeant hingerichtet worden.«
Am Tag nach ihrer Hinrichtung reiste der Limousiner mit geheimen Befehlen nach London ab.
29
König Ludwig von Parma
Wenn die Existenz eines Menschen für die Interessen, die Ehre und das Schicksal einer großen Nation von überragendem Gewicht ist, wenn aller Gedanken dem Erfolg oder Misserfolg dieses Menschen und seines Geschicks gelten und alle sich in Spekulationen ergehen, welche Folgen Erfolg oder Misserfolg, Aufstieg oder Fall zeitigen könnten, stehen Freund und Feind einander gegenüber und erwägen, was Hass oder Hingabe, entgegengebracht dem Mann, der sich erhebt, aber jeden Augenblick fallen kann, ihnen einbringen mögen. Das ist die Stunde der Wahrsager, der Vorahnungen, der Voraussagen. Selbst die Träume üben ihren geheimen Einfluss aus, und jeder lässt sich nur zu gerne in das unbekannte Land der Zukunft entführen von einem jener leichten und flüchtigen Führer, die dem Reich der Nacht durch die hörnerne oder elfenbeinerne Pforte entweichen. Die einen sehen – von Natur aus ängstlich oder aus gewohnheitsmäßiger Schwarzseherei – bei jedem Anlass die schrecklichsten Dinge voraus und liegen aller Welt mit absurden Warnungen vor eingebildeten Gefahren in den Ohren, die anderen wiederum sehen alles im rosigsten Licht, reden sich die Dinge und die Zukunft schön und bestärken Cäsar oder Bonaparte unbekümmert in deren Blindheit für alles außer dem angestrebten Ziel, während eine dritte Partei – die Partei der Verlierer, auf die sich der große Mann, dem Zufall und Vorsehung in die Hände spielen, stützt, indem er sie zertritt – ihrem ohnmächtigen Zorn mit finsteren Verwünschungen und Plakaten voller Drohungen und blutrünstigen Ankündigungen Luft macht.
Und inmitten der geistigen Strömungen solch unseliger Zeiten, ja sogar aus diesen Strömungen heraus keimen bisweilen verbrecherische Gedanken, an denen sich schwache oder düstere Geister berauschen – heillose Zustände, denen derjenige, der sie geschaffen hat, nur durch den Tod entkommen zu können scheint.
Solche Zustände herrschten unter Cäsar, der sich zum König krönen wollte, unter Heinrich IV., der Maria von Medici und Concino Concini den Prozess machen wollte, und nach dem 18. Brumaire unter Bonaparte, der zwischen der Rolle eines Augustus und der eines Washington zauderte.
Unter diesen Umständen kann es leicht geschehen, dass ein Preis auf den Kopf ausgesetzt wird, der die Zukunft zu bergen scheint, dass er der allgemeinen Ruhe geopfert werden soll, und die Frage ist dann nur, wer als Erster zum Dolch eines Brutus oder zum Messer eines Ravaillac greift, um das Hindernis zu beseitigen, das seinen Wünschen, Grundsätzen oder Hoffnungen im Weg steht.
Wahrhaftig war das ganze erste Jahr des Konsulats von einer schier endlosen Kette der Verschwörungen gegen den Ersten Konsul begleitet gewesen. Feinde, die er sich mit dem 13. Vendémiaire geschaffen hatte, mit dem 18. Fructidor, mit dem 18. Brumaire, Royalisten, Republikaner, Compagnons de Jéhu, Vendée-Aufständische und Chouans konspirierten bei Nacht und im Wald, auf den Landstraßen, in den Cafés, ja sogar im Theater.
Ergrimmt ob des Handstreichs von Saint-Cloud, Bonapartes letztem politischen Handstreich, besorgt ob der möglichen Folgen, besorgt auch durch Bonapartes beharrliches Schweigen auf die Briefe Ludwigs XVIII., versetzten sich Royalisten und Republikaner, die beiden einzigen politischen Parteien im damaligen Frankreich, kurz: die Weißen und die Blauen, in Rage, indem sie laut Rache und Tod forderten.
»Wie soll ich nicht konspirieren?«, hatte Aréna zu seinen Richtern gesagt. »Alle Welt konspiriert heutzutage. Auf den Straßen, in den Salons, auf den Kreuzungen und öffentlichen Plätzen, überall wird konspiriert.«
»Die Luft ist voller Dolche«, wird sogar Fouché sagen, um das Denken dieser Verschwörer zu schildern und um Bonaparte aus seiner Untätigkeit zu wecken.
In allen Einzelheiten kennen wir den schrecklichen Krieg der Vendée und der Bretagne, die Verschwörung der Wälder gegen die Stadt, untrennbar verbunden mit den Namen La Rochejacquelein, Bonchamps, d’Elbée, Charette und Lescure. In allen Einzelheiten kennen wir die Verschwörung der Compagnons de Jéhu zum Straßenraub, die vor unseren Augen Valensolles, Jahiat, Ribier und Sainte-Hermine mit dem Leben bezahlt haben, doch mit keiner Silbe erwähnten wir bisher die Verschwörung der Straße eines Metge, eines Veycer und eines Chevalier, die von Standgerichten abgeurteilt und füsiliert wurden.
In wenigen Zeilen berichteten wir von der Verschwörung zum Mord im Theater, an der Topino-Lebrun, Demerville, Ceracchi und d’Aréna beteiligt waren. Dann sahen wir die Verschwörung Limoëlans, Carbons und Saint-Régeants zum Attentat an der Straßenkreuzung heraufziehen und verfolgten die Attentäter von der Rue Saint-Nicaise bis zur Place de Grève. Und bald werden wir die Verschwörung Pichegrus, Cadoudals und Moreaus heraufziehen sehen.
Doch sobald es den Anschein hatte, als beruhige sich die Lage, als auf den Frieden von Lunéville mit Österreich der Frieden von Amiens mit England folgte, als Franz I., diese Verkörperung der politischen Reaktion in Europa, zuließ, dass sich vor seiner Tür in Italien Republiken bildeten, als Georg II. von England bereit war, von dem Wappen Heinrichs IV. die drei Bourbonenlilien zu tilgen, als Ferdinand von Neapel den Engländern seine Häfen versperrte, als Bonaparte sich unmissverständlich im Tuilerienpalast eingerichtet hatte und seine Frau mit einer Etikette umgab, die zwar noch weit entfernt von kaiserlicher Etikette war, aber fürstliche Etikette bereits bei Weitem überstieg, als Joséphine zum Ausgehen die Begleitung von vier Ehrendamen und vier Offizieren benötigte, als sie in ihren Gemächern Empfänge gab und in den Gemächern des Erdgeschosses mit Blick auf den Garten Minister empfing, Diplomaten, vornehme Ausländer, als sich, angeführt vom Außenminister, die Gesandten aller europäischen Mächte einfanden, durch den Frieden nach Paris gelockt, als die Tür zu den Gemächern des Ersten Konsuls sich unversehens öffnete und er mit dem Hut auf dem Kopf all diese Gesandten begrüßte, die sich vor ihm verbeugten, als am zweiten Jahrestag des 18. Brumaire das Fest des Friedens gefeiert wurde, als man miterlebte, wie derjenige, den zwei Kammern seinerzeit kurzzeitig für vogelfrei erklärt hatten, mit dem Papst, dem Gesandten Gottes, so umsprang, wie er es mit den Gesandten irdischer Könige getan hatte, als die Kirchen wieder geöffnet waren und Kardinal Caprara in Notre-Dame das Tedeum singen ließ, als Chateaubriand, der den aus Frankreich verjagten Gott im Schatten der Urwälder Amerikas und in den Wasserfällen des Niagara gefunden hatte, seinen Geist des Christentums in jener Stadt veröffentlichte, in der man fünf Jahre zuvor mit Robespierre den Kult des Höchsten Wesens gefeiert und der Göttin Vernunft gehuldigt hatte, zu deren Tempel man Philippe-Augustes alte Basilika umgewandelt hatte, als Rom sich mit der Revolution versöhnt hatte und der Papst dem Mann die Hand reichte, der das Abkommen unterzeichnet hatte, das ihn seiner Länder beraubte, als zu guter Letzt der Sieger von Montebello, von Rivoli, der Pyramiden und von Marengo den beiden gesetzgebenden Versammlungen den Frieden zu Lande durch den Vertrag von Lunéville und den Frieden zu Meere durch den Vertrag von Amiens brachte sowie den Frieden mit dem Himmel durch das Konkordat, die Amnestie für alle Verfolgten und ein unerreichtes Gesetzbuch, als er zum Lohn für seine Dienste das Konsulat auf Lebenszeit erhielt, ja fast die Krone, als schließlich klar wurde, dass nichts von dem eingetreten war, was sich England in seiner erbitterten Feindschaft ersehnt hatte, als für einen Augenblick die Hoffnung erlaubt schien, dass dieser Diktator künftig so weise sein würde, wie er in der Vergangenheit groß gewesen war, im Besitz jener Widersprüche, die Gott in keinem anderen Menschen je vereinte: Kraft und Instinkt des großen Heerführers sowie Glück und Ruhm des Begründers eines Reiches, als man hoffen wollte, dass dieser Mann Frankreich der Freiheit entgegenführen werde, nachdem er es so groß gemacht hatte, mit Ruhm überhäuft, an die Spitze der Nationen gestellt hatte – da erschrak England und redete sich ein, es habe die Pflicht, unter Hintanstellung von Recht und Moral diesem neuen Washington, kaum minder machtvoll als jener in seiner gesetzgeberischen Eigenschaft, doch weitaus beeindruckender als Feldherr, in den Arm zu fallen.
Doch schon bald ergab sich für den Ersten Konsul die Gelegenheit, Europas Erstaunen und Zweifel noch zu steigern. Da der König von Spanien ihn in seinem Krieg gegen Portugal unterstützt hatte, hatte er ihm für den Infanten von Parma, der mit seiner Tochter verheiratet war, das Königreich Etrurien versprochen.
Mit dem Frieden von Lunéville war dieses Versprechen ratifiziert worden. Die Infanten von Parma kamen auf ihrem Weg in die Toskana von der Pyrenäengrenze nach Paris, um die Befehle des Ersten Konsuls entgegenzunehmen. Bonaparte legte großen Wert darauf, das Infantenpaar den Franzosen zu zeigen und es in Paris herumzuführen, bevor er es den Thron in Florenz einnehmen heißen würde. An Kontrasten jeder Art entzündete sich die Phantasie des Ersten Konsuls, der sich allmählich dem Eindruck hingab, er könne alles bewerkstelligen, was er wollte. Die Vorstellung eines Königs, hervorgebracht von einer Republik, war so recht nach seinem Sinn, so wahrlich antik und von erhaben römischem Geist; nicht weniger nach seinem Sinn war zu zeigen, dass er keineswegs fürchtete, einen Bourbonen in Frankreich zu sehen; enthob sein Ruhm ihn nicht jedem Vergleich mit diesem alten Herrscherhaus, das er vielleicht nicht vom Thron gestoßen, doch in seiner Bedeutung abgelöst hatte? Zudem war es für ihn die erste Gelegenheit, Paris in glanzvollem Rahmen von all seinen revolutionären Wunden genesen zu zeigen und als einfacher Konsul einen Prunk zu entfalten, wie ihn zu jener Zeit nur die wenigsten Könige pflegten, denn diese hatte der Krieg ruiniert, der Frankreich reich gemacht hatte.
Bonaparte beriet sich mit seinen zwei Kollegen. Zu dritt erwogen sie ausführlich, welche Ehrenbekundungen König und Königin von Etrurien bezeigt werden sollten. Man kam überein, sie inkognito als Graf und Gräfin von Livorno zu empfangen. Unter diesem Namen sollten sie mit der gleichen Etikette behandelt werden, die unter Ludwig XVI. dem Zarewitsch Paul von Russland und Joseph II. erwiesen worden war.
Entsprechende Ordre wurde an alle zivilen und militärischen Behörden der Departements erteilt, durch deren Gebiet der Reiseweg des Königspaars führte.
Während Frankreich in seinem Stolz darauf, Könige zu erschaffen, und glücklich darüber, selbst keinen zu haben, das junge Prinzenpaar beifällig betrachtete, betrachtete Europa Frankreich voller Verblüffung.
Die Royalisten wollten im Theater von Bordeaux die Anwesenheit des jungen Paares dazu nutzen, die öffentliche Meinung auf die Probe zu stellen, und riefen: »Es lebe der König!«, doch der ganze Saal antwortete wie aus einem Mund: »Nieder mit den Königen!«
Das Prinzenpaar kam im Juni nach Paris, wo es sechs Wochen verbringen würde. Es war nicht zu übersehen, dass Bonaparte als Erster Konsul, das heißt als bloßer auf Zeit gewählter Staatsbeamter einer Republik, das Land Frankreich repräsentierte. Vor dieser Würde erloschen alle Privilegien königlichen Geblüts, und die zwei jungen Majestäten statteten als Erste Bonaparte ihren Besuch ab.
Er erwiderte den Besuch am Tag darauf.
Um den Unterschied zwischen ihm und seinen Kollegen herauszustreichen, statteten diese wiederum dem jungen Paar ihren Besuch zuerst ab.
In der Oper wollte der Erste Konsul seine Gäste dem Pariser Publikum vorstellen, doch am festgesetzten Tag mit dem per Ordre festgesetzten Schauspiel war Bonaparte indisponiert, ob aus Kalkül oder wirklich, sei dahingestellt.
Cambacérès ersetzte ihn als Begleiter der Infanten. Als sie die Loge der Konsuln betreten hatten, nahm er die Hand des Grafen von Livorno und stellte ihn dem Publikum vor, das mit tosendem Applaus antwortete, der vielleicht nicht ganz frei von Bosheit war.
Das Unwohlsein des Ersten Konsuls löste eine Vielzahl von Vermutungen aus, und man unterstellte ihm Absichten, die er möglicherweise niemals gehegt hatte. Seine Anhänger sagten, er habe Frankreich keine Bourbonen vorstellen wollen; die Royalisten beteuerten, es sei dies seine Art, das Volk auf die Rückkehr des abgesetzten Herrscherhauses einzustimmen, und die wenigen Republikaner, die nach dem letzten Aderlass noch übrig waren, behaupteten, er wolle mit diesem in seiner Abwesenheit veranstalteten königlichen Gepränge Frankreich an die Wiedereinführung der Monarchie gewöhnen.
Die Minister folgten dem Beispiel des Ersten Konsuls, vor allem Monsieur de Talleyrand, dessen aristokratische Neigungen ihn schon immer mit der Wiedereinführung des Ancien Régime hatten liebäugeln lassen und der zweifellos der vollendetste Vertreter dieser Epoche in Eleganz und Wortgewandtheit war; in seinem Schloss in Neuilly richtete er dem durchreisenden Prinzenpaar ein großartiges Fest aus, das die gesamte vornehme Welt von Paris besuchte. In der Tat verkehrten viele im Haus des Außenministers, die keinen Fuß in den Tuilerienpalast gesetzt hätten.
Eine Überraschung harrte des jungen Paares, das seine künftige Hauptstadt noch nicht kannte. Während eines prunkvollen Feuerwerks erschien plötzlich die Stadt Florenz, verkörpert durch das Florentinischste an ihr, den Palazzo Vecchio; Volksmassen in florentinischer Tracht tanzten und sangen auf dem Platz, und eine Prozession junger Mädchen brachte den künftigen Herrschern Blumen zum Geschenk und dem Ersten Konsul Triumphkronen.
Dieses Fest, so hieß es, habe Monsieur de Talleyrand eine Million Francs gekostet; allerdings gelang ihm, was niemand anderem gelungen wäre: indem er an diesem einen Abend der Regierung mehr neue Freunde aus den Reihen der Anhänger des Ancien Régime verschaffte als in den zwei Jahren davor, denn nicht Wenige, die diesem Regime nachtrauerten, weil sie mit ihm Mittel und Einfluss verloren hatten, begannen zu hoffen, beides unter dem neuen Regime wiederzugewinnen.
Zuletzt wurden Graf und Gräfin von Livorno von Graf Azara, dem spanischen Botschafter, nach La Malmaison geleitet. Der Erste Konsul empfing den König an der Spitze seines militärischen Hausgesindes, und der König, der so prunkvolle Festlichkeiten und eine solche Überfülle an Goldstickerei und Epauletten noch nie zu sehen bekommen hatte, wurde völlig kopflos und warf sich dem Ersten Konsul an den Hals.
Denn um der Wahrheit die Ehre zu geben, müssen wir gestehen, dass der arme junge Fürst schwachsinnig war oder doch beinahe; die Natur hatte ihn mit einem ausgezeichneten Herzen bedacht, ihm aber alles vorenthalten, was den Geist ausmacht. Und die Erziehung, die er bei den Mönchen genossen hatte, war darauf angelegt gewesen, noch die letzten Funken Intelligenz zu ersticken, die seinem Herzen entsprangen und die Leere in seinem Kopf ausgefüllt hätten.
Ludwig von Parma verbrachte fast seinen ganzen Aufenthalt in Frankreich in La Malmaison. Madame Bonaparte entführte die junge Königin in ihre Gemächer, und da der Erste Konsul nur zum Diner sein Arbeitskabinett verließ, mussten seine Aides de Camp dem König Gesellschaft leisten und ihn unterhalten, denn er war nicht nur außerstande, sich zu beschäftigen, sondern auch, sich Unterhaltung zu verschaffen.
»Und wahrhaftig«, sagte der Herzog von Rovigo, der zu jener Zeit zu den Aides de Camp des Ersten Konsuls zählte, »musste man Geduld aufbringen, um sich die Kindereien anzuhören, die er im Kopf hatte. Aber da wir wussten, wie es um ihn bestellt war, ließen wir Spiele für ihn holen, mit denen man sonst Kinder unterhält. Von da an langweilte er sich nicht mehr.
Seine geistige Leere schmerzte uns; es war qualvoll mit anzusehen, dass ein groß gewachsener, schöner junger Mann, der andere hätte anführen sollen, beim Anblick eines Pferdes, das er nicht zu besteigen wagte, zu zittern begann, dass er seine Zeit damit verbrachte, Verstecken zu spielen und Huckepack zu reiten, und dass seine ganze Bildung sich darauf beschränkte, dass er seine Gebete vor dem Essen und nach dem Essen aufsagen konnte.
Diese Hände sollten die Geschicke einer Nation leiten!
Als er abreiste, um sich in seinen Staat zu begeben, sagte der Erste Konsul nach der Abschiedsaudienz zu uns: ›Rom kann unbesorgt sein, der wird den Rubikon nicht überschreiten.‹«
Gott erwies seinem Volk die Gnade, es nach einem Jahr Regentschaft von diesem König zu erlösen.
Europa jedoch hatte nicht die Hohlköpfigkeit des jungen Prinzen zu sehen bekommen, sondern die Begründung eines neuen Königreichs, und es musste sich fragen, welche sonderbare Bewandtnis es mit diesem Volk der Franzosen haben mochte, das seine eigenen Könige köpfte und andere Völker mit Königen versah.
30
Jupiter auf dem Olymp
Man wird nicht übersehen haben, wie gewissenhaft wir bemüht waren, die historischen Persönlichkeiten, die in dieser Erzählung eine Rolle spielen, unseren Lesern so unvoreingenommen wie möglich zu schildern, ja so zu schildern, wie sie selbst sich von der unvoreingenommenen Geschichte geschildert wünschten. Wir ließen uns dabei weder von den persönlichen Erinnerungen an die Missgeschicke unserer Familie beeinflussen, deren Ursprung bis zu Bonapartes Zwist mit Kléber in Ägypten zurückreicht (denn für Kléber hatte mein Vater Partei ergriffen), noch von dem Hosianna-Geschrei der unermüdlichen Bonapartisten, die grundsätzlich alles an ihrem Idol bewundern, noch von der Mode, ausgelöst durch erneute Opposition gegen Napoleon III., die Vergangenheit in Bausch und Bogen zu verurteilen, um die Grundfesten seiner wackeligen Dynastie zu erschüttern. Nein; fern sei mir zu behaupten, ich sei gerecht gewesen, denn welcher Mensch könnte das von sich sagen?, doch aufrichtig war ich, und ich bin mir sicher, dass an dieser Aufrichtigkeit niemand zweifelt. Nun denn! Es ist meine aufrichtige Überzeugung, dass zu jener Zeit, von der soeben die Rede war, in dem Wissen, dass für die Vollendung seiner hochgesteckten Ziele der Frieden nicht minder nützlich wäre als der Krieg, der Erste Konsul ernsthaft den Frieden wünschte. Ich will damit keineswegs behaupten, dass ihm, der so erfolgreich, so versiert und so sicher das blutige Spiel der Schlachten zu spielen verstand, nicht bisweilen die Schatten von Arcoli und Rivoli den Schlaf verdüsterten, ich will nicht behaupten, dass nicht von Zeit zu Zeit die geschmeidigen Palmen des Nils oder die starren Pyramiden von Giseh ihm in wachen Stunden vor das innere Auge traten, und ebenso wenig will ich leugnen, dass ihn dann der blendende Schnee des Sankt Bernhard oder der beißende Rauch von Marengo aus diesen Halbträumen rissen. Dagegen will ich bereitwillig behaupten, dass er die goldenen Früchte und Eichenlaubkronen schimmern sah, die der Frieden jenen schenkt, denen ein günstiges Geschick vergönnt, die Türen des Janustempels zu schließen.
Denn Bonaparte war gelungen, im Alter von einunddreißig Jahren das zu tun, was weder Marius noch Sulla, noch Cäsar in ihrem ganzen Leben hatten tun können.
Doch würde es in seiner Macht liegen, diesen Frieden zu bewahren, der so teuer erworben war? Und würde England, dessen drei Leoparden er die Krallen gestutzt und die Zähne ausgerissen hatte, Cäsar die Zeit lassen, ein Augustus zu werden?
Und doch benötigte Bonaparte den Frieden, um den Thron Frankreichs zu erobern, wie Napoleon den Krieg benötigt hatte, um auf Kosten der anderen Throne Europas diesen Thron fester zu verankern. Zudem gab Bonaparte sich keinen Illusionen über die Absichten seines ewigen Widersachers hin; er wusste sehr wohl, dass England den Frieden nur geschlossen hatte, weil es den Krieg ohne seine Alliierten nicht fortsetzen konnte, und er wusste, dass England Frankreich nicht genug Zeit lassen würde, seine Marine wiederaufzubauen, was vier bis fünf Jahre in Anspruch nehmen musste. Bonaparte war sich der diesbezüglichen Pläne des Kabinetts von Saint James so gewiss, dass er, wenn von den Bedürfnissen der Völker die Rede war, von den Vorteilen des Friedens und seinen wohltätigen Auswirkungen auf die innere Ordnung, die Künste, Handel und Gewerbe, kurzum alles, was gebündelt den allgemeinen Wohlstand ausmacht, nichts davon leugnete, doch erwiderte, all diese Dinge seien nur im Zusammenwirken mit England erreichbar und man könne sich darauf verlassen, dass es keine zwei Jahre dauern werde, bis England von Neuem das Gewicht seiner Marine in die Waagschale der Welt werfen und mit seinem Gold alle Kabinette Europas zu beeinflussen suchen werde. Dann brachen seine Gedanken hervor wie ein Fluss, der sich von seinem Damm nicht mehr halten lässt, und er schien zu spüren, wie der Frieden seinen Händen entglitt, nachgerade, als wohnte er den Sitzungen des englischen Kabinetts bei.
»Der Frieden wird nicht von Bestand sein«, rief er, »und England wird ihn brechen. Wäre es da nicht klüger, den Engländern zuvorzukommen? Wäre es nicht besser, ihnen keine Zeit zu lassen, uns zuvorzukommen, sondern einen großen, schrecklichen Erstschlag zu führen, der die ganze Welt in Erstaunen versetzen müsste?«
Und daraufhin verlor er sich in einen jener tiefgründigen Gedankengänge, die Frankreich aufmerksam und Europa staunend verfolgten.
In der Tat rechtfertigte Englands Betragen Bonapartes Misstrauen nur allzusehr oder, anders gesagt, indem England annahm, Bonaparte wolle den Krieg, handelte England ganz genau so, wie Bonaparte erwartete, und das Einzige, was dieser an jenem auszusetzen hätte haben können, war, dass es schneller handelte, als selbst Bonaparte wünschen konnte.
Der englische König hatte seinem Parlament eine Nota übermittelt, in der er sich darüber beschwerte, dass in den Häfen Frankreichs offenbar gerüstet werde, und verlangte, dass Gegenmaßnahmen getroffen würden, damit man sich der Angriffe erwehren könne, welche die Franzosen im Schilde führten. Dieses Misstrauen erboste den Ersten Konsul im höchsten Maß: Kaum hatte sich seine Beliebtheit verdoppelt dank des heißersehnten Friedens, den er seinem Land endlich beschert hatte, drohte England bereits, diesen Frieden zu brechen.
England hatte sich im Vertrag von Amiens verpflichtet, die Insel Malta abzutreten, doch nichts dergleichen getan. Es sollte sich aus Ägypten zurückziehen, doch nichts war geschehen. Es sollte das Kap der Guten Hoffnung an Frankreich abtreten, dachte jedoch nicht daran.
Zu guter Letzt beschloss der Erste Konsul, diese Situation zu beenden, die quälend, unerträglich und schlimmer als der Krieg war, und er nahm sich vor, mit ungeschminkter Ehrlichkeit mit dem englischen Gesandten zu sprechen, um diesem klarzumachen, dass in zwei Punkten seine Meinung feststand, nämlich bezüglich der Räumung Maltas und der Räumung Ägyptens. Was er vorhatte, war etwas völlig Neues: ohne Umschweife mit dem Gegner zu sprechen und ihm zu sagen, was man sonst nie sagt, die Wahrheit über das, was man denkt.
Am 18. Februar 1803 war Lord Whitworth in den Tuilerienpalast eingeladen; Bonaparte empfing ihn in seinem Kabinett, bot ihm einen Sitz am einen Ende eines langen Tischs an und nahm am anderen Ende Platz. Sie waren allein, wie es sich für eine derartige Besprechung geziemt.
»Milord«, sagte Bonaparte, »ich wollte Sie unter vier Augen sehen und Ihnen unmittelbar meine wahren Absichten enthüllen, etwas, was kein Minister an meiner Stelle tun könnte.«
Dann erinnerte er sein Gegenüber an den Verlauf seiner Beziehungen zu England seit seinem Eintritt in das Konsulat – mit welcher Umsicht er noch am selben Tag seine Ernennung zum Konsul der englischen Regierung hatte mitteilen lassen, wie unverschämt Mister Pitt alle Annäherungsversuche zurückgewiesen hatte, wie unverdrossen er wiederum die Verhandlungen erneut aufgenommen hatte, sobald es ohne Ehrverlust möglich war, und unter welchen Zugeständnissen es zum Friedensschluss von Amiens gekommen war. Mehr im Scherz als im Zorn sprach er von dem Kummer, den es ihm bereitete, seine Bemühungen um ein gedeihliches Auskommen mit Großbritannien so gänzlich fruchtlos zu sehen. Er erinnerte den Botschafter daran, dass die üblen Machenschaften, die mit den Feindseligkeiten hätten aufhören sollen, stattdessen seit dem Unterzeichnen des Abkommens offenbar zugenommen hatten; er beklagte sich, dass die englischen Gazetten anscheinend dazu ermuntert wurden, gegen ihn vom Leder zu ziehen, dass man den Gazetten der Emigranten erlaubte, ihn unflätig zu beschimpfen, dass den französischen Prinzen in ganz England ein königlicher Empfang bereitet werde, und zuletzt ließ er durchblicken, dass er bei jeder neuen Verschwörung gegen ihn die Hand Englands im Spiel sehe.
»Jeder Windstoß aus England«, fügte er hinzu, »bringt mir neben dem alten Hass neuen Schimpf. Und jetzt, Milord, haben wir eine Situation erreicht, aus der wir uns unter allen Umständen befreien müssen; wollen Sie den Vertrag von Amiens einhalten oder nicht?
Ich für meinen Teil habe ihn bis in alle Einzelheiten erfüllt. Dieser Vertrag hat mich genötigt, Neapel, Tarent und die römischen Staaten binnen drei Monaten zu verlassen, und innerhalb von zwei Monaten hatten die französischen Truppen sich aus all diesen Ländern zurückgezogen.
Vor zehn Monaten wurden die Verträge bestätigt, und noch heute halten die englischen Truppen Malta und Alexandria besetzt.
Wollen Sie Frieden? Oder wollen Sie Krieg? Mein Gott, wenn Sie Krieg wollen, müssen Sie es nur sagen. Wenn Sie Krieg wollen, können Sie ihn haben, und zwar bis zum letzten Mann unserer beiden Völker.
Wollen Sie Frieden? Dann müssen Sie Malta und Alexandria räumen. Die felsige Insel Malta, auf der so viele Befestigungen aufeinandergetürmt wurden, mag von großer strategischer Bedeutung sein, doch sie ist für mich von noch größerer Bedeutung, was die Ehre Frankreichs betrifft. Was würde die Welt sagen, wenn wir zuließen, dass ein feierlich mit uns geschlossener Vertrag mit Füßen getreten würde? Sie müßte an unserem Mut zweifeln. Ich habe mich entschieden, und ich sähe Sie lieber im Besitz der Butte Montmartre und der Butte Chaumont als im Besitz Maltas.«[2]
Lord Whitworth, der nicht im Geringsten auf diesen Ausfall gefasst war, hatte schweigend und reglos zugehört, denn er besaß keine Instruktionen seiner Regierung für den Fall derartiger Vorwürfe; nun erwiderte er auf den Redeschwall des Ersten Konsuls: »Wie soll es möglich sein, innerhalb weniger Monate den Hass zu ersticken, den ein über zweihundert Jahre währender Krieg zwischen den zwei Nationen entfacht hat?
Sie wissen, wie wenig Macht die englischen Gesetze uns über die Presse einräumen; uns sind die Hände gefesselt, sogar gegenüber denen, die jeden Tag die englische Regierung mit Schimpf und Schande überhäufen. Die Bezüge der Chouans wiederum sind der Lohn für vergangene Dienste und nicht etwa Zahlungen für künftige. Und der Empfang, der den emigrierten Prinzen zuteil wird, ist der noble Ausdruck englischer Gastfreundschaft.«
»Doch all das«, unterbrach ihn Bonaparte, »rechtfertigt weder die Nachsicht, mit der die französischen Pamphletisten behandelt werden, noch die Ruhegelder, die Sie den Meuchelmördern zahlen, noch die Ehrenbezeigungen, die den bourbonischen Prinzen zuteil werden.« Er brach in Gelächter aus. »Einem Mann, den ich so schätze wie Sie«, sagte er, »will ich nicht die Haltlosigkeit Ihrer Argumente vor Augen führen. Kehren wir zu Malta zurück.«
»Nun denn, ich kann Ihnen versichern«, sagte Lord Whitworth schnell, »dass unsere Soldaten zum gegenwärtigen Zeitpunkt Alexandria geräumt haben dürften, und das Gleiche träfe auch auf Malta zu, hätte Ihre Politik nicht so gewaltige Veränderungen in Europa bewirkt.«
»Auf was für Veränderungen spielen Sie an?«, rief Bonaparte.
»Haben Sie sich etwa nicht zum Präsidenten der Republik Italien ernennen lassen?«
»Milord«, sagte Bonaparte lachend, »ist Ihr Zahlengedächtnis so schwach, dass Sie vergessen haben sollten, dass diese Präsidentschaft mir vor dem Vertrag von Amiens angetragen wurde?«
»Und was ist mit dem Königreich Etrurien, das Sie geschaffen haben«, erwiderte der Gesandte, »ohne England zu diesem Gegenstand im Mindesten zu konsultieren?«
»Da irren Sie sich, Milord: England wurde so eingehend konsultiert, obwohl es sich dabei um eine überflüssige Formalität handelte, dass es die umgehende Anerkennung dieses Königreichs in Aussicht gestellt hat.«
»England«, erwiderte Lord Whitworth, »hat Ihre Zusage verlangt, den König von Sardinien wieder in Besitz seiner Länder zu setzen.«
»Und ich habe Österreich, Russland und Ihnen erwidert, dass ich ihm nicht nur seine Länder nicht wiedergeben, sondern ihn auch nicht entschädigen werde. Sie wussten schon immer, denn es war nie ein Geheimnis, dass ich mich seit Langem mit der Absicht trage, Piemont mit Frankreich zu vereinigen; diese Vereinigung ist Voraussetzung für meine Herrschaft über Italien, eine ungeschmälerte Herrschaft, weil ich es so will, und so soll es bleiben. Aber lassen Sie uns beide ruhig einen Blick auf die Karte Europas werfen: Sehen Sie selbst, sehen Sie nur. Gibt es in irgendeinem Winkel, an irgendeinem Flecken ein Regiment meiner Armee, das dort nichts zu suchen hat? Gibt es irgendwo einen Staat, den ich bedrohe oder den ich überfallen will? O nein, das wissen Sie sehr wohl, zumindest solange der Frieden Bestand haben wird.«
»Wären Sie offen, Citoyen Erster Konsul, gäben Sie zu, dass Sie Ägypten noch immer im Sinn haben.«
»Gewiss habe ich Ägypten im Sinn, gewiss doch, gewiss werde ich es immer im Sinn behalten, und das erst recht, wenn Sie mich zwingen sollten, Krieg zu führen. Doch Gott bewahre mich davor, den Frieden aufs Spiel zu setzen, den wir seit so Kurzem erst genießen, und das einer bloßen Frage der Chronologie wegen. Das Osmanische Reich bröckelt an allen Ecken und Enden und steht kurz vor dem Zusammenbruch; sein Platz ist nicht in Europa, sondern in Asien; ich werde mich dafür einsetzen, es solange wie möglich am Leben zu erhalten, doch wenn es zerbricht, dann will ich, dass auch Frankreich davon profitiert. Sie müssen zugeben, nichts wäre leichter gewesen, als eine der zahlreichen Schiffsbemannungen, die ich nach Santo Domingo führe, Kurs auf Alexandria nehmen zu lassen. Sie haben dort viertausend Mann stationiert, die seit zehn Monaten Ägypten hätten verlassen sollen; diese viertausend Mann wären kein Hindernis für mich gewesen, sondern im Gegenteil ein Vorwand. Ich hätte Ägypten in vierundzwanzig Stunden erobert, und diesmal hätten Sie es mir nicht wieder abgejagt. Sie denken, meine Machtfülle mache mich blind für das Bild, das die öffentliche Meinung in Frankreich und in Europa von mir hat. Ich aber sage Ihnen, dass diese Machtfülle nicht so groß ist, dass sie mir einen mutwillig vom Zaun gebrochenen Angriffskrieg erlauben würde. Wäre ich so töricht, England ohne einen schwerwiegenden Grund anzugreifen, wäre mein politisches Ansehen, das weit mehr moralische als materielle Grundlagen hat, auf der Stelle in den Augen ganz Europas verwirkt. Frankreich wiederum muss ich beweisen, dass man mich bekriegt hat, ohne von mir dazu herausgefordert worden zu sein, wenn ich den Kampfgeist in ihm wecken will, den ich für den Krieg gegen Sie benötigen werde, falls sie mich zu diesem Krieg zwingen; dann müssen Sie ganz und gar im Unrecht sein, und ich muss im Recht sein! Und sollten Sie noch an meinem ernsthaften Wunsch zweifeln, den Frieden zu erhalten, dann hören und urteilen Sie selbst.
Ich bin zweiunddreißig Jahre alt; mit zweiunddreißig Jahren genieße ich eine Macht und ein Prestige, die zu steigern schwerfallen dürfte. Soll ich diese Macht, soll ich dieses Prestige leichtfertig aufs Spiel setzen, um einen aussichtslosen Kampf zu führen? O nein, das täte ich nur, wenn mir keine andere Wahl bliebe. Dann aber täte ich Folgendes: Ich würde keinen Scharmützelkrieg und keinen Blockadekrieg führen, keinen Krieg, bei dem hie und da ein Schiff auf dem Meer in Brand gesetzt wird und vom Meer gelöscht werden kann; o nein, ich würde zweihunderttausend Mann zusammenrufen und mit einer unermesslich großen Flotte den Ärmelkanal überqueren. Vielleicht verlöre ich dabei wie Xerxes meinen Ruhm und mein Glück, die zum Meeresboden sänken! Und sogar das Leben! Denn von solchen Expeditionen kehrt man nicht zurück – entweder man hat Erfolg, oder man kommt um!« Und da Lord Whitworth ihn sprachlos vor Erstaunen ansah, fuhr er fort: »Ein befremdlich kühner Einfall, nicht wahr, England überfallen zu wollen! Aber warum nicht? Was Cäsar gelang, ist auch mir gelungen; warum sollte mir nicht gelingen, was Wilhelm dem Eroberer gelang? Und deshalb will ich diese Kühnheit wagen, sollten Sie mich dazu zwingen. Ich werde meine Armee und mich selbst dem Wagnis unterziehen; ich habe die Alpen im Winter überschritten, und ich weiß, wie man möglich macht, was dem Hausverstand unmöglich erscheint. Doch sollte ich dabei Erfolg haben, dann werden noch Ihre fernsten Neffen blutige Tränen über den Entschluss vergießen, den zu treffen Sie mich gezwungen haben werden. Wenn ich sage: Ich will den Frieden, kann ich Ihnen keine anderen Beweise meiner Aufrichtigkeit geben. Und es wäre besser für Sie und für mich, wenn wir den Rahmen der Verträge einhielten: Ziehen Sie sich von Malta zurück und aus Ägypten, bringen Sie Ihre Gazetten zum Schweigen, verjagen Sie die feigen Mörder, die mir nach dem Leben trachten, aus Ihrem Land, handeln Sie im Einvernehmen mit mir, und ich verspreche Ihnen meinerseits ungetrübtes Einvernehmen. Nähern wir unsere Nationen einander an, schweißen wir sie aneinander, und wir werden eine Herrschaft über die Welt ausüben, wie sie weder Frankreich noch England allein ausüben könnte! Sie besitzen eine Marine, der ich mit zehn Jahren ununterbrochener Anstrengung und unter Einsatz all meiner Mittel nichts Vergleichbares zur Seite stellen könnte; ich hingegen habe fünfhunderttausend Mann, die bereit sind, unter meinem Befehl zu marschieren, wohin ich will. Sind Sie die Herren der Meere, so bin ich der Herr des Landes; ziehen wir also in Betracht, uns zu vereinen, statt einander zu befehden, und wir werden die Geschicke der übrigen Welt nach unserem Gutdünken leiten!«
Lord Whitworth informierte die englische Regierung von seiner Unterredung mit dem Ersten Konsul. Unglücklicherweise war er zwar ein Ehrenmann und ein Mann von Welt, doch kein großes Licht, und hatte deshalb den Gedanken, die der Erste Konsul entwickelt hatte, nicht ganz folgen können.
Auf Bonapartes lange und beredte Stegreifrede antwortete König George mit folgender Nota an sein Parlament:
George, König...
Seine Majestät hält es für erforderlich, das Unterhaus davon in Kenntnis zu setzen, dass beträchtliche militärische Vorbereitungen in den Häfen Frankreichs und Hollands getroffen werden und dass er es deshalb als geraten erachtet, neue Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit Großbritanniens zu gewährleisten. Wiewohl die erwähnten Vorbereitungen allem Anschein nach Kolonialexpeditionen ermöglichen sollen, hat Seine Majestät es angesichts der gegenwärtigen ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen Seiner Majestät und der französischen Regierung, deren Ausgang ungewiss ist, für ratsam gehalten, seinem treuen Unterhaus zu versichern, dass er im vollen Vertrauen darauf, sich von seinem Parlament in seinem dringlichen und unermüdlichen Eintreten für den Frieden unterstützt zu wissen, ebenfalls auf dessen Bürgergeist und Großzügigkeit vertraut und darauf, dass es ihm ermöglichen wird, alle Maßnahmen zu ergreifen, welche die Umstände erfordern mögen, auf dass die Ehre der englischen Krone und das Wohlergehen des englischen Volkes erhalten bleiben.
Der Erste Konsul erfuhr durch Monsieur de Talleyrand von dieser Verlautbarung. Er geriet in einen Zornesausbruch wie seinerzeit Alexander der Große; doch Monsieur de Talleyrand gelang es, ihn zu beruhigen und ihm das Versprechen abzuringen, sich zu beherrschen und es den Engländern zu überlassen, sich durch den ersten Schritt ins Unrecht zu setzen. Unglückseligerweise war der übernächste Tag ein Sonntag und der Tag, an dem im Tuilerienpalast die Diplomaten empfangen wurden. Alle Gesandten waren aus schierer Neugier anwesend. Jeder wollte wissen, wie Bonaparte den Schimpf ertragen und wie er mit dem englischen Botschafter verfahren würde.
Der Erste Konsul wartete bei Madame Bonaparte auf die Gäste und spielte mit dem ersten Kind König Louis’ und Königin Hortenses, als man ihm meldete, die Gesandten seien vollzählig versammelt.
Monsieur de Rémusat, der Präfekt des Palasts, trat ein und verkündete, dass alle anwesend seien.
»Ist Lord Whitworth auch da?«, fragte Bonaparte lebhaft.
»Ja, Citoyen Erster Konsul«, erwiderte Monsieur de Rémusat. Bonaparte, der auf dem Teppich lag, stieß das Kind weg, das er in den Armen hielt, richtete sich auf, ergriff Madame Bonapartes Hand, durchschritt die Tür zum Empfangssalon, ging an den ausländischen Ministern vorbei, ohne ihren Gruß zu erwidern, trat zu dem Vertreter Englands und sagte: »Milord, haben Sie Nachrichten aus England?«
Und ohne ihm Zeit für eine Antwort zu lassen, fügte er hinzu: »Sie wollen also Krieg?«
»Nein, General«, erwiderte der Botschafter, der sich verneigte, »dafür sind wir uns der Vorteile des Friedens allzu bewusst.«
»Sie wollen also Krieg«, sagte der Erste Konsul mit lauter Stimme, als hätte er die Antwort nicht gehört, wollte aber von allen Anwesenden gehört werden. »Wir haben einander zehn Jahre lang bekämpft, und Sie wollen, dass wir einander noch zehn Jahre länger bekämpfen! Wie konnte man sich zu der Lüge versteigen, Frankreich rüste? Man hat Europa belogen und der Welt Lügengeschichten erzählt! In unseren Häfen ankert kein einziges Kriegsschiff; alle diensttauglichen Kriegsschiffe wurden nach Santo Domingo geschickt. Das einzige vorhandene bewaffnete Schiff befindet sich in holländischen Gewässern, und jedermann weiß, dass es für Louisiana bestimmt ist. Es wurde das Gerücht verbreitet, zwischen Frankreich und England bestünden Meinungsverschiedenheiten. Ich weiß nichts davon; ich weiß nur, dass die Insel Malta nicht innerhalb der vereinbarten Zeitspanne geräumt wurde, doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Minister der englischen Loyalität untreu werden wollen, indem sie sich weigern sollten, einen Vertrag einzuhalten. Ebenso wenig will ich glauben, dass Sie mit Ihrem Rüsten das französische Volk einzuschüchtern gedächten. Man kann es töten, Milord, aber einschüchtern? Niemals!«
»General«, warf der Botschafter ein, völlig benommen von diesem Ausfall Bonapartes, »es ist unser höchstes Bestreben, in gutem Einvernehmen mit Frankreich zu leben.«
»Aber dann«, rief der Erste Konsul voller Vehemenz, »müssen Sie die Verträge einhalten! Wehe dem, der die Verträge bricht! Wehe dem Volk, dessen Verträge mit einem schwarzen Schleier bedeckt werden müssen!«
Und indem er abrupt Miene und Ton wechselte, um Lord Whitworth deutlich zu machen, dass die soeben ausgesprochene Schmähung seiner Regierung und nicht ihm persönlich galt, sagte er: »Milord, erlauben Sie mir, mich nach Ihrer Gemahlin, der Herzogin von Dorset, zu erkundigen; nachdem sie den Winter in Frankreich verbracht hat, hoffe ich, dass sie die schöne Jahreszeit hier wird genießen können. Doch dies hängt nicht von mir ab, sondern von England; und sollten wir uns genötigt sehen, wieder zu den Waffen zu greifen, läge die Verantwortung dafür voll und ganz und in den Augen Gottes und der Meinen bei den Eidbrüchigen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen wollten.«
Und er ging nach einem Gruß an Lord Whitworth und die übrigen Gesandten, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, und ließ das ganze ehrbare diplomatische Korps in der tiefsten Verwirrung zurück, die es seit Langem erlebt hatte.
31
Der Krieg
Das dünne Eis friedlichen Einvernehmens war gebrochen. Bonapartes Auftritt vor Lord Whitworth kam einer Kriegserklärung gleich.
In der Tat ließ England es sich von diesem Moment an angelegen sein, Malta zu behalten, obwohl es sich verpflichtet hatte, die Insel zu verlassen.
Unseligerweise besaß England seinerzeit eine jener Übergangsregierungen, die sich ihre wichtigsten Entscheidungen von der öffentlichen Meinung aufnötigen lassen, statt sie im Interesse des Staates zu treffen.
Es handelte sich um die Regierung Addingtons und Hawkesburys, die durch ihre Fehlentscheidungen seither zu so traurigem Ruhm gelangt ist.
George III. von England befand sich in einer eigenartigen Zwickmühle zwischen der Tory-Regierung Mister Pitts und der Whig-Regierung Mister Foxes. Mit Mister Pitt teilte er die politischen Ansichten, doch den Menschen konnte er nicht ausstehen. Mister Fox brachte er als Person die größte Hochachtung entgegen, doch seine politischen Ansichten waren ihm ein Gräuel. Und um weder auf den einen noch den anderen dieser Rivalen um das Regierungsamt zurückgreifen zu müssen, behielt er die Regierung Addington, die wie alles Provisorische zu einer Dauereinrichtung geworden war.
Am 11. Mai ersuchte der englische Botschafter um Pass und Reisepapiere.
Die Abreise Lord Whitworths erregte ein Aufsehen, wie man es bei einem ähnlichen Anlass noch nie erlebt hatte. Seit sich herumgesprochen hatte, dass er seine Reisepapiere beantragt hatte, warteten zwei- bis dreihundert Neugierige von morgens bis abends vor den Pforten des Stadtpalais, in dem er residierte.
Als zuletzt die Wagen herausfuhren, wurde dem scheidenden Botschafter seitens der Zuschauer lebhafteste Sympathie bekundet, denn jedermann wusste, dass er sich bis zuletzt für den Frieden eingesetzt hatte.
Wie alle tatkräftigen Menschen hatte Bonaparte, sobald er sich für den Frieden entschieden hatte, dessen Vorzüge zu schätzen gewusst und die Vorteile, die er für Frankreich daraus beziehen konnte, in den leuchtendsten Farben gesehen. Unversehens mit aller Gewalt in die entgegengesetzte Richtung genötigt, gelangte er zu dem Schluss, wenn er nicht der Wohltäter Frankreichs und der ganzen Welt sein könne, wolle er sie wenigstens das Staunen lehren. Die dumpfe Abneigung, die er England schon immer entgegengebracht hatte, verwandelte sich nun in überschäumenden Hass, begleitet von größenwahnsinnigen Zukunftsplänen. Die Meerenge zwischen Dover und Calais war keine größere Entfernung als die Strecke, die er beim Überqueren des Sankt Bernhard zurückgelegt hatte, und er dachte sich, wenn er die Alpen bezwungen hatte, im tiefsten Winter, vorbei an Abgründen und oft ohne erkennbaren Weg, über schneebedeckte Berge, die als unüberwindlich galten – wenn all das also nur eine Frage des Transports war, warum sollte ihm dann die Eroberung Englands nicht ebenso gelingen können wie die Eroberung Italiens, vorausgesetzt, er brachte genug Schiffe auf, um eine Armee von hundertfünfzigtausend Mann über den Ärmelkanal zu transportieren? Er ließ die Personen in seiner Umgebung vor seinem inneren Auge Revue passieren und erwog, auf wen er sich verlassen konnte und vor wem er sich in Acht nehmen musste. Die Gesellschaft der Philadelphes war noch immer eine Geheimgesellschaft, doch das Konkordat hatte den Hass der republikanischen Generäle erneut geschürt und vermehrt. All die Apostel der Vernunft – ob Dupuis, Monge oder Berthollet -, die man mit Mühe und Not dazu bewegen konnte, Gott eine gewisse Göttlichkeit zuzuerkennen, waren keineswegs bereit, dem Papst einen besonderen Status einzuräumen. Als halber Italiener war Bonaparte vielleicht nur bedingt religiös, doch abergläubisch war er immer gewesen. Er glaubte an Vorahnungen, Voraussagen, Wahrsager; und wenn er sich dazu hinreißen ließ, in Joséphines engerem Kreis über die Religion zu sprechen, waren seine überspannten Ideen für die Zuhörer nicht selten verstörend.
Eines Abends sagte Monge zu ihm: »Citoyen Erster Konsul, hoffen wir nur, dass wir nicht zum Beichtzettel zurückkehren.«
»Das kann man nie wissen«, erwiderte Bonaparte ungerührt.
Das Konkordat hatte Bonaparte mit der Kirche ausgesöhnt, aber es hatte ihn mit einem Teil seiner Armee entzweit. Die Philadelphes schöpften Hoffnung und wähnten den Moment gekommen, der ein Handeln erforderlich machte. Eine Verschwörung gegen den Ersten Konsul wurde angezettelt.
Die Verschwörer beabsichtigten, Bonaparte während einer Truppeninspektion und vor den Augen seines Gefolges aus Generälen und Ordonnanzen vom Pferd zu stoßen und unter den Pferdehufen zu Tode treten zu lassen. Große Hoffnungen setzten die Verschwörer bei all ihren Projekten stets in Bernadotte, den Kommandanten der Armee im Westen, der sich zurzeit allerdings in Paris aufhielt, und in Moreau, der auf seinem Landgut Grosbois schmollte, weil ihm sein glänzender Sieg bei Hohenlinden, der den Krieg mit Österreich beendet hatte, mit Undank gelohnt worden war.
Daraufhin gelangten drei Schmähschriften nach Paris, die in Form einer Ansprache an die französischen Armeen gehalten waren. Sie kamen aus dem Generalquartier in Rennes, das heißt von Bernadotte. In ihnen wurde der korsische Tyrann verunglimpft, der feige Mörder Klébers, denn die Nachricht von dessen Tod verbreitete sich gerade in Paris, und nicht nur wahrheitswidrig, sondern sogar gegen jede Wahrscheinlichkeit wurde dieser gewaltsame Tod demjenigen angelastet, dem der eine Teil Frankreichs alles Gute zuschrieb, was sich ereignete, und der andere Teil alles Böse. Nach diesen blutigen Themen wurden Bonapartes capucinades mit beißendem Spott bedacht, und das Ganze gipfelte in einem Aufruf, sich gegen ihn zu erheben und ihn mitsamt seiner korsischen Sippschaft vom Erdboden zu tilgen.
Diese Pamphlete wurden mit der Post an alle Generäle, kommandierenden Generäle und ranghöheren Offiziere geschickt, doch hatte Fouchés Polizei jede dieser Sendungen mit Ausnahme der allerersten beschlagnahmt. Die erste Sendung war in der Eilpost von Rennes nach Paris gelangt, in einem Butterfässchen, das an General Moreaus Aide de Camp Rapatel geliefert wurde.
An dem Tag, an dem Bonaparte Fouché kommen ließ, damit dieser mit ihm die Liste der Freunde und Feinde zusammenstellte, hatte Fouché sich darauf eingerichtet, mit den Beweisen der Offiziersverschwörung im Tuilerienpalast vorzusprechen.
Bei Bonapartes ersten Worten begriff Fouché, dass er keinen besseren Zeitpunkt hätte wählen können, denn er führte von jedem der drei Pamphlete ein Exemplar mit sich. Er wusste, dass ein Packen Pamphlete an Rapatel abgeschickt worden war, was bedeutete, dass Moreau auf jeden Fall Mitwisser, wenn nicht gar Mitanstifter dieses Umsturzversuches war, der zum Ziel hatte, in alle Ränge des Heeres Brandsätze zu schleudern.
Es war die Zeit, zu der Bonaparte Ehrensäbel und Ehrengewehre verlieh, eine Vorstufe zur Verleihung des Ordens der Ehrenlegion. Moreau, angespornt durch seine Frau und seine Schwiegermutter, die sich mit Joséphine überworfen hatten und sie mit ihrem Hass verfolgten, hatte sich über diese Ehrengaben lustig gemacht; Fouché berichtete Bonaparte, im Verlauf eines großen und prunkvollen Diners bei Moreau sei dem Koch eine Ehrenkasserolle verliehen und bei einer Wildschweinjagd sei der Jagdhund, der sich am tapfersten in der Verfolgung hervorgetan und drei Bisswunden davongetragen hatte, mit einem Ehrenhundehalsband ausgezeichnet worden.
Solche Bosheiten verübelte Bonaparte dem Urheber ganz ungemein, umso mehr, als sie sich so massiert ereigneten. Er verlangte von Fouché, sich auf der Stelle zu Moreau zu begeben und eine Erklärung von ihm zu fordern. Moreau jedoch lachte nur über die Botschaft, tat die »Butterfässchenverschwörung« als Kinderei ab und gab zur Antwort, wenn Bonaparte als Regierungsoberhaupt Ehrensäbel und Ehrengewehre verteile, könne er als Oberhaupt seines Hauses dort nach eigenem Gutdünken Ehrenkasserollen und -hundehalsbänder verteilen.
Fouché war selten entrüstet, doch diesmal kam er voller Entrüstung zurück.
Als Bonaparte den Bericht seines Ministers vernahm – des Polizeiministers, der nur für ihn allein da war -, geriet er in maßlosen Zorn.
»Moreau ist der Einzige, der neben mir etwas taugt, und es geht nicht an, dass Frankreich darunter leidet, zwischen ihm und mir hin- und hergezerrt zu werden. Wäre ich an seiner Stelle und er an meiner, diente ich ihm mit Vergnügen als sein erster Aide de Camp. Wenn er aber denkt, er könnte sich ein Regierungsamt zutrauen! … Armes Frankreich! Nun, wohlan! Er soll sich morgen früh um vier Uhr im Bois de Boulogne einfinden, und dann werden wir mit dem Säbel die Entscheidung ausfechten. Fouché, Sie werden ihm meinen Befehl übermitteln, Wort für Wort.«
Bonaparte wartete bis um Mitternacht. Um Mitternacht kam Fouché zurück. Diesmal hatte er Moreau zugänglicher vorgefunden. Moreau hatte zugesagt, am nächsten Tag zum Lever in den Tuilerienpalast zu kommen; dieser Zeremonie hatte er schon seit Langem nicht mehr beigewohnt.
Von Fouché vorbereitet, empfing Bonaparte Moreau leutselig, lud ihn zum Frühstück ein und beschenkte ihn beim Abschied mit einem prachtvollen Paar diamantbesetzter Pistolen, die er mit den Worten überreichte: »Ich hätte Ihre Siege auf diese Waffen gravieren lassen, General, doch dafür war nicht genug Platz.«
Sie reichten einander die Hand, doch die Herzen hatten nicht zueinander gefunden.
Kaum war diese Fraktion beruhigt, wenn auch nicht zum Verstummen gebracht, machte Bonaparte sich an die Umsetzung seiner großen Pläne; er ließ die flandrischen und holländischen Häfen auf Form, Größe, Bewohnerschaft und Material untersuchen. Oberst Lacuée, der mit dieser Aufgabe betraut war, musste sich einen ungefähren Überblick über den Zustand aller Schiffe verschaffen, die zwischen Le Havre und Texel Küstenschifffahrt und Fischerei dienten. Offiziere wurden nach Saint-Malo, Granville und Brest entsandt, um die Schiffe zu zählen. Marineingenieure mussten dem Ersten Konsul die Modelle aller Flachboote vorführen, die schweres Geschütz transportieren konnten. Sämtliche Wälder am Ärmelkanal wurden auf die Menge Holz, die man in ihnen schlagen konnte, und auf die Tauglichkeit dieses Holzes zum Bau einer Kriegsflotte inspiziert, und da Bonaparte wusste, dass die Engländer in Italien mit Holz handelten, schickte er Unterhändler mit dem erforderlichen Geld, dieses Holz zu erwerben, das unser Land so dringend brauchte.
Signal der Wiederaufnahme der Kriegshandlungen sollte die Besetzung Portugals und des Golfs von Tarent im Handstreich sein.
Englands Eidbrüchigkeit war so eklatant, dass nicht einmal Bonapartes eingefleischtester Feind ihm den Bruch zur Last legte. Ganz Frankreich empörte sich einhellig; man war sich zwar der Unterlegenheit unserer Marine bewusst, doch zugleich war man der Überzeugung, mit genug Zeit und genug Geld für den Bau der erforderlichen Menge Flachboote werde es uns gelingen, die Engländer zur See ebenso vernichtend zu schlagen wie ihre Alliierten zu Lande.
Sobald bekannt wurde, was diese Flachboote kosteten, wurde es zur Mode, sie dem Ersten Konsul zum Geschenk zu machen. Das Departement Loiret ging voran und bot dreihunderttausend Francs an. Für diesen Betrag konnte man eine Fregatte bauen und mit dreißig Kanonen bestücken. Und alsbald schenkten kleine Städte wie Coutances, Berny, Louviers, Valognes, Foix, Verdun oder Moissac Flachboote, die zwischen achttausend und zwanzigtausend Francs kosteten.
Paris, dessen Wappen ein Schiff ziert, spendete ein Schiff mit hundertzwanzig Kanonen, Lyon eines mit hundert, Bordeaux eines mit achtzig und Marseille eines mit vierundsiebzig Kanonen. Die italienische Republik schließlich spendete dem Ersten Konsul vier Millionen für den Bau zweier Fregatten, die Le Président und La République Italienne heißen sollten.
Unterdessen, während Bonaparte ganz in seinen Kriegsvorbereitungen aufging und die Innen- um der Außenpolitik willen vergaß, erhielt Savary das Schreiben eines ehemaligen Anführers der Vendée, dem Savary so manchen Gefallen getan hatte und der sich auf seine Landgüter zurückgezogen hatte, um dort in Frieden zu leben. Er meldete Savary, eine Gruppe Bewaffneter habe ihn aufgesucht und auf Torheiten angesprochen, wie er sie seit dem 18. Brumaire nicht mehr beging. Er fügte hinzu, um sein Wort zu halten, das er seinerzeit der Regierung gegeben hatte, und um sich vor möglichen Folgen dieses Besuchs zu schützen, habe er sofort Meldung erstattet und sei überdies bereit, sich nach Paris zu begeben, um alles zu berichten, sobald die Weinlese beendet sei.
Savary wusste, welch großen Wert der Erste Konsul darauf legte, über alles informiert zu sein. Sein gewitzter und durchdringender Verstand witterte in den harmlosesten Geschehnissen die verborgensten Absichten. Der Brief beschäftigte ihn eine Weile, doch nach kaum einer Viertelstunde sagte er zu Savary: »Sie werden hinfahren, einige Tage bei Ihrem Vendéer verbringen, die Vendée beobachten und herauszufinden versuchen, was sich dort zusammenbraut.«
Savary reiste am selben Tag inkognito ab.
Bei seinem Freund angekommen, hielt er die Situation für so gravierend, dass er sich als Bauer verkleidete und seinen Freund nötigte, es ihm gleichzutun, woraufhin sie sich an die Verfolgung der Bande machten, die seinen Freund aufgesucht hatte.
Am dritten Tag trafen sie auf einige Männer, die sich am Vortag von der Bande getrennt hatten. Von ihnen erfuhren sie alles, was sie wissen wollten.
Savary kehrte nach Paris zurück, zutiefst überzeugt, dass es nur des sprichwörtlichen Funkens bedürfe, um das Pulverfass namens Vendée und Morbihan in die Luft zu sprengen.
Bonaparte lauschte ihm mit ungeheuchelter Überraschung. Mit dieser Entwicklung hatte er nicht gerechnet; gewiss, Georges hatte ihm den Fehdehandschuh hingeworfen, doch ihn wähnte der Erste Konsul in London, denn Régniers Polizei hatte ihm versichert, sie überwache Cadoudal lückenlos.
In den verschiedenen Kerkern der Stadt gab es zahllose Gefangene, die der Spionage angeklagt waren oder politischer Umtriebe und denen kein Prozess gemacht worden war, weil Bonaparte selbst gesagt hatte, die Zeit werde kommen, da man derlei Intrigen keine Bedeutung mehr beimessen und all diese Unglücklichen auf einen Schlag freilassen werde.
Diesmal ließ der Erste Konsul nicht nach Fouché rufen, sondern sich von Savary die Liste der festgenommenen Personen mit dem Datum ihrer Festnahme und den Notizen über ihr Vorleben bringen.
Unter diesen Häftlingen befanden sich ein gewisser Picot und ein gewisser Lebourgeois; sie waren vor über einem Jahr um die Zeit des Attentats mit der Höllenmaschine nach ihrer Ankunft aus England in Pont-Audemer in der Normandie festgenommen worden. Das Vernehmungsprotokoll wies folgende Randnotiz auf: »Eingereist, um den Ersten Konsul umzubringen.«
Es lässt sich nur spekulieren, warum diese Namen Bonaparte eher auffielen als andere. Jedenfalls ordnete er an, diese beiden und drei weitere vor Gericht zu stellen und abzuurteilen.
Trotz der erdrückenden Beweislage bewahrten Picot und Lebourgeois eine bewunderswerte Kaltblütigkeit; ihre Komplizenschaft mit Saint-Régeant und Carbon war so offenkundig, dass sie zum Tode verurteilt und füsiliert wurden. Bis zuletzt war kein Geständnis von ihnen zu erlangen; im Gegenteil trotzten sie dem Gericht und verkündeten, es werde bald genug Krieg geben, und dieser Krieg werde Bonaparte den Kopf kosten.
Zwei der drei übrigen Gefangenen wurden vom Gericht freigesprochen, einer wurde verurteilt. Der Verurteilte hieß Querelle; er war ein Niederbretone, der in der Vendée-Armee unter Georges Cadoudal gedient hatte.
Verhaftet worden war er auf Betreiben eines Gläubigers, dem er zu seinem eigenen Pech einen Teil des geschuldeten Geldes gezahlt hatte; da er nicht den ganzen Betrag hatte aufbringen können, hatte jener ihn als Verschwörer denunziert.
Der Prozess gegen Picot und Lebourgeois und der gegen Querelle wurden nicht gleichzeitig verhandelt, und so kam es, dass die drei nicht zusammen hingerichtet werden konnten. Die zwei zuerst Verurteilten hatten ihren Gefährten ermahnt, als sie zu ihrem letzten Gang aufbrachen: »Folge unserem Beispiel: Frommen Herzens und ehrlichen Sinnes kämpfen wir für Thron und Altar; wir sterben für eine Sache, die uns die Himmelspforten weit öffnet; sterbe wie wir und sage nichts, wenn du verurteilt wirst; Gott wird dich in die Reihen seiner Märtyrer erheben, und du wirst alle himmlischen Freuden kosten!«
Wie seine Gefährten es vorausgesehen hatten, wurde Querelle zum Tode verurteilt. Gegen neun Uhr abends ließ der Richter das Urteil dem Befehlshaber des Regimentsstabs überbringen, damit dieser bei Anbruch des nächsten Tages das Urteil vollstrecken ließ, wie es üblich war.
Der Befehlshaber war auf einem Ball; er kam um drei Uhr nachts nach Hause, öffnete die Depesche, steckte sie unter sein Kopfkissen und schlief ein.
Wäre der Befehl rechtzeitig ergangen, wäre Querelle zusammen mit seinen Gefährten zur Hinrichtung geschritten, dann wäre er sicherlich wie sie gestorben, von ihrem Mut und von seiner Selbstachtung aufrechterhalten, und er hätte wie sie sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Doch die Verspätung in der Ausführung seines Todesurteils, der Tag, den er ganz allein im Angesicht des nahen Todes verbrachte, das langsame Herannahen des letzten Augenblicks, all das senkte Verzweiflung in seinen Geist. Gegen sieben Uhr abends fiel er in so heftige Zuckungen, dass man glaubte, er habe seinen Wärtern Gift entwendet. Der Gefängnisarzt wurde gerufen. Er befragte den Gefangenen nach der Ursache seiner Zustände; er war überzeugt, es mit einer Vergiftung zu tun zu haben, und wollte erfahren, welches Gift der Gefangene genommen hatte.
Querelle jedoch umschlang den Hals des Arztes, näherte seinen Mund dessen Ohr und flüsterte: »Ich bin nicht vergiftet. Ich habe Angst!«
Da erkannte der Arzt, wie man ihn zum Sprechen bringen konnte.
»Sie wissen um ein Geheimnis«, sagte er, »für das die Polizei viel geben würde; stellen Sie Ihre Bedingungen – wer weiß, ob man Sie nicht begnadigen wird!«
»Oh! Niemals, niemals!«, stöhnte der Verurteilte. »Zu spät.«
Auf Drängen des Arztes verlangte Querelle zuletzt eine Feder und Papier und schrieb an den Gouverneur von Paris, er habe ihm Enthüllungen zu machen.
Gouverneur von Paris war nicht mehr Junot, sondern Murat. Bonaparte fand, Junot sei zu leichtfertig, und hatte ihn durch Murat ablösen lassen.
Gegen elf Uhr abends unterhielt sich der Erste Konsul sorgenvoll und nachdenklich in seinem Kabinett mit Réal. Plötzlich wurde die Tür geöffnet, Savary kündigte den Gouverneur von Paris an, und Murat erschien.
»Ah, Murat, Sie sind es«, sagte Bonaparte und trat seinem Schwager ein paar Schritte entgegen. »Sie müssen gewichtige Neuigkeiten haben, wenn Sie mich zu so später Stunde aufsuchen.«
»Ja, General; ich habe soeben den Brief eines armen Teufels erhalten, der zum Tode verurteilt ist und morgen früh hingerichtet werden soll. Er bietet uns Enthüllungen an.«
»Und?«, sagte Bonaparte gleichgültig. »Leiten Sie den Brief an den Richter weiter, der ihn abgeurteilt hat, der soll sich damit befassen.«
»Ich gedachte«, sagte Murat, »so zu verfahren, doch der Brief ist von einer solchen Offenheit und Ehrlichkeit, dass er mein Interesse geweckt hat. Lesen Sie selbst.«
Bonaparte las den Brief, den Murat ihm entrollt hinhielt.
»Armer Teufel! Er will eine Stunde Leben herausschlagen, weiter nichts. Tun Sie, wie Ihnen geboten.«
Und er reichte ihm den Brief zurück.
»Aber General«, beharrte Murat, »haben Sie denn nicht gesehen, was dieser Mann steif und fest behauptet?«
»O doch, das habe ich sehr wohl gesehen; aber solche Behauptungen bin ich gewohnt, und ich sage Ihnen noch einmal, dass der Verurteilte uns nichts mitzuteilen hat, was einen Aufschub rechtfertigen würde.«
»Wer weiß?«, sagte Murat. »Überlassen Sie mir und Monsieur Réal diese Sache.«
»Wenn Sie unbedingt darauf bestehen«, lenkte Bonaparte ein, »dann tun Sie, was Sie für richtig halten. Réal, Sie werden ihn vernehmen. Murat, Sie begleiten den Oberrichter, wenn Sie wollen, aber keinen Aufschub, haben Sie verstanden, ich gestatte keinen Aufschub.«
Réal und Murat zogen sich zurück. Bonaparte ging in sein Schlafzimmer.
32
Die Polizei des Citoyen Régnier und die Polizei des Citoyen Fouché
Es war nach Mitternacht, als Réal und Murat den Tuilerienpalast verließen. Der Verurteilte sollte erst um sieben Uhr morgens füsiliert werden. Um ihn aufzusuchen, hatte Murat eine prunkvolle Abendgesellschaft verlassen müssen, die er zufällig an diesem Abend gab und bei der sich zu zeigen er nicht umhinkonnte. Er überließ es daher Réal, den Gefangenen aufzusuchen; seine Aufgabe hatte er erfüllt, er hatte den Ersten Konsul informiert, und der Erste Konsul hatte die Sache demjenigen übergeben, den sie von Rechts wegen betraf, nämlich dem Oberrichter.
Réal dachte sich, es werde genügen, den Gefangenen zwei Stunden vor der Hinrichtung zu besuchen; sollten die Enthüllungen einen Aufschub geraten sein lassen, wäre dafür immer noch genug Zeit; wären sie wertlos, würde die Hinrichtung ihren Verlauf nehmen.
Als jemand, der es gewohnt war, die Eindrücke und Empfindungen anderer zu beeinflussen, dachte er sich zudem, dass der Anblick des militärischen Gepränges, das mit Anbruch des Tageslichts um das Gefängnis herum entfaltet werden würde, dem Mut des Gefangenen den Todesstoß versetzen und den Bedauernswerten zu einem lückenlosen Geständnis bewegen musste.
Bedenkt man die Verfassung des unglücklichen Verschwörers, als dieser Murat durch den Arzt ausrichten ließ, er habe ihm Enthüllungen zu machen, wird man verstehen, dass dieser Zustand sich zwangsläufig verschlechtert hatte, als keine Antwort erfolgt war, der Gouverneur von Paris nicht von sich hatte hören lassen.
In seiner völligen Verzweiflung war der Bedauernswerte zu einem Geschöpf geworden, das kraftlos, zu jeder Regung unfähig, wie ein Kind den Tod erwartete, seinen Todesängsten und -qualen ausgeliefert. Die Augen auf das Fenster gerichtet, aus dem man auf die Straße sah, erwartete er zitternd die Strahlen des ersten Tageslichts.
Gegen fünf Uhr morgens zuckte er zusammen, als er Räderrollen vernahm und ein Wagen vor dem Gefängnistor anhielt. Kein Geräusch entging ihm, weder das Öffnen und schwerfällige Schließen des Tores noch die Schritte im Flur; es waren die Schritte von mehreren Personen; sie machten vor der Tür halt, und der Schlüssel drehte sich klirrend im Schloss. Die Tür wurde geöffnet. Ein Rest von Hoffnung ließ ihn den Blick auf den Eintretenden richten; er hoffte, Murat in seinem prunkvollen Aufzug zu erblicken, voller Federn und Goldstickerei unter seinem Umhang; stattdessen erblickte er einen schwarz gekleideten Mann, der ihm trotz seiner sanften und ehrlichen Miene von finsteren Dingen zu künden schien.
In Kandelabern an der Wand wurden Kerzen entzündet. Réal sah sich um, denn er merkte, dass er sich nicht in einer Kerkerzelle befand. In der Tat hatte man den Gefangenen in die Kanzlei des Gerichtsschreibers gebracht, weil man um sein Leben zu fürchten begonnen hatte.
Réal sah ein Bett, auf das der Verurteilte sich hatte sinken lassen, ohne etwas abzulegen; dann richtete er den Blick auf das Gesicht des Unglücklichen, der ihm die Hände entgegenstreckte.
Réal machte ein Zeichen. Man ließ ihn allein mit demjenigen, den er befragen wollte.
»Ich bin«, sagte er, »Oberrichter Réal. Sie haben die Absicht bekundet, Enthüllungen zu machen, und ich bin gekommen, um sie entgegenzunehmen.«
Der Mann, zu dem er sprach, wurde von einem so heftigen Nervenzittern heimgesucht, dass er vergebens zu antworten versuchte; seine Zähne klapperten, und auf seiner Miene zeigten sich erschreckende Konvulsionen.
»Beruhigen Sie sich«, sagte der Staatsrat zu ihm; obwohl er es gewohnt war, mit Menschen zu tun zu haben, denen der Tod bevorstand, hatte er noch nie jemanden erlebt, der sich so schrecklich davor fürchtete. »Denken Sie, Sie können mir jetzt antworten?«
»Ich will es versuchen«, erwiderte der Unglückliche, »aber wozu? Wird es in zwei Stunden etwa nicht aus und vorbei mit mir sein?«
»Es liegt nicht in meiner Macht, Ihnen etwas zu versprechen«, sagte Réal, »doch falls sich das, was Sie mir zu sagen haben, als so außergewöhnlich wichtig erweisen sollte, wie Sie behaupten...«
»Ach! Beurteilen Sie es selbst!«, rief der Gefangene. »Warten Sie, was wollen Sie wissen? Was wollen Sie von mir erfahren? Leiten Sie mich, ich bin völlig kopflos.«
»Beruhigen Sie sich und antworten Sie auf meine Fragen. Wie heißen Sie?«
»Querelle.«
»Was waren Sie?«
»Arzt.«
»Wo lebten Sie?«
»In Biville.«
»Nun gut; nun ist es an Ihnen, mir zu erzählen, was Sie mir zu sagen haben.«
»Im Namen Gottes, vor dem ich mich zu verantworten haben werde, schwöre ich, Ihnen die Wahrheit zu sagen, aber dennoch werden Sie mir nicht glauben.«
»Ich weiß, was Sie sagen wollen«, sagte Réal, »Sie sind unschuldig, nicht wahr?«
»Ja, das schwöre ich Ihnen.«
Réal machte eine Handbewegung.
»Unschuldig an dem, was man mir zu Last legt«, fuhr der Gefangene fort, »und ich hätte meine Unschuld beweisen können.«
»Warum haben Sie es nicht getan?«
»Weil ich dann ein Alibi hätte nennen müssen, das mich von der einen Tat losgesprochen und mich einer anderen überführt hätte.«
»Sie haben also doch konspiriert?«
»Ja, aber nicht mit Picot und Lebourgeois. Ich hatte nichts mit der Verschwörung um die Höllenmaschine zu tun, das schwöre ich Ihnen. Zu jener Zeit war ich mit Georges Cadoudal in England.«
»Und seit wann sind Sie in Frankreich?«
»Seit zwei Monaten.«
»Sie haben Georges also vor zwei Monaten verlassen.«
»Ich habe ihn nicht verlassen.«
»Wie! Sie wollen ihn nicht verlassen haben? Aber wenn Sie in Paris sind und er in England ist, dann müssen Sie ihn ja wohl verlassen haben!«
»Georges ist mitnichten in England.«
»Wo ist er dann?«
»In Paris.«
Réal sprang von seinem Stuhl auf. »In Paris?«, rief er. »Unmöglich!«
»Aber so ist es; wir sind zusammen hergekommen, und ich habe noch am Tag vor meiner Verhaftung mit ihm gesprochen.«
Georges befand sich also seit zwei Monaten in Paris! Die Enthüllungen des Gefangenen waren noch weitaus bedeutsamer, als man für möglich gehalten hätte.
»Und wie sind Sie nach Frankreich zurückgekommen?«, fragte Réal.
»Über die Klippe von Biville. Es war an einem Sonntag, eine kleine englische Slup hat uns dort abgesetzt; wir wären um ein Haar ertrunken, weil der Seegang so heftig war.«
»Warten Sie einen Augenblick«, sagte Réal, »das ist alles weitaus wichtiger, als ich dachte, mein Lieber; versprechen kann ich nichts, aber dennoch... Fahren Sie fort. Zu wie vielen waren Sie?«
»Bei der ersten Landung waren wir neun.«
»Wie viele weitere Landungen sind erfolgt?«
»Drei.«
»Und wer hat Sie an Land empfangen?«
»Der Sohn eines Mannes, der das Gewerbe des Uhrmachers ausübt; er hat uns zu einem Bauernhof geführt, dessen Namen ich nicht weiß. Dort sind wir für drei Tage geblieben, und dann haben wir uns von Hof zu Hof bis nach Paris geschlichen. Und in Paris haben uns Freunde von Georges in Empfang genommen.«
»Wissen Sie deren Namen?«, fragte Réal.
»Ich kenne nur zwei von ihnen: den ehemaligen Adjutanten Sol de Grisolles und einen gewissen Charles d’Hozier.«
»Hatten Sie die beiden früher schon einmal gesehen?«
»Ja, in London, ein Jahr zuvor.«
»Und was ist dann geschehen?«
»Die beiden Herren haben Georges in ein Kabriolett steigen lassen, wir anderen haben die Stadt zu Fuß an verschiedenen Schlagbäumen betreten. In zwei Monaten habe ich Georges nur dreimal an verschiedenen Orten gesehen, und jedes Mal hat er mich rufen lassen.«
»Und wo haben Sie ihn zum letzten Mal getroffen?«
»Bei einem Weinhändler, dessen Laden an der Ecke der Rue du Bac und der Rue de Varenne liegt. Ich hatte keine dreißig Schritte auf der Straße getan, als ich verhaftet wurde.«
»Haben Sie danach von ihm gehört?«
»Ja, er hat mir durch Fauconnier, den Kerkermeister des Temple, hundert Francs übergeben lassen.«
»Glauben Sie, dass er sich noch immer in Paris aufhält?«
»Ich bin mir sicher. Er wartete auf weitere Landungen; ohnehin sollte nichts geschehen, bevor sich nicht ein Prinz aus dem Hause Frankreich in Paris befand.«
»Ein Prinz aus dem Hause Frankreich!«, rief Réal. »Haben Sie je den Namen dieses Prinzen zu hören bekommen?«
»Nein, Monsieur.«
»Gut«, sagte Réal und erhob sich.
»Monsieur«, rief der Gefangene und ergriff Réals Hand, »ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, obwohl ich in den Augen meiner Kameraden nun ein Verräter, ein Feigling, ein Nichtswürdiger bin.«
»Beruhigen Sie sich«, sagte der Oberrichter, »Sie werden nicht sterben – wenigstens vorerst nicht. Ich werde versuchen, den Ersten Konsul milde zu stimmen, doch Sie dürfen kein Wort von dem, was Sie mir erzählt haben, weitersagen, niemandem, sonst wären mir die Hände gebunden. Nehmen Sie dieses Geld, und lassen Sie sich alles besorgen, was Sie benötigen, um wieder zu Kräften zu kommen. Morgen werde ich wahrscheinlich wiederkommen.«
»Oh, Monsieur!«, rief Querelle und warf sich vor Réal auf die Knie. »Sind Sie sich dessen gewiss, dass ich nicht sterben werde?«
»Ich kann es Ihnen nicht versprechen, aber wahren Sie Schweigen und geben Sie die Hoffnung nicht auf.«
Allerdings war die Anweisung des Ersten Konsuls, keinen Aufschub zu gewähren, so unmissverständlich gewesen, dass Réal dem Gouverneur des Abbaye-Gefängnisses nicht mehr zu sagen wagte als: »Verständigen Sie sich mit dem zuständigen Adjutanten darüber, dass vor zehn Uhr vormittags nichts geschehen wird.«
Es war sechs Uhr morgens; Réal kannte Bonapartes Anweisung, ihn nur für schlechte Nachrichten zu wecken und niemals für gute.
Réal erwog die Nachricht, die er zu überbringen hatte, entschied, dass sie eher schlecht sei als gut, und beschloss, Bonapartes Nachtruhe zu beenden. Er begab sich sofort zum Tuilerienpalast und ließ Constant wecken. Constant wiederum weckte den Mamelucken, der vor Bonapartes Zimmertür schlief, seit dieser ein eigenes Schlafzimmer hatte.
Der Mamelucke Rustan weckte den Ersten Konsul. Bourrienne war in letzter Zeit bei seinem ehemaligen Kameraden von der Militärakademie in Ungnade geraten und verfügte nicht mehr über die einstigen Privilegien. Bonaparte ließ den Mamelucken zweimal wiederholen, dass der Oberrichter warte, und sagte dann, als er sicher war, dass Rustan keinen Unsinn geredet hatte: »Lass Licht bringen und lass ihn eintreten.«
Ein Kandelaber am Ende des Kaminsimses warf den Schein seiner Kerzen auf das Bett des Ersten Konsuls.
»Réal, sind Sie es?«, fragte Bonaparte, als der Oberrichter eintrat. »Die Sache ist also ernster, als wir erwartet haben?«
»So ernst wie nur möglich, General.«
»Wie! Was soll das heißen?«
»Dass ich sehr sonderbare Dinge erfahren habe.«
»Erzählen Sie«, sagte Bonaparte, der das Gesicht in die Hand stützte und den Oberrichter aufmerksam ansah.
»Citoyen General«, sagte der Oberrichter, »Georges befindet sich mitsamt seiner ganzen Bande in Paris.«
»Wie?«, sagte der Erste Konsul, der wähnte, sich verhört zu haben.
Réal wiederholte seine Worte.
»Na, na, na!«, rief Bonaparte mit einer Schulterbewegung, die er immer machte, wenn er ungläubig war. »Das ist unmöglich!«
»Aber es ist wahr, General.«
»Dann ist es das, was dieser Brigant Fouché meinte, als er mir gestern schrieb: ›Nehmen Sie sich in Acht, die Luft ist voller Dolche.‹ Hier, da ist sein Brief. Ich hatte ihn auf den Nachttisch gelegt und mir nicht weiter den Kopf darüber zerbrochen.«
Er klingelte.
Constant trat ein.
»Rufen Sie Bourrienne«, sagte Bonaparte.
Man ging Bourrienne wecken, der herunterkam und auf die Anweisungen des Ersten Konsuls wartete.
»Schreiben Sie«, sagte dieser, »Fouché und Régnier, dass sie sich sofort einzufinden haben, um die Affäre Cadoudal zu besprechen, und dass sie alles mitbringen sollen, was sie an Unterlagen in dieser Sache haben; lassen Sie die beiden Depeschen durch Ordonnanzen überbringen. Unterdessen wird Réal mir alles erläutern.«
Réal blieb in der Tat bei Bonaparte und wiederholte Wort für Wort, was Querelle ihm erzählt hatte: wie die Verschwörer mit einer englischen Slup zu der Klippe von Biville gebracht worden waren, wie sie von einem Uhrmacher aufgenommen worden waren, dessen Namen Querelle nicht wusste, wie sie zu einem Bauernhof gebracht worden und von Hof zu Hof nach Paris gelangt waren und wie Querelle Cadoudal zum letzten Mal in dem Haus gesehen hatte, das an der Ecke der Rue du Bac und der Rue de Varenne lag. Nachdem er dem Ersten Konsul all diese Auskünfte erteilt hatte, ersuchte er um die Erlaubnis, zu dem Unglücklichen zurückzukehren, den er im Abbaye-Gefängnis in Todesangst zurückgelassen hatte, und bat darum, der Bedeutung der Enthüllungen wegen die Hinrichtung bis auf Weiteres aussetzen zu dürfen.
Diesmal war Bonaparte der gleichen Meinung wie Réal und gestattete ihm, dem Gefangenen das Leben zu schenken und ihn eventuell sogar zu begnadigen.
Réal ging und überließ Bonaparte seinem Kammerdiener, während er Fouché und Régnier erwartete.
Fouchés Wohnung lag in der Rue du Bac, Régnier wohnte näher und kam folglich als Erster.
Bonapartes Toilette war beendet. Als Régnier eintraf, wanderte der Erste Konsul mit auf die Brust gesenktem Kopf auf und ab, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die Stirn gerunzelt.
»Ah, Régnier, da sind Sie ja«, sagte Bonaparte. »Was sagten Sie gestern über Cadoudal?«
»Ich sagte Ihnen, Citoyen Erster Konsul, dass ich einen Brief erhalten hatte, in dem es hieß, er befinde sich noch in London und habe vor drei Tagen in Kingston bei dem Sekretär Mr. Addingtons gespeist.«
In diesem Augenblick wurde Fouché angekündigt.
»Lassen Sie ihn eintreten«, sagte Bonaparte, dem es nicht übel gefiel, seine zwei Polizeiminister miteinander zu konfrontieren, den offiziellen und den inoffiziellen.
»Fouché«, sagte der Erste Konsul zu diesem, »ich habe Sie holen lassen, damit Sie zwischen Régnier und mir schlichten. Régnier behauptet, Cadoudal halte sich in London auf, während ich behaupte, er befinde sich in Paris; wer von uns hat recht?«
»Derjenige, dem ich gestern gesagt habe: ›Nehmen Sie sich in Acht, die Luft ist voller Dolche!‹«
»Haben Sie gehört, Régnier? Ich bin es, dem Fouché diesen Brief geschrieben hat, und ich bin es, der recht hat.«
Régnier zuckte die Schultern. »Würden Sie Monsieur Fouché den Brief zeigen, den ich gestern aus London erhalten habe?«
Bonaparte, der Régniers Brief in der Hand hielt, reichte ihn Fouché.
Fouché las den Brief.
»Würde der Erste Konsul mir gestatten, ihm einen Mann vorzuführen, der zusammen mit Cadoudal aus London hergereist und mit ihm zusammen nach Paris gekommen ist?«
»Ha! Weiß Gott!«, sagte Bonaparte. »Nur zu gern!«
Fouché ging zu der Tür, die in das Vorzimmer führte, und öffnete sie. Herein trat der Polizeispitzel Victor, elegant gekleidet und mit dem Gehabe eines jener jungen Royalisten, die aus echter Überzeugung oder lediglich der Mode wegen zu jener Zeit gegen den Ersten Konsul konspirierten.
Victor verbeugte sich ehrerbietig und blieb neben der Tür stehen.
»Wer ist denn das?«, fragte Bonaparte. »Und wie kommt es, dass dieser Mann am Leben ist, wenn er wirklich mit Cadoudal zusammenhergekommen ist?«
»Das kommt daher«, erwiderte Fouché, »dass er derjenige unter meinen Männern ist, den ich beauftragt hatte, Cadoudal in London zu überwachen und nie aus den Augen zu lassen. Und um ihn nicht aus den Augen zu lassen, ist er ihm nach Frankreich und dort bis nach Paris gefolgt.«
»Wie lange ist das her?«, fragte Bonaparte.
»Zwei Monate«, erwiderte Fouché. »Wenn Monsieur Régnier meinen Agenten persönlich befragen möchte, wäre das eine große Ehre für ihn.«
Régnier bedeutete dem Spitzel, näher zu treten; Bonaparte musterte unterdessen den jungen Mann ungeniert. Der Polizeispitzel war nach der letzten Mode gekleidet, weder zu auffällig noch zu bieder; man hätte meinen können, er komme soeben von einer Morgenvisite bei Madame Récamier oder Madame Tallien. Es war ihm sogar anzusehen, dass er sich bemühte, sein gewohntes schlaues und strahlendes Lächeln zu unterdrücken.
»Was haben Sie in London getan, Monsieur?«, fragte Régnier.
»Ha, Citoyen Minister«, erwiderte der Spitzel, »ich habe das getan, was dort alle tun, ich habe gegen den Citoyen Erster Konsul konspiriert.«
»Zu welchem Zweck?«
»Selbstverständlich zu dem Zweck, von ihren Hoheiten, den Prinzen, Monsieur Cadoudal empfohlen zu werden.«
»Welche Prinzen meinen Sie?«
»Selbstverständlich die Prinzen aus dem Hause Bourbon.«
»Und ist es Ihnen gelungen, Georges empfohlen zu werden?«
»Seine Gnaden der Herzog von Berry waren so freundlich, mir diese Ehre zu erweisen, Herr Minister. Und General Georges hat mich für würdig befunden, an der ersten Expedition teilzunehmen, die nach Frankreich geschickt wurde, das heißt, einer der neun zu sein, die ihn begleiteten.«
»Und wer waren die Übrigen?«
»Monsieur Coster Saint-Victor, Monsieur Burban, Monsieur de Rivière, General Lajolais, ein gewisser Picot, nicht zu verwechseln mit dem Picot, der füsiliert wurde, Monsieur Bouvet de Lozier, Monsieur Damonville, ein gewisser Querelle, der gestern zum Tode veruteilt wurde, meine Wenigkeit und schließlich Georges Cadoudal.«
»Und wie sind Sie nach Frankreich gelangt?«
»Auf einer Slup unter dem Kommando von Kapitän Wright.«
»Ha!«, rief Bonaparte. »Den kenne ich, das ist der ehemalige Sekretär von Sidney Smith.«
»So ist es, General«, erwiderte Fouché.
»Es war sehr schlechtes Wetter«, fuhr der Spitzel fort, »und wir erreichten den Fuß der Klippe von Biville bei Flut und nur mit größter Mühe.«
»Wo liegt Biville?«, fragte Bonaparte.
»In der Nähe von Dieppe, General«, erwiderte Fouché.
Bonaparte entging nicht, dass der Spitzel ihm nicht unmittelbar antwortete, sondern sich mit einer für einen Mann seines Schlages außergewöhnlichen Zurückhaltung damit begnügte, sich zu verbeugen, während Fouché an seiner Stelle sprach. Diese Bescheidenheit rührte ihn.
»Wenn ich Sie etwas frage«, sagte er, »können Sie mir direkt antworten.«
Der Spitzel verbeugte sich abermals.
»Man setzte uns«, fuhr er fort, »am Fuß der Klippe von Biville ab, die an dieser Stelle ungefähr zweihundertdreißig Fuß hoch ist.«
»Und wie überwindet man so eine Klippe?«, fragte Bonaparte.
»Selbstverständlich mit einem Seil vom Umfang eines Schiffskabels! Man hält sich an dem Seil fest und stößt sich mit den Füßen an der Klippe ab, die an der betreffenden Stelle wie ein Kamin geformt ist. Hin und wieder hat das Seil Knoten, die einem das Festhalten erleichtern, manchmal sogar hölzerne Querstreben, auf denen man sich für einen Augenblick ausruhen kann wie ein Papagei auf seiner Vogelstange. Ich kletterte als Erster hinauf, gefolgt von Monsieur le Marquis de Rivière, General Lajolais, Picot, Burban, Querelle, Bouvet, Damonville, Coster Saint-Victor und zuletzt Georges Cadoudal.
Als wir etwa die Hälfte des Aufstiegs bezwungen hatten, beklagten sich mehrere über die Anstrengung. ›Ich muss euch warnen‹, sagte Georges, ›ich habe das Kabel hinter uns abgeschnitten.‹ Tatsächlich hörten wir, wie das Kabel auf die Felsbrocken am Fuß des Abhangs auftraf.
Wir hingen zwischen Himmel und Erde«, fuhr der Spitzel fort, »und konnten nicht zurück; es hieß weitersteigen, bis wir den Gipfel der Klippe erreichten. Zuletzt kamen wir ohne Zwischenfälle oben an.
Ich muss gestehen, dass mich beim Berühren festen Bodens unter den Füßen der Aufstieg, den wir soeben vollbracht hatten, mit so großem Entsetzen erfüllte, dass ich mich auf den Boden warf, denn ich befürchtete, von Schwindel ergriffen zu werden und ins Leere zu stürzen, wenn ich mich aufrichtete.
Monsieur de Rivière war von zarter Konstitution und mehr tot als lebendig; Coster Saint-Victor kletterte zu uns herauf und pfiff eine Jagdmelodie, und Cadoudal schnaufte nach erfolgtem Aufstieg laut und sagte: ›Für jemanden, der zweihundertunddreißig Pfund wiegt, ist das kein Kinderspiel. ‹
Dann schnitt Cadoudal das Kabel von dem Pfosten, um den es geschlungen gewesen war, und warf die zweite Hälfte zu der ersten hinunter. Wir wollten wissen, warum er das tat, und er antwortete, dieses Seil diene für gewöhnlich den Schmugglern und irgendein armer Teufel hätte an dem Kabel hinunterklettern können, ohne zu ahnen, dass es nur noch halb so lang war, so dass er am Ende des Seils aus hundert Fuß Höhe zerschmettert worden wäre.
Als Nächstes ahmte er den Ruf des Raben nach; man antwortete mit dem Ruf der Schleiereule, und zwei Männer erschienen. Sie waren unsere Führer.«
»Monsieur Fouché sagte, Georges habe auf der Reise von Biville nach Paris bei Stationen haltgemacht, die eigens vorbereitet worden waren. Ist Ihnen aufgefallen, um welche Stationen es sich dabei gehandelt hat?«
»Allerdings, General. Ich habe Monsieur Fouché die Liste der Stationen gegeben. Doch ich kann mich gut genug daran erinnern, dass ich sie diktieren könnte, falls das Erfordernis eintreten sollte.«
Bonaparte klingelte.
»Lassen Sie Savary rufen«, sagte er. »Er hat Dienst.«
Savary kam.
»Setzen Sie sich dorthin«, sagte Bonaparte und wies auf einen Tisch, »und schreiben Sie auf, was Monsieur Ihnen diktieren wird.«
Savary setzte sich, griff zur Feder und schrieb auf, was der Polizeispitzel ihm diktierte.
»Zuerst in etwa hundert Schritt Entfernung von der Klippe ein Seemannsheim, das dazu bestimmt ist, jene, die auf ihr Schiff oder auf Ankömmlinge warten, vor den Unbilden des Wetters zu schützen. Von dort sind wir zur ersten Station aufgebrochen, nach Guilmécourt, wo uns ein junger Mann namens Pageot de Pauly aufgenommen hat; die zweite Station ist der Bauernhof de la Potterie in der Gemeinde Saint-Rémy, geführt von dem Ehepaar Détrimont; die dritte ist in Preuseville bei einem gewissen Loizel. Gestatten Sie mir, Herr Oberst«, sagte der Polizeispitzel mit seiner gewohnten Höflichkeit, »Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich hier der Weg in drei unterschiedliche Routen verzweigt, die alle drei nach Paris führen. Auf dem am weitesten links verlaufenden Weg ist die vierte Station Aumale, bei einem gewissen Monnier, die fünfte Feuquières bei einem gewissen Colliaux, die sechste Monceau bei Leclerc, die siebte Auteuil bei Rigaud, die achte Saint-Lubin bei Massignon und die neunte Saint-Leu-Taverny bei Lamotte.
Wenn wir jetzt der mittleren Route folgen, ist die vierte Station in Gaillefontaine bei der Witwe Le Seur, die fünfte in Saint-Clair bei Sachez, die sechste in Gournay bei der Witwe Cacqueray. Und die vierte Station der rechts verlaufenden Route ist in Roncherolles bei Familie Gambu, die fünfte in Saint-Crespin bei Bertengels, die sechste in Étrépagny bei Damonville, die siebte in Vauréal bei Bouvet de Lozier und die achte in Eaubonne bei einem gewissen Hyvonnet. Das war alles.«
»Savary, bewahren Sie diese Liste sorgfältig auf«, sagte der Erste Konsul, »sie wird uns noch von Nutzen sein. Wohlan, Régnier, was sagen Sie dazu?«
»Meiner Treu, dass meine Spitzel Dummköpfe sind oder aber Monsieur ein überaus gewandter Spitzbube ist.«
»Von Ihnen, Herr Minister«, sagte der Spitzel mit einer Verbeugung, »wäre das, was Sie sagten, höchstes Lob; doch ich bin kein Spitzbube, sondern nur ein Mensch mit etwas ausgeprägterem Scharfsinn, als andere ihn besitzen, und mit besonders großem Vermögen, mich zu verwandeln.«
Bonaparte fragte: »Und was war mit Georges, seit er in Paris ist?«
»Ich habe ihn in die drei oder vier Häuser begleitet, in denen er seitdem gewohnt hat. Zuerst hat er in der Rue de la Ferme eine Wohnung genommen, dann ist er in die Rue du Bac umgezogen, wo er Querelle empfing, der verhaftet wurde, als er das Haus verließ; und heute wohnt er unter dem Namen Larive in der Rue de Chaillot.«
»Aber wenn Sie das alles gewusst haben, Monsieur, und seit so Langem...«, sagte Régnier zu Fouché.
»Seit zwei Monaten«, erwiderte dieser.
»Aber warum haben Sie ihn dann nicht festnehmen lassen?«
Fouché brach in Gelächter aus. »Oh! Verzeihen Sie, Herr Justizminister«, sagte er, »aber solange ich nicht selbst unter Anklage gestellt werde, habe ich nicht die Absicht, Ihnen meine Berufsgeheimnisse zu verraten. Und das eben erwähnte Geheimnis will ich für General Bonaparte aufbewahren.«
»Mein lieber Régnier«, sagte Bonaparte lachend, »nach allem, was wir soeben vernommen haben, können Sie Ihren Spitzel unbesorgt aus London zurückbeordern, wenn ich mich nicht täusche. Als Justizminister, mein lieber Régnier, tragen Sie bitte Sorge dafür, dass der arme Teufel, der gestern verurteilt wurde und der uns die Wahrheit gesagt hat – das lässt sich nicht bestreiten, denn seine Aussage stimmt mit den Worten Monsieurs überein« – wobei Bonaparte auf den Spitzel deutete, dessen Aussage wir soeben gelesen haben -, »nicht hingerichtet wird. Keine unumschränkte Begnadigung, denn ich will sehen, wie er sich im Gefängnis aufführt. Sie werden ihn im Auge behalten, und in sechs Monaten berichten Sie mir, wie er sich betragen hat. Zuletzt, mein lieber Régnier, möchte ich Ihnen mein Bedauern ausdrücken, dass ich Sie so früh aus dem Bett holen ließ, obwohl Ihre Anwesenheit völlig entbehrlich war. Bleiben Sie, Fouché.«
Der Polizeispitzel zog sich in den hinteren Teil des Salons zurück, so dass der Erste Konsul und der eigentliche Polizeipräfekt sich unbelauscht unterhalten konnten.
Bonaparte trat zu Fouché: »Sie sagten, Sie würden mir enthüllen, warum Sie mir Cadoudals Anwesenheit in Paris bislang verschwiegen haben.«
»In allererster Hinsicht, Citoyen Erster Konsul, verschwieg ich es Ihnen, damit Sie nichts davon erfuhren.«
»Keine Scherze, bitte«, sagte Bonaparte und runzelte die Stirn.
»Ich scherze keineswegs, Citoyen General, und ich bedaure, dass Sie mich heute dazu genötigt haben, es Ihnen zu sagen. Die Ehre, in Ihren näheren Kreis aufgenommen zu sein, hat mich bewogen, Sie zu beobachten. Runzeln Sie nicht die Stirn! Zum Teufel auch, das ist mein Beruf! Nun denn! Sie zählen zu jenen, die sich ein Geheimnis durch ihre Zornesausbrüche ablesen lassen. Solange Sie kühles Blut bewahren, steht nichts zu befürchten, denn Sie sind so verschlossen wie eine Champagnerflasche, doch sobald der Zorn Sie übermannt, explodiert die Champagnerflasche, und alles schäumt über.«
»Monsieur Fouché«, sagte Bonaparte, »verzichten Sie auf solche Vergleiche.«
»Und ich«, erwiderte Fouché, »verzichte auf weitere vertrauliche Mitteilungen; gestatten Sie, dass ich mich verabschiede.«
»Sachte, sachte«, sagte Bonaparte, »geraten wir jetzt nicht in Streit. Ich will wissen, warum Sie Georges Cadoudal nicht verhaften ließen.«
»Das wollen Sie wissen?«
»Unbedingt.«
»Und wenn ich meine persönliche Schlacht von Rivoli verlieren sollte, dann werden Sie es mir nicht verübeln?«
»Nein.«
»Nun gut! Ich werde Ihnen ermöglichen, alle Verschwörer mit ein und demselben Netz zu fangen. Ich will, dass Sie sich als Erster Ihres wunderbaren Fischzugs rühmen können. Ich habe Cadoudal nicht verhaften lassen, weil Pichegru erst seit gestern in Paris weilt.«
»Wie? Pichegru weilt seit gestern in Paris?«
»In der Rue de l’Arcade, wenn es beliebt, denn er konnte sich bisher noch nicht mit Moreau verständigen.«
»Mit Moreau!«, rief Bonaparte. »Sie müssen verrückt sein! Haben Sie vergessen, dass die beiden bis aufs Messer verfeindet sind?«
»Ach! Weil Moreau Pichegru denunziert hat, auf den er eifersüchtig war! Denn Sie, Citoyen Erster Konsul, wissen besser als jedermann sonst, dass Pichegru für seinen Bruder, den Abt, bei dessen keineswegs freiwilliger Abreise nach Cayenne zum Begleichen einer Schuld von sechshundert Francs Schwert und Epauletten verkaufen musste, welche die Inschrift trugen: Schwert und Epauletten des Siegers von Holland, und Sie wissen auch sehr wohl, dass Pichegru von Monsieur dem Prinzen von Condé keineswegs eine Million Francs erhalten hat. Noch besser wissen Sie, dass Pichegru, der nie verheiratet war und folglich weder Frau noch Kinder besitzt, sich in seinem Vertrag mit dem Prinzen von Condé keine Rente von zweihunderttausend Francs für seine Witwe oder von hunderttausend Francs für seine Kinder ausbedungen haben kann. Solche schäbigen Verleumdungen benutzt die Regierung gegen einen Mann, dessen sie sich entledigen will und der ihr so große Dienste erwiesen hat, dass sie ihn nicht anders als mit Undank zu belohnen weiß. Nun gut! Moreau hat um Verzeihung gebeten, und Pichegru ist gestern eingetroffen, um ihm zu verzeihen.«
Als Bonaparte hörte, dass die zwei Männer, die er für seine größten Feinde hielt, sich verständigt hatten, machte er unwillkürlich das schnelle Kreuzeszeichen auf der Brust, das ihm wie allen Korsen zutiefst vertraut war.
»Aber«, sagte er, »werden Sie mich von ihnen befreien, sobald man sie sehen wird, sobald sie sich geeinigt haben werden, sobald diese Dolche, von denen die Luft voll ist, auf mich gerichtet sein werden? Werden Sie sie verhaften lassen?«
»Noch nicht.«
»Und worauf warten Sie noch, in drei Teufels Namen?«
»Ich warte auf die Ankunft des Prinzen in Paris.«
»Sie erwarten einen Prinzen?«
»Einen Prinzen aus dem Hause Bourbon.«
»Sie brauchen einen Prinzen, um mich zu ermorden?«
»Wer hat behauptet, man wolle Sie ermorden? Cadoudal hat immer gesagt, das würde er nie und nimmer tun.«
»Und was hat er dann mit dieser Höllenmaschine bezweckt?«
»Er schwört bei Gott und allen Heiligen, dass er mit diesem Teufelswerk nichts zu tun hatte.«
»Und was will er dann?«
»Sie besiegen.«
»Mich besiegen?«
»Warum nicht? Sie wollten sich neulich doch sogar mit Moreau schlagen.«
»Aber Moreau ist Moreau, ein großer General, ein Sieger; ich habe ihn den General der Rückzüge genannt, gewiss, aber das war vor Hohenlinden. Und wie will er mich besiegen?«
»Irgendeines Abends, wenn Sie nach La Malmaison oder nach Saint-Cloud zurückkehren, mit einer Eskorte von fünfundzwanzig bis dreißig Mann, sollen fünfundzwanzig bis dreißig Chouans unter Cadoudals Führung, bewaffnet wie Ihre Männer, Ihnen den Weg versperren, Sie angreifen und töten.«
»Und wenn ich tot bin, was wollen sie dann?«
»Der Prinz, der dem Kampf beigewohnt haben wird, ohne sich daran zu beteiligen, wird die Monarchie ausrufen; der Graf von Provence, der in der ganzen Sache nicht einmal den kleinen Finger gerührt hat, wird den Namen Ludwig XVIII. annehmen, sich auf den Thron seiner Vorfahren setzen, und das wird es gewesen sein. Sie werden als strahlender Punkt in der Geschichte verbleiben, als eine Art Sonne, die wie Saturn goldene Satelliten besitzt mit Namen wie Toulon, Montebello, Arcoli, Rivoli, Lodi, die Pyramiden oder Marengo.«
»Lassen Sie die Scherze, Monsieur Fouché. Wer ist der Prinz, der nach Frankreich kommen soll, um mein Erbe anzutreten?«
»Ach, was das betrifft, muss ich zugeben, dass ich nicht die geringste Ahnung habe. Seit etwa zehn Jahren erwartet man diesen Prinzen, und er kommt und kommt nicht.
Man hat ihn zur Zeit der Vendée-Kriege erwartet, aber er kam nicht. Man hat ihn bei Quiberon erwartet, er kam aber nicht. Man erwartet ihn in Paris, und es ist anzunehmen, dass er auch diesmal nicht kommen wird, nicht anders als in der Vendée und bei Quiberon.«
»Nun gut«, sagte Bonaparte, »dann wollen wir ihn erwarten. Fouché, Sie übernehmen die Verantwortung?«
»Für alles, was in Paris geschieht, vorausgesetzt, Ihre Polizei pfuscht der meinen nicht ins Handwerk.«
»Abgemacht. Sie wissen, dass ich keine Vorsichtsmaßnahmen treffe; es ist also Ihre Sache, mich zu bewachen. Apropos: Vergessen Sie nicht, Ihrem Mann sechstausend Francs Belohnung auszahlen zu lassen, und er soll nach Möglichkeit Cadoudal im Auge behalten.«
»Seien Sie unbesorgt; falls er ihn aus dem Auge verlöre, hätten wir immer noch zwei unfehlbare Mittel, ihn wiederzufinden.«
»Und welche?«
»Moreau und Pichegru.«
Kaum war Fouché gegangen, ließ Bonaparte Savary rufen.
»Savary«, sagte er zu seinem Adjutanten, »bringen Sie mir das Verzeichnis der Individuen, die im Departement Seine-Inférieure wegen Raubüberfällen auf die Eilpost und ähnlichen Delikten gemeldet wurden.«
Seit der innere Frieden eingekehrt war, hatte die Polizei alle Individuen erfasst, die sich zuvor am Bürgerkrieg beteiligt hatten oder in jenen Gegenden auffällig geworden waren, in denen die Kutschen der Eilpost überfallen wurden. Diese Individuen waren in mehrere Kategorien aufgeteilt: 1. Anstifter, 2. Täter, 3. Komplizen, 4. all jene, die einem Individuum der vorgenannten Kategorien zur Flucht verholfen hatten.
Es galt nun, den Uhrmacher ausfindig zu machen, den Querelle und Fouchés Spitzel erwähnt hatten. Über Fouchés Spitzel hätte Bonaparte seinen Namen erfahren können, doch er wollte nicht zeigen, dass ihm dieser Name wichtig war, damit Fouché nicht erriet, was er im Schilde führte.
Fouchés Scharfsinn hatte Bonaparte kaum minder gekränkt als Régniers Blindheit. Sich plötzlich einer Gefahr ausgesetzt zu wissen, von der er nichts geahnt hatte, und durch den Schild der Polizei vor dieser Gefahr geschützt worden zu sein, ohne davon gewusst zu haben, das kam für einen Menschen von Bonapartes Charakter und Tatkraft einer Demütigung gleich. Er hatte sich täuschen lassen – nun, dann würde er jetzt umso klarer sehen! Und deshalb ließ er sich von Savary die Liste der Verdächtigen im Departement Seine-Inférieure bringen.
Schon bei ihrem ersten Blick auf das Verzeichnis für Eu und Tréport sahen sie den Namen eines Uhrmachers Troche. Vater Troche befand sich in Haft, und da er zu den Hauptbeschuldigten zählte, war kaum damit zu rechnen, dass er den Mund aufmachte. Doch es gab einen neunzehnjährigen Sohn, der über die Landungen, die bereits stattgefunden hatten, und die noch bevorstehenden sicherlich Bescheid wusste.
Bonaparte ließ telegraphisch anordnen, den Sohn festzunehmen und auf schnellstem Weg nach Paris zu bringen; mit der Eilpost konnte er am Tag nach seiner Verhaftung in Paris sein.
Unterdessen war Réal in das Gefängnis zurückgekehrt, wo er den Gefangenen in einem erbarmungswürdigen Zustand vorgefunden hatte.
Bei Tagesanbruch, das heißt zwischen sechs und sieben Uhr morgens, war die militärische Einheit, die den Todeskandidaten zum Hinrichtungsplatz eskortieren und ihn dort füsilieren sollte, eingetroffen und hatte Aufstellung bezogen. Der Fiaker, der den Gefangenen befördern würde, stand vor der Gefängnispforte mit offener Tür und heruntergelassenem Trittbrett.
Der Gefangene, der sich wie gesagt in der Kanzlei des Gerichtsschreibers befand, deren vergitterte Fenster auf die Straße gingen, konnte von dort alle Vorbereitungen zu seiner Erschießung mit ansehen – Vorbereitungen, die zweifellos weniger erschreckend sind als die zum Guillotinieren, aber dennoch nicht ohne Grauen.
Er hatte gesehen, dass die Ordonnanz, die den Hinrichtungsbefehl abzuholen hatte, zum Gouverneur von Paris geschickt worden war, und er sah, dass der zuständige Adjutant bereits zu Pferde wartete, um die Hinrichtung anzuordnen und durchzuführen, sobald die Ordonnanz mit dem Befehl zurückkehrte. Die Dragoner, die ihm als Eskorte dienen würden, warteten ebenfalls aufgereiht zu Pferde, und ihr Offizier hatte die Zügel seines Pferdes an das Gitter des Fensters gebunden, aus dem er sah. In diesem schrecklichen Warten verbrachte er die Zeit von halb sieben bis um neun Uhr morgens.
Nachdem er darauf gelauscht hatte, wie die Glocke halbe Stunden und Viertelstunden schlug, vernahm er um neun Uhr endlich das gleiche Räderrollen, das er um fünf Uhr gehört hatte.
Ängstlich heftete sein Blick sich auf die Tür; sein Ohr suchte die Geräusche im Flur aufzufangen, und die Gefühle, die er vor Stunden empfunden hatte, ließen wieder sein Herz klopfen.
Réal trat lächelnd ein.
»Oh, Sie würden nicht lächeln«, rief der unglückliche Gefangene, warf sich vor ihm nieder, umschlang seine Knie und preßte sie an seine Brust, »wenn ich zum Tode verurteilt wäre!«
»Ich habe Ihnen nicht die Begnadigung versprochen«, sagte Réal, »ich habe Ihnen einen Aufschub versprochen, und Aufschub wird Ihnen gewährt, doch ich verspreche Ihnen, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um Ihr Leben zu retten.«
»Aber dann«, rief der Gefangene, »dann lassen Sie diese Dragoner, diesen Fiaker, diese Soldaten entfernen, wenn ich nicht vor Angst sterben soll. Meinetwegen sind sie hier, und solange sie hier sind, kann ich nicht glauben, was Sie mir sagen.«
Réal ließ den Gefängnisdirektor kommen. »Die Hinrichtung ist aufgeschoben«, sagte er, »durch Ordre des Ersten Konsuls. Bringen Sie Monsieur in eine Einzelzelle, und lassen Sie ihn heute Abend in das Temple-Gefängnis überstellen.«
Querelle atmete auf. Im Temple befanden sich Häftlinge mit langen Haftstrafen, aber keine zum Tode Verurteilten. Das war die Bestätigung dessen, was Réal ihm gesagt hatte. Als Nächstes sah er aus dem Fenster, von dem er den Blick nicht abwenden konnte, dass das Trittbrett des Fiakers eingezogen und die Tür geschlossen wurde, dann sah er, dass der Offizier sein Pferd losband, es bestieg, an die Spitze seiner Männer ritt, und dann sah er nichts mehr.
Im Übermaß seiner Freude war er ohnmächtig geworden.
Der Arzt wurde gerufen und ließ den Gefangenen zur Ader. Querelle kam wieder zu sich, wurde in Einzelhaft untergebracht und wie befohlen am Abend in das Temple-Gefängnis überführt.
Monsieur Réal war bei ihm geblieben, solange er ohnmächtig war, und hatte bei seinem Erwachen das Versprechen wiederholt, sich bei dem Ersten Konsul für ihn zu verwenden.
33
Das Nest ist leer
Ein befremdlicher Umstand hatte die Polizei auf Troches Fährte gesetzt. Zwei, drei Jahre vor der Zeitspanne, die wir inzwischen behandeln, war es bei einer Landung zu einer Auseinandersetzung zwischen Zoll und Schmugglern gekommen; Schüsse waren gefallen, und an einem der halb verbrannten Stopfen, die auf dem Schlachtfeld liegen geblieben waren, konnte man die Aufschrift entziffern: An Citoyen Troche, Uhrmacher in …
Jedermann in Dieppe kannte den Citoyen Troche, und niemand bezweifelte, dass der Citoyen Troche sein Gewehr mit einem Stopfen geladen hatte, der aus einem an ihn adressierten Brief bestand; dieser Brief lenkte folglich die Aufmerksamkeit der Regierung auf Troche.
Wenige Tage vor Querelles Verurteilung hatte man den Citoyen Troche, einen gewieften Normannen von fünfundvierzig bis fünfzig Jahren, Querelle gegenübergestellt; da Troche sah, dass Querelle ihn nicht erkennen wollte, hatte auch er Querelle nicht erkannt, doch ungeachtet seiner Schweigsamkeit hatten die Behörden den Citoyen Troche in Haft behalten.
Nun wandte man sich an Troche junior, einen groß gewachsenen naiven Jüngling von neunzehn oder zwanzig Jahren, der seiner vorgeblichen Naivität zum Trotz als Schmuggler weitaus gewandter war denn als Uhrmacher. Nach Paris gebracht und Savary vorgeführt, der zur Wache beim Ersten Konsul eingeteilt war, tat Nicolas Troche so, als glaubte er, was man behauptete, dass nämlich sein Vater alles gestanden habe, und legte ein Geständnis ab.
Dieses Geständnis belastete ihn selbst nicht allzu schwer. Er gestand, dass er von Schmugglern, die an Land gehen wollten, benachrichtigt wurde und dass er ihnen ein verabredetes Signal zukommen ließ. Bei ruhigem Seegang half er ihnen, bei unruhiger See wartete er auf Windstille; er reichte ihnen die Hand, wenn sie den Gipfel der Klippe erreichten, und dann, so erklärte er, wies er sie an einen seiner Freunde weiter und hörte erst wieder von ihnen, wenn er die drei Francs pro Person für seine Hilfe erhielt.
So hatte man es seit Menschengedenken im Hause Troche gehalten; der älteste Sohn erbte dieses Gewerbe als Teil seines Geburtsrechts, und die ganze Sippschaft der Troches, die auf diese Weise an die tausend Francs im Jahr erwirtschaftete, tat so, als hätte sie bei diesem klandestinen Treiben noch nie mit anderen Kunden als Schmugglern zu tun gehabt.
Durch eine angelehnte Tür hatte General Bonaparte das ganze Verhör belauscht und erfahren, was man sich im Großen und Ganzen erwartet hatte. Savary fragte den jungen Troche, ob man bald mit einer neuen Landung von »Schmugglern« rechne. Der junge Troche erwiderte, zu dem Zeitpunkt, da Savary ihm die Ehre habe angedeihen lassen, ihn abzuholen, um sich mit ihm zu unterhalten, kreuze ein englischer Kutter vor der Klippe von Biville und warte auf ruhigeres Wetter, um anlegen zu können.
Der Erste Konsul hatte Savary haarklein vorgegeben, wie er zu verfahren habe. Sollte Nicolas Troche gestehen – was er nun getan hatte -, dann würde Savary mit ihm in den Wagen steigen, der ihn hergebracht hatte, und sich unverzüglich auf den Weg machen, um die Neuankömmlinge bei Biville in Empfang zu nehmen.
Der junge Troche wurde die ganze Fahrt über bewacht.
Savary konnte nicht vor sieben Uhr abends aufbrechen; ihm folgte ein Wagen, in dem sich ein Dutzend Elitegendarmen befand.
Kurzfristig hatte man mit dem Gedanken gespielt, Troche junior zu seinem Vater Jérôme ins Gefängnis zu stecken, doch der junge Mann, der die frische Luft auf den Klippen der Kerkerluft vorzog, hatte darauf hingewiesen, dass keine Landung stattfinden würde, wenn er nicht an Ort und Stelle wäre, um das verabredete Signal zu geben. Nicolas Troche war der geborene Jäger: Wenig kümmerte ihn, für wen er jagte, solange er nur jagte. Die Einsicht, dass der Weg, dem er folgte, ihn auf das Schafott führen konnte, machte, dass er mit ebenso großem Eifer denen eine Falle stellte, deren Landung er erwartete, wie er denen geholfen hatte, die zuvor gelandet waren.
Savary erreichte Dieppe vierundzwanzig Stunden nach seiner Abfahrt aus Paris bei stockfinsterer Nacht, vom Kriegsminister mit allen Vollmachten versehen.
Troche erkundete sogleich die Lage an der Küste. Die See war noch immer unruhig, der Kutter kreuzte noch immer in Sichtweite. Das schlechte Wetter hatte eine Landung bisher verhindert. Bei Tagesanbruch suchte Savary mit Troche das Ufer auf. Der Kutter war nach wie vor zu sehen.
Bei günstigen Windverhältnissen konnte er von seiner derzeitigen Position aus ohne zu kreuzen den Fuß der Klippe erreichen.
Savary wollte nicht in Dieppe bleiben. Er verkleidete sich als Bürgersmann, ließ zwölf seiner Gendarmen ebenfalls bürgerliche Kleidung anlegen und begab sich mit ihnen nach Biville. Die zwölf Gendarmen gehörten zu den tapfersten des ganzen Regiments.
Savary ließ seine Pferde vorausschicken; von Troche geführt, betrat er ein Haus, das für gewöhnlich von den Kundschaftern besucht wurde, welche die englischen Postschiffe an der Küste absetzten. Dieses abgelegene Haus befand sich außerhalb des Überwachungsbereichs der Polizeibehörde am äußersten Rand des Dorfs und bot denen, die seinen Schutz suchten, den Vorteil, unbemerkt kommen und gehen zu können.
Savary ließ seine Männer vor dem Garten, sprang über die Hecke und näherte sich dem kleinen Haus. Durch einen geöffneten Fensterladen sah er einen Tisch, gedeckt mit Wein, frisch geschnittenen Brotscheiben und Butterbroten.
Savary wandte sich zur Hecke um, rief Troche herbei und zeigte ihm die Mahlzeit. »Das«, sagte Troche, »ist die Verpflegung, die für all jene bereitsteht, die von der Küste kommen, und sie zeigt, dass für heute Nacht oder spätestens für morgen mit der Landung gerechnet wird. Bei Ebbe werden die Ankömmlinge entweder innerhalb der nächsten Viertelstunde eintreffen oder erst morgen.«
Savary wartete vergebens; weder an diesem Tag noch an den folgenden Tagen kam es zu einer Landung.
Diese Landung, die nicht erfolgte, wurde mit größter Ungeduld erwartet. Den Gerüchten zufolge befand sich der sagenumwobene Prinz, ohne den nicht gehandelt werden konnte oder ohne den zumindest Georges nicht handeln wollte, an Bord des Kutters.
Bei Tagesanbruch war Savary auf dem Gipfel der Klippe. Der Boden war schneebedeckt; unterwegs hatte Savary einen Augenblick lang geglaubt, gefunden zu haben, was er suchte.
Der Wind blies heftig vom Meer herein, Schneeflocken wirbelten in der Luft, und man sah keine zehn Schritte weit, doch man hörte sehr gut. Stimmen ertönten aus einem Hohlweg, der zur Klippe führte, Troche legte Savary die Hand auf den Arm und sagte: »Das sind unsere Leute; ich höre Pageot de Pauly.« Pageot de Pauly war ein junger Mann in Troches Alter, der in seiner Abwesenheit die Funktion des Führers innehatte. Savary ließ seine Gendarmen den Hohlweg am anderen Ende abriegeln und ging mit Troche und zwei Mann auf die Stimmen zu. Das plötzliche Erscheinen von vier Männern oben auf der Klippe und der laut geäußerte Ruf: »Halt!« erschreckten die nächtlichen Wanderer. Pageot aber erkannte Troche und rief: »Ihr habt nichts zu fürchten, es ist Troche!« Die zwei Gruppen näherten sich einander; Pageots Begleiter waren nur Dörfler, die in Erwartung einer Landung zur Klippe gegangen waren.
Die Landung war versucht worden, doch die Schaluppe hatte nicht landen können, weil der Seegang zu heftig war. Eine laute Stimme hatte aber gerufen: »Bis morgen!«, und diese Worte hatte der Wind bis zu den Dörflern hinaufgetragen. Es war das dritte Mal, dass der Kutter seine Schaluppe zu Wasser gelassen hatte, ohne dass ihr die Landung geglückt war.
Bei Tagesanbruch fuhr der Kutter auf das offene Meer hinaus, und dort kreuzte er den ganzen Tag. Am Abend näherte er sich wieder der Küste und versuchte eine Landung seiner Schaluppe. Savary blieb die ganze Nacht auf der Lauer, doch nichts geschah, und am nächsten Morgen entfernte sich der Kutter von der Küste und fuhr nach England zurück.
Savary blieb einen Tag länger, um zu sehen, ob der Kutter wiederkehren würde. Während dieses Tages untersuchte er aufmerksam das Kabel, mit dessen Hilfe die Gelandeten die Klippe überwanden, und obwohl er kein Hasenfuß war, bekannte er, dass er lieber zehn Schlachten auf sich nähme, als an diesem dünnen Seil die Klippe zu erklimmen, vom Sturm umtost, vor sich die Finsternis, unter sich das Meer.
Jeden Tag korrespondierte er über einen Boten mit Bonaparte. Am achtundzwanzigsten Tag wurde er telegraphisch nach Paris zurückbeordert.
Savary war zurückbeordert worden, weil gewisse Dinge sich erhellt und andere sich verdunkelt hatten.
Bonaparte war inzwischen überzeugt, dass auf dem Kutter, dessen Anwesenheit ihm Savary zehn oder zwölf Tage lang gemeldet hatte, nicht der sagenumwobene Prinz weilte, ohne den Georges nicht losschlagen wollte. Wenn Georges allein handelte, war er nur ein gewöhnlicher Verschwörer; wenn Georges mit dem Herzog von Berry oder dem Grafen von Artois zusammen handelte, war er Verbündeter eines Prinzen.
Bonaparte hatte Carnot und Fouché kommen lassen. Lesen wir, was er selbst über diese Unterredung in dem Manuskript sagt, welches das Schiff Le Héron von Sankt Helena mitbrachte:
Je weiter ich voranschritt, desto gefährlicher wurden die Jakobiner, die mir den Hinrichtungstod ihrer Freunde nicht verzeihen konnten. In dieser äußersten Gefahr ließ ich Carnot und Fouché holen.
»Meine Herren«, sagte ich zu ihnen, »nach langen Stürmen schmeichle ich mir mit dem Gedanken, dass Sie wie ich erkannt haben, dass die Interessen Frankreichs bislang keineswegs im Einklang mit den verschiedenen Regierungen waren, die das Land sich im Lauf der Revolution verliehen hat; keine dieser Regierungen war der geographischen Lage Frankreichs, Anzahl und Befähigung seiner Bewohner umsichtig angepasst. Der Staat mag Ihnen heute friedlich erscheinen, doch er gründet noch immer auf einem Vulkan, dessen Lava brodelt und dessen Ausbruch es um jeden Preis zu verhindern gilt. Ich glaube, wie im Übrigen sehr viele ehrbare Leute, dass es nur einen einzigen Weg gibt, Frankreich zu retten und ihm für alle Zeiten die Vorteile der Freiheit zu sichern, die es errungen hat, indem es unter den Schutz einer konstitutionellen Monarchie mit erblicher Thronfolge gestellt wird.«
Carnot und Fouché zeigten sich über meinen Vorschlag nicht erstaunt; sie hatten damit gerechnet. Carnot sagte unumwunden, er bezweifle nicht, dass ich es auf den Thron abgesehen hätte.
»Und verhielte es sich so«, erwiderte ich, »was würden Sie dann darauf erwidern, wenn es Ruhm und Frieden Frankreichs diente?«
»Dass Sie an einem Tag das Werk eines ganzen Volkes vernichten würden, welches Sie dafür eines Tages büßen lassen könnte.«
Ich erkannte wohl, dass bei Carnot nichts auszurichten war, und beendete das Gespräch, das ich ein andermal mit Fouché weiterführen wollte, den ich wenige Tage darauf rufen ließ.
Carnot hatte mein Geheimnis verraten, das in der Tat allmählich keines mehr war. Da ich ihn nicht um Stillschweigen gebeten hatte, verübelte ich ihm seine Indiskretion nicht. Schließlich mussten meine Vorhaben wohl oder übel bekannt werden, damit ich erfuhr, wie sie sich auf die öffentliche Meinung auswirkten.
Hatte mein Handeln, seit ich die Geschicke des Landes leitete, die Franzosen darauf vorbereitet, mich eines Tages nach dem Szepter greifen zu sehen, sahen sie mein Handeln gar als Garanten ihres Friedens und ihres Glücks? Ich weiß es nicht; gewiss aber ist, dass die Sache sich ohne großes Aufsehen hätte abwickeln lassen, wäre nicht ein wahrer Teufel auf den Plan getreten, nämlich Fouché. Sollte er allen Ernstes an das Gerücht geglaubt haben, das er ausstreuen ließ, wäre er weniger schuldig, doch sollte er es allein zu dem Zweck haben ausstreuen lassen, mir Ungelegenheiten zu bereiten, wäre er ein wahres Ungeheuer.
Kaum hatte Fouché durch seine Polizeispitzel von meinen Absichten auf den Thron erfahren, ließ er unter den Hauptjakobinern, ohne dass man ahnte, dass er die Quelle war, das Gerücht verbreiten, ich wolle die Monarchie wiedereinführen, und zwar in der alleinigen Absicht, die Krone dem legitimen Erben zurückzugeben. Weiter hieß es, in einem Geheimabkommen sei festgehalten, dass alle ausländischen Mächte mich in diesem Unternehmen unterstützen würden.
Es war dies diabolisch ersonnen, denn es machte mir all jene zum Feind, deren Wohlergehen oder gar Existenz durch eine Rückkehr der Bourbonen Gefahr drohen konnte.
Hinzu kam, dass ich zu jener Zeit Fouché weder gut genug kannte, noch ihm ein so finsteres Vorhaben zu unterstellen vermochte. Die Wahrheit dieser Worte mag belegen, dass ich ihn damit beauftragte, die öffentliche Meinung zu sondieren. Es fiel ihm nicht schwer, mir die Gerüchte zu melden, die in Umlauf waren, da er sie selbst ausgestreut hatte.
»Die Jakobiner«, sagte er, »werden eher ihren letzten Tropfen Blut vergießen, als Sie den Thron besteigen zu lassen. Nicht einen Herrscher fürchten sie – denn ich neige mittlerweile zu der Ansicht, sie würden sich früher oder später gerne davon überzeugen lassen, dass dies das beste Mittel wäre, gesicherte Verhältnisse zu etablieren -, sondern die Bourbonen, die sie nicht zurückkehren lassen wollen, weil sie auf deren Rachsucht rechnen.«
Diese Worte zeigten mir zwar Hindernisse auf, waren jedoch nicht dazu angetan, mich zu entmutigen, denn die Bourbonen hatte ich nicht im Entferntesten im Sinn. Dies bemerkte ich zu Fouché, und ich fragte ihn, wie man es anstellen solle, die falschen Gerüchte zu dementieren und die Jakobiner davon zu überzeugen, dass ich nicht zum Liebediener der Bourbonen geworden war.
Er verlangte zwei Tage Bedenkzeit.
Zwei Tage später kam Fouché wie angekündigt wieder. »Der Kutter, von dem Oberst Savary uns berichtet hat«, sagte er, »ist am elften Tag verschwunden. Dieser Kutter hatte nur zweitrangige Verschwörer an Bord, die an der bretonischen Küste abgesetzt werden sollten und die auf anderem Weg nach Frankreich gelangen werden. Die bourbonischen Prinzen, den Grafen von Artois und den Herzog von Berry, kennen Sie gut genug, um zu wissen, dass sie sich niemals darauf einlassen würden, nach Paris zu kommen, um es dort mit Ihnen aufzunehmen; trotz aller Appelle waren sie nicht einmal bereit, sich in die Vendée zu begeben, um es dort mit den Republikanern aufzunehmen. Der Herr Graf von Artois, dieser eitle Hohlkopf, ist viel zu sehr damit beschäftigt, den englischen Misses und Ladys schöne Augen zu machen, und der Herzog von Berry hat es, wie Sie wissen, noch nie darauf ankommen lassen, in einem Duell oder in einem Gefecht den persönlichen Mut zu beweisen, den jeder Prinz unter Beweis stellen müsste. Doch am anderen Ende der Welt, auf dem jenseitigen Rheinufer, sechs bis acht Meilen von Frankreich entfernt, gibt es einen mutigen Mann, der wiederholt seine Tapferkeit bewiesen hat, als er gegen die republikanischen Truppen kämpfte: Ich spreche von dem Sohn des Prinzen von Condé, dem Herzog von Enghien.«
Bonaparte zuckte zusammen. »Nehmen Sie sich in Acht, Fouché«, sagte er. »Ich pflege meine Zukunftspläne nicht in allen Einzelheiten mit Ihnen zu erörtern, doch mir will scheinen, dass Ihnen von Zeit zu Zeit eine Befürchtung in den Sinn kommt: die Befürchtung, ich könnte mich eines Tages mit den Bourbonen arrangieren, was für Sie, den ausgemachten Königsmörder, die allerunerquicklichsten Folgen haben könnte. Wenn ein Bourbone gegen mich konspirieren sollte und mir das klipp und klar bewiesen würde, ließe ich mich weder von seinem königlichen Geblüt noch von irgendwelchen gesellschaftlichen Erwägungen von dem abhalten, was zu tun mir geboten erschiene. Ich will mein Geschick vollenden, wie es im Buch des Schicksals geschrieben steht, jedenfalls soweit ich es sehen kann. Jedes Hindernis auf diesem Weg werde ich beseitigen, doch dabei werde ich immer auf mein Recht und auf mein Gewissen vertrauen.«
»Citoyen«, sagte Fouché, »ich erwähne den Herzog von Enghien weder zufällig noch aus Eigennutz. Als nach der Unterredung, die Sie Cadoudal gewährten, Sol de Grisolles nicht etwa seinem General nach London folgte, sondern nach Deutschland aufbrach, war ich neugierig zu erfahren, was er am anderen Rheinufer zu suchen hatte. Ich setzte jenen Spitzel auf seine Fährte, der die Ehre hatte, Ihnen seinerzeit vorgestellt zu werden. Er ist überaus gewandt, wie Ihnen aufgefallen sein wird. Er verfolgte seinen Mann nach Straßburg, überschritt mit ihm den Rhein, machte sich unterwegs mit ihm bekannt und kam mit ihm zusammen in Ettenheim an. Die erste Sorge des Aide de Camp Cadoudals war, Seiner Durchlaucht dem Herzog von Enghien seine Aufwartung zu machen, und der Herzog von Enghien lud ihn zum Abendessen ein und behielt ihn bis um zehn Uhr nachts bei sich.«
»Schon recht«, sagte Bonaparte schroff, denn er hatte begriffen, wohin Fouché ihn führen wollte, »aber gespeist hat Ihr Spitzel nicht mit den beiden, oder? Er kann weder wissen, worüber sie gesprochen haben, noch, welche Pläne sie geschmiedet haben.«
»Worüber sie gesprochen haben, ist nicht schwer zu erraten. Die Pläne allerdings sind schwieriger zu erraten. Doch bleiben wir bei dem, was wir wissen, ohne uns in Spekulationen zu ergehen.
Wie Sie sich denken können, war mein Mann nicht acht Stunden lang sich selbst überlassen, ohne auf Betätigung zu sinnen. Nun, er hat die Zeit darauf verwendet, Erkundigungen einzuholen. Auf diese Weise erfuhr er, dass der Herzog von Enghien von Zeit zu Zeit für sieben bis acht Tage aus Ettenheim verschwindet und bisweilen eine oder auch zwei Nächte in Straßburg zu verbringen pflegt.«
»Was soll daran erstaunlich sein?«, sagte Bonaparte. »Ich weiß es, denn auch ich habe mich über das Tun des Herzogs informiert.«
»Und was tut er zu diesen Zeiten?«, fragte Fouché.
»Er besucht seine Geliebte, die Fürstin Charlotte de Rohan.«
»Jetzt müssten wir nur noch in Erfahrung bringen«, sagte Fouché, »ob die Anwesenheit Madame Charlotte de Rohans in Straßburg, die im Übrigen nicht die Geliebte, sondern die heimlich angetraute Ehefrau des Herzogs von Enghien ist, die ohne Weiteres mit ihm in Ettenheim residieren könnte, ob also ihre Anwesenheit in Straßburg nicht ein Vorwand ist, damit der Fürst, der seine Frau besuchen kommt, bei diesem Anlass auch seine Komplizen sprechen kann, ganz zu schweigen davon, dass er von Straßburg aus innerhalb von zwanzig Stunden in Paris wäre.«
Bonaparte runzelte die Stirn. »Dann wäre wahr«, sagte er, »was behauptet wurde, als man mir erzählte, man habe ihn im Theater gesehen! Ich habe die Schultern gezuckt und es als Hirngespinst abgetan.«
»Ob er im Theater war oder nicht«, sagte Fouché, »ich würde dem Ersten Konsul raten, den Herzog von Enghien nicht aus den Augen zu verlieren.«
»Ich werde mehr tun als nur das«, sagte Bonaparte, »ich werde morgen noch einen Mann meines Vertrauens auf die andere Rheinseite schicken; er wird mir sofort berichten, und unmittelbar nach seiner Rückkehr werden wir über die Angelegenheit beraten.«
Indem er Fouché den Rücken zuwendete, gab er ihm zu verstehen, dass er allein sein wollte.
Fouché ging.
Eine Stunde später ließ der Erste Konsul den Gendarmerieinspektor kommen und fragte ihn, ob er in seinen Rängen einen intelligenten Mitarbeiter habe, den man in geheimer und höchst vertraulicher Mission nach Deutschland schicken und der außerdem die Auskünfte überprüfen könne, die Fouchés Spitzel schickte.
Der Inspektor erwiderte, er habe einen Mann zur Hand, der genau das sei, was der Erste Konsul suche, und fragte, ob der Erste Konsul den Mann persönlich instruieren wolle oder ob es ihm genüge, seine Anweisungen über ihn, den Inspektor, weiterzugeben.
Bonaparte antwortete, in einer so ernsthaften Angelegenheit könnten die Instruktionen gar nicht zu klar sein. Er werde sie deshalb noch am selben Abend aufsetzen und dem Inspektor übergeben lassen, damit dieser sie an den Beamten weitergeben könne, der abreisen solle, sobald er seine Instruktionen erhalten hätte.
Die Instruktionen lauteten: »Sich darüber informieren, ob der Herzog von Enghien tatsächlich regelmäßig auf geheimnisvolle Weise aus Ettenheim verschwindet; sich darüber informieren, mit welchen Personen aus dem Kreis der Emigranten er sich mit Vorliebe umgibt oder wen er häufiger als andere empfängt; sich schließlich darüber informieren, ob er politische Beziehungen zu den englischen Spitzeln an den kleinen deutschen Fürstenhöfen unterhält.«
Um acht Uhr morgens reiste der Gendarmeriebeamte nach Straßburg ab.
34
Die Enthüllungen eines Gehenkten
Während der Erste Konsul die Instruktionen verfasste, die der Gendarmeriebeamte mitnehmen sollte, spielte sich im Temple-Gefängnis eine tragische Szene ab.
Im Temple befanden sich die wenigen Gefangenen, die man in dieser Verschwörungssache bisher gemacht hatte, darunter Georges’ Diener, ein gewisser Picot, und zwei weitere Verschwörer, die mit ihm zusammen im Haus eines Weinhändlers in der Rue du Bac verhaftet worden waren, am nämlichen Tag, an dem der Limousiner Georges besagtes Haus hatte verlassen sehen. Eine Karte, die man in Picots Zimmer fand, war mit einer Adresse in der Rue Saintonge beschriftet; unter dieser Adresse fand die Polizei unfehlbar Roger und Damonville und verfehlte Coster Saint-Victor nur um wenige Augenblicke.
Noch am Abend seiner Einlieferung in das Temple-Gefängnis erhängte sich Damonville. Deshalb wurde angeordnet, dass die Wärter zweimal nachts in den Zellen der Gefangenen nach dem Rechten sahen, was sonst nicht üblich war.
Ein weiterer Gefangener, Bouvet de Lozier, war am 12. Februar bei einer gewissen Dame namens Saint-Léger in der Rue Saint-Sauveur verhaftet worden. Im Temple-Gefängnis wurde er aus dem Loch für Krethi und Plethi, wo es ihm übel ergangen war, in Einzelhaft versetzt und streng verhört.
Er war Mitte dreißig, royalistischer Offizier, Adjutant Cadoudals, einer seiner engsten Vertrauten, und hatte unter falschem Namen alles vorbereiten lassen, was Savary in seinem Bericht aufgeführt hatte.
Er war einer der umtriebigsten Verschwörer, und durch besagte Madame de Saint-Léger, die seine Vermieterin war, hatte er in Cahillot in der Grande Rue, Nummer sechs, ein Haus mieten lassen, in dem Georges Cadoudal nach seiner Ankunft in Paris unter dem Namen Larive Logis genommen hatte.
Als er begriff, dass er in seinem ersten Verhör schon zu viel gesagt hatte, und weil er befürchtete, in einem zweiten Verhör noch unvorsichtiger zu sein, beschloss er, sich das Leben zu nehmen, wie Damonville es getan hatte.
Am 14. Februar gegen Mitternacht erhängte er sich an einer schwarzen Seidenkrawatte, die er so hoch wie möglich an seiner Zellentür befestigt hatte. Als er das Bewusstsein verlor, betrat jedoch einer seiner Wärter namens Savard im Verlauf seiner nächtlichen Runde die Zelle. Er spürte, dass die Tür sich nicht öffnen ließ, drückte sie mit aller Kraft auf, vernahm ein Stöhnen, drehte sich um, sah den Gefangenen an seiner Krawatte baumeln und rief Hilfe herbei.
Der zweite Wärter dachte, es gebe Streit mit einem Gefangenen, und lief mit gezücktem Messer herbei.
»Schneide ihn ab, Élie, schneide ihn ab!«, rief Savard und deutete auf die Krawatte, die der Gefangene sich um den Hals geschlungen hatte.
Élie säumte nicht, sondern durchschnitt den Knoten, und Bouvet stürzte wie ein Toter zu Boden. Für tot hielt man ihn wahrhaftig, doch da der Obergefängniswärter Fauconnier sich Gewissheit verschaffen wollte, befahl er seinen Männern, den Selbstmörder in den Raum des Kanzleischreibers zu bringen und Monsieur Souppé, den Arzt des Temple-Gefängnisses, zu holen.
Der Arzt stellte fest, dass der Gefangene noch atmete, und ließ ihn zur Ader; das Blut sprudelte hervor, und wenige Sekunden darauf schlug Bouvet de Lozier die Augen auf. Sobald sein Zustand es erlaubte, wurde er in einen Wagen gesetzt und zu Citoyen Desmarets gebracht, dem Leiter der Geheimpolizei.
Bei Desmarets traf der Gefangene auf Monsieur Réal. Er legte nicht nur ein umfassendes Geständnis ab, sondern schrieb es nieder und unterzeichnete es. Um sieben Uhr am nächsten Morgen, als der Gendarm sich anschickte, nach Deutschland abzureisen, suchte Réal den Ersten Konsul auf, der gerade von Constant, seinem Kammerdiener, frisiert wurde.
»Ah, Herr Staatsrat, Sie haben offenbar Neuigkeiten für mich, dass ich Sie zu so früher Stunde sehe?«
»Ja, General, ich habe Ihnen Neuigkeiten von allerhöchster Wichtigkeit mitzuteilen, aber ich würde Sie gerne unter vier Augen sprechen.«
»Pah! Machen Sie sich keine Gedanken, was Constant betrifft, Constant ist niemand.«
»Wenn Sie es wünschen, General, bitte sehr. Pichegru weilt in Paris, wie Sie wissen.«
»Natürlich weiß ich das«, sagte Bonaparte. »Das hat mir Fouché gesagt.«
»Ja, aber was er Ihnen nicht gesagt hat, weil er es selbst nicht wissen kann, ist, dass Pichegru und Moreau miteinander verkehren und miteinander konspirieren.«
»Kein weiteres Wort!«, sagte Bonaparte. Und er führte einen Finger an den Mund, um Réal Schweigen zu gebieten.
Bonaparte beeilte sich mit seiner Toilette und führte dann den Staatsrat in sein Arbeitskabinett. »Gut«, sagte er, »Sie hatten recht, und wenn das, was Sie mir sagen, wahr sein sollte, dann wäre dies in der Tat eine Neuigkeit von allergrößter Wichtigkeit.« Bei diesen Worten vollführte er die Geste mit dem Daumen, die wir bereits erwähnten.
Réal berichtete ihm, was vorgefallen war.
»Und Sie sagen«, unterbrach ihn Bonaparte, »er habe ein schriftliches Geständnis verfasst, das Sie bei sich tragen?«
»Hier ist es«, erwiderte Réal.
In seiner Ungeduld riß Bonaparte es ihm beinahe aus der Hand.
In der Tat war es eine gewichtige Neuigkeit für ihn zu erfahren, dass Moreau sich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligte. Moreau und Pichegru waren die Einzigen, die sich in militärischer Hinsicht mit ihm messen konnten. Pichegru, zu Recht oder zu Unrecht des Hochverrats verdächtigt und am 18. Fructidor nach Sinnamary geschickt, war trotz seiner wunderbaren Rettung wie durch Gottes Hand kein Gegner mehr, vor dem Bonaparte sich fürchten musste.
Moreau hingegen, noch vom Glanz seines Sieges bei Hohenlinden umstrahlt und von Bonaparte für diesen trefflichen und klugen Sieg mit Undank gelohnt, lebte als schlichter Bürger in Paris und konnte sich auf eine große Gefolgschaft verlassen. Am 18. Fructidor und am 13. Vendémiaire hatte Bonaparte nur die Jakobiner, das heißt die exaltiertesten Republikaner, für vogelfrei erklärt und aus den Staatsgeschäften verbannt. Alle gemäßigten Republikaner jedoch, die sahen, wie der Erste Konsul sich nach und nach die Macht sicherte und sich Schritt für Schritt dem Königtum näherte, hatten sich zumindest geistig – wenn nicht greifbarer – um Moreau gesammelt, der mit Unterstützung der wenigen anderen Generäle, die den Grundsätzen von 1789 und sogar von 1793 treu geblieben waren, und durch seine ununterbrochene Verschwörertätigkeit in der Armee, sichtbar durch Augereau und Bernadotte verkörpert, unsichtbar durch Malet, Oudet und die Philadelphes, zu einem Gegner geworden war, den man ernsthaft fürchten musste.
Und nun sollte Moreau, dieser untadelige Republikaner, dieser zweite Fabius, wie er genannt wurde, dieser Beschwichtiger, der immer gesagt hatte, sein Wahlspruch sei, dass man den Menschen und den Dingen Zeit geben müsse – nun sollte dieser Moreau sich ohne alle Bedenken Hals über Kopf in ein royalistisches Komplott gestürzt haben, mit dem Condé-Anhänger Pichegru und dem Chouan Cadoudal als Verbündeten! Bonaparte lächelte, verdrehte die Augen zum Himmel und sagte: »Die Sterne meinen es wahrhaftig gut mit mir!«
Dann wandte er sich an Réal: »Ist der Brief wirklich von seiner Hand?«
»Ja, General.«
»Und unterzeichnet?«
»Und unterzeichnet.«
»Sehen wir es uns an.« Ohne eine Antwort abzuwarten, las er:
Ein Mann, soeben dem Grabe entronnen und noch von den Schatten des Todes umfangen, verlangt nach Rache an denen, die ihn und seine Mitstreiter durch ihre Perfidie in den Abgrund gestürzt haben, in dem er sich befindet. Nach Frankreich entsandt, um die Sache der Bourbonen zu unterstützen, sieht er sich genötigt, entweder für Moreau zu kämpfen oder auf das Unternehmen zu verzichten, welches das einzige Ziel seiner Aufgabe war...
Bonaparte hielt inne. »Was soll das heißen: ›für Moreau zu kämpfen?‹« fragte er.
»Lesen Sie weiter«, sagte Réal.
Ein Prinz aus dem Hause Bourbon sollte nach Frankreich kommen und sich an die Spitze der royalistischen Partei stellen. Moreau hatte versprochen, sich der Sache der Bourbonen anzuschließen. Kaum haben die Royalisten in Frankreich Fuß gefasst, zieht Moreau sich zurück. Er bietet ihnen an, für sie zu wirken und sich zum Diktator ausrufen zu lassen. Das sind die Tatsachen; ziehen Sie daraus Ihre Schlüsse.
Lajolais, ein General, der unter Moreau gedient hatte, wird von ihm nach London zu dem Prinzen geschickt. Pichegru war der Mittelsmann. Lajolais hält sich im Namen und im Auftrag Moreaus an den vereinbarten Plan. Der Prinz macht sich bereit abzureisen, doch in den Gesprächen, die Moreau, Pichegru und Cadoudal in Paris führen, erklärt Ersterer, dass er nur zu handeln bereit sei, um einem Diktator den Weg zu ebnen, nicht aber einem König. Ergebnis ist Zerwürfnis und beinahe völlige Niederlage der royalistischen Partei.
Besagten Lajolais sah ich in Paris, als er am 25. Januar Georges und Pichegru abholte; ich saß mit ihnen im Wagen am Boulevard de la Madeleine, Lajolais wollte sie zu Moreau bringen, der in der Nähe wartete; sie hatten eine Besprechung in den Champs-Élysées, in deren Verlauf Moreau sich dagegen aussprach, die Monarchie wiedereinzuführen, und vorschlug, man solle stattdessen ihn als Diktator an die Spitze der Regierung setzen und den Royalisten keine andere Wahl lassen, als seine Mitstreiter oder Soldaten zu werden.
Der Prinz sollte erst nach Frankreich kommen, nachdem ihm das Ergebnis der Konferenz der drei Generäle vorläge und nachdem die drei sich völlig einig erklärt hätten und Einigkeit über ihr weiteres Vorgehen bestünde.
Georges wies jeden Gedanken an einen Meuchelmord und an eine Höllenmaschine weit von sich; in London hatte er dies in aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben; ihm war es nur um einen Kampf zu tun gewesen, in dem er und seine Offiziere ihr Leben riskiert hätten. Dieser Kampf hätte zum Ziel gehabt, sich des Ersten Konsuls und damit der Regierung zu bemächtigen.
Ich kann nicht wissen, welches Gewicht Sie den Worten eines Mannes beimessen, der seit einer Stunde dem Tod entrissen ist, den er sich selbst gegeben hatte, und der sich vor dem Tod sieht, den ihm eine Regierung zuweist, die er gekränkt hat, doch ich kann den Aufschrei meiner Verzweiflung nicht zurückhalten und den Mann, der mich ihr ausgeliefert hat, nicht schonen. Im Übrigen lassen sich im Verlauf des Hochverratsprozesses, der gegen mich geführt wird, Beweise finden, die erhärten, was ich vorbringe.
BOUVET DE LOZIER
Bonaparte verharrte nach der Lektüre einen Augenblick schweigend. Zweifellos versuchte er durch heftige geistige Anstrengung ein Problem zu lösen. Dann sagte er wie im Selbstgespräch: »Der Einzige, der mich besorgt stimmen kann, der Einzige, der mir gegenüber die geringsten Aussichten hätte, sollte sich so tölpelhaft verraten! Unmöglich!«
»Soll ich Moreau auf der Stelle verhaften lassen?«, fragte Réal.
Der Erste Konsul schüttelte den Kopf.
»Moreau ist zu wichtig«, sagte er, »er ist mir zu feindlich gesinnt, ich bin viel zu sehr daran interessiert, mich von ihm zu befreien, als dass ich mich den Mutmaßungen der öffentlichen Meinung aussetzen wollte.«
»Aber wenn Moreau mit Pichegru konspirieren sollte?«, wandte Réal ein.
»Dann muss ich sagen«, fuhr Bonaparte fort, »dass ich Pichegrus Anwesenheit in Paris erst durch Fouché und Ihren Todeskandidaten heute Nacht erfahren habe. Aber alle englischen Zeitungen tun so, als weilte er heute noch in London oder in der Nähe der Stadt. Ich weiß sehr wohl, dass diese Zeitungen gegen mich sind und gegen die französische Regierung konspirieren.«
»Auf alle Fälle«, sagte Réal, »habe ich die Schlagbäume schließen lassen und angeordnet, dass jeder, der die Stadt betreten will, gründlich untersucht wird.«
»Vor allem jeder, der die Stadt verlassen will«, sagte Bonaparte.
»Ist nicht vorgesehen, dass Sie morgen eine große Parade abnehmen, Citoyen Erster Konsul?«
»Ja.«
»Nun, die müssen Sie absagen.«
»Und warum?«
»Weil sich noch etwa sechzig Verschwörer in Paris herumtreiben, und wenn wir ihnen jeden Weg abschneiden, die Stadt zu verlassen, könnten sie einen waghalsigen Coup riskieren.«
»Und wenn schon«, sagte Bonaparte, »was geht mich das an? Ist es nicht Ihre Aufgabe, mich zu bewachen?«
»General«, erwiderte Réal, »für Ihre Sicherheit können wir nur garantieren, wenn Sie die Parade absagen.«
»Herr Staatsrat, ich wiederhole es«, sagte Bonaparte, der die Geduld zu verlieren begann, »jeder von uns hat seine Aufgabe; Ihre besteht darin, darüber zu wachen, dass ich nicht ermordet werde, wenn ich Paraden abnehme, die meine besteht darin, Paraden abzunehmen auf die Gefahr hin, dabei ermordet zu werden.«
»General, das ist unbedacht.«
»Monsieur Réal«, erwiderte Bonaparte, »Sie sprechen wie ein Staatsrat; die größte Bedachtsamkeit in Frankreich ist der Mut!«
Und er kehrte dem Staatsrat den Rücken zu und sagte zu Savary: »Lassen Sie Fouché durch eine Ordonnanz zu Pferd benachrichtigen, dass er mich auf der Stelle aufsuchen soll.«
Von den Tuilerien bis zu Fouchés Wohnung in der Rue du Bac war es nicht weit, und keine zehn Minuten später hielt der Wagen des wahren Polizeiministers vor dem Tor des Tuilerienpalasts.
Fouché traf Bonaparte an, der mit großen Schritten umherging und sich in Rage redete.
»Kommen Sie schon!«, sagte er zu Fouché. »Wissen Sie, dass Bouvet de Lozier versucht hat, sich in seiner Zelle zu erhängen?«
»Ich weiß auch«, erwiderte Fouché ungerührt, »dass man ihn rechtzeitig retten konnte, dass er zu Monsieur Desmarets gebracht wurde, wo er von Monsieur Réal verhört wurde und seine Aussage unterzeichnet hat.«
»In dieser Aussage behauptet er, Pichegru sei in Paris.«
»Ich hatte Ihnen das bereits gesagt.«
»Ja, aber Sie hatten mir nicht gesagt, dass er hier ist, um mit Moreau zu konspirieren.«
»Das wusste ich damals noch nicht oder wenigstens noch nicht definitiv; ich hegte nur einen Verdacht, und diesen Verdacht habe ich Ihnen mitgeteilt.«
»Und jetzt wissen Sie mehr?«, fragte Bonaparte.
»Sie sind ein schrecklicher Mann«, sagte Fouché. »Sie wollen alles wissen und am liebsten im Voraus, so dass man nie das Verdienst hat, Ihnen etwas zu enthüllen. Wollen Sie wissen, wie weit meine Nachforschungen gediehen sind, vorausgesetzt, Sie lassen mich die Sache so zu Ende führen, wie ich es will?«
»Ich stelle keine Bedingungen, und ich will wissen, wie weit Sie sind.«
»Wohlan. Jeder von uns hat seine Rolle: Réal für Bouvet de Lozier, der sich gestern erhängt hat, und ich habe Lajolais, der sich vielleicht morgen erhängen wird. Ich habe Lajolais verhaften lassen, ich habe ihn verhört; wollen Sie erfahren, was er ausgesagt hat? Ich habe seine Aussage mitgebracht, weil ich mir dachte, Sie wollten sie sehen. Hier das Wesentliche, ohne seine Bitten und Fragen.
Seit Längerem wusste ich durch einen gemeinsamen Freund, den Abbé David, dass Pichegru und Moreau, die verfeindet gewesen waren, sich zuletzt versöhnt hatten. Moreau hatte ich im vergangenen Sommer mehrmals gesehen; er hat mir den Wunsch bezeigt, sich mit Pichegru zu unterhalten. Um dies zu bewerkstelligen, bin ich nach London abgereist; dort habe ich Pichegru gesprochen und ihm Moreaus Wunsch mitgeteilt. Pichegru hat mir versichert, er hege den gleichen Wunsch und wolle eine solche Annäherung wahrnehmen, um England zu verlassen.
Kaum waren zwei Wochen vergangen, als sich die Gelegenheit bot, und wir ließen sie nicht ungenutzt verstreichen. Pichegru wohnte damals in der Rue de l’Arcade; die Verabredung sollte auf dem Boulevard de la Madeleine stattfinden, an der Ecke zur Rue Basse-du-Rempart. Moreau kam im Fiaker von zu Hause, aus der Rue d’Anjou-Saint-Honoré.
An der Madeleine stieg er aus, und ich blieb im Wagen, der im Schritt weiterfuhr. Die zwei Generäle begegneten sich an der vereinbarten Stelle. Sie gingen etwa eine Viertelstunde lang miteinander. Ich weiß nicht, was bei dieser ersten Unterredung besprochen wurde. Die zwei weiteren Unterredungen fanden in Moreaus Haus in der Rue d’Anjou-Saint-Honoré statt. Diesmal erwartete ich Pichegru in der Rue de Chaillot, denn wir hatten ihn eine neue Wohnung nehmen lassen. Bei seiner Rückkehr zeigte er sich äußerst unzufrieden mit Moreau, und als ich ihn fragte, was der Grund seiner Unzufriedenheit sei, sagte er: »Wissen Sie, was Moreau uns angeboten hat, dieser selbstlose Mensch mit dem Herzen eines Spartaners? Er hat von uns verlangt, dass wir ihn zum Diktator machen. Die Diktatur würde er sich gnädig antragen lassen! Offenbar ist dieser... so ehrgeizig, dass er die Regentschaft übernehmen will. Nun, da wünsche ich ihm viel Erfolg; Doch meiner Meinung nach könnte er Frankreich keine drei Monate lang regieren.«
»Meinen Sie, man sollte Moreau verhaften?«, fragte Bonaparte.
»Ich wüsste nicht, was dagegenspräche«, sagte Fouché. »So wie wir ihn kennen, wird er in drei Monaten nicht weiter sein, als er heute ist. Und Pichegru sollte man in diesem Fall gleich mitverhaften, damit beide Namen gleichzeitig ausgesprochen und an den Hauswänden von Paris angeschlagen werden.«
»Wissen Sie, wo Pichegru sich gegenwärtig aufhält?«
»Ich habe ihm seine Wohnung besorgt, bei einem ehemaligen Kammerdiener namens Leblanc, der früher in seinen Diensten war. Er kommt mich teuer zu stehen, aber ich weiß über alles, was er tut, Bescheid.«
»Sie kümmern sich also um die Verhaftung Pichegrus?«
»Selbstverständlich. Sie können Réal beauftragen, Moreau festzunehmen, das wird nicht weiter schwierig sein, und dieser Vertrauensbeweis wird den guten Staatsrat entzücken. Er soll mir sagen, wann Moreau in das Temple-Gefängnis eingeliefert werden wird, dann kann er Pichegru dort eine halbe Stunde später entgegennehmen.«
»Sie wissen«, sagte Bonaparte, »dass ich am Sonntag eine Parade abnehme. Réal hat mir geraten, sie abzusagen.«
»Im Gegenteil, nehmen Sie sie ab«, sagte Fouché. »Ihre Parade wird die allerbeste Wirkung haben.«
»Das ist sonderbar«, sagte Bonaparte, der Fouché ansah, »ich hielt Sie nicht für mutig, doch Sie geben mir immer wieder Ratschläge, die von größtem Mut künden.«
»Ich gebe sie nur«, sagte Fouché mit seinem gewohnten Zynismus, »ich muss sie nicht befolgen.«
Der Befehl, die zwei Generäle zu verhaften, wurde gleichzeitig, am selben Tisch und mit derselben Feder unterzeichnet. Savary überbrachte Réal die Ordre für die Festnahme Moreaus, Fouché nahm die für Pichegru mit.
Moncey, einer von Moreaus besten Freunden, wurde in seiner Eigenschaft als kommandierender Gendarmeriegeneral angewiesen, diesen zu verhaften.
Dem Oberrichter wurde die Ordre zusammen mit einer Notiz Bonapartes überbracht, die lautete: »Monsieur Régnier, bevor Sie General Moreau in das Temple-Gefängnis bringen lassen, finden Sie heraus, ob er mir etwas zu sagen hat. In diesem Fall bringen Sie ihn in Ihrem Wagen zu mir. Möglicherweise können wir alles untereinander regeln.«
Keine derartige Empfehlung wurde Fouché für Pichegru mitgegeben. Und doch war Pichegru ein alter Bekannter Bonapartes, denn in der Militärschule zu Brienne war er sein Repetitor gewesen.
Bonaparte erinnerte sich nicht gerne an seine Schulzeit: Zu oft war er des bescheidenen Adelsstandes seiner Familie und seiner spärlichen Mittel wegen gehänselt worden.
35
Die Verhaftungen
Der darauffolgende Tag war für die Verhaftung Moreaus und Pichegrus festgesetzt worden.
Nicht ohne Besorgnis malte Bonaparte sich aus, welche Wirkung die Nachricht von Moreaus Festnahme in Paris haben würde. Seine Ungerechtigkeit Moreau gegenüber verriet, welchen Rang dieser in seiner Wertschätzung einnahm. Und deshalb wäre es Bonaparte am liebsten gewesen, Moreau auf seinem Landgut in Grosbois verhaften zu lassen und nicht in der Stadt.
Gegen zehn Uhr vormittags hatte Bonaparte keinerlei Neuigkeiten erfahren, wünschte sich jedoch nichts sehnlicher als das und ließ deshalb Constant kommen, dem er befahl, sich im Faubourg Saint-Honoré umzuhören. Falls etwas geschehen war, würde Constant es zweifellos erfahren, sobald er Moreaus Haus in der Rue d’Anjou observierte.
Constant gehorchte, doch im Faubourg Saint-Honoré und in der Rue d’Anjou begegnete er nur einigen verkleideten Polizeispitzeln, die niemandem auffielen außer ihm, denn er kannte sie von ihren Streifzügen um die Tuilerien herum. Einen, mit dem er ein wenig besser bekannt war, fragte er aus, und er erfuhr, dass Moreau sich offenbar auf seinem Landsitz aufhielt. In seinem Pariser Haus hatte man ihn nicht vorgefunden.
Constant war auf dem Rückweg, als der Spitzel, der in ihm den Kammerdiener des Ersten Konsuls erkannt hatte, hinter ihm hereilte und ihm zurief, Moreau sei auf der Brücke von Charenton festgenommen und in das Temple-Gefängnis gebracht worden. Er hatte keine Gegenwehr geleistet, war von seinem Wagen in das Kabriolett des Spitzels umgestiegen, und als der Großrichter Régnier ihn bei seiner Ankunft im Temple gefragt hatte, ob er vielleicht mit Bonaparte zu sprechen wünsche, hatte er erwidert, er habe keinerlei Anlass, ein Gespräch mit dem Ersten Konsul zu begehren.
Bonapartes Hass auf Moreau war von großer Ungerechtigkeit, doch andererseits war Moreaus Hass auf Bonaparte von nicht geringer Kleinlichkeit – denn dieser Haß gründete nicht in seinen eigenen Gefühlen, sondern in der Ranküne zweier Frauen: seiner Ehefrau und seiner Schwiegermutter. Madame Bonaparte hatte Moreau mit ihrer Freundin Mademoiselle Hulot verheiratet, Kreolin aus Martinique wie sie. Mademoiselle Hulot war eine fügsame, liebenswerte junge Frau mit allen Eigenschaften, die eine gute Ehefrau und gute Mutter ausmachen, voll leidenschaftlicher Liebe zu ihrem Ehemann und stolz auf den ruhmreichen Namen, den sie trug. Unglücklicherweise zählte zu ihren Tugenden auch die unumschränkte Unterwerfung unter die Ansichten, Wünsche und Leidenschaften ihrer Mutter. Madame Hulot war so ehrgeizig, dass sie ihren Schwiegersohn auf einer Stufe mit Bonaparte sah und sich für ihre Tochter eine Stellung erträumte, die der Joséphines gleichkam. Ihre Mutterliebe äußerte sich in endlosen Klagen und unablässigen Beschwerden, von der Tochter dem Ehemann zu Ohren gebracht. Die Gelassenheit des alten Römers hielt dieser Belagerung nicht stand, sein Gemüt verfinsterte sich, sein Haus wurde zu einem Brennpunkt der Opposition gegen Bonaparte, in dem alle Unzufriedenen verkehrten; jedes Tun des Ersten Konsuls bot Anlass zu beißendem Spott und strengstem Tadel. Moreau verwandelte sich von einem melancholischen Träumer in einen finster Brütenden, aus Ungerechtigkeit wurde Gehässigkeit, aus Unzufriedenheit Verschwörertum.
Bonaparte wiederum hoffte, dass Moreau zur Besinnung kommen würde, war er erst einmal verhaftet, dem Einfluss von Ehefrau und Schwiegermutter entzogen und mit ihm allein.
»Und«, fragte er Régnier, als er ihn nach der Verhaftung sah, »bringen Sie ihn zu mir?«
»Nein, General. Er hat gesagt, er habe keinen Anlass, ein Gespräch mit Ihnen zu begehren.«
Bonaparte sah den Großrichter über die Schulter an und sagte schulterzuckend: »Das hat man davon, wenn man sich mit Schwachköpfen abgibt.«
Wer aber war der Schwachkopf?
Der Großrichter dachte, Bonaparte hätte Moreau gemeint. Wir aber denken, dass Bonaparte Régnier im Sinn gehabt hatte.
Pichegru war ebenfalls verhaftet worden, doch in seinem Fall hatte man weniger Nachsicht walten lassen als bei Moreau.
Wir erinnern uns, dass Fouché gesagt hatte, er wisse, wo Pichegru sich aufhielt. Dank der Wachsamkeit des Limousiners hatte Fouché Pichegru seit dessen Ankunft in Paris tatsächlich keine Sekunde lang aus den Augen verloren.
Von der Rue de l’Arcade hatte er ihn in die Rue de Chaillot verfolgt; als er die Rue de Chaillot verlassen musste, hatte Coster Saint-Victor ihn bei seiner einstigen Freundin, der schönen Aurélie de Saint-Amour, versteckt, wo er sich in mehr oder weniger größerer Sicherheit befand als an jedem anderen Ort, doch diese letzte Zuflucht unseres Alkibiades widersprach der Sittenstrenge Pichegrus. Deshalb nahm er die Gastfreundschaft eines ehemaligen Dienstboten an oder, wie andere behaupten, eines ehemaligen Aide de Camp – doch wir hoffen, es war ein Dienstbote -, verließ die Rue des Colonnes und zog in die Rue Chabanais um.
Bei Aurélie hatte er zwei Tage lang gewohnt; dies ist der einzige Zeitraum, in dem Fouché ihn aus den Augen verloren hatte.
In dem neuen Unterschlupf blieb Pichegru zwei Wochen lang, ohne dass man ihn belästigt hätte. Seit zwölf Tagen hatte Fouché seine Fährte wiedergefunden und ließ ihn nicht mehr aus den Augen.
Am Vorabend des Tages, an dem Moreau verhaftet werden soll, will ein gewisser Leblanc General Murat persönlich sprechen und lässt sich nicht abweisen.
Wie wir uns erinnern, war Murat, Bonapartes Schwager, der ihn beim 18. Brumaire so trefflich unterstützt hatte, an Junots Stelle zum Gouverneur von Paris ernannt worden.
Unter der Last seiner Verpflichtungen weigert Murat sich zunächst, den Bittsteller vorzulassen, doch als Pichegrus Name fällt, öffnen sich dem Petitionär alle Türen.
»Herr Gouverneur«, sagte ein Mann um die fünfzig, »ich biete Ihnen an, Ihnen Pichegru auszuliefern.«
»Ihn auszuliefern oder ihn zu verkaufen?«
Der Mann stand für einen Augenblick gesenkten Kopfs und stumm da.
»Ihn zu verkaufen«, murmelte er dann.
»Für wie viel?«
»Hunderttausend Francs.«
»Ho, ho, lieber Freund, das ist viel Geld!«
»General«, sagte der Mann und erhob den Kopf, »wenn man ein Schurkenstück wie dieses begeht, soll es sich wenigstens auszahlen.«
»Werde ich bis heute Abend seine Adresse wissen und ihn verhaften können, wann ich will?«
»Sobald das Geld bezahlt ist, werden Sie tun können, was Sie wollen, sogar meine Seele dem Teufel verkaufen, sollte Ihnen der Sinn danach stehen.«
»Man wird Ihnen den Betrag auszahlen«, sagte Murat. »Wo hält Pichegru sich auf?«
»Bei mir, in der Rue Chabanais, Nummer fünf.«
»Geben Sie mir eine schriftliche Beschreibung seines Zimmers.«
»Im vierten Stock, ein Zimmer samt Kammer, zwei Fenster zur Straße, eine Tür zum Treppenabsatz und eine Tür zur Küche. Ich werde Ihnen den Schlüssel zur Küchentür aushändigen, ich habe einen Zweitschlüssel anfertigen lassen, und meine Bedienstete wird Ihren Männern den Weg weisen. Lassen Sie sich aber gesagt sein, dass Pichegru immer mit einem Paar doppelter Pistolen und mit einem Dolch unter dem Kopfkissen schläft.«
Murat las die Erklärung und legte sie dem Verräter vor: »Jetzt«, sagte er, »müssen Sie unterzeichnen.«
Der Mann ergriff die Feder und unterzeichnete mit »Leblanc«.
»Ich könnte Ihnen Ihrer hunderttausend Francs wegen die Hölle heißmachen«, sagte Murat. »Sie kennen sehr wohl das Gesetz gegen Hehler; wie kommt es, dass Sie zwei Wochen lang gewartet haben, bevor Sie Pichegru denunzierten?«
»Ich hatte nicht gewusst, dass er gesucht wurde. Er hatte sich als Emigrant vorgestellt, der gekommen war, um seine Exilierung ungeschehen zu machen. Gestern erst hatte ich begriffen, dass er aus einem anderen Grund nach Paris gekommen war, und ich wollte der Regierung behilflich sein, indem ich seine Verhaftung beförderte, und außerdem«, wiederholte der Verräter mit niedergeschlagenem Blick, »sagte ich bereits, dass ich nicht wohlhabend bin.«
»Sie werden es sein«, sagte Murat, der die Geldscheine und Münzen zu ihm schob. »Möge das Geld Ihnen Glück bringen, was ich allerdings bezweifle.«
Keine Stunde war seit dieser Unterredung vergangen, als Murat Fouché angekündigt wurde. Murat genoss Bonapartes Vertrauen und wusste, dass Fouché der wahre Polizeipräfekt war.
»Mein General«, sagte Fouché, »Sie haben soeben hunderttausend Francs ohne Not verpulvert.«
»Und wie das?«, fragte Murat.
»Indem Sie diesen Geldbetrag einem Halunken namens Leblanc gaben, der Ihnen eröffnet hat, Pichegru befinde sich bei ihm.«
»Meiner Treu, das schien mir nicht zu viel für ein solches Geheimnis.«
»Es war aber zu viel, denn ich wusste davon und hätte ihn bei erstbester Gelegenheit festnehmen lassen.«
»Und wussten Sie, wie sein Zimmer aussieht, so dass Sie keinen Fehler gemacht hätten?«
Fouché zuckte die Schultern. »Im vierten Stock, zwei Fenster auf die Straße, zwei Türen, eine zur Küche, die andere auf den Teppenabsatz, zwei Pistolen und ein Dolch unter dem Kopfkissen. Pichegru wird im Temple-Gefängnis sein, sobald Sie es wünschen.«
»Am besten morgen. Morgen wird man Moreau verhaften.«
»Sehr gut«, sagte Fouché, »um vier Uhr morgens wird man ihn verhaften; allerdings bin ich dem Ersten Konsul für die Sache verantwortlich und möchte sie deshalb zu Ende führen.«
»Bitte sehr«, sagte Murat.
Am nächsten Morgen zwischen drei und vier Uhr begaben sich der Polizeikommissar Comminges, zwei Inspektoren und vier Gendarmen aufgrund der ihnen gegebenen Informationen in die Nummer fünf der Rue Chabanais. Tapfere und unerschrockene Männer waren für dieses Unternehmen gewählt worden, denn es war bekannt, dass Pichegru keine Furcht kannte und sich nicht ohne erbitterten Widerstand gefangen nehmen lassen würde.
Der Concierge wurde so leise wie möglich geweckt; man teilte ihm mit, worum es ging, und verlangte, Leblancs Köchin zu sprechen.
Die Köchin, am Abend eingeweiht, hatte sich nicht entkleidet; sie kam herunter, öffnete mit dem Schlüssel, den ihr Herr hatte machen lassen, die Küchentür, und ließ die sechs Polizisten und den Kommissar in Pichegrus Zimmer eintreten.
Pichegru schlief.
Die sechs Gendarmen stürzten sich auf das Bett. Pichegru richtete sich auf, warf zwei Gendarmen um, suchte nach seinen Pistolen und seinem Dolch, doch vergebens.
Die verbliebenen vier Gendarmen warfen sich wie ein Mann auf ihn. Pichegru, halbnackt, wehrte sich gegen drei von ihnen, indes der vierte ihm mit dem Säbel die Beine zerfleischte. Er stürzte nieder wie ein Berg. Ein Gendarm stellte ihm den Stiefel auf das Gesicht, stieß jedoch sofort einen Schrei aus: Pichegru hatte ihm die Stiefelsohle und einen Teil des Fersenbeins abgebissen. Die drei anderen umschlangen ihn mit dicken Seilen, die sie mittels eines Drehkreuzes befestigten.
»Ich bin besiegt!«, sagte Pichegru. »Genug!«
Man warf ihm eine Decke über und verfrachtete ihn in einen Fiaker.
An der Barrière des Sergents bemerkten der Kommissar und die zwei Polizisten, die mit Pichegru im Wagen saßen, dass er nicht mehr atmete. Der Kommissar ließ die Stricke lockern. Es war höchste Zeit, der Gefangene stand kurz vor dem Tod.
Unterdessen brachte ein Gendarm Bonaparte die Papiere, die man bei Pichegru gefunden hatte.
Pichegru wiederum wurde so, wie er war, in Monsieur Réals Arbeitszimmer gebracht. Dieser versuchte, ihn zu verhören. Marco Saint-Hilaire hat uns dieses erste Verhör erhalten. Er schildert sehr genau, in welchem Zustand Pichegru sich befand.
»Wie heißen Sie?«, fragte ihn der Staatsrat.
»Wenn Sie meinen Namen nicht wissen«, erwiderte Pichegru, »werden Sie kaum bestreiten wollen, dass es nicht an mir ist, ihn Ihnen zu nennen.«
»Kennen Sie Georges?«
»Nein.«
»Woher kommen Sie?«
»Aus England.«
»Wo sind Sie gelandet?«
»Wo ich konnte.«
»Wie sind Sie nach Paris gekommen?«
»Im Wagen.«
»Mit wem?«
»Mit mir.«
»Kennen Sie Moreau?«
»Ja, er hat mich vor dem Direktorium verleumdet.«
»Haben Sie ihn in Paris wiedergesehen?«
»Hätten wir uns wiedergesehen, dann mit dem Degen in der Hand.«
»Und kennen Sie mich?«
»Sicherlich.«
»Ich habe oft von Ihnen gehört, und ich achte Ihre militärischen Fähigkeiten.«
»Sehr schmeichelhaft«, erwiderte Pichegru.
»Man wird Ihre Wunden verbinden.«
»Das ist unnötig, sorgen Sie dafür, dass ich erschossen werde.«
»Haben Sie einen Vornamen?«
»Meine Taufe ist so lange her, dass ich ihn vergessen habe.«
»Nannte man Sie nicht bisweilen Charles?«
»Diesen Namen haben Sie mir in dem gefälschten Briefwechsel gegeben, den Sie mir untergeschoben haben; im Übrigen werde ich von jetzt an nicht mehr auf Ihre unverschämten Fragen antworten.«
In der Tat wahrte Pichegru von da an Schweigen. Man brachte ihm in Monsieur Réals Arbeitszimmer Kleidung und Leibwäsche, die man aus seiner Wohnung mitgenommen hatte.
Einer der Gerichtsdiener diente ihm als Kammerdiener.
Als Pichegru das Temple-Gefängnis betrat, trug er einen braunen Frack, eine schwarze Seidenkrawatte und Stulpenstiefel; eine eng anliegende lange Hose hielt die Verbände an seinen zerfleischten Beinen. Ein blutiges weißes Taschentuch diente als Verband um eine seiner Hände.
Nach erfolgtem Verhör eilte Monsieur Réal in den Tuilerienpalast. Wie gesagt hatte man Pichegrus Papiere Bonaparte gebracht. Réal fand ihn damit beschäftigt, nicht etwa Pichegrus Papiere zu lesen, sondern einen Bericht, den Pichegru über die Verbesserung Französisch-Guyanas verfasst hatte. Während seines Aufenthalts in Sinnamary hatte er sich Notizen über das Klima gemacht, und während der Zeit, die er in England verbrachte, hatte er als begeisterter Ingenieur den Bericht geschrieben. Er schloss mit der Bemerkung, dass seiner Ansicht nach nicht mehr als zwölf oder vierzehn Millionen erforderlich seien, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
Dieser Bericht hatte Bonaparte zutiefst beeindruckt: Er hörte Réal nur mit halbem Ohr zu, als dieser von Verhör und Verhaftung Pichegrus berichtete. Als Réal schwieg, reichte Bonaparte ihm den Bericht, den er soeben gelesen hatte.
»Lesen Sie selbst«, sagte er.
»Was ist das?«
»Das ist das Werk eines Unschuldigen, der in die Gesellschaft von Schuldigen geraten ist, wie es zuweilen geschieht, und der fern seinem Vaterland keineswegs konspiriert hat, sondern Ruhm und Reichtum Frankreichs zu mehren bestrebt war.«
»Ah«, sagte Réal, der auf den Bericht blickte, den der Erste Konsul ihm hinhielt, »ein Bericht über Guyana und die Möglichkeiten, unseren Landbesitz auf dem Festland zu verbessern.«
»Wissen Sie, von wem er stammt?«, fragte Bonaparte.
»Ich sehe keinen Verfassernamen«, sagte Réal.
»Ha, Pichegru ist der Verfasser. Seien Sie wohlwollend, sprechen Sie zu ihm, wie es einem Mann von seinen Verdiensten zusteht, bringen Sie das Gespräch auf Cayenne und Sinnamary; ich wäre nicht übel geneigt, ihn als Gouverneur dorthin zu schicken und ihm zehn bis zwölf Millionen Kredit einzuräumen, damit er seine Pläne in die Tat umsetzen kann.«
Bonaparte verschwand in sein Kabinett und ließ einen Réal zurück, der kaum zu fassen vermochte, welche Pläne der Erste Konsul mit einem Mann hatte, dessen Vergehen die Todesstrafe verdienten.
Doch unter Bonapartes Rivalen war Pichegru nicht nur derjenige, der ihm vielleicht nützlicher sein konnte, sondern auch derjenige, den Bonaparte weniger verabscheute, denn Pichegru hatte seine Beliebtheit bereits verloren, während Moreau beliebter war denn je. Wollte er um die Gunst des Volkes buhlen, hätte Bonaparte Moreau begnadigen und Pichegru entschädigen müssen. Und im Windschatten dieser demonstrativen Großmut konnte er die übrigen Verschwörer hinrichten lassen, ohne befürchten zu müssen, dass gemurrt wurde.
36
Georges
Blieb Georges.
Hatte man ihn bis zum Schluss aufgespart, damit die anderen genug Zeit hatten, sich in die Nesseln zu setzen? Oder standen ihm, weil er schlauer war, gewandter, besser informiert und auch wohlhabender als jene, Mittel und Wege zur Verfügung, über die seine Komplizen nicht geboten? Wie auch immer, nach der Verhaftung Moreaus und Pichegrus blieb ihm keine Zeit mehr, denn nun machte Fouché sich allen Ernstes an seine Verfolgung. Ein geschickter Architekt hatte im Voraus in einem Dutzend Häuser Verstecke angelegt, die zu entdecken schier unmöglich war, sofern man nicht die Pläne besaß. Mehr als einmal wähnte Fouché sich auf der richtigen Fährte, doch all seiner Schläue zum Trotz entwischte Georges ihm jedes Mal. Stets bewaffnet, und zwar bis zu den Zähnen, angekleidet schlafend, Gold in die Kleidung eingenäht, verschwand Georges in der erstbesten Tür des erstbesten Hauses und fand stets Unterschlupf, dank seiner Überredungskünste, dank seines Goldes oder durch Drohungen. Einige seiner Bravourstücke sind Legende geworden.
Eines Nachts gegen Ende Februar, als man ihn aus dem Haus gejagt hatte, in dem er Zuflucht gefunden hatte, eine Meute von Polizisten auf den Fersen und in höchster Not, stürzt sich Georges wie ein Hirsch beim Anblick eines Teichs den Boulevard entlang in den Faubourg Saint-Denis. Auf einem beleuchteten Schild liest er die Worte: Guilbart, Chirurg und Zahnarzt, läutet stürmisch, die Tür wird geöffnet, er schließt sie hinter sich, erwidert dem Concierge, der sein Begehr wissen will: »Zu Monsieur Guilbart«, begegnet auf halber Treppe dem Dienstmädchen des Arztes, das beim Anblick eines in seinen Mantel vermummten Mannes, der sich gewaltsam Zutritt zu schaffen versucht hat, am liebsten um Hilfe rufen würde.
Georges zieht ein Taschentuch hervor und presst es sich an die Wange.
»Ist der Chirurg zu sprechen, Madame?«, fragt er und stößt ein lautes Stöhnen aus.
»Nein, Monsieur!«, erwidert das Hausmädchen.
»Wo ist er denn?«, fragte Georges.
»Er ist zu Bett. Wie es sich gehört, es ist schließlich Mitternacht!«
»Für mich wird er aufstehen, wenn er ein Mensch mit Herz ist.«
»Menschen mit Herz schlafen um diese Zeit wie alle anderen.«
»Gewiss, aber sie stehen auf, wenn man an ihr Herz appelliert.«
»Haben Sie Zahnweh?«
»Sagen Sie ihm, dass ich höllisches Zahnweh habe.«
»Soll er Ihnen mehrere Zähne reißen?«
»Den ganzen Kiefer, wenn es sein muss.«
»Das ist etwas anderes. Aber ich muss Ihnen sagen, dass Monsieur nicht unter einem Louisdor je Zahn reißt.«
»Zwei Louisdor, wenn es sein muss.«
Das Dienstmädchen steigt die Treppe hinauf, führt Georges in das Behandlungszimmer, zündet die zwei Kerzen an dem Sessel an und geht in das Nachbarzimmer; fünf Minuten später kehrt es zurück und sagt: »Monsieur, folgt mir.«
In der Tat trat der Arzt im nächsten Augenblick ein.
»Beeilen Sie sich, mein lieber Doktor«, rief Georges, »ich warte sehnsüchtig auf Sie.«
»Da bin ich schon, da bin ich schon«, sagte der Arzt. »Setzen Sie sich in jenen Sessel... Gut, jetzt sind Sie hier. Zeigen Sie mir den Zahn, der Ihnen Schmerzen bereitet.«
»Den Zahn, der mir Schmerzen bereitet, zum Teufel!«
»Ja.«
»Hier.«
Und Georges öffnete den Mund und enthüllte dem Blick des Chirurgen ein wahres Schmuckkästchen, das zweiunddreißig Perlen enthielt.
»Oho!«, sagte der Arzt. »So ein prachtvolles Gebiss habe ich selten gesehen; doch welches ist der Zahn, der Ihnen Schmerzen bereitet?«
»Es ist eine Art Neuralgie, Doktor, suchen Sie selbst.«
»Auf welcher Seite?«
»Rechts.«
»Sie belieben zu scherzen, ich kann keinen einzigen Zahn entdecken, der einen Makel hätte.«
»Doktor, denken Sie, ich bäte Sie zum Vergnügen, mir einen Zahn zu reißen?«
»Aber welchen Zahn soll ich Ihnen reißen?«
»Den da«, sagte Georges und deutete auf den ersten Backenzahn, »nehmen Sie den!«
»Sind Sie ganz sicher?«
»Mehr als sicher, beeilen Sie sich.«
»Monsieur, ich muss Ihnen trotzdem versichern...«
»Mir scheint«, erwiderte Georges mit gerunzelter Stirn, »dass es erlaubt sein müsste, sich einen Zahn reißen zu lassen, der Schmerzen macht.«
Und indem Georges sich aufrichtete, ließ er vielleicht nicht unabsichtlich die Griffe zweier Pistolen und eines reichverzierten Dolchs sehen.
Der Chirurg begriff, dass er einem so wohlbewaffneten Mann besser nichts abschlug; er setzte die Schraubzange an, drehte sie und zog den Zahn.
Georges stieß keinen Klagelaut aus. Er ergriff ein Glas, schenkte Wasser ein, gab ein paar Tropfen Medizin in das Wasser und sagte überaus höflich: »Monsieur, niemand dürfte eine leichtere Hand und zugleich einen festeren Griff haben als Sie. Dennoch muss ich sagen, dass mir die englische Methode lieber ist als die französische.«
Er spülte sich den Mund und spie in das Becken.
»Und wie kommt es zu dieser Vorliebe, Monsieur?«
»Sie rührt daher, dass die Engländer die Zähne mit der Zange ziehen, von unten nach oben, so dass der Zahn in gerader Richtung entfernt wird, während die Franzosen eine Schraubbewegung ausführen, mit der die Zahnwurzel gedreht wird, und das ist sehr schmerzhaft.«
»Recht viel Schmerz haben Sie sich nicht anmerken lassen.«
»Das kommt daher, dass ich große Selbstbeherrschung besitze.«
»Sind Sie Franzose, Monsieur?«
»Nein, ich bin Bretone.«
Und er legte zwei Louisdor auf den Kaminsims.
Georges hatte noch nicht das vereinbarte Signal gehört, das reine Luft bedeutete, und wollte deshalb Zeit gewinnen. Monsieur Guilbart wiederum hatte nicht die Absicht, einen so schwerbewaffneten Patienten zu verärgern, und zeigte sich von den banalsten Gesprächsgegenständen angetan. Schließlich ertönte ein Pfiff.
Das war das Signal, auf das Georges gewartet hatte. Er erhob sich, schüttelte dem Arzt herzlich die Hand und stieg eilig die Treppe hinunter.
Der Arzt blieb zurück, außerstande, sich zu erklären, was vorgefallen war, und ratlos, ob er es mit einem Wahnsinnigen oder mit einem Einbrecher zu tun gehabt hatte. Erst am nächsten Tag, als ein Polizist ihn aufsuchte und ihm Georges beschrieb, den die Polizisten in der Nähe seines Hauses aus den Augen verloren hatten, erkannte er den Gesuchten wieder.
Als der Polizist sagte: »Er hat alle zweiunddreißig Zähne im Mund«, ging dem Arzt ein Licht auf; er sagte: »Da irren Sie sich! Er hat nur noch einunddreißig Zähne.«
»Seit wann?«, fragte der Polizist.
»Seit gestern Abend«, sagte Moniseur Guilbart, »denn da habe ich ihm einen Zahn gezogen.«
Zwei Tage nach diesen Geschehnissen, die in Polizeikreisen seither legendär geworden sind, wurden zwei Verschwörer von höchster Bedeutung festgenommen.
Es geschah folgendermaßen (der folgende Bericht ist weder eine Polizeilegende noch eine Kanzlistenanekdote):
Bei meiner ersten Überfahrt von Genua nach Marseille mit dem Dampfschiff lernte ich den Marquis de Rivière kennen. Seine fesselnde Konversation weckte mein größtes Interesse, doch als er dazu ansetzte, mir die Geschichte seiner Verhaftung zu erzählen, setzte bei mir die Seekrankheit ein, und mir war, als bohrte sich seine kraftvolle Stimme, die mich bis in meine unerträglichen Qualen verfolgte, in meinen armen Kopf; er schwieg erst, als er merkte, welch übermenschliche Anstrengung es mich kostete, ihm zuzuhören und ihm zugleich meine Unpässlichkeit zu verbergen. Aus diesem Grund ist mir das, was er erzählte, nach vierzig Jahren noch so gegenwärtig, als hätte ich mich erst gestern mit ihm unterhalten.
Monsieur de Rivière und Monsieur Jules de Polignac verband eine jener Freundschaften wie im Altertum, die nur der Tod beenden kann; sie konspirierten miteinander, sie waren gemeinsam nach Paris gekommen, und sie zählten darauf, miteinander zu sterben.
Nachdem Moreau und Pichegru verhaftet worden waren, wurden auch sie aufgestöbert. Da sie nicht wussten, wo sie sich verstecken sollten, erwogen sie, den Grafen Alexandre de Laborde um Asyl zu bitten, einen jungen Mann ihres Alters, der sich mit der Regierung des Ersten Konsuls ohne Weiteres hatte arrangieren können, da er zum Geldadel zählte.
Monsieur de Labordes Stadtpalais befand sich in der Rue d’Artois an der Chaussée d’Antin. Als die Flüchtenden den Boulevard des Italiens erreichten, blieb der Marquis de Rivière vor einem der Pfeiler des sogenannten Pavillon de Hanovre stehen und las die dort angeschlagene Bekanntmachung des Polizeipräfekten, die den Hehlern mit der Todesstrafe drohte. Er ging zu Jules de Polignac zurück, der auf dem Boulevard wartete.
»Mein Freund«, sagte der Marquis, »beinahe hätten wir uns etwas zuschulden kommen lassen: Wenn wir den Grafen von Laborde um Asyl bitten, bringen wir ihn und seine ganze Familie in Lebensgefahr. Für Geld können wir uns einen ebenso sicheren Zufluchtsort besorgen – machen wir uns auf die Suche.«
Jules de Polignac, ein aufrechter Charakter, war der gleichen Ansicht, und sogleich trennten sie sich, damit jeder allein eine Unterkunft suchen konnte.
Noch am selben Abend begegnete der Marquis de Rivière einem seiner ehemaligen Kammerdiener, einem Mann namens Labruyère, der seinem einstigen Herrn schon zuvor vergebens angeboten hatte, ihn zu verstecken. Diesmal stießen seine Bitten nicht auf taube Ohren.
Der Marquis blieb achtzehn Tage unbehelligt in dem Versteck, das Labruyère ihm besorgt hatte, und wahrscheinlich wäre er nie entdeckt worden, hätte sein Kamerad Jules nicht etwas Unbedachtes getan. Jules de Polignac erfuhr in seinem Versteck, dass sein Burder Armand verhaftet worden war. Kopflos und ohne sich vorzusehen, lief er auf der Stelle zu seinem Freund Monsieur de Rivière, um es ihm zu erzählen, und der Marquis verlangte, dass Polignac bei ihm blieb.
»Hat Sie auch niemand kommen sehen?«, fragte er ihn.
»Keine Menschenseele, nicht einmal die Pförtnerin des Hauses.«
»Dann sind Sie in Sicherheit.«
Sie hatten sich sechs Tage lang in ihrem gemeinsamen Versteck aufgehalten, als Jules de Polignac eines Abends trotz der Bitten seines Freundes das Haus verließ, um eine Verabredung einzuhalten, die er für unverzichtbar hielt.
Ein Polizist erkannte ihn, als er zurückkam und das Haus betrat. Der Polizist wachte die ganze Nacht vor dem Haus, und am Tag darauf wurden Polignac und der Marquis in Labruyères Wohnung festgenommen.
Der Polizeikommissar war Comminges, der Mann, der sechs Tage zuvor Pichegru verhaftet hatte. Als Erstes erklärte er Labruyère, dass es einem Citoyen verboten sei, Fremde zu beherbergen, worauf Labruyère erwiderte, Monsieur de Rivière sei für ihn kein Fremder, sondern ein Freund, den er selbst dann aufgenommen hätte, wenn ihm dafür die Guillotine drohte.
Alle drei wurden zum Staatsrat Réal gebracht, damit er sie verhörte.
»Herr Staatsrat«, sagte der Marquis de Rivière, »ich mache Sie darauf aufmerksam, dass weder mein Freund noch ich eine einzige Frage beantworten werden, solange Sie uns nicht Ihr Wort geben, dass der Mann, der mich aufgenommen hat und der über die Motive unseres Aufenthalts in Paris nicht das Geringste weiß, unbehelligt bleiben wird.«
Der Staatsrat gab ihm sein Wort; daraufhin umarmte der Marquis seinen ehemaligen Diener und sagte: »Adieu, lieber Freund; jetzt bin ich zufrieden, da ich Ihre Sicherheit gewährleistet weiß.«
Am Freitag, den 9. März, erhielt um sechs Uhr abends ein Polizist der Sicherheitspolizei namens Caniolle in der Präfektur, wo er wartete, den Befehl, sich an den Fuß der Montagne Sainte-Geneviève zu begeben, um dort ein Kabriolett mit der Nummer dreiundfünfzig zu beschatten, falls es vorbeikommen sollte.
Dieses Kabriolett war dazu bestimmt, Georges abzuholen, der den Aufenthaltsort wechselte und in eine Wohnung umziehen wollte, die Freunde für ihn zum Preis von achttausend Francs im Monat gemietet hatten.
Das Kabriolett fährt leer vorbei, doch Caniolle folgt ihm. Er hatte erraten, dass der Wagen eine verdächtige Gestalt abholen würde.
Auf der Straße wimmelte es von Polizisten, die mit Instruktionen versehen waren. Caniolle weihte sie in seine Ordre ein. Sie folgten ihm.
Das Kabriolett fährt langsam bis zur Place Saint-Étienne-du-Mont, biegt in die Rue Sante-Geneviève ein und hält gegenüber einem Gässchen, das zu einem kleinen Obstladen führt.
Das Gässchen war menschenleer, das Verdeck des Kabrioletts geöffnet. Der Fahrer betritt den Obstladen und lässt sich Feuer geben, um seine Laternen anzuzünden. Als er sie am Wagen angebracht hat, verlassen Georges, seine Freunde Le Ridant und Burban sowie ein Vierter eilig das Gebäude, und Georges springt in den Wagen. Seine Freunde wollen es ihm nachtun, doch Caniolle drängt sich zwischen sie und hindert sie am Einsteigen.
»Was soll das?«, fragt Burban und stößt Caniolle weg. »Ist auf der anderen Straßenseite nicht genug Platz für Sie?«
»Mich dünkt«, erwidert der Polizist im gleichen Ton, »dass ich ohne Ihre Erlaubnis meiner Wege gehen kann, solange ich niemanden störe.«
Georges jedoch, der damit rechnet, dass man ihn überwacht, zieht Le Ridant in den Wagen, ohne auf die anderen zu warten, und lässt den Kutscher im Galopp losfahren. Man wollte Georges nicht auf der Straße verhaften, weil man ein blutiges Handgemenge befürchtete. Deshalb hatte der Spitzel nur den Befehl, dem Kabriolett zu folgen, das er im Verlauf des Wortwechsels aus den Augen verloren hatte.
Er rief Verstärkung herbei, und zwei Polizisten gesellten sich zu ihm; einer der beiden war ein gewisser Buffet.
Das Kabriolett entfernt sich immer weiter die Rue Saint-Hyacinthe entlang, obwohl die Straße ansteigt, und nun überquert es die Place Saint-Michel. Es biegt in die Rue des Fossés-Monsieur-le-Prince ein, damals Rue de la Liberté, und als Georges, der das Verdeck geschlossen hat, durch das kleine Rückfenster Menschen hinter ihnen herlaufen sieht, sagte er zu Le Ridant, der die Zügel hält: »Fahr zu, wir werden verfolgt! Fahr zu, oder sie fassen uns! Legt euch hin! Legt euch hin!«
Das Kabriolett, das wie ein Wirbelwind die Straße entlanggesaust war, näherte sich dem Carrefour de l’Odéon, als Caniolle, dem es gelungen war, den Wagen zu erreichen, sich mit letzter Kraft hinaufschwang, die Zügel ergriff und rief: »Halt! Halt im Namen des Gesetzes!«
Der ohrenbetäubende Lärm des dahinrasenden Wagens hatte alle Welt vor die Tür gelockt. Das gewaltsam angehaltene Pferd hatte noch einige Schritte getan und Caniolle mitgeschleift, bevor es stehen geblieben war.
Daraufhin springt Buffet auf das Trittbrett und steckt den Kopf unter das Verdeck, um sich zu vergewissern, wer in dem Kabriolett sitzt; doch fast im selben Augenblick ertönen zwei Pistolenschüsse, und Buffet stürzt rückwärts zu Boden, mitten in die Stirn getroffen. Caniolle spürt, wie sein Arm, mit dem er den Zügel hielt, schlaff herunterfällt. Ihm war der Arm zerschmettert worden!
Georges und Le Ridant springen aus dem Wagen, der eine zur Rechten, der andere zur Linken.
Kaum hat Le Ridant zehn Schritte getan, wird er ohne Gegenwehr verhaftet, während Georges mit dem Dolch in der Hand gegen zwei Polizisten kämpft.
Er steht im Begriff, mit dem erhobenen Dolch einen seiner Gegner zu treffen, als ein Hutmacherlehrling namens Thomas sich auf ihn wirft und seine Arme festhält. Zwei weitere Zuschauer, der Schreiber eines Lotteriebüros in der Rue du Théâtre-Français mit Namen Lamotte und ein Büchsenmacher namens Vignal, kommen Thomas zu Hilfe, und es gelingt ihnen, Georges den Dolch zu entreißen.
Georges wird gefesselt, in einen Fiaker verfrachtet und zur Polizeipräfektur gebracht, wo der Abteilungsvorsteher Dubois ihn in Anwesenheit von Desmarets verhört.
Beide Männer zeigten größtes Erstaunen, sich Georges gegenüberzusehen. Es folgt, was Desmarets über diesen Augenblick gesagt hat: »Georges, den ich damals zum ersten Mal sah, war in meinen Augen immer eine Art Alter vom Berge gewesen, der seine Meuchelmörder gegen die Machthabenden in alle Himmelsrichtungen aussandte. Stattdessen sah ich einen jungen Mann vor mir, einen Mann mit klaren Augen, frischer Farbe und einem Blick, der fest, doch zugleich so sanft war wie seine Stimme. Trotz seiner Beleibtheit bewegte er sich gewandt. Sein Kopf war ganz rund, mit einem sehr kurzen Lockenschopf, kein Backenbart, keinerlei Ähnlichkeit mit einem finsteren Verschwörer, der seit Jahren über die bretonische Einöde herrschte.«
»Elender!«, rief Dubois, als er Georges erblickte. »Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben einen Familienvater getötet und einen zweiten verwundet.«
Georges brach in Gelächter aus. »Daran sind Sie schuld«, sagte er.
»Wieso das?«
»Gewiss doch: Sie hätten mich von Ledigen festnehmen lassen müssen.«
37
Der Herzog von Enghien (2)
Wir erwähnten Fouchés Interesse am Tod des Herzogs von Enghien, um auf diese Weise Bonaparte für alle Zeiten mit dem Hause Bourbon und darüber hinaus mit allen Königshäusern Europas zu verfeinden.
Und nun bestätigten Georges, Moreau und Pichegru in ihren Verhören mehr oder weniger, was Fouché sich zusammengereimt hatte, indem sie einer nach dem anderen bestätigten, was zuvor nur Gerücht gewesen war: Ein Prinz aus dem Hause Bourbon werde nach Paris kommen und sich an die Spitze der Verschwörung setzen.
Wir erinnern uns, dass Bonaparte befürchtete, sich von Fouchés Hass auf eine falsche Fährte führen zu lassen, und deshalb einen Gendarmen beauftragt hatte, die Sachverhalte zu überprüfen, die der interimistische Polizeiminister, der ohne Portefeuille dennoch der eigentliche Minister war, vorgebracht hatte. Oberrichter Régnier und Staatsrat Réal waren dabei seine passiven und ahnungslosen Werkzeuge.
Der Gendarm brach auf.
Sobald die unsichtbare und unbekannte Macht festgesetzt hat, dass ein glückliches oder schicksalträchtiges Ereignis zu geschehen hat, kommt alles diesem Willen zu Hilfe, der die Menschen im Verfolgen seiner Ziele nach Belieben dirigiert. Kennzeichnend für die großen Ereignisse der modernen Zeit ist die schier ausnahmslose Machtlosigkeit des Individuums. Selbst Männer im Ruf größter Stärke oder Gewandtheit hatten die Geschicke nicht in ihrer Hand, sondern wurden von den Ereignissen mitgerissen. Mächtig waren sie, solange sie der Bewegung dienten, machtlos, sobald sie sich ihr entgegenstellen wollten; und das macht Bonapartes wahren Glücksstern aus, denn das Geschick wahrte ihm die Treue, solange er die Interessen des Volkes vertrat, und kündigte sie ihm auf, als er den aberwitzigen Kometen von 1811 für seinen Stern nahm. Indem er sich den römischen Cäsaren gleichsetzte, wollte er die Sache der Revolution der Sache der alten Monarchien gleichsetzen – ein unmögliches Unterfangen. Der Philosoph kann mit demütigem Staunen die Kraft beobachten, die über den Gesellschaften schwebt und aus sich selbst heraus wirkt: Denn weder in überragendem Geist noch im Adel darf man suchen, was es zum Regieren braucht. Die Ergebnisse darf man sich zunutze machen, doch Verdienst daran darf man sich keines anmaßen.
Der Zufall nun wollte, dass besagter Gendarm, der unter anderen Umständen nur als Echo fungiert hätte, seine eigene Meinung besaß. Er hatte Paris in der Überzeugung verlassen, der Herzog von Enghien sei der Prinz, den Georges erwartete; er hielt sich selbst für denjenigen, der dazu ausersehen war, dieses große Komplott aufzuklären, und von Stund an sah er die Dinge nur noch durch die Brille seiner Ansichten.
Zuerst schrieb er nach Paris, es bestehe kein Zweifel daran, dass der Herzog von Enghien in Ettenheim Tag und Nacht Intrigen spinne und dass seine Abwesenheiten von sieben oder acht Tagen nur vorgeblich der Jagd dienten, in Wahrheit aber der Konspiration.
Diese Abwesenheiten, die der Herzog selbst stets leugnete, wurden allerorten kommentiert, denn aus England schrieb ihm sein Vater, der Prinz von Condé: »Man versichert uns hier, mein lieber Sohn, Sie seien vor sechs Monaten nach Paris gereist, während andere behaupten, Sie seien nur in Straßburg gewesen; Sie werden mir zustimmen, dass Sie Ihr Leben und Ihre Freiheit auf diese Weise unnötig aufs Spiel gesetzt haben, denn was Ihre Grundsätze betrifft, mache ich mir nicht die geringsten Sorgen, da ich sie in Ihrem Herzen so fest verankert weiß wie in dem meinen.«
Worauf der Herzog erwiderte: »Zweifellos, lieber Papa, muss man mich schlecht kennen, wenn man behaupten oder Ihnen einreden wollte, ich könnte einen Fuß auf republikanischen Boden setzen, ohne den Rang oder den Platz einzunehmen, den der Zufall mir von Geburt an bestimmt hat. Ich bin zu stolz, um den Kopf zu beugen. Dem Ersten Konsul mag es gelingen, mich zu vernichten, doch er wird mich nicht dazu bringen, mich selbst zu erniedrigen.«
Schwerwiegender jedoch als alldas war einer jener entsetzlichen Zufälle des Schicksals, der darin bestand, dass der Gendarm sich nach den Namen derer erkundigte, die für gewöhnlich mit dem Herzog verkehrten, und man ihm erwiderte, am häufigsten sehe er zwei Kommissare der englischen Regierung, Sir Francis Drake und Sir Spencer Smith, deren einer in Stuttgart und der andere in München residierte und die trotz der Entfernung häufig nach Ettenheim fuhren; hinzu kämen ein Oberst Schmidt und ein General Thuméry. Aus einem deutschen Mund klang der Name Thuméry wie Dümmerie; von Dümmerie bis zu Dumouriez war es nicht mehr weit, und diesen Schritt ging unser Gendarm sofort. In seiner Depesche trat der Name des Generals Dumouriez an die Stelle des Namens Thuméry und verlieh der Anwesenheit des Herzogs am Rheinufer eine Bedeutung von größter Tragweite. Mit einem Mal war Frankreich Gegenstand einer Verschwörung von allen Seiten: Moreau in Paris bildete ihren Mittelpunkt, Georges und Pichegru verkörperten sie im Westen, Dumouriez war ihr Vertreter im Osten, und Frankreich musste sich nach Leibeskräften wehren, um das Netz des Bürgerkriegs zu zerreißen.
Ein weiterer Umstand kam hinzu. Wie es sich heute verhält, weiß ich nicht, doch damals führten Gendarmerieoffiziere keinen Auftrag aus, wer ihn auch angeordnet haben mochte, ohne eine Zweitschrift ihres Berichts an ihren Vorgesetzten zu senden, und deshalb wurden sie auch nie mit Aufträgen betraut, die höchste Geheimhaltung erforderten.
Die zwei Berichte kamen mit derselben Post: Einer war an General Moncey adressiert, der andere an Monsieur Réal. Monsieur Réal kam zu festgesetzter Stunde, um mit Bonaparte zu arbeiten, General Moncey kam jeden Morgen auf Befehl, und an diesem Morgen hatte er den Bericht seines Gendarmen in der Tasche und las ihn Bonaparte vor. Die Wirkung des Berichts auf Bonaparte war erschreckend: Er sah einen bewaffneten Bourbonen am Stadtrand von Straßburg vor sich, der nur auf die Nachricht von der Ermordung des Ersten Konsuls wartete, um Frankreich zu betreten, und diesen einzigen Prinzen, der den Mut gehabt hatte, das Schwert zu erheben, um für den Thron zu kämpfen, umringte ein ganzer Stab von Emigranten, englischen Ministern und englischen Offizieren, ganz zu schweigen von Dumouriez, der englischer war als die Engländer selbst. Bonaparte schickte Moncey weg, behielt aber den Bericht da und ordnete an, er wolle nicht gestört werden.
Moncey ging mit dem Auftrag, Fouché, den zwei Konsuln und Monsieur Réal durch Ordonnanzen mitteilen zu lassen, sie sollten sich um sieben Uhr im Tuilerienpalast einfinden.
Bonaparte hatte für sieben Uhr eine Audienz mit Chateaubriand vorgesehen. Auf der Stelle ließ er seinen Sekretär Monsieur Méneval dem Verfasser von Der Geist des Christentums einen Brief schreiben, in dem er ihn bat, das Gespräch auf neun Uhr verlegen zu können.
Das Geschick dieser zwei großen Geister war auf seltsame Weise ähnlich verlaufen. Beide waren 1769 geboren, beide zählten mittlerweile fünfunddreißig Jahre. Diese Männer, die in dreihundert Meilen Entfernung voneinander das Licht der Welt erblickt hatten, die sich begegnen, sich in die Haare geraten, sich trennen und sich wieder in die Haare geraten sollten, wuchsen auf, ohne voneinander zu wissen, der eine als Schüler im Schatten der hohen und tristen Mauern des Kollegs, den strengen Vorschriften unterworfen, die Generäle und Staatsmänner herausbilden, der andere müßig an den Gestaden, Gefährte von Wind und Wellen, mit der Natur als einzigem Lehrbuch und Gott als einzigem Lehrer, den zwei großen Lehrmeistern der Träumer und der Dichter.
Und so hatte der eine der beiden immer ein Ziel, das er erreichte, mochte es noch so hochgesteckt sein, während der andere nur Wünsche hegte, die er nie verwirklichte. Der eine wollte den Raum messen, der andere die Unendlichkeit erobern.
Im Jahr 1791 kehrte Bonparte für ein Semester zu seiner Familie zurück, um dort die Ereignisse abzuwarten. Im Jahr 1791 schiffte Chateaubriand sich in Saint-Malo ein, um den Seeweg nach Indien im Nordwesten Amerikas zu entdecken: Folgen wir dem Dichter.
Chateaubriand verlässt Saint-Malo am 6. Mai um sechs Uhr morgens. Er geht auf den Azoren an Land, wie er es später seine Figur Chactas tun lassen wird, dann treiben die Winde ihn an das Ufer Neufundlands, er quert die Meerenge und landet an der Insel Saint Pierre, auf der er zwei Wochen verbringt; verloren in den Nebeln, die sie unaufhörlich bedecken, unter Wolken und Windstößen, begleitet vom Tosen eines unsichtbaren Meeres, irrt er auf einer dürren, abgestorbenen Heide umher, am Rand eines rötlichen Gießbachs zwischen den Felsen.
Nach den zwei Wochen Aufenthalt verlässt der Reisende Saint Pierre und erreicht die Breiten der Küste von Maryland, wo ihn Windstille aufhält; doch was schert das den Dichter? Die Nächte sind prachtvoll, die Sonnenaufgänge herrlich, die Sonnenuntergänge zauberhaft; vom Oberdeck des Schiffs folgt er mit dem Blick der Sonnenscheibe, die, im Begriff, sich in die Wogen zu tauchen, durch das Tauwerk des Schiffes scheint, in den schrankenlosen Räumen des Ozeans.
Eines Tages schließlich erblickte man oberhalb der Wogen einige Baumwipfel, die man für das Grün etwas dunklerer Wellen hätte halten können, wären sie nicht unbewegt gewesen. Das war Amerika!
Ein großer Gegenstand für die Gedanken des zweiundzwanzigjährigen Dichters – diese Welt mit ihren wilden Schicksalen und mit ihrer ungewissen Zukunft, von Seneca erahnt, von Kolumbus entdeckt, von Vespucci getauft, die ihres Historikers aber noch harrt.
Es war die rechte Stunde, um Amerika zu besuchen! Ein Amerika, das über den Ozean hinweg Frankreich die Revolution zurücksandte, die es vollbracht hatte, die Freiheit, die es sich mithilfe französischer Schwerter erobert hatte.
Wie merkwürdig, die Erbauung einer blühenden Stadt dort mitzuerleben, wo hundert Jahre zuvor William Penn einigen nomadischen Indianern ein Stück Land abgekauft hatte! Und was für ein letzten Endes erhebender Anblick, eine Nation aus einem Schlachtfeld wachsen zu sehen, als hätte ein neuer Kadmos in die Furchen der Gewehr- oder Kanonenkugeln seine Drachenzähne gesät, denen Menschen entsprangen.
Chateaubriand machte in Philadelphia halt; er wollte nicht die Stadt besichtigen, sondern Washington besuchen. Washington zeigt ihm einen Schlüssel der Bastille, den ihm die Sieger aus Paris geschickt haben. Chateaubriand konnte ihm seinerseits noch nichts zeigen; nach seiner Rückkehr hätte er ihm den Geist des Christentums zeigen können.
Sein Leben lang sollte der Dichter sich an diesen Besuch bei dem amerikanischen Staatenlenker erinnern. Am Abend des ersten Tages hatte Washington ihn zweifellos bereits vergessen. Washington befand sich auf dem Gipfel seines Ruhmes, er war der Präsident des Volkes, dem er als General und als Begründer einer Nation gedient hatte. Chateaubriand war ein Niemand, jung und unbekannt, und der Glanz seines späteren Ruhms hatte noch keine ersten Strahlen ausgesandt. Washington starb, ohne denjenigen erkannt zu haben, der später von ihm und von Napoleon sagen sollte: »Diejenigen, welche wie ich den Eroberer Europas und den Gesetzgeber Amerikas gesehen haben, wenden heute ihre Blicke von der Schaubühne der Welt hinweg, denn ein paar Possenreißer, die lachen oder weinen machen, sind nicht der Mühe wert, gesehen zu werden.«
Washington war die einzige Sehenswürdigkeit in den Städten Amerikas, nach der es Chateaubriand verlangte. Zudem hatte unser Reisender keineswegs den Atlantik überquert und die Neue Welt betreten, um Menschen zu sehen, die allerorten mehr oder weniger die gleichen sind. Es war ihm darum zu tun gewesen, in der Tiefe der Urwälder, am Ufer der Seen, die so groß waren wie Meere, und inmitten der Prärien, die so unendlich waren wie Wüsten, die Stimme zu suchen, die in der Einsamkeit zu uns spricht.
Hören wir, was der Reisende uns von seinen Eindrücken erzählt. Vergessen wir nicht, dass dieses Land, das Cooper so unnachahmlich geschildert und poetisch gemalt hat, damals fast gänzlich unbekannt war. Gabriel Ferry, der sich auf Coopers Spuren verirrte, hatte weder Der Waldläufer noch Der Indianer veröffentlicht, und Gustave Aimard hatte noch nicht den Legendenschatz, den er ins Leben rief, aus den Tiefen der amerikanischen Wälder heraufbeschworen: Nein, alles war noch jungfräulich im Wald und auf der Prärie, so jungfräulich wie Wald und Prärie selbst, und derjenige, der als Erster deren Schleier heben sollte, fand sie so keusch und rein vor wie am ersten Tag der Schöpfung.
»Als ich den Mohawk überquert hatte, gelangte ich in Wälder, die noch nie eine Axt berührt hatte. Eine Art Unabhängigkeitstaumel ergriff mich. Ich ging von rechts nach links und von Baum zu Baum und sagte mir immer wieder: ›Hier gibt es keine Wege mehr, keine Städte, keine Monarchie und keine Republik, weder Präsidenten noch Könige, noch überhaupt Menschen.‹ Und um zu erproben, ob ich wirklich wieder in meine angestammten Rechte eingesetzt sei, überließ ich mich einer völligen Willkür, was meinen Führer, der mich ohnehin insgeheim für verrückt hielt, in Zorn versetzte.«
Und bald sagte der Reisende der Zivilisation Adieu: kein Dach über dem Kopf mehr als eine Ajupa, kein Bett mehr als den Erdboden, kein Kopfkissen mehr als den Sattel, keine Decke mehr als die Mäntel, keinen Betthimmel mehr als den Himmel selbst.
Die Pferde liefen frei umher, mit einem Glöckchen am Hals, und ein bewundernswerter Selbsterhaltungstrieb machte, dass sie nie das von ihren Herren entzündete Feuer aus dem Auge verloren, das die Insekten vertrieb und die Schlangen fernhielt.
Und dann beginnt eine Reise im Geiste Sternes: Doch statt die Zivilisation zu beackern, durchpflügt unser Reisender die Einsamkeit. Ab und zu bietet sich ein Indianerdorf unversehens seinem Blick dar, oder ein Nomadenstamm kommt ihm vor die Augen. Dann macht der Mann der Zivilisation dem Mann der Einöde eines jener Zeichen universeller Brüderlichkeit, die auf der ganzen Erdoberfläche verstanden werden, und seine künftigen Gastgeber stimmen den Gesang an, mit dem sie Fremde willkommen heißen: »Seht den Fremden, seht den Gesandten des großen Geistes!«
Nach Beendigung des Gesangs trat ein Kind auf den Fremden zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn zu einer Hütte, an deren Schwelle es sagte: »Siehe den Fremden«, worauf der Herr der Hütte antwortete: »Kind, führe den Mann in meine Hütte!« Der Fremde trat an der Hand des Kindes ein und setzte sich, wie bei den Griechen, an das Feuer. Man reichte ihm die Friedenspfeife, er rauchte dreimal, und die Weiber sangen den Gesang des Trostes: »Der Fremde hat wieder eine Mutter und ein Weib gefunden: Die Sonne wird wieder für ihn auf- und untergehen wie ehedem.« Man füllte eine geheiligte Schale mit Ahornsaft; der Fremde trank die Hälfte, bot dann die Schale seinem Wirt, und dieser trank sie vollends aus.
Wollen Sie statt dieser pittoresken Bilder aus dem Leben der Wilden lieber Nacht, Schweigen, Besinnlichkeit, Melancholie?
Der Reisende malt all dies; sehen Sie nur:
»Von meinen Gedanken erhitzt, erhob ich mich und setzte mich in einiger Entfernung auf eine Baumwurzel, die über einen Bach ragte. Es war eine jener amerikanischen Nächte, die kein von Menschenhand geführter Pinsel jemals wiedergeben kann und deren Erinnerung mir immer köstlich war.
Der Mond hatte seinen höchsten Stand am Himmel erreicht; hie und da sah man in großen Abständen Tausende Sterne funkeln. Bald ruhte der Mond auf zusammengeballten Wolken wie auf schneegekrönten Berggipfeln, bald zerstreuten sich die Wolken und zerflossen zu durchsichtigen, wogenden, weißseidenen Schleiern oder verwandelten sich in leichte Schaumflöckchen, unendlich viele Schäfchen, die sich in den blauen Weiten des Firmaments verloren. Ein andermal war das Himmelsgewölbe wie in einen Meeresstrand verwandelt, dessen horizontale Schichten deutlich sichtbar waren, parallel verlaufende Streifen, wie sie Ebbe und Flut in den Sand graben; dann zerriss ein Windstoß den Wolkenschleier, und am ganzen Himmel ballten sich dichte Massen strahlend weißer Watte, so bauschig, dass man ihre Weichheit und Geschmeidigkeit fast zu spüren vermeinte. Der Anblick der irdischen Landschaft war kaum weniger bezaubernd; das blaue, samtige Mondlicht hing still über den Baumwipfeln, drang zwischen die Bäume und sandte Lichtgarben bis in die tiefste Finsternis. Der schmale Bach zu meinen Füßen verschwand immer wieder in Dickichten aus Eichen, Weiden und Magnolien, um auf der nächsten Lichtung wieder zum Vorschein zu kommen, und im Schimmer der nächtlichen Sternbilder glich er einem Band aus Moiré und Lapislazuli, mit Diamantensplittern übersät und schräg mit schwarzen Bändern besetzt. Jenseits des Flusses ruhte das Mondlicht reglos über dem Gras einer weiten Prärie wie eine straff gespannte Leinwand. Vereinzelte Birken auf der Savanne verschmolzen mit dem Boden, wenn der Wind blasse Sandschleier um sie wob, oder hoben sich von dem kreidigen Hintergrund ab, indem sie sich in Dunkelheit hüllten wie Inseln schwebender Schatten in einem unbeweglichen Meer des Lichts. In der Nähe war nichts zu hören als das Fallen einzelner Blätter, ein plötzlicher Windstoß, der seltene und unregelmäßige Ruf des Waldkauzes; in der Ferne jedoch war von Zeit zu Zeit das dumpfe Rauschen des Niagarafalls zu vernehmen, das in der nächtlichen Stille von Einöde zu Einöde getragen wurde, bis es sich in den Weiten der Wälder verlor.
Das Majestätische und melancholisch Erschütternde dieses Anblicks lässt sich in menschlichen Worten nicht fassen, und die schönsten Nächte in Europa geben keinen Begriff davon. Inmitten unserer bestellten Felder sucht die Phantasie sich vergebens zu weiten, denn überall stößt sie auf menschliche Behausungen; in jenen menschenleeren Gefilden hingegen verliert sich die Seele mit Genuss in einem Ozean ewiger Wälder; sie kennt nichts Schöneres, als im Sternenlicht am Ufer riesiger Seen zu wandeln, mit den Wellen zu steigen und zu fallen und sich dieser wilden und erhabenen Natur gleichsam anzuverwandeln und einzuverleiben.«
Zuletzt erreichte der Reisende die Niagarafälle, deren Getöse jeden Morgen von den unzähligen Geräuschen der erwachenden Natur übertönt wird, die jedoch in der Stille der Nacht immer näher zu vernehmen waren, als wollten sie ihn leiten und zu sich führen. Dieser herrliche Wasserfall, den zu sehen Chateaubriand von so weit gekommen war, hätte ihn zweimal hintereinander fast das Leben gekostet. Versuchen wir nicht, es nachzuerzählen, sondern überlassen wir Chateaubriand selbst das Wort:
»Ich hatte den Zügel meines Pferdes um meinen Arm geschlungen, eine Klapperschlange raschelte in dem Gebüsch; das erschreckte Pferd bäumte sich auf und wich zurück, wobei es sich dem Wasserfall näherte. Ich konnte meinen Arm nicht aus den Zügeln befreien; das immer verängstigtere Pferd zog mich hinter sich her. Schon verloren seine Vorderhufe den festen Halt. Mit den Hinterbeinen am Rand des Abgrunds, hielt es sich dort nur noch mit der Kraft seiner Schenkel. Es war um mich geschehen, aber plötzlich schlug das ob der neuen Gefahr selbst erstaunte Tier mit einer Pirouette einen Bogen landeinwärts.«
Damit nicht genug: Aus dieser Gefahr kaum gerettet, begab sich der Reisende sehenden Auges in die nächste gefährliche Situation, doch es scheint Menschen zu geben, die im Innersten spüren, dass sie Gott ungestraft auf die Probe stellen dürfen. Hören wir ihn: »Eine Lianenleiter diente den Wilden, um in das untere Bassin zu steigen; sie war zerrissen. Da ich den Wasserfall von unten sehen wollte, wagte ich mich, entgegen den Einwänden meines Führers, bis zu einem fast steil abfallenden Felsen vor. Trotz des tosenden Wassers, das unter mir brodelte, bewahrte ich meine Kaltblütigkeit und gelangte bis vierzig Fuß über den Abgrund. Dort bot mir der nackte, senkrecht abfallende Fels keinerlei Anhaltspunkte mehr: Mit einer Hand an die letzte Wurzel geklammert, fühlte ich, dass meine Finger unter dem Gewicht meines Körpers zu zittern begannen: Es gibt wohl wenige Menschen, die in ihrem Leben zwei solche Minuten, wie ich sie ertragen musste, durchgemacht haben. Meine ermüdete Hand lockerte sich, und ich fiel. Durch ein unerhörtes Glück fand ich mich auf dem Absatz eines Felsens wieder, wo ich mir tausendmal die Knochen hätte brechen müssen, aber ich schien keine ernste Verletzung davongetragen zu haben. Ich befand mich einen halben Fuß über dem Abgrund, doch ich war nicht hinabgestürzt; als indes die Kälte und die Feuchtigkeit mich langsam durchdrangen, bemerkte ich, dass ich nicht ganz so leichten Kaufes davonkommen sollte; ich hatte mir den linken Arm oberhalb des Ellbogens gebrochen. Mein Führer, der von oben herunterschaute und dem ich Zeichen gab, lief, um Wilde zu Hilfe zu holen. Sie zogen mich mit Stricken über einen Fischotternpfad hoch und brachten mich in ihr Dorf.«
All das ereignete sich zur gleichen Zeit, zu der ein junger Leutnant namens Napoleon Bonaparte fast ertrunken wäre, als er in der Saône badete.
Der Reisende begab sich zu den Seen in Kanada. Als Erstes erreichte er den Eriesee. Vom Ufer aus sah er den schauerlichen Anblick der Indianer, die sich in ihren Kanus aus Baumrinde auf das trügerische Meer wagten, dessen Stürme so unberechenbar sind.
»Zuallererst hängen sie ihre Manitus wie einst die Phönizier ihre Götzenbilder am Hinterteil ihres Kanus auf und geben sich dann inmitten des wirbelnden Schneegestöbers den aufrührerischen Wogen preis. Diese Wogen, ebenso hoch oder noch höher als der Rand des Schiffchens, scheinen sie verschlingen zu wollen. Die Hunde der Jäger, die Vorderpfoten am Rand des Bootes, stoßen ein klägliches Geheul aus, während ihre Herren in tiefem Schweigen die Wellen mit gemessenen Ruderschlägen bekämpfen. Die Kanus bewegen sich eines nach dem anderen vorwärts; im Vorderteil des Ersten steht ein Häuptling, der immer wieder ›Oah‹ ruft. In dem letzten Kanu steht wieder ein Häuptling, welcher ein großes Ruder in Form eines Steuerruders lenkt. Durch den Nebel, den Schnee und die Wogen gewahrt man nichts als die Federn, womit das Haupt dieser Indianer geschmückt ist, die gestreckten Hälse der heulenden Hunde und den Oberkörper der beiden Sachems, des Steuermanns und des Augurs, man könnte sagen: der Götter dieser Gewässer.«
Wenden wir nun den Blick vom See zu seinen Gestaden, vom Wasser zum Ufer. »An der Westseite ist der See auf eine Strecke von mehr als zwanzig Meilen mit breitblättrigen Seerosen bedeckt, und im Sommer sonnt sich eine Menge Schlangen, die eine in die andere verwickelt, auf den Blättern dieser Pflanzen. Wenn sich diese Tiere im Sonnenschein bewegen, sieht man sie im herrlichsten Blau, Rot, Gold und Schwarz schillern, und man unterscheidet an diesen doppelt und dreifach verschlungenen schrecklichen Knoten nichts als funkelnde Augen, dreizackige Pfeile von Zungen, feurige Rachen und mit Stacheln oder Klappern bewehrte Schweife, die sich wie Geißeln in der Luft bewegen. Ein immerwährendes Zischen und ein Geräusch, ähnlich dem Rauschen des dürren Laubes im Wald, lässt sich aus diesem unreinen Kokytos vernehmen.«
Ein Jahr lang irrte unser Reisender umher, stieg Wasserfälle hinunter, überquerte Seen, durchquerte Urwälder und machte in den Ruinen des Staates Ohio nur halt, um sich in den düsteren Abgrund der Vergangenheit zu versenken, folgte dem Lauf von Flüssen, stimmte morgens und abends in den allumfassenden Lobpreis der Natur und ihres Schöpfers ein, träumte sein Versepos der Natchez, vergaß Europa und lebte von Freiheit, Einsamkeit und Poesie.
Und indem er von Wald zu Wald wanderte, von See zu See, von Prärie zu Prärie, hatte er sich, ohne dessen gewahr zu sein, den Grenzen des urbaren Amerikas genähert. Eines Abends erblickt er an einem Bachufer eine Blockhütte; er bittet um Gastfreundschaft, sie wird ihm gewährt.
Die Nacht bricht herein; als einziges Licht im Hause scheint der Feuerschein des Herdes. Der Gast setzt sich an diesen Herd, und während die Frau des Hauses das Abendessen zubereitet, vertreibt er sich die Zeit, indem er eine englische Zeitung liest, die auf dem Boden liegt.
Kaum war sein Blick auf die Zeitung gefallen, als die vier Worte Flight of the King ihn festhielten. Es handelte sich um den Bericht der Flucht Ludwigs XVI. und seiner Festnahme in Varennes. In dieser Zeitung wurde von der Emigration des Adels berichtet und von der Vereinigung der Vornehmen unter den Fahnen der französischen Prinzen. Die Stimme, die bis in die fernste Einsamkeit »Zu den Waffen!« rief, war ihm ein Befehl des Schicksals.
Er kehrte nach Philadelphia zurück, überquerte das Meer, von einem Sturm in achtzehn Tagen an die Küste Frankreichs getrieben, und im Monat Juli des Jahres 1792 betrat er in Le Havre festes Land und rief: »Der König ruft mich, hier bin ich!«
Und im selben Augenblick, als Chateaubriand den Fuß auf ein Schiff setzte, um für seinen König zu kämpfen, lehnte ein junger Artilleriehauptmann müßig an einem Baum auf der Terrasse der Tuilerien neben dem Springbrunnen, betrachtete Ludwig XVI., der sich mit phrygischer Mütze am Fenster zeigte, und murmelte mit verächtlicher Stimme: »Dieser Mann ist des Todes.«
»So brachte das, was mir als Pflicht erschien«, sagt der Dichter, »meine ersten Pläne zum Scheitern und führte die erste jener Schicksalswenden herbei, von denen meine Laufbahn gekennzeichnet ist.
Die Bourbonen waren nicht darauf angewiesen, dass ein bretonischer Edelmann über das Meer zurückkam und ihnen seine bedeutungslose Ergebenheit anbot, so wenig wie sie später, als er aus seinem Schattendasein herausgetreten war, seiner Dienste bedurften. Wenn ich mir mit der Zeitung, die mein Leben änderte, die Pfeife angesteckt und danach meine Reise fortgesetzt hätte, würde niemand meine Abwesenheit bemerkt haben. Mein Leben war damals genauso unbekannt und bedeutungslos wie der Rauch meines Pfeifenkopfes. Ein schlichter Gewissenskonflikt schleuderte mich wieder auf das Welttheater. Es stand ganz in meinem Belieben zu tun, was ich wollte; denn ich war der einzige Zeuge dieses Konflikts; aber unter allen Zeugen gab es keinen, in dessen Augen zu erröten mir peinlicher gewesen wäre.« Chateaubriand brachte Atala und Natchez aus Amerika mit.
38
Chateaubriand
Frankreich hat sich gewaltig verändert, seit der Reisende es verlassen hatte; es gibt viele neue Dinge und vor allem viele neue Männer.
Diese neuen Männer heißen Barnave, Danton, Robespierre. Und es gibt Marat, gewiss, doch er ist kein Mann, kein Mensch, sondern ein wildes Tier. Mirabeau wiederum ist tot.
Unser Reisender lässt es sich nicht verdrießen und unterhält sich mit allen; er sucht all diese Männer auf, die unerschiedlichen Parteien verschrieben, aber ein und demselben Schafott geweiht sind.
Er besucht die Jakobiner, den Club der Aristokraten, der Literaten, der Künstler: Die ehrbaren Leute bilden die Mehrheit, und es gibt sogar vornehme Herren: La Fayette und die beiden Lameth sind Mitglieder des Clubs, Laharpe, Chamfort, Andrieux, Desaine und Chénier vertreten darin die Dichtung, wenn auch die Dichtung ihrer Zeit. Doch letzten Endes kann man von einer Zeit nicht mehr verlangen, als sie geben kann. David, der in der Malerei eine Revolution bewirkt hat, Talma, der auf der Bühne eine Revolution bewirkt hat, lassen fast keine Sitzung aus. An der Tür kontrollieren zwei Wächter die Karten: Der eine ist der Sänger Laïs, der andere ist der natürliche Sohn des Herzogs von Orléans.
Der Mann am Schreibtisch, der Mann in Schwarz, mit seinen eleganten Manieren und seinem düsteren Lächeln, ist der Verfasser der Gefährlichen Liebschaften, der Chevalier de Laclos.
Warum ist Crébillon der Jüngere nicht mehr am Leben? Er wäre dort Vorsitzender oder wenigstens zweiter Vorsitzender.
Ein Mann spricht an der Tribüne, mit schwacher, ein wenig kreischender Stimme, mit magerem, tristem Gesicht, einem etwas langweiligen, ein wenig abgenutzten olivfarbenen Rock, aber mit gepudertem Haar, mit weißer Weste und tadelloser Leibwäsche.
Es ist Robespierre, der Ausdruck der Gesellschaft, der sich mit ihr im Gleichklang bewegt und der an dem Tag, an dem er so unklug sein wird, ihr voranzugehen, in Dantons Blut ausrutschen wird.
Chateaubriand besucht die Cordeliers.
Sonderbares Schicksal dieser Kirche, die ein Club geworden ist!
Der heilige Ludwig, selbst ein Franziskaner, gründete sie nach einem revolutionären Staatsstreich. Ein hoher Baron, der Herr von Courcy, beging ein Verbrechen; der Gerichtsherr von Vincennes erlegte ihm eine Geldbuße auf, und mit diesem Geld wurden Schule und Kirche der Franziskaner errichtet.
An diesem Ort erklang im Jahr 1300 der Streit um das ewige Evangelium. Es wurde die Frage gestellt, die vierhundert Jahre später der Atheismus lösen sollte: »Weilt Jesus Christus nicht mehr unter uns?«
König Johann wird in Poitiers gefangen genommen. Der Adel, dezimiert und geschlagen, wird mit ihm gefangen genommen. Ein Mann bemächtigt sich im Namen des Volkes der königlichen Macht und errichtet im Kloster der Cordeliers oder Franziskaner sein Hauptquartier. Dieser Mann ist Étienne Marcel, der Vorsteher von Paris. »Wenn die Herren sich befehden, werden die braven Leute auf sie losgehen.«
Im Übrigen sind die Franziskanermönche selbst die würdigen Vorläufer jener, die später ihre Kirche einnehmen werden; als Sansculotten des Mittelalters sagten sie lange vor Babeuf: »Besitz ist ein Vergehen« und lange vor Proudhon: »Besitz ist Diebstahl.« Sie waren ihren Worten treu, denn sie ließen sich lieber verbrennen, als ihre Bettlerkleidung abzulegen.
Wenn die Jakobiner die Aristokratie sind, dann sind die Cordeliers das Volk – das umtriebige, tatkräftige, heftige Volk von Paris, das Volk, das aus seinen liebsten Schriftstellern sprach, aus Marat mit seiner Druckerei im Keller der Kapelle, aus Desmoulins, Fréron, Fabre d’Églantine, Anacharsis Cloots, aus den Rednern Danton und Legendre, den zwei Schlächtern, deren einer die Straßen von Paris zu Schlachthöfen machte.
Die Cordeliers sind der Bienenstock; die Bienen wohnen ringsum: Marat fast gegenüber, Desmoulins und Fréron in der Rue de la Vieille Comédie, Danton fünfzig Schritte entfernt, Passage du Commerce, Cloots in der Rue Jacob, Legendre in der Rue des Boucheries-Saint-Germain.
Chateaubriand sah und hörte sie alle: den schnarrenden Desmoulins, den stotternden Marat, den donnernden Danton, den fluchenden Legendre, den gotteslästerlichen Cloots, und sie machten ihm Angst.
Er beschloß, sich im Ausland den Vornehmen anzuschließen, die sich unter den Fahnen der Prinzen gesammelt hatten; zu seinem Unglück stand diesem Vorhaben im Weg, dass er kein Geld hatte.
Madame de Chateaubriand hatte als Mitgift nur Assignaten in die Ehe mitgebracht, und Assignaten besaßen mittlerweile weniger Wert als unbedrucktes Papier, das man wenigstens benutzen konnte, um eine Rechnung oder einen Wechsel auszustellen.
Schließlich fand sich ein Notar, der noch über etwas Geld verfügte und zwölftausend Francs herlieh. Monsieur de Chateaubriand steckte das Geld in eine Brieftasche und die Brieftasche in seine Tasche. Diese zwölftausend Francs waren seine Zukunft und die seines Bruders.
Aber der Mensch denkt, und Satan lenkt. Der künftige Emigrant begegnet einem Freund, erzählt ihm, dass er zwölftausend Francs mit sich führt. Der Freund ist Spieler, die Spielsucht ist ansteckend: Monsieur de Chateaubriand betritt eine Spelunke im Palais-Royal und verspielt zehntausendfünfhundert Francs des ihm anvertrauten Geldes.
Zum Glück gibt ihm das, was ihm den Verstand hätte rauben können, die Vernunft zurück. Der künftige Verfasser des Geistes des Christentums war kein Spieler von Natur aus. Die fünfzehnhundert Francs, die ihm geblieben sind, verwahrt er in seiner Brieftasche, er entflieht dem übel beleumdeten Ort, steigt in eine Droschke, kommt zu Hause an, sucht nach seiner Brieftasche, doch vergebens. Die Brieftasche liegt in der Droschke, Monsieur de Chateaubriand steigt zu eilig aus, die Droschke fährt weiter. Er läuft hinterher. Kinder haben die Droschke mit neuen Fahrgästen vorbeifahren sehen. Ein Dienstmann kennt den Kutscher, weiß, wo er wohnt, und nennt die Adresse.
Monsieur de Chateaubriand wartet vor der Wohnungstür auf den Kutscher, der um zwei Uhr morgens nach Hause kommt. Nach Monsieur de Chateaubriand hat er drei Sansculotten und einen Priester gefahren. Wo die Sansculotten wohnen, weiß er nicht, aber die Adresse des Priesters kennt er.
Es ist drei Uhr morgens, eine Zeit, zu der man einen ehrbaren Bürger nicht aus dem Schlaf reißen kann. Monsieur de Chateaubriand geht nach Hause, zu Tode erschöpft, und schläft.
Später am Tag weckt ihn der Priester, der ihm seine Brieftasche mit den fünfzehnhundert Francs bringt.
Am Tag darauf brechen Monsieur de Chateaubriand und sein älterer Bruder in Begleitung eines Dieners nach Brüssel auf; der Diener ist gekleidet wie sie und wird als Freund ausgegeben.
Der unglückselige Diener hatte drei Fehler: Er war zu ehrerbietig, andererseits zu vertraulich, und drittens träumte er laut. Seine Träume aber waren von kompromittierendster Art. Er wähnte ständig, man wolle ihn verhaften, und stand stets im Begriff, aus der Eilpost zu springen. In der ersten Nacht gelang es den Brüdern mit Mühe und Not, ihn zurückzuhalten; in der zweiten Nacht rissen sie die Tür der Kutsche weit auf, der arme Teufel sprang hinaus und rannte ohne Hut querfeldein davon, immer noch in seinem Traum befangen.
Die beiden Reisenden glaubten sich von ihm befreit, doch ein Jahr später kostete seine Aussage den älteren Bruder Monsieur de Chateaubriands den Kopf.
Die Brüder erreichten Brüssel, damals Treffpunkt der Royalisten. Von Brüssel nach Paris waren es vier bis fünf Tage Fußmarsch, für Pessimisten acht Tage. Die anwesenden Royalisten waren sehr erstaunt, dass die zwei Brüder kamen, statt zu warten. Man rechnete fest darauf, Paris einzunehmen, wozu also die Stadt verlassen? Und für den Neuankömmling gab es keinen Platz, auch nicht in dem Regiment von Navarra, in dem er vormals als Leutnant gedient hatte.
Bretonische Einheiten, vergleichbar den alten fränkischen Einheiten, wollten Thionville belagern. Sie waren weniger stolz als die Herren des Regiments von Navarra, begrüßten ihren Landsmann und nahmen ihn in ihre Reihen auf.
Wie man sieht, war Monsieur de Chateaubriand nicht dazu ausersehen, seinen Weg auf dem Feld der Ehre zu machen. Zum Kavalleriehauptmann befördert, so dass er in die Karossen des Hofes steigen konnte, nach dieser Beförderung wieder zum Unterleutnant geworden, marschierte er nun als einfacher Gefreiter der Belagerung von Thionville entgegen.
Als Monsieur de Chateaubriand Brüssel verließ, begegnete er Monsieur de Montrond, und beide erkannten im anderen den Geistesverwandten. »Woher kommen Sie, Monsieur?«, fragte der Städter den Soldaten. »Vom Niagara, Monsieur.« – »Und Sie gehen nun...?« – »Dorthin, wo man kämpft.« Die beiden verabschiedeten sich voneinander, und jeder ging seiner Wege.
Zehn Meilen weiter begegnet Monsieur de Chateaubriand einem Reiter. »Wohin des Weges?«, fragt ihn der Reiter. »Ich ziehe in den Kampf«, erwidert der Fußgänger. »Wie heißen Sie?« – »Monsieur de Chateaubriand, und Sie?« – »Friedrich Wilhelm.« Der Mann zu Pferde war der König von Preußen. Bevor er weiterritt, sagte er: »Monsieur, die Gesinnung des französischen Adels ist unverkennbar.«
Monsieur de Chateaubriand war aufgebrochen, um Thionville einzunehmen, wie er aufgebrochen war, um die Nordwestpassage zu finden; er hatte die Passage nicht gefunden, und er nahm Thionville nicht ein. Allerdings hatte er sich bei dem ersten Unternehmen den Arm gebrochen, während er beim zweiten durch einen brennenden Balken am Bein verletzt wurde.
Zur gleichen Zeit, zu der Monsieur de Chateaubriand diese Verletzung erlitt, wurde ein junger Bataillonskommandeur namens Napoleon Bonaparte bei der Belagerung Toulons durch einen Bajonettstich in den Oberschenkel verwundet.
Eine Kugel hatte es auf das Leben des royalistischen Freiwilligen abgesehen, doch sie stieß zwischen Bekleidung und Brust auf das Manuskript von Atala, das sie auffing. Als wäre es mit der Verletzung nicht genug, bekam Monsieur de Chateaubriand obendrein die Blattern, und zu diesen beiden Geißeln gesellte sich eine dritte, noch schlimmere: die Niederlage.
In Namur schlich der junge Emigrant durch die Straßen, von Fieberschauern geschüttelt, und eine arme Frau warf ihm eine zerlumpte Decke über die Schultern, die alles war, was sie besaß. Der heilige Martin wurde heiliggesprochen und gab dem Bettler doch nur seinen halben Mantel. Als der Kranke die Stadt verließ, stürzte er in einen Graben.
Die Einheit des Fürsten von Ligne kam vorbei; der Sterbende streckte einen Arm aus. Man sah, dass er noch nicht tot war, hatte Mitleid mit ihm, nahm ihn auf einem Packwagen mit und setzte ihn am Eingang von Brüssel ab. Die Belgier, die sich so gut darauf verstehen, die Vergangenheit zu nutzen, aber vom Himmel noch nicht mit der Fähigkeit begnadet wurden, in der Zukunft zu lesen, die Belgier, die nicht ahnen konnten, dass eines Tages das unerlaubte Nachdrucken der Werke, die dieser junge Mann veröffentlichte, drei, vier dieser Nachdrucker reich machen würde, die Belgier verschlossen dem armen Verwundeten ihre Türen.
Zu Tode ermattet legte er sich vor einer Herberge nieder und wartete. Die Einheit des Fürsten von Ligne war ihm begegnet: Vielleicht würde die Vorsehung ihn auch diesmal nicht im Stich lassen.
Man tut gut daran zu hoffen, selbst im Angesicht des Todes. Die Vorsehung ließ den Sterbenden nicht im Stich, sondern sandte ihm seinen Bruder.
Die beiden erkannten einander auf der Stelle und streckten einander die Arme entgegen. Monsieur de Chateaubriand der Ältere war reich, er trug zwölfhundert Francs bei sich und gab seinem Bruder die Hälfte. Er wollte ihn mitnehmen, doch zum Glück war unser Dichter zu krank, um ihn zu begleiten, und bat stattdessen einen Barbier um Unterkunft. Dort genas er, während sein Bruder nach Frankreich zurückkehrte, wo ihn das Schafott erwartete.
Nach langer Konvaleszenz genesen, brach Monsieur de Chateaubriand nach Jersey auf, von wo aus er nach Großbritannien zu gelangen hoffte. Er war der Emigration überdrüssig und wollte sich den Freischärlern der Vendée anschließen.
Ein kleines Schiff wurde gefunden, und zwanzig Passagiere teilten sich die Reisekosten. Unterwegs kam ein heftiger Sturm auf, die Reisenden mussten sich auf das Zwischendeck begeben, wo zum Ersticken wenig Luft war. Der Frischgenesene konnte sich nicht zur Wehr setzen, als andere Passagiere ihn fast erdrückten. Als man an der Insel Guernesey anhielt, fand man ihn ohnmächtig vor, kaum noch lebendig. Er wurde vom Schiff gebracht und an eine Mauer gesetzt, das Gesicht der Sonne zugekehrt, damit er friedlich seinen letzten Atemzug tun konnte. Die Frau eines Seemanns kam vorbei und holte ihren Mann zu Hilfe. Dieser und einige Matrosen trugen den Sterbenden in ein Haus und legten ihn in ein gutes Bett. Am nächsten Morgen brachte man ihn auf die Slup, die nach Ostende fuhr.
Als er Jersey erreichte, war er im Fieberwahn. Erst im Frühjahr 1793 fühlte der Kranke sich kräftig genug, seine Reise fortzusetzen. Er brach nach England auf in der Hoffnung, sich irgendeiner weißen Fahne anzuschließen. Doch stattdessen machte sich ein Brustleiden bemerkbar, und die Ärzte verschrieben ihm größte Schonung; sie erklärten, dass er, falls er größte Umsicht walten ließ, noch zwei bis drei Jahre zu leben hätte. Die gleiche Voraussage war ehedem Voltaire zuteilgeworden, und es ist nur recht und billig, dass Gott die Ärzte abermals zu Lügnern machte und uns das Leben des Verfassers des Geistes des Christentums erhielt.
Die Ärzte hatten Monsieur de Chateaubriand verboten, zum Gewehr zu greifen; stattdessen griff er zur Feder. Er schrieb seine Essais und verfasste den Entwurf für seinen Geist des Christentums. Und da diese zwei großen und einander so entgegengesetzten Werke ihren Autor nicht vor dem Hungertod gerettet hätten, fertigte er in seiner Freizeit Übersetzungen an, die mit einem Livre pro Seite bezahlt wurden.
Unter solchen Kämpfen verbrachte er die Jahre 1794 und 1795.
Ein anderer Mann kämpfte zu dieser Zeit gegen den Hunger: der junge Bataillonskommandeur, der Toulon eingenommen hatte. Der Vorsitzende des Kriegskomitees, Aubry, hatte ihn des Kommandos über die Artillerie enthoben; er war nach Paris gekommen, wo man ihm das Kommando über eine Brigade in der Vendée angeboten hatte, das er abgelehnt hatte; und während Chateaubriand Übersetzungen anfertigte, machte er sich Notizen über die Möglichkeiten, die Türkei gegen die europäischen Mächte zu unterstützen.
Gegen Anfang September hatte dieser Bataillonskommandant in seiner äußersten Verzweiflung beschlossen, in die Seine zu springen. Er war auf dem Weg zum Fluss, als er kurz vor der Brücke einem Freund begegnete. »Wohin gehst du?«, fragte ihn dieser. »Ich gehe ins Wasser.« – »Warum?« – »Weil ich nicht von der Luft leben kann.« – »Ich habe zwanzigtausend Francs, die kann ich mit dir teilen.« Und der Freund gibt dem jungen Offizier, der nicht ins Wasser geht, zehntausend Francs. Der Offizier begibt sich am 4. Oktober in das Théâtre-Feydeau, wo er erfährt, dass die Nationalgarde der Sektion Lepelletier die Truppen des Konvents unter dem Befehl von General Menou zum Rückzug gezwungen hat und dass ein General gesucht wird, der diese Blamage wettmacht.
Am nächsten Morgen erhielt General Alexandre Dumas um fünf Uhr morgens vom Konvent die Ordre, die Truppen zu befehligen. General Alexandre Dumas befand sich nicht in Paris, und Barras wurde an seiner Stelle zum General ernannt und ersuchte um die Erlaubnis, die er erhielt, den ehemaligen Bataillonskommandanten Bonaparte zu seinem Adjutanten zu machen.
Der 5. Oktober ist der 13. Vendémiaire.
Napoleon befreite sich durch einen Sieg aus der Anonymität, Chateaubriand würde sich durch ein Meisterwerk aus ihr befreien.
Die Geschehnisse des 13. Vendémiaire richteten zweifellos den Blick des Schriftstellers auf den General, und das Erscheinen von Der Geist des Christentums richtete seinerseits den Blick des Generals auf den Dichter.
Bonaparte hatte zuerst Vorbehalte gegen Monsieur de Chateaubriand. Eines Tages wunderte Bourrienne sich in seiner Gegenwart laut darüber, dass ein Mann seines Namens und seiner Verdienste auf keine der Listen gelangte, die Bonaparte sich vorlegen ließ, wenn er Stellungen zu vergeben hatte.
»Bourrienne, Sie sind nicht der Erste, der mir damit kommt«, erwiderte Bonaparte, »aber ich habe Ihren Vorgängern eine Antwort gegeben, die ihnen das Maul gestopft hat. Dieser Mann hat Vorstellungen von Freiheit und Unabhängigkeit, die sich nie und nimmer in mein System einfügen lassen würden. Lieber habe ich in ihm einen offenen Gegner als einen erzwungenen Freund. Außerdem werden wir später sehen. Ich werde ihn zuerst auf einem bescheidenen Posten erproben, und wenn er sich gut aufführt, werde ich ihn befördern.«
Diese Worte lassen keinen Zweifel daran, dass Bonaparte nichts von der wahren Bedeutung Chateaubriands ahnte. Doch bald darauf versah das Erscheinen von Atala den Namen Chateaubriand mit großem Glanz, was der Erste Konsul besorgt verfolgte, denn alles, was die Aufmerksamkeit von ihm ablenkte, weckte seine Eifersucht.
Auf Atala folgte Der Geist des Christentums. Bonaparte fand sich in seinen restaurativen Bestrebungen unversehens unterstützt durch ein Buch, das allerorten auf Begeisterung stieß, ein Buch, dessen unstreitiger Wert die Geister dazu anregte, sich wieder mit religiösen Gedanken zu beschäftigen.
Eines Tages besuchte Madame Baciocchi ihren Bruder und reichte ihm ein schmales Bändchen. »Lesen Sie das, Napoleon«, sagte sie. »Ich bin mir sicher, dass es Ihren Beifall finden wird.« Bonaparte nahm das Buch in die Hand und warf zerstreut einen Blick darauf. Es war Atala. »Schon wieder ein Roman mit A«, sagte er. »Als hätte ich nichts anderes zu tun, als Ihre ganzen Eseleien zu lesen!«
Dennoch nahm er das Buch und legte es auf seinen Schreibtisch.
Als Nächstes bat ihn Madame Baciocchi, den Namen Monsieur de Chateaubriands von der Liste der Emigranten zu streichen. »Aha«, sagte er, »hat Monsieur de Chateaubriand Ihr Atala geschrieben?« – »Ja, Bruder. »- »Sehr gut, ich werde es lesen, wenn ich Zeit dazu finde«, und dann, an seinen Sekretär gewandt: »Bourrienne, schreiben Sie Fouché, er soll den Namen Monsieur de Chateaubriands von der Liste der Emigranten streichen.«
Ich sagte bereits, dass Bonaparte nicht allzu gebildet war und sich nicht sonderlich für die Literatur interessierte; dass er den Namen des Verfassers von Atala nicht kannte, bestätigt dies nur.
Der Erste Konsul las Atala, und das Buch fand sein Gefallen; als einige Zeit darauf Monsieur de Chateaubriand den Geist des Christentums veröffentlichte, war der erste unvorteilhafte Eindruck, den Bonaparte von ihm gehabt hatte, ganz und gar getilgt.
Am Abend der Unterzeichnung des Ehevertrags zwischen Mademoiselle de Sourdis und Hector de Sainte-Hermine waren Bonaparte und Monsieur de Chateaubriand einander zum ersten Mal begegnet. Bonaparte hatte im Verlauf des Abends das Wort an den Dichter zu richten beabsichtigt, doch der Abend fand ein so brüskes und absonderliches Ende, dass Bonaparte in den Tuilerienpalast zurückkehrte, ohne einen weiteren Gedanken an Chateaubriand verschwendet zu haben.
Die zweite Gelegenheit für ein Gespräch war der prunkvolle Empfang, den Monsieur de Talleyrand für die Infanten von Parma ausrichtete, die auf der Durchreise waren, um den Thron von Etrurien zu besteigen.
Lassen wir Monsieur de Chateaubriand selbst berichten, wie er den ersten elektrisierenden Kontakt mit dem Ersten Konsul empfunden hat:
»Ich stand in der Galerie, als Napoleon eintrat. Ich war angenehm überrascht, hatte ich ihn doch bisher immer nur von Weitem gesehen: Sein Lächeln war gewinnend und schön; sein Auge herrlich. Noch war sein Ausdruck frei von aller Scharlatanerie, noch lag nichts Theatralisches und Affektiertes in seinem Blick. Mein Geist des Christentums, das damals viel Aufsehen erregte, hatte auch Napoleon beeindruckt. Eine wunderbare Einbildungskraft belebte den so kalten Politiker. Er wäre ohne den Beistand der Muse nicht geworden, was er wurde; der Verstand führte die Ideen des Poeten aus. Alle großen Männer sind stets aus zwei Naturen gebildet, denn sie müssen sowohl Eingebung als auch Befähigung zum Handeln besitzen: Die Erstere entwickelt den Plan, die Zweite führt ihn durch.
Bonaparte wurde meiner ansichtig und erkannte mich; woran, weiß ich nicht. Als er sich auf mich zubewegte, wusste man nicht, wen er suchte; die Reihen öffneten sich nacheinander, und jeder hoffte, der Konsul würde vor ihm stehen bleiben. Es schien, als sei er etwas ungeduldig über dieses Missverständnis; ich versteckte mich hinter meinen Nachbarn; plötzlich erhob Bonaparte die Stimme und sagte zu mir: ›Monsieur de Chateaubriand. ‹ Ich stand allein vor ihm, denn die Menge trat ein wenig zurück und stellte sich alsbald im Kreis um die beiden Gesprächspartner. Bonaparte begrüßte mich ganz schlicht; ohne mir Komplimente zu machen, ohne müßige Fragen zu stellen, sprach er ganz unvermittelt über Ägypten und über die Araber, als hätte ich zu seinen Vertrauten gehört und als führte er eine bereits begonnene Unterhaltung weiter. ›Ich war immer betroffen‹, sagte er zu mir, ›wenn die Scheiks mitten in der Wüste auf die Knie fielen, sich nach Osten wendeten und mit ihrer Stirn den Sand berührten. Welches unbekannte Wesen beten sie so gen Osten gewendet an?‹
Bonaparte unterbrach sich und nahm ohne jeden Übergang einen anderen Gedanken auf: ›Das Christentum? Haben die Ideologen nicht ein astronomisches System aus ihm machen wollen? Meinen sie, wenn es wirklich so wäre, mich überzeugen zu können, das Christentum sei nichtig? Wenn das Christentum die Allegorie der Bewegung der Welträume ist oder die Geometrie der Sterne, dann können die freien Geister sich anstrengen, wie sie wollen, wider Willen haben sie dem Infamen noch genug Größe gelassen.‹
Und alsbald ging Bonaparte weiter. Da blieb ich wie Hiob in meiner Nacht – ›Und ein Hauch fuhr an mir vorüber; es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht.‹
Meine Erdentage sind nur eine Folge von Visionen gewesen, unablässig haben sich Hölle und Himmel unter meinen Schritten oder über meinem Haupte geöffnet, ohne dass ich Zeit gehabt hätte, deren Finsternis und deren Helligkeit auszuloten. Ein einziges Mal bin ich am Ufer der beiden Welten dem Mann des vorigen und dem Mann des neuen Jahrhunderts begegnet: Alle beide schickten mich wieder in meine Einsamkeit zurück, der Erste mit einem wohlwollenden Wunsch, der Zweite mit einem Verbrechen.
Ich bemerkte, dass Bonaparte, während er sich in der Menge bewegte, mir tiefere Blicke zuwarf als jene, die er auf mich geheftet hielt, während er mit mir gesprochen hatte. Ich verfolgte ihn mit den Augen und dachte mir wie Dante: Chi è quel grande, che non par que curi L’incendio? Wer ist der Riese, der so unbekümmert daliegt, als könnte ihm kein Feuerregen etwas anhaben?«
Diese tiefen Blicke, die Bonaparte Chateaubriand zuwarf, hatten nichts Außergewöhnliches; in diesem Moment standen sich einfach zwei Männer gegenüber, die höchsten Ruhm erlangt hatten: Chateaubriand als Dichter, Bonaparte als Staatsmann.
Man war über so viele Ruinen gegangen, dass es einen danach verlangte, auf einem Denkmal auszuruhen, doch unter all den zerstörten Dingen war die Religion am gründlichsten vernichtet, zertreten, zu Staub zermalmt worden. Man hatte die Glocken eingeschmolzen, die Altäre umgestürzt, die Heiligenstatuen zerschmettert, die Priester erwürgt, man hatte sich falsche Götter ersonnen, unbeständige, vergängliche Götter, die vorbeigezogen waren wie ein Wirbelsturm der Ketzerei, der das Gras unter den Füßen verdorren lässt und die Städte verwüstet. Man hatte die Kirche Saint-Sulpice zum Tempel des Sieges und Notre-Dame zum Tempel der Vernunft erklärt. Es gab nur noch einen wahren Altar, das Schafott, und ein wahres Heiligtum, den Grève-Platz. Selbst große Geister schüttelten verleugnend den Kopf, und nur große Seelen gaben die Hoffnung nicht auf.
In dieser Atmosphäre kam Chateaubriands Geist des Christentums wie die erste Brise sauberer Luft nach einer Epidemie, wie ein Lebenszeichen nach dem Moderhauch des Todes.
War es nicht wahrhaft tröstlich, dass zur gleichen Zeit, als ein ganzes Volk vor den blutbeschmierten Gefängnistoren brüllte, auf der Place de la Révolution eine unermüdlich arbeitende Guillotine umtanzte und rief: »Es gibt keine Religion mehr, es gibt keinen Gott mehr!«, dass zu ebendieser Zeit ein Mann sich ganz dem Zauber einer Nacht in den amerikanischen Urwäldern überließ, auf dem Moos sitzend, den Rücken an einen einzeln stehenden Baumstamm gelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt, den Blick auf den Mond geheftet, dessen Schein auf ihn fiel, als verbände er ihn mit dem Himmel, und die Worte murmelte: »Es gibt einen Gott! Ihm huldigen die Lilien des Tals und die Zedern des Libanons; das Insekt summt seinen Lobgesang, der Elefant begrüßt ihn bei Tagesanbruch, die Vögel besingen ihn im Laub, der Wind murmelt seinen Namen im Wald, der Donner kündet dröhnend von seiner Gegenwart, der Ozean rauscht seine Unendlichkeit!
Der Mensch allein sagt: ›Es gibt keinen Gott!‹
Hat dieser Mensch denn niemals im Unglück den Blick zum Himmel erhoben? Hat sein Blick sich nie in die bestirnten Weiten verirrt, in denen die Welten wie Sandkörner gesät sind? Ich habe gesehen, und das genügt mir. Ich sah die Sonne an der Pforte des Sonnenuntergangs in purpurnen und goldenen Tüchern hängen und den Mond am entgegengesetzten Horizont wie eine silberne Lampe im azurblauen Osten aufsteigen.
Die zwei Gestirne mischten im Zenit ihr Bleiweiß und ihr Karmin; das Meer vervielfachte die östliche Szenerie in diamantenen Girlanden und wiegte den westlichen Prunk in Rosenwogen. Die ruhigen Wellen verliefen sich sanft vor meinen Füßen am Ufer, und die erste Stille der Nacht und das letzte Murmeln des Tages kämpften miteinander an den Hängen, den Flussufern und in den Tälern.
Du, den ich nicht kenne, Du, dessen Name mir so unbekannt ist wie Dein Aufenthalt, Unsichtbarer, Erschaffer unseres Universums, der Du mir den Instinkt verliehen hast, alles zu empfinden, und die Vernunft verweigert hast, alles zu verstehen, solltest Du nur ein Hirngespinst sein, der goldene Traum des Glücklosen? Wird meine Seele sich mit dem Rest meines Staubes auflösen? Ist das Grab ein Abgrund ohne Ausweg oder die Pforte zu einer anderen Welt? Hat die Natur nur aus grausamem Mitleid dem Menschenherzen die Hoffnung auf ein besseres Leben neben dem menschlichen Elend eingegeben?
Verzeihe mir meine Schwäche, Vater der Barmherzigkeit: Nein, ich zweifle nicht an Deiner Existenz, und ob Du mir eine Laufbahn der Unsterblichkeit vorherbestimmt hast oder ich nur vergehen und sterben werde, ich verehre Deine Beschlüsse schweigend, und Dein Insekt verkündet Deine Wahrheit!«
Es lässt sich denken, welche Wirkung eine solche Sprache nach den Verwünschungen eines Diderot, nach den theophilanthropischen Erörterungen eines La Revellière-Lépaux, nach den geifernden und bluttriefenden Tiraden eines Marat zeitigen musste.
So kam es, dass Bonaparte, über den Abgrund der Revolution gebeugt, von dem er den Blick noch nicht zu wenden wagte, den rettenden Engel festzuhalten suchte, der diese Nacht des Nichts mit einem ersten Lichtstrahl durchdrang. Und als er Kardinal Fesch nach Rom entsandte, ordnete er ihm den großen Dichter bei, den Adler anstelle der Taube, der wie diese beauftragt war, dem Heiligen Vater den Ölzweig zu überbringen!
Doch es genügte nicht, Chateaubriand zum Botschaftssekretär zu ernennen, er musste die Ernennung auch annehmen.
39
Die römische Gesandtschaft
Bonaparte zeigte sich von der Unterhaltung mit Monsieur de Chateaubriand entzückt. Monsieur de Chateaubriand wiederum berichtet in seinen Erinnerungen, Bonapartes Fragen seien einander so rasch gefolgt, dass er keine Zeit fand, ihm zu antworten.
Das waren Gespräche, wie Bonaparte sie liebte: solche, die er allein bestritt. Es kümmerte ihn wenig, ob Monsieur de Chateaubriand diplomatische Erfahrung hatte oder nicht; mit einem Blick hatte er entschieden, wo und wie dieser Mann ihm nützlich sein würde, und er war der festen Überzeugung, dass ein Geist wie dieser alles wusste und nichts zu lernen brauchte.
Bonaparte war weiß Gott ein großer Entdecker von Menschen, allerdings mit der Eigenheit, dass er von ihren Fähigkeiten völlige Unterordnung unter seinen Willen verlangte, ununterbrochen der Geist sein wollte, der die Massen antrieb. Die Mücke, die ohne Bonapartes Genehmigung ihr Mückenliebchen umschwirrte, war eine rebellische Mücke.
Chateaubriand, den die Vorstellung marterte, jemand zu sein, jemand Bedeutendes, wäre nie auf den Gedanken gekommen, er könnte nur eine Sache sein. Er lehnte ab.
Abbé Émery erfuhr davon. Abbé Émery war Vorsteher des Priesterseminars von Saint-Sulpice, und Bonaparte schätzte ihn. Der Abbé flehte Chateaubriand an, der Sache der Religion einen Gefallen zu erweisen und die Stelle des Ersten Botschaftssekretärs anzunehmen, die Bonaparte ihm anbot.
Zuerst wollte Chateaubriand davon nichts hören, doch der Abbé blieb hartnäckig, und zuletzt lenkte der Dichter ein.
Chateaubriand traf seine Reisevorbereitungen und machte sich auf den Weg, denn als Botschaftssekretär musste er vor dem Botschafter in Rom eintreffen.
Für gewöhnlich beginnt der Reisende seine Reisen mit dem Besuch antiker Städte, den Ahnen unserer Zivilisation. Chateaubriand hatte mit den alten Urwäldern Amerikas begonnen, dem Schauplatz künftiger Zivilisationen.
Überaus pittoresk liest sich der Bericht dieser Reise nach Rom, verfasst in dem unnachahmlichen Stil Chateaubriands – einem gleichermaßen so erhabenen und eigenartigen Stil, dass eine Schule ihm nacheiferte, die uns Monsieur d’Arlincourt bescherte, dessen unsinnige Romane mit den Titeln Solitaire und Ipsiboé für kurze Zeit ganz Frankreich begeisterten, doch was Chateaubriands Einzigartigkeit ausmacht und worin seine Nacheiferer so kläglich scheitern, das ist die Mischung aus Schlichtheit und Größe, die bei ihm so natürlich und bei jenen so gestelzt anmutet.
Seine Fahrt durch die lombardische Ebene ist ein Beispiel dieses unvergleichlichen Stils; er malt uns das Bild unserer Soldaten in der Fremde und zeigt, warum man uns überall, wo wir hinkommen, liebt und verabscheut.
»Die französische Armee richtete sich in der Lombardie wie eine militärische Kolonie ein. Die Fremdlinge aus Gallien und ihre wachhabenden Kameraden mit ihren Polizeimützen wirkten wie eifrige und fröhliche Schnitter, die statt der Sichel einen Säbel umhängen hatten. Sie versetzten Steine, schleppten Kanonen, fuhren Karren, errichteten Unterstände und Laubhütten. Pferde tummelten sich, bäumten sich auf, tänzelten in der Menge wie Hunde, die ihren Herrn umspringen. Auf dem Markt dieser närrischen Armee verkauften die Italienerinnen Früchte aus ihren flachen Körben; unsere Soldaten schenkten ihnen ihre Pfeifen und ihre Feuerzeuge und sagten zu ihnen, was ihre Vorfahren, die alten Barbaren, zu ihren Geliebten gesagt hatten: ›Ich, Fotrad, Sohn des Eupert aus dem Geschlecht der Franken, schenke dir, Helgine, meinem geliebten Eheweib, zu Ehren deiner Schönheit meine Behausung im Viertel der Tannen. ‹
Wir sind eigenartige Gegner: Zuerst findet man uns ein wenig dreist, ein wenig zu munter, zu mutwillig; und kaum haben wir den Staub von unseren Füßen geschüttelt, weint man uns nach. Der französische Soldat ist lebhaft, geistreich, intelligent und legt bei allen Verrichtungen seiner Logiergeber Hand an; er holt Wasser am Brunnen, ganz wie Moses für die Töchter des Priesters in Midian, er verjagt die Hirten und tränkt die Schafe, er hackt Holz, macht Feuer, wacht über den Kochtopf, trägt das Kleinkind in den Armen oder schaukelt es in der Wiege. Seine gute Laune und seine Umtriebigkeit erfüllen alles mit Leben, und nach und nach hält man ihn für einen familieneigenen Rekruten. Wird die Trommel gerührt? Der Besatzungssoldat eilt zu seiner Muskete, lässt die Töchter des Hauses weinend auf der Türschwelle zurück und verlässt das Bauernhaus, an das er erst wieder denken wird, wenn er im Invalidenheim weilt.
Als ich Mailand durchreiste, war ein großes Volk erwacht und öffnete kurz die Augen. Italien schüttelte den Schlaf ab und entsann sich seines Genius wie eines göttlichen Traumes; als nützlicher Verbündeter unseres wiedererstehenden Landes versah dieses Ausonien die Schäbigkeit unserer Armut mit dem Glanz transalpiner Mentalität, der sich den Kunstwerken und erhabenen Erinnerungen eines so berühmten Ursprungslandes verdankte. Dann kam Österreich; es deckte seinen bleiernen Mantel über Italien und zwang die Italiener in den Sarg zurück. Rom ist in seine Ruinen zurückgekehrt, Venedig in sein Meer. Im Sterben verschönerte Venedig den Himmel mit einem letzten Lächeln, bevor es betörend in den Fluten versank wie ein Gestirn, das nie wieder aufgehen wird.«
Am Abend des 27. Juni traf Chateaubriand in Rom ein; am nächsten Tag war Sankt Peter, einer der vier höchsten Feiertage der Ewigen Stadt.
Am 28. durchstreifte er den ganzen Tag die Stadt; wie jeder Neuankömmling warf er einen ersten Blick auf das Kolosseum, das Pantheon, die Trajanssäule und die Engelsburg. Abends nahm Monsieur Artaud, sein Amtsvorgänger, ihn zu einer Gesellschaft in ein Gebäude in der Nähe des Petersplatzes mit; dort sahen sie zwischen den wirbelnden Walzern, die vor den offenen Fenstern einhertanzten, die Feuergirlande der Kuppel Michelangelos, während die Leuchtraketen des Feuerwerks an der Hadrianmole sich über Sant’ Onofrio und über Tassos Grab entfalteten.
Stille, Andacht und Dunkelheit herrschten in der Campagna.
Am nächsten Tag besuchte Chateaubriand den Gottesdienst im Petersdom, bei dem Papst Pius VII. die Messe feierte. Zwei Tage später wurde er Seiner Heiligkeit vorgestellt; der Papst hieß ihn sich neben ihn setzen, was eine seltene Ehre war, denn bei der päpstlichen Audienz pflegen die Besucher zu stehen. Allerdings lag ein geöffneter Band des Geistes des Christentums auf dem Tisch.
Mit Vergnügen entdecken wir in dem großen Geist Chateaubriands mitten unter all den herrlichen Wendungen, die unsere Phantasie ansprechen, die unscheinbaren und alltäglichen Details, deren sich jedermann entsinnt.
Kardinal Fesch hatte nahe dem Tiber den Palazzo Lancelotti gemietet, und man hatte dem jungen Botschaftssekretär das oberste Stockwerk des Palazzos zugewiesen. Als er es betrat, sprangen ihm so viele Flöhe an den Beinen hoch, dass seine weiße Hose schwarz aussah. Er ließ dieses diplomatische Kabinett reinigen, richtete sich darin ein und begann, Pässe auszustellen und sich ähnlich wichtigen Aufgaben zu widmen.
Im Unterschied zu mir, dem meine ordentliche Handschrift eine zuverlässige Stütze ist, war Chateaubriands Handschrift der Entfaltung seiner Fähigkeiten eher hinderlich. Kardinal Fesch verdrehte die Augen, als er seine Unterschrift zu sehen bekam, und da der Kardinal weder Atala noch den Geist des Christentums gelesen hatte, fragte er sich, was jemand, dessen Name die ganze Breite eines Blatts Papier einnahm, Vernünftiges schreiben können sollte.
Da es in der hohen Position eines Botschaftssekretärs, von der Übelgesinnte gemunkelt hatten, sie werde seine Intelligenz überfordern, so gut wie nichts zu tun gab, vertrieb er sich die Zeit damit, aus seinem Mansardenfenster über den Dächern zu einem Nachbarhaus zu schauen, in dem ihm Wäscherinnen zuwinkten und eine zukünftige Sängerin ihn mit ihren unablässigen Solfeggien verfolgte. Wenn ein Trauerzug zu seiner Unterhaltung unten vorbeiging, fühlte er sich glücklich, weil der Tod ihn an die unsterbliche Poesie von Himmel und Erde erinnerte. Und von seinem Fenster aus sah er in der Straßenschlucht den Leichenzug einer jungen Mutter, die mit enthülltem Gesicht zwischen zwei Reihen Büßermönchen getragen wurde, ihr ebenfalls verstorbenes blumenbekränztes Neugeborenes zu ihren Füßen.
In den ersten Tagen seines Aufenthalts beging Chateaubriand einen großen Fehler. Der ehemalige König von Sardinien, den Bonaparte abgesetzt hatte, weilte in Rom; Chateaubriand machte ihm seine Aufwartung, denn große Herzen haben eine natürliche Affinität zu allem Gestürzten. Dieser Besuch hatte die Wirkung eines diplomatischen Sturms, der über den Palazzo der Botschaft hereinbrach. Alle Diplomaten wandten sich beim Anblick des Sekretärs ab, zeigten ihm die kalte Schulter und murmelten untereinander: »Das ist sein Ende!«
»Da war kein diplomatischer Gimpel«, schreibt Chateaubriand, »der sich auf der Höhe seiner grenzenlosen Dummheit mir nicht überlegen wähnte. Man hoffte wohl, dass ich nun stürzen würde, obwohl ich nichts war und auch nichts weiter galt, gleichviel, Hauptsache, dass jemand zu Fall kommt, das macht immer Vergnügen. In meiner Einfalt ahnte ich nichts von meinem Vergehen. Die Könige, denen ich, wie man meinte, eine so große Wichtigkeit beimaß, hatten in meinen Augen nur die ihres Unglücks. Man berichtete von Rom nach Paris über meine erschreckenden Torheiten. Glücklicherweise hatte ich mit Bonaparte zu tun; und was mich zugrunde richten sollte, errettete mich.«
Chateaubriand langweilte sich schier zu Tode. Die Tätigkeit, der man seine Verdienste und seine Intelligenz nicht gewachsen gewähnt hatte, bestand darin, Federn zuzuschneiden und Briefe zu versenden. In den Auseinandersetzungen, die sich anbahnten, hätte man ihn sinnvoll beschäftigen können, doch man weihte ihn in keines der diplomatischen Mysterien ein. Er begnügte sich klaglos mit den Streitfällen der Kanzlei, doch es muss gesagt werden, dass man den größten Denker seiner Zeit für Arbeiten einsetzte, die der erstbeste Schreiber ebenso gut verrichtet hätte.
Eine der wichtigsten Aufgaben, mit denen man ihn betraute, bestand darin, der Fürstin Borghese eine Kiste mit Schuhen aus Paris zu überbringen. Die Fürstin probierte mit vollendeter Anmut fünf oder sechs Paar in seiner Anwesenheit als Zeichen des Danks; diese eleganten Schuhe sollten an ihren Füßen den alten Erdboden der Söhne der Wölfin nur kurze Zeit berühren.
Chateaubriand hatte bereits beschlossen, den diplomatischen Dienst an den Nagel zu hängen, eine Laufbahn, bei der sich zu der Geistlosigkeit der Beschäftigung persönliche politische Händel gesellten, als ein persönliches Unglück ihm zu der Langeweile des Geistes den Kummer des Herzens brachte. Bei seiner Rückkehr aus dem Exil hatte ihn eine Madame de Beaumont aufgenommen, die Tochter des Grafen von Montmorin, des seinerzeitigen französischen Gesandten in Madrid, Kommandant der Bretagne und Minister für Auswärtige Angelegenheiten unter Ludwig XVI., der den Grafen sehr schätzte und dem dieser samt eines Teils seiner Familie auf das Schafott folgte.
Die Porträts, die Chateaubriand zeichnet, sind so poetisch, dass man, wenn man über ihn spricht, immer wieder versucht ist, seine Worte dem Leser zu zitieren, in der Überzeugung, dass auch er bewundern wird, was man selbst bewundert hat. Sehen Sie nun das Porträt der Freundin, die Sie nicht kennen, nicht einmal dem Namen nach, und die vor Ihnen erscheinen wird, als höbe der Zauberstab der Wahrsagerin von Endor den Schleier von ihrem Gesicht.
»Madame de Beaumont, deren Antlitz eher hässlich als schön war, ähnelte sehr dem Porträt, das Madame Lebrun von ihr malte. Ihr Gesicht war abgezehrt und bleich. Die mandelförmig geschnittenen Augen wären vielleicht zu glänzend gewesen, hätte nicht eine außerordentliche Liebenswürdigkeit den Blick halb gesänftigt, indem sie ihn schmachtend machte, so wie ein Lichtstrahl sich sänftigt, wenn er durch kristallklares Wasser hindurchgeht. Ihr Charakter war von Strenge und Unnachgiebigkeit gekennzeichnet, was der Heftigkeit ihrer Gefühle und ihrem Leiden geschuldet war. Sie war eine edle Seele und ein großer Geist und für die Welt bestimmt, aus der sie sich willentlich und aus Not zurückgezogen hatte; doch wenn eine Freundesstimme die einsame Intelligenz aus ihrem Versteck rief, kam sie und sagte Worte, die vom Himmel hätten kommen können.«
Die Ärzte empfahlen Madame de Beaumont die Luft des Südens, und Chateaubriands Anwesenheit in Rom bewegte sie dazu, sich dorthin zu begeben. In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft besserte ihr Zustand sich merklich. Monsieur de Chateaubriand fuhr im Wagen mit ihr aus und zeigte ihr die ganze prachtvolle Ewige Stadt; doch um zu sehen, zu lieben und zu bewundern, muss man leben. Die Kranke fand an nichts mehr Gefallen. Eines Tages besuchte er mit ihr das Kolosseum. Es war einer jener Oktobertage, wie man sie nur in Rom erlebt. Die Leidende setzte sich auf einen Stein vor einem der Altäre an der Innenmauer des Gebäudes; sie hob den Blick und ließ ihn langsam über das Gemäuer schweifen, das selbst seit so vielen Jahren tot war und so viele Menschen und Dinge hatten sterben sehen. Brombeerranken und herbstlich gelbe Akelei schmückten die von der Herbstsonne vergoldeten Ruinen; dann wandte die Sterbende ihren Blick vom Sonnenlicht ab, richtete ihn an den Sitzreihen entlang hinunter bis zur Arena, wo er auf dem Kreuz des Altars verharrte, und sagte: »Gehen wir, mir ist kalt!«
Monsieur de Chateaubriand brachte sie in ihre Wohnung; sie legte sich zu Bett und zur letzten Ruhe.
Der Dichter schildert den Tod Madame de Beaumonts mit den Worten: »Sie bat mich, das Fenster zu öffnen, weil sie sich beklemmt fühlte. Ein Sonnenstrahl fiel auf ihr Bett und schien sie zu erquicken. Sie erinnerte sich nun an die Pläne zu einem gemeinsamen Landaufenthalt, über die wir uns manchmal unterhalten hatten, und sie begann zu weinen.
Zwischen zwei und drei Uhr nachmittags bat Madame de Beaumont ihre alte spanische Kinderfrau, Madame Saint-Germain, die ihr mit größter Anhänglichkeit diente, sie möge sie umbetten; der Arzt widersetzte sich dem, aus Furcht, dass Madame de Beaumont während dieser Umbettung stürbe. Dann sagte sie zu mir, sie spüre das Herannahen der Agonie. Plötzlich warf sie die Bettdecke weg, hielt mir die Hand hin, presste die meine in einem Krampf, ihre Augen verdrehten sich. Mit der freien Hand machte sie irgendjemandem, den sie am Fuß ihres Bettes sah, ein Zeichen, dann sagte sie mit auf ihre Brust gelegter Hand: ›Da ist es!‹
Erschreckt fragte ich sie, ob sie mich erkenne: Inmitten ihrer Verwirrung leuchtete ein leises Lächeln auf, sie bejahte es mir durch ein leichtes Neigen des Kopfes; ihre Sprache war schon nicht mehr in dieser Welt. Die Zuckungen währten nur wenige Minuten. Wir hielten sie in unseren Armen, ich, der Arzt und die Krankenwärterin: Eine meiner Hände lag auf ihrem Herzen, das mit der Geschwindigkeit eines überdrehten Uhrwerks gegen ihre zarten Knochen hämmerte.
Plötzlich spürte ich, wie es stillstand. Wir betteten die zur Ruhe gekommene Frau auf ihr Kissen; ihr Kopf sank zur Seite. Einige ihrer aufgelösten Locken fielen ihr in die Stirn; ihre Augen waren geschlossen, die ewige Nacht hatte sich herabgesenkt. Der Arzt hielt einen Spiegel und eine brennende Kerze an den Mund der Fremden. Der Spiegel wurde vom Atem des Lebens nicht getrübt, und das Licht blieb unbeweglich. Alles war zu Ende.«
Ich werde Dich immer lieben, besagt die griechische Grabinschrift auf dem Grabmal Madame de Beaumonts, doch Du im Totenreich trinke, ich bitte Dich, nicht von den Wassern der Lethe, die Dich die Menschen, die Du geliebt hast, vergessen machen würden.
Einige Zeit darauf erhielt Monsieur de Chateaubriand die Nachricht, der Erste Konsul habe ihn zum Gesandten in der neu gegründeten Republik Wallis ernannt. Bonaparte hatte begriffen, dass der Verfasser des Geistes des Christentums zu jenen Menschen zählte, die nur in herausragender Position zu etwas nütze sind und die man nicht mit anderen zusammenspannen darf.
Chateaubriand kehrte nach Paris zurück; und dankbar, dass Bonaparte seine Verdienste gewürdigt hatte, widmete er ihm die zweite Auflage des Geistes des Christentums. Diese Widmung habe ich vor mir, und ich schreibe sie ab, denn die Ausgabe, die sie enthält, scheint mittlerweile recht selten geworden zu sein:
An den Ersten Konsul, General Bonaparte.
General,
Sie waren so gnädig, diese zweite Auflage des Geistes des Christentums mit Ihrem Wohlwollen zu bedenken. Es ist dies eine neuerliche Bezeigung der Gunst, die Sie der edlen Sache erweisen, die im Schutz Ihrer Macht triumphiert. In Ihrem Geschick ist das Walten der Vorsehung nicht zu leugnen, der Vorsehung, die Sie von Anfang an zur Erfüllung ihrer großen Ziele ausersehen hatte. Die Völker blicken auf Sie, und das durch Ihre Siege gemehrte Frankreich setzt all seine Hoffnung in Sie, seit Sie die Religion zur Grundlage des Staates und Ihres Gedeihens gemacht haben.
Reichen Sie auch weiterhin den dreißig Millionen Christen die Hand, die an den Altären, die Sie ihnen zurückgaben, für Sie beten.
Mit tiefster Hochachtung verbleibe ich, General,
Ihr ergebenster und gehorsamster Diener
CHATEAUBRIAND
So waren die Beziehungen beschaffen, die zwischen dem Ersten Konsul und dem Dichter bestanden, als Bonaparte die Abschiedsaudienz für Monsieur de Chateaubriand, den er zum Minister im Wallis ernannt hatte, um zwei Stunden verschob, weil er sich über den Herzog von Enghien beraten wollte.
40
Der Entschluss
Bevor wir diese lange Abschweifung über den Verfasser des Geistes des Christentums eröffneten, erwähnten wir, dass Bonaparte angeordnet hatte, man möge ihn nicht stören. Diese Anordnung bedeutete, dass er sich in seinen Zorn so heftig hineinsteigern wollte, wie es das Thermometer der Leidenschaft nur erlaubte. Im Unterschied zu anderen, die sich beruhigen, wenn sie mit sich allein sind, die das Nachdenken besänftigt, überhitzte sich in solchen Momenten seine Phantasie in ihrer Reizbarkeit, ein Sturm braute sich in seinem Inneren zusammen, und wenn dieser Sturm losbrach, musste der Blitz ein Opfer treffen.
Er speiste allein, und als Monsieur Réal abends zur Arbeit mit einem Bericht erschien, der demjenigen glich, den der Erste Konsul morgens erhalten hatte, der aber in dem Staatsrat völlig andere Überlegungen ausgelöst hatte, fand er den Ersten Konsul über einen Tisch gebeugt vor, auf dem große Landkarten entrollt lagen.
Bonaparte studierte die Entfernung vom Rhein nach Ettenheim, maß sie, rechnete die Wegstunden aus. Während er damit beschäftigt war, trat Monsieur Réal ein.
Bonaparte blickte auf, stützte sich mit einer Faust auf den Tisch und begrüßte den Staatsrat mit den Worten: »So, so, Monsieur Réal, Sie sind für meine Polizei zuständig, Sie sehen mich jeden Tag, und Sie vergessen, mir zu sagen, dass der Herzog von Enghien sich vier Wegstunden von meiner Grenze entfernt aufhält, wo er militärische Verschwörungen anzettelt!«
»In der Tat«, erwiderte Réal ungerührt, »komme ich, um mit Ihnen über all das zu sprechen. Der Herzog von Enghien hält sich keineswegs vier Wegstunden von Ihrer Grenze entfernt auf, sondern in Ettenheim, das er nicht verlassen hat und das zwölf Wegstunden von der Grenze entfernt ist.«
»Und wenn schon!«, versetzte Bonaparte. »War Georges etwa nicht sechzig Meilen weit weg? Und Pichegru achtzig? Und wo war Moreau? Der war wohl keine vier Wegstunden weit entfernt, wie? Er weilte in der Rue d’Anjou-Saint-Honoré, in vierhundert Schritt Entfernung zum Tuilerienpalast; er musste nur mit den Fingern schnipsen, und seine zwei Komplizen waren in seiner Nähe in Paris... Angenommen, sein Vorhaben wäre ihm geglückt: Ein Bourbone wäre in der Hauptstadt und träte meine Nachfolge an. Das wäre ja noch schöner! Ich bin wohl ein Hund, den man auf der Straße totschlagen kann, während meinen Mördern kein Haar gekrümmt werden darf!«
In diesem Augenblick trat Monsieur de Talleyrand in Begleitung des Zweiten und des Dritten Konsuls ein.
Bonaparte stellte sich vor den Außenminister und fuhr ihn an: »Was macht eigentlich Ihr Minister Massias in Karlsruhe, während die bewaffneten Einheiten meiner Feinde in Ettenheim zusammengezogen werden?«
»Davon ist mir nichts bekannt«, sagte Monsieur de Talleyrand, »und Massias hat mir diesbezüglich nichts gemeldet«, fügte er mit seiner gewohnten Gelassenheit hinzu.
Diese Art zu antworten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, brachte Bonaparte noch mehr auf. »Glücklicherweise genügen die Auskünfte, die ich besitze«, sagte er. »Ich werde ihre Komplotte bestrafen; der Schuldige wird mit dem Leben dafür bezahlen.« Dabei ging er mit großen Schritten im Salon auf und ab, wie es seine Art war.
Cambacérès, der Zweite Konsul, versuchte, mit ihm Schritt zu halten, doch bei den Worten »der Schuldige wird mit dem Leben dafür bezahlen« blieb er stehen. »Ich erlaube mir die Hoffnung«, sagte er, »dass Ihre Strenge nicht so weit reichte, befände sich eine solche Person in Ihrer Macht.«
»Was reden Sie da, Monsieur?«, herrschte Bonaparte ihn an und maß ihn von oben bis unten. »Merken Sie sich, dass ich denen gegenüber, die mir mit Meuchelmördern nachstellen, keine Milde walten lassen werde; in dieser Sache werde ich so handeln, wie meine Eingebung es mir sagt, und ich werde auf keine Ratschläge hören, schon gar nicht auf welche von Ihnen, Monsieur, die Sie mir seit dem Tag, an dem Sie für den Tod Ludwigs XVI. stimmten, mit dem Blut der Bourbonen recht sparsam geworden zu sein scheinen. Wenn ich die Gesetze des Landes gegen die Vergehen des Schuldigen nicht auf meiner Seite habe, dann habe ich die Rechte des Naturrechts für mich, das Recht der legitimen Verteidigung.
Dieser Herzog und die Seinen haben nichts anderes im Sinn, als mir das Leben zu nehmen. Von allen Seiten wird mir aufgelauert, sei es mit dem Dolch, sei es mit Feuerwaffen; Luftgewehre werden gebastelt, Höllenmaschinen werden gebaut, Komplotte, wohin ich den Blick wende, Fallstricke, so viel das Herz begehrt! Tag für Tag will man mir ans Leben! Keine Macht, kein Gericht auf Erden können mich davor schützen, und da sollte ich nicht das Recht haben, Krieg mit Krieg zu erwidern! Wo ist der Mann, der es wagen wollte, mich kaltblütig – von Vernunft und Gerechtigkeitssinn ganz zu schweigen – zu verurteilen? Welche Seite müsste er der Schuld, der Abscheulichkeit, des Verbrechens bezichtigen? Blut verlangt Blut, das ist die natürliche, unausweichliche, unvermeidliche Konsequenz; wehe dem, der sie provoziert!
Wer sich darauf versteift, Unruhen zu schüren und politische Umwälzungen zu betreiben, läuft Gefahr, ihnen zum Opfer zu fallen! Nur ein Esel oder ein Wahnsinniger könnte allen Ernstes auf die Idee kommen, dass eine Familie das befremdliche Vorrecht besäße, meine Existenz unablässig anzugreifen, ohne mir das Recht einzuräumen, ihr dies heimzuzahlen. Woher nähme sie den Anspruch, oberhalb der Gesetze zu stehen, wenn es darum geht, einen anderen zu vernichten und sich dann zum eigenen Schutz auf die Gesetze zu berufen? O nein, die Voraussetzungen müssen die gleichen sein.
Ich habe persönlich keinem einzigen Bourbonen jemals etwas zuleide getan. Eine große Nation hat mich an ihre Spitze gesetzt; Europa hat dieser Wahl fast einhellig zugestimmt; mein Blut ist schließlich kein Straßenkot, und es ist höchste Zeit, dass ich es dem ihren gleichstelle. Was wäre denn gewesen, wenn ich sie mit Repressalien bedrängt hätte? Die Macht dazu hatte ich! Mehr als einmal lagen ihre Geschicke in meiner Hand. Zehnmal wurden mir ihre Köpfe angeboten, und zehnmal habe ich dieses Angebot mit Abscheu zurückgewiesen. Nicht dass ich es ungerecht gefunden hätte angesichts der Lage, in die sie mich bringen, doch ich wähnte mich so mächtig und so wenig in Gefahr, dass ich es für niedrige und schäbige Feigheit gehalten hätte, dergleichen anzunehmen. Mein Leitspruch in der Politik wie im Krieg war stets, dass alles Schlechte, und wäre es noch so gerechtfertigt, nur dann entschuldbar ist, wenn es unumgänglich ist; alles, was darüber hinausgeht, ist ein Verbrechen.«
Fouché hatte bislang geschwiegen. Bonaparte drehte sich zu ihm um, denn er wusste, dass dieser ihn unterstützen würde.
Als Antwort auf die stumme Frage des Ersten Konsuls sagte Fouché zu Monsieur Réal: »Könnten der Herr Staatsrat uns zum Zwecke der Aufklärung das Verhörungsprotokoll eines gewissen Le Ridant zeigen, der zur gleichen Zeit wie Georges verhaftet wurde? Möglicherweise wissen Herr Staatsrat noch nichts von der Existenz dieses Protokolls, denn es wurde Ihnen erst vor zwei Stunden von Monsieur Dubois überreicht, und in diesen zwei Stunden haben Sie vor Arbeit vielleicht noch nicht die Zeit gefunden, es zu lesen.«
Réal spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. In der Tat hatte er Unterlagen erhalten, deren Wichtigkeit ihm ans Herz gelegt worden war, doch er hatte sie in Georges’ Dossier gelegt, ohne sie zu lesen, und sich vorgenommen, dies nachzuholen, sobald er eine freie Minute hatte. Diese freie Minute hatte er nicht gehabt; er wusste von der Existenz des Protokolls, ohne zu wissen, was es enthielt.
Wortlos öffnete er sein Portefeuille und begann, zwischen den Papieren darin zu suchen. Fouché blickte ihm über die Schulter, deutete mit dem Finger auf einen Bogen und sagte: »Das ist es.«
Bonaparte betrachtete mit unverhohlenem Erstaunen den Mann, der besser als die anderen mit dem Inhalt ihrer Portefeuilles vertraut war.
Das Protokoll enthielt die gravierendsten Aussagen. Le Ridant gestand eine Verschwörung, behauptete, ein Prinz stehe an der Spitze des Komplotts, sei bereits in Paris gewesen und werde aller Wahrscheinlichkeit nach wiederkommen. Außerdem habe er bei Georges einen jungen Mann von zweiunddreißig Jahren gesehen, wohlerzogen, elegant gekleidet, Gegenstand allgemeiner Ehrerbietung, vor dem jedermann, sogar Pichegru, den Hut gezogen habe.
Bonaparte gebot Réal innezuhalten. »Genug, meine Herren, genug!«, sagte er. »Es steht außer Frage, dass der junge Mann, dem die Verschwörer so viel Ehrerbietung bezeigen, keiner der Prinzen aus London sein kann, denn die Klippe von Biville wurde einen ganzen Monat lang von Savary bewacht. Es kann sich nur um den Herzog von Enghien handeln, der in achtundvierzig Stunden von Ettenheim nach Paris kam und im gleichen Zeitraum von Paris nach Ettenheim zurückkehrte, nachdem er sich kurz mit seinen Komplizen beraten hatte. Das gesamte Vorhaben wird unstreitig immer klarer«, fuhr er fort. »Der Graf von Artois sollte mit Pichegru über die Normandie kommen, der Herzog von Enghien mit Dumouriez aus dem Elsass. Als Vorhut für ihre Rückkehr nach Frankreich wollten die Bourbonen zwei der berühmtesten Generäle der Republik einsetzen. Man rufe die Obersten Ordener und Caulaincourt.«
Begreiflicherweise wagte niemand mehr, sich den Plänen des Ersten Konsuls unmittelbar oder auch nur indirekt zu widersetzen, nachdem er seine Meinung so unumwunden ausgesprochen hatte.
Konsul Lebrun erhob einige unbestimmte Einwendungen, denn er fürchtete die Reaktionen, die Bonapartes Durchgreifen in Europa hervorrufen musste. Cambacérès appellierte abermals an die Großmut des Ersten Konsuls und bat um Milde, obwohl Bonaparte ihm so hässlich über den Mund gefahren war, doch dieser erwiderte lediglich: »Lassen Sie es gut sein, ich weiß, was Sie so sprechen macht, es ist Ihre Ergebenheit, und dafür danke ich Ihnen; aber ich werde mich nicht ermorden lassen, ohne mich zu wehren; ich werde all diese Leute das Zittern lehren und ihnen beibringen, Ruhe zu geben.«
Das Gefühl, das in diesem Augenblick in Bonapartes Geist vorherrschte, war weder Besorgnis noch Rachsucht, sondern die Entschlossenheit, ganz Frankreich zu zeigen, dass das Blut der Bourbonen, das ihren Parteigängern heilig war, für ihn nicht heiliger war als das jeder anderen Persönlichkeit der Republik.
»Aber«, fragte Cambacérès, »zu welcher Entscheidung sind Sie nun gelangt?«
»Das ist recht einfach«, sagte Bonaparte, »zu der, den Herzog von Enghien auszuheben und die Sache zu beenden.«
Man schritt zur Abstimmung. Cambacérès wagte als Einziger, bis zuletzt seinen Widerstand aufrechtzuerhalten.
Nachdem der Beschluss von dem versammelten Staatsrat gefasst worden war und Bonaparte somit nicht allein die Verantwortung dafür trug, ließ er die Obersten Ordener und Caulaincourt hereinholen, die im Vorzimmer warteten.
Oberst Ordener sollte zum Rheinufer aufbrechen und dreihundert Dragoner, mehrere Brigaden Gendarmen und einige Pontoniere mitnehmen, versehen mit Lebensmitteln für vier Tage und mit einem Geldbetrag von dreißigtausend Francs, damit er und seine Begleitung auf keinen Fall der Bevölkerung zur Last fielen. Sie sollten den Rhein bei Rheinau überschreiten, direkten Weges nach Ettenheim marschieren, die Ortschaft umstellen und den Herzog von Enghien mitsamt allen Emigranten in seiner Begleitung, insbesondere Dumouriez, gefangen nehmen.
Unterdessen sollte sich ein zweites Detachement unter Oberst Caulaincourt, verstärkt durch einige Artilleriegeschütze, über Kehl nach Offenburg begeben und dort warten, bis der Herzog französisches Territorium erreichte. Sobald der Oberst diese Nachricht erhalten hatte, sollte er den Markgrafen von Baden aufsuchen und ihm eine Note überreichen, die erklärte, was man soeben getan hatte.
Es war acht Uhr. Bonaparte entließ den versammelten Staatsrat, und als fürchte er, sich eines Besseren zu besinnen, befahl er den zwei Obersten, denen ihre Mission den Titel General verlieh, noch am selben Abend aufzubrechen.
Als Bonaparte allein war, zeigte seine Miene einen Ausdruck des Triumphs; die Tat, die für ihn ein Gegenstand ständiger Reue sein musste, war sie erst vollbracht, flößte ihm in dem Augenblick, in dem sie beschlossen war, nur das Gefühl befriedigter Eitelkeit ein; sein Blut war dem von Prinzen und Königen gleich, da niemand, nicht einmal ein gekrönter Prinz, das Recht hatte, es zu vergießen.
Er sah auf die Uhr, die ein Viertel nach acht anzeigte. Monsieur de Méneval, sein neuer Sekretär, Bourriennes Nachfolger, der dieser befremdlichen Sitzung beigewohnt hatte, war geblieben für den Fall, dass der Erste Konsul Befehle für ihn hatte.
Bonaparte trat zu dem Tisch, an dem sein Sekretär saß, berührte die Tischplatte mit einem ausgestreckten Finger und sagte schroff: »Schreiben Sie!«
Der Erste Konsul an den Kriegsminister,
Paris, 19. Ventôse des Jahres XII (10. März 1804)
Citoyen General, haben Sie die Güte, General Ordener, den ich zu diesem Zweck zu Ihrer Verfügung stelle, zu befehlen, sich heute Nacht zum Dienst nach Straßburg zu begeben; er wird dort unter fremdem Namen logieren und beim Divisionsgeneral vorstellig werden.
Der Zweck seiner Mission ist es, sich nach Ettenheim zu begeben, die Stadt zu umzingeln und den Herzog von Enghien, Dumouriez, einen englischen Obersten und jedes weitere Individuum auszuheben, das sich bei ihnen befinden mag. Der Divisionsgeneral, der Quartiermeister der Gendarmerie, die Ettenheim ausgekundschaftet hat, und der Polizeikommissar werden ihm alle erforderlichen Auskünfte erteilen.
Sie werden General Ordener anweisen, aus Schlettstadt dreihundert Mann des sechsundzwanzigsten Dragonerregiments ausrücken zu lassen, die sich nach Rheinau begeben, wo sie um acht Uhr abends eintreffen.
Der Divisionskommandant wird elf Pontoniere nach Rheinau entsenden, die ebenfalls um acht Uhr abends eintreffen und zu diesem Zweck die Eilpost oder Pferde der leichten Artillerie nehmen werden, unabhängig von der Rheinfähre. Man wird Sorge getragen haben, dass vier oder fünf große Schiffe vorhanden sind, mit denen dreihundert Pferde auf einmal übergesetzt werden können.
Die Truppen werden sich mit Brot für vier Tage und mit genügend Munition versorgen. Der Divisionsgeneral wird ihnen einen Hauptmann oder einen Offizier mitgeben, einen Gendarmerieleutnant und drei oder vier Gendarmeriebrigaden. Hat General Ordener den Rhein überquert, wird er Ettenheim aufsuchen und sich dort zum Haus des Herzogs und dem Haus Dumouriez’ begeben. Sobald diese Expedition beendet ist, wird er nach Straßburg zurückkehren.
In Lunéville wird General Ordener anordnen, dass sich der Karabinieroffizier, der die Ersatzkompanie in Ettenheim befehligte, auf Posten nach Straßburg begibt, wo er seine Ordres erwartet.
In Straßburg wird General Ordener unter höchster Geheimhaltung zwei zivile oder militärische Polizeispitzel losschicken, nachdem er mit ihnen vereinbart hat, wo sie sich ihm anschließen werden.
Sie werden Ordre geben, dass sich am selben Tag zur selben Zeit zweihundert Mann des sechsundzwanzigsten Dragonerregiments unter dem Befehl General Caulaincourts nach Offenburg aufmachen, um die Stadt zu umzingeln und die Baronin von Reich festzunehmen, sofern sie nicht schon in Straßburg gefasst wurde, sowie weitere Agenten der englischen Regierung, über welche der Präfekt des Departements Bas-Rhin, der sich zur Zeit in Straßburg befindet, ihm Auskunft erteilen wird.
Von Offenburg aus wird General Caulaincourt seine Patrouillen auf Ettenheim ausdehnen, bis General Ordener dort eingetroffen sein wird. Beide werden einander unterstützen. Gleichzeitig wird der Divisionsgeneral dreihundert Kavalleristen bei Kehl über den Rhein setzen lassen, zusammen mit vier leichten Artilleriegeschützen, und er wird einen Posten leichte Kavallerie nach Willstätt schicken, dem Verbindungspunkt zwischen den zwei Routen.
Die Generäle werden auf äußerste Disziplin achten und darauf, dass die Truppen den Bewohnern nicht zur Last fallen; zu diesem Zweck werden Sie sie mit zwölftausend Francs ausstatten.
Sollten sie ihre Aufgabe nicht erfüllen können und die Hoffnung hegen, nach drei oder vier Tagen Aufenthalt und Patrouillen Erfolg zu haben, sind sie hiermit ermächtigt, so zu handeln.
Sie werden den Amtmännern der beiden Städte bekannt geben, dass diese sich großem Ungemach aussetzen werden, wenn sie weiterhin den Feinden Frankreichs Unterschlupf gewähren.
Sie werden anordnen, dass der Kommandant von Neu-Breisach hundert Mann mit zwei Kanonen auf dem rechten Rheinufer Position beziehen lässt.
Die Posten von Kehl werden ebenso wie die am rechten Rheinufer abgezogen, sobald die beiden Detachements zurückgekehrt sein werden.
General Caulaincourt wird ungefähr dreißig Gendarmen bei sich haben; im Übrigen werden sich General Caulaincourt, General Ordener und der Divisionsgeneral miteinander beraten und die Veränderungen vornehmen, die ihnen die Umstände geraten erscheinen lassen.
Sollten in Ettenheim weder Dumouriez noch der Herzog von Enghien vorzufinden sein, wird man durch einen Sonderkurier vom Stand der Dinge Bericht erstatten.
Sie werden anordnen, dass der Postmeister von Kehl und andere Personen, die über Obiges Mitteilung machen könnten, festzunehmen sind.
BONAPARTE
Kaum hatte er dieses Dokument unterzeichnet, wurde ihm der Citoyen Chateaubriand angekündigt.
Wie gesagt war Monsieur de Chateaubriand gleichen Alters mit Bonaparte – beide waren damals fünfunddreißig Jahre alt. Beide waren klein, beinahe von gleicher Größe. Bonaparte hielt sich aufrecht und reckte den Kopf, Monsieur de Chateaubriand, der ohne seine schlechte Körperhaltung größer gewesen wäre, zog den Kopf zwischen die Schultern, eine Marotte, die, wenn man seinen Erinnerungen Glauben schenken will, bei Nachfahren kriegerischer Familien, deren Ahnen lange Zeit dem Militär angehörten, äußerst verbreitet ist.
Alle, welche die Ehre hatten, Monsieur de Chateaubriand zu kennen, werden, dafür lege ich die Hand ins Feuer, mit mir darin übereinstimmen, dass sie einem vergleichbaren Hochmut niemals begegnet sind – mit Ausnahme Bonapartes.
Der Hochmut des Verfassers des Geistes des Christentums überlebte alles: den Verlust seines Vermögens, den Verlust der politischen Ämter und literarischen Ehren, die er bekleidet hatte. Und in diesem Augenblick des Triumphs muss sein Hochmut unfassbar gewesen sein.
Bonaparte wiederum trennte nur mehr ein Schritt von der höchsten gesellschaftlichen Stellung, die ein Mensch erreichen kann, und sein Hochmut erlaubte keinen Vergleich zwischen ihm und anderen, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Leviathan und Behemoth fanden sich einander von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
»Wohlan, Monsieur de Chateaubriand«, sagte Bonaparte und trat auf ihn zu, »Sie sehen, dass ich Sie nicht vergessen habe.«
»Ich danke Ihnen, Citoyen Erster Konsul. Sie haben verstanden, dass es Menschen gibt, die nur an dem Platz, der ihnen gebührt, etwas taugen.«
»Anders gesagt«, sagte Bonaparte, »habe ich mich der Worte Cäsars erinnert: ›Lieber der Erste in einem Dorf sein als Zweiter in Rom.‹ Ich nehme an«, fuhr er fort, »dass es für Sie bei meinem verehrten Onkel nicht allzu vergnüglich war zwischen dem kleinkrämerischen Gezänk des Kardinals, dem vornehmtuerischen Bramarbasieren des Bischofs von Châlons und den unvermeidbaren Eiertänzen des baldigen Bischofs von Marokko.«
»Sie meinen Abbé Guillon«, sagte Chateaubriand.
»Sie kennen seine Geschichte«, erwiderte Bonaparte. »Nachdem er sich die Namensähnlichkeit mit dem Lyoner Eidverweigerer zunutze gemacht hat, gibt er vor, er sei dem Massaker im Carmes-Gefängnis wie durch ein Wunder entkommen, nachdem er in La Force Madame de Lamballe die Beichte abgenommen hatte. Kein Wort davon ist wahr... Womit haben Sie sich die Zeit vertrieben?«
»Ich lebte mit den Toten, soviel ich konnte. Ich tat alles, was die Fremden tun, die nach Rom gehen, um dort zu träumen. Rom selbst ist ein Traum, den man im Mondschein erleben muss: Von der Piazza Trinitá dei Monti erscheinen die fernen Gebäude wie Skizzen eines Malers oder wie von Bord eines Schiffes aus gesehene umnebelte Meeresgestade. Das Gestirn der Nacht, dieser Himmelskörper, den man für eine untergegangene Welt halten könnte, warf seine bleichen Strahlen auf die Einöden Roms. Er erleuchtete die menschenleeren Straßen, die Winkel, die Plätze, die Gärten, in denen niemand weilte, die Klöster, die so stumm und unbewohnt wirkten wie die Säulengänge des Kolosseums.
Ich fragte mich, was sich zu solcher Stunde an diesen Stätten vor achtzehn Jahrhunderten ereignet haben mochte. Welche Menschen überquerten hier den Schatten jenes Obelisken, der nun nicht mehr auf ägyptischen Wüstensand fiel? Nicht nur das antike Italien, auch das Italien des Mittelalters ist verschwunden. Dennoch ist die Ewige Stadt von den Spuren beider Italien geprägt. Wenn das moderne Rom seinen Petersdom und seine Meisterwerke vorweist, stellt ihm das antike Rom sein Pantheon und seine Ruinen entgegen; wenn jenes seine Konsuln vom Kapitol herabsteigen lässt, bringt dieses seine Päpste aus dem Vatikan herbei; der Tiber trennt diese in denselben Staub gebettete Pracht: Das heidnische Rom versinkt immer tiefer in seinen Gräbern, und das christliche Rom steigt allmählich in seine Katakomben zurück.«
Bonaparte hatte dieser poetischen Beschreibung Roms mit verträumter Miene gelauscht; seine Ohren hatten vernommen, was der Dichter sagte, doch sein Blick richtete sich ganz augenscheinlich in weitere Ferne.
»Monsieur«, sagte er, »begäbe ich mich nach Rom, insbesondere als Mitglied der französischen Gesandtschaft, sähe ich in Rom etwas anderes als die Stadt Cäsars, Diokletians oder Gregors VII.; ich sähe in ihr nicht allein die Erbin von sechstausend Jahren Geschichte, die Mutter der römischen Welt, anders gesagt: des größten Weltreiches, das es jemals gab, sondern ich sähe in ihr vor allen anderen Dingen die Königin des Mittelmeerraums, dieses großartigen, unvergleichlichen, von der Vorsehung geschenkten Gebiets, geprägt von den Zivilisationen aller Zeiten und Garant der Einheit aller Länder, dieses Spiegels, in dem sich Marseille, Venedig, Korinth, Athen, Konstantinopel, Smyrna, Alexandria, Kyrene, Karthago und Cadiz spiegeln durften und um das herum die drei Teile der Alten Welt Europa, Afrika und Asien aneinandergrenzen.
Dank dieser Stadt könnte derjenige, der über Rom und Italien gebietet, sich in jede Richtung und an jeden Ort begeben: über die Rhône in das Herz Frankreichs, über den Eridanos in das Herz Italiens, über die Meerenge von Gibraltar in den Senegal, zum Kap der Guten Hoffnung, in die beiden Amerikas, über die Dardanellen in das Marmarameer, zum Bosporus, zum Pontos Euxeinos, das heißt in das Land der Tataren, über das Rote Meer nach Indien, Tibet, Afrika, zum pazifischen Ozean, anders gesagt zur Unendlichkeit, über den Nil nach Ägypten, nach Theben, Memphis, Elephantine, nach Äthiopien, in die Wüste, anders gesagt, in das Unbekannte. In Erwartung künftiger Größe, die jene Cäsars oder Karls des Großen vielleicht übertreffen wird, wuchs die heidnische Welt um dieses Meer. Die Christenheit hat sie für einen Augenblick umarmt. Alexander, Hannibal, Cäsar wurden an ihrem Rand geboren. Vielleicht wird man eines Tages sagen: ›Bonaparte wurde mitten darin geboren!‹ Mailands Echo lautet ›Karl der Große‹, das von Tunis lautet ›Sankt Ludwig‹. Die Invasionen der Araber haben sich am einen Ufer des Meeres ereignet, die Kreuzzüge am anderen. Seit dreitausend Jahren erhellt die Zivilisation diesen Raum. Und seit achtzehn Jahrhunderten beherrscht ihn der Kalvarienberg!
Wenn nun der Zufall wollte, dass Sie nach Rom zurückkehrten, wagte ich zu sagen: ›Monsieur de Chateaubriand, von Ihrem Standpunkt aus haben genug Dichter, genug Träumer und genug Philosophen Rom betrachtet; es ist an der Zeit, dass ein praktisch veranlagter Mensch die Weite des Horizonts erwägt, statt in Träumereien über die Stadt zu versinken. Die Stadt, die zweimal die Hauptstadt der Welt war, hat uns nichts mehr zu sagen, aber die große Ebene, die sich ganz allein bestellt und die wir das Meer nennen, hat uns alles zu sagen.‹ Wäre ich eines Tages Herr über Spanien, wie ich es über Italien bin, würde ich England die Meerenge von Gibralter versperren, selbst wenn ich dafür eine Zitadelle in den Tiefen des Ozeans verankern müsste. Und dann, Monsieur de Chateaubriand, wäre das Mittelmeer nicht länger ein Meer, sondern es wäre ein französischer See.
Sollte, was durchaus möglich ist, ein Mann Ihrer Fähigkeiten jemals nach Rom zurückkehren, während ich an der Macht wäre, dann würde ich Sie nicht mehr als Botschaftssekretär zurückschicken, sondern als Botschafter. Ich würde zu Ihnen sagen: ›Beschweren Sie sich nicht mit einer Bibliothek; lassen Sie Ovid, Tacitus und Sueton in Paris; nehmen Sie nur eine Karte mit, die Karte des Mittelmeergebiets, und verlieren Sie diese Karte keine Sekunde lang aus den Augen. Wo auch immer ich mich auf der Welt befände, ich würde sie jeden Tag ansehen, das kann ich Ihnen versprechen. ‹
Adieu, Monsieur de Chateaubriand.«
Monsieur de Chateaubriand verließ den Ersten Konsul gesenkten Kopfes; er hatte an seiner Stirn den Druck einer der mächtigen Hände gespürt, die den Willen brechen und den Hochmut in die Knie zwingen.
41
Der schmerzensreiche Weg
Als Bonaparte und Chateaubriand sich trennten, nachdem sie sich eher gemessen hatten wie zwei Athleten, die ihren nächsten Kampf vorbereiten, als wie ein Untergeordneter, der von seinem Vorgesetzten Befehle entgegennimmt, reiste General Ordener mit der Eilpost nach Straßburg ab.
Sobald er dort ankam, begab er sich zu dem Divisionskommandanten, der Ordre hatte, sämtliche Forderungen zu erfüllen, die ihm gestellt werden würden, auch ohne dass er wusste, worum es ging.
Der Kommandant stellte General Ordener auf der Stelle General Fririon und dreihundert Mann der sechsundzwanzigsten Dragoner sowie Pontoniere und alle Ausrüstung zur Verfügung, die General Ordener wünschte.
Und während General Ordener nach Schlettstadt aufbrach, entsandte er einen verkleideten Kavallerieunteroffizier nach Ettenheim, der sich vergewissern sollte, dass der Herzog und General Dumouriez sich dort befanden.
Der Unteroffizier kehrte zurück und berichtete, beide seien in Ettenheim.
General Ordener begab sich daraufhin nach Rheinau, wo er um acht Uhr abends eintraf; mithilfe der Fähre und fünf großer aneinandergebundener Schiffe konnten seine Truppen den Rhein auf einmal überqueren.
Gegen fünf Uhr morgens war das Schloss des Prinzen vollständig umzingelt. Von den Geräuschen der Pferde und der Aufforderung zu öffnen geweckt, sprang der Herzog aus dem Bett, ergriff ein zweiläufiges Gewehr, riss das Fenster auf und legte auf den Citoyen Charlot an, der die achtunddreißigste Schwadron der Nationalgendarmerie befehligte und den Bediensteten, die er hinter den Fenstern des Schlosses sah, zurief: »Im Namen der Republik, öffnen Sie!«
Der Herzog war im Begriff abzudrücken, und um Citoyen Charlot wäre es geschehen gewesen, wenn nicht Oberst von Grünstein, der in dem Zimmer neben dem des Herzogs schlief, zu dem Fenster geeilt wäre, an dem der Herzog stand. Grünstein legte die Hand auf das Gewehr und fragte den Herzog: »Gnädiger Herr, haben Sie sich kompromittiert?«
»Nicht im Geringsten, lieber Grünstein«, erwiderte der Fürst.
»Dann«, sagte Grünstein, »ist Widerstand zwecklos; wir sind umstellt, wie Sie sehen, und ich sehe die Bajonette blitzen. Derjenige, auf den Sie angelegt haben, ist der Kommandant; bedenken Sie, dass Sie Ihr Schicksal und das unsere besiegeln, wenn Sie ihn erschießen.«
»Sie haben recht«, sagte der Prinz und ließ das Gewehr sinken. »Mögen sie eintreten, aber nur mit Gewalt, denn ich erkenne die Französische Republik nicht an und werde ihnen nicht öffnen.«
Während die Türen eingeschlagen wurden, kleidete der Prinz sich schnell an. Vereinzelte Hilferufe verstummten bald; ein Mann, der zur Kirche laufen wollte, um die Sturmglocke zu läuten, wurde festgehalten, der vermeintliche General Dumouriez (in Wahrheit der Marquis de Thuméry) ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen, der Fürst wurde aus seinem Zimmer geführt und zu der Ziegelmühle vor dem Stadttor gebracht, während man sich all seiner Unterlagen bemächtigte. Zudem wäre es nicht einmal nötig gewesen, die Türen einzuschlagen, denn der Kavallerieunteroffizier Pferdsdorf, der am Vorabend nach Ettenheim entsandt worden war und dem Kommandanten Charlot gezeigt hatte, wo die verschiedenen Gäste des Herzogs logierten, war mit einigen Gendarmen und einem Dutzend Dragonern des zweiundzwanzigsten Regiments über die Hofmauer geklettert und durch die Wirtschaftsgebäude in das Haus eingedrungen.
Nachdem die Verhafteten vollzählig waren, suchte man unter ihnen vergebens nach Dumouriez. Der Herzog wurde befragt und erklärte, dass Dumouriez nie einen Fuß nach Ettenheim gesetzt und er ihn noch nie im Leben gesehen habe.
Die Festgenommenen waren: der Herzog von Enghien, der Marquis de Thuméry, der Baron von Grünstein, Leutnant Schmidt, Abbé Weinborn, vormaliger Generalvikar des Bistums Straßburg, Abbé Michel, Sekretär Abbé Weinborns, Jacques, Sekretär des Herzogs von Enghien, Simon Féron, sein Kammerdiener, und zwei weitere Bedienstete namens Pierre Poulain und Joseph Canone.
Der Herzog von Enghien zeigte zu Anfang große Furcht davor, nach Paris gebracht zu werden. »Jetzt, da er mich hat«, sagte er, »wird der Erste Konsul mich einsperren lassen. Es verdrießt mich sehr«, fügte er hinzu, »nicht auf Sie geschossen zu haben, Kommandant; ich hätte Sie getötet, Ihre Männer hätten auf mich geschossen, und jetzt wäre für mich alles erledigt.«
Ein mit Stroh gefüllter Karren stand bereit; man hieß die Gefangenen einsteigen und führte sie zwischen zwei Reihen von Füsilieren bis zum Rhein. Dort wurde der Fürst nach Rheinau übergesetzt; zu Fuß ging er weiter nach Plobsheim, und da es inzwischen seit langem Tag war, machte man dort halt, um zu frühstücken. Nach dem Frühstück stieg der Fürst mit Kommandant Charlot und dem Kavallerieunteroffizier in den Wagen. Ein Gendarm und Oberst von Grünstein bestiegen den Fahrersitz.
Gegen fünf Uhr abends wurde Straßburg erreicht, wo man bei Oberst Charlot abstieg. Eine halbe Stunde später wurde der Herzog in einem Fiaker zur Zitadelle gebracht, wo er auf seine Gefährten traf, die in dem Karren und auf Bauernpferden hergekommen waren.
Der Festungskommandant hatte sie alle in seinem Salon versammelt, in dem Matratzen ausgelegt worden waren; drei Wachen wurden für die ganze Nacht postiert, zwei im Zimmer und eine an der Tür.
Der Fürst schlief schlecht; die Entwicklung der Dinge beunruhigte ihn. Die Ratschläge, die man ihm erteilt hatte, kamen ihm in Erinnerung, und er machte sich Vorwürfe, nicht darauf gehört zu haben.
Am Freitag, dem 16. März, teilte man ihm mit, dass er verlegt werden würde; General Leval, der zuständige Kommandant von Straßburg, und General Fririon, der ihn ausgehoben hatte, suchten ihn auf. Man unterhielt sich gezwungen und mehr als kühl. Der Herzog wurde in den Pavillon gebracht, der zur Rechten liegt, wenn man sich von der Stadt her nähert; durch Nebentüren konnte er von seinem Zimmer aus in die Zimmer der Herren de Thuméry, Schmidt und Jacques gelangen. Doch weder er noch seine Begleiter durften das Haus verlassen.
Man stellte jedoch in Aussicht, er könne in einem kleinen Garten an der Rückseite seines Pavillons spazieren gehen. Zwölf Soldaten und ein Offizier bewachten seine Tür.
Man trennte ihn von Baron von Grünstein, der auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes untergebracht wurde. Diese Trennung erfüllte den Herzog mit großem Schmerz.
Er schrieb an seine Ehefrau. Den Brief übergab er General Leval mit der Bitte, ihn weiterzuleiten.
Er erhielt keine Antwort, und sein Schmerz wurde zu Niedergeschlagenheit. Jede Kommunikation war ihm verboten. Um halb fünf Uhr wurden in seiner Anwesenheit seine Papiere durchsucht, die Oberst Charlot in Begleitung eines Kommissars der Geheimpolizei eröffnete. Man überflog sie flüchtig, teilte sie auf und schickte sie nach Paris.
Um elf Uhr abends ging der Prinz zu Bett, konnte aber nicht schlafen, obwohl er völlig erschöpft war. Der Kommandant der Zitadelle, Major Machin, besuchte ihn, als er schon im Bett lag, und versuchte ihn mit unverbindlichen Höflichkeiten zu trösten.
Am Samstag, dem 17. März, hatte der Herzog von Enghien keine Antwort auf den Brief erhalten, den er der Fürstin von Rohan geschrieben hatte; mittlerweile grenzte sein Zustand an Verzweiflung. Er musste das Protokoll über die Eröffnung seiner Papiere unterzeichnen, und abends erfuhr er, dass er in Begleitung des wachhabenden Offiziers und seiner Mitgefangenen im Garten spazierengehen dürfe.
Er speiste zu Abend und legte sich ruhig schlafen.
Am Sonntag, dem 18. März, wurde der Prinz um halb zwei Uhr morgens geweckt; man ließ ihm kaum Zeit, sich anzukleiden und seine Freunde zum Abschied zu umarmen. Er fuhr allein ab, begleitet von zwei Gendarmerieoffizieren und zwei Gendarmen. Auf der Place de l’Église wartete ein Wagen mit sechs Postpferden, in den man den Herzog schob, worauf Gendarmerieleutnant Petermann und ein Gendarm sich neben ihn setzten, während Wachtmeister Blittersdorf und der zweite Gendarm neben dem Kutscher Platz nahmen.
Die Kutsche mit dem Herzog erreichte am 20. März gegen elf Uhr vormittags die Stadtgrenze von Paris. Dort wartete der Wagen fünf Stunden lang, und in dieser Zeit wurden zweifellos alle Einzelheiten der schrecklichen Tragödie, die bevorstand, festgelegt. Um vier Uhr nachmittags nahm der Wagen über die Außenboulevards den Weg nach Vincennes, wo er erst nach Einbruch der Nacht eintraf.
Die Zwischenzeit benötigten die Konsuln der Republik, um folgenden Erlass aufzusetzen:
Paris, 29. Ventôse des Jahres XII der einen und unteilbaren Republik
Die Regierung der Republik hat Folgendes beschlossen:
Der vormalige Herzog von Enghien, angeklagt, gegen die Republik Waffen erhoben zu haben, im Sold Englands gestanden zu haben und noch zu stehen, an den Verschwörungen beteiligt zu sein, die diese Macht gegen die innere und äußere Sicherheit der Republik schmiedet, wird vor ein Militärtribunal gestellt werden, das aus sieben Mitgliedern besteht, die der Stadtkommandant von Paris bestimmen wird und die sich in Vincennes versammeln werden.
Der Oberrichter, der Kriegsminister und der Stadtkommandant von Paris tragen die Verantwortung für diesen Erlass.
BONAPARTE
HUGUES MARET
MURAT, STADTKOMMANDANT VON PARIS
Den Militärgesetzen zufolge war der Divisionskommandant dafür zuständig, das Militärtribunal zusammenzustellen, einzuberufen und die Exekution des Urteils anzuordnen.
Murat war sowohl Stadtkommandant von Paris als auch Divisionkommandant.
Als Murat obigen Erlass der Konsuln öffnete, den er selbst abgezeichnet hatte, weil ihm keine andere Wahl geblieben war, glitt ihm die Urkunde aus den Händen, so groß war sein Schmerz. Er war tapfer, ungestüm, aber gutherzig. Der Beschluss der Konsuln, den Herzog von Enghien festnehmen zu lassen, war ihm mitgeteilt worden, und in seinem Unwillen, das Leben seines Schwagers unablässig durch neue Verschwörungen gefährdet zu sehen, hatte er diesen Beschluss begrüßt; doch als der Herzog von Enghien festgenommen war und Murat sich damit konfrontiert fand, die entsetzlichen Konsequenzen dieser Verhaftung ins Werk zu setzen, konnte er sich dazu nicht überwinden.
»Ach«, rief er verzweifelt und warf seinen Hut auf den Boden. »Ach, der Erste Konsul will meine Uniform wohl mit Blut tränken!«
Dann lief er zum Fenster, öffnete es und rief hinaus: »Die Pferde anspannen!«
Kaum waren die Pferde vor den Wagen gespannt, sprang er hinein und sagte: »Nach Saint-Cloud!«
Er wollte nicht einen Befehl unwidersprochen ausführen, der in seinen Augen Bonaparte und ihn mit Unehre befleckte.
Es gelang ihm, bis zu seinem Schwager vorzudringen, und mit der Besorgnis, die sein Entsetzen ihm einflößte, legte er ihm die schmerzvollen Gefühle dar, die ihn quälten. Bonaparte jedoch verbarg hinter einer unbewegten Miene die Erregung, die ihn selbst ergriffen hatte; hinter dieser Maske der Unerschütterlichkeit beurteilte er seine Schwäche als Feigheit und beendete das Gespräch mit den Worten: »Nun, wenn Sie sich fürchten, werde ich die Befehle geben und abzeichnen, die im Verlauf dieses Tages gegeben werden.«
Wir erinnern uns, dass der Erste Konsul Savary von der Klippe von Biville zurückbeordert hatte, wo dieser die Prinzen bei ihrer Landung überraschen und verhaften sollte. Savary war einer jener seltenen Menschen, die alles, was sie tun, ganz tun, mit Leib und Seele; er hatte keine eigene Meinung, sondern liebte Bonaparte; er hatte keine politischen Ansichten, sondern verehrte den Ersten Konsul.
Bonaparte diktierte sämtliche Ordres, unterschrieb sie eigenhändig und befahl Savary, sie Murat zu überbringen, damit dieser ihre Ausführung überwachte.
Diese Ordres waren umfassend und unmissverständlich. Und Murat, den der Erste Konsul so grob abgewiesen und geschurigelt hatte, erließ folgenden Befehl, wobei er sich voller Gram seine schönen Haare raufte:
An die Regierung von Paris,
den 29. Ventôse des Jahres XII der Republik
Der kommandierende General und Stadtkommandant von Paris verkündet:
In Befolgung des Regierungserlasses mit Datum des heutigen Tages, dem zufolge der vormalige Herzog von Enghien vor ein Militärtribunal gestellt werden wird, das aus sieben Mitgliedern besteht, zu bestimmen von dem General und Gouverneur von Paris, hat dieser zu Mitgliedern besagten Tribunals folgende Personen ernannt:
General Hulin, Befehlshaber der Grenadiere der konsularischen Garde, als Vorsitzenden,
Oberst Guiton, Kommandant des ersten Kürassierregiments,
Oberst Bazancourt, Kommandant des vierten Infanterieregiments,
Oberst Ravier, Kommandant des achzehnten Infanterieregiments,
Oberst Barrois, Kommandant des sechsundneunzigsten Infanterieregiments,
Oberst Rabbe, Kommandant des zweiten Regiments des Pariser Gendarmeriekorps,
Citoyen d’Autancourt, Hauptmann der Elitegendarmerie und Rapporteur.
Dieses Tribunal wird sich unverzüglich im Schloss von Vincennes versammeln, um auf der Stelle über den oben Erwähnten aufgrund der im Erlass der Regierung vorgebrachten Beschuldigungen, die in Abschrift dem Vorsitzenden überreicht werden, sein Urteil zu fällen.
J. MURAT
Wir hatten den Gefangenen verlassen, als er Vincennes betrat.
Der Festungskommandant hieß Harel; er hatte den Befehl über dieses Schloss zur Belohnung für sein Mitwirken in der Affäre Ceracchi und Aréna erhalten.
Eine Fügung des Schicksals wollte, dass seine Ehefrau Milchschwester des Herzogs von Enghien war.
Harel hatte keinerlei Ordre erhalten. Man fragte ihn, ob er einen Gefangenen unterbringen könne. Er erwiderte, das könne er nicht, er habe nur seine eigene Wohnung und das Ratszimmer.
Daraufhin erteilte man ihm die Anweisung, auf der Stelle ein Zimmer herrichten zu lassen, in dem ein Gefangener schlafen und auf sein Urteil warten konnte. Dieser Ordre folgte die Aufforderung, als Nächstes im Hof eine Grube ausheben zu lassen.
Harel erwiderte, dies werde schwierig sein, da der Hof gepflastert war. Daraufhin suchte man nach einer geeigneten Stelle und verfiel auf den Festungsgraben, wo man die Grube aushob.
Der Herzog kam gegen sieben Uhr abends in Vincennes an; er war ausgehungert und fror, doch er wirkte weder traurig noch beunruhigt. Da sein Zimmer noch nicht geheizt war, lud Harel ihn in seine Wohnräume ein. Im Dorf wurde ihm etwas zu essen geholt. Der Herzog begab sich zu Tisch und lud den Kommandanten ein, mit ihm zu speisen.
Harel lehnte ab und hielt sich zur Verfügung des Herzogs, der ihm daraufhin viele Fragen über die Festung von Vincennes und die Geschehnisse darin stellte. Er erzählte, dass er in der Nähe aufgewachsen war, und plauderte gut gelaunt und freundlich.
Dann kam er auf seine Lage zu sprechen und fragte: »Oh, lieber Freund, wissen Sie, was man mit mir bezweckt?«
Der Kommandant wusste es nicht und konnte auf diese Frage nicht antworten. Seine Frau jedoch, die hinter den Vorhängen eines Alkovens lag, hörte alles mit an; und der Befehl, eine Grube auszuheben, enthüllte ihr das, was bevorstand, so klar, dass sie ihr Schluchzen nur mit größter Mühe zurückhalten konnte.
Wie gesagt war sie die Milchschwester des Herzogs.
Dieser begab sich so bald wie möglich zu Bett, erschöpft von seiner Fahrt. Doch bevor er einschlafen konnte, betraten Leutnant Noirot, Leutnant Jacquin, Hauptmann d’Autancourt und die Gendarmen Nerva und Tharsis sein Zimmer und begannen mit dem Verhör, dem als Gerichtsschreiber Citoyen Molin beiwohnte, Hauptmann des achtzehnten Regiments, den der Rapporteur bestimmt hatte.
»Name, Vorname, Alter und Beruf?«, fragte Hauptmann d’Autancourt.
»Ich heiße Louis-Antoine-Henri de Bourbon, Herzog von Enghien, geboren am 2. August 1772 in Chantilly«, erwiderte der Herzog.
»Zu welchem Zeitpunkt haben Sie Frankreich verlassen?«
»Das kann ich nicht genau sagen, ich denke aber, dass es am 16. Juli 1789 war, zusammen mit meinem Großvater, dem Prinzen von Condé, meinem Vater, dem Herzog von Bourbon, dem Grafen von Artois und den Kindern des Grafen von Artois.«
»Wo haben Sie sich aufgehalten, seit Sie Frankreich verließen?«
»Als ich Frankreich verließ, reiste ich mit meinen Verwandten, denen ich immer folgte, von Mons nach Brüssel; anschließend begaben wir uns nach Turin zu dem König von Sardinien, wo wir etwa eineinhalb Jahre blieben, und von dort nach Worms und in die Umgebung von Worms am Rheinufer; dann wurde das Korps Condé gebildet, und ich habe den ganzen Krieg mitgemacht; davor habe ich in Brabant am Feldzug von 1792 im Heer des Herzogs von Bourbon teilgenommen, in der Armee des Herzogs Albert.«
»Wo haben Sie sich nach dem Friedensschluss zwischen der Französischen Republik und dem Kaiser von Österreich niedergelassen?«
»Den letzten Feldzug haben wir in der Gegend von Graz beendet; dort wurde das Korps Condé verabschiedet, das im Sold Englands stand. Ich blieb acht oder neun Monate lang zum Zeitvertreib in Graz und Umgebung und wartete auf Nachrichten von meinem Großvater, der nach England gegangen war und dort meinen Sold verhandelte. In der Zwischenzeit bat ich den Kardinal von Rohan, mich in seinem Gebiet niederzulassen zu dürfen, in Ettenheim im Breisgau. Seit zwei Jahren halte ich mich dort auf. Nach dem Tod des Kardinals habe ich den Markgrafen von Baden offiziell darum ersucht, dort wohnen bleiben zu können, und die Erlaubnis wurde mir von ihm erteilt.«
»Sind Sie nicht nach England gereist, und hat Ihnen der englische Staat keine Besoldung zuerkannt?«
»Ich war nie in England, der englische Staat besoldet mich, und ich habe keinerlei andere Einnahmequellen.«
»Unterhalten Sie Beziehungen zu den französischen Prinzen, die sich nach London zurückgezogen haben, und haben Sie sie in letzter Zeit gesehen?«
»Selbstverständlich stehe ich in Briefwechsel mit meinem Vater und meinem Großvater, die ich aber, soweit ich mich erinnern kann, seit 1794 oder 1795 nicht mehr gesehen habe.«
»Welchen Rang haben Sie in der Armee Condé bekleidet?«
»Kommandant der Vorhut; vor 1796 habe ich im Generalstab meines Großvaters als Freiwilliger gedient.«
»Kennen Sie General Pichegru?«
»Ich glaube, dass ich ihn nie gesehen habe; ich hatte nie mit ihm zu tun; ich weiß, dass er mich kennenlernen wollte, und ich muss mir gratulieren, ihn nicht gekannt zu haben, wenn ich bedenke, welch niedriger Mittel er sich bedient haben soll.«
»Kennen Sie General Dumouriez, und haben Sie Beziehungen zu ihm unterhalten?«
»Nicht im Geringsten, ich habe ihn nie gesehen.«
»Haben Sie seit dem Friedensschluss keinerlei Briefwechsel in die Republik unterhalten?«
»Ich habe verschiedenen Freunden geschrieben, doch es handelt sich um Briefe, die der Regierung keine Sorgen bereiten dürften.«
Hauptmann d’Autancourt beendete das Verhör, und das Protokoll wurde von ihm unterzeichnet, von Leutnant Jacquin, von Leutnant Noirot, den zwei Gendarmen und dem Herzog von Enghien.
Doch bevor er unterzeichnete, schrieb der Herzog die folgenden Zeilen:
Bevor ich das Protokoll dieses Verhörs unterzeichne, bitte ich eindringlich um eine persönliche Audienz bei dem Ersten Konsul. Mein Name, meine Stellung, meine Denkweise und das Entsetzliche meiner Lage flößen mir die Hoffnung ein, dass er sein Ohr meiner Bitte nicht verschließen wird.
LOUIS-A.-H. DE BOURBON
Unterdessen hatte Bonaparte sich nach La Malmaison zurückgezogen und hatte angeordnet, dass er unter keinen Umständen gestört werden wolle. La Malmaison war seine Zuflucht, wenn er mit seinen Gedanken allein und ungestört sein wollte.
Madame Bonaparte, die junge Königin Hortense und der ganze weibliche Hofstaat waren verzweifelt. Die Sympathien dieser Damen waren durch und durch royalistisch. Mehrmals hatte Joséphine Bonapartes schlechter Laune die Stirn geboten und sich bis zu ihm vorgewagt, um die Frage anzusprechen. Bonaparte jedoch hatte ihr mit gespielter Schroffheit erwidert: »Geben Sie Ruhe und lassen Sie mich in Frieden; Frauen verstehen nichts von der Politik.«
Er wiederum war an diesem Abend des 20. März zerstreut, tat so, als wäre er ruhig, wanderte mit großen Schritten auf und ab, wie es seine Gewohnheit war, die Hände hinter dem Rücken, den Kopf gesenkt. Zuletzt setzte er sich an einen Tisch, auf dem ein Schachspiel aufgebaut war, und sagte laut: »Nun, meine Damen, welche von Ihnen spielt mit mir?«
Madame de Rémusat erhob sich, trat zu ihm und setzte sich, doch nach wenigen Minuten warf er die Schachfiguren um und verließ den Raum, ohne sich bei ihr zu entschuldigen.
Um sich dieser Sache zu entledigen, hatte Bonaparte sie, wie wir gesehen haben, Murat zu dessen größter Verzweiflung übertragen.
Unterdessen war der Herzog nach erfolgtem Verhör vor Erschöpfung sogleich eingeschlafen. Doch es war kaum eine Stunde vergangen, als man wieder in sein Zimmer kam.
Man weckte ihn, forderte ihn auf, sich anzukleiden und in den Gerichtssaal hinunterzukommen.
Der Vorsitzende des Gerichts, General Hulin, hatte eine ungewöhnliche militärische Laufbahn hinter sich. Er war Schweizer, 1758 in Genf geboren, und wie alle Genfer zum Uhrmacher ausgebildet. Der Marquis von Conflans, von seiner Körpergröße und seinem hübschen Gesicht eingenommen, hatte ihn zu seinem Leibjäger gemacht. Als bei der Erstürmung der Bastille die ersten Schüsse fielen, war er in seinem prachtvollen bestickten Anzug herbeigelaufen, und man hatte ihn für einen General gehalten. Er hatte diesen Irrtum nicht korrigiert, hatte sich an die Spitze eines Pelotons besonders Mutiger gestellt und war als einer der Ersten in den Hof des königlichen Kerkers eingezogen. Seitdem trug er den Titel eines Obersten, den ihm niemand streitig machte, und vor Kurzem erst hatte er sein Generalspatent erhalten. Der Mut, den er bezeigt hatte, war umso erstaunlicher, als er sich nach beendetem Kampf sofort auf die Seite des Gouverneurs de Launay geschlagen und diesen so lange wie möglich verteidigt hatte, bis er selbst unter dem Ansturm der Gegner zusammenbrach; er hatte, wie man weiß, nicht verhindern können, dass der arme Offizier in Stücke gerissen wurde.
Vielleicht war er der Menschlichkeit wegen, die er damals bezeigt hatte, zum Vorsitzenden des Tribunals ernannt worden, das über den Herzog von Enghien zu richten hatte.
Der Herzog wurde von ihm nochmals mit aller nur erdenklichen Rücksicht verhört, doch für ein Kriegstribunal gab es nur eines zu tun: den Herzog, falls für unschuldig befunden, aus Vincennes zu entfernen, für schuldig befunden aber der Urteilsvollstreckung zuzuführen.
Hier nun der Wortlaut des Urteils:
1. Das Tribunal erklärt Louis-Antoine-Henri de Bourbon, Herzog von Enghien, einstimmig für schuldig, bewaffnet gegen die Französische Republik gekämpft zu haben;
2. einstimmig für schuldig, seine Dienste der englischen Regierung angeboten zu haben, der Feindin des französischen Volkes;
3. einstimmig für schuldig, Spitzel besagter englischer Regierung empfangen und mit Empfehlungen versehen zu haben, ihnen dazu verholfen zu haben, in Frankreich Erkundungen zu betreiben, und mit ihnen gegen die innere und äußere Sicherheit des Staates konspiriert zu haben;
4. einstimmig für schuldig, sich an die Spitze einer Zusammenrottung französischer Emigranten und anderer Subjekte im Sold Englands begeben zu haben, die sich an Frankreichs Grenzen in Freiburg und Baden gebildet hat;
5. einstimmig für schuldig, in Straßburg Spionage betrieben zu haben, um die benachbarten Departements in Aufruhr zu versetzen und eine Diversion zu bewirken, die England nützen würde;
6. einstimmig für schuldig, Helfershelfer und Komplize der Verschwörung zu sein, die von den Engländern gegen das Leben des Ersten Konsuls angestiftet wurde, verbunden mit dem Vorhaben, im Falle des Gelingens der Verschwörung Frankreich zu betreten.
Nach dem Verhör stellte der Vorsitzende die letzte Frage nach der Strafe. Diese Frage wurde wie erwartet beantwortet, und einstimmig verurteilte das Militärtribunal Louis-Antoine-Henri de Bourbon, Herzog von Enghien, zum Tode für die Verbrechen der Spionage, der Verständigung mit den Feinden der Republik und der Attentate auf die innere und äußere Sicherheit des Staates.
Ein befremdlicher Nebenumstand war, dass die Mitglieder des Tribunals sich anfangs nicht zurechtgefunden hatten, weil keinem von ihnen mitgeteilt worden war, in welcher Sache man sie zusammengerufen hatte. Einer von ihnen hatte über eine Stunde auf Einlass warten müssen. Ein anderer hatte aufgrund des Befehls, sich unverzüglich nach Vincennes zu begeben, angenommen, er sei verhaftet, und hatte gefragt, wohin er sich zu wenden habe, um seine Haft anzutreten.
Was das Begehren des Herzogs nach einer Audienz bei Bonaparte betraf, erbot sich ein Mitglied des Tribunals an, es der Regierung zu übermitteln.
Das Tribunal stimmte zu, doch ein Uniformierter, der hinter dem Sessel des Vorsitzenden gewartet hatte und offenbar den Ersten Konsul vertrat, erklärte, dieses Begehren sei nicht angebracht; das Tribunal vertagte die Entscheidung und behielt sich vor, nach Verkündung des Urteilsspruchs darauf zurückzukommen.
Nach ergangenem Urteil griff General Hulin zur Feder, um Bonaparte das Begehren des Herzogs von Enghien mitzuteilen.
»Was tun Sie da?«, fragte ihn derjenige, der das Begehren als nicht angebracht bezeichnet hatte.
»Ich schreibe an den Ersten Konsul«, erwiderte Hulin, »um ihm den Wunsch des Tribunals und des Verurteilten mitzuteilen.«
»Ihre Arbeit ist getan«, sagte der andere und nahm Hulin die Feder aus der Hand. »Alles Weitere ist meine Sache.«
Nachdem Savary (denn um ihn handelte es sich) der Urteilsverkündung beigewohnt hatte, begab er sich zu den Elitegendarmen auf dem Platz vor dem Schloss.
Der befehlshabende Offizier kam mit Tränen in den Augen zu ihm und sagte, er habe Befehl, einen Pfahl aufzustellen, damit das Urteil des Militärtribunals vollzogen werden könne.
»Dann tun Sie es«, sagte Savary.
»Aber wo soll ich das tun?«
Und wahrhaftig waren die Gemüsebauern aus der Umgebung von Paris schon unterwegs zu den verschiedenen Märkten.
Der Offizier untersuchte die Örtlichkeiten und entschied sich für den Festungsgraben als sichersten Ort.
Nachdem die Sitzung des Tribunals beendet war, ging der Herzog in sein Zimmer zurück, legte sich zu Bett und schlief ein.
Er lag in tiefem Schlaf, als man ihn weckte. Sein Urteil sollte verlesen und vollstreckt werden. Da das Urteil am Ort der Exekution zu verlesen war, forderte man den Herzog auf, sich anzukleiden und mitzukommen.
Er ahnte so wenig, dass man ihn in den Tod führte, dass er im Hinuntersteigen der Treppe zum Festungsgraben fragte: »Wohin gehen wir?«
Als er die Kälte von unten heraufsteigen spürte, drückte er die Hand des Kommandanten, der die Laterne trug, und fragte im Flüsterton: »Will man mich etwa in ein Verlies werfen?«
Schon bald wurde ihm alles klar, ohne dass jemand ein Wort sagen musste.
Im Licht der Laterne, die Harel hielt, wurde ihm das Urteil verkündet. Er hörte unbewegt zu. Dann nahm er einen Brief aus der Tasche, den er zweifellos in Vorausahnung des Kommenden geschrieben hatte. Dieser Brief enthielt eine Locke seines Haars und einen goldenen Ring. Er übergab ihn Leutnant Noirot, demjenigen der Offiziere, mit dem er seit seiner Ankunft in Vincennes am meisten zu tun gehabt hatte und der ihm am freundlichsten erschienen war.
Der Kommandant, der den Schießbefehl geben sollte, fragte den Herzog, ob er bereit sei niederzuknien.
»Wozu?«, fragte der Herzog.
»Um zu sterben.«
»Ein Bourbone«, erwiderte der Herzog von Enghien, »kniet vor niemandem nieder als vor Gott.«
Die Soldaten traten einige Schritte zurück, und dabei wurde die Grube sichtbar.
Im gleichen Augenblick lief der kleine Hund des Herzogs, der ihn von Ettenheim bis hierher begleitet hatte, herbei und sprang unter Freudengebell zwischen seinen Beinen umher.
Der Fürst bückte sich, um ihn zu streicheln, und als er sah, dass die Soldaten anlegten, sagte er: »Kümmern Sie sich um meinen armen Fidèle, das ist alles, was ich verlange«, und dann richtete er sich auf: »Ich bin bereit, meine Herren, tun Sie Ihre Pflicht!«
Die vier Befehle: »Macht euch bereit!«, »Erhebt das Gewehr«, »Legt an!« und »Feuer!« ertönten in schneller Folge; Schüsse hallten wider, und der Herzog fiel zu Boden.
Man legte ihn angekleidet in die im Voraus ausgehobene Grube, und in wenigen Augenblicken war der Leichnam mit Erde bedeckt und die Soldaten traten die Erde fest, um die Spuren im Rasen zu verwischen.
Kaum war das Urteil gesprochen, wollten die Mitglieder des Tribunals Vincennes so schnell wie möglich verlassen. Jeder rief nach seinem Wagen, doch da am Ausgang des Schlosses ein Durcheinander entstanden war, konnte keiner derjenigen, die am Tod des unglücklichen Fürsten mitgewirkt hatten, den Ort verlassen, bevor die Gewehrschüsse ertönten, die verkündeten, dass alles zu Ende war.
Daraufhin wurde das Tor geöffnet, das möglicherweise auf höheren Befehl verschlossen geblieben war; ein jeder stieg in seinen Wagen und befahl dem Kutscher, das verwünschte Schloss zu verlassen; man hätte meinen können, diese tapferen Soldaten, die auf dem Schlachtfeld oft genug und ohne mit der Wimper zu zucken dem Tod ins Auge gesehen hatten, ergriffen vor einem Gespenst die Flucht.
Savary, den das Geschehen vielleicht stärker beeindruckt hatte als die anderen, begab sich ebenfalls nach Paris zurück; am Schlagbaum jedoch begegnete er dem als Staatsrat gewandeten Monsieur Réal, der nach Vincennes fuhr. Er hielt ihn an und fragte: »Wohin fahren Sie?«
»Nach Vincennes«, erwiderte Monsieur Réal.
»Und was wollen Sie dort tun?«, fragte Savary.
»Ich will den Herzog von Enghien verhören, wie es mir der Erste Konsul befohlen hat.«
»Der Herzog von Enghien ist seit einer Viertelstunde tot«, sagte Savary.
Monsieur Réal stieß einen Ausruf der Verwunderung und des Entsetzens aus und erbleichte sichtlich. »Oh«, sagte er, »wer kann es so eilig gehabt haben, diesen bedauernswerten Fürsten um sein Leben zu bringen?«
»Bei dieser Antwort«, schreibt Savary in seinen Erinnerungen, »begann ich mich zu fragen, ob der Tod des Herzogs von Enghien wirklich das Werk des Ersten Konsuls war.«
Monsieur Réal kehrte nach Paris zurück.
Savary fuhr nach La Malmaison, um Bonaparte Bericht zu erstatten. Er kam dort um elf Uhr an.
Der Erste Konsul wirkte nicht minder erstaunt als Monsieur Réal, als er vom Tod des Herzogs erfuhr. Wieso hatte man die Bitte des Fürsten nicht erfüllt, der mit ihm zu sprechen verlangt hatte?
»Soweit ich seinen Charakter beurteilen kann«, sagte Bonaparte, »hätte wir alles einvernehmlich regeln können«, und dann, während er mit großen Schritten hin- und herging: »Ich verstehe das Ganze nicht! Dass das Tribunal aufgrund des Geständnisses des Herzogs von Enghien sein Urteil fällte, ist völlig begreiflich; aber dieses Geständnis erfolgte schließlich zu Beginn der Verhandlung, und das Urteil hätte erst exekutiert werden dürfen, nachdem Monsieur Réal ihn über eine Sache befragt hatte, die unbedingt zu erhellen war.« Und er wiederholte: »Die Sache bleibt mir rätselhaft! Das ist eine Untat, die keinen Sinn hat und nur dazu dient, mich verhasst zu machen!«
Gegen elf Uhr erschien Admiral Truguet, der von diesen Geschehnissen nichts wusste, in La Malmaison, um dem Ersten Konsul den Bericht vorzulegen, den er auf sein Geheiß über die Organisation der Flotte vor Brest ausgearbeitet hatte. Da der Admiral nicht in Bonapartes Kabinett vorgelassen werden konnte, wo dieser sich mit Savary befand, wurde er in den Salon gebeten, in dem er Madame Bonaparte in Tränen aufgelöst und in tiefster Verzweiflung vorfand. Sie hatte erfahren, dass der Herzog von Enghien hingerichtet worden war, und konnte die Ängste nicht verbergen, die ihr die Folgen dieser schrecklichen Katastrophe einflößten.
Auch den Admiral ergriff beim Erfahren dieser unerwarteten Nachricht ein unbezähmbares Zittern, das sich noch verschlimmerte, als man ihm sagte, der Erste Konsul wolle ihn sehen.
Er ging durch das Speisezimmer, in dem die Adjutanten frühstückten; sie wollten ihn zum Frühstück einladen, doch er sagte, er sei nicht hungrig; er zeigte ihnen sein Portefeuille und gab zu verstehen, dass er es eilig habe, brachte jedoch kein Wort hervor.
Als er zu Bonaparte kam, riss er sich zusammen und sagte: »Citoyen Erster Konsul, ich unterbreite Ihnen den Bericht über die Flotte von Brest, den Sie verlangt haben.«
»Danke«, sagte Bonaparte, ohne in seinem Umhergehen innezuhalten, und dann blieb er unvermittelt stehen und fügte hinzu: »Nun, Truguet, jetzt gibt es einen Bourbonen weniger.«
»Pah!«, sagte Truguet. »Sollte etwa Ludwig XVIII. den letzten Atemzug getan haben?«
»Nein. Es handelt sich um Folgendes!«, erklärte Bonaparte nervös. »Ich habe den Herzog von Enghien in Ettenheim ausheben lassen; ich habe ihn nach Paris bringen lassen, und heute Morgen um sechs Uhr wurde er in Vincennes füsiliert.«
»Aber was war der Zweck einer so unerbittlichen Maßnahme?«, fragte Truguet.
»Mein Gott«, erwiderte Bonaparte, »es war an der Zeit, den zahllosen Meuchelmorden ein Ende zu machen, die gegen mich angestiftet wurden; jetzt wird niemand mehr zu sagen wagen, ich wolle Moncks Rolle spielen.«
Zwei Tage nach diesem entsetzlichen Geschehen sandte Bourrienne einen Eilboten zu Madame Bonaparte, um sie zu fragen, ob sie ihn empfangen könne, denn er machte sich Sorgen.
Der Bote kam mit bejahender Antwort zurück.
Bourrienne eilte nach La Malmaison, und kaum war er angekommen, wurde er in das Boudoir geleitet, in dem Joséphine mit Madame Louis Bonaparte und Madame Rémusat allein war. Alle drei Damen waren vor Schmerz außer sich.
»Ach, Bourrienne!«, rief Madame Bonaparte, als sie ihn sah. »Was für ein scheußliches Unglück! Wenn Sie wüssten, wie er sich in letzter Zeit aufgeführt hat! Aller Welt geht er aus dem Weg, niemanden will er sehen! Wer konnte ihm nur eine solche Tat einflüstern?«
Daraufhin berichtete Bourrienne ihnen alle Einzelheiten der Hinrichtung, die ihm Harel erzählt hatte.
»Welche Grausamkeit!«, rief Joséphine. »Wenigstens wird niemand behaupten können, ich sei daran schuld, denn ich habe nichts unversucht gelassen, um ihn von diesem abscheulichen Vorhaben abzubringen; er hatte mir nichts davon anvertraut, aber Sie wissen, wie gut ich ihn kenne. Er hat alles zugegeben; aber wenn Sie wüssten, mit welcher Herzlosigkeit er mein Flehen abgewiesen hat! Ich habe nicht aufgegeben, ich habe mich vor ihm auf die Knie geworfen. ›Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten!‹, hat er mir wutentbrannt entgegengeschleudert. ›Das geht Frauen nichts an, lassen Sie mich in Ruhe!‹ Und er hat mich so heftig weggestoßen, wie ich es seit seiner Rückkehr aus Ägypten nicht mehr erlebt habe. Was wird man in Paris darüber denken? Ich bin überzeugt, dass man überall nur das Schlechteste von ihm annimmt, denn selbst hier machen seine eingefleischtesten Liebediener einen betroffenen Eindruck. Sie wissen, wie er sich aufführt, wenn er sich selbst nicht ausstehen kann und sich das um keinen Preis anmerken lassen will – dann wagt niemand, das Wort an ihn zu richten, und alle führen sich auf wie die reinsten Leichenbitter. Hier habe ich die Haare und einen Goldring des armen Prinzen mit der Bitte, sie jemandem zu senden, der ihm teuer war. Der Leutnant, dem er sie gab, hat sie Savary anvertraut, und Savary gab sie mir. Savary sprach mit Tränen in den Augen von den letzten Worten des Herzogs, und er schämte sich nicht zu weinen, als er zu mir sagte: ›Ach, Madame, einen solchen Menschen kann man nicht sterben sehen, ohne ergriffen zu sein.‹«
Monsieur de Chateaubriand, der noch nicht zu seinem Botschafterposten in der Republik Wallis aufgebrochen war, ging durch den Tuileriengarten, als er einen Mann und eine Frau eine amtliche Bekanntmachung verkünden hörte: »Mit Beschluss der in Vincennes zusammengetretenen Militärkommission wird Louis-Antoine-Henri de Bourbon, Herzog von Enghien, geboren am 2. August 1772 in Chantilly, zum Tode verurteilt.«
Dieser Ruf traf ihn wie ein Blitzschlag; einen Augenblick lang verharrten er und die anderen Passanten wie versteinert.
Er ging nach Hause, setzte sich an einen Tisch, schrieb sein Entlassungsgesuch und schickte es noch am selben Tag an Bonaparte.
Dieser erkannte Chateaubriands Handschrift auf dem Briefumschlag und drehte und wendete den ungeöffneten Brief hin und her.
Schließlich erbrach er das Siegel, las den Brief und warf ihn zornentbrannt auf den Tisch. »Umso besser!«, sagte er. »Dieser Mann und ich hätten uns nie verstanden; er ist nichts als Vergangenheit, ich aber bin die Zukunft.«
Madame Bonaparte hatte sich zu Recht Sorgen über die Auswirkungen der Nachricht vom Tod des Herzogs gemacht. In ganz Paris war die Antwort auf die Bekanntmachung durch die Ausrufer deutlich missbilligendes Gemurmel. Niemand sprach von einer Hinrichtung; jedermann sprach von der Ermordung des Herzogs. Niemand glaubte an irgendeine Schuld des Herzogs, und es kam zu regelrechten Pilgerzügen zu dem Festungsgraben.
Die Grube, in welcher der Tote verscharrt worden war, hatte man sorgsam mit Rasen bedeckt, um sie dem Erdboden ringsum anzugleichen, und niemand hätte das Grab des bedauernswerten jungen Mannes ausfindig machen können, wäre nicht ein Hund gewesen, der sich nicht von der Stelle rührte. Die Pilger hielten den Blick auf das Rasenstück gerichtet, bis ihre Tränen es verschleierten, und dann riefen sie leise: »Fidèle! Fidèle! Fidèle!«, worauf das arme Tier mit langem, traurigem Geheul antwortete.
Eines Morgens suchte man vergebens nach Fidèle; für jene, die mit den Augen des Herzens hinsahen, war die Stelle noch zu erkennen; Fidèle aber hatte die Polizei beunruhigt, und deshalb war er verschwunden.
42
Selbstmord
Pichegru, zu dem wir nun zurückkehren, hatte zu Anfang alles abgestritten; doch nachdem Moreaus Kammerdiener ihn als denjenigen wiedererkannt hatte, der seinem Herrn geheimnisumwitterte Besuche abstattete und mit Respekt begrüßt wurde – anders gesagt, entblößten Hauptes -, gab er das Leugnen auf und teilte das Schicksal Cadoudals.
Im Temple-Gefängnis wurde Pichegru eine Zelle im Erdgeschoss zugewiesen. Sein Bett stand mit der Kopfseite zum Fenster, so dass er die Fensterbank als Nachtschränkchen benutzen konnte und das Licht auf ihr abstellte, wenn er im Bett las; draußen vor dem Fenster war eine Wache postiert, die alles beobachten konnte, was sich in der Zelle abspielte.
Nur ein kleines Vorzimmer trennte Georges und Pichegru. Abends wurde ein Gendarm in dieses Vorzimmer eingeschlossen, und der Schlüssel wurde dem Concierge übergeben. Der Gendarm konnte durch das Fenster um Hilfe oder nach Verstärkung rufen. Die Wache am Hoftor hätte seine Botschaft dann an den nächsten Wachposten weitergegeben, und dieser hätte den Concierge verständigt.
Eine Zeit lang waren in Pichegrus Zelle zwei weitere Gendarmen postiert, die ihn keine Sekunde aus den Augen ließen. Zudem trennte seine Zelle nur eine Scheidewand von der Zelle Bouvets de Lozier, der versucht hatte, sich zu erhängen. Und drei oder vier Schritte entfernt lag an dem Flur zur Rechten Georges Cadoudals Zelle, die Tag und Nacht geöffnet war und in der zwei Gendarmen und ein Brigadier ein Auge auf den Gefangenen hatten.
Im Anschluss an Monsieur Réals Unterhaltung mit Pichegru verlangte Letzterer, dass die zwei Gendarmen, durch die er sich entsetzlich gestört fühlte, aus seiner Zelle entfernt würden.
Das Begehren wurde Bonaparte unterbreitet, der die Achseln zuckte. »Warum soll man den Mann unnötig irritieren?«, sagte er. »Diese Gendarmen sollen ihn nicht an der Flucht hindern, sondern daran, sich umzubringen; wer aber ernsthaft beabsichtigt, sich umzubringen, hat noch immer Mittel und Wege zu finden gewusst.«
Man hatte Pichegru Tinte und Papier überlassen, und er schrieb fleißig. Die gute Aufnahme, die seine Überlegungen zur Verbesserung von Guyana gefunden hatten, schmeichelte ihm sehr, und vermutlich sah er sich mit seiner doppelten Phantasie des Strategen und des Mannes der Zahlen und mit seinen Erinnerungen an die Erkundungsreisen und Jagdausflüge in das Landesinnere jener Küsten im Geiste schon an der Arbeit und ging ganz in ihr auf.
Bonapartes Befürchtung, Pichegru trage sich mit Selbstmordgedanken, war nicht unberechtigt.
Der Marquis de Rivière hat Monsieur Réal und Monsieur Desmarets erzählt, er sei eines Abends mit Pichegru in Paris herumgeirrt, und als sie vor lauter Furcht, nach Hause zu gehen oder auf der Straße aufgegriffen zu werden, nicht ein noch aus wussten, sei der General auf einmal stehen geblieben, habe sich eine Pistole an die Stirn gesetzt und gesagt: »Ach, wozu noch weiter herumlaufen, machen wir hier ein Ende.«
Monsieur de Rivière fiel ihm in den Arm, entriss ihm die Pistole und konnte ihn – wenigstens für den Augenblick – dazu bewegen, seine Selbstmordabsichten aufzugeben.
Er brachte ihn zu einer Dame in der Rue des Noyers, bei der er selbst Unterschlupf gefunden hatte. Und dort legte Pichegru seinen Dolch auf den Tisch und sagte: »Noch ein Abend wie dieser, und alles wird ein Ende haben.«
In seinen Erinnerungen aus der Revolutionszeit berichtet Charles Nodier eine merkwürdige Anekdote, die sich wie eine Vorahnung dessen ausnimmt, was sich zehn Jahre später im Temple-Gefängnis zutragen sollte.
Wie der ganze Generalstab Pichegrus trug der junge Nodier Krawatten aus schwarzer Seide, die sehr eng am Hals gebunden waren. Um sich von den merveilleux der Zeit mit ihrer ausladenden Krawatte im Stil Saint-Justs abzusetzen, pflegte der junge Mann seine Krawatte mit einem einzigen Knoten rechts zu knüpfen.
In Befolgung der Ordre Saint-Justs schlief man angekleidet. Pichegru und seine zwei Sekretäre nächtigten im selben Zimmer, jeder auf einer Matratze, die auf dem Boden lag. Pichegru ging stets als Letzter gegen drei, vier Uhr morgens zu Bett.
Eines Nachts, als Nodier ein Alptraum plagte, in dem indische Thags ihn erdrosselten, erwachte er, als er eine Hand spürte, die seinen Hals berührte und den Knoten seiner Krawatte lockerte. Er wurde völlig wach und sah den General neben seinem Lager knien. »Sind Sie es, General?«, fragte er. »Benötigen Sie mich?«
»Nein«, erwiderte Pichegru. »Im Gegenteil, du hast mich benötigt: Du hast schlecht geschlafen und hast gestöhnt, und es war nicht schwer, die Ursache dafür zu erkennen. Wer wie wir eine eng geknüpfte Krawatte trägt, muss darauf achten, sie zu lockern, wenn er zu Bett geht, denn wenn man diese Vorkehrung vergisst, kann einen der Schlag rühren oder gar der unerwartete Tod treffen. Die enge Krawatte beim Schlaf ist der sichere Weg zum Selbstmord.«
Bei Monsieur de Réals Besuch, als sie sich über die Kolonisierung Guyanas unterhielten, hatte Monsieur Réal wissen wollen, ob Pichegru Wünsche habe.
»Ja, Bücher!«, hatte Pichegru gesagt.
»Geschichtswerke?«
»O nein, wahrhaftig nicht! Die Geschichte hängt mir zum Halse heraus; lassen Sie mir Seneca bringen; mir ergeht es wie dem Spieler.«
»General«, hatte Monsieur Réal lachend erwidert, »der Spieler verlangt erst nach Seneca, wenn er die letzte Partie verloren hat; so weit sind Sie noch lange nicht.«
Zur gleichen Zeit bat Pichegru, dass man ihm ein Porträt zurückgebe, das ihm weggenommen worden und das ihm teuer war. Seneca wurde ihm gebracht, und Monsieur Desmarets wollte ihm das Porträt aushändigen lassen, als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es wie alle anderen Beweisstücke dem Gericht vorgelegt werden müsse.
Als Pichegru nur das Buch erhielt, verlangte er das Porträt. Man teilte ihm mit, warum er es nicht erhielt, doch die Antwort stellte ihn nicht zufrieden.
»Dann hat Monsieur Réal sich über mich lustig gemacht, als er mit mir über Cayenne sprach«, sagte er zum Kerkermeister. Und er wartete ungeduldig auf einen weiteren Besuch Monsieur Réals.
Unterdessen war der Herzog von Enghien entführt und verurteilt worden, und Monsieur Réal war mit Arbeit so überlastet, dass er keine Zeit fand, Pichegru einen zweiten Besuch abzustatten.
Daraufhin fasste dieser offenbar den Entschluss, sich das Leben zu nehmen. Zuerst beklagte er sich über die Kälte; da es in seinem Zimmer einen Kamin gab, machte man Feuer. Zu diesem Zweck brachte man ein Bündel Reisig, damit das Feuer wieder entzündet werden konnte, wenn es erstarb.
Am übernächsten Tag fand die Wache, die morgens das Zimmer des Generals betrat, diesen reglos und still auf seinem Bett vor.
Sie rief seinen Namen – er war tot!
Eine Stunde nach dieser grausigen Entdeckung, gegen acht Uhr morgens, erhielt Savary, der im Tuilerienpalast wachhabender Offizier war, eine Nachricht des Offiziers der Elitegendarmerie, der an diesem Tag die Wachposten im Temple-Gefängnis befehligte. Die Nachricht besagte, General Pichegru sei tot in seinem Bett aufgefunden worden und man benötige ein Mitglied der Polizei, das den Sachverhalt bezeugte. Savary ließ die Nachricht sofort an den Ersten Konsul weiterleiten, und dieser ließ Savary rufen, da er dachte, jener wisse mehr. Als er sah, dass es sich nicht so verhielt, befahl er: »Informieren Sie sich unverzüglich. Zum Teufel! Das ist mir ein schöner Tod für den Eroberer Hollands!«
Savary verlor keine Sekunde, eilte zum Temple und kam gleichzeitig mit Monsieur Réal dort an, den der Oberrichter geschickt hatte, damit er ihm alle Einzelheiten berichtete.
Noch hatte niemand den Raum betreten, in dem die Wache den Toten gefunden hatte. Monsieur Réal und Savary wurden an das Bett des Toten geführt und erkannten ihn, obwohl sein Gesicht durch den Erstickungstod stark gerötet war.
Der General lag auf der rechten Seite und hatte seine Krawatte wie ein Seil um den Hals geschlungen; daran hatte er sich erhängt, indem er diesen Strang so eng wie möglich zusammengezogen hatte und dann ein Stöckchen von fünfzehn Zentimetern Länge aus dem Reisigbündel, dessen Überreste im Zimmer und im Kamin lagen, hineingesteckt und als Hebel benutzt hatte, mit dem er die Schlinge so lange zusammenschnürte, bis sein Geist sich zu trüben begann; dann hatte er den Kopf auf das Kissen sinken lassen, und unter dem Gewicht seines Halses hatte das Stöckchen die Krawatte daran gehindert, sich zu lockern. Der Atemstillstand hatte nicht auf sich warten lassen, und noch im letzten Moment hatte Pichegrus Hand das Stöckchen zu halten versucht.
Hinter ihm lag auf der Fensterbank ein aufgeschlagenes Buch, als hätte er in seiner Lektüre nur kurz innegehalten. Es war der Band Seneca, den Monsieur Réal ihm besorgt hatte; geöffnet war das Buch an der Stelle, an der Seneca schreibt: »Wer sich verschwören will, darf vor allem keine Angst vor dem Sterben haben.«
Wahrscheinlich war diese Stelle Pichegrus letzte Lektüre gewesen; seit über den Tod des Herzogs von Enghien gemunkelt wurde, hatte Pichegru angenommen, dass für ihn nur mehr die Aussicht bestand, sich entweder der Gnade des Ersten Konsuls anzuempfehlen oder zu sterben.
Auf der Stelle wurden alle verhört, die über diesen unerwarteten und befremdlichen Tod etwas sagen konnten, denn Savary dachte sich sofort, dass man diesen Tod Bonaparte anlasten würde.
Zuerst vernahm er den Gendarmen, der die Nacht in dem Vorzimmer verbracht hatte, das Georges von Pichegru trennte; dieser hatte nichts gehört bis auf einen hartnäckigen Hustenanfall des Generals gegen ein Uhr morgens, und da er nicht zu ihm gelangen konnte, nachdem er selbst eingeschlossen war, hatte er dieses Hustens wegen nicht das ganze Gefängnis wecken wollen. Daraufhin wurde der Gendarm verhört, der vor dem Fenster postiert war und alles sehen konnte, was in Pichegrus Zimmer vor sich ging; er hatte nichts bemerkt.
Monsieur Réal verzweifelte. »Dass es ein Selbstmord war, steht außer jeder Frage«, sagte er, »doch wir können tun, was wir wollen, es wird immer behauptet werden, der Gefangene wäre erdrosselt worden, weil man nichts gegen ihn in der Hand hatte.«
Und dies wurde in der Tat gemunkelt, wenn auch zu Unrecht. Diese Gerüchte waren für das Verfahren gegen Moreau von großem Nachteil.
In Wahrheit hatte Bonaparte keinerlei Grund, Pichegru etwas anzutun, denn ganz im Gegenteil hatte der Erste Konsul Pläne mit einem lebenden Pichegru, die seiner eigenen Beliebtheit nützen sollten. Indem Bonaparte nicht allein seinen ehemaligen Lehrer begnadigte, sondern ihn überdies in ehrenvollem Auftrag nach Cayenne schickte, konnte er den negativen Folgen einer Verurteilung Moreaus entgegenwirken. Und Pichegru brachte er nicht einen Bruchteil des Ressentiments entgegen, das er für Moreau empfand.
Zudem hätte er es kaum für opportun gehalten, in ebenjenem Augenblick, in dem die Öffentlichkeit ihm die Hinrichtung des Herzogs von Enghien so sehr verübelte, Öl ins Feuer zu gießen und Pichegru des Nachts in seiner Zelle von gedungenen Mördern erdrosseln zu lassen.
»Ach!«, sagte Bonaparte, als Réal zu ihm zurückkehrte, und schlug mit der Faust auf den Tisch, »wenn man bedenkt, dass er für die Kolonisierung Guyanas nichts weiter von uns verlangte als sechs Millionen Neger und sechs Millionen in Geld!«
43
Der Prozess
Wenn die Maßnahmen der Polizei hinsichtlich Georges so vorausschauend waren, dass dem Sicherheitspolizisten Caniolle befohlen werden konnte, am Fuß des Hügels Sainte-Geneviève auf ein Kabriolett mit der Nummer dreiundfünfzig zu warten, das zwischen sieben und acht Uhr abends vorbeifahren würde, wenn er um sieben Uhr dem Kabriolett folgen und sehen konnte, dass es am Eingang eines Gässchens neben einem Obstladen anhielt, wenn um halb acht vier Personen aus dem Gässchen kamen, darunter Georges Cadoudal und Le Ridant, und wenn Georges zuletzt dank der genauen Informationen, die man über ihn besaß, gefasst werden konnte, dann liegt das daran, dass er von seiner Abreise aus London bis zu seiner Ankunft in Paris und von dem Tag seiner Ankunft bis zum Freitag, dem 9. März, ohne Unterbrechung von dem fähigsten und intelligentesten Spitzel des Citoyen Fouché überwacht wurde, dem sogenannten Limousiner.
Und weil Fouché wusste, dass Georges sich nicht ohne Gegenwehr ergeben würde, hatte er es nicht darauf ankommen lassen wollen, seinen kostbaren Limousiner dem Zorn des bretonischen Anführers auszusetzen; ohne vorauszusehen, welches Blutbad Cadoudal unter seinen Häschern anrichten würde, hatte er ihn von Familienvätern festnehmen lassen statt durch den ledigen Limousiner.
Fouché wartete zu Hause auf die Nachricht von Cadoudals Festnahme, die ihm gegen neun Uhr überbracht wurde.
Er rief den Limousiner aus dem Nebenzimmer. »Sie haben es gehört«, sagte Fouché. »Jetzt müssen wir nur noch Villeneuve und Burban verhaften.«
»Wann immer Sie wollen. Ich weiß, wo sie wohnen.«
»Wir können uns Zeit lassen. Verlieren Sie sie nur nicht aus den Augen.«
»Habe ich Georges aus den Augen verloren?«
»Nein.«
»Gestatten Sie mir zu sagen, dass es eine Sache gibt, die Sie aus den Augen verlieren?«
»Ich?«
»Ja.«
»Und was wäre das?«
»Cadoudals Geld. Als wir aus London aufbrachen, hatte er mehr als hunderttausend Francs bei sich.«
»Wollen Sie versuchen, dieses Geld aufzustöbern?«
»Ich tue, was ich kann. Aber nichts verschwindet so schnell wie Geld.«
»Machen Sie sich noch heute Abend auf die Suche.«
»Bin ich bis morgen um die gleiche Zeit beurlaubt?«
»Zufällig bin ich für morgen um die gleiche Zeit mit dem Ersten Konsul verabredet. Es wäre mir kein geringes Vergnügen, alle seine Fragen beantworten zu können.«
Am nächsten Tag fand Fouché sich um halb zehn Uhr im Tuilerienpalast ein.
Es geschah dies vor dem Beschluss, den Herzog von Enghien entführen zu lassen. Indem wir uns mit Georges’ Festnahme befassen, sind wir einen Schritt zurückgegangen.
Fouché traf den Ersten Konsul ruhig und beinahe vergnügt an.
»Warum haben Sie mich nicht persönlich von der Festnahme Cadoudals informiert?«, fragte Bonaparte.
»Schließlich«, erwiderte Fouché, »muss man den anderen auch etwas zu tun übrig lassen.«
»Wissen Sie, wie sich die Sache abgespielt hat?«
»Er hat einen der Polizisten namens Buffet getötet und einen anderen namens Caniolle verwundet.«
»Offenbar sind beide verheiratet.«
»Ja.«
»Man muss etwas für die Ehefrauen der armen Teufel tun.«
»Ich habe daran gedacht: eine Pension für die Witwe und eine Belohnung für die Frau des Verwundeten.«
»Eigentlich müsste England ihnen dieses Geld auszahlen.«
»Das wird es auch tun.«
»Wie das?«
»England oder Cadoudal. Denn da Cadoudals Geld englisches Geld ist, wird letzten Endes England die Pension bezahlen.«
»Man hat mir aber gesagt, er habe nur tausend bis zwölfhundert Francs bei sich gehabt und die Durchsuchung seines Quartiers habe nichts erbracht.«
»Er ist mit hunderttausend Francs aus London abgereist, und seit seiner Ankunft in Paris hat er dreißigtausend ausgegeben. Siebzigtausend waren übrig, und das ist mehr, als für die Pension der Witwe und eine Belohnung für die Verwundeten benötigt wird.«
»Und wo sind diese siebzigtausend Francs?«, fragte Bonaparte.
»Hier, bitte sehr«, sagte Fouché, und er legte einen Beutel voller Goldmünzen und Banknoten auf den Tisch.
Bonaparte leerte den Beutel neugierig aus. Es waren vierzigtausend Francs in holländischen Sovereigns, der Rest in Papiergeld.
»Oho!«, sagte Bonaparte. »Bezahlt jetzt Holland meine Meuchelmörder?«
»Nein, man hat lediglich befürchtet, mit englischem Gold Verdacht zu erregen.«
»Und wie haben Sie dieses Geld in die Finger bekommen?«
»Sie kennen doch den alten Polizeigrundsatz: Cherchez la femme!«
»Und?«
»Ich habe die Frau suchen lassen und sie gefunden.«
»Erzählen Sie schnell, ich bin heute neugierig.«
»Nun, ich wusste, dass eine gewisse Izaï, eine Kurtisane aus dem vierten Stand, sich den Verschwörern angeschlossen hatte und bei der Obsthändlerin ein Zimmer gemietet hatte, in dem sie sich bisweilen trafen. Als Georges in das Kabriolett stieg, folgte sie ihnen aus der unbeleuchteten Gasse. Georges schien zu ahnen, dass er verfolgt wurde, und er hatte nur noch Zeit, den Beutel, den er in der Hand hielt, der Frau in die Schürze zu werfen und zu rufen: ›Zu dem Parfumeur Canon!‹ Diese Worte hörte Caniolle, der wiederum nur noch Zeit hatte, zu einem Polizisten zu sagen: ›Beschatten! ‹«
»Und was heißt das?«, fragte Bonaparte.
»Der Dirne folgen und sie nicht aus den Augen verlieren. Doch als sie unmittelbar nach Georges’ Verhaftung den Carrefour de l’Odéon erreichte und die Menschenmenge sah, die sich über das Geschehen unterhielt, wagte sie nicht weiterzugehen. Sie erfuhr, dass Georges festgenommen war, und fürchtete sich noch mehr; weil sie nicht wagte, nach Hause zu gehen, suchte sie Zuflucht bei einer Freundin, der sie das Päckchen zur Aufbewahrung übergab.
Ich ließ die Wohnung der Freundin durchsuchen, und so fanden wir das Päckchen. Das war alles, nicht weiter schwierig.«
»Und das Straßenmädchen haben Sie nicht festnehmen lassen?«
»Gewiss doch, wir brauchten sie ja nicht mehr. Oh, das ist eine fromme Person«, fuhr Fouché fort, »die es verdient hätte, dass der Himmel ihr besseren Schutz angedeihen ließe.«
»Was soll das heißen, Monsieur?«, fragte Bonaparte mit gerunzelter Stirn. »Sie wissen, dass ich Scherze auf Kosten der Religion nicht schätze.«
»Wissen Sie, was diese Person um den Hals hängen hatte?«, fragte Fouché.
»Woher soll ich das wissen?« fragte Bonaparte zurück, der sich nolens volens aus Neugier auf die verschlungenen Mäander der Erzählweise Fouchés einließ, ein Privileg, dessen sich niemand außer Fouché erfreute, denn zu den Eigenschaften, über die Bonaparte nicht verfügte, gehörte die des Zuhörenkönnens.
»Nun, sie trug ein Medaillon mit der Aufschrift:
Splitter vom wahren Kreuz
Verehrt in der Sainte-Chapelle in Paris
Und in der Stiftskirche von Saint-Pierre in Lille.«
»Schon gut«, sagte Bonaparte. »Nach Saint-Lazare mit ihr. Die Kinder des bedauernswerten Buffet und die Kinder Caniolles werden auf Staatskosten erzogen. Von dem Geld, das bei der Freundin der Dirne Izaï sichergestellt wurde, geben Sie der Witwe Buffet fünfzigtausend Francs, den Rest bekommt Caniolle. Ich lege eine Pension von tausend Francs aus meiner Privatschatulle für die Witwe Buffet dazu.«
»Wollen Sie, dass sie vor Freude tot umfällt?«
»Wieso das?«
»Weil sie den Tod ihres Ehemannes schon als Erlösung begrüßt haben dürfte.«
»Ich verstehe Sie nicht«, sagte Bonaparte, der die Geduld zu verlieren begann.
»Wie! Sie verstehen nicht? Wohlan! Der Ehemann war ein ausgemachter Tunichtgut, der sich jeden Abend einen gehörigen Rausch antrank und jeden Morgen seine Frau grün und blau schlug. Ohne es zu ahnen, hat unser guter Georges zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.«
»Aber nun«, sagte Bonaparte, »nachdem Georges hinter Schloss und Riegel sitzt, möchte ich die Verhörprotokolle einsehen, sobald Sie darüber verfügen. Ich will diese Geschichte Schritt für Schritt und mit größter Aufmerksamkeit verfolgen.«
»Ich habe Ihnen das erste Protokoll mitgebracht«, sagte Fouché, »und es liest sich nicht gerade wie Vergil oder Horaz, wie wir sie ad usum delphini den Schülern der Oratorianer von Paimbœuf zu lesen geben, sondern es ist Wort für Wort die Mitschrift dessen, was Georges und Monsieur Réal gesagt haben.«
»Werden die Worte der Angeklagten in den Verhörprotokollen in anderen Fällen etwa verändert?«
»Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Worte der Redner auf der Tribüne nie dieselben sind wie im Abdruck der Rede im Moniteur? Nun, ebenso verhält es sich mit den Verhörprotokollen; der Wortlaut wird nicht verändert, sondern verschönert.«
»Befassen wir uns mit Georges’ Worten.«
44
Das Temple-Gefängnis
Fouché reichte dem Ersten Konsul ein Papier, das dieser lebhaft ergriff; er überflog die ersten Fragen, die von Gesetz wegen vorgeschrieben sind, und begann bei der vierten Frage zu lesen.
Frage: Seit wann halten Sie sich in Paris auf?
Antwort: Seit fünf, sechs Monaten. Genauer kann ich es nicht sagen.
F: Wo haben Sie gewohnt?
A: Nirgends.
F: In welcher Absicht sind Sie nach Paris gekommen?
A: Um den Ersten Konsul zu überfallen.
F: Mit dem Dolch?
A: Nein, mit Waffen wie denen seiner Eskorte.
F: Erklären Sie das bitte.
A: Meine Offiziere und ich haben die Wachen Bonapartes gezählt, es sind dreißig; ich und neunundzwanzig der Meinen hätten Mann für Mann gegen sie gekämpft, nachdem wir auf den Champs-Élysées Seile gespannt hätten, um die Eskorte aufzuhalten, und sie mit vorgehaltener Pistole zum Kampf gezwungen hätten; und dann hätten wir auf die gute Sache und auf unseren Mut vertraut, und Gott hätte uns nicht im Stich gelassen.
F: Wer hat Sie beauftragt, nach Frankreich zu kommen?
A: Die Prinzen: Einer von ihnen hätte sich zu uns gesellt, sobald ich ihnen geschrieben hätte, dass ich mich in der Lage sähe, mein Ziel zu erreichen.
F: Mit wem haben Sie in Paris verkehrt?
A: Gestatten Sie mir, Ihnen die Antwort zu verweigern. Ich will die Zahl der Opfer nicht vergrößern.
F: Hatte Pichegru etwas mit dem Plan Ihres Überfalls auf den Ersten Konsul zu tun?
A: Nein. Er hat davon nie etwas wissen wollen.
F: Aber angenommen, Ihr Vorhaben wäre Ihnen gelungen, hätte der Tod des Ersten Konsuls ihm dann für sein weiteres Handeln von Nutzen sein können?
A: Das ist sein Geheimnis, nicht meines.
F: Angenommen, der Überfall wäre Ihnen geglückt, was hätten Sie und Ihre Mitverschwörer dann unternommen?
A: Wir hätten einen Bourbonen an die Stelle des Ersten Konsuls gesetzt. F: Und welcher Bourbone war dafür ausersehen?
A: Louis-Stanislas-Xavier, vormalig Monsieur, Graf von Provence, den wir als Ludwig XVIII. anerkennen.
F: Ihr Vorhaben war also in Übereinkunft mit den vormaligen französischen Prinzen ersonnen worden und wäre unter deren Mitwisserschaft ausgeführt worden?
A: Ja, Citoyen Richter.
F: Sie haben sich also mit den vormaligen Prinzen verständigt.
A: Ja, Citoyen Richter.
F: Wer war für die Finanzierung und die Bewaffnung zuständig?
A: Das Geld besaß ich seit Langem. Nur die Waffen fehlten mir.
Bonaparte wendete das Blatt Papier um. Die andere Seite war leer, das Verhör war beendet.
»Was für eine absurde Idee«, sagte er, »mich mit einer Anzahl von Männern anzugreifen, die meiner Eskorte entspricht!«
»Beschweren Sie sich nicht!«, sagte Fouché mit spöttischem Lachen. »Man wollte Sie nicht niedermetzeln, sondern nur umbringen. Eine Art von Schlacht der Dreißig, ein Duell im Stil des Mittelalters mit Sekundanten.«
»Ein Duell mit Georges?«
»Sie waren doch bereit, sich ohne Sekundanten mit Moreau zu schlagen.«
»Moreau ist Moreau, Monsieur Fouché, ein großer General, ein Städtebezwinger, ein Sieger. Sein Rückzug aus dem tiefsten Deutschland zur Grenze Frankreichs hat ihn zu einem zweiten Xenophon geadelt. Seine Schlacht von Hohenlinden hat ihn Hoche und Pichegru gleichgestellt, während Georges nichts als ein Räuberhauptmann ist, eine Art royalistischer Spartakus, ein Mann, gegen den man sich wehrt... mit dem man sich aber nicht duelliert: Vergessen Sie das bitte nicht, Monsieur.«
Und Bonaparte erhob sich, um Fouché anzudeuten, dass die Arbeit beendet sei.
Die zwei schrecklichen Neuigkeiten von der Hinrichtung des Herzogs von Enghien und von Pichegrus Selbstmord überraschten Paris innerhalb weniger Tage, und es steht außer Frage, dass die grausame Exekution des Herzogs den Selbstmord Pichegrus erst recht unglaubwürdig erscheinen ließ.
Insbesondere im Temple-Gefängnis hatte die Nachricht unter den politischen Gefangenen eine niederschmetternde Wirkung, und es erfüllte sich, was Réal Savary am Bett des Toten prophezeit hatte: »Wir werden den Selbstmord des Generals über jeden Zweifel hinaus beweisen können und doch die Gerüchte nicht unterbinden können, wir hätten ihn erdrosselt.«
Wir sagten unsere – durchaus persönliche – Meinung über den Tod des Generals; wir wollen nicht anstehen, die Meinung der Männer auszusprechen, die das Gefängnis mit ihm teilten und die in gewisser Weise Zeugen des Endes eines so ruhmvollen wie tragischen Lebens waren.
Betrachten wir also der Reihe nach, was die Gefangenen gesagt haben, die ihm am nächsten standen.
Ein Mann, der hier nicht zum ersten Mal Erwähnung findet, der bereits einen unheilvollen Einfluss auf Pichegrus Leben ausgeübt hatte, der Schweizer Buchhändler Fauche-Borel nämlich, der dem General die ersten Offerten des Fürsten von Condé überbracht hatte, war am 1. Juli des Vorjahres festgenommen und in das Temple-Gefängnis gebracht worden.
In diesem Gefängnis hatte man nach und nach auch Moreau, Pichegru, Cadoudal und alle Komplizen der großen Verschwörung inhaftiert – Joyaut, genannt Villeneuve, Roger, genannt Loiseau, und nicht zuletzt Coster Saint-Victor, der durch den Schutz aller hübschen Freudenmädchen bis zuletzt den Häschern der Polizei entkommen war und jede Nacht an einem anderen Ort verbracht hatte; als man Fouché zu Rate zog, hatte dieser nur gesagt: »Stellen Sie einen Mann, der ihn kennt, vor das Vergnügungsetablissement Frascati, und es wird keine drei Tage dauern, bis Ihnen der Vogel ins Netz geht«, und schon am zweiten Tag wurde der Gesuchte verhaftet, als er das Lokal verließ.
Zur Zeit der Festnahme des Herzogs von Enghien befanden sich im Temple-Gefängnis siebenhundert Gefangene, und es war so überfüllt, dass man keine Zelle für den Herzog finden konnte. Daher sein Aufenthalt von fünf Stunden Dauer an der Stadtgrenze: Man suchte nach einer provisorischen Unterkunft für ihn, bis jene Kammer bereit war, die, wie es der Totengräber in Hamlet ausdrückt, bis zum Jüngsten Tage währt.
Wir berichteten Exekution und Tod des Herzogs von Enghien.
Ich wiederhole: Im Temple gab es keinen einzigen Gefangenen, der nicht im tiefsten Inneren überzeugt gewesen wäre, dass Pichegru ermordet worden war. Fauche-Borel behauptet nicht nur, Pichegru sei erdrosselt worden, sondern benennt sogar die Täter.
Folgendes schreibt er im Jahr 1807: »Ich konnte mich davon überzeugen, dass dieser Mord von einem gewissen Spon begangen wurde, Brigadier der Elitekompanie, unter Mittäterschaft von zwei Schließern, deren einer, wiewohl recht kräftig, zwei Monate nach der Tat verstarb, während der andere, ein gewisser Savard, als einer der Täter der September-Massaker von 92 wiedererkannt wurde.«
Die Gefangenen standen noch unter dem niederschmetternden Eindruck dieser schrecklichen Überzeugung, als sie General Savary in Galauniform und mit großem Gefolge in das Gefängnis kommen sahen, darunter Louis Bonaparte, der unbedingt Georges Cadoudal sehen wollte. Georges war soeben rasiert worden; er lag auf seinem Bett, die Hände mit Handschellen auf dem Bauch gefesselt. Zwei Gendarmen bewachten ihn, so dass in dem kleinen Turmzimmer kaum noch Platz war. Die Besucher drängten sich hinein, als wollten sie sich über die traurige Lage des royalistischen Anführers belustigen, der seinerseits über ihre Anwesenheit alles andere als erfreut war. Nach zehn Minuten des Beäugens und Getuschels gingen sie, wie sie gekommen waren.
»Was waren das denn für herausgeputzte Gecken?«, fragte Georges seine Bewacher.
»Das war der Bruder des Ersten Konsuls«, erwiderte der eine, »in Begleitung von General Savary und seinem Generalstab.«
»Da habt ihr weiß Gott gut daran getan, mir Handschellen anzulegen.«
Unterdessen wurde das Verfahren vorbereitet, und je mehr es voranschritt, desto lockerer schienen die Vorschriften im Temple-Gefängnis gehandhabt zu werden. Die Gefangenen durften ihre Zellen verlassen und sich im Garten ergehen, was wiederholt zu heftigen Kollisionen zu führen drohte. Savary hatte die Oberhoheit über das Gefängnis inne und hatte es in eine Art Kaserne umgewandelt; die Gefangenen hassten ihn zwangsläufig, doch das hinderte ihn nicht daran, den Kerker häufiger als nötig zu besuchen. Eines Tages sah Moreau sich beim Verlassen seiner Zelle Savary gegenüber; er machte kehrt, drehte ihm den Rücken zu und schlug ihm die Tür seiner Zelle vor der Nase zu.
Was Moreau betrifft, gibt es kaum etwas Ergreifenderes als die Bezeigungen tiefer Achtung, die ihm alle Militärs erwiesen, die im Gefängnis Dienst taten: Alle führten die Hand an den Hut und salutierten. Wenn er sich setzte, bildeten sie einen Kreis um ihn und warteten darauf, dass er gnädig das Wort an sie richtete, und dann baten sie ihn untertänig, ihnen von seinen militärischen Großtaten zu erzählen, die ihn zum Rivalen Bonapartes gemacht und weit über alle anderen Generäle gestellt hatten. Niemand bezweifelte, dass sie gehorcht und die Tore des Gefängnisses für ihn geöffnet hätten, hätte er ihre Hilfe verlangt; im Übrigen waltete auch ihm gegenüber Milde wie in allen anderen Fällen, er durfte Frau und Sohn sehen, und die junge Mutter kam jeden Tag mit dem Kind. Hin und wieder brachte man Moreau den hervorragenden Wein von Clos-Vougeot, und er teilte ihn an alle Kranken aus und bisweilen sogar an jene, die gar nicht krank waren. Es muss nicht eigens gesagt werden, dass Barren- und Ballspieler, wenn sie sich erhitzt hatten, als Kranke betrachtet wurden und ihr Glas Clos-Vougeot erhielten. Was Georges und seine Gefährten von den anderen Gefängnisinsassen unterschied, war ihre Fröhlichkeit und Unbekümmertheit; sie betrieben ihre Spiele so lärmend wie eine Horde Schuljungen; unter ihnen gab es zwei der schönsten und elegantesten Männer von ganz Paris: Coster Saint-Victor und Roger, genannt Loiseau. Eines Tages, als Letzterer sich beim Barrenspiel erhitzt hatte, legte er seine Krawatte ab. »Weißt du eigentlich«, sagte Saint-Victor zu ihm, »dass du den Hals eines wahren Antinoos hast, mein Lieber?«
»Pah!«, entgegnete Roger, »dazu musst du mir nicht mehr gratulieren, in acht Tagen wird er durchgeschnitten.«
Schon bald war alles vorbereitet, damit die Angeklagten vor Gericht erscheinen konnten und die Verhandlung eröffnet werden konnte. Die Zahl der Angeklagten belief sich auf siebenundfünfzig Personen, und sie wurden benachrichtigt, dass sie sich bereithalten sollten, in die Conciergerie verlegt zu werden.
Die Haft nahm einen völlig neuen Aspekt an. Voller Begeisterung, sich dem Ende einer Gefangenschaft zu nähern, das für manche mit dem Ende des Lebens gleichbedeutend war, sangen alle lauthals, während sie ihre Koffer packten und ihre Sachen zusammenschnürten; die einen sangen, die anderen pfiffen, und alle betäubten sich, so gut sie konnten; Nachdenklichkeit und Kummer überließen sie denen, die im Temple-Gefängnis blieben.
45
Das Gericht
Georges Cadoudal, der nicht nur der Fröhlichste – sagen wir ruhig: der Verrückteste – unter allen Gefangenen gewesen war, der sich in allen Spielen hervorgetan und neue erfunden hatte, wenn die bekannten Spiele fade wurden, Cadoudal, der die phantastischsten Geschichten erzählt hatte, der am geistreichsten und beißendsten das neue Imperium verspottet hatte, das auf den Trümmern des Throns Ludwigs XVI. errichtet wurde, der mit so munteren Versen die dahinschwindende Republik besungen hatte, dieser Cadoudal spielte nicht mehr, lachte nicht mehr und sang nicht mehr, als er sah, dass die Stunde gekommen war, da er tatsächlich mit seinem Leben würde bezahlen müssen; er setzte sich in einen Winkel des Gartens, sammelte seine Adjutanten und seine Offiziere um sich und sagte in zärtlichem und zugleich entschiedenem Ton zu ihnen: »Meine tapferen Freunde, meine lieben Kinder, bis heute war ich euch ein Muster an Sorglosigkeit und Frohsinn; lasst mich euch raten, vor dem Gericht alle Ruhe, alle Kaltblütigkeit, alle Würde zu zeigen, die euch zu Gebote stehen; ihr werdet vor Männern auftreten, die sich das Recht anmaßen, über eure Freiheit zu entscheiden, über eure Ehre, über euer Leben; vor allem rate ich euch, niemals unüberlegt, verärgert oder arrogant auf die Fragen zu antworten, die eure Richter euch stellen werden; antwortet ohne Furcht, ohne Besorgnis und ohne Schüchternheit; betrachtet euch als die Richter über eure Richter; und wenn ihr euch aus eigener Kraft nicht stark genug wähnt, dann denkt daran, dass ich bei euch bin und dass mein Schicksal sich von dem euren nicht unterscheiden wird; wenn ihr leben werdet, werde ich leben, und wenn ihr sterben werdet, werde ich sterben.
Seid sanftmütig, nachsichtig und brüderlich untereinander; lasst es an Zuneigung und Rücksichtnahme nicht fehlen; macht euch untereinander keine Vorwürfe, den anderen in Gefahr gebracht zu haben; möge jeder von euch sich seinem eigenen Tod stellen und ihn würdig sterben!
Bevor ihr dieses Gefängnis verlasst, wurdet ihr dort auf verschiedene Weise behandelt; die einen waren freundlich zu euch, die anderen grob, die einen nannten euch Freunde, die anderen nannten euch Briganten. Dankt denen, die euch gut behandelt haben, genauso wie denen, die euch schlecht behandelt haben; verlasst diesen Ort mit dem Gefühl der Dankbarkeit für die einen und ohne Hass auf die anderen; denkt daran, dass unser gütiger König Ludwig XVI., der wie wir in diesem Kerker untergebracht war, als Verräter und Tyrann beschimpft wurde; selbst unser Herr Jesus Christus« (und bei diesem Namen lüpften alle mit der einen Hand den Hut und bekreuzigten sich mit der anderen) »wurde als Aufwiegler und Hochstapler verleumdet, verspottet, geschlagen, ausgepeitscht, denn wenn sie Böses tun, sagen die Menschen auch das Falsche und schimpfen, um sie zu erniedrigen, diejenigen, die es in Wahrheit zu preisen gälte.«
Und dann erhob er sich und sagte laut: »Amen!«, bekreuzigte sich, was die anderen ihm nachtaten, rief sie einen nach dem anderen auf, nannte sie beim Namen, wies sie an hinauszugehen, und folgte ihnen als Letzter.
An diesem Tag blieben von den siebenundfünfzig Gefangenen, die in die Verschwörung Moreaus, Cadoudals und Pichegrus verwickelt waren, nur die Komplizen zweiter Ordnung im Temple-Gefängnis, die Helfershelfer, die den Verschwörern unterwegs Obdach gewährt und als nächtliche Führer gedient hatten. Sobald die Hauptschuldigen nicht mehr da waren, durften die anderen sich nicht nur in den Höfen und Gärten bewegen, sondern sogar in den anderen Kammern und Kerkerzellen.
Einige Tage lang ging es in dem Gefängnis recht laut und unruhig zu. Am Palmsonntag schließlich wurde den Gefangenen gestattet, in dem großen Saal, aus dem alle Betten entfernt worden waren, einen Ball zu veranstalten, und die Gefangenen, ausnahmslos aus dem Bauernstand, sangen und tanzten.
Dieser Ball fand am selben Tag statt, an dem die Angeklagten dem Gericht vorgeführt wurden, was die Tanzenden nicht wussten. Einer von ihnen, ein Mann namens Leclerc, erfuhr von einem Schließer, dass das Gerichtsverfahren, das mit dem Todesurteil gegen zwölf der Angeklagten enden sollte, begonnen hatte; und er sprang mitten unter die Tanzenden und stampfte mit dem Fuß auf, um sie zum Schweigen zu bringen. Stille trat ein, alle hielten inne.
»Ihr Unseligen!«, rief Leclerc. »Was ist das für ein Betragen an diesem verfluchten Ort, obwohl ihr wisst, dass jene, die ihn mit euch bewohnten und ihn verlassen haben, im Begriff stehen, ihr Leben zu verlieren? Ihr solltet besser beten und das De Profundis singen, statt herumzuspringen und volkstümliche Weisen zu grölen! Monsieur dort hält ein geistliches Buch in der Hand; er kann uns etwas Erbauliches vortragen, das vom Tod handelt.«
Der Mann, auf den Leclerc deutete, war der Neffe Fauche-Borels, ein junger Mann namens Vitel; das Buch in seiner Hand war ein Band Bourdaloue, der kein De Profundis, aber eine Totenpredigt enthielt. Vitel bestieg einen Tisch und las die Predigt vor, und alle Anwesenden lauschten kniend seinem Vortrag.
Wie gesagt, war die Gerichtsverhandlung eröffnet worden.
Nie zuvor hatte Bonaparte sich vielleicht in einer schwierigeren Situation befunden, nicht einmal im Vendémiare, nicht einmal am 18. Brumaire; sein Ansehen als das eines herausragenden Feldherrn auf dem Schlachtfeld war ungeschmälert, doch sein moralisches Ansehen als Staatsmann war durch den Tod des Herzogs von Enghien mit einem untilgbaren Makel gezeichnet, verstärkt durch die mysteriösen Umstände des Selbstmords Pichegrus. Die wenigsten teilten Savarys Ansicht über den Tod des Generals. Je eifriger die Regierung die Beweise für den Freitod sammelte und veröffentlichte, desto hartnäckiger verfestigte sich in den Köpfen der Zweifel an einem Selbstmord, den fast alle Gerichtsärzte für ein Ding der Unmöglichkeit erklärten; und zu der eingestandenen Hinrichtung des Herzogs von Enghien und der abgestrittenen Ermordung Pichegrus kam nun die Anklage gegen den allseits beliebten Moreau hinzu.
Von dieser Anklage hatte sich niemand hinters Licht führen lassen, denn jedermann hatte dahinter den Neid und die Eifersucht Bonapartes auf einen Rivalen erkannt; Bonaparte war so tief davon überzeugt, dass Moreau selbst auf der Anklagebank nichts von seiner Macht und seinem Einfluss eingebüßt haben würde, dass auf seine Anweisung lange überlegt wurde, wie viele Wachen man für Moreau zu bestellen habe. Bonapartes Besorgnis war so groß, dass er seinen Groll auf Bourrienne hintanstellte. Er ließ ihn aus dem Exil zurückholen, beauftragte ihn, der Gerichtsverhandlung beizuwohnen und ihn jeden Abend davon zu unterrichten, was tagsüber vor Gericht verhandelt worden war.
Nun, da der Herzog von Enghien füsiliert und Pichegru erdrosselt war, wünschte Bonaparte vor allem eines: dass Moreau schuldig erklärt und verurteilt wurde, damit er, Bonaparte, ihn begnadigen konnte; er nahm deshalb sogar Verbindung zu einzelnen Richtern auf, denen er mitteilen ließ, er wünsche Moreaus Aburteilung nur, um ihn begnadigen zu können, doch mit diesen Einflüsterungsversuchen hatte es ein Ende, als der Richter Clavier auf die Beteuerungen der Begnadigung Moreaus nach einer Verurteilung erwiderte: »Und wer wird uns begnadigen?«
Man kann sich keine Vorstellung von den Menschenmassen machen, die am ersten Verhandlungstag zum Justizpalast strömten; die vornehmste Gesellschaft von Paris wollte dem Gerichtsverfahren beiwohnen; der Verzicht auf Geschworene in diesem Verfahren bewies, welche Bedeutung das Regierungsoberhaupt dem Urteil beimaß. Um zehn Uhr vormittags machte die Menge Platz, damit die zwölf Richter des Tribunals in ihren roten Talaren das Gericht betreten konnten. Der große Saal war für das Verfahren vorgesehen, und die Richter nahmen schweigend Platz.
Diese Richter waren Hémard, der Vorsitzende Richter, Martineau, zweiter Vorsitzender, Thuriot, von den Royalisten »Tueroi« genannt, Lecourbe, Bruder des Generals gleichen Namens, Clavier, der Urheber der mutigen Antwort, die wir weiter oben berichteten, Bourguignon, Dameu, Laguillaumie, Rigault, Selves und Grangeret-Desmaisons.
Der Staatsanwalt hieß Gérard, der Gerichtsschreiber Frémyn.
Acht Gerichtsdiener zählten zum Gerichtshof, und der Arzt des Temple-Gefängnisses, Souppé, sowie der Arzt der Conciergerie durften den Verhandlungen nicht fernbleiben.
Der Vorsitzende ordnete an, die Gefangenen vorzuführen. Einer nach dem anderen traten sie zwischen zwei Gendarmen ein: Bouvet de Lozier kam gesenkten Hauptes herein, denn er wagte den Blick nicht zu jenen zu heben, die sein fehlgeschlagener Selbstmord verraten hatte. Alle anderen waren ernst und selbstbeherrscht.
Moreau, der neben den anderen auf der Anklagebank saß, wirkte ruhig oder eher geistesabwesend; er trug einen langen dunkelblauen Gehrock von militärischem Zuschnitt, doch kein Abzeichen seines Rangs. Neben ihm saßen, durch Gendarmen voneinander getrennt, Lajolais, sein früherer Adjutant, und der junge und schöne Charles d’Hozier, der so erlesen gewandet war, dass man hätte meinen können, er hätte sich für einen Hofball angekleidet. Georges wiederum, den die Zuschauer einander als die interessanteste Persönlichkeit unter den Angeklagten zeigten, war leicht erkennbar an seinem riesigen Kopf, seinen mächtigen Schultern, seinem starren und hochmütigen Blick, der von einem Richter zum anderen wanderte, als wolle er sie herausfordern; neben ihm saßen Burban, der sich auf seinen kriegerischen Unternehmungen abwechselnd Malabry und Barco nannte, und Pierre Cadoudal, der ein Rind mit einem Faustschlag niederstrecken konnte und im ganzen Morbihan nur unter dem Namen Bras-de-Fer bekannt war. Die Brüder Polignac und der Marquis de Rivière saßen in der zweiten Reihe und zogen durch ihre Jugend und Eleganz die Blicke des Publikums auf sich. Doch sie schwanden zur Bedeutungslosigkeit neben dem schönen Coster Saint-Victor, obwohl neben diesem Roger, genannt Loiseau, saß, der so wenig auf seinen Antinoos-Hals gab.
Über Coster Saint-Victor wurde etwas gemunkelt, was ihn in den Augen der weiblichen Zuschauer besonders interessant machte: Es hieß, Bonaparte verfolge ihn auch aus Eifersucht, nicht militärischer Art wie bei Moreau, sondern in Liebesdingen; es hieß, Bonaparte und er seien sich im Schlafzimmer einer der schönsten und berühmtesten Schauspielerinnen jener Zeit in die Quere gekommen und Coster Saint-Victor habe so getan, als erkenne er den Ersten Konsul nicht, und sei Sieger geblieben, nicht auf dem Schlachtfeld, sondern auf dem Feld der Liebe.
Er hätte den Ersten Konsul damals ohne Weiteres töten können, doch er hatte Georges Cadoudal sein Wort gegeben, nur mit gleichen Waffen zu kämpfen, und hatte es gehalten.
In der dritten Reihe schließlich saßen die wackeren Chouans, die aus Hingabe mitgemacht hatten, die ihr Leben aufs Spiel setzten, wenn sie scheiterten, und die, wenn sie Erfolg hatten, nichts anderes blieben als einfache Bauern.
Unter den sechsundvierzig Angeklagten – so viele waren von den ursprünglich siebenundfünfzig übrig geblieben – befanden sich fünf Frauen: die Ehefrauen Denaud, Dubuisson, Gallois und Monier und das Freudenmädchen Izaï, dem Cadoudal die sechzigtausend Francs anvertraut hatte, die Fouché als Pension und Belohnung an die Witwe Buffet und die Ehefrau Caniolle verteilen wollte.
Das Verhör begann mit den Fragen des Gerichtsvorsitzenden an die fünf Zeugen, Polizisten und Privatpersonen, die geholfen hatten, Georges festzunehmen. Jeder von ihnen machte seine Aussage. Nach der Befragung wandte sich der Vorsitzende an Georges.
»Georges«, sagte er zu ihm, »haben Sie etwas zu sagen?«
»Nein«, erwiderte Georges, ohne den Blick von seiner Lektüre zu heben.
»Geben Sie zu, was Ihnen zur Last gelegt wird?«
»Ich gebe es zu«, erwiderte Georges so kaltblütig wie zuvor.
»Der Angeklagte Georges wird aufgefordert, nicht zu lesen, wenn das Wort an ihn gerichtet ist«, sagte Untersuchungsrichter Thuriot.
»Was ich lese, ist aber überaus interessant«, erwiderte Georges, »es ist der Bericht von der Sitzung am 17. Januar 1793, in der Sie über den Tod des Königs abgestimmt haben.«
Thuriot biss sich auf die Lippen. Gemurmel drang aus dem Publikum. Der Vorsitzende beeilte sich, das Raunen zu unterbinden, indem er mit dem Verhör fortfuhr.
»Sie geben zu«, sagte er zu Georges, »dass Sie sich an dem Ort befanden, den die Zeugen angegeben haben?«
»Ich weiß nicht, wie der Ort heißt.«
»Haben Sie zwei Pistolenschüsse abgegeben?«
»Das weiß ich nicht mehr.«
»Haben Sie einen Mann erschossen?«
»Ich muß sagen, dass ich es nicht weiß.«
»Sie hatten einen Dolch bei sich.«
»Das kann sein.«
»Und zwei Pistolen?«
»Das ist möglich.«
»Mit wem befanden Sie sich in dem Kabriolett?«
»Das habe ich vergessen.«
»Wo haben Sie in Paris gewohnt?«
»Bei niemandem.«
»Als Sie festgenommen wurden, wohnten Sie da nicht in der Rue de la Montagne Sainte-Geneviève bei einer Obsthändlerin?«
»Als ich festgenommen wurde, wohnte ich in meinem Kabriolett.«
»Wo haben Sie in der Nacht vor Ihrer Festnahme übernachtet?«
»In der Nacht vor meiner Festnahme war ich nicht zu Bett.«
»Was haben Sie in Paris getan?«
»Ich bin spazieren gegangen.«
»Wen haben Sie in Paris gesehen?«
»Eine Menge Spitzel, die mir folgten.«
»Sie sehen, dass der Angeklagte nicht antworten will«, sagte der Untersuchungsrichter, »befragen wir einen anderen.«
»Danke, Monsieur Thuriot... Gendarmen, geben Sie mir ein Glas Wasser; wenn ich diesen Namen in den Mund genommen habe, spüle ich ihn gerne aus.«
Man wird sich vorstellen können, welche gehässige Heiterkeit solche Wortwechsel im Publikum weckten; jeder der Anwesenden spürte, dass Georges sein Leben geopfert hatte, und man brachte ihm schon im Voraus die Hochachtung entgegen, die man den zum Tode Verurteilten zollt.
Voller Ungeduld wurde Moreaus Verhör erwartet; doch erst am vierten Tag, dem 31. Mai, einem Donnerstag, vernahm ihn Richter Thuriot.
Wie bei Cadoudal wurden zuerst die Belastungszeugen vernommen. Unter diesen erkannte jedoch kein einziger Moreau wieder. Und mit einem verächtlichen Lächeln sagte dieser: »Meine Herren, mich hat nicht nur keiner der Belastungszeugen erkannt, es hat mich auch keiner der anderen Angeklagten gesehen, bevor ich im Temple-Gefängnis eingekerkert wurde.«
Man verlas die Aussage eines gewissen Roland, eines Dieners Pichegrus, der in seinem Verhör ausgesagt hatte, es habe ihn geschmerzt, von Pichegru mit dem Auftrag zu Moreau geschickt zu werden, den er erfüllt habe, und noch mehr geschmerzt, als er ihn erfüllt hatte.
Moreau erhob sich und wandte sich an den Vorsitzenden. »Entweder«, sagte er, »gehört dieser Roland zur Polizei, oder er hat seine Aussage gemacht, weil er Angst hatte. Ich werde Ihnen sagen, wie die Dinge zwischen dem Untersuchungsrichter und diesem Mann vor sich gegangen sind.
Man hat ihn nicht verhört. O nein, denn das hätte nichts erbracht. Als er verhört wurde, hat man zu ihm gesagt: ›Sie befinden sich in einer aussichtslosen Lage, Sie werden als Mittäter oder Mitwisser einer Verschwörung angeklagt werden; wenn Sie keine Aussage machen, wird man Sie als Verschwörer behandeln, wenn Sie gestehen, retten Sie Ihren Hals.‹ Und um seinen Hals zu retten, hat dieser Mann das Lügenmärchen zusammengestrickt, das er Ihnen erzählt hat. Ich frage jeden Mann von ehrlicher Gesinnung und zuverlässigem Verstand: Zu welchem Zweck hätte ich konspirieren sollen?«
»Nun«, sagte Hémard, »weil Sie Diktator werden wollten.«
»Diktator, ich?«, rief Moreau. »Dann möchte ich meine Parteigänger sehen! Meine Parteigänger sind alle französischen Soldaten, da ich neun Zehntel von ihnen befehligt und mehr als fünfzigtausend von ihnen gerettet habe. Das sind meine Parteigänger. Alle meine Adjutanten, alle Offiziere, mit denen ich zu tun hatte, wurden verhaftet, und dennoch ließ sich gegen keinen von ihnen der Schatten eines Verdachts erhärten. Es war die Rede von meinem Vermögen: Ich habe zu Anfang nichts besessen und besitze heute nur ein Haus in Paris und meine Ländereien von Grosbois; meine Bezüge als kommandierender General betragen vierzigtausend Francs, aber ich hoffe, dass man diesen Betrag nicht mit meinen Verdiensten gleichsetzen wird.«
In diesem Augenblick ereignete sich ein seltsamer Zwischenfall, fast wie von dem General und seinem Adjutanten Lecourbe ausgeheckt, um die Macht des Siegers von Hohenlinden besonders eindrucksvoll in Szene zu setzen: Lecourbe betrat den Gerichtssaal mit einem Kind in den Armen. Es war Moreaus Sohn, den er ihm brachte, damit der Vater ihn in die Arme schließen konnte, doch die Soldaten, die den Gerichtssaal bewachten und nicht wussten, wessen Kind da gebracht wurde, verweigerten Lecourbe den Zutritt. Da hob dieser das Kind hoch und rief: »Soldaten, lasst den Sohn eures Generals passieren!«
Kaum waren diese Worte erklungen, präsentierten alle Militärs im Saal ihre Waffen und alle Zuschauer applaudierten. Hochrufe ertönten: »Es lebe Moreau!«
Die allgemeine Begeisterung war so groß, dass Moreau nur ein Wort hätte sagen müssen, und das Gericht wäre gestürzt und die Angeklagten wären im Triumph entführt worden.
Moreau aber schwieg und rührte sich nicht.
Cadoudal beugte sich zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr: »General, noch so eine Gerichtsverhandlung, und es liegt nur an Ihnen, ob Sie noch am selben Abend im Tuilerienpalast schlafen werden.«
46
Das Urteil
Bei der Verhandlung am 2. Juni erregte ein unerwarteter Zeuge besonders lebhaftes Interesse: Kapitän Wright, der Kommandant der kleinen Brigg, der die Angeklagten am Fuß der Klippe von Biville abgesetzt hatte.
Vor Saint-Malo hatte er sich, von einer Windstille überrascht, dem Angriff durch fünf oder sechs französische Schaluppen ausgesetzt gefunden, und nach einem Gefecht, in dessen Verlauf eine Kugel seinen Arm verletzt hatte, war er gefangen genommen worden. Als er erschien, ging ein Raunen durch den Saal.
Die Zuschauer standen auf, stellten sich auf die Zehenspitzen und erblickten einen kleinen, schmächtigen Mann von schwächlichem Körperbau in der Uniform der englischen Königlichen Marine, den Arm in einer Schlinge. Er gab an, Korvettenkapitän zu sein, fünfunddreißig Jahre alt, und in London bei seinem Freund Kommodore Sidney Smith zu logieren. Da der Zeuge sich nur mit Mühe auf den Beinen hielt, ließ man ihm einen Stuhl bringen. Der Kapitän dankte und setzte sich; er war so bleich, als wäre er einer Ohnmacht nahe.
Coster Saint-Victor reichte ihm ein Riechfläschchen mit Eau de Cologne. Der Kapitän erhob sich, salutierte beherrscht und mit vollendeter Höflichkeit und wendete sich wieder den Richtern zu. Der Vorsitzende wollte mit dem Verhör fortfahren.
Der Kapitän aber schüttelte den Kopf. »Ich wurde im Verlauf eines Gefechts gefangen genommen«, sagte er, »und bin Kriegsgefangener; ich bestehe auf den Rechten, die mir daraus erwachsen.«
Daraufhin verlas man ihm das Protokoll seines Verhörs vom 21. Mai.
Der Zeuge hörte aufmerksam zu und sagte: »Verzeihen Sie, Herr Vorsitzender, aber ich kann darin nichts von der Drohung finden, die mir gemacht wurde, dass ich vor ein Militärtribunal gestellt und füsiliert werden würde, wenn ich keine Geheimnisse meines Landes verriete.«
»Georges, kennen Sie den Zeugen?«, fragte der Vorsitzende.
Georges sah ihn an, zuckte die Schultern und sagte: »Ich habe ihn nie zuvor gesehen.«
»Und Sie, Wright, wollen Sie endlich auf meine Fragen antworten?«
»Nein«, erwiderte der Kapitän, »ich bin Kriegsgefangener, und ich verlange, dass ich den Regeln und Usancen entsprechend behandelt werde.«
»Verlangen Sie, was Sie wollen«, erwiderte der Vorsitzende. »Die Verhandlung wird morgen fortgesetzt.«
Es war kaum Mittag. Alle verließen den Saal und schimpften auf die Unbeherrschtheit des Vorsitzenden Hémard.
Am nächsten Tag drängten sich die Massen schon um sieben Uhr morgens um das Gerichtsgebäude, denn es ging das Gerücht, Moreau wolle zu Beginn der Verhandlung sprechen.
Diese Erwartung wurde enttäuscht, doch stattdessen bot sich dem Publikum ein überaus rührendes Schauspiel.
Die Brüder Armand und Jules de Polignac saßen nebeneinander, ohne Gendarmen, der sie trennte; sie drückten einander immer wieder die Hand, als wollten sie dem Gerichtshof trotzen und danach dem Tod und sich nicht trennen lassen.
An diesem Tag wurden Jules verschiedene Fragen gestellt, und da diese Fragen ihn in Verlegenheit zu setzen schienen, erhob sich Armand und sagte: »Meine Herren, ich bitte Sie, dieses Kind anzusehen: Es ist kaum neunzehn Jahre alt; retten Sie sein Leben. Als es mit mir nach Frankreich kam, folgte es mir, mehr tat es nicht. Ich allein bin schuldig, denn ich allein wusste, was ich tat. Ich weiß, dass Sie Köpfe fallen lassen müssen: Nehmen Sie meinen, ich biete ihn an; aber verschonen Sie diesen jungen Mann, geben Sie ihm die Zeit zu erfahren, was er verliert, bevor Sie ihn des Lebens berauben.«
Da sprang Jules auf und umschlang den Hals seines Bruders: »Oh, meine Herren!«, rief er. »Hören Sie nicht auf ihn! Eben weil ich erst neunzehn Jahre alt bin, weil ich allein auf der Welt bin, weil ich weder Frau noch Kinder habe, müssen Sie mich verurteilen. Armand hingegen ist Familienvater. In jungen Jahren und noch bevor ich mein Vaterland kannte, aß ich das Brot des Exils; mein Leben außerhalb Frankreichs ist für Frankreich unnütz und mir selbst eine Last. Nehmen Sie meinen Kopf, ich schenke ihn Ihnen, aber verschonen Sie meinen Bruder.«
Von diesem Augenblick an richtete sich das Interesse, das bis dahin nur Georges und Moreau gegolten hatte, auf all die schönen jungen Männer auf der Anklagebank, die letzten Vertreter der Treue, der Hingabe gegenüber einem gestürzten Thron.
In der Tat sammelte sich in ihnen alles, was nicht nur die royalistische Partei, sondern ganz Paris an Aristokratie, an Jugend, an Eleganz aufbieten konnte. Mit unmissverständlichem Beifall bedachte das Publikum alles, was sie sagten, und ein Zwischenfall rührte alle Anwesenden zu Tränen; der Vorsitzende Hémard zeigte Monsieur Rivière als Beweisstück ein Porträt des Grafen von Artois und fragte ihn: »Angeklagter Rivière, erkennen Sie diese Miniatur?«
»Ich kann sie von hier aus nicht gut erkennen, Herr Vorsitzender«, erwiderte der Marquis, »hätten Sie die Güte, sie mir reichen zu lassen?«
Der Vorsitzende übergab das Porträt einem Gerichtsdiener, der es dem Angeklagten brachte.
Sobald dieser es in Händen hielt, führte er es an seine Lippen; mit tränenerstickter Stimme drückte er es an sein Herz und sagte: »Glauben Sie etwa, ich hätte es nicht wiedererkannt? Ich wollte es nur ein letztes Mal küssen, bevor ich sterbe; jetzt können Sie mein Urteil sprechen, und ich werde Sie segnen, wenn ich das Schafott besteige.«
Zwei Szenen völlig anderer Art machten ebenfalls tiefen Eindruck.
Als der Vorsitzende von Coster Saint-Victor wissen wollte, ob er seiner Verteidigung nichts hinzuzufügen habe, sagte dieser: »Gewiss doch, ich möchte hinzufügen, dass die Entlastungszeugen, die vorzuladen ich verlangt habe, nicht erschienen sind; außerdem füge ich hinzu, dass es mich unangenehm überrascht zu sehen, dass die Öffentlichkeit zum Narren gehalten wird und nicht nur wir, sondern auch unsere Verteidiger mit Spott und Hohn überschüttet werden. Heute Morgen las ich die Zeitungen des heutigen Tages, und es schmerzte mich zu sehen, dass meine Aussagen von vorne bis hinten verfälscht wiedergegeben waren.«
»Angeklagter«, sagte der Vorsitzende, »diese Dinge haben mit dem Gegenstand des Verfahrens nichts zu tun.«
»Ganz im Gegenteil«, erwiderte Coster, »die Beschwerde, die dem Gerichtshof zu unterbreiten ich die Ehre habe, hat sehr wohl mit dem Gegenstand zu tun, bei dem es sich um mich und meine unglücklichen Freunde handelt; die Wiedergabe unserer Aussagen hat aufs Abscheulichste die Plädoyers verschiedener unserer Verteidiger entstellt; ich aber würde mich schändlichsten Undanks schuldig machen, versäumte ich es, meinem Verteidiger, dem der Staatsanwalt immer wieder das Wort abschnitt, an dieser Stelle für den Eifer und das Können zu danken, die er auf meine Verteidigung verwendet hat. Ich protestiere gegen die Beleidigungen und Verleumdungen, die von bezahlten Schmutzfinken und Schmieranten im Dienst der Regierung diesen tapferen Staatsbürgern in den Mund gelegt wurden, und ich bitte Monsieur Gautier, meinen Anwalt, meinen tiefempfundenen Dank anzunehmen und mir seine edle und großzügige Unterstützung bis zum letzten Augenblick weiterhin zu gewähren.«
Dieser Ausfall Coster Saint-Victors wurde nicht nur mit gewaltigem Mitgefühl, sondern auch mit donnerndem Beifall aufgenommen.
Hinter Coster Saint-Victor saßen in der dritten Reihe sieben bretonische Bauern aus dem Morbihan, schwergliedrige Burschen mit kantigen Gesichtszügen; neben der Intelligenz, die befiehlt, verkörperten sie die brutale Kraft, die gehorcht. Mitten unter ihnen befand sich ein Bediensteter Cadoudals namens Picot, dessen furchterregende Rachetaten an unseren Soldaten ihm den Spitznamen »Henker der Blauen« eingetragen hatten; er war ein kleinwüchsiger, untersetzter Mann mit breiten Schultern und einem von den Pocken zerfurchten Gesicht; seine schwarzen Haare waren kurz geschnitten, in gerader Linie oberhalb der Stirn. Was seinem Gesicht einen besonderen Ausdruck verlieh, war das Funkeln seiner kleinen grauen Augen unter den dichten Augenbrauen.
Kaum hatte Coster Saint-Victor zu Ende gesprochen, erhob sich Picot und sagte, unbekümmert um die Höflichkeitsregeln, die ein vornehmer Herr wie Coster Saint-Victor auch in dieser Situation einhielt: »Und ich will mich nicht beschweren, sondern, mehr noch, Anzeige erstatten.«
»Anzeige erstatten?«, wiederholte der Vorsitzende.
»Ja«, sagte Picot, »ich will anzeigen, dass man am Tag meiner Verhaftung auf der Polizeipräfektur zweihundert Louisdor vor mir auf den Tisch gezählt und sie mir samt meiner Freiheit angeboten hat, falls ich bereit wäre, die Wohnung meines Herrn General Georges zu offenbaren. Ich habe geantwortet, dass ich seinen Aufenthaltsort nicht wüßte, und das war die Wahrheit, denn der General war immer heute hier und morgen da. Daraufhin hat der Citoyen Bertrand sich von dem wachhabenden Offizier das Schloss eines Kommissgewehrs und einen Schraubenzieher bringen lassen, um mir die Daumen zu quetschen, und dann haben sie mich gefesselt und mir die Finger gebrochen.«
»Da hat man Ihnen nur eine Lektion erteilt«, sagte der Vorsitzende Hémard, »die Sie uns jetzt anstelle der Wahrheit erzählen wollen.«
»Es ist die Wahrheit, Gott ist mein Zeuge, die reine Wahrheit«, beteuerte Picot. »Die wachhabenden Soldaten können es bezeugen, ich wurde ins Feuer gehalten, und mir wurden die Finger zerquetscht.«
»Es wird Ihnen auffallen«, sagte Thuriot, »dass der Angeklagte zum ersten Mal von diesen Dingen spricht.«
»Ha!«, rief Picot. »Sie kennen diese Dinge sehr wohl, denn als ich im Temple davon sprach, sagten Sie: ›Seien Sie still, wir werden das schon regeln.‹«
»In Ihren Erklärungen findet sich kein Wort von dem, worüber Sie heute Klage führen.«
»Wenn ich seitdem nicht mehr darüber gesprochen habe, dann deshalb, weil ich Angst hatte, man würde mich wieder zerquetschen und mit Feuer malträtieren.«
»Angeklagter«, rief der Staatsanwalt, »lügen Sie, so viel Sie wollen, aber zeigen Sie Respekt vor dem Gericht!«
»Das Gericht ist ein Spaßvogel: Ich soll mich höflich benehmen, aber es will mir keine Gerechtigkeit widerfahren lassen.«
»Genug jetzt, schweigen Sie«, sagte Hémard, und dann, zu Georges gewandt: »Haben Sie den Ausführungen Ihres Verteidigers etwas hinzuzufügen?«
»Ich habe etwas hinzuzufügen«, erwiderte Georges. »Der Erste Konsul hat mir die Ehre einer Audienz erwiesen; wir haben uns über verschiedene Dinge verständigt, die von meiner Seite aus strikt eingehalten und von der Regierung sträflich missachtet wurden; man hat in der Vendée und im Morbihan Banden von Fußbrennern ins Leben gerufen, die unter meinem Namen so abscheuliche Gräueltaten begangen haben, dass ich aus London in die Bretagne zurückkehren, einem der Anführer dieser Banden das Lebenslicht ausblasen und mich als den wahren Georges Cadoudal zu erkennen geben musste; daraufhin habe ich meinen Leutnant Sol de Grisolles zu Napoleon Bonaparte geschickt, damit er ihm die Vendetta zwischen uns für eröffnet erklärte; als Korse wird er verstanden haben, was das hieß. Und da habe ich beschlossen, nach Frankreich zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob das, was ich getan habe und was meine Freunde getan haben, unter den Begriff einer Verschwörung fällt, aber die Gesetze kennen Sie besser als ich, und ich überantworte mich Ihrem Gewissen, was Ihr Urteil über uns betrifft.«
Unter den Angeklagten befand sich auch Abbé David, den wir bereits erwähnten; er war ein Freund Pichegrus, und diese Freundschaft hatte ihn auf die Anklagebank gebracht. Er war gelassen, unnahbar und fürchtete den Tod nicht; er erhob sich und sagte mit fester Stimme: »Pélisson ließ den verfolgten Staatskämmerer Fouquet nicht im Stich, und die Nachwelt hat ihm für seine Selbstaufopferung Kränze geflochten; ich hoffe, dass die Treue, die ich Pichegru während seines Exils bewahrt habe, mir nicht weniger zum Nachteil gereichen wird als Pélisson seine Treue zu Fouquet. Der Erste Konsul muss Freunde haben, vielleicht sogar viele Freunde, denn ähnlich wie von Sylla kann man von ihm sagen, dass niemand seine Klienten besser versorgt hat. Ich nehme an, dass er, wäre sein Staatsstreich am 18. Brumaire fehlgeschlagen, möglicherweise zum Tode verurteilt und ganz gewiss für vogelfrei erklärt worden wäre.«
»Was Sie da reden, ist völlig unsinnig!«, rief der Vorsitzende.
»Vogelfrei, ganz gewiss«, wiederholte der Abbé.
»Schweigen Sie!«, rief Thuriot.
»Ich schweige nicht«, widersprach der Priester, »sondern ich frage Sie: Wagten Sie es, seine Freunde zu verurteilen, wenn Sie mit ihm in Verkehr geblieben wären und sich darum bemühten, dem Vogelfreien die Staatsbürgerschaft wieder zu verschaffen?«
Thuriot war außer sich.
»Meine Herren«, rief er voller Zorn und richtete den Blick auf die anderen Richter und die Gerichtsdiener, »was wir soeben vernommen haben, ist so unangebracht …«
Doch Abbé David fiel ihm ins Wort. »Meine Herren Richter«, sagte er ruhig, »mein Leben liegt in Ihren Händen; den Tod fürchte ich nicht, denn ich weiß, dass man sich in Zeiten der Revolution auf alles gefasst machen und mit allem rechnen muss, wenn man sich ein reines Gewissen bewahren will.«
Die Aussagen der Angeklagten, die wir anführten, wurden von den anderen Angeklagten wiederholt, und die Verhandlung schloss mit einer neuerlichen Zärtlichkeitsbekundung der Brüder Polignac.
»Meine Herren«, sagte Jules und beugte sich mit flehend gefalteten Händen den Richtern entgegen, »nach den Worten meines Bruders war ich zu aufgewühlt, um meine eigene Verteidigung klaren Kopfes vorzubringen; nun bin ich ruhiger, und ich wage zu hoffen, dass das, was Armand sagte, Sie nicht veranlassen wird, so zu handeln, wie er es wünscht. Ich wiederhole im Gegenteil: Muss einer von uns sich als Sühneopfer darbringen, muss einer von uns sterben, dann ist noch Zeit, Armand zu retten und ihn seiner Frau zurückzugeben; ich hingegen habe keine Frau, ich kann dem Tod ohne Bedauern ins Auge blicken, denn ich bin so jung, dass ich das Leben nicht gut genug kenne, um seinen Verlust zu bedauern.«
»Nein, nein!«, rief Armand, schloss seinen Bruder in die Arme und presste ihn ans Herz. »Nein, du darfst nicht sterben! Ich werde sterben, ich, darum bitte ich dich, mein lieber Jules; dieser Platz gebührt mir.«
Diese Szene bewegte das Gewissen der Richter.
»Die Verhandlung ist beendet«, rief der Vorsitzende.
Es schlug elf Uhr morgens, als das Gericht sich zur Beratung zurückzog. Die Zuschauermenge war jeden Tag gewachsen, statt abzunehmen: Jeder wusste, dass dieses Gerichtsverfahren zwei Prozesse in sich vereinigte, den Moreaus und den Bonapartes; und obwohl man voraussehen konnte, dass das Urteil spät gefällt werden würde, verließ niemand den Saal.
Was die Beratung übermäßig in die Länge zog, war Réals Mitteilung an die Richter, dass Moreau unbedingt verurteilt werden müsse, sei die Strafe noch so unbedeutend, denn wenn er freigesprochen würde, wäre die Regierung zum Staatsstreich entschlossen.
Es erforderte wahrhaftig eine lange Beratung, um einen Angeklagten abzuurteilen, der erwiesenermaßen unschuldig war.
Schließlich ertönte am 10. Juni um vier Uhr morgens eine Glocke, deren Ton den Anwesenden durch Mark und Bein ging; sie verkündete, dass die Richter zurückkommen und ihr Urteil verkünden würden. Erstes schwaches Tageslicht fiel durch die Fenster herein und mischte sich in das letzte Kerzenlicht; es gibt, wie man weiß, nichts Bedrückenderes als dieses morgendliche Licht, das Tag wie Nacht gleichermaßen angehört.
Mitten in diesem Erschrecken traten Bewaffnete ein, die sich überall im Saal verteilten. Die Glocke erklang zum zweiten Mal, lauter diesmal, die Tür wurde aufgerissen, und ein Gerichtsdiener rief: »Das hohe Gericht!«
Der Vorsitzende Hémard erschien, gefolgt von der feierlichen Prozession der übrigen Richter, und nahm Platz. In der Hand hielt er ein langes Blatt Papier: das Urteil des Tribunals. Sodann wurden die Angeklagten hereingeführt.
Und als die erste Abteilung der Angeklagten vorgeführt war und dem Richter gegenüberstand, verlas dieser, die Hand auf die Brust gelegt, mit düsterer Stimme das umständlich begründete Todesurteil, gefällt über die Angeklagten Georges Cadoudal, Bouvet de Lozier, Rugulion, Rochelle, Armand de Polignac, Charles d’Hozier de Rivière, Louis Ducorps, Picot, Lajolais, Roger, Coster Saint-Victor, Deville, Armand Gaillard, Léhan, Pierre Cadoudal, Joyaut, Lemercier, Burban und Mérille.
Man kann sich denken, in welch schier unerträglicher Spannung die Zuhörer der langsamen, feierlichen Verlesung lauschten, die nach jedem Namen eine lange Pause hatte. Jeder der Anwesenden, die mit offenen Ohren, angehaltenem Atem und stockendem Herzschlag lauschten, musste fürchten, unter diesen ersten Namen, den Namen der Todgeweihten, den eines Verwandten oder Freundes zu vernehmen.
Obwohl einundzwanzig Namen auf dieser Liste figurierten, machte sich im Publikum große Erleichterung breit, als sie beendet war. Daraufhin ergriff der Vorsitzende das Wort und verkündete das weitere Urteil:
»Da Jean-Victor Moreau, Jules de Polignac, Le Ridant, Roland und die Dirne Izaï zwar der Beteiligung an der Verschwörung schuldig sind, sich jedoch mildernde Umstände zu ihren Gunsten ergeben haben, setzt das Gericht die Strafe, die es ihnen bemisst, auf zwei Jahre Gefängnis hinunter.
Alle übrigen Angeklagten sind freigesprochen.«
Die Verurteilten hörten das Urteil mit unbewegter Miene an, weder prahlerisch noch verächtlich. Nur Georges, der sich neben Monsieur de Rivière befand, neigte sich zu diesem und sagte: »Jetzt, da wir mit dem König der Welt abgeschlossen haben, müssen wir danach trachten, uns mit dem König des Himmels zu verständigen.«[3]
47
Die Hinrichtung
Doch die größte Besorgnis herrschte möglicherweise nicht in dem Gerichtssaal, in dem über das Los der Angeklagten entschieden wurde. Joséphine, Madame Murat und Madame Louis, die der Tod des Herzogs von Enghien und der fragwürdige Selbstmord Pichegrus so schwer geprüft hatten, konnten nicht ohne Entsetzen an die Hinrichtung von einundzwanzig Menschen denken, eine Zahl von Verurteilten, die an die schönen Tage der Schreckensherrschaft erinnern musste.
Ja, ein Gemetzel an einundzwanzig Personen auf der Place de Grève hatte wahrhaftig etwas Grauenerregendes.
Fouchés Worte »Die Luft ist voller Dolche« waren für Joséphine eine ständige Drohung geblieben; sie dachte an den neuen Hass, den einundzwanzig Hinrichtungen schaffen mussten, und sah ununterbrochen den Dolch der alten und neuen Rachegier der Brust ihres Mannes dräuen. Sie war es, an die man sich wendete. Madame de Polignacs Tränen fielen als Erste auf ihre kaiserliche Schleppe; sie eilte in Bonapartes Kabinett, um ihn anzuflehen, den jungen Edelmann zu verschonen, der gewissermaßen seinen Kopf verkauft hatte, um den seines Bruders zu retten.
Bonaparte weigerte sich. Weder Bitten noch Tränen konnten ihn erweichen. »Sie nehmen also immer noch Anteil an meinen Feinden, Madame!«, sagte er schroff. »Ob Royalisten oder Republikaner, die einen sind so unverbesserlich wie die anderen. Wenn ich ihnen vergebe, fangen sie von vorne an, und Sie werden sich genötigt sehen, mich für neue Opfer um Gnade zu bitten.«
Ach! Indem sie alterte und Bonaparte mit jedem Tag weniger Hoffnung auf Nachwuchs ließ, begann Joséphine ihren Einfluss zu verlieren; sie ließ Madame de Polignac kommen und sich Napoleon in den Weg stellen; Madame de Polignac warf sich ihm zu Füßen, nannte ihren Namen und bat ihn um Gnade für ihren Ehemann Armand de Polignac.
»Armand de Polignac!«, rief Bonaparte. »Mein Gefährte an der Militärschule in Brienne! Und er musste unbedingt gegen mich konspirieren? Oh, Madame«, sagte er, »die Prinzen haben sich wahrhaftig mit Schuld beladen, als sie ihre treuen Gefolgsmänner in Gefahr brachten, ohne sich selbst zu kompromittieren.«
Madame de Polignac verließ den Tuilerienpalast, als Murat und seine Frau ihn betraten, um für Monsieur de Rivière um Gnade zu bitten. Murat mit seinem guten Herzen war der Verzweiflung nahe wegen der Rolle, die er unbeabsichtigt in der Affäre des Herzogs von Enghien gespielt hatte, und er wollte diesen Blutfleck, wie er es nannte, mit dem Bonaparte seinen Soldatenrock befleckt hatte, wegwaschen. Die Gnade, die Monsieur de Rivière gewährt wurde, war Folge der Gnade für Armand de Polignac, und sie wurde fast widerstandslos gewährt. Monsieur Réal eröffnete Monsieur de Rivière, dass er begnadigt worden sei, doch tat er dies in der Absicht, aus der Begnadigung Nutzen für die Begnadigenden zu ziehen.
»Der Kaiser schätzt Ihre Tapferkeit und Ihre Treue«, sagte Monsieur Réal, »und er will Ihnen das Leben schenken; er sähe es gerne, wenn Sie in seinen Dienst träten, da er weiß, dass Sie Ihr Wort halten. Wünschen Sie ein Regiment?«
»Ich wäre stolz und glücklich, französische Soldaten zu kommandieren«, erwiderte Monsieur de Rivière, »aber Ihr Angebot kann ich nicht annehmen, denn ich habe bislang unter einer anderen Fahne gedient.«
»Sie hatten zuerst die diplomatische Laufbahn eingeschlagen; wäre es Ihnen recht, Frankreich als Gesandter in Deutschland zu vertreten?«
»Nicht zufällig wurde ich im Namen des Königs und des Thronprätendenten an verschiedene deutsche Höfe entsandt; als ich diese Missionen erfüllte, war ich Ihr Feind. Was müssten die Herrscher von mir denken, wenn sie mich mit einem Mal Interessen vertreten sähen, die denen, die ich bis dahin vertrat, diametral entgegengesetzt sind? Ihre Achtung und die meine besäße ich nicht länger; ich kann Ihr Angebot nicht annehmen.«
»Dann treten Sie in die Verwaltung ein! Wie wäre es mit einer Präfektur?«
»Ich bin nur Soldat und gäbe einen sehr schlechten Präfekten ab.«
»Aber was wollen Sie dann?«
»Etwas ganz Einfaches. Ich bin verurteilt, und ich will meine Strafe erleiden.«
»Sie sind ein loyaler Mann«, sagte Réal, der sich zurückzog. »Wenn ich Ihnen helfen kann, verfügen Sie über mich.«
Als Nächsten ließ er Georges kommen. »Georges«, sagte er zu ihm, »ich bin geneigt, den Kaiser um Gnade für Sie zu bitten; gewiss wird er sie gewähren, wenn Sie nur versprechen, künftig nicht mehr gegen die Regierung zu konspirieren. Treten Sie in die Armee ein.«
Doch Georges schüttelte nur den Kopf. »Meine Freunde und meine Kameraden sind mir nach Frankreich gefolgt«, sagte er, »und ich werde ihnen auf das Schafott folgen.«
Alle mitfühlenden Herzen waren voller Anteilnahme für Georges, und nachdem Murat die Begnadigung für Monsieur de Rivière erlangt hatte, bemühte er sich um Gnade für Cadoudal.
»Wenn Ihre Majestät einem Polignac und seinesgleichen das Leben schenken«, sagte er, »warum sollten Sie dann Georges gegenüber keine Milde walten lassen? Georges ist ein Mann von herausragendem Charakter, und wenn Ihre Majestät ihm das Leben schenkten, würde ich ihn zum Adjutanten nehmen.«
»Zum Henker«, erwiderte Napoleon, »das glaube ich gern, denn ich nähme ihn auch! Aber dieser Teufel von einem Mann verlangt, dass ich seine Gefährten mit ihm begnadige, und das ist unmöglich, denn darunter sind Männer, die vor aller Augen Morde begangen haben. Im Übrigen: Handeln Sie nach Ihrem Gutdünken; was Sie tun, wird das Richtige sein.«
Murat begab sich in den Kerker, in dem Georges mit seinen Gefährten eingesperrt war. Es war der Tag vor dem festgesetzten Hinrichtungstermin. Murat fand die Gefangenen im Gebet vor; nicht einer drehte sich um, als er kam. Er wiederum wartete, bis das Gebet beendet war; dann sprach er Georges an und nahm ihn beiseite. »Monsieur«, sagte er zu ihm, »ich komme im Namen des Kaisers, um Ihnen eine Stelle in der Armee anzubieten.«
»Monsieur«, erwiderte Georges, »das wurde mir heute Morgen schon einmal angeboten, und ich habe abgelehnt.«
»Dem, was Ihnen Monsieur Réal heute Morgen gesagt hat, kann ich hinzufügen, dass die Begnadigung auch denjenigen Ihrer Männer gewährt werden wird, die mit Ihnen kommen, in den Dienst des Kaisers treten und ihren alten Grundsätzen abschwören.«
»Dann gestatten Sie«, sagte Georges, »denn dann geht es nicht mehr mich allein an, dass ich Ihre Vorschläge meinen Kameraden unterbreite und ihre Meinung einhole.«
Und mit lauter Stimme wiederholte er das Angebot, das Murat ihm im Flüsterton gemacht hatte. Dann wartete er wortlos und mit unbewegter Miene, um niemanden zu beeinflussen.
Burban erhob sich als Erster, lüpfte den Hut und rief: »Es lebe der König!«
Zehn Stimmen übertönten die seine mit dem gleichen Ruf.
Georges wandte sich zu Murat und sagte: »Sie sehen selbst, Monsieur, dass wir nur einen Gedanken und nur einen Wahlspruch kennen: ›Es lebe der König!‹ Seien Sie so freundlich, dies denen mitzuteilen, die Sie geschickt haben.«
Am nächsten Tag, dem 25. Juni 1804, hielt der Karren mit den Verurteilten am Fuß des Schafotts.
Beispiellos in der blutigen Geschichte der vollzogenen Todesurteile war, dass Georges, der Rädelsführer der Verschwörung, als Erster hingerichtet wurde und nicht als Letzter, doch geschah dies auf seinen ausdrücklichen Wunsch. Da mehrere Male versucht worden war, eine Begnadigung für ihn zu erwirken, befürchtete er, seine Freunde, die vor ihm starben, könnten argwöhnen – selbst in dem kurzen Zeitraum zwischen vorletzter und letzter Hinrichtung -, man habe ihn aufgespart, um ihn in letzter Sekunde zu begnadigen, ohne dass er sich vor den abgeschnittenen Köpfen seiner Gefährten schämen musste.
Ein unvorhergesehener Zwischenfall verlängerte das blutige Schauspiel, das man dem Volk vorführte. Louis Ducorps, der als Sechster an der Reihe war, und Lemercier, der Siebte, kamen unmittelbar vor Coster Saint-Victor. Saint-Victor war die Begnadigung versprochen, und man wartete auf den Boten. Ducorps und Lemercier behaupteten, sie hätten Enthüllungen zu machen, und ließen sich zum Gouverneur von Paris bringen; eineinhalb Stunden lang hielten sie den Gouverneur mit Nebensächlichkeiten hin, eineinhalb Stunden lang ruhte das Fallbeil der Guillotine. Coster Saint-Victor, der elegante Coster, fragte, ob er die Pause nicht nutzen dürfe, um einen Barbier kommen zu lassen. »Denn wissen Sie«, sagte er zu dem Henker, »die vielen Frauen hier sind zweifellos meinetwegen gekommen; ich kenne sie fast alle; vor vier Tagen habe ich im Gefängnis um einen Barbier gebeten, und seit vier Tagen wird er mir vorenthalten: Ich muss abscheulich anzusehen sein.«
Zum zweiten Mal wurde dem schönen Dandy der Barbier verweigert, was ihn sehr zu bedrücken schien. Dann kamen Ducorps und Lemercier zurück, die Begnadigung war nicht überbracht worden, und das gefräßige Schafott verschlang sie allesamt.
Es schlug zwei Uhr am Hôtel de Ville, und diese Uhrzeit war der Beginn der wahrhaftigen Allmacht Napoleons. Im Jahr 1799 hatte er den politischen Widerstand überwunden und das Direktorium zerbrochen; 1802 hatte er den zivilen Widerstand überwunden und das Tribunat abgeschafft; 1804 hatte er den militärischen Widerstand besiegt, indem er die Verschwörung der Emigranten im Zusammenspiel mit den republikanischen Generälen aufdeckte. Pichegru, sein einziger Rivale, hatte sich erdrosselt. Moreau, sein einziger Nebenbuhler, wurde ins Exil geschickt. Nach zwölf Jahren der Kämpfe, des Schreckens, des Aufruhrs, der Parteien, die einander auf dem Fuß folgten, vollendete sich die Revolution; in ihm hatte sie sich nach und nach verkörpert; sie hatte menschliche Gestalt angenommen, und das Geld, das 1804 ausgegeben wurde, trug tatsächlich die Aufschrift: Republik Frankreich, Kaiser Napoleon.
Am Abend des 25. Juni 1804 stattete Fouché dem frisch ernannten Kaiser seinen Besuch ab, denn zum Dank für die guten Dienste, die Fouché ihm in oben erwähnter Sache geleistet hatte, war er von dem Kaiser in das Polizeiministerium zurückberufen worden; an diesem Abend des 25. Juni 1804 also befand sich Fouché allein mit Napoleon in einer Fensternische, und weil er den Augenblick für günstig hielt, fragte er: »Majestät, was wollen wir nun mit dem armen Jungen anstellen, der seit drei Jahren in einem Verlies des Abbaye-Gefängnisses Ihre Entscheidung erwartet?«
»Welcher arme junge Mann?«
»Der Graf von Sainte-Hermine.«
»Und wer soll das sein, dieser Graf von Sainte-Hermine?«
»Das ist der junge Mann, der Mademoiselle de Sourdis heiraten wollte und am Abend der Eheschließung verschwand.«
»Dieser Strauchritter?«
»Ja.«
»Wurde er denn nicht füsiliert?«
»Nein.«
»Aber das hatte ich doch angeordnet.«
»Im Gegensatz zu Monsieur Talleyrands Wort ist Ihre erste Regung die, vor der Sie sich hüten müssen.«
»Woraus folgt...«
»Dass ich Ihre zweite Regung abgewartet habe. Wahrhaftig scheinen mir drei Jahre Kerker eine recht strenge Strafe für das zu sein, was er sich zuschulden hat kommen lassen.«
»Schon gut, schicken Sie ihn als einfachen Soldaten in die Armee.«
»Darf er sich die Art seines Dienstes aussuchen?«, fragte Fouché.
»Das darf er«, erwiderte Bonaparte, »aber er soll nicht denken, dass er jemals zum Offizier befördert wird.«
»Sehr wohl, Majestät … Es wird ihm obliegen, die Hand Seiner Majestät zur Milde zu bewegen.«
48
Nach drei Jahren Kerkerhaft
Seit dem Gespräch des Polizeiministers mit dem Kaiser war keine Stunde vergangen, als der Gerichtsdiener, der vor Fouchés Tür wachte, verkündete, dass der Gefangene eingetroffen sei.
Fouché wandte den Kopf und sah durch die offene Tür den Grafen von Sainte-Hermine zwischen zwei Gendarmen.
Auf ein Zeichen des Polizeiministers trat der Graf von Sainte-Hermine ein.
Seit dem Tag seiner Festnahme, seit Fouché ihn hatte hoffen lassen, man würde ihn ohne Prozess erschießen, hatte er den Minister nicht wiedergesehen.
Eine Woche, zwei Wochen, einen ganzen Monat lang war Sainte-Hermine jedes Mal in der Hoffnung, man hole ihn zu seiner Hinrichtung, zur Tür seiner Zelle geeilt, wenn er hörte, dass der Schlüssel sich im Schloss drehte.
Dann begriff er, dass er sich wenigstens bis auf weiteres damit abfinden musste, am Leben zu bleiben.
Ihn ergriff die Furcht, man verschone ihn, um ihn in den Prozessen, die stattfinden würden, als Zeugen zu befragen.
Mehrere Monate verbrachte er in dieser Furcht, die sich zuletzt genauso verflüchtigte wie zuvor seine Hoffnung.
Bis dahin war ihm die Zeit nicht lang erschienen, denn ihn beschäftigten die zwei Empfindungen, die sich in seiner Seele ablösten.
Dann begann er sich zu langweilen und verlangte Bücher.
Sie wurden ihm gewährt.
Er verlangte Stifte, Zeichenpapier, mathematische Instrumente.
Sie wurden ihm gewährt.
Er verlangte Tinte, Schreibpapier, Federn.
Sie wurden ihm gewährt.
Und als die langen Winternächte kamen und es um vier Uhr nachmittags in seiner Zelle dunkel wurde, verlangte Hector eine Lampe, die ihm nach einigem Hin und Her gewährt wurde. Zwei Stunden täglich durfte er im Garten spazieren gehen, doch diese Gunst nutzte er nie, weil er fürchtete, erkannt zu werden. So lebte er drei Jahre lang.
Bei besonderen Menschen gibt es ein Alter, in dem das Unglück die körperliche Schönheit und die seelischen Vorzüge noch steigert.
Hector war ein wenig älter als fünfundzwanzig Jahre und von außergewöhnlichem Naturell. Während der langen Einsamkeit hatte sein Gesicht das jugendliche Aussehen verloren; die rosige Färbung seiner Wangen war einer bleichen Hautfarbe mit leicht bräunlichem Anflug gewichen; seine Augen wirkten größer, weil sie im Dunkeln zu sehen versuchten; sein Bart war gewachsen und umrandete sein Gesicht auf männliche Weise; sein Äußeres war von drei Eindrücken gekennzeichnet, die fast unmerklich ineinander übergingen: Nachdenklichkeit, Verträumtheit, Melancholie.
Dem Bedürfnis junger Menschen, ihre körperliche Kraft zu erschöpfen, war er mit gymnastischen Übungen begegnet; er hatte sich Kanonenkugeln unterschiedlichen Gewichts erbeten und hatte mit ihnen Gewichtheben geübt und zuletzt jongliert.
An einem Seil, das von der Decke hing, hatte er gelernt, nur mithilfe seiner Hände zu klettern. Und schließlich hatte er sich all die gymnastischen Übungen, die heutzutage zur Leibesertüchtigung eines jungen Mannes gehören, selbst ausgedacht, nicht um seine Erziehung zu vervollkommnen, sondern aus bloßer Langeweile.
Und während dieser dreijährigen Haft hatte Sainte-Hermine alles gründlich studiert, was man allein studieren kann – Geographie, Mathematik, Geschichte. In seiner Jugend hatte er sich für das Reisen begeistert, er sprach Deutsch, Englisch und Spanisch wie seine Muttersprache, und die Erlaubnis, Bücher zur Verfügung zu haben, hatte er weidlich genutzt und seine Reisen auf Karten unternommen, da er sie real nicht unternehmen konnte.
Insbesondere Indien, das den Engländern damals so hartnäckig streitig gemacht wurde von Haidar Ali und seinem Sohn Tipu Sahib, von dem Bailli de Suffren, von Bussy und Dupleix, hatte seine Aufmerksamkeit geweckt und war Gegenstand eingehender Studien geworden, ohne dass Hector sich hätte träumen lassen, dass diese Studien jemals einen Nutzen haben würden, da er sich zu ewig währender Haft verurteilt wähnte.
Er hatte sich an dieses Leben gewöhnt, und der Befehl, sich vor dem Polizeiminister einzufinden, war ein großes Ereignis in diesem Leben; geben wir zu, dass ein leises Gefühl der Furcht von seiner Seele Besitz ergriff, als er den Befehl befolgte.
Auf der Stelle erkannte Hector Fouché wieder, der sich nicht im Geringsten verändert hatte, abgesehen davon, dass er nun einen bestickten Anzug trug und Monseigneur genannt wurde. Anders verhielt es sich mit Hector de Sainte-Hermine: Um ihn wiederzuerkennen, musste Fouché zweimal hinsehen.
Vor dem Polizeiminister spürte Sainte-Hermine alle alten Gefühle in seinem Inneren wiederaufleben.
»Ach, Monsieur!«, sagte er und unterbrach als Erster ihre stumme Zwiesprache, »so haben Sie also Ihr Wort gehalten!«
»Verargen Sie mir wirklich, dass ich Sie gezwungen habe, am Leben zu bleiben?«, sagte Fouché.
Sainte-Hermine lächelte traurig.
»Nennen Sie das leben«, fragte er, »in einem Zimmer von zwölf Fuß auf zwölf Fuß mit vergitterten Fenstern und zwei Riegeln an jeder Tür eingesperrt zu sein?«
»In einem Zimmer von zwölf Fuß auf zwölf Fuß lebt es sich immer noch behaglicher als in einem Sarg von sechs Fuß Länge und zwei Fuß Breite.«
»Der Sarg mag noch so eng sein, aber im Tod kennt man den Frieden.«
»Würden Sie mich heute«, fragte daraufhin Fouché, »ebenso inständig anflehen, Sie sterben zu lassen, wie Sie es seinerzeit taten?«
Sainte-Hermine zuckte die Schultern. »Nein«, sagte er. »Damals war das Leben mir zuwider, heute ist es mir gleichgültig; Sie ließen mich rufen, heißt das nicht, dass mein Schicksal sich nun erfüllt?«
»Und warum sollte Ihr Schicksal sich erfüllen?«, fragte Fouché.
»Weil man mit dem Herzog von Enghien, mit Pichegru, Moreau und Cadoudal aufgeräumt hat und es, wie mir scheinen will, nach drei Jahren an der Zeit ist, auch mit mir aufzuräumen.«
»Mein lieber Monsieur«, erwiderte Fouché, »als Tarquinius seine Befehle Sextus bekanntgeben wollte, köpfte er nicht alle Mohnblüten in seinem Garten, sondern nur die höchsten.«
»Was soll ich dieser Antwort entnehmen, Monsieur?«, fragte Hector, dem das Blut in die Wangen stieg. »Dass mein Kopf zu niedrig ist, um es wert zu sein, dass man ihn abschlägt?«
»Ich wollte Sie keineswegs verletzen, Monsieur, aber Sie werden mir zustimmen, dass Sie weder ein Prinz von Geblüt sind wie der Herzog von Enghien noch ein siegreicher General wie Pichegru, noch ein großer Feldherr wie Moreau oder ein berühmter Partisan wie Georges.«
»Sie haben recht«, sagte Hector und senkte den Kopf, »ich bin ein Nichts neben jenen, die Sie genannt haben.«
»Aber«, fuhr Fouché fort, »alles, was die anderen sind oder waren, können Sie werden, ausgenommen Prinz von Geblüt.«
»Ich?«
»Gewiss doch. Hat man Sie in Ihrem Gefängnis behandelt wie jemanden, der seine Kerkerzelle nur verlassen wird, um den Tod zu erleiden? Hat man während Ihrer Gefangenschaft versucht, Ihren Geist zu erniedrigen, Ihre Seele zu zerbrechen oder Ihr Herz zu verderben? Haben Sie einen Wunsch gehegt, der Ihnen nicht erfüllt worden wäre? Hat Ihnen das nicht gezeigt, dass eine wohlwollende Macht über Sie wachte? Drei Jahre, wie Sie sie zugebracht haben, Monsieur, sind keine Bestrafung, sondern eine zusätzliche Erziehung, und vorausgesetzt, die Natur hat Sie dazu bestimmt, ein Mann zu werden, hätten diese drei Jahre Ihnen unter anderen Umständen gefehlt.«
»Aber schließlich«, rief Sainte-Hermine ungeduldig, »hat man mich zu einer Strafe verurteilt; worin besteht sie?«
»Darin, dass Sie als einfacher Soldat in die Armee eintreten.«
»Aber das ist eine Degradierung.«
»Und welchen Rang hatten Sie bei Ihren Wegelagerern inne?«
»Was meinen Sie?«
»Ich will wissen, welchen Rang Sie bei den Compagnons de Jéhu innehatten.«
Hector senkte den Kopf.
»Sie haben recht«, sagte er, »ich werde einfacher Soldat sein.«
»Und seien Sie ruhig stolz darauf, Monsieur: Marceau, Kléber, Hoche haben ihre Laufbahn als einfache Soldaten begonnen und wurden berühmte Generäle. Jourdan, Masséna, Lannes, Berthier, Augereau, Brune, Murat, Bessières, Moncey, Mortier, Soult, Davout und Bernadotte sind heute Marschälle Frankreichs und haben fast alle als einfache Soldaten angefangen; fangen Sie an wie diese und enden Sie wie sie.«
»Man wird anordnen, mich in den niedrigsten Rängen der Armee zu belassen.«
»Sie werden durch herausragende Taten Ihre Vorgesetzten zwingen, Sie zu befördern.«
»Ich werde gezwungen sein, einer Regierung zu dienen, der meine Familie ablehnend gegenüberstand und die ich ablehnen muss.«
»Monsieur, seien Sie ehrlich und gestehen Sie sich ein, dass Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie im Wald von Vernon Postkutschen überfielen, noch gar keine Zeit gehabt hatten, eine eigene Haltung in diesen Dingen zu entwickeln; Sie haben Ihrer Familientradition gehorcht und nicht Ihrem eigenen Urteil. Seit Sie im Gefängnis sind, seit Sie die Geschichte der Vergangenheit und die Möglichkeiten der Zukunft betrachtet haben, muss Ihnen klar geworden sein, dass die alte Welt zu Trümmern zerfällt und auf diesen Trümmern eine neue errichtet wird. Alles, was die alte Welt bedeutete, was mit ihr zusammenhing, ist tot, ist einen gewalttätigen, unumkehrbaren, vom Schicksal vorherbestimmten Tod gestorben. Vom Thron bis zum niedrigsten Rang in der Armee, von den höchsten Staatsbeamten bis zu den bescheidensten Dorfbürgermeistern sieht man nur neue Gesichter; sogar in Ihrer eigenen Familie hat eine vergleichbare Trennung stattgefunden: Ihr Vater und ihre zwei Brüder gehörten der Vergangenheit an, Sie aber sind Teil der neuen Welt; und was Sie selbst in diesem Augenblick denken, gibt mir recht, davon bin ich überzeugt.«
»Ich muss gestehen, Monsieur, dass an dem, was Sie sagen, viel Wahres ist und dass Ludwig XVI. und Marie-Antoinette ebenso für die alten Geschlechter standen, zu denen sie zählten, wie Bonaparte und Joséphine, die beide unbedeutenderen Geschlechtern entstammen, die neue Zeit verkörpern.«
»Es freut mich, dass ich mich nicht getäuscht habe; Sie sind der intelligente Mann, für den ich Sie gehalten habe.«
»Darf ich, um die Schmach der Vergangenheit zu tilgen, meinen Dienst unter fremdem Namen antreten?«
»Ja; Sie dürfen Ihren Dienst nicht nur unter fremdem Namen antreten, sondern sogar die Art des Dienstes, den anzutreten Sie verurteilt sind, selbst wählen.«
»Danke.«
»Haben Sie eine Vorliebe?«
»O nein; welchen Weg ich auch gehe, ich werde zu dem Staub gehören, den der Wind aufwirbelt.«
»Warum sich vom Wind davontragen lassen, wenn man gegen ihn kämpfen kann? Soll ich Ihnen einen Rat geben, Monsieur, was die Wahl der Heeresgattung betrifft, in der Sie dienen wollen?«
»Geben Sie ihn, Monsieur.«
»Wir werden einen erbitterten Krieg mit England führen, einen Seekrieg; Sie können wählen, werden Sie Seemann.«
»Ich spielte mit dem Gedanken daran«, sagte Hector.
»In Ihrer Familie gibt es Seeleute: Fünf Ihrer Vorfahren, angefangen mit Hélée de Sainte-Hermine, Schwadronschef im Jahr 1734, haben hohe Positionen in der Marine bekleidet; der Bruder Ihres Vaters war Schiffskapitän – Sie wissen es selbst am besten, denn als Vierzehnjähriger haben Sie unter ihm als Steuermannsjunge und Seekadett gedient; Ihre seemännische Ausbildung ist also bereits zur Hälfte absolviert.«
»Da Sie so gut über alles informiert sind, was sich seit eineinhalb Jahrhunderten in meiner Familie ereignet hat, Monsieur, können Sie mir vielleicht auch sagen, was aus meinem Onkel geworden ist? In den drei Jahren meiner Gefangenschaft habe ich keine Kunde von der Welt gehabt.«
»Ihr Onkel, ein loyaler Untertan des Königs, hat anlässlich des Todes des Herzogs von Enghien um seine Entlassung nachgesucht und hat sich mit Ihren zwei Cousinen nach England zurückgezogen.«
»Wann soll ich mich an meinem Bestimmungsort einfinden?«
»Wie lange brauchen Sie, um zu Hause Ihre Angelegenheiten zu regeln?«
»Meine Angelegenheiten werden schnell geregelt sein, denn ich nehme an, dass mein Vermögen beschlagnahmt wurde.«
»Ihr Vermögen steht voll und ganz zu Ihrer Verfügung, und wenn Ihr Verwalter Sie nicht betrügt, werden Sie die Erträge von drei Jahren vorfinden, dreihundert Millionen Francs, was keine schlechte Ausstattung für einen Seemann ist.«
»Monsieur, aus allem, was Sie sagen, geht hervor, dass ich Ihnen viel verdanke, und doch habe ich Ihnen bislang mit keinem Wort gedankt. Bitte schreiben Sie meine Unaufmerksamkeit der unbegreiflichen Situation zu, in der ich mich wiederfinde, und nicht der Fühllosigkeit eines Undankbaren.«
»Ich halte Sie so wenig für undankbar, dass ich Ihnen einen Rat geben will, den ich bis zuletzt aufgespart habe, weil er der beste ist.«
»Sagen Sie ihn, Monsieur.«
»Treten Sie auf keinen Fall in die kaiserliche Marine ein.«
»Und wo soll ich Ihrer Meinung nach eintreten?«
»Nehmen Sie Dienst an Bord eines Kaperschiffs. Ein neues Gesetz hat die Korsaren den Marineoffizieren gleichgestellt; müssten Sie als einfacher Seemann dienen, fiele Ihnen die Disziplin an Bord eines Marineschiffs beschwerlich, doch an Bord eines Kaperschiffs, auf dem zwischen den Dienstgraden weniger streng unterschieden wird, können Sie sich ohne Weiteres mit dem Kapitän anfreunden und ihm vielleicht sogar einen Teil seiner Ausrüstung finanzieren; es steht ihm frei, Ihnen den Rang zu verleihen, den er Ihnen verleihen will, und wenn Sie von der irregulären Marine in die des Staates überwechseln, wird Ihnen die Dienstzeit seit Ihrem ersten Tag als Steuermannsjunge bei Ihrem Onkel angerechnet werden.«
»Aber Monsieur Fouché«, sagte Hector voller Erstaunen über so viel Wohlwollen seitens eines Mannes, der nicht unbedingt als wohlwollend galt, »was habe ich getan, um solche Aufmerksamkeit Ihrerseits zu verdienen?«
»Das weiß ich in der Tat nicht, und ich erkenne mich selbst nicht wieder«, sagte der Polizeiminister. »Ich weiß nur, dass ich bestimmte Männer, deren überragende Intelligenz mir auffällt, gerne schwierigen Situationen aussetze, denn sie gehen immer ehrenvoll und ruhmvoll aus ihren Prüfungen hervor. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergehen wird, aber eines Tages werden Sie mir danken, und zwar mit mehr Berechtigung als heute.«
»Monsieur«, sagte Sainte-Hermine mit einer Verbeugung, »schon heute bin ich Ihnen für alles verpflichtet, auch für mein Leben.«
»Vergessen Sie nicht, mir den Namen Ihres Schiffs mitzuteilen, wenn Sie an Bord gehen, die Nummer, die Ihnen in der Mannschaft zugeteilt wird, und das Pseudonym, unter dem Sie Ihren Dienst antreten; denn Sie sagten, wenn ich mich recht erinnere, Sie wollten unter fremdem Namen dienen.«
»Ja, Monsieur, der Name Sainte-Hermine ist tot.«
»Für alle Welt?«
»Für alle Welt und vor allem für diejenige, die ihn tragen sollte.«
»Bis er zusammen mit dem Titel eines Kommandanten oder Generals wiederauferstehen wird, nicht wahr?«
»Aber ich hoffe, dass die Person, die Sie erwähnten, bis dahin ihr Glück gefunden und mich vergessen haben wird.«
»Aber wenn sie mich, der ich in meiner Eigenschaft als Polizeiminister alles wissen muss, fragt, wie Sie gestorben sind, was soll ich ihr dann antworten?«
»Antworten Sie ihr, dass ich mit aller Achtung, die ich ihr schulde, und in ungeminderter Liebe zu ihr gestorben bin.«
»Monsieur sind frei«, sagte Fouché und öffnete beide Türflügel.
Die Gendarmen machten Platz.
Der Graf von Sainte-Hermine salutierte und ging hinaus.
49
Saint-Malo
An einer der zahlreichen Buchten, die Frankreichs Küsten zwischen Calais und Brest, zwischen Normandie und Bretagne, zwischen dem Kap von La Hague und dem Kap Tréguir aufweisen, und gegenüber den alten französischen Inseln Jersey, Guernesey und Aurigny erhebt sich die kleine Stadt Saint-Malo wie das Nest eines Meeresvogels auf einem Felsen.
In den rauen und umwölkten alten Zeiten, als die Bretagne Armorique hieß, trennten diesen Felsen, den der Fluss Rance umspülte, Wälder und Wiesen von dem Meer, zu denen die Inseln, die Saint-Malo umschlossen, und jene, die wir weiter oben nannten, zweifellos gehörten, doch das Erdbeben, das sich im Jahr 709 vor Christus ereignete, verschlang einen Teil des Kaps, das sich ebenso weit ins Meer erstreckte wie das Kap von La Hague und das Kap Tréguir.
Die Vorstöße der normannischen Seeräuber kosteten Karl den Großen noch auf seinem Totenbett Tränen und nötigten die Bewohner der Umgegend, auf dem Felsen von Saint-Malo Schutz zu suchen. Zwischen 1143 und 1152 verlegte Jean de Châtillon den Bischofssitz dorthin, nachdem er die Mönche von Marmoutier der Insel und ihrer Dependenzien enteignet hatte.
Von diesem Zeitraum an datiert das neue Leben: Die Tochter des ungebändigten Ozeans entwickelte sich rasch unter dem Schutz der wackeren Seeleute und unter der herrschaftlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs und des Kapitels.
Diese Einteilung, die dem Gemeinwesen und den Rechten des Volkes Rechnung trug, führte zu einem Bevölkerungswachstum durch Asylsuchende, dem riskanten Aufschwung junger Städte; die Marine gedieh dank der Zollfreiheit des Hafens, der Handel dank Abgabenfreiheit und Privilegien, die Herzöge und Könige der Stadt gewährten, und Wohlergehen und Wohlstand wuchsen durch die Prisen in Kriegszeiten und in Friedenszeiten durch steten Handel und gewinnbringende Transaktionen. Die Stadt bildete gewissermaßen eine unabhängige Republik im Herzen der bretonischen Nation. Die Unantastbarkeit des Asyls rettete dem jungen Grafen Richmond aus dem Hause Lancaster das Leben, dem späteren Henry VII. Von Edward IV., dem ersten Herrscher aus dem Hause York, erbarmungslos verfolgt, flüchtete er sich 1475 in die Kathedrale von Saint-Malo.
Eine Merkwürdigkeit besteht darin, dass des Nachts bei Ebbe die Schiffe von einer Meute aus vierundzwanzig Doggen bewacht wurden, die aus England stammten. Diese Sitte führten Kapitel und Gemeinde im Jahr 1145 ein, und bis 1770 versah die Meute regelmäßig ihren Dienst. In diesem Jahr war ein junger Offizier so tollkühn, sich mit den vierfüßigen Wächtern anzulegen, als er an Bord zu gehen versuchte, nachdem die Tore bereits geschlossen waren. Die Hunde rissen ihn in Stücke, woraufhin der Stadtrat befahl, sie zu vergiften.
Die Bollwerke von Saint-Malo hatten nicht einmal die Hunde je bewachen dürfen.
Lang und ruhmreich wäre die Geschichte all der Boote, die in Saint-Malo vom Stapel gelassen wurden und die Wogen durchpflügten, um ihre eisernen Klauen in englische, portugiesische und spanische Schiffe zu schlagen. Keine zweite Nation verzeichnet in ihren Annalen so viele siegreich bestandene Kämpfe wie dieses kleine Volk, dessen Stadtmauern man binnen einer Stunde umrunden kann.
Schon 1234 prägten die Einwohner Saint-Malos, die Malouins, dem Meer ihren Stempel auf. Und als Matthew Paris sie wie im Sturzflug über die englischen Schiffe herfallen sah, nannte er sie die leichten Truppen des Meeres.
Ludwig der Heilige hört von dem Ruhm der waghalsigen Seefahrer; er vereint sie mit denen aus Picardie und Normandie und schickt sie der englischen Flotte entgegen. Die englische Flotte wird geschlagen, und ihre Schiffe müssen sich in den Hafen zurückziehen, aus dem sie ausgelaufen waren.
Am 1. April 1270 trat Ludwig der Heilige, angetrieben von dem heiligen Wahn, dessen Heilung er in El-Mansura zu finden hoffte, die siebte, letzte Kreuzfahrt an. Die Schiffe der Seeleute aus Saint-Malo folgten seinem Aufruf und umfuhren Spanien, um sich wie verlangt vor Aigues-Mortes einzufinden.
Das Glück blieb den Schiffen von Saint-Malo treu bis zu dem Seegefecht auf dem Swin im Jahr 1340, in dessen Verlauf sie gegen Engländer und Flamen unterlagen. Sie verständigten sich mit ihren früheren Gegnern und schlossen sich Jean de Montfort an, den diese unterstützten; als er jedoch aus seinen Ländern verjagt wurde und nach England floh, unterwarf Saint-Malo sich Karl V. Daraufhin wollte der Herzog von Lancaster die Stadt einnehmen; dies hoffte er mittels einer neuen Erfindung, der Artillerie, zu bewerkstelligen, doch die Einwohner entfachten künstlichen Nebel, töteten die Minierer in ihren Unterständen und steckten einen Teil des feindlichen Lagers in Brand. Froissart behauptet, das Scheitern dieses Angriffs habe Lancaster und sein ganzes Heer mit Schande überhäuft.
Herzog Jean, der mittlerweile sein Herzogtum zurückerhalten hatte, wollte ebenfalls Saint-Malo einnehmen; er belagerte die Stadt und ließ keine Lebensmittel hineingelangen, und er unterbrach die Wasserzufuhr des Aquädukts oberhalb des Hafens. Nach seinem Sieg nahm er den Bewohnern der Stadt alle Privilegien, die sein Vater ihnen gewährt hatte.
Doch so leicht gaben die Malouins sich nicht geschlagen. Wie sie sich einst Karl V. unterworfen hatten, unterwarfen sie sich nun Karl VI. und nutzten dessen Huld, um eine Flotte auszurüsten, mit der sie die Küsten Englands heimsuchten.
Am 25. Oktober 1415 schlug die schwere Stunde der Schlacht von Azincourt, die beinahe Frankreichs Verderben besiegelte. Der Herzog der Bretagne gewann Saint-Malo, dessen Bewohner ihn mit hermelinbesetzten Bannern und in weißen Gewändern begrüßten.
Daraufhin dehnte das siegreiche England seine Herrschaft über ganz Frankreich aus, und die englische Fahne flatterte auf Notre-Dame und auf allen französischen Festungen. Nur auf dem Gipfel des Mont-Saint-Michel protestierten die drei Lilien des französischen Banners gegen unsere Niederlage. Eine Flotte blockierte die wehrhafte Zitadelle. Kardinalbischof Guillaume de Montfort rüstete die englische Flotte mit Waffen aus. Und obwohl an Größe und Zahl unterlegen, kämpften die Schiffe der Seeleute von Saint-Malo Schiff für Schiff gegen die der Engländer. Der Kampf wurde erbittert und erbarmungslos geführt; die englischen Schiffe wurden geentert, ihre Mannschaften erschlagen, die Niederlage war vernichtend. Als das geschlagene Frankreich den Siegesruf Saint-Malos vernahm, hob es erstaunt den Kopf und begann wieder Hoffnung zu schöpfen, hatte es doch an dieser Stelle seines Landes alles verloren gewähnt; und der Garnison von Mont-Saint-Michel kam Saint-Malo mit Männern und Lebensmitteln zu Hilfe.
Karl VII. wurde durch die Meldung dieses Sieges für einen Augenblick aus seiner Liebesträgheit wachgerüttelt, und am 6. August 1425 erließ er ein Edikt, das die Schiffe Saint-Malos für drei Jahre von allen alten wie neuen Abgaben in allen der Krone unterstehenden Ländern befreite.
Dieser Freibrief wurde von Franz I. der Bretagne verdoppelt, denn er verbot seinem Generalpächter, Hafengebühren zu erheben; dieser durfte nun nicht mehr verlangen und nehmen als das, was die Herzöge für den Unterhalt des Kapitäns und für die Befestigung der Stadt festgesetzt hatten.
Im Jahr 1466 nahm sich Ludwig XI. die Freibriefe und Abgabenfreiheiten Saint-Malos zum Vorbild und wendete sie auf Paris an, um die Bevölkerung der Stadt zu vermehren, die durch die langen Kriege gegen die »Ligue du Bien public« stark dezimiert war.
1492, fast gleichzeitig mit der Eroberung Amerikas durch Christoph Kolumbus, entdeckten die Bewohner Saint-Malos zusammen mit denen der Städte Dieppe und den Biskayern Neufundland und verschiedene Stellen des Südens von Kanada. Die Basken nennen das Land bacalaos, und daher rührt der Name baccalat, der in Italien, Spanien, Portugal und ganz Südfrankreich den Stockfisch bezeichnet.
1505 hatte Anne von Frankreich, die Tochter Franz II., die als Siebenjährige mit ebenjenem Prinzen von Wales verlobt wurde, der seinen Onkel Gloucester erwürgen ließ, und die zwei Könige Frankreichs nacheinander ehelichen sollte – Karl VIII. und Ludwig XII. -, einen kurzen Auftritt in Saint-Malo. Sie ließ das begonnene Schloss weiterbauen, ohne sich um den Widerstand des Kapitels zu scheren; und um zu zeigen, was sie von diesem Widerstand hielt, ließ sie in die Steine eines Turms dieser Festung mit Blick auf die Stadt folgende Herausforderung einmeißeln: »Scheltet nur! Mein Wille geschieht, weil es mir so gefällt.«
Im selben Jahr, in dem den Bewohnern Saint-Malos ein Rathaus zugestanden wurde, anders gesagt die Freiheit, sich selbst zu regieren, kam Jacques Cartier zur Welt, der künftige Kolumbus Kanadas. Er brachte als Erster den kostbaren Kabeljau nach Saint-Malo, der einen ganzen Handel begründete und einem Drittel Europas Reichtum bescherte.
Von da an findet man Seeleute aus Saint-Malo auf jeder Expedition: Sie folgen Kaiser Karl V. nach Afrika, als er dem König von Tunis seinen Thron zurückgeben will, und sie bewaffnen sich, um den Portugiesen nach Indien zu folgen.
Ein Malouin, Archidiakonus Ébrard, war so kühn, Henry VIII. den Brief zu überbringen, in dem Paul III. die Exkommunikation aussprach, die er über ihn verhängt hatte.
Ein neuer Krieg zwischen Frankreich und England brach 1512 aus und wurde erbittert geführt. Unter Monsieur de Bouillé kämpften die Einwohner Saint-Malos gegen die Engländer auf der Insel Cézembre, machten sie nieder, und die Überlebenden mussten auf ihren Schiffen fliehen.
Franz I. kommt an die Regierung, und mit ihm wird es zum Krieg gegen Spanien kommen; an wen wendet er sich wohl, um die Flotte des Admirals Annebaut zu verstärken? An die Seeleute Saint-Malos, deren Kriegsschiffe er mietet. Verschiedene Kapitäne wollen sich dem Admiral nicht anschließen, doch nur, weil sie bis an das Ende der damaligen Welt auf eigene Rechnung gegen Spanien kämpfen wollen. So kam es, dass ein Teil der Flotte Kaiser Karls V. auf der Rückfahrt von Amerika durch bretonische Schiffe und Schiffe aus Saint-Malo aufgebracht wurde, die sich bis in den Golf von Mexiko vorgewagt hatten.
Heinrich II. folgt seinem Vater auf den Thron und entzweit sich mit Edward VI. Er greift zur Feder und schreibt den Einwohnern Saint-Malos, sie möchten sich so schnell wie möglich mit Schiffen ausrüsten, in See stechen, die Engländer überfallen und ihnen alles nur Erdenkliche antun, wobei er verspricht, dass sie weder von den Prisen etwas abzugeben noch sonstige Abgaben oder Steuern zu gewärtigen hätten.
Der Portugiese Cabral hatte eine neue Handelsroute über den Atlantik eröffnet, den Weg nach Brasilien, und schon bald befuhren die Schiffe der Malouins diese Route.
Auch auf Neufundland machten sie weiterhin gute Geschäfte. Im Jahr 1560 erhielten sie einen Brief Franz’ II., der seinem Vater auf den Thron gefolgt war. In diesem Schreiben untersagte er ihnen, Schiffe zum Fischfang auszusenden, weil man befürchtete, die Kalvinisten könnten auf diesem Weg fliehen; stattdessen wurden sie beauftragt, mit ihren Schiffen an den Küsten zu patrouillieren, um den Kalvinisten den Weg zu versperren, die nach Bekanntwerden des Todesurteils gegen den Prinzen von Condé aus dem Anjou in die Bretagne strömten, um nach England zu fliehen.
Während die katholischen Bewohner Saint-Malos vor der bretonischen Küste kreuzten, um die Hugenotten daran zu hindern, nach England überzusetzen, beteiligten sich die kalvinistischen Bewohner Saint-Malos an der Expedition, die Admiral Coligny unter der Leitung Kapitän Ribauts nach Florida entsandte.
Die Schlacht von Jarnac, die der Herzog von Anjou gewinnt, verschafft Frankreich kurzzeitig Frieden. Karl IX. nutzt diese Ruhepause und besucht die Bretagne. Guillaume de Ruze, Bischof von Saint-Malo, begleitet ihn; es ist das einzige Mal, dass der würdige Prälat den Fuß in seine Bischofsstadt setzt; die Einwohner begrüßen Karl IX. in Festtagskleidung, mit Büchsen bewaffnet und mit einem Spalier aus vierhundert Kindern. Am nächsten Tag, dem Fronleichnamsfest, begibt sich der König in die Kathedrale und nimmt an der Prozession teil. Ab Mittag wird zur Unterhaltung Seiner Majestät ein Seegefecht aufgeführt, woraufhin dieser sich mit all seinen Geschenken über Cancale und Dol auf den Heimweg macht.
Doch das ist noch nicht alles. Im Jahr darauf erfährt Saint-Malo, dass Seine christliche Majestät pekuniär gewaltig in der Klemme steckt. Man lässt sich den Betrag der königlichen Schulden nennen und begleicht sie. Das sind Untertanen, wie es sie heute nicht mehr gibt!
Das Massaker der Bartholomäusnacht nimmt seinen Lauf, doch die Malouins weigern sich, daran teilzunehmen, und in ihrer Stadt wird keinem Hugenotten ein Haar gekrümmt. Als sie aber im Folgejahr Belle-Isle den Engländern und den französischen Hugenotten entreißen wollen, bewaffnen sie sich, rüsten ihre Schiffe auf eigene Kosten aus und verjagen Montgomery um den Preis von sechzig Toten in den eigenen Reihen.
Die Einwohner Saint-Malos wurden zu Ligisten mit der Inbrunst, mit der sie alles taten. Und als sie erfuhren, dass Heinrich III. ermordet worden war und der König Frankreichs Heinrich IV. hieß, nahm die Stadt diese zwei Ereignisse mit finsterem Schweigen auf. Nur Monsieur de Fontaine, der Gouverneur der Festung, war bereit, sich einem ketzerischen König zu unterwerfen. Daraufhin bewaffneten sich die Bewohner der Stadt, verbarrikadierten die Stadttore und gelobten, sich erst zu ergeben, wenn Gott Frankreich einen katholischen König geschenkt haben würde.
Doch sobald Heinrich IV., der erfahren hatte, dass er mangels Geld nicht in die Bretagne kommen und den Herzog von Mercœur bezwingen konnte, von einer Belagerung absah, gelobten die Malouins, den König mit so vielen Kanonen, Pulverfässern, Kanonenkugeln und mit so viel Geld zu unterstützen, wie er verlangen mochte, und sie beteiligten sich mit zwölftausend Talern an den Kosten seines Unternehmens.
Das waren die Männer, die kurz zuvor den Gouverneur der Festung ermordet hatten, weil er gewagt hatte zu sagen, wenn Heinrich IV. die Stadt betreten wolle, werde er ihn im Schloss willkommen heißen, und er werde es schon verstehen, ihm die Tore öffnen zu lassen, was sie als Affront gegen ihre Interessen aufzufassen beliebt hatten.
Doch wie gesagt, kaum hatte Heinrich IV. seine Pläne aufgegeben, wurden sie zu seinen ergebensten Anhängern und entfesselten einen Vernichtungskrieg gegen die Stützpunkte der Ligisten, die sie bis dahin versorgt hatten.
Und Heinrich schrieb ihnen, dass sie die legitimste, ehrlichste und loyalste Schiffahrt betrieben, die man sich nur wünschen könne, und bat Elisabeth I. um Einschreiten gegen die englischen Piraten.
Denn Korsaren darf man nicht mit Piraten verwechseln.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Saint-Malo bereits eine nicht unbedeutende Seemacht.
1601 hatten zwei seiner Schiffe, Le Croissant und Le Corbin, das Kap der Guten Hoffnung umfahren und waren nach Indien gelangt. 1603 stachen drei weitere Schiffe in See, »um Kanada und anliegende Länder zu entdecken und dort Handel zu treiben«. 1607 bemannte der Graf von Choisy, Neffe des Herzogs von Montmorency, beauftragt, eine Expedition einer Flotte aus fünf Schiffen zu leiten, diese Schiffe – L’Archange, Choisy, L’Affection, L’Esprit und L’Ange – in Saint-Malo und rüstete sie dort aus, weil er die Malouins für die besten Seeleute weit und breit hielt.
Kaum hatte die Ermordung Heinrichs IV. den Thron für Ludwig XIII. freigemacht, hatte dieser nichts Eiligeres zu tun, als den Bewohnern Saint-Malos alle Privilegien zu bestätigen, die sein Vater ihnen verliehen hatte, und zwei seiner Kriegssschiffe bewaffnen zu lassen, damit diese die Fischereiflotte Saint-Malos bei ihrem Fischfang vor Neufundland beschützten.
Auch Richelieu wendete sich an die treuen Untertanen Saint-Malos, als er beschloss, La Rochelle zu belagern, das die Hugenotten mit Nahrungsmitteln und Geld unterstützte, und dafür benötigte er eine Marine, die es mit der Buckinghams aufnehmen konnte. Er verfügte über nur vierunddreißig Walfänger; Saint-Malo brachte zweiundzwanzig mit. Eine Bevölkerung von achttausend Bewohnern, eine Kleinstadt, ein kleiner Hafen, hatten ganz allein fast ebenso viel ausgerichtet wie das übrige Frankreich. Der Hafen Saint-Malo wurde zum Admiralssitz erhoben; was die Kosten der Stadt betraf, das vergossene Blut zum Beispiel, erließ man sie dem König gnädig.
Richelieu stirbt. Mazarin ist sein Nachfolger.
1649 lässt die Regierung mit Schiffen, die von Saint-Malo nach Kanada fahren, zahlreiche Straßenmädchen in die neue Kolonie deportieren, um diese zu besiedeln; jede von ihnen fand bei der Ankunft einen Ehemann, und keine zwei Wochen später waren sie alle verheiratet, und alle hatten ihrem Mann als Mitgift einen Ochsen, eine Kuh, einen Eber, eine Sau, einen Hahn, ein Huhn, zwei Fass Pökelfleisch, einige Waffen und zwölf Taler mitgebracht.
Die Tapferkeit der Männer von Saint-Malo war so sprichwörtlich, dass die Mannschaft des Flaggschiffs in der Regel aus ihnen rekrutiert wurde, und dieser Regel verlieh Ludwig XIV. Gesetzeskraft.
Damals bestand die Marine Saint-Malos aus einhundertfünfzig Schiffen, davon sechzig unter hundert Tonnen und neunzig von hundert bis vierhundert Tonnen.
Und nun kommen die großen Seefahrer ins Spiel. Von 1672 bis 1700 sehen wir in den Annalen Saint-Malos einst so berühmte und heute so vergessene Namen wie Dufresne des Saudrais, Le Fer de La Bellière, Gouin de Beauchesne – der Name des ersten Mannes aus Saint-Malo, der Kap Hoorn umschiffte -, Alain Porée, Legoux, Herr von la Fontaine, Louis-Paul Danycan, Herr von la Cité, Joseph Canycan, Athanaze Le Jolif, Pépin de Bellisle, François Fossart, la Villauglamatz, Thomas des Minimes, Étienne Piednoir, Joseph Grave, Jacques Porcher, Josselin Gardin, Nouail des Antons, Nicolas de Giraldin, Nicolas Arson und Duguay-Trouin. Viele dieser Sterne sind erloschen, verblichen, doch der Name Duguay-Trouin strahlt weiterhin so hell wie Jupiter.
Während des für Frankreich so verhängnisvollen Unabhängigkeitskrieges machte Saint-Malo im Jahr 1704 einundachtzig Prisen, deren Verkauf zwei Millionen und vierhundertzweiundzwanzigtausendsechshundertfünfzig Francs und zwei Centimes erbrachte. Saint-Malo eröffnet den Handel mit Mocha, begründet die Kontore in Surate, Calicut und Pondicherry, erobert Rio de Janeiro, nimmt die Insel Mauritius in Besitz, die in Île de France umbenannt wird, erweitert seine eigene Stadt, umgibt sie mit Befestigungen und bringt nach Duguay-Trouins Tod seinen würdigen Nachfolger hervor, Mahé de la Bourdonnais, der die Île de France und die Île de Bourbon regierte und die Schlappen wettmachte, die wir in Asien erlitten hatten.
Während der schrecklichen Kriege unter der Herrschaft Ludwigs XV., die durch den schändlichen Friedensschluss von 1763 beendet wurden, erlitt Saint-Malos Handel schmerzliche Einbußen. Trotz der Hoffnungen, die man an die Herrschaft Ludwigs XVI. knüpfte, ging es mit dem Wohlstand nicht bergauf, und die stürmischen Revolutionsjahre 1794 und 1795 machten ihm vollends den Garaus; schon gegen Ende 1793 besaß Saint-Malo kaum mehr als zwei, drei Küstenfahrer und kein einziges Kaperschiff.
1790 hatte sich Saint-Servan, bis dahin ein Vorort Saint-Malos, von der Stadt losgesagt und ihr die Hälfte ihrer Bevölkerung genommen.
Als jedoch im Juni 1793 Prokonsul Le Carpentier nach Paris zurückbeordert wurde und Saint-Malo aufatmen konnte, ließ man fünf kleine Kaperschiffe zu Wasser, und zwischen 1796 und 1797 war ihre Zahl auf dreißig angewachsen, auch wenn manche nur mit Musketen und Gewehren bewaffnet waren. Im Jahr darauf rüstete Saint-Malo achtundzwanzig neue Kaperschiffe aus. Diese Zahl von Kriegsschiffen wurde bis zum Frieden von England im Jahr 1801 beibehalten.
Dieser Frieden aber war nicht von Dauer; schon 1803 waren die Feindseligkeiten mit einer Verbissenheit wiederaufgenommen worden, die verriet, welch alter Hass zwischen den zwei Völkern schwelte.
Die Helden dieser Zeit waren Le Même, Lejolif, Tréhouart und Surcouf, und der letztgenannte Name führt uns zu unserem Sujet zurück.
50
Die Herberge der Madame Leroux
Am 8. Juli 1804 hingen gegen elf Uhr vormittags die Wolkenmassen so tief und so eng über den Dächern, dass es aussehen wollte, als entstiegen sie dem Meer, statt sich vom Himmel herabzusenken, als ein fünfoder sechsundzwanzigjähriger junger Mann, dem die atmosphärischen Gegebenheiten höchst gleichgültig zu sein schienen, zu Fuß die Ortschaft Saint-Servan verließ, die er über die Straße von Châteauneuf erreicht und in der er sich nur aufgehalten hatte, um langsam und frugal zu Mittag zu speisen; zwischen den Granitfelsen stieg er den Weg nach Boisouze hinunter, den es heute nicht mehr gibt, denn er musste der Route Impériale weichen. Die Sturzbäche, die sich über ihn ergossen und von seinem Lederhut auf seine Seemansjacke troffen, konnten ihn nicht zur Eile nötigen; er ging unbeschwerten Schritts, seinen Seesack auf dem Rücken, und schlug mit seinem Wanderstock gegen die Blüten voller Tau, die Diamantenschauer entsandten. Hinter und vor ihm toste das Meer, doch das schien ihn nicht zu beeindrucken; der Donner grollte über seinem Kopf, doch Donner und Blitz schienen ihn nicht zu bekümmern, und als er die Schiffswerft erreichte, konnte ihn nicht einmal das überwältigende Schauspiel, das sich nun seinem Blick bot, aus seiner Gedankenverlorenheit wecken.
Er hatte den Rand des Sillon erreicht, am Eingang des Viertels Rocabey.
Dieser Sillon war eine schmale Mole zwischen dem Ärmelkanal und dem Meerwasserbecken landeinwärts, die Saint-Malo mit Saint-Servan verband. Sie war dreißig Fuß hoch, aber keine acht Fuß breit, und bei Flut und stürmischem Wetter ergossen sich nach jedem Ansturm der Wassermassen die Wogen wie eine flüssige Kuppel über die Mauer und stürzten dröhnend und zischend in das landeinwärts gelegene Becken. Wenn Wind und Wasser den wilden Ärmelkanal aufwühlten, wagte sich fast keine Menschenseele auf den schmalen Steg, denn man erzählte sich, dass nicht nur Wanderer, sondern sogar Pferde und Wagen von den Wirbelstürmen erfasst und in das Becken geschleudert worden waren; es wäre also klüger gewesen, abzuwarten, bis das Toben der Elemente sich etwas beruhigte und man den Sillon ungehindert überqueren konnte. Doch der junge Mann betrat unbeschwerten Schritts den Weg auf der Mole. Unterwegs warf das Meer wie ein zweiköpfiges Ungeheuer, das beide Rachen aufriss, um ihn zu verschlingen, zwei riesige Wogen über ihn, doch ohne sich zu beeilen, erreichte er das andere Ende des Sillon und die Schlossmauern, die er nun entlangging und die ihn zwar nicht vor dem Regen, doch vor Wind und Meer schützten.
Um die Zugbrücke zu erreichen, musste unser Reisender bis zu den Knien im Wasser waten; dann stieg er zur Innenstadt hinunter, in der er sich kurz umsah; ohne lange zu fackeln, bog er nach links ab und erreichte den kleinen Platz, an dem sich heute das Café Franklin befindet. Dort schien er sich wieder auszukennen, denn er bog in die Straße ein, die von der Place au Beurre zur Rue Traversière führt; und als er sich in dem Gewirr enger Gässchen verirrte, deren stattlichste zwei Meter breit waren, wendete er sich an einen Seemann, der in einem Hauseingang Schutz vor dem Regen gesucht hatte. »He, Kamerad«, sagte der junge Mann, »können Sie mir sagen, wie ich zu der Herberge von Madame Leroux finde?«
»À La Victorieuse?«, fragte der Seemann.
»À La Victorieuse«, erwiderte der Reisende.
»Kennen Sie den Ankerplatz, Kamerad?«, fragte der Seemann.
»Nur dem Namen nach.«
»Oho!«, sagte der Seemann vieldeutig.
»Ist es ein unsicheres Pflaster?«
»O nein, die Reede ist tadellos, aber wenn man sich da hineinwagt, muss man gut gefüllte Taschen haben.«
»Zeig mir den Weg zu der Herberge, und wenn du heute Abend mit mir speisen willst, werden wir eine Flasche des besten Weins leeren, den sie haben, und eine ihrer berühmten Pré-Salé-Lammkeulen schmausen.«
»Mit Vergnügen«, sagte der Seemann, »so etwas werde ich einem Kameraden nicht abschlagen. Nach wem soll ich fragen?«
»René«, erwiderte der Reisende.
»Sehr wohl, und wann?«
»Zwischen sieben und acht Uhr abends, wenn es dir recht ist. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet.«
»Welche Frage?«
»Die nach dem Weg zu der Herberge der Madame Leroux.«
»Zwanzig Schritte von hier entfernt«, erwiderte der Seemann, »in der Rue Traversière, du wirst das Schild nicht verfehlen; aber vergiss nicht, dass du zuerst einen Beutel Gold auf den Tisch leeren und sagen musst: ›Gebt mir zu trinken und zu essen, und ich kann bezahlen, wie ihr seht‹, wenn du dort willkommen sein willst.«
»Ich danke dir für den guten Rat!«, erwiderte der Reisende und machte sich auf den Weg.
Diesmal fand er sich nach zwanzig Schritten, wie ihm gesagt worden war, vor einem riesengroßen Gebäude, über dessen Tür ein Schild mit einer aufgemalten Fregatte und der Inschrift À La Frégate victorieuse hing.
Der Reisende zögerte, bevor er eintrat, denn noch nie war ein solcher Höllenlärm an sein Ohr gedrungen: eine Mischung aus Geschrei, Verwünschungen, Blasphemien und Flüchen, die man miterlebt haben muss, um sie sich vorzustellen. Der Korsar Niquet, ein Rivale Surcoufs, war vor wenigen Tagen mit zwei reichhaltigen Prisen eingelaufen, deren Ertrag am Vorabend unter den Matrosen aufgeteilt worden war; keiner von ihnen hatte bisher seinen Anteil ausgeben können, doch nun waren sie mit einem Eifer bei der Sache, dass man hätte meinen können, es wären Wetten abgeschlossen worden, wer sein Geld zuerst verschleudert haben würde. Die heftigen Regenschauer hatten alle Mannschaften in das Innere der Herbergen verbannt. All die irrwitzigen Spazierfahrten im geschmückten Wagen, mit Geigen und Flöten, all die Eintagshochzeiten, bei denen die Braut des Vortags der des nächsten Tages Platz macht, hatten sich in die sieben oder acht großen Hotels verlagert, welche die Stadt Saint-Malo besaß. Diejenigen, die sich keine aristokratische Unterkunft hatten verschaffen können, waren in die Gässchen und die kleineren Herbergen ausgeschwärmt, in denen Seeleute für gewöhnlich unterkamen.
Der Reisende hätte nicht zu zögern brauchen, denn niemand beachtete ihn, jedermann war viel zu beschäftigt mit seinen eigenen Angelegenheiten: Die einen tranken, die anderen rauchten, wieder andere spielten Tricktrack oder Karten, und um zwei Billardtische drängten sich nicht nur fünfundzwanzig bis dreißig Spieler, sondern außerdem fünfzig bis sechzig Zuschauer, die auf Stühle, Bänke und Öfen geklettert waren. Mitten in diesem ohrenbetäubenden Tohuwabohu, aus dem das Klirren der Geldmünzen auf den Marmortischen deutlich herauszuhören war, verfolgte jeder seine Gedanken, doch da es in diesem Krach unmöglich gewesen wäre, ihnen geistig zu folgen, sprach jeder sie in seinem halb berauschten Zustand laut aus, um sie den anderen, die sich nicht dafür interessierten, und sich selbst, obwohl er sie nicht zu Ende denken konnte, zu Gehör zu bringen.
Der junge Mann trat in den Nebel, den in Madame Leroux’ großen Räumen der Dampf aus den Lungen der Trunkenen und aus ihrer regennassen Kleidung bildete. Ohne eine Antwort zu erhalten, fragte er nach Madame Leroux, ohne Hilfe suchte er nach ihr, deren Szepter über ein Königreich von Wahnsinnigen regierte; zuletzt sah er sie und bahnte sich den Weg zu ihr. Sie wiederum erblickte ein unbekanntes Gesicht, auf dem sich nicht das blöde Lächeln der Trunkenheit malte, und schickte sich an, ihm entgegenzugehen.
Madame Leroux war eine mollige kleine Frau von ungefähr dreißig Jahren mit herzlichem Lächeln, einschmeichelnden Worten und einladender Gestik, die sich dieser Berufsliebenswürdigkeit von einer Sekunde zur nächsten zu entledigen verstand, um sich Annäherungen verliebten oder pekuniären Ursprungs zu entziehen, wenn ihre Kundschaft sich dergleichen erdreistete. Dann stemmte sie die Fäuste in die Hüften und wuchs zusehends, ihre Stimme grollte wie Donner, und ihre Hände schlugen zu wie der Blitz. Wir müssen nicht eigens betonen, dass sie unseren Reisenden mit ihrem Schönwettergesicht begrüßte.
»Madame«, sagte dieser mit der gleichen Ehrerbietung und Höflichkeit, als hätte er es mit einer der feinen Damen des Faubourg Saint-Germain zu tun, »wurden Ihnen vor drei Tagen zwei Koffer und eine Holztruhe für einen Citoyen René, Matrose, überbracht, sowie ein Brief mit der Bitte, ein Zimmer für ihn freizuhalten?«
»Oh, gewiss, gewiss doch, Citoyen«, erwiderte Madame Leroux, »das Zimmer ist bereit, und wenn Sie mir folgen wollen, wird es mir ein Vergnügen sein, Sie hinzuführen.«
Ein Nicken war Renés Antwort, und er folgte Madame Leroux die Wendeltreppe hinauf bis zu dem Zimmer mit der Nummer elf; mitten auf dem Zimmerboden standen seine zwei Koffer und seine Holztruhe, und vor dem Fenster hatte die umsichtige Wirtin einen Tisch mit Papier und Tinte aufstellen lassen, denn jemand, der zwei so elegante Koffer und eine so stabile Truhe besaß, hatte sicherlich Briefe zu schreiben.
»Wird der Citoyen unten speisen, oder will er sich das Essen auf sein Zimmer bringen lassen?«, fragte Madame Leroux.
René entsann sich der Empfehlung des Seemanns, den er nach dem Weg gefragt hatte; er suchte unauffällig in seiner Tasche, holte eine Handvoll Louisdor hervor und legte sie auf den Tisch.
»Ich wünsche, auf meinem Zimmer zu speisen«, sagte er, »und gut zu speisen.«
»Das werden Sie, Monsieur, seien Sie unbesorgt«, sagte Madame Leroux mit ihrem reizendsten Lächeln.
»Wohlan, meine liebe Madame Leroux, lassen Sie mir ein gutes Feuer machen, denn ich bin bis auf die Knochen durchnässt, und ein gutes Abendessen mit zwei Gedecken für fünf Uhr; ein wackerer Seemann wird nach mir – René – fragen, und Sie werden ihn zu meinem Zimmer weisen. Vergessen Sie nicht guten Wein.«
Fünf Minuten später brannte ein prächtiges Feuer in Nummer elf.
Sobald René allein war, zog er seine nasse Kleidung aus und holte aus seinem Seesack ein zweites Gewand, das den Kleidern auf dem Boden völlig gleich war; dann kleidete er sich sorgfältig an, auch wenn seine Sorgfalt nur einfachster Seemannskleidung galt.
Wenige Augenblicke später hatte sich das Sommergewitter verzogen, das Straßenpflaster begann zu trocknen, der Himmel erstrahlte erneut in ungetrübtem Blau; die Natur lächelte wieder, abgesehen von vereinzelten Tränen, die von den Dachrinnen tropften, und zeigte sich bereit, ihre Kinder zu liebkosen, wie sie es vor ihrem Zornesausbruch getan hatte. Mit einem Mal war lautes Geschrei zu vernehmen. Im einen Augenblick klang es wie Wehgeschrei, im nächsten wie übermäßiges Freudengelächter. René öffnete das Fenster und erblickte eine Szene, wie er sie sich in seinen verstiegensten Träumen nicht hätte ausmalen können. Ein Matrose, dem als Anteil an der Prise zweitausend Piaster zugefallen waren, hatte die Hälfte des Geldes innerhalb von acht Tagen auf den Kopf gehauen, und in seiner Ratlosigkeit, was er mit dem Rest anfangen sollte, war er auf die Idee verfallen, die Münzen in einer Pfanne glühend zu machen und sie unter die Gaffer zu werfen, die sich vor der Tür angesammelt hatten; die Zuschauer hatten sich auf die Piaster gestürzt, doch die Ersten, die das Geld berührten, hatten sich die Fingerspitzen versengt, daher das Wehgeschrei; andere hatten gewartet und erst zugegriffen, als die Münzen abgekühlt waren, und daher die Jubelrufe.
René erkannte mitten unter den Zuschauern den Seemann, dem er früher am Tag begegnet war; bis zum Abendessen blieb noch eine Stunde Zeit. René hatte zuerst vorgehabt, Surcouf nach am selben Tag seine Aufwartung zu machen, doch er hatte den Besuch auf den nächsten Tag verschoben, um nicht in Zeitnot zu geraten; zudem kam es ihm nicht ungelegen, von einem Seemann, einem gewöhnlichen Matrosen, Auskünfte über den außergewöhnlichen Mann zu erhalten, den er aufsuchen wollte. Deshalb winkte er seinem Gast, um ihm zu bedeuten, er solle hereinkommen, was dieser sogleich tat; doch da er sich im Erdgeschoss der Herberge durch die eng gedrängte Menschenmenge kämpfen musste, hatte René Zeit, die Klingelschnur zu ziehen und Zigarren, etwas Kautabak und ein Fläschchen Branntwein bringen zu lassen.
Kaum waren diese Dinge auf den Tisch gestellt worden, trat der Seemann ein.
René trat zu ihm, reichte ihm die Hand und bot ihm einen Stuhl neben dem Tisch an.
Der Seemann aber sah sich erstaunt in dem Zimmer um; offenbar fand er es etwas sehr elegant für einen einfachen Matrosen, und der Branntwein, die Zigarren und der Kautabak bestärkten ihn in seinem Eindruck, dass der Neuankömmling offenbar ebenfalls einen Prisenanteil zu verprassen habe.
»Ha, ha, Matrose!«, sagte er. »Der Fischzug scheint reiche Ernte gebracht zu haben! Zwei Gewänder, was für ein Luxus! Seit zehn Jahren fahre ich zur See, und seit zehn Jahren trocknet mir das Gewand am Leib, wenn es nass wurde, denn ich hatte nie genug Geld, um mir ein zweites zu kaufen.«
»Sie täuschen sich, Kamerad«, erwiderte René. »Ich komme von zu Hause, ich bin der einzige Sohn wohlhabender Eltern, und die Fahrt, für die ich anheuern will, wird meine erste sein. Aber ich bin lernwillig, ich fürchte mich nicht vor Gefahren, und ich bin willens, mein Leben zu verlieren oder meinen Weg zu machen. Ich habe erfahren, dass mehrere Schiffe ausgerüstet werden, um auszulaufen: die Leth, die Saint-Aaron und die Revenant. Auf der Leth führt Niquet das Kommando, auf der Saint-Aaron Angenard und auf der Revenant Surcouf. Für welches dieser Schiffe würdest du dich entscheiden?«
»Ha! Du bist mir ein Spaßvogel! Ich habe mich schon entschieden.«
»So, du schiffst dich wieder ein?«
»Gestern habe ich angeheuert.«
»Und auf welchem der drei Schiffe?«
»Na, auf der Revenant.«
»Ist sie der beste Segler unter den dreien?«
»Tja, das kann man noch nicht wissen, weil sie neu ist. Unter Surcouf wird ihr nichts anderes übrigbleiben als verdammt gut zu segeln oder verdammt gute Gründe zu haben, warum sie es nicht tut. Surcouf würde sogar einem Transportkahn Beine machen.«
»Du hast also Vertrauen zu Surcouf?«
»Na, ich habe ihn ja schließlich erlebt, ich fahre nicht zum ersten Mal unter ihm. Mit der Confiance haben wir den Engländern ganz schön heimgeleuchtet. Ha, dem haben wir es gezeigt, dem armen John Bull!«
»Kannst du mir nicht ein paar eurer Streiche erzählen, Kamerad?«
»Ha, du musst nur sagen, welche.«
»Nur zu, ich lausche dir.«
»Warten Sie, ich nehme mir erst einen neuen Priem«, sagte der alte Seemann, und er widmete sich dieser Handlung mit aller gebotenen Aufmerksamkeit, schenkte sich daraufhin ein Gläschen Branntwein ein, das er auf einen Zug leerte, hustete zweimal feierlich und begann zu erzählen:
»Wir kreuzten also in den Gewässern der Insel Ceylon; unsere Kampagne hatte unter schlechten Vorzeichen begonnen: Als wir uns vor der Antilleninsel Saint-Anne segelfertig machten, kenterte eine Pirogge, und drei Männer wurden von Haien zerrissen; in diesen Gewässern bleibt niemand lange im Wasser, man wird sofort gefressen.
Wir befanden uns östlich von Ceylon und kreuzten von der malaiischen Küste zur Küste von Koromandel über den Golf von Bengalen; dort hatten wir so ungeahntes Glück, dass wir es kaum fassen konnten; in nicht einmal einem Monat kaperten wir sechs prachtvolle Schiffe, jedes einzelne reich beladen und bedeutend, die miteinander an die fünfhundert Tonnen ausmachten.
Nachdem wir unsere Prisen verschifft hatten, bestand unsere Mannschaft aus einhundertdreißig verschworenen Kameraden. Mit einem Schiff wie der Confiance und einem Kapitän wie Surcouf durften wir hoffen, noch weitere glänzende Fänge zu tun.
Hin und wieder begegneten wir englischen Kreuzern mit Oberwerk, und vor denen mussten wir die Flucht ergreifen, was unsere Eitelkeit kränkte, aber die Confiance war so schnell, dass wir trotz allem stolz darauf waren, wie flugs wir den Engländern entkamen. So steuerten wir seit ungefähr einer Woche von Küste zu Küste, ohne auf Beute zu stoßen, als eines Morgens der Ruf erscholl: ›Schiff in Sicht!‹
›Und wo?‹, rief Surcouf, der den Ruf in seiner Kabine gehört hatte und an Deck eilte.
›Ein dickes, fettes Schiff?‹
›Fett genug, dass die Confiance es nicht auf einmal verschlingen kann.‹
›Umso besser! Welchen Kurs hält es?‹
›Schwierig zu entscheiden, es hat alle Segel gesetzt.‹<
Sofort richteten sich alle Fernrohe und alle Augen auf die angegebene Stelle, und wahrhaftig sah man eine hohe, unbewegliche Pyramide, deren Weiße durch den dichten Nebel leuchtete, denn in jenen Gewässern kriecht der Nebel nachts von den Bergen herunter und bedeckt noch am Morgen alles, was sich in Ufernähe befindet.
›Das kann genauso gut ein Schiff mit Oberwerk sein wie ein Handelsschiff der französischen Ostindienkompanie. Wenn es ein Kriegsschiff ist – pah, dann werden wir uns eben amüsieren, aber wenn es ein Handelsschiff ist, dann werden wir es kapern.‹<
Keine zwei Seemeilen trennten uns von unserem Ziel, und obwohl es unter den gegebenen Umständen einigermaßen schwierig war, abzuschätzen, um welche Art Schiff es sich tatsächlich handelte, begannen wir mit der Beobachtung -«
Doch in diesem Augenblick wurde geklopft, und man teilte ihnen mit, dass der Tisch gedeckt sei und das Essen sie erwarte. So groß das Vergnügen der beiden neuen Gefährten am Erzählen und Zuhören sein mochte, stärker war die Zauberwirkung dieser Worte, denn beide erhoben sich unverzüglich und vertagten die Fortsetzung des Berichts auf einen späteren Zeitpunkt.
51
Die falschen Engländer
Um ihren Gast nicht zu stören, hatte Madame Leroux, mehr als besänftigt durch die Handvoll Gold, die sie in seinen Fingern hatte funkeln sehen, das Abendessen in einem Nachbarzimmer auftragen lassen. Es ließ sich kein einladenderer Anblick denken als der des gedeckten Tischs mit den Austern, den drei Gläsern verschiedener Form neben den Gedecken, dem blitzenden Silberbesteck und den zwei Flaschen Chablis, beide bereits entkorkt. Der alte Seemann blieb an der Tür stehen und betrachtete den herrlichen Anblick mit wohlgefälligem Lachen.
»Ha!«, sagte er, »wenn Sie sich in der Hoffnung einschiffen, an Bord jeden Tag so fürstlich zu leben, dann täuschen Sie sich, mein junger Freund. Die Kost ist nicht zu verachten bei Surcouf, aber trockene Bohnen sind da eher an der Tagesordnung als gebratene Hühner.«
»Nun, Kamerad, wenn trockene Bohnen an der Tagesordnung sind, werden wir trockene Bohnen essen, aber bis dahin wollen wir uns an den Austern gütlich tun, die uns erwarten. Eines noch: Du weißt meinen Namen, aber ich nicht den deinen, das erschwert unsere Unterhaltung. Wie heißt du?«
»Saint-Jean, gnädiger Herr. An Bord hieß ich ›Mastkorb‹, weil ich oben am Mast Wache halte.«
»Gut, Saint-Jean. Ein Glas Chablis? Der hat die Linie nicht passiert, das kann ich dir versichern.«
Saint-Jean hielt dem Gastgeber sein Glas hin und leerte es auf einen Zug.
»Verdammt«, sagte er, »ich dachte wohl, es wäre Apfelmost. Schenken Sie mir ein zweites Glas ein, Kamerad, damit ich gutmachen kann, dass ich das erste so formlos hinuntergestürzt habe.«
René ließ sich nicht lange bitten, denn er wollte Saint-Jean zum Sprechen bringen und selbst so wenig wie möglich reden, was sich auf diesem Weg als nicht weiter schwierig erwies. Nach dem Chablis gab es Bordeaux, nach dem Bordeaux Burgunder und nach dem Burgunder Champagner. Und Saint-Jean ließ sich mit einer Ungezwungenheit bewirten, die seine Arglosigkeit bezeugte.
Als das Dessert serviert wurde, sagte René: »Ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit für den Rest der Geschichte, wie es Surcouf gelang, seine Fahrt auf einem englischen Schiff statt auf der Confiance zu beenden.«
»Als wir gewendet haben, um bei Tisch vor Anker zu gehen, waren die zwei Schiffe keine zwei Seemeilen mehr voneinander entfernt. Ich war auf Posten im Ausguck und hatte ein Fernrohr; ich meldete unserem Kapitän, dass das Schiff, das wir uns ausgesucht hatten, verdeckte Geschütze besaß, dass es teuflisch aufgetakelt war und dass seine Segel englischen Zuschnitt hatten: Nun galt es nur noch herauszufinden, wie gut es bewaffnet war und mit welchem Schiff wir es zu tun hatten. Während ich mit dem Kapitän spreche, wird die Position unserer Confiance prekär, weil der Wind, der anfangs ein mildes Lüftchen war, so frisch wird, dass wir auf einmal vier Knoten machen; aber um uns zweifelsfrei zu vergewissern und um zu erfahren, mit welchem Gegner wir es zu tun haben, streichen wir alle kleinen Segel, luven an und segeln hoch am Wind. Das andere Schiff macht uns das Manöver nach, so dass man meinen könnte, es wäre unser Schatten, wäre es nicht größer gewesen als die Confiance. Da die beiden Schiffe einander der Entfernung wegen nicht taxieren können, segelt die Confiance eine Dreiviertelwende nach Backbord, und abermals wiederholt das rätselhafte fremde Schiff unser Manöver, so dass wir einander erneut so schräg gegenüberliegen wie zuvor und wir das andere Schiff nicht recht in Augenschein nehmen können, denn Balken und Fässer verdecken seine Geschütze.
Wissen Sie, Kamerad«, fuhr Saint-Jean fort, »es gibt eine brave kleine Fee, die man zur Taufe Surcoufs einzuladen vergessen hat, und diese Fee heißt Geduld. Aber die Mannschaft war nun genauso aufgebracht wie ihr Kapitän. Gnade Gott dem fremden Schiff, wenn es von gleicher Stärke wie das unsere ist und es zum Handgemenge kommt!
Die Confiance profitierte von ihrer besonderen Bauweise am meisten, wenn sie dicht am Wind segelte; da dieses Manöver jedoch zu den allergefährlichsten bei Beginn eines Kampfes gehört, luven wir wieder an und lassen das Schiff Fahrt aufnehmen, damit wir im äußersten Notfall den Rückzug antreten können.
Schließlich gehen wir hoch an den Wind und überholen das andere Schiff, was wir mit Freudenrufen quittieren.
Surcouf hatte sich neben mich gesetzt. ›Zum Teufel!‹, sagte er. ›Jetzt werden wir bald sehen, ob dieses Schiff ein ehrliches Spiel treibt und ob es ehrlich an unserem Schiff längsseits gehen will. Ich bin ein alter Seebär, aber einen Bären lasse ich mir nicht aufbinden. Ich kenne alle Schliche dieser Schurken mit ihren Handelsschiffen. Oft genug habe ich erlebt, dass solche Schiffe verlockend aussahen und von Kapitänen geführt wurden, die mit allen Wassern gewaschen waren und jene, die sie verfolgten, in die Flucht schlugen, weil sie sich stellten, als suchten sie selbst den Kampf!‹
Surcouf war von dieser Überzeugung so durchdrungen, dass sich die Confiance laut seinem Befehl von Luv dem gegnerischen Schiff näherte. Das war nicht zum Lachen, denn hätte er sich getäuscht, wäre uns eine Breitseite auf den Pelz gefeuert worden, oder aber wir wären Gefahr gelaufen, geentert zu werden.
Surcouf lässt sich an einem Tau auf das Deck herunter und geht dann schnellen Schritts auf den ersten und den zweiten Leutnant zu. ›Tod und Teufel!‹, ruft er und stampft mit dem Fuß auf. ›Ich habe eine Riesendummheit begangen, ich hätte das fremde Schiff zuerst herankommen lassen und es dann mit verschiedenen Geschwindigkeiten jagen sollen, um seine Stärke und Schnelligkeit einschätzen zu können.‹ Und er schlug sich mit der Faust an die Stirn, spuckte seine Zigarre weg, gewann dann seine Kaltblütigkeit wieder und sagte: ›Das soll mir eine Lehre sein.‹
Dann hob er sein Fernrohr ans Auge, folgte dem Schiff fünf Minuten lang mit dem Blick, schob die Kupferrohre des Perspektivs mit der Handfläche wieder zusammen und rief die Mannschaft herbei. ›Alle hierher an Deck!‹
Wir drängten uns um ihn. ›Zum Teufel!‹, rief er. ›Jetzt ist mir alles klar. Ihr seid Männer, keine Kinder, wozu euch also verbergen, was ich jetzt weiß? Seht euch den Engländer gut an: Er hat eine Büste als Galionsfigur, Bugsprietsegelbrassen mit einfachen Taljen und ein nagelneues Geschütz über dem Reff seines kleinen Toppsegels. Nun, es handelt sich ganz einfach um eine Fregatte.‹
›Eine Fregatte!‹
›Und wollt ihr wissen, wie diese Fregatte heißt? Das ist die vermaledeite Sibylle! Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, sie uns vom Hals zu schaffen, aber noch ist nicht aller Tage Abend; wenn es mir gelingt, mit unserer Confiance so dicht wie möglich am Wind zu bleiben, möchte ich sehen, wie sie uns einholen wollen. Ach!‹, fuhr er fort, ballte die Fäuste und knirschte mit den Zähnen. ›Wenn mir nicht die Hälfte meiner Männer fehlte, die ich mit den Prisen zur Île de France schicken musste, zum Teufel, auch wenn es nichts einbrächte, würde ich mir den Spaß erlauben, den Engländern ein bisschen die Hölle heißzumachen, so dass wir etwas zu lachen hätten; aber mit den paar Mann Besatzung, die mir geblieben sind, kann ich mir diese Unterhaltung nicht erlauben, denn es hieße die Confiance ohne Not aufs Spiel zu setzen. Lieber den Engländer täuschen. Aber welche List soll ich ersinnen, welche Falle kann ich ihm stellen?‹
Surcouf ging nach achtern, setzte sich und senkte den Kopf in die Hände, um nachzudenken. Fünf Minuten später hatte er gefunden, was er suchte, und es war höchste Zeit, denn wir befanden uns nur mehr in halber Gefechtsdistanz zu dem anderen Schiff.
›Die englischen Uniformen!‹, rief er.
Zu einer der letzten Prisen, die wir erbeutet hatten, gehörten zwölf Truhen englischer Uniformen, die auf dem Weg nach Indien gewesen waren; in einer Vorahnung, dass diese Uniformen ihm eines Tages nützlich sein würden, hatte Surcouf sie an Bord der Confiance behalten.
Kaum hatte Surcouf nach den Uniformen verlangt, ging ein Lächeln über alle Mienen, denn jedermann begriff, was er vorhatte; die Uniformen werden geholt und ins Zwischendeck gebracht; jeder Seemann steigt durch eine Luke in unserer Nationaltracht hinunter und durch eine andere Luke im roten Rock wieder hinauf: Und keine fünf Minuten später waren nur noch Engländer auf Deck zu sehen.
Daraufhin legen etwa dreißig der Unseren einen Arm in eine Schlinge, und andere binden sich gerötete Bandagen um den Kopf: Das Blut musste ein Huhn hergeben. Unterdessen nageln wir von außen an die Schiffsplanken Holzstücke, die den Eindruck zugestopfter Einschusslöcher machen sollen, und mit Hammerschlägen durchlöchern wir das Schandeck unserer Beiboote. Zuletzt begibt sich unser echter Engländer, unser Dolmetscher, in Kapitänsuniform und mit Sprachrohr auf die Wachtbank des Offiziers, während Surcouf, als einfacher Matrose verkleidet, sich neben ihn stellt, um ihm zu soufflieren, was er sagen soll.
Unser Fähnrich zur See, ein tapferer Bursche namens Bléas, den Hut eines englischen Offiziers auf dem Kopf, tritt zu Surcouf. ›Zu Befehl, Kapitän‹, sagt er, ›ich hoffe, Sie sind mit meiner Verkleidung zufrieden.‹
›Ganz ausgezeichnet‹, erwidert Surcouf lachend. ›Aber für Maskeraden und Späße ist jetzt keine Zeit mehr. Bléas, merken Sie sich gut, was ich Ihnen sagen werde, denn Ihr Auftrag ist von allergrößter Wichtigkeit; aus zwei Gründen habe ich Sie dazu ausersehen: Zum einen sind Sie Neffe des Eigners der Confiance und unmittelbar an ihrem Schicksal beteiligt, zum anderen sprechen Sie tadellos die englische Sprache; im Übrigen setze ich uneingeschränktes Vertrauen in Ihren Mut, Ihre Intelligenz und Ihre Kaltblütigkeit. ‹<
›Kapitän, ich kann nur wiederholen, was ich bereits sagte: Ich stehe Ihnen zu Befehl.‹<
›Danke. Bléas, Sie werden in die Jolle steigen und sich an Bord der Sibylle begeben.‹
›Kapitän, in zehn Minuten werden Sie mich an Deck der Sibylle sehen.‹<
›Oh, nicht so schnell‹, sagte Surcouf, ›ganz so einfach ist die Sache nicht. In fünf Minuten will ich sehen, dass Ihre Jolle mit Wasser vollläuft, während Sie sich darin befinden.‹
›Ich bin gerne bereit, sie volllaufen zu lassen, mit ihr unterzugehen oder mich von einem Hai anknabbern zu lassen, während ich mich schwimmend zu retten versuche. Aber vor allem wüsste ich gerne, was all das zur Rettung der Confiance beitragen soll.‹
›Glauben Sie mir, dass ich Ihnen nichts Böses will, Bléas?‹
›Oh, ganz gewiss, mein Kapitän.‹<
›Nun, denn: Verlangen Sie keine Erklärung von mir.‹
›Einverstanden, mein Kapitän; was aber ist mit denen, die mich begleiten? ‹
›Seien Sie unbesorgt, sie werden ihre Rollen umso überzeugender spielen, je weniger sie wissen; und zum Beweis, dass ich weder Sie noch jene in ernstlicher Gefahr glaube, gebe ich Ihnen hundert Dublonen und Ihren Begleitern je fünfundzwanzig Dublonen. Diese Belohnung erhalten Sie neben Ihrem Sold, denn sie ist dazu gedacht, Ihnen die Gefangenschaft nicht langweilig werden zu lassen; doch seien Sie unbesorgt, ich verspreche Ihnen, dass Sie aus der Gefangenschaft befreit sein werden, bevor Sie noch Zeit haben, das Geld auf den Kopf zu hauen, und wenn ich fünfzig Engländer hergeben müsste, um euch freizubekommen. Ich muss wohl nicht eigens erwähnen, dass zu den hundert Dublonen und Ihrem Prisengeld noch eine ansehnliche Belohnung auf Sie und Ihre Männer wartet.‹<
›Oh, was das betrifft, Kapitän …‹<
›Pah, lassen Sie nur; Gold bringt Glück. Haben Sie alles verstanden?‹
›Jawohl.‹<
›Springen Sie auf keinen Fall ins Wasser.‹
›Wie, sollen wir doch ertrinken?‹, rief Bléas ratlos.
›Nein; sobald Ihnen das Wasser über die Knöchel steigt, wenden Sie sich der Sibylle zu und rufen in gutem Englisch um Hilfe. Verstanden?‹
›Ja, Kapitän, verstanden.‹
›Dann geben Sie mir die Hand und springen Sie ins Boot.‹
Und zu dem Matrosen, der die Jolle führte, sagte er: ›Kernoch, mein Freund, du vertraust mir, nicht wahr?‹
›Potz Bomben und Granaten! Das will ich wohl meinen!‹
›Dann leere dieses Glas Wein auf mich, nimm dieses Splisshorn, und wenn du auf halbem Weg zu der Fregatte bist, hau mir ein paar anständige Löcher in den Boden der Jolle, damit sie schnell vollläuft.‹<
Dann näherte er den Mund dem Ohr des Seemanns und die Hand seiner Tasche, flüsterte ihm ein paar Worte ins Ohr und steckte ihm ein zusammengerolltes Papier in die Tasche.
›Das war nicht nötig, Kapitän‹, sagte Kernoch, ›aber es schadet auch nicht.‹<
›Willst du mich nicht zum Abschied küssen?‹
›Teufel auch! Mit dem größten Vergnügen‹, erwiderte der Seemann.
Und indem er einen Priem von der Größe eines Hühnereis in der Backe versteckte, drückte er Surcouf auf beide Wangen einen schmatzenden Kuss, wie er auf dem Land Ammenkuss heißt.
Kurz darauf verließ uns die Jolle mit Monsieur Bléas.
Von der Sibylle bedrängt, streicht die Confiance alle Segel bis auf die Toppsegel, kommt fast zum Stehen bei rauem Wind, hisst die englische Flagge, die sie mit einem Kanonenschuss bestätigt, segelt eine Backbordhalse und fiert auf. Die Sibylle wiederum, die dem Frieden und unserer Nationalität nicht so recht traut, hält sich weiterhin gefechtsbereit, lässt einige der vorgeblichen Balken ins Wasser fallen, um die Stückpforten ihrer Geschütze freizumachen, enthüllt unseren Blicken eine furchterregende Reihe von Kanonen und dreht zu unserer Linken bei.
Kaum hatten wir den gleichen Kurs aufgenommen, als der englische Kapitän uns die Frage zurief, woher wir kamen und warum wir uns ihm mit vollen Segeln genähert hatten.
Unser Dolmetscher erwiderte, was ihm Surcouf einflüsterte, dass wir nämlich die Sibylle an ihrer Maskierung erkannt und uns deshalb so schnell genähert hatten, weil wir eine gute Nachricht für ihren Kapitän hatten.
›Was für eine Nachricht?‹, fragt der Kapitän persönlich durch sein Sprachrohr.
›Die Nachricht Ihrer Beförderung in den nächsthöheren Dienstgrad‹, erwidert der Dolmetscher mit unerschütterlicher Kaltblütigkeit.
Mit dieser Antwort bewies Surcouf, wie gut er das Menschenherz kennt: Denn wer eine gute Nachricht erhält, ist nur selten geneigt, an der Glaubwürdigkeit des Überbringers zu zweifeln. Und von diesem Augenblick an verschwand das Misstrauen von der Miene des englischen Kapitäns.
Dennoch sagte er kopfschüttelnd: ›Es ist doch gar zu sonderbar, wie ähnlich Ihr Schiff einem französischen Kaperschiff sieht.‹<
›Aber Kapitän, das kommt daher, dass es ein Kaperschiff ist‹, erwidert unser Dolmetscher, ›und ein berühmtes obendrein, das wir an der Küste der Gascogne gekapert haben. Und weil die Kaperschiffe von Bordeaux die schnellsten Schiffe der Welt sind, wollten wir lieber damit die Fahrt fortsetzen als mit unserem eigenen, um mit Gottes Hilfe den Korsaren Surcouf zu verfolgen und einzufangen.‹
Während dieses Gesprächs zwischen unserem Dolmetscher und dem englischen Kapitän stoßen die Männer in der Jolle auf einmal Verzweiflungsschreie und Hilferufe aus, und man sieht, dass das Boot voller Wasser ist und unterzugehen droht.
Sofort stellen wir die Fregatte in den Wind und bitten um Hilfe für unsere Männer, denn unsere anderen Beiboote sind noch ärger beschädigt als die Jolle, die gerade absäuft, und völlig seeuntüchtig.
Da es die erste Pflicht und das oberste Gebot für jeden Seemann ist, diejenigen zu retten, die sich in Gefahr befinden, ob Freund oder Feind, lässt man von der Sibylle große Boote zu Wasser, die dem Fähnrich zur See Bléas und seinen Matrosen entgegenrudern.
›Retten Sie nur unsere Leute aus dem Boot‹, rief der Dolmetscher. ›Wir werden manövrieren, ohne zu wenden, und sie dann mitsamt dem Boot mitnehmen.‹
Um dieses Manöver auszuführen, lässt die Confiance das Focksegel herunter, hisst das Vorbramsegel, den großen Klüver, holt das Briggsegel bei und entfernt sich von der Fregatte.
Surcouf hatte einen famosen Geistesblitz gehabt, und nun konnte er seiner Freude freien Lauf lassen. ›Seht mir diese wackeren Engländer‹, ruft er, ›wir sollten uns schämen, dass wir sie nicht lieben, wo sie doch unsere Männer an Bord nehmen. Ha! Da bekommt Kernoch einen Nervenzusammenbruch, und Bléas, meiner Treu, fällt in Ohnmacht! Ha, ha, was für Spitzbuben, das werde ich ihnen nicht vergessen; sie haben ihre Rolle ganz hervorragend gespielt; unsere Freunde sind in Sicherheit und wir auch. Aber jetzt heißt es manövrieren! Setzt alle Segel! Stellt alle Segel so dicht wie möglich auf Am-Wind-Kurs! Setzt alle Beisegel! Und du, Schiffsjunge, bring mir eine angezündete Zigarre.‹<
Der Wind blies mit voller Kraft, und die Confiance legte sich ins Zeug wie noch nie. So flink, wie sie segelte, hätte man meinen können, sie wüsste um die Gefahr, aus der sie uns rettete.
Voller Stolz auf unser Schiff betrachteten wir dankbar und staunend, wie sie das schäumende Wasser durchpflügte.
Kaum hatte die Besatzung der Sibylle unsere Finte erraten, feuerte sie ihre Geschütze auf uns ab, nahm ihre Boote an Bord und nahm Kurs auf uns, doch wir waren bereits außer Reichweite ihrer Kanonenkugeln.
Die Verfolgungsjagd dauerte bis zum Abend. Als es Nacht geworden war, steuerten wir einen falschen Kurs, und angeschmiert war der Engländer von der Bramstenge bis zum Kiel!«
Und da im späteren Verlauf dieses Berichts, auf dessen pittoreske Sprache wir weitgehend verzichtet haben, um dem Leser das Verständnis zu erleichtern, René nicht versäumt hatte, seinem Gast fleißig nachzuschenken, sei es Rum, sei es Zuckerrohrschnaps, sei es Cognac, ließ Saint-Jean nach seinen letzten Worten den Kopf auf den Tisch sinken, und sein lautes Schnarchen verriet, dass er die Wirklichkeit des Wachseins mit dem launischen Reich des Schlafs vertauscht hatte.
52
Surcouf
René hatte erfahren, dass Surcouf vormittags von acht bis zehn Uhr seine Seeleute rekrutierte.
Folglich legte René um halb acht Uhr seine Kleidung vom Vortag, die über Nacht getrocknet war, wieder an; der Kleidung sah man den langen Weg an, den René gekommen war, und sie eignete sich besser für ein Vorsprechen bei Surcouf als ein ungetragenes Gewand frisch aus der Schneiderwerkstatt.
Um acht Uhr erreichte er die Rue Porcon de la Barbinais, gelangte dann über die Rue de la Boucherie zur Rue de Dinan, an deren Ende unterhalb der Befestigungen und gegenüber dem Stadttor Surcoufs Haus lag, ein großes Gebäude mit Hof und Garten.
Ein Dutzend Seeleute, die sich zeitiger eingefunden hatten als René, wartete im Vorraum; sie wurden einer nach dem anderen in den Nebenraum vorgelassen, und damit es keine Rangeleien gab, hatte ein Matrose neben der Tür des Vorraums Nummern ausgegeben, mit denen die Reihenfolge geregelt wurde.
René bekam eine Nummer und wartete zusammen mit sechs verbliebenen Seemännern; um sich die Zeit zu vertreiben, betrachtete er die Trophäen und Waffen aus aller Herren Länder an den Wänden.
In einem schwarzen Pantherfell aus Java steckten vergiftete malaiische Dolche, Kris geheißen, Pfeile, die in die tödlichsten Gifte getaucht worden waren, und Säbel, mit denen die Haut des Opfers nur geritzt werden muss, um eine tödliche Wunde zu erzielen.
Das Fell eines Löwen aus dem Atlasgebirge trug eine Reihe von Candjiar-Dolchen aus Tunis, von Flissah-Säbeln aus Algier, von Pistolen mit verzierten silbernen Griffen und von halbmondförmig gebogenen Damasszenerklingen.
Das Fell eines Präriebisons zeigte eine Sammlung von Bogen, von Tomahawks, von Skalpiermessern und Gewehren mit gezogenem Lauf.
Das Fell eines bengalischen Tigers präsentierte Dolche mit vergoldeten Klingen und Jadegriffen, damaszierte Dolche mit Elfenbein- und Karneolgriffen, Silberringe und silberne Armreifen.
Die vier Erdteile fanden sich solchermaßen an den vier Wänden dieses Wartezimmers durch ihre Waffen dargestellt.
Während René diese Trophäen mit Interesse musterte und den Blick zur Zimmerdecke hob, wo sich neben einem zwanzig Fuß langen Kaiman eine mindestens doppelt so lange Boa schlängelte, waren weitere Wartende vorgelassen worden, und zehn neue Kandidaten hatten den Vorraum betreten und ihre Nummer erhalten.
Ab und zu waren Schüsse zu hören, denn Surcouf saß an einem Fenster und hatte Pistolen vor sich liegen; einige seiner Offiziere vertrieben sich die Zeit damit, in dem großen Garten auf metallene Zielscheiben zu schießen, an denen die Kugeln ihre Spur hinterließen.
In einem zweiten Raum, der als Rüstkammer diente, erprobten drei oder vier junge Männer, die an Bord des Kaperschiffs vermutlich als Fähnriche zur See oder als Seekadetten dienten, ihre Gewandtheit mit Degen und Säbel.
Obwohl René als einfacher Matrose gekleidet war, erkannte Surcouf auf den ersten Blick, dass er es mit einem Mann aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Sphäre zu tun hatte; der entschiedene Gesichtsausdruck des jungen Mannes beeindruckte ihn; mit Kennerblick registrierte er den wohlgestalten Körper und den gepflegten, sorgfältig gestutzten Bart, und gerne hätte er die Hände gesehen, um sein Urteil abzurunden, doch sie waren in Handschuhen verborgen, die zwar alt waren, aber frisch mit Gummi gereinigt, so dass man ihrem Träger zwar nicht unbedingt Luxus attestieren konnte, aber Streben nach Eleganz.
Und als René zwei Schritte vor Surcouf stehen blieb und salutierte, erwiderte dieser den Gruß, indem er seinen Hut lüpfte, was er einem gewöhnlichen Seemann gegenüber nicht getan hätte.
René wiederum hatte Surcouf mit einem einzigen Blick eingeschätzt: Der berühmte Seefahrer war ein Mann von einunddreißig Jahren, mit kurz geschnittenen blonden Haaren, kurz getrimmtem Kinn- und Backenbart, kräftigem Hals und stämmigen Schultern, eher klein als groß und dennoch von wahrscheinlich herkulischer Körperkraft.
»Was wünschen Sie von mir, Monsieur?«, fragte Surcouf mit einer leichten Kopfbewegung.
»Ich weiß, dass Sie in See stechen wollen, und ich würde gerne bei Ihnen anheuern.«
»Doch nicht etwa als einfacher Matrose?«, fragte Surcouf.
»Als einfacher Matrose«, erwiderte René mit einer Verbeugung.
Surcouf betrachtete ihn erneut und noch verwunderter als zuvor. »Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen«, fuhr Surcouf fort, »dass Sie mir so wenig zum Matrosen geeignet erscheinen wie ein Chorknabe zum Schuhputzer.«
»Das mag sein, Monsieur, aber jedes Gewerbe lässt sich erlernen, sei es noch so hart, wenn man nur fest dazu entschlossen ist.«
»Körperkraft ist für dieses Gewerbe unerlässlich.«
»In Ermangelung der Kraft, Monsieur, kann man mit Geschicklichkeit manches ausrichten. Mir scheint, dass man nicht allzu viel Kraft benötigt, um das große oder kleine Toppsegel zu reffen oder um vom Mastkorb oder den Wanten aus Granaten auf das Deck eines gegnerischen Schiffs zu werfen.«
»In unserem Gewerbe«, sagte Surcouf, »gibt es Tätigkeiten, die ohne Körperkraft nicht zu bewältigen sind. Angenommen, Sie müssten eine Kanone bedienen, würden Sie sich dann zutrauen, eine achtundvierzigpfündige Kanonenkugel zur Kanone zu tragen?«
Und mit dem Fuß stieß er eine solche Kanonenkugel zu René hin.
»Ich glaube«, sagte dieser, »dass mir das ein Leichtes wäre.«
»Versuchen Sie es!«, sagte Surcouf.
René bückte sich, ergriff die Kugel mit einer Hand, als wäre er beim Kegelspiel, und warf sie über Surcoufs Kopf in den Garten.
Die Kugel rollte fast zwanzig Schritte weit, bevor sie liegen blieb.
Surcouf erhob sich, sah hinaus und setzte sich wieder.
»Vortrefflich Monsieur; an Bord der Revenant gibt es, mich eingeschlossen, höchstens fünf oder sechs Mann, die zu dem, was Sie eben taten, befähigt wären. Darf ich Ihre Hand sehen?«
René lächelte, zog seinen Handschuh aus und reichte Surcouf seine zarte und zierliche Hand, die dieser eingehend besah.
»Parbleu! Meine Herren«, rief Surcouf die Offiziere herbei, die sich am anderen Fenster aufhielten, »das müssen Sie sehen!«
Die Offiziere kamen herbei.
»Diese Mädchenhand«, fuhr Surcouf fort, »hat soeben jene Achtundvierzigerkugel über meinen Kopf hinweg nach dort draußen geschleudert.«
Renés Hand, die in Surcoufs kräftigen Händen wie eine Frauenhand gewirkt hatte, sah zwischen Kernochs riesigen Pranken wie eine Kinderhand aus.
»Kapitän«, sagte Kernoch, »Sie halten uns wohl zum Besten; soll das vielleicht eine Hand sein?« Und mit einer verächtlichen Geste brutaler Kraft gegenüber augenscheinlicher Schwäche stieß er Renés Hand von sich.
Surcouf streckte die Hand aus, um Kernoch Einhalt zu gebieten, doch René kam ihm zuvor und sagte: »Kapitän, gestatten Sie?«
»Nur zu, mein Junge, nur zu«, sagte Surcouf, der wie alle überlegenen Geister das Unerwartete begrüßte.
Und René sprang über die Querstange des Fensters hinweg in den Garten.
Nicht weit von der Kugel, die René geworfen hatte, lag eine zweite Kugel gleicher Größe, mit der Surcouf wohl Gewichtheben geübt hatte.
René legte die eine Kugel auf seine Handfläche, legte dann die zweite Kugel im Gleichgewicht auf die erste und trug beide zum Fenster; dort angekommen, nahm er in jede Hand eine Kugel, sprang unter der Querstange hindurch in das Zimmer und trat zu Kernoch, dem er eine Kugel reichte. »Ein Fass Apfelwein für die Mannschaft«, sagte er, »zu Ehren desjenigen, der die Kugel am weitesten wirft.«
René hatte sich seiner selbstgestellten Aufgabe mit so viel Anmut und Leichtigkeit unterzogen, dass mehrere der Offiziere die Kugeln betasteten, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich aus Eisen waren.
»Ha! Kernoch, alter Freund, das ist ein Vorschlag, den du kaum zurückweisen wirst.«
»Ganz gewiss nicht«, sagte Kernoch, »und vorausgesetzt, mein Schutzpatron, der heilige Jakob, lässt mich nicht im Stich...«
»Bitte sehr«, sagte René zu dem bretonischen Hünen.
Kernoch richtete sich auf, sammelte alle Körperkraft in seinem rechten Bein und rechten Arm, dann schnellten beide wie Federn zurück, die Kugel sauste durch das Fenster, fiel draußen in einer Entfernung von zehn Schritten zu Boden und rollte noch ein paar Schritte weiter.
»So viel vermag ein Mensch«, sagte Kernoch, »mehr kann nur der Teufel.«
»Ich bin nicht der Teufel, Monsieur Kernoch«, sagte René, »aber ich glaube Grund zu der Annahme zu haben, dass Sie es sein werden, der das Fass für die Mannschaft ausgibt.«
René begnügte sich damit, mehrmals mit dem Arm auszuholen, bevor er beim dritten Mal die Kugel warf, die ein paar Schritte hinter Kernochs Kugel zu Boden fiel und noch etwa zehn Schritte weit rollte.
Surcouf stieß einen Freudenruf aus, Kernoch einen Laut des Zorns. Alle anderen waren sprachlos vor Staunen; allerdings erbleichte René nach diesem Wurf erschreckend und musste am Kaminsims Halt suchen.
Surcouf sah ihn besorgt an, sprang zu einem Schränkchen, holte die umflochtene Flasche mit Branntwein heraus, die er bei Gefechten quer über Brust und Schulter umgehängt trug, und bot sie René an.
»Danke«, sagte dieser, »ich trinke nie geistige Getränke.«
Daraufhin trat er zu einer Wasserkaraffe, die mit einem Glas und etwas Zucker auf einem Tablett stand, goss ein wenig Wasser in das Glas und trank es. Sogleich kehrte das Lächeln auf seine Lippen und das Rot in seine Wangen zurück.
»Willst du deine Revanche, Kernoch?«, fragte ein junger Leutnant zur See.
»Meiner Treu, nein!«, erwiderte Kernoch.
»Kann ich Ihnen einen anderen Gefallen tun?«, fragte René.
»Jawohl!«, sagte Kernoch. »Machen Sie das Kreuzeszeichen.«
René musste lächeln; er bekreuzigte sich und sagte dazu die Worte: »Ich glaube an Gott den Herrn, den Allmächtigen, Schöpfer von Himmel und Erde.«
»Meine Herren«, sagte Surcouf, »lassen Sie mich jetzt bitte mit diesem jungen Mann allein.«
Alle zogen sich zurück, Kernoch brummend, die anderen lachend.
René, der mit Surcouf allein zurückblieb, war wieder so ruhig und bescheiden wie vorher. Ein anderer hätte vielleicht auf den Sieg angespielt, den er soeben errungen hatte, er jedoch wartete ruhig darauf, dass Surcouf das Wort an ihn richtete.
»Monsieur«, sagte dieser lachend, »ich weiß nicht, ob Sie noch andere Fertigkeiten besitzen als die, welche Sie mir vorgeführt haben, aber ein Mann, der so springen kann wie Sie und mit einer Hand eine Achtundvierzigerkugel wirft, wird auf einem Schiff wie dem meinen immer gebraucht. Was sind Ihre Bedingungen?«
»Eine Hängematte an Bord, Verpflegung wie an Bord üblich und das Recht, mich für Frankreich töten zu lassen, das ist alles, was ich verlange, Monsieur.«
»Mein lieber Freund«, sagte Surcouf, »ich bin es gewohnt, die Dienste, die man mir leistet, zu bezahlen.«
»Aber ein Seemann, der noch nie auf dem Meer war, ein Seemann, der sich auf sein Gewerbe nicht versteht, kann Ihnen keinerlei Dienst leisten, sondern im Gegenteil leisten Sie ihm einen Dienst, indem Sie ihm sein Gewerbe beibringen.«
»Meine Mannschaft erhält ein Drittel meiner Prisen; wären Sie einverstanden, in meinen Dienst zu treten zu den Bedingungen, die für meine besten und für meine schlechtesten Matrosen gelten?«
»Nein, Kapitän, denn Ihre Matrosen müssten mir zu Recht vorwerfen, dass ich Geld einstecke, das mir nicht zusteht, da ich nichts kann und alles lernen muss. In sechs Monaten können wir dieses Gespräch führen, wenn es Ihnen recht ist; bis dahin sollten wir es auf sich beruhen lassen.«
»Aber mein Lieber«, sagte Surcouf, »Sie werden doch nicht einzig und allein ein Athlet wie Milon von Kroton sein? Sind Sie vielleicht Jäger?«
»Die Jagd zählte zu den Vergnügungen meiner Jugend«, erwiderte René.
»Wenn Sie jagen, verstehen Sie sich auch auf Pistolen?«
»Wie jedermann.«
»Sie fechten?«
»Gut genug, um mich erstechen zu lassen.«
»Nun gut! An Bord haben wir drei ausgezeichnete Schützen und eine Rüstkammer, in der jedes Mitglied unserer Mannschaft zu den Zeiten, da es nicht auf Wache ist, nach Herzenslust mit Degen oder Säbel üben kann. Sie werden es halten wie die anderen und ihnen innerhalb von drei Monaten in nichts nachstehen.«
»Ich hoffe es«, sagte René.
»Dann bleibt nur noch die Frage Ihres Solds, und die werden wir nicht in sechs Monaten klären, sondern über dem Abendessen, denn ich hoffe, Sie werden mir nicht abschlagen, heute Abend mit mir zu speisen.«
»Oh, Kapitän, ich danke Ihnen für die Ehre.«
»Wollen Sie unterdessen unseren Pistolenschützen zusehen? Kernoch und Bléas sind gegeneinander angetreten, und da sie gleichwertige Kombattanten sind, wird die Sache so bald nicht entschieden sein.«
Surcouf führte Roland zu dem zweiten Fenster. Von dort aus sah man im Garten eine gusseiserne Schießscheibe in einer Entfernung von fünfundzwanzig Schritt, mit einem senkrechten Kreidestrich in der Mitte markiert.
Die zwei Seemänner setzten ihren Wettkampf fort, ohne sich um die Neuankömmlinge zu scheren; bei jedem Treffer applaudierten die Zuschauer.
Kernoch und Bleás waren gute, wenn auch nicht herausragende Schützen.
René applaudierte mit den anderen.
Kernoch traf den Kreidestrich, und René rief: »Bravo!«
Kernoch, der René noch immer verübelte, dass dieser ihn besiegt hatte, nahm Bléas wortlos die Pistole aus der Hand und reichte sie René.
»Was soll ich damit anstellen, Monsieur?«, fragte René.
»Vorhin haben Sie uns Ihre Körperkraft bewiesen«, sagte Kernoch, »und ich hoffe, Sie werden sich jetzt nicht zieren, Ihre Geschicklichkeit zu beweisen.«
»Oh, Monsieur, mit Vergnügen. Sie lassen mir wenig Chancen, da Sie die Linie getroffen haben, doch ich sehe, dass Ihre Kugel rechts ein wenig mehr übersteht als links.«
»Und?«, fragte Kernoch.
»Und«, sagte René, »ich will versuchen, den Kreidestrich genau in der Mitte zu treffen!«
Und er schoss so schnell, dass man fast hätte meinen können, er hätte gar nicht gezielt.
Die Kugel traf den Strich genau in der Mitte, und die Stelle sah aus, als wäre sie sorgsam ausgemessen worden.
Die Matrosen wechselten verblüffte Blicke. Surcouf brach in Gelächter aus.
»Nun, Kernoch«, fragte er seinen Bootsmann, »was sagst du dazu?«
»Ich sage, dass so etwas durch Zufall glücken kann, aber ein andermal …«
»Ein andermal wird es nicht geben«, sagte René, »denn schließlich ist das ein Kinderspiel, und ich mache Ihnen lieber einen anderen Vorschlag.«
Er sah sich um und bemerkte auf dem Schreibtisch rote Siegellackstückchen; er nahm fünf davon, sprang in den Garten, wobei er sich mit der Hand an der Querstange abstützte, und klebte die fünf Siegellackstücke auf die Schießscheibe, so dass sie eine Karo-Fünf bildeten; dann kehrte er zum Fenster zurück und sprang wieder hinein, ergriff die Pistolen und schoss fünf Kugeln ab, unter denen die fünf Siegellackstücke verschwanden.
Dann reichte er Kernoch die Pistole. »Jetzt sind Sie an der Reihe«, sagte er.
Kernoch schüttelte den Kopf. »Danke«, erwiderte der, »ich bin ein guter Bretone und ein guter Christ, aber das hier ist Teufelswerk, und damit will ich nichts zu tun haben.«
»Du hast recht, Kernoch«, sagte Surcouf, »und damit der Teufel uns keinen Streich spielt, werden wir ihn an Bord der Revenant mitnehmen.«
Und er öffnete die Tür zum Nebenraum, in dem sich der Fechtmeister des Schiffs aufhielt, denn Surcouf, der selbst jede Art körperlicher Ertüchtigung beherrschte, wünschte sich das Gleiche für seine Matrosen, und deshalb hatte er einen Fechtmeister angestellt, der diese im Schwertkampf und im Florettfechten unterrichtete.
Man war gerade beim Assaut.
Surcouf und René sahen eine Weile zu.
Surcouf konsultierte René zu einem Stoß, der ihm schlecht pariert erschien.
»Ich«, sagte der junge Mann, »hätte mit einer Quart pariert und als Riposte einen Ausfall geführt.«
»Monsieur«, sagte der Fechtmeister und strich sich über seinen Schnurrbart, »das wäre der sicherste Weg gewesen, sich wie ein Vogel zum Braten aufspießen zu lassen.«
»Das mag sein, Monsieur«, sagte René, »dann hätte ich meine Parade und meine Riposte zu langsam ausgeführt.«
»Ist Monsieur hier, um eine Stunde zu nehmen?«, fragte der Fechtmeister lachend Surcouf.
»Sehen Sie sich vor, mein lieber Bras-d’Acier«, erwiderte Surcouf, »dass Monsieur nicht am Ende Ihnen eine Stunde gibt. Zwei Lektionen hat er schon erteilt, seit er hier ist, und ich bin stark geneigt zu glauben, dass er sich nicht bitten ließe, Ihnen die dritte zu erteilen, wenn Ihr Schüler ihm sein Florett leihen wollte.«
»Chasse-Bœuf«, sagte der Fechtmeister, »geben Sie Monsieur Ihr Florett, damit er den Ratschlag, den er Ihnen vorhin gab, in die Tat umsetzen kann.«
»Das werden Sie nicht erleben, Monsieur Chasse-Bœuf«, sagte René, »denn es wäre ungehörig, einen Fechtmeister zu touchieren, und deshalb will ich mich damit begnügen zu parieren.«
Und mit unnachahmlicher Anmut salutierte René mit dem Florett, das der Schüler ihm gereicht hatte, und ging in Fechterstellung.
Daraufhin begann ein merkwürdiger Zweikampf mit Meister Brasd’Acier, der seine ganze Kunst aufbot, doch vergebens. René wehrte seine Klinge mit leichter Hand und den vier Grundparaden ab, ohne sich die Mühe zu machen, Kontrariposten zu führen. Bras-d’Acier führte seinen Spitznamen zu Recht, denn eine Viertelstunde lang erschöpfte er das ganze Repertoire an Fechthieben, als da sind Finte, Ausfall, Bindung; er machte die kompliziertesten Hiebe noch komplizierter, doch alles vergebens: Der Knopf an seinem Rapier fuhr immer wieder links und rechts an seinem Gegner vorbei.
Als René erkannte, dass Meister Bras-d’Acier nicht bereit war, sich geschlagen zu geben, salutierte er mit ebenso formvollendeter Höflichkeit wie zur Eröffnung des Zweikampfes und versprach Surcouf, der ihn zur Tür begleitete, sich pünktlich zum Essen einzufinden, das heißt um fünf Uhr.
53
Die Offiziere der Revenant
Am selben Tag wurde René um drei Uhr nachmittags in den Salon des Kapitäns geführt, in dem ihn Madame Surcouf empfing, die mit einem Kind von zwei Jahren spielte.
»Verzeihen Sie, Monsieur«, sagte sie, »aber Surcouf, den dringende Geschäfte aufgehalten haben, konnte nicht um drei Uhr hier sein, um sich ausführlich mit Ihnen zu unterhalten, wie es seine Absicht war; er bat mich, Sie in der Zwischenzeit zu empfangen, und ich bitte Sie, Nachsicht mit einer einfachen Frau aus der Provinz zu haben.«
»Madame«, sagte René, »ich weiß, dass Monsieur Surcouf seit drei Jahren das Glück genießt, mit einer bezaubernden Frau verheiratet zu sein; ich hätte nicht bis jetzt gewartet, ihr vorgestellt zu werden, hätte nicht der Rang eines einfachen Matrosen, falls Monsieur Surcouf mich als solchen in seine Mannschaft aufnehmen sollte, meinen Wunsch zu einer Anmaßung gemacht. Bis heute habe ich seinen Mut bewundert, Madame, und von heute an bewundere ich seine Hingabe. Niemand hat seine Dankesschuld an das Vaterland gründlicher entrichtet als Monsieur Surcouf. Frankreich mochte viel von ihm erwarten, doch zu verlangen hatte es nichts mehr von ihm, und ich wiederhole es: Um dieses reizende Kind zu verlassen, das zu küssen Sie mir hoffentlich erlauben, und vor allem die Mutter dieses Kindes zu verlassen, braucht man mehr als nur Mut, man braucht Hingabe.«
»Ha, weiß Gott!«, sagte Surcouf, der die letzten Worte gehört hatte und mit dem doppelten Stolz des Vaters und des Ehegatten gesehen hatte, wie der Matrose in spe seinen Sohn küsste und sich vor seiner Frau verbeugte.
»Kommandant«, sagte René, »bevor ich Madame und das reizende Kind gesehen hatte, hätte ich Ihnen jedes Opfer zugetraut; doch nun kann ich es nicht glauben, dass die Liebe zum Vaterland so weit gehen kann, dass ein Mann sich vom Innersten seines Herzens trennt, es sei denn, Sie bestätigen es ausdrücklich.«
»Nun, meine Liebe, was sagen Sie dazu?«, fragte Surcouf. »Hat Ihnen je, seit Sie mit einem Korsaren verheiratet sind, einer meiner Matrosen so elegante Komplimente gedrechselt wie unser neuer Freiwilliger?«
»Was für Scherze!«, rief Madame Surcouf. »Monsieur ist doch nicht etwa als gewöhnlicher Marose angeheuert!«
»So gewöhnlich wie nur irgend möglich, Madame, und sollte ich mich durch den Zufall von Bildung und Erziehung in einem Salon vorteilhafter ausnehmen als die wackeren Männer der Schiffsbesatzung, werden die Ungebildesten unter ihnen mir haushoch überlegen sein, sobald wir uns an Bord befinden.«
»Ich hatte Ihnen drei Uhr angegeben, Monsieur«, sagte Surcouf, »weil ich Sie mit jedem der Offiziere der Revenant bekannt machen will, die heute...«
Im selben Augenblick wurde die Tür geöffnet, und Surcouf sagte: »Das ist unser erster Offizier Monsieur Bléas.«
»Ich habe die Ehre, Monsieur vom Hörensagen zu kennen; Sie haben sich an Bord der Confiance gemeinsam mit Kernoch geopfert und an Bord der Sibylle nehmen lassen, in der Sie zu spät ein gegnerisches Schiff erkannten. Solche Selbstaufopferung macht demjenigen, der sie übt, ebenso viel Ehre wie demjenigen, um dessentwillen sie geübt wird.«
»Ich hoffe, Kommandant«, sagte Bléas, »dass Sie mir nun auch Monsieur vorstellen werden, denn bislang kenne ich ihn nur als einen der besten Pistolenschützen, die ich je erlebt habe.«
»O weh, Monsieur«, sagte René, »anders als Sie verfüge ich über keine strahlende Vergangenheit, auf die den Blick zu richten sich lohnte. Ich heiße ganz einfach René und erbitte von Monsieur Surcouf die Güte, mich als Matrosen in die Mannschaft der Revenant aufzunehmen.«
»Darum müssen Sie nicht mich bitten«, sagte Surcouf lachend, »sondern unseren Quartiermeister.« Und bei diesen Worten wies er auf Kernoch, der soeben eintrat.
»Kommen Sie her, Kernoch! Es verdrießt mich, dass Sie vorhin nicht zugegen waren, als Monsieur René in den höchsten Tönen einen Bootsmann von der Confiance pries, der sich zusammen mit einem jungen Fähnrich, dessen Name mir entfallen ist, opferte und sich an Bord eines englischen Schiffs nehmen ließ, auf dem er dann einen Nervenzusammenbruch vortäuschte und die Herren Rotfräcke gewaltig an der Nase herumführte, während der Kapitän der Confiance, statt wie ein Kaninchen von einem Leoparden zerfleischt zu werden, mit vollen Segeln die Flucht ergriff.«
»Meiner Treu«, sagte Kernoch und deutete auf René, »wäre Monsieur damals zugegen gewesen, wäre das alles gar nicht nötig gewesen: Sie hätten ihm eine unserer vortrefflichen Lepage-Pistolen gegeben und gesagt: ›Schießen Sie diesem Dummkopf ein Loch in den Kopf!‹ Gesagt, getan, und das hätte an Bord des Engländers ein viel gewaltigeres Durcheinander angerichtet als mein Nervenzusammenbruch. Oh! Sie waren nicht dabei, Monsieur Bléas, als Monsieur René uns heute Morgen eine Lektion im Pistolenschießen erteilt hat. Das verdrießt mich, aber wenn er mit uns in See sticht, wie es heißt, dann werden Sie selbst sehen, wie er dieses kleine Instrument handhabt. Was sein Florettfechten betrifft, kann unser Freund Bras-d’Acier Ihnen darüber alle erforderlichen Auskünfte erteilen.«
»Sie täuschen sich, Kernoch«, sagte der Fechtmeister, »denn Monsieur hat mir zwar die Ehre erwiesen, alle Hiebe zu parieren, es aber nicht für nötig befunden, eine einzige Riposte zu führen.«
»Da haben Sie in der Tat meine schwache Stelle entdeckt, Monsieur Bras-d’Acier«, sagte René. »Ich habe die Verteidigungsstellungen zu sehr geübt und die Attacke zu wenig; mein Fechtlehrer war ein alter Italiener mit Namen Belloni, der zu behaupten pflegte, man bringe seinen Gegner mehr aus der Fassung, wenn man dreimal pariere, als wenn man ein einziges Mal touchiere; und wenn das stimmt, warum touchieren, wenn man parieren kann?«
»Und jetzt«, sagte Surcouf, »muss ich Ihnen nur noch diese zwei saumseligen Gesellen vorstellen, die ich für die zwei besten Granatenwerfer der Welt halte; und ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass sie sich vielleicht zum Essen verspäten, aber nie und nimmer, wenn es zum Kampf kommt, der eine im Besanmars, der anderen im Fockmars. Doch nun, Monsieur René, wollen wir uns in das Esszimmer begeben, wenn Sie Ihren Arm Madame Surcouf geben.«
Eine Zofe trat nach diesen Worten herbei, um den kleinen Surcouf zu holen, der als braves Kind gehorchte, ohne zu mucken.
Wir alle kennen die reichhaltigen Mahlzeiten der Provinz, und Surcoufs Tafel war in dieser Hinsicht geradezu legendär; seine Diners hätten die homerischen Heroen zufriedengestellt: Seine eigenen Helden aßen wie ein Diomedes und tranken wie ein Ajax, und er selbst hätte es gar mit Bacchus aufnehmen können. Es versteht sich von selbst, dass die Gesellschaft von närrischer Ausgelassenheit und äußerst laut war. Da René nur Wasser trank, wurde er so ausgiebig verspottet, dass er zuletzt um Gnade bat, die ihm jedermann außer Meister Bras-d’Acier gern gewähren wollte. Von der Hartnäckigkeit des Fechtmeisters enerviert, bat René Madame Surcouf um Verzeihung für das, was zu tun er sich genötigt sah, und bat sie, auf ihre Gesundheit trinken zu dürfen.
Die Erlaubnis wurde gewährt.
»Und nun, Madame«, sagte er, »hätten Sie vielleicht ein Trinkgefäß im Hause, würdig eines wahren Trinkers, das den Inhalt von zwei oder drei Flaschen fasst?«
Madame Surcouf sagte etwas zu einem Bedienten, der einen silbernen Kelch brachte, mit Wappen verziert, die seine englische Herkunft verrieten. René goss drei Flaschen Champagner hinein.
»Monsieur«, sagte er zu dem Fechtmeister, »ich werde die Ehre haben, diesen Kelch auf die Gesundheit Madame Surcoufs zu leeren. Beachten Sie bitte, dass Sie mich dazu zwingen, denn als ich zu Beginn unserer Mahlzeit sagte, ich tränke nur Wasser, sprach ich die Wahrheit. Sobald ich den Kelch geleert haben werde, hoffe ich, dass Sie ihn ebenfalls füllen und leeren werden, diesmal nicht auf die Gesundheit Madame Surcoufs, sondern auf Ruhm und Ehre ihres Gatten.«
Donnernder Beifall erschallte nach dieser Ansprache, die der Fechtmeister wortlos, aber mit weit aufgerissenen Augen vernahm.
René hatte sich erhoben, um sich vor Madame Surcouf zu verbeugen, und die Gäste hatten seinen Worten begeistert applaudiert; doch als man sah, mit welch unbeteiligter und trauriger Miene er den riesigen Kelch voll des berauschenden Champagners zum Munde führte, ein verächtliches Lächeln für das, was er tat, auf den Lippen, trat Stille ein, und alle hielten ihren Blick auf den jungen Matrosen gerichtet, um zu sehen, wie weit er es treiben würde, was selbst die Trinkfestesten als Wahnsinnstat bezeichnen mussten.
Doch ungerührt und ohne sich zu beeilen, begann René zu trinken, trank weiter, wobei er den Kelch unmerklich anhob, und seine Lippen blieben dem Kelchesrand verhaftet, bis kein Tropfen des schäumenden Nasses mehr im Kelch verblieben war. Daraufhin stellte er ihn mit dem Fuß nach oben auf seinen Unterteller, und kein Tropfen rann hinunter. Dann setzte er sich, stellte den Kelch vor den Fechtmeister und sagte: »Nun sind Sie an der Reihe, Monsieur.«
»Ha! Meiner Treu, Sapperlot!«, sagte Kernoch. »Jetzt bist du an der Reihe, Bras-d’Acier.«
Dieser fühlte sich außerstande, den Wettstreit auszutragen, und wollte sich entschuldigen, doch Kernoch erhob sich und sagte, wenn er den Kelch nicht freiwillig leere, werde man ihn dazu zwingen, und während er dies sagte, riss er den Drahtverschluss von einer Flasche Champagner und leerte sie in den Silberkelch. Als Bras-d’Acier sah, dass ihm keine andere Wahl blieb, bat er, die drei Flaschen nacheinander trinken zu dürfen, und das wurde ihm gewährt; doch kaum hatte er die erste Flasche geleert, ließ er den Kopf in den Nacken fallen, bat um Gnade und sagte, er könne keinen Tropfen mehr trinken, und keine fünf Minuten später sank er besinnungslos von seinem Stuhl.
»Lassen Sie mich unseren heiligen Georg versorgen«, sagte Kernoch, »und wenn ich wiederkomme, werde ich Ihnen ein Liedchen vortragen, um den Zwischenfall aus Ihren Gemütern zu tilgen.«
Zu jener Zeit endete jedes Diner – selbst in den großen Städten – damit, dass der eine oder andere Gast sich erhob und ein Loblied anstimmte, sei es auf die Dame des Hauses, sei es auf den Gastgeber, sei es auf den eigenen Berufsstand. Kernochs Vorschlag wurde daher freudig aufgenommen; während seiner kurzen Abwesenheit riefen die anderen: »Kernoch! Das Lied! Das Lied!« und verlangten noch lauter nach dem Lied, als er wieder erschien. Kernoch ließ sich nicht lange bitten. Nachdem er ein Zeichen gemacht hatte, dass er beginnen wolle, gab er mit entsprechendem Mienenspiel und Agréments folgendes Lied zum Besten:
Die Brigg Black
Wenn das Meer und der Wind
Uns gewogen sind
Wenn sie sacht
In der Nacht
Wiegen unser Schiff
Unsern alten Kahn
Ho!
Küsst die Brise dann
Sanft den Wellenkamm
Krick und krack!
Schon säuft’s ab
Das alte Wrack!
»Alle zusammen!«, rief Kernoch. Und alle Gäste bis auf Bras-d’Acier, dessen Schnarchen noch aus dem Nebenzimmer zu vernehmen war, riefen im Chor: »Krick und krack! Schon säuft’s ab, das alte Wrack!«
So ein Seemannslied war ganz nach dem Herzen der Gäste, und es wurde mit großem Beifall aufgenommen; Da-capo-Rufe ertönten, bis der Sänger einzelne Strophen wiederholte, und zuletzt wurde Bravo gerufen und applaudiert, dass die Wände wackelten. Doch was den Gästen kaum weniger Bewunderung abnötigte als die Gesangsdarbietung des Quartiermeisters, das war die Contenance, die René weiterhin bewahrte, nachdem er den Kelch geleert hatte, den der Fechtmeister nicht hatte leeren können. Seine Miene war unverändert, weder gerötet noch erbleicht, und seine Sprache war so klar und vernünftig, als hätte er höchstens ein Glas Wasser getrunken.
Alle Blicke richteten sich nun auf Surcouf; ein Lied von ihm wäre die Krönung seiner Gastfreundschaft, und da er wohl begriff, was man von ihm erwartete, sagte er lächelnd: »Wohlan, sei’s drum! Ich werde euch das Lied vortragen, das ich früher sang, wenn ich die Schiffsjungen unterwies.«
Gemurmel erhob sich, indes andere Stimmen riefen: »Psst! Leise!«, und dann trat Stille ein.
Surcouf räuspert sich und beginnt:
Junge, nimm das Tau dort am Mast
Und zeig mir, wie du den Palstek machst
Eins und zwei, so recht? … Sapperlot!
Meister, weder Bürger bin ich noch Soldat
Und ich weiß, wie man den Palstek schlingt und löst
Denn ich lerne meinen Dienst...
Surcouf sang alle Strophen, und sein Lied wurde ebenso begeistert aufgenommen wie Kernochs Darbietung. Die schöne Dame des Hauses jedoch konnte ihre Neugier darauf nicht verhehlen, ob Renés Gelassenheit ungekünstelt war oder sich einer übermächtigen Willensanstrengung verdankte, und deshalb sprach sie ihn an und sagte: »Monsieur René, wollen Sie der Einzige sein, der uns kein Lied aus seiner Heimat zu Gehör bringt?«
»Ach, Madame!«, sagte René, »ich habe keine Heimat; ich bin in Frankreich geboren, an mehr darf ich mich nicht erinnern, und ich weiß nicht, ob ich in meinem Gedächtnis, suchte ich darin, noch ein einziges Lied wiederfinden würde; alle Freuden meiner Kindheit, alle Blumen meiner Jugend wurden durch drei Jahre des Kummers und des Winters abgetötet; doch ich werde mich zu erinnern suchen, und wenn ich ein paar Schneeglöckchen finde, werde ich sie pflücken. Madame, Sie und Ihre Gäste werden entschuldigen, dass ich keine Lieder zu singen verstehe, die den Seemannsstand preisen; nach der ersten Kampagne werde auch ich mich darauf verstehen, wie ich hoffe, doch bis dahin muss ich mich mit dem begnügen, was Sie nun hören werden.«
Und mit einer hellen und klaren Stimme wie der eines Mädchens sang er folgendes Lied:
Wär ich ein Sonnenstrahl
Schien ich als Liebespfeil
Hüllte dich in mein Licht
Doch meine Kraft versiegt
An deinem Augenlid
Wär ich das Spiegelein
In deinem Kämmerlein
Sähst du dein Bild darin
An meines Herzens Grund
Dies schöne Traumgespinst.[4]
Und alle Couplets dieses Liedes wurden von den Gästen mit großem Beifall bedacht.
»Meine Herren«, sagte Madame Surcouf, »wenn die Nachtigall gesungen hat, schweigen alle Vögel. Gehen wir in den Salon, wo der Kaffee wartet.«
René erhob sich, reichte Madame Surcouf den Arm und ging mit ihr in den Salon; kaum hatte er sich dort mit einer Verbeugung zurückgezogen, als Surcouf auf ihn zukam, ihn nun am Arm nahm und mit ihm an ein Fenster trat. René begleitete ihn mit der Ehrerbietung eines Untergebenen für seinen Vorgesetzten.
»Mein lieber René, ich glaube, dass es langsam an der Zeit ist«, sagte Surcouf, »diese Komödie zu beenden. Sagen Sie mir, was Sie von mir wünschen und zu welchem Zweck Sie mich aufgesucht haben; Sie sind so liebenswert, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um mich Ihnen gefällig zu zeigen.«
»Ich hatte und habe keinen anderen Wunsch als den, bei Ihnen anzuheuern, mein Kommandant, und als einfacher Matrose in Ihre Mannschaft aufgenommen zu werden.«
»Aber wie kommt es, dass Sie sich solche Flausen in den Kopf gesetzt haben? Sie versuchen vergebens zu verbergen, dass Sie einer vornehmen Familie entstammen; Ihre Erziehung ist die eines Mannes, der höchste Staatsämter anstreben kann. Ist Ihnen denn nicht bewusst, in welche Gesellschaft Sie sich begeben und welche Arbeiten Sie dort zu verrichten haben?«
»Monsieur Surcouf, jemand wie ich, der sich allen Stolzes entschlagen hat, kennt keine Gesellschaft, die seiner unwürdig wäre. Meine Arbeit wird mühsam sein, das weiß ich, doch Sie wissen, dass ich stark bin, und Sie haben gesehen, dass ich geschickt sein kann; ich trinke nur Wasser, und wenn man mich zwingt, Wein zu trinken, viel Wein sogar, bewahre ich trotzdem einen klaren Kopf, wie Sie sahen. Was die Gefahr betrifft, glaube ich das Gleiche behaupten zu können wie vom Wein: Ich habe so lange Tag für Tag mit dem Tod gerechnet, dass ich zuletzt mit ihm vertraut wurde; da man mir die Wahl der Waffengattung und des Mannes, bei dem ich dienen wollte, überließ, beschloss ich, Matrose zu werden, und da Sie einer der tapfersten und loyalsten Offiziere sind, die ich kenne, wählte ich Sie als meinen Anführer.«
»Ich mache Sie darauf aufmerksam, Monsieur«, sagte Surcouf, »jeder Matrose, auch jeder einfache Matrose, der bei uns anheuert, kann seine Wünsche äußern, und sobald sie in die Musterrolle eingetragen sind, werden sie berücksichtigt.«
»Ich will Dienst und Lebensweise meiner Kameraden teilen; ich habe keinerlei Anspruch darauf, dass man mir irgendeine Tätigkeit erspart, die ich als einfacher Matrose zu verrichten hätte; das Einzige, was mir widerstrebte, wie Sie sich denken können, wäre, die Hängematte mit einem anderen teilen zu müssen.«
»Was Sie verlangen, ist so lächerlich wenig, dass ich es Ihnen schwerlich verweigern kann, aber ich will Ihnen mehr anbieten: Wollen Sie mein Sekretär sein? Dann hätten Sie nicht nur eine eigene Hängematte, sondern auch eine eigene Kajüte.«
»Ich nehme Ihr Angebot dankend an, vorausgesetzt, diese Tätigkeit lässt mir genug Zeit für die übrigen Arbeiten eines Matrosen und die Teilnahme am Kampf, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte.«
»Ihre Arbeit als Matrose könnte ich getrost entbehren«, sagte Surcouf lachend, »aber ich müsste ein rechter Tor sein, wollte ich auf Ihre Unterstützung im Kampf verzichten.«
»Darf ich Sie um einen weiteren Gefallen bitten? Ich möchte mit meinen eigenen Waffen kämpfen, mit den Waffen, die ich gewohnt bin.«
»Bevor der Kampf beginnt, werden die Waffen an Deck gebracht, und jeder nimmt, was ihm zusagt; Sie werden sich in Ihrer Kajüte bewaffnen; dieser Gefallen ist also denkbar gering.«
»Eine letzte Bitte: Sollten wir an der Küste Koromandels oder Bengalens an Land gehen, gestatten Sie mir, an einer Tiger- oder Pantherjagd teilzunehmen – auf eigene Kosten, wohlverstanden -, denn davon habe ich so oft gehört; und wenn Sie eine Expedition unternehmen müssen, bei der Sie das Leben Ihrer Offiziere nicht gefährden wollen, dann beauftragen Sie mich damit; mein Leben ist für niemanden von Bedeutung, und niemand muss um mich trauern.«
»Dann erlauben Sie mir«, sagte Surcouf, »dass ich Sie bei der Verteilung der Prisen als Offizier behandle. Die Prisen werden folgendermaßen aufgeteilt: ein Drittel für mich, ein Drittel für die Offiziere, ein Drittel für die Soldaten.«
»Und ich darf mit meinem Anteil anfangen, was mich gut dünkt?«, fragte René.
»Selbstverständlich«, erwiderte Surcouf.
»Mein Kommandant, jetzt möchte ich Sie etwas fragen«, sagte René. »Haben Sie Waffen, auf die Sie sich verlassen können?«
»Die habe ich: einen Stutzen, eine Doppelflinte, die ich Donnerbüchse nenne, und meine Flaschenköpfer, die Sie bereits kennen.«
»Ihre Flaschenköpfer?«
»Meine Pistolen. Auf See lasse ich Flaschen an den Luvbäumen der Beisegel befestigen, damit meine Männer sich im Schießen üben können; wer sich vom Schlingern und Stampfen des Schiffs nicht aus der Ruhe bringen lässt und eine Flasche erwischt, hat drei Francs verdient, wenn er mit dem Gewehr geschossen hat, und fünf Francs, wenn es ein Pistolenschuss war.«
»Ich werde Sie bitten, mich an diesen Übungen zu beteiligen, allerdings unter dem Vorbehalt, mit meiner Belohnung nach eigenem Gutdünken verfahren zu dürfen.«
»Sicherlich; und jetzt, mein lieber René, rate ich Ihnen trotz Ihrer bescheidenen Wünsche, gründlich über den Stand nachzudenken, in den Sie eintreten wollen, sei es aus Neigung, sei es, weil eine Macht, die stärker ist als Ihr Wille, Sie dazu nötigt. Ich will, dass Sie es zu etwas bringen, notfalls gegen Ihren Willen. Haben wir jetzt alles besprochen? Wollen Sie mich noch irgendetwas fragen? Kann ich Ihnen noch irgendetwas anbieten?«
»Nichts, mein Kommandant, ich danke Ihnen.«
»Kernoch, den Sie sich zum Freund gemacht haben, wird Sie in allen praktischen Belangen unterweisen, und ich werde Ihre anderweitigen Studien leiten, wenn es Ihnen recht ist. Oh, da kommt Madame Surcouf mit einer Tasse Kaffee in der einen und einem Gläschen Likör in der anderen Hand, auf der Suche nach Ihnen.«
René näherte sich Madame Surcouf, verbeugte sich höflich und sagte: »Madame, Sie werden mich entschuldigen, aber ich nehme niemals Kaffee oder Likör zu mir.«
»Ha, wahrscheinlich ist es damit so wie mit dem Champagner«, sagte Kernoch, der es nicht lassen konnte, die höflichen Worte des jungen Mannes mit einem groben Scherz zu unterbrechen, »wenn man wenig davon trinkt, bekommt es einem schlecht.«
»Es würde mich sehr verdrießen«, fuhr René fort, »sollten Sie, Madame, in dem unedlen Sieg, den ich davongetragen habe, etwas anderes sehen als meinen Wunsch, mich den Scherzen Meister Bras-d’Aciers zu entziehen, die mir sonst eines der bezauberndsten Diners meines Lebens vergällt hätten.«
»Und da Sie nun beim Dessert angekommen sind«, sagte eine Stimme, »müssen Sie hoffentlich nicht mehr befürchten, dass es Ihnen vergällt werden könnte.«
»Sieh an«, sagte René, »Meister Bras-d’Acier ist aus seinem Schlummer erwacht. Ich muss Ihnen gratulieren, Monsieur, denn ich hätte gedacht, Sie wären mindestens bis morgen früh betäubt.«
»Beim Schwert des heiligen Georg, Kommandant, Sie werden doch nicht zulassen, dass einer Ihrer Offiziere in Ihrer Gegenwart so schmählich beleidigt wird, ohne dass er auf der Stelle Genugtuung verlangte! Degen her, Degen her!«
Der Fechtmeister eilte in die Rüstkammer, in der er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, und kehrte sogleich zurück, in jeder Hand einen Kampfdegen.
Madame Surcouf stieß einen Schrei aus, und die Männer stellten sich Bras-d’Acier in den Weg.
»Monsieur«, sagte Surcouf, »ich befehle Ihnen, sich unverzüglich nach Hause zu begeben und dort bis zu unserer Abfahrt unter Arrest zu bleiben.«
»Verzeihen Sie, Kommandant«, sagte René, »aber hier sind Sie nicht an Bord Ihres Schiffs, sondern in Ihrem Wohnhaus, und als Ihre Gäste haben Sie uns – wenigstens für den Augenblick – Ihnen gleichgestellt. Wenn Sie Monsieur vor die Tür setzen, zwingen Sie mich, das Haus mit ihm zu verlassen und ihn unter der nächstbesten Straßenlaterne zu töten; wenn Sie aber gestatten, dass das, was als Komödie begann, auch als Komödie beendet wird, werden wir Madame das merkwürdige Spektakel eines Duells auf Tod und Leben bieten, in dem kein Tropfen Blut vergossen wird.«
»Aber...«, sagte Surcouf.
»Lassen sie mich gewähren, mein Kommandant«, sagte René. »Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass niemandem ein Haar gekrümmt wird.«
»Auf dann, wenn Sie darauf bestehen, meine Herren. Tun Sie, was Sie nicht lassen können.«
Sobald Surcouf seine Erlaubnis erteilt hatte, stellten sich die Gäste an zwei Seiten des Salons auf, um in der Mitte genug freien Platz zu lassen.
Meister Bras-d’Acier, dem die Etikette des Duells heilig war, entledigte sich seines Rocks und seiner Weste und reichte René zwei Degen. René erkannte, dass der Fechtmeister in seiner Hast aus Versehen anstelle von zwei Degen einen Degen und ein Florett ergriffen hatte. René nahm daraufhin schnell das Florett, und die Umstehenden, die den Knopf am Ende der Klinge sahen, mussten lachen.
Meister Bras-d’Acier blickte verwirrt um sich, um den Grund des Gelächters herauszufinden, und merkte, dass René ein Florett in Händen hielt und er einen Degen.
»Ich sagte es ja, Monsieur«, sagte René, »dass Sie noch nicht ganz wach sind, aber Sie haben genau das getan, was ich mir gewünscht habe. In Deckung, bitte, und schonen Sie mich nicht.«
Und der junge Mann ging in Deckung.
»Aber Sie können sich unmöglich«, riefen alle Zuschauer, »mit einem Florett verteidigen, wenn Monsieur Sie mit einem Degen attackiert!«
»Und doch werde ich es tun«, erwiderte René ernst, »denn sonst sähe ich mich gezwungen, morgen mit gleichen Waffen gegen Monsieur anzutreten, und dann wäre ich genötigt, Monsieur zu töten, wenn ich nicht wie ein Hanswurst dastehen wollte, und das würde ich unendlich bedauern. Auf, Meister Bras-d’Acier, Sie sehen doch, dass ich warte: Bis zum ersten Blutstropfen, wenn Sie darauf bestehen; und damit niemand mich des Mogelns beschuldigen kann, werde ich es Ihnen mit Madames Erlaubnis nachtun.«
Er warf seine Jacke und seine Weste auf einen Sessel und stand im Hemd aus feinstem Batist da, dessen strahlendes Weiß mit dem Eierschalton des Hemdes von Bras-d’Acier kontrastierte.
Dann vollführte er eine gewandte Drehung und stand wieder in Deckung, die Spitze des Floretts gesenkt und in so eleganter Haltung, dass die Zuschauer unwillkürlich klatschten, als hätten sie es mit einem ganz normalen Assaut zu tun.
Dieser Beifall versetzte den Fechtmeister in ohnmächtigen Zorn, und er stürzte sich auf seinen Gegner.
Das gleiche Schauspiel, das am Vormittag im Sonnenschein seinen Lauf genommen hatte, wiederholte sich nun bei Kerzenlicht: Meister Brasd’Acier setzte alles ein, was es in der Fechtkunst an Hieben, Finten und Riposten gibt, und all seine Hiebe wurden mit wahrhaft entmutigender Ruhe, Kaltblütigkeit und Gelassenheit pariert, bis René zuletzt eine Finte so leichtfertig vollführte, dass die Degenspitze seines Gegners sein Hemd, wenn auch nicht seine Haut berührte und einen langen Riss hineinschnitt, so dass seine Brust halb entblößt war.
René begann zu lachen.
»Heben Sie Ihren Degen auf, Monsieur«, sagte er, und im gleichen Augenblick brachte er die Klinge seines Floretts so geschickt und heftig mit dem Degen des Fechtmeisters in Bindung, dass er ihn zehn Schritt hinter seinen Gegner schleuderte.
Und während Meister Bras-d’Acier seinen Degen holte, tauchte René den Knopf an der Spitze seines Floretts in ein Tintenfass.
»Ich werde«, sagte er, »Ihnen jetzt drei Hiebe versetzen, und diese drei Hiebe werden ein Dreieck auf ihrer Brust bilden. In einem echten Duell wäre jeder dieser drei Hiebe ein tödlicher Stich. Wenn wir gute Freunde sein werden, und ich vertraue darauf, dass wir es bald sein werden, werde ich Ihnen beibringen, wie man diese Stöße pariert.«
Und wahrhaftig führte René wie angekündigt seine Klinge dreimal wie einen Blitz, und dann sprang er zurück: Der Knopf an seiner Klinge hatte drei schwarze Flecken auf die rechte Seite der Brust des Fechtmeisters gemalt, und diese drei Flecken bildeten ein so gleichmäßiges Dreieck, als wären sie mit dem Zirkel aufgezeichnet.
Daraufhin legte René sein Florett auf einen Stuhl, zog seine Weste und seine Jacke wieder an, nahm seinen Hut, trat zu seinem Gegner, um ihm die Hand zu geben, was ihm dieser verweigerte, schüttelte Surcouf die Hand, küsste Madame Surcouf die Hand und bat sie um Verzeihung, dass er an diesem Tag zweimal gegen die guten Sitten gesündigt hatte, indem er zuerst auf einen Zug drei Flaschen Champagner geleert und ihr danach das Schauspiel eines Duells verschafft hatte; dann verabschiedete er sich von allen anderen Anwesenden mit einem freundschaftlichen Blick und einer anmutigen Geste und ging.
Kaum hatte die Tür sich hinter ihm geschlossen und Meister Brasd’Acier sich in die Rüstkammer begeben, um sich wieder anzukleiden, als die Gäste sich in Lobreden auf den neuen Matrosen der Revenant ergingen.
»Aber was zum Teufel«, rief Surcouf, »kann einen solchen Stutzer dazu bewegt haben, sich als einfacher Matrose zu verdingen?«
»Ich weiß es«, flüsterte Madame Surcouf ihrem Mann ins Ohr.
»Du weißt es?«
»Dahinter steckt ein Liebeskummer.«
»Und wie hast du das erraten?«
»Durch den Riss in seinem Hemd habe ich auf seiner Brust eine goldene Kette mit einem Medaillon gesehen, das eine Zahl aus Diamanten trägt.«
»Da könntest du recht haben«, sagte Surcouf, »was den Liebeskummer betrifft. Aber wie kommt ein so vornehmer Mann auf die Grille, als einfacher Matrose anzuheuern?«
»Oh, das weiß ich allerdings nicht.«
»Das ist das Geheimnis«, sagte Surcouf.
Am nächsten Morgen wurde René von Surcouf und dem Fechtmeister geweckt. Die Nacht und vor allem Surcouf hatten den Fechtmeister eines Besseren belehrt, und er kam, um René um Entschuldigung zu bitten.
54
In See gehen
Acht Tage nach den soeben berichteten Ereignissen – anders gesagt gegen Ende Juli – drängten sich auf den Stadtmauern von Saint-Malo mit Blick auf das Becken im Landesinneren und mit Blick auf den Seehafen sowie auf den Felsen von Saint-Servan, die heute unter einer Straße verschwunden sind, zahlreiche Neugierige, die es nach einem Schauspiel gelüstete, das in Seehäfen jeden Tag aufs Neue geboten wird, ohne dass die Zuschauer seiner je überdrüssig würden; alle Schiffe im Hafen waren beflaggt, ebenso alle Häuser mit Hafenblick, und aus dem Becken im Landesinneren kam eine schöne Brigg von vierhundert Tonnen, geschleppt von vier Barken mit jeweils zwölf Ruderern; um sie anzuspornen, erscholl aus vielen Kehlen folgendes Seeräuberlied:
Auf Kaperfahrt zieht der Korsar
Die Losung heißt Sieg oder Tod
Gegen den Wind, Frankreich lebe hoch!
Beim Auslaufen aus Saint-Malo
Mit langen Riemen ward gepullt
Beim Auslaufen aus Saint-Malo
Mit langen Riemen ward gepullt
Gegen den Wind, und viel Glück!
Auf hoher See gebt Acht, Matrosen!
Die besten Schiffe sind die größten
Auf hoher See gebt Acht, Matrosen!
Die besten Schiffe sind die größten
Gegen den Wind, unsere Pinasse!
Unsere Pinasse läuft so geschwind
Fliegt schneller als ein fliegender Fisch
In diesem Augenblick gelangten die Barken und das Schiff, das sie schleppten, in das enge Fahrwasser, das Saint-Servan von Saint-Malo trennt, und unterhalb des Bugspriets wurde ein kunstvoll geschnitztes Skelett sichtbar, das seinen Grabstein anhob und in seinem Leichentuch dem Grab entstieg.
Das war die Revenant, die Kapitän Surcouf auf eigene Kosten hatte bauen lassen, um mit ihr die Meere zu befahren, diesen gewaltigen Schauplatz seiner Heldentaten, und im Atlantik und im Indischen Ozean sollte sie wie ein regelrechter Wiedergänger ihre Auftritte haben.
Als die auf den Felsen verstreute, auf den Mauern hockende und sich in den Fenstern drängende Volksmenge die Rudernden in den Schaluppen gewissermaßen auf Tuchfühlung vor sich sah, rief sie wie aus einem Mund: »Hoch lebe die Revenant! Hoch lebe ihre Mannschaft!«, und die Rudernden hoben ihre Riemen in die Luft, dann erhoben sie sich selbst und riefen: »Hoch lebe Surcouf! Hoch lebe Frankreich!«
Und während die Malouins sechzehn Zwölfpfünder zählten, deren Rohre aus den Stückpforten lugten, ein drehbares langes Geschütz von sechsunddreißig Pfund im vorderen Teil des Schiffs bewunderten und die Mündungen von zwei Vierundzwanzigpfündern bestaunten, die aus der Kapitänskajüte ragten, hatten die Matrosen sich wieder gesetzt und sangen weiter, während sie das Schiff bis zu seinem Platz im Hafen gegenüber von Surcoufs Haus schleppten.
Wir entern und wir kapern sie
Mir geht Paris nicht aus dem Sinn
Gegen den Wind, ihr Landratten!
Freibeuter haben mich reingelegt
Aufs Trockene gesetzt und eingelocht
Freibeuter haben mich reingelegt
Aufs Trockene gesetzt und eingelocht
Gegen den Wind! Ach und Weh!
Mit einem Schuh an einem Fuß
Bin ich an Bord zurückgekehrt
Mit einem Schuh an einem Fuß
Bin ich an Bord zurückgekehrt
Gegen den Wind! Halunkenbrut!
Die schlimmsten unter den Korsaren
Kreuzen nicht gegen Englands Fahne
Die schlimmsten unter den Korsaren
Kreuzen nicht gegen Englands Fahne
Gegen den Wind! Denn die Notare
Die Richter und die Advokaten
Das sind die blutrünstigsten Piraten!
Jetzt waren sie gegenüber der Porte de Dinan und Surcoufs Haus angekommen. In den Fenstern des Hauses sah man Surcoufs Ehefrau, sein Kind, seine Verwandten und Freunde; sie wirkten ungeduldig und nervös, denn das Schiff sollte zur Mittagsstunde ablegen. Bald würde es elf Uhr schlagen, doch von Surcoufs Mannschaft war weit und breit nichts zu sehen. Surcouf schickte seinen ersten Offizier Bléas in die Stadt, damit er herausfand, was die Männer anstellten, die sich bei Madame Leroux und in der Rue Traversière aufhielten. Bléas kam zurück und flüsterte ihm zu, wie Cäsar, der nach Spanien aufbrechen wollte und dem seine Gläubiger sich in den Weg stellten, sähen seine Leute sich von den Juden festgehalten, die ihnen auf ihre Vorschüsse Geld geliehen hatten und sie nun nicht ziehen lassen wollten, wenn sie ihre Schulden nicht beglichen. René stand in der Nähe; als er sah, dass Surcouf intervenieren wollte, bat er ihn, an seiner statt handeln zu können, um zu sehen, ob sich ein Vergleich zwischen Schuldnern und Gläubigern aushandeln ließe.
Wer noch nie ein Schiff unter solchen Umständen in See stechen sah, hat eines der sehenswertesten und merkwürdigsten Schauspiele verpasst, die man sich vorstellen kann.
Kaum haben die Matrosen im Kontor ihre Vorschüsse ausbezahlt bekommen, fallen Frauen und Gläubiger über sie her, um ihnen so viel zu entreißen, wie sie können; es muss gesagt werden, dass die Frauen dabei noch rücksichtsloser vorgehen als die Gläubiger: Die Schreie, die Tränen, das Gejammer der wehklagenden Gattinnen mischen sich in die Drohungen der Juden und übertönen sie; und mögen die Geldverleiher noch so geldgierig sein, gelingt es den Frauen doch fast immer, als Erste an ihr Geld zu kommen; zudem wissen die unseligen Raubvögel sehr wohl, dass nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch die Richter im Zweifelsfall den Frauen den Vorzug vor ihnen geben, und deshalb lassen sie es fast immer zu, wenn auch zeternd und mit großem Missvergnügen, dass die Familien zuerst zufriedengestellt werden; doch kaum ist die letzte Frau bezahlt, stoßen die Kormorane mit neuem Ingrimm wieder auf ihre Beute hernieder. Wenn nun die ersten Matrosen, mit denen die Juden zu tun haben, sich kulant zeigen und zahlen, dann ist ihr Beispiel doppelt wirksam, und die anderen lassen sich auch das Geld abnehmen, machtlos fluchend die einen, ergeben seufzend die anderen; wenn aber der erste Gläubiger nicht auf die Vernunft hören will und sich nicht mit der Hälfte des geforderten Betrags zufriedengibt (was ihm noch immer einen hübschen Profit einbringt), wenn der erste Schuldner unwillig ist, sich widerborstig zeigt und seine Gefährten aufwiegelt, bis zu guter Letzt Militär und Polizei eingreifen müssen, dann liefern sich der erboste Matrose und der unversöhnliche Gläubiger Wortgefechte, die denen homerischer Heroen in nichts nachstehen.
Und genau dies war geschehen. René sah sich mit einem wahren Aufruhr konfrontiert, und die Matrosen erkannten in René einen Verbündeten; mit dem Ruf: »Der Sekretär des Kommandanten!« und mit lautem Jauchzen begrüßten sie ihn. Ein Beutel in seiner Hand, mit Geldstücken prall gefüllt, stimmte wiederum die Gläubiger milde. René stieg auf einen Tisch und gab mit Zeichen zu verstehen, dass er sprechen wolle.
Auf der Stelle herrschte Ruhe, nein, absolute Stille, so dass man eines der Atome Descartes’ sich hätte bewegen hören können.
»Freunde«, sagte René, »der Kommandant wünscht nicht, dass beim ersten Mal, da er ein Schiff in seiner Heimatstadt ausrüstet, zwischen seinen Matrosen, woher sie auch stammen mögen, und seinen Landsleuten Streit entsteht.«
Und als er mitten unter den Köpfen, die sich ihm zuwendeten, den Kopf Saint-Jeans erblickte, jenes Seemanns, der ihm zum Dank für das Abendessen alles, was er wissen wollte, über Surcouf erzählt hatte, rief er: »Komm her, Saint-Jean!«, und dann, an Matrosen und Gläubiger gleichermaßen gerichtet: »Kennt ihr alle Saint-Jean?«
»Wir kennen ihn«, erwiderten Gläubiger und Matrosen.
»Er ist eine ehrliche Haut, oder?«
»O ja!«, riefen alle Matrosen wie aus einem Mund. »O ja! O ja!«
»Ja«, erwiderten die Juden etwas leiser und weit weniger freudig.
»Ihn will ich beauftragen, Eure Schulden zu begleichen. Er wird jedem Gläubiger fünf Prozent Zinsen bezahlen, egal, wann der Kredit eingeräumt wurde, so dass jene, die Geld für einen Monat oder zwei Wochen oder nur für eine Woche verliehen haben, Zinsen wie für ein ganzes Jahr erhalten.«
Unter den Juden wurde Gemurmel laut.
»Oh, entweder nehmen Sie an, oder Sie lassen es«, sagte René. »Hier ist das Geld« (er hob den Beutel hoch) »hier meine Tasche; wenn ich den Beutel eingesteckt habe, werden Sie ihn nie wiedersehen. Eins, zwei, drei...«
»Wir sind einverstanden!«, riefen die Juden.
»Saint-Jean, zahle die Schulden, und beeile dich; der Kommandant wird langsam ungeduldig.«
Saint-Jean war ein fähiger Buchhalter und ein schneller Rechner; nach einer Viertelstunde war alles erledigt: Der Betrag, den die Juden verlangten und der sich laut ihren Forderungen auf zweiundfünfzigtausend Francs belief, war mit zwanzigtausend Francs abgegolten, und die Juden, die unter ihren ungepflegten Schnurrbärten und über ihren spitzen Bärten lächeln mussten, gaben zu, dass sie nichts dagegen hätten, wenn all ihre Außenstände auf diese Weise eingetrieben würden.
René ließ ihnen eine Gesamtquittung ausstellen, die Saint-Jean aufsetzte, und zahlte ihnen zwanzigtausend Francs unter der Bedingung, dass die Schuldner ihre Freiheit erhielten. Die Türen wurden geöffnet, die Hindernisse aus dem Weg geräumt, und die Matrosen eilten so stürmisch und schnell wie ein Wirbelwind zur Porte de Dinan, um nicht zu spät zu kommen.
Zur Mittagszeit wollte Surcouf in See stechen, und bis dahin blieb nur noch eine Viertelstunde Zeit. Surcoufs Stirn glättete sich, als er seine Mannschaft herbeieilen sah.
»Ha, meiner Treu«, sagte er zu René, »ich weiß zwar, dass Sie es im Zweikampf mit Herkules aufnehmen können, im Pistolenschießen mit Junot, im Fechten mit Saint-Georges und im Trinken mit General Bisson, aber dass Sie in der Diplomatie ein zweiter Talleyrand sind, das wusste ich nicht; wie zum Teufel haben Sie das fertiggebracht?«
»Nun ja, ich habe für sie bezahlt«, erwiderte René gelassen.
»Sie haben für sie bezahlt?«, fragte Surcouf.
»Ja.«
»Und wie viel haben sie bezahlt?«
»Zwanzigtausend Francs, sehr günstig; sie hatten fünfzigtausend verlangt.«
»Zwanzigtausend Francs!«, wiederholte Surcouf.
»Ist es nicht üblich«, sagte René lachend, »dass der Neue zahlt, um seinen Einstand zu feiern?«
»Zweifellos«, sagte Surcouf im Selbstgespräch, »habe ich es mit dem Enkel Peters des Großen zu tun, der wie sein Vorfahre das Matrosengewerbe erlernen will.«
Und mit lauter Stimme wendete er sich an seine Mannschaft: »He! Ihr Hunde, ihr Bankrotteure, ihr denkt vielleicht, dass ihr es mir verdankt, mit heiler Haut den Händen eurer Gläubiger entronnen zu sein, aber da täuscht ihr euch. Wenn die Vorschüsse ausgezahlt sind, das weiß jeder, der mit mir gefahren ist, braucht keiner meiner Matrosen auch nur einen Sou von mir zu erwarten. Nein, euer neuer Kamerad René hat euch ausgelöst, um seinen Einstand zu feiern – zwanzigtausend Francs, ein teures Vergnügen, aber was soll man tun, wenn es ihm so gefällt; jedenfalls hoffe ich, dass ihr euch dankbar zeigen werdet, und falls er in Gefahr geraten sollte, alles tun werdet, um ihm zu Hilfe zu kommen. Und jetzt an Bord.«
Gegenüber seinen Fenstern hatte Surcouf eine Einschiffungsstelle errichten lassen, die bei Ebbe bis zum Wasserspiegel reichte; da die Flut eingesetzt hatte, waren die untersten Stufen bereits im Wasser verschwunden.
Zum Geräusch der Trommel, die sie an Bord rief, stiegen die Seeleute die Stufen hinunter und setzten mit Schaluppen, die jeweils zwölf Mann transportierten, zur Revenant über. Nach einer Stunde waren alle hundertvierzig Matrosen an Bord ihres Schiffs, und René, der als einer der Ersten an Bord gegangen war, sah sich von dankbaren Kameraden umringt. Nach den einfachen Matrosen kamen die Offiziere an Bord, wo sie von Pfeife und Trommel begrüßt wurden.
Im Handumdrehen war jedermann auf seinem Posten: der Kapitän an seiner Wachtbank, die Mastwächter in den Mastkörben, der Signalmaat neben der Kiste mit den Flaggen und Signalraketen. Dann begann der Zählappell. Die Mannschaft bestand aus insgesamt einhundertfünfundvierzig Mann, und Surcouf rechnete fest damit, sie in den ersten Häfen, in denen er einen Zwischenhalt machen würde, auf einhundertachtzig Mann zu vergrößern.
Nur Bras-d’Acier war nicht mitgekommen. Er hatte Surcouf erklärt, dass dieser keinen Fechtmeister mehr benötige, wenn er René an Bord habe.
Die Barken wurden vor das Schiff gespannt; ein Kanonenschuss und die an der Spitze des Großmasts gehisste Trikolore waren das Signal zum Auslaufen.
Da der Wind die Brigg nicht aus dem Hafen holen konnte, mussten die Ruderer sie dorthin schleppen, wo der Wind war; die Matrosen pullten, was das Zeug hielt, und sangen dazu, während Surcouf, der sich in diesen Gewässern wie in seiner Westentasche auskannte, dem Untersteuermann den Weg wies.
Als das Schiff auf der Höhe von La Roche-aux-Anglas angekommen war, wurde angehalten, und man hörte Surcouf seiner Mannschaft Befehle zurufen, die zugleich ein Abschiedsgruß an die Zuschauer zu Lande waren: »Gutes Wetter, schönes Meer, steife Brise! Ablegen und Kurs hinaus auf die offene See! Marssegel und Vorbramsegel hissen und Kurs aufs offene Meer!«
Die Segel fielen an den Masten herunter und blähten sich dann anmutig, das Schiff fuhr in die Fahrrinne der Petite Conchée, und zwei Stunden später war vom Land aus von der Revenant nichts mehr zu sehen als ein weißer Punkt, der immer kleiner wurde, bis er ganz verschwunden war.
55
Teneriffa
In nicht allzu weiter Entfernung zur Küste Marokkos erhebt sich gegenüber dem Atlasgebirge, zwischen den Azoren und den Kapverdischen Inseln, die Königin der Kanarischen Inseln, deren Gipfel sich in siebentausendfünfhundert Metern Höhe in den Wolken verliert, die ihn fast ständig umhüllen.
Die Luft ist in diesen herrlichen Breiten so klar, dass man den Berggipfel auf dreißig Meilen Entfernung erkennen kann, und von den Bergen der Insel sieht man Schiffe bis zu zwölf Meilen weit, während man sie andernorts bei sieben Meilen aus den Augen verliert.
Dort, im Schatten des gewaltigen Vulkans, inmitten der Inselgruppe, welche die Völker der Antike die Glücklichen Inseln nannten, dort, wo man den Blick gleichzeitig auf die Meerenge von Gibraltar, auf die Route der Spanier nach Nord- und Südamerika und auf die Route der Europäer nach Indien richten kann – dort hatte Surcouf einen Zwischenhalt eingelegt, um Wasser und frische Lebensmittel an Bord zu nehmen und um an die hundert Flaschen des zu jener Zeit begehrten Madeiraweins zu kaufen, dieses Lieblingssohnes der Sonne, der heute völlig aus der Mode gekommen ist und dem alkoholischen Gebräu Platz gemacht hat, das man Marsalawein nennt.
Von Saint-Malo bis Teneriffa waren die Wetterverhältnisse günstig gewesen, abgesehen von den unvermeidlichen Sturmwinden im Golf der Gascogne, und die Fahrt war gut verlaufen, wenn man die Fahrt eines Kaperschiffs gut nennen will, dem kein einziges Schiff begegnet, das zu jagen sich lohnen würde; zudem war man einer englischen Fregatte ausgewichen und hatte sich davon überzeugen können, dass die Revenant wendig und schnell war, denn hoch am Wind machte sie bis zu zwölf Knoten. Das gute Wetter hatte Surcouf erlaubt, sich seinen täglichen Übungen zu widmen, und eine große Zahl aufgehängter Flaschen waren von ihm und von René, der selten danebenschoss, geköpft worden.
Die Matrosen, die sich an Gewandtheit mit ihrem Anführer nicht messen konnten, hatten Renés Schießkünste mit Beifall bedacht, doch was die Herren Offiziere für ihn einnahm, und zwar uneingeschränkt, das waren die schönen Waffen, mit denen oder dank derer er seine Wunder an Geschicklichkeit vollbrachte.
Diese Waffen waren ein Gewehr mit gewöhnlichem Lauf für die Jagd auf Niederwild und ein Stutzen gleichen Kalibers mit gerieftem Lauf für die Jagd auf Hochwild oder um auf Menschen zu schießen in jenen Ländern, in denen der Mensch als schädliches Tier eingestuft wird. Zwei kleinere Futterale enthielten jeweils ein Paar Pistolen, gewöhnliche Duellpistolen und Gefechtspistolen mit übereinanderliegenden Läufen.
Außerdem hatte René sich eine Enteraxt anfertigen lassen, ohne jede Verzierung, aus schlichtem poliertem Stahl, doch von so hervorragender Härte, dass sie auf einen Hieb ein kleinfingerdickes Stück Eisen durchtrennte, als wäre es Schilf; seine Lieblingswaffe jedoch, die er mit besonderer Hingabe pflegte und an einer Silberkette um den Hals trug, war ein Dolch von türkischer Form, leicht gebogen, mit dem er einen Seidenschal in der Luft zerschneiden konnte, wie es die Araber von Damaskus mit ihren unvorstellbar scharfen Säbeln tun.
Surcouf war sehr zufrieden, René als seinen Sekretär an Bord zu haben, denn das erlaubte ihm, sich mit ihm zu unterhalten, so viel er wollte. Surcouf war von schwermütigem und gebieterischem Charakter und wortkarg, und um seine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus den verschiedensten Ländern und mit den verschiedensten Berufen in passivem Gehorsam zu halten, war er darauf bedacht, stets für Unterhaltung und Zerstreuung seiner Männer zu sorgen. An Bord der Revenant hatte er zwei Rüstkammern eingerichtet, die eine auf dem Back für die Offiziere, die andere auf der Schanz für diejenigen unter den Matrosen, die Neigung zum Fechten hatten. Er unterwies sie auch im Schießen, doch der Schießstand der Offiziere lag steuerbords und der jener rangniederen Offiziere und der Matrosen backbords.
Nur der erste Offizier Monsieur Bléas hatte jederzeit und in jeder Angelegenheit Zutritt zu Surcoufs Kajüte; die anderen Offiziere, sogar der Kapitänleutnant, durften nur mit einem wichtigen Anliegen unaufgefordert vorsprechen. René war von dieser Vorschrift ausgenommen, doch um keine Eifersucht unter seinen Gefährten zu wecken, nutzte er dieses Privileg so selten wie möglich, und statt Surcouf aufzusuchen, ließ er sich lieber von Surcouf besuchen. Die Kajüte des Kommandanten war von ausgesprochen militärischer Eleganz: Die zwei Vierundzwanzigergeschütze, die ganz eingezogen waren, wenn kein Feind in Sicht war, bestanden aus Kupfer, das wie Gold glänzte, auf Hochglanz poliert von dem Neger Bambou, der besonderes Vergnügen daran empfand, sich in den blanken Rohren zu spiegeln. Die Wandbespannungen waren aus indischem Kaschmir, geschmückt mit Waffen aus allen Ländern der Erde. Eine einfache Hängematte aus gestreiftem Segeltuch hing in dem Zwischenraum zwischen den zwei Kanonen und diente Surcouf als Bett, doch häufig warf er sich angekleidet auf das große Kanapee, das ebenfalls zwischen den Kanonen stand. Wenn zum Kampf gerüstet wurde, ließ er alle Möbelstücke, die beim Bedienen der Kanonen stören konnten, aus der Kajüte entfernen, und der Raum wurde den Kanonieren überlassen.
Wenn Surcouf auf Deck umherwanderte, richtete er das Wort fast nur an den wachhabenden Leutnant; alle machten ihm von sich aus Platz, und um sie nicht in ihrer Arbeit zu hindern, hielt er sich deshalb lieber auf dem Hackbord auf.
Wenn er in seiner Kajüte war, rief er seinen Neger Bambou, indem er auf ein Tamtam schlug; die Vibration war im ganzen Schiff zu vernehmen, und dem Grad der Heftigkeit dieser Vibration konnte man Surcoufs Laune entnehmen.
In dem irdischen Paradies am Fuß des Gipfels von Teneriffa, in dem Surcouf und seine Männer sich seit acht Tagen aufhielten, fügte der Kapitän den Freuden der Jagd und des Fischfangs ein weiteres Vergnügen hinzu: das Tanzen.
Unter dem schönen Himmel voller unbekannter Sterne kamen jeden Abend zu der Stunde, wenn die Bäume ihren balsamischen Duft verströmen und eine frische Brise vom Meer hereinweht, über den Rasen, der so weich wie ein Teppich war, aus den Dörfern Chasna, Vilaflor und d’Arico schöne Bäuerinnen in ihrer malerischen Kleidung herunter. Am ersten Tag hatte man nicht recht gewusst, welche Musik man wählen sollte, doch René hatte gesagt: »Besorgt mir eine Gitarre oder eine Geige, dann werde ich versuchen, mich meiner Tage als Wandermusikant zu erinnern.«
In einer spanischen Stadt braucht man nur die Hand auszustrecken, wenn man eine Gitarre haben will, und am nächsten Tag konnte René zwischen zehn Geigen und ebenso vielen Gitarren wählen; er ergriff die nächstbeste, und schon dem ersten Ton, den er anschlug, war seine Meisterschaft anzuhören. Tags darauf wurde das Orchester durch den Pfeifer und den Trommler verstärkt, die jeden Abend den Zapfenstreich bliesen und nun unter Renés Leitung mit ein paar hohen Tönen oder mit einem Trommelwirbel das spanische Instrument begleiteten.
Bisweilen geschah es, dass René Tanz und Tanzende vergaß und sich, von seinen Erinnerungen überwältigt, in eine melancholische Improvisation verlor; dann hielten die Tanzenden inne, Stille trat ein, und mit dem Finger auf dem Mund näherte man sich ihm; wenn er nach kürzerer oder längerer Zeit die Melodie beendete, sagte Surcouf leise im Selbstgespräch: »Meine Frau hatte recht, dahinter steckt irgendein Liebesleid.«
Eines Morgens wurde René durch Vorbereitungen zu einem Gefecht geweckt; auf der Höhe der Kapverdischen Inseln war wenige Meilen seewärts ein Schiff zu sehen, dem Schnitt seiner Segel nach zu schließen, ein Engländer. Bei dem Ruf: »Segel in Sicht!« war Surcouf an Deck gesprungen und hatte Befehl gegeben, Segel zu setzen. Zehn Minuten später stach die Revenant unter einer Wolke von Segeln, die jede Sekunde dichter wurde, und im Gelärme der Kampfvorbereitungen in See und nahm Kurs auf das englische Schiff. Keine fünf Minuten darauf kam René aus seiner Kajüte, den Stutzen in der Hand und seine doppelläufigen Pistolen im Gürtel.
»Nun«, sagte Surcouf, »es hat ganz den Anschein, als würden wir uns jetzt ein wenig amüsieren.«
»Endlich!«, sagte René.
»Sie wollen also dabei sein, sehe ich das richtig?«
»O ja, aber ich bitte Sie, mir einen Platz zuzuweisen, an dem ich niemandem im Weg bin.«
»Gut! Halten Sie sich in meiner Nähe, und nehmen wir uns jeder einen Matrosen, der unsere Gewehre lädt. – Bambou!«, rief Surcouf.
Sein Negerdiener kam angelaufen.
»Hole mir meine Donnerbüchse.« (Das war der Name seiner Doppelflinte, während sein Stutzen Spaßvogel hieß.) »Und«, fuhr er fort, »hole auch das Gewehr von Monsieur René.«
»Nicht nötig«, sagte René, »an meinem Gürtel habe ich den Tod von vier Männern, und in der Hand halte ich den eines fünften; für einen Amateur finde ich das ausreichend.«
»Was macht der Engländer, Monsieur Bléas?«, fragte Surcouf, der sein Gewehr lud, den ersten Offizier, der vom Hackbord aus die Fahrt des Engländers mit dem Fernrohr verfolgte.
»Er macht eine ganze Wendung, um uns auszweichen, mein Kommandant«, erwiderte der junge Offizier.
»Holen wir auf?«, fragte Surcouf.
»Wenn ja, dann so langsam, dass ich davon nichts bemerke.« »Holla!«, rief Surcouf. »Hisst Vorbramsegel und Beisegel! Setzt alle Segel der Revenant, auch den kleinsten Fetzen Segeltuch!«
Die Revenant pflügte durch die Wellen, und der Schaum, den ihr Kiel nun aufwirbelte, zeigte deutlich, dass sie wie ein Rassepferd die Sporen ihres Herrn gespürt hatte. Der Engländer wiederum setzte ebenfalls alle Segel und musste sich eingestehen, dass das Kaperschiff schneller war als er.
Daraufhin ließ Surcouf einen Kanonenschuss abfeuern, um das andere Schiff aufzufordern, seine Nationalität zu erkennen zu geben, und hisste die Trikolore. Die englische Flagge entfaltete sich am Mast des Engländers, und als die beiden Schiffe nur mehr halbe Gefechtsdistanz trennte, eröffnete der Engländer das Feuer mit seinen zwei hintersten Geschützen in der Hoffnung, das Kaperschiff zu entmasten oder eine Havarie zu bewirken, die es von seinem Kurs abbrachte, doch die Salven richteten nur wenig Schaden an und verwundeten nur zwei Männer. Eine dritte Salve war von einem unheimlichen und grauenerregenden Heulen begleitet, das sich René, der mit solchen Phänomenen noch nicht vertraut war, nicht erklären konnte.
»Was zum Teufel ist da eben über unsere Köpfe hinweggeflogen?«, fragte er.
»Mein junger Freund«, erwiderte Surcouf ebenso ruhig, wie René seine Frage gestellt hatte, »das waren zwei Kettenkugeln. Kennen Sie den Roman des Monsieur de Laclos?«
»Welchen?«
»Gefährliche Liebschaften.«
»Nein.«
»Nun, der Verfasser ist der Erfinder dieser gefährlichen Abtakelungsgeschosse, die Sie eben fast den Kopf gekostet hätten. Ist diese Bemerkung Ihnen unangenehm?«
»O nein, keineswegs; wenn ich tanze, will ich den Namen der Instrumente wissen, die das Orchester bilden.«
Daraufhin stieg der Kapitän auf seine Wachtbank, und als er sah, dass die Entfernung zu dem englischen Schiff halbe Gefechtsdistanz betrug, rief er: »Sechsunddreißiger klar zum Gefecht?«
»Jawohl, Kommandant«, erwiderten die Kanoniere.
»Was für Munition?«
»Drei Kartätschenladungen.«
»Klar zum Gefecht, Ruder nach Backbord!«
Und als er sah, dass sein Schiff auf der Fährte des Engländers war, befahl er: »Feuer!«
Die Kanoniere gehorchten, visierten den Engländer vom einen bis zum anderen Ende an, und ihre Geschosse bereiteten an seinem Deck Tod und Verwüstung.
Dann wies Surcouf den Rudergänger an, nach Steuerbord zu gehen, damit die Revenant aus dem Kielwasser des Engländers herausgelangte. »Rankommen lassen!«, rief er.
Und als sie sich nahe genug befanden, schoss Surcouf beide Läufe seiner Donnerbüchse ab, und von dem Mastkorb des Großmasts stürzten zwei Männer auf das Deck.
René sah, wie er sein Gewehr fallen ließ und die Hand ausstreckte. »Schnell, gib mir dein Gewehr!«
Wortlos reichte René ihm sein Gewehr.
Surcouf legte an und feuerte.
In der Kajüte des englischen Kapitäns, der sie sich näherten, hatte Surcouf einen Kanonier gesehen, der sich anschickte, eine lange Zwölfpfünderkanone abzuschießen, die auf Surcouf und die Offiziere in seiner Umgebung gerichtet war; bevor der Kanonier die Zündschnur anzünden konnte, war er tot.
Mit diesem Schuss hatte Surcouf sein eigenes Leben und das nicht weniger seiner Offiziere gerettet. Da man inzwischen auf Pistolenschussweite an den Engländer herangekommen war, erschoss René den englischen Kanonier, der die Zündschnur aufgehoben hatte und das Werk seines toten Kameraden fortsetzen wollte. Dann gab René seine weiteren drei Schüsse in Richtung der Mastkörbe des Großmasts und des Fockmasts ab und entsandte damit drei Todesboten. Die zwei Schiffe waren nurmehr zehn Schritte voneinander entfernt, Seite an Seite, als Surcouf rief: »Feuer Backbord!«
Ein Granatenhagel ergoss sich aus den Mastkörben der Revenant auf das Deck des Engländers, während sich die Marsgäste auf zwanzig Schritt ein Musketengefecht lieferten. Im selben Augenblick, in dem die Engländer ihre Steuerbordgeschütze zünden wollten, krachte eine gewaltige Salve der Revenant in ihr Schiff, riss die Verschanzung in Stücke, zerstörte fünf oder sechs Kanonen, stürzte den Großmast um und expedierte die Marsgäste der zwei Mastkörbe des Großmasts ins Meer hinaus.
Mitten in diesem Höllenlärm hörte man Surcouf rufen: »Entern, Leute, entern!«
Diesen Ruf wiederholten hundertfünfzig Stimmen, und Surcoufs Mannschaft schickte sich an, ihn in die Tat umzusetzen, als an Bord des englischen Schiffs ein anderer Ruf ertönte: »Wir ergeben uns!«
Der Kampf war beendet. An Bord des Kaperschiffs gab es zwei Tote und drei Verwundete, an Bord des Engländers waren zwölf Tote und zwanzig Verwundete zu beklagen.
Surcouf ließ den englischen Kapitän auf sein Schiff holen. Von ihm erfuhr er, dass er die Star of Liverpool gekapert hatte, die mit sechzehn Zwölfpfündern bewaffnet war. Angesichts ihres geringen Werts gab Surcouf sich mit einem Lösegeld zufrieden.
Das Lösegeld betrug sechshundert Pfund Sterling, die Surcouf zur Gänze als Prisengeld unter seinen Leuten verteilte, um sie zu noch besseren Leistungen anzuspornen; er selbst nahm nichts; um zu verhindern, dass der Engländer auf seiner Rückkehr ein schwächeres Schiff überfiel und seinen Zorn über die Niederlage an diesem ausließ, befahl Surcouf Monsieur Bléas, an Bord des englischen Schiffs zu überwachen, dass alle Kanonen über Bord geworfen wurden und alles Schießpulver ins Meer gestreut wurde.
Dann nahm die Revenant Kurs auf das Kap der Guten Hoffnung; die Mannschaft war stolz auf ihren Sieg, beglückt von den acht Tagen Urlaub auf Teneriffa und voller Vorfreude darauf, den Äquator mit einem so großzügigen Kameraden wie René zu überqueren, der es zweifellos nicht versäumen würde, seine Taufe großzügig zu begießen.
Doch im Logbuch der Revenant war bereits verzeichnet, dass ihre Besatzung an jenem Tag eine andere Aufgabe haben würde als die, dem alten Neptun ein groteskes Schauspiel über die Meeresgötter darzubieten.
56
Die Überquerung des Äquators
Am Vorabend des Tages, an dem Surcouf den Äquator zu überqueren gedachte – besser gesagt, an jenem Tag -, rief der wachhabende Matrose gegen drei Uhr eines schönen Septembermorgens: »Segel in Sicht!«
Sogleich kam Surcouf aus seiner Kajüte geeilt.
»Welchen Kurs hält es?«, fragte er.
»Es kommt aus Nordwesten und scheint in Richtung Südosten zu fahren, was hieße, dass es die gleiche Route wie wir hätte.«
Kaum hatte Surcouf dies vernommen, als er sich vom Schanzdeck in die Wanten und von dort auf den Mars des Großmasts hangelte.
Bei den Worten »Schiff in Sicht!«, diesem Zauberwort der Meere, sprangen die Matrosen, die Wache hatten, auf Rahen und Marsen, um sich ein Bild von der Kampfkraft des Schiffs zu machen, mit dem man zu tun haben würde und das eine ähnliche Route wie die Revenant zu verfolgen schien, nur dass es höchstwahrscheinlich vom Golf von Mexiko kam. Die Revenant verlangsamte ihre Fahrt und manövrierte sich auf Gefechtsdistanz zu dem englischen Schiff, denn Surcouf wollte es in Augenschein nehmen und sich die Möglichkeit vorbehalten, anzugreifen oder die Flucht zu ergreifen. Von beiden Schiffen aus wurde aufmerksam observiert, und diese Observation nahm an die zwei Stunden in Anspruch. Der Tag brach an, und die Farben am Firmament verblassten, als der Engländer an der Wendigkeit und Schnelligkeit der Revenant, am Schnitt ihrer Segel und an ihren hohen Masten erkannte, dass er es mit einem Kaperschiff zu tun hatte. Sogleich verkündete das englische Schiff mit einem Kanonenschuss, dass es sich zu erkennen geben wolle, und die Flagge Großbritanniens stieg wie eine düstere Flamme in der Takelage empor, bis sie an der Spitze des Besanmasts verharrte.
Die Kanonenkugel sauste über die Wasseroberfläche, berührte die höchsten Wellenkämme und flog über das Kaperschiff hinweg, bevor sie hinter ihm im Wasser verschwand.
Surcouf sah ungerührt zu, als ginge ihn das alles nichts an. Doch obwohl er sich bisher nicht vergewissert hatte, ob das englische Schiff, mit dem er sich anlegen wollte, ein Handelsschiff war, ließ er mit einem Pfiff für Stille sorgen und befahl dann: »Alle Mann achtern antreten!«
Die Mannschaft sammelte sich um das Dach der Treppe, auf dem er es sich bequem gemacht hatte und das ihm bei besonderen Anlässen als Wachtbank diente; er wollte sich unmittelbar an seine Leute wenden, ohne sich zuvor mit seinen Offizieren darüber zu beraten, ob man es wagen könne, das englische Schiff anzugreifen, denn er wusste, dass man ihm geraten hätte, von einem so waghalsigen Unterfangen Abstand zu nehmen: Obwohl niemand wissen konnte, dass die Mannschaft an Bord des Engländers doppelt so viele Leute zählte wie die der Revenant und dass zusätzlich Soldaten an Bord waren, konnte man die vielen Uniformen auf Deck gut erkennen.
»Schön und gut«, rief Surcouf in seiner kurzen Ansprache, »das ist ein gewaltig großes Schiff, aber schließlich kein Kriegsschiff, sondern ein Schiff der englischen Handelsflotte. Wir sind zwar nicht stark genug, um es durch Kanonenbeschuss in die Knie zu zwingen, aber wir werden es entern; jeder soll sich bewaffnen. Zum Dank für den tollkühnen Überfall, den ihr vollbringen werdet, gebe ich euch eine Stunde zum Plündern auf eigene Rechnung.«
Ohne zu zaudern, eilten alle unter Jubelrufen an ihren Posten und bewaffneten sich. Der Waffenmeister teilte an die Männer Entersäbel und Streitäxte aus, lange Pistolen und Dolche, diese gefährlichen Waffen des Nahkampfs. Die Marsgäste schmückten ihre Mastkörbe mit kupfernen Musketen und Granatenfässern, während die Quartiermeister furchterregende Enterhaken vorbereiteten.
Zur gleichen Zeit schlugen die zwei Wundärzte mithilfe der Krankenpfleger ihr Feldlazarett am Eingang der Luke auf. Die Arzneikiste mit ihren Fläschchen und Medikamenten wurde vorbereitet, und neben ihr errichtete man eine Pyramide aus Scharpie, Kompressen und Verbandmaterial; etwas weiter weg ging von der Aderpresse, den chirurgischen Instrumenten und dem Nähbesteck der unheimliche Glanz polierter, funkelnder Instrumente aus, und der Operationstisch und die Matratzen, die der Unglücklichen harrten, die sie aufnehmen würden, vervollständigten die Vorbereitungen der Sanitäter und hinterließen ein Gefühl der Traurigkeit.
Ein schrilles, langes Pfeifen war der Befehl für alle, sich auf Posten zu begeben und sich gefechtsbereit zu halten.
Der englische Kapitän, der auf seine Überlegenheit vertraute, stellte sein Schiff in den Wind, um wieder in Gefechtsposition zu gelangen; außerdem schickte er einen Offizier zu den Passagieren, die noch ruhten, um sie einzuladen – auch die Damen -, auf die Poop zu kommen, um dem Schauspiel beizuwohnen, das im Kapern oder Versenken eines französischen Kaperschiffs bestand.
Als Surcouf das Manöver des Gegners sah, wendete er ebenfalls und näherte sich ihm; er segelte jetzt über Steuerbordbug und hatte das englische Schiff steuerbords; er fuhr so nahe an dem Engländer vorbei, dass er den Namen Standard lesen konnte, und als die Standard sich im Windschatten der Revenant befand, schickte sie ihr eine ganze Breitseite, ohne dass Surcouf das Feuer erwiderte. Die Schäden an der Revenant beschränkten sich auf durchlöcherte Segel und zerfetztes Tauwerk, was schnell zu beheben war.
Surcouf sieht die vielen Soldaten auf dem Deck des Gegners, lässt ein Dutzend lange Piken an zwölf Matrosen ausgeben, die sich mitten auf Deck aufstellen und von Surcouf angewiesen werden, auf die eigenen Männer ebenso wie auf die Gegner einzuschlagen, falls Erstere zurückweichen und Letztere vorrücken. Die Mastkörbe sind besetzt, und ihre Besatzung hat ausreichend Granaten zur Hand, die Kupferrohre der Musketen spiegeln die Sonnenstrahlen, und die besten Schützen an Bord der Revenant legen sich auf dem im Wasser befindlichen Mastwerk und in den Schaluppen in den Hinterhalt, um wie von einer Schanze aus auf die englischen Offiziere zu schießen.
Gleichzeitig füllt sich die Poop des Engländers mit eleganten Ladys und vornehmen Gentlemen – Schaulustigen, die mit bloßem Auge, mit Lorgnetten und Operngläsern den Kampf verfolgen wollen.
»Mein Kapitän«, sagt Bléas zu Surcouf, »haben Sie auch den Eindruck, dass diese Weiberwelt und diese Dandys da oben sich über uns lustig machen wollen? Sehen Sie nur, wie sie neckisch grüßen und winken, als wollten sie sagen: ›Gute Reise, Herrschaften, wir werden Ihr Schiff versenken; bitte langweilen Sie sich nicht zu sehr am Meeresgrund.‹«
»Lassen Sie sie prahlen«, erwidert Surcouf, »und ärgern Sie sich nicht über die hübschen Püppchen; Sie wissen so gut wie ich, dass sie in weniger als einer Stunde demütig und unterwürfig gesenkten Hauptes vor uns stehen werden. Sehen Sie lieber, wie dieser dreiste Kanonier einen Kopf kürzer wird.«
In der Tat hatte sich ein schöner junger Mann ohne Kopfbedeckung, dessen blonde Haare im Wind wehten, hinter der Verschanzung hervorgewagt, um seine Kanone zu laden. Surcouf zielt auf ihn, die Kugel fährt ihm durch die Haare, ohne seinen Kopf zu streifen, er erhebt die Hand zu einer verächtlichen Gebärde in dem Glauben, er könne sich zurückziehen, bevor Surcouf sein Gewehr laden kann, doch er macht die Rechnung ohne Surcoufs doppelläufige Donnerbüchse; Surcouf feuert, und diesmal stürzt der junge Mann nieder wie ein gefällter Baum, umschlingt seine Kanone mit beiden Armen, rutscht an ihr mit den Beinen zuerst hinunter, kann sich noch einen Augenblick mit gefalteten Händen am Rohr festhalten, bis die Kraft ihn verlässt und der Verwundete ins Wasser fällt und verschwindet. Dieser Tod, den er in allen Einzelheiten mit ansah, beeindruckte Surcouf zutiefst.
»Alle Mann an Deck hinlegen bis zu neuer Ordre!«, ruft er nach kurzem Schweigen, als er seine Gefühle bezwungen hat.
Es war höchste Zeit: Das englische Schiff feuerte aus allen Geschützen, doch das Glück war Surcouf an diesem Tag hold; dank seines Befehls wurde keiner seiner Männer getroffen; und sobald Surcouf sich in der Flanke des Gegners sah, ließ er sich zurückfallen, um dessen Heck zu umrunden und ihn backbord in Luv zu entern; um diesem Vorhaben auszuweichen, wendete die Standard – so wie ein Stier sich schnell im Kreis dreht, um dem Feind die Hörner zu zeigen -, was wiederum die Revenant nötigte, schnell über Steuerbordbug zu segeln und dem Widersacher den Wind zu nehmen, um ihn ein drittes Mal zu überholen. Als die Engländer sahen, dass ihr Gegner sich nicht abschütteln ließ, begriffen sie, dass er zum Entern entschlossen war. Der englische Kapitän steuert, um zu wenden; die Standard, deren Großsegel gerefft wurde, damit man feuern konnte, geht hoch an den Wind, ohne aufholen zu können; da das Wenden ihr nicht gelingt, fällt sie ab, und bald befindet sich die Revenant unter dem hohen festungsähnlichen Heck des Engländers. Um die Standard nicht ganz zu überholen und um die eigene Geschwindigkeit zu drosseln, lässt Surcouf alle Segel backbrassen; dann lässt er längsseits an der Standard anlegen, ruft: »Feuer!« und verpasst ihr beim Anlegen eine Doppelsalve aus Kugeln und Kartätschenladung. Im nächsten Augenblick ertönt lautes Krachen und Knirschen, die Rahen der zwei Schiffe verfangen sich, das Tauwerk verhakt sich, und die Schiffe stoßen gegeneinander; sie liegen nun so eng nebeneinander, dass sich die Läufe ihrer Kanonen fast berühren.
Im gleichen Moment ertönt auf beiden Schiffen der Befehl: »Feuer!«, und zwei Vulkankrater speien Feuer und Rauch, doch die niedrige Revenant liegt unterhalb der Schusslinie der Geschütze der Standard, während die Salve der Revenant die Verschanzung der Standard einen Fuß oberhalb des Decks zerfetzt und alles niedermäht, worauf sie trifft. Daraufhin bricht an Bord des Engländers entsetzliche Panik aus: Surcoufs Überfall war so tollkühn, dass seine Gegner die Tragweite des Geschehens noch nicht erfasst hatten, sondern glaubten, sie hätten das Kaperschiff mit ihrer Breitseite außer Gefecht gesetzt, denn sie rechneten nicht einmal entfernt mit der Möglichkeit, dass Surcouf mit seiner dreimal kleineren Mannschaft wagen könnte, ihr Schiff zu entern; sie hatten sich auf dem Hackbord versammelt, um nach Herzenslust die Niederlage der Revenant und den Todeskampf ihrer Mannschaft zu begaffen; groß war daher das Erstaunen, besser gesagt: das Erschrecken, als die Enterhaken sich in der Reling festbissen und der schwere Anker der Standard sich in einer Stückpforte der Revenant verfing und eine Hängebrücke bildete, über die man bequem vom einen Schiff zum anderen gelangte; doch noch größer war das Entsetzen der Engländer, als sie den Feuersturm sahen, der soeben über die Standard getobt war und zwanzig bis fünfundzwanzig Tote und Verletzte hinterließ, die sich in ihrem Blut wälzten.
»Auf, Bléas!«, brüllte Surcouf. »Fertig zum Entern!«
»Fertig zum Entern!«, wiederholte die Mannschaft wie aus einer Kehle, und alle stürmten das gegnerische Schiff wie ein Mann.
Surcouf befiehlt den zwei Trommlern, die er bei sich behalten hat, das Signal zum Angriff zu geben. Als der Trommelwirbel ertönt, erklettern die Korsaren die beschädigte Verschanzung, indem sie alles, was sich anbietet, als Trittbrett nutzen; Axt oder Säbel haben sie in der Hand, den Dolch zwischen den Zähnen, ihre Lippen sind zornig verzogen, die Augen blutunterlaufen. Von den Mastkörben der Revenant werfen Guide und Avriot unterdessen Granate um Granate auf das gegenerische Deck. Als sie kurz innehalten, ruft Surcouf ihnen zu: »Avriot, weiter! Guide, weiter! Granaten, Granaten, mehr Granaten!«
»Sofort, Kapitän«, erwidert der Mastwächter Guide von seinem Mastkorb hoch oben am Fockmast; »die zwei Werfer am Ende der Rahe wurden getroffen.«
»Und wenn schon! Dann werft ihr eben statt Granaten die zwei Toten auf die Engländer; so haben sie die Ehre, als Tote das gegnerische Schiff zuerst zu entern!«
Fast im gleichen Augenblick beschreiben die zwei Leichname, von kräftigen Armen geschleudert, eine Kurve und landen auf einer Gruppe englischer Offiziere. Die Umstehenden ergreifen sofort die Flucht.
»Vorwärts, Freunde!«, ruft Bléas, der diesen Rückzug nutzt. Ein Schwall Angreifer stürzt sich über das Ankertau, das die beiden Schiffe verbindet, an Bord der Standard; die drei ersten Angreifer sind der Neger Bambou, der seinen Anteil an der Prise darauf verwettet hat, als Erster das Deck des Engländers zu betreten, René und Bléas. Bambou, bewaffnet mit einer Lanze, die er wie kein zweiter handhabt, wirft sie zwei-, dreimal und tötet jedes Mal einen Engländer. René hat ebenso oft mit seiner Axt zugeschlagen und mit jedem Schlag einen Mann niedergestreckt.
Doch mit einem Mal hält er inne, verharrt regungslos und betrachtet mit Verwunderung und Erschrecken einen Passagier, der vorbeigetragen wird, eine Wunde in der Brust; die zwei Töchter des Mannes begleiten ihn inmitten des grausigen Gemetzels, ohne der Gefahr zu achten; die eine hält dem Verwundeten den Kopf, die andere küsst ihm die Hände. René kann den Blick nicht von dem bleichen Gesicht des Verwundeten abwenden, gezeichnet von den letzten Zuckungen des Todeskampfes, bis das Grüppchen die Treppenluke hinunter verschwindet.
Als sie fort sind, sieht René ihnen noch immer nach. Bléas muss ihn heftig zur Seite stoßen und mit einem Pistolenschuss den Engländer unschädlich machen, der René soeben den Schädel spalten wollte; erst dann schüttelt René seine unerklärliche Benommenheit ab und stürzt sich wieder in den Kampf.
Surcouf hat sich zur Flagge der Standard hinaufgehangelt und überblickt das ganze Schiffsdeck: Rotröcke, wohin er sieht, und nicht ohne Staunen muss er feststellen, wie schnell neue Soldaten die Gefallenen ersetzen. Vergebens vollbringen Surcoufs Männer wahre Wundertaten; Kernoch schwingt einen Ladekolben wie eine Keule, und jeder Schlag, den der bretonische Herkules führt, kostet einen Gegner das Leben. Doch all diesem heldenhaften Mut zum Trotz sind die Korsaren bisher nicht weiter vorgedrungen als bis zum Großmast.
Surcouf, der wie gesagt über dem blutigen Geschehen schwebt, hat die zwei ersten Sechzehnergeschütze aus ihren Stückpforten entfernen lassen, mit Kartätschenladung laden lassen, und bevor die Engländer ahnen, wie ihnen geschieht, sind die Kanonen umgedreht und zielen auf das Heck des eigenen Schiffs.
»Von den Laufplanken wegtreten!«, ruft Surcouf mit schallender Stimme.
Und jeder, der errät, was Surcouf im Schilde führt, drückt sich hastig backbords und steuerbords an die Reling, um nicht von dem Sturmwirbel der Kartätschenladung getroffen zu werden.
Kaum sind die Korsaren aus dem Weg, ertönt eine furchterregende Detonation, und die zwei Kanonen speien ihre Salven, die Heck und Poop der Standard mit Toten bedecken.
Diese Verheerungen rauben den Engländern fast den Mut, doch ihr Kommandant sammelt sie, und aus der vordersten Luke steigen fünfzig neue Soldaten. Doch zum Unglück der Standard haben Avriot und Guide zwei Körbe voll neuer Munition bekommen und werfen ihre Granaten mit vollen Händen auf das Deck des Engländers; eine der mit Pulver gefüllten Flaschen explodiert am Fuß der Wachtbank, und der englische Kapitän fällt mit dem Gesicht zu Boden.
»Der Kommandant ist tot!«, ruft Surcouf. »Der Kommandant ist gefallen! Falls einer von uns des Englischen mächtig ist, soll er es auf Englisch rufen!«
René hat zwei Sprünge vorwärts getan, erhebt seine blutige Axt und ruft: »The captain of the Standard is dead, lower the flag!«
Diesen Befehl gibt er in so tadellosem Englisch, dass der Flaggkapitän denkt, der erste Offizier habe ihn erteilt, und gehorcht.
Unterdessen flammte der Kampf wieder auf, denn der erste Offizier der Standard, der erfahren hatte, dass der Kommandant gefallen war, sprang an Deck, um die Befehlsgewalt zu übernehmen und diejenigen der Engländer anzufeuern, die noch kampffähig waren. Trotz des scheußlichen Blutbads, das sich an Bord der Standard abgespielt hatte, verblieben auf dem Schiff, das Truppen nach Kalkutta transportieren sollte, noch immer ebenso viele unversehrte Besiegte wie Sieger. Zum Glück befand sich das Deck noch gänzlich in der Hand der Korsaren, die den neuen Kapitän und seine Getreuen in das Zwischendeck trieben, dessen Luken sie versperrten; doch in seiner Erbitterung über diese Niederlage und in dem Wunsch, bis zuletzt zu kämpfen, lässt der Kapitän zwei der Achtzehnpfündergeschütze auf das Schiffsdeck richten, damit ihre Geschosse die Planken durchschlagen und Surcouf und seine Offiziere unter den Trümmern begraben.
Als Surcouf hört, dass die Kanonen bewegt werden, errät er den Plan des Kapitäns, lässt eine Luke öffnen und springt hinunter.
Als er im Zwischendeck ankommt, will er einem jungen Midshipman das Leben retten, der sich tapfer verteidigt und aus zahlreichen Wunden blutet.
Surcouf eilt auf ihn zu, um den jungen Mann mit seinem eigenen Körper zu schützen, doch dieser missversteht die noble Regung des Bretonen und will ihn mit seinem Dolch erstechen. Surcouf glaubt sein letztes Stündlein gekommen. Doch da erscheint sein Neger Bambou, sieht seinen Herrn in Lebensgefahr und spießt den bedauernswerten Midshipman mit seiner Lanze auf, worauf dieser sein Leben aushaucht; Surcouf hätte die Lanze ebenfalls durchdrungen, wäre ihre Spitze nicht von einem Uniformknopf des Toten verbogen worden. Diesmal ergeben sich die Männer im Zwischendeck ebenso wie die an Deck.
»Keine Toten mehr!«, ruft Surcouf. »Die Standard gehört uns, hoch lebe Frankreich! Hoch lebe unsere Nation!«
Lautes Hurrageschrei ertönt; das Gemetzel hat ein Ende.
Doch ein lauter Schrei folgt: »Plündern auf eigene Rechnung!«
»Ich habe es versprochen«, sagt Surcouf zu René, »und das muss ich halten. Aber die Passagiere dürfen nicht ausgeplündert werden, und den Frauen unter ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Ich werde darüber wachen, dass die Männer in Ruhe gelassen werden, und Sie, René, wachen in meinem Namen darüber, dass die Ehre der Frauen unangetastet bleibt.«
»Danke, Surcouf«, sagt René und eilt zu den Kabinen der Passagiere.
Unterwegs begegnet er dem Schiffsarzt.
»Monsieur«, fragt er ihn, »ein Passagier wurde lebensgefährlich verwundet; können Sie mir sein Zimmer zeigen?«
»Man hat ihn in das Zimmer seiner Töchter gebracht.«
»Und wo ist das Zimmer?«
»Wenn Sie ein paar Schritte tun, können Sie das Schluchzen der armen Kinder hören.«
»Gibt es denn keine Hoffnung, ihn zu retten?«
»Er ist soeben gestorben.«
René lehnte sich an eine Kabinentür, fuhr sich mit der Hand über die Augen und stieß einen Seufzer aus.
Plötzlich erfüllt ein Schwarm wein- und bluttrunkener Männer das Unterdeck, schreiend und singend, torkelnd und lärmend. Mit Fußtritten werden die Kabinentüren eingetreten. Und René entsinnt sich der beiden schönen Mädchen, deren Schluchzen er gehört hatte.
Ihm ist, als höre er einen Hilferuf aus weiblicher Kehle.
Er springt vor, kommt an einer Tür vorbei, hinter der etwas wie erstickte Schreie zu vernehmen ist, erstickte Hilferufe.
Die Tür ist von innen verschlossen.
René hat seine Axt noch in der Hand; er hackt die Türfüllung in Stücke.
Es ist das Zimmer des Verwundeten oder besser gesagt Toten. Ein Matrose hält eine der beiden Schwestern in den Armen und will ihr Gewalt antun.
Die andere kniet vor dem Leichnam ihres Vaters, hebt die Arme zum Himmel und fleht zu Gott, der sie zu Waisen gemacht hat, sie nicht der Schande auszuliefern, nachdem er sie dem Unglück überlassen hat.
Der Seemann hat gehört, wie die Tür zersplittert, und wendet sich zur Tür um.
»Elender!«, herrscht René ihn an. »Im Namen des Kommandanten, lass die Frau sofort los!«
»Ich soll die Frau loslassen? Die ist mein Anteil an der Beute. Die gehört mir, und die behalte ich.«
René wurde bleicher als der Tote auf dem Bett. »Die Frauen sind nicht Teil der Beute. Zwinge mich nicht, meine Aufforderung zu wiederholen.«
»Das ist nicht nötig«, sagte der Matrose zähneknirschend, zog eine Pistole aus dem Gürtel und feuerte auf René, doch nur Pulverdampf war zu sehen.
Renés rechter Arm schnellte vor wie eine Feder, man sah einen Blitz, und der Seemann fiel tot zu Boden.
René hatte ihm mit der Klinge des Dolchs, den er am Hals trug, das Herz durchbohrt.
Bevor die jungen Mädchen sich von ihrem Schrecken erholen konnten, schob er mit der Fußspitze den Toten aus der Kabine, damit der Anblick des Bluts sie nicht noch mehr erschreckte.
Dann legte er den Toten quer vor die Tür. »Seien Sie unbesorgt«, sagte er mit seiner sanften, mädchenhaften Stimme, »niemand wird mehr versuchen, sich Zugang zu verschaffen.«
Die beiden Mädchen hielten einander umarmt.
Dann wandte die Ältere sich an den jungen Mann.
»Oh, Monsieur«, sagte sie, »ich wollte, mein Vater wäre noch am Leben und könnte Ihnen danken! Er könnte es besser als seine zwei armen Kinder, die bei dem Gedanken an die Gefahr, in der sie schwebten, noch zittern müssen.«
»Jeder Dank ist überflüssig, Mademoiselle«, sagte René, »denn ich tat nur, was meine Pflicht war und was mein Herz mir gebot!«
»Da Sie sich zu unserem Beschützer erklärt haben, Monsieur, hoffe ich, dass Sie uns auch weiterhin beschützen werden.«
»O weh, Mademoiselle, ein armseliger Beschützer«, erwiderte René. »Ich bin ein gewöhnlicher Matrose wie derjenige, der Sie beleidigt hat, und meine Macht beschränkt sich darauf, dass ich der Stärkere war. Aber«, fügte er mit einer Verbeugung hinzu, »wenn Sie sich unter den Schutz unseres Kommandanten stellen wollen, kann ich Ihnen versichern, dass man weder Sie noch Ihr Vermögen anrühren wird.«
»Sie werden uns sagen, Monsieur, zu welcher Stunde und auf welche Weise wir uns bei ihm einfinden sollen.«
Im selben Augenblick war Surcoufs Stimme zu vernehmen.
»Da ist er«, sagte René.
»Und Sie bestätigen«, sagte Surcouf, »dass René diesen Mann getötet hat.«
René öffnete die Reste der Kabinentür. »Ja, mein Kommandant«, sagte er, »das war ich.«
»Was hat er angestellt, René, dass Sie sich zu einer solchen Tat hinreißen ließen?«
»Sehen Sie, in welchem Zustand Mademoiselle sich befindet«, sagte René und wies auf die zerrissene Kleidung der jüngeren Schwester.
»O Monsieur!«, rief das junge Mädchen und warf sich Surcouf zu Füßen, »Monsieur hat mehr gerettet als unsere Ehre!«
Surcouf reichte René die Hand und trat einen Schritt zurück.
»Sind Sie Französin, Mademoiselle?«, fragte er.
»Ja, Kommandant. Das ist meine Schwester … und« – ihre Stimme zitterte – »das ist unser verstorbener Vater.«
»Aber wie ist Ihr Vater gestorben? Hat er gegen uns gekämpft?«
»Du lieber Himmel! Mein Vater soll gegen Franzosen gekämpft haben!«
»Aber wie ist es dann zu diesem Unglücksfall gekommen?«
»Wir sind in Portsmouth an Bord dieses Schiffs gegangen. Wir sind unterwegs nach Rangun in Indien, wo wir eine Plantage besitzen. Der Kommandant der Standard lud uns ein, an Deck zu kommen, um zuzusehen, wie ein Piratenschiff von ihm versenkt würde, wie er es ausdrückte. Dort wurde mein Vater, der nur ein Zuschauer war, von einer Kugel getroffen und getötet.«
»Verzeihen Sie, Mademoiselle«, sagte Surcouf, »wenn ich Sie weiter mit Fragen bedränge – nicht aus Neugier, sondern in der Hoffnung, Ihnen nützlich zu sein. Wäre Ihr Vater am Leben, hätte ich mir niemals erlaubt, Ihre Kabine zu betreten.«
Die zwei Mädchen sahen einander an. Das also waren die erbärmlichen Piraten, die Mister Revigston zur Unterhaltung seiner Passagiere aufzuknüpfen gedacht hatte!
Sie waren ratlos. Noch nie waren sie in der vornehmen Welt mehr Höflichkeit begegnet als bei diesen zwei Korsaren.
Surcoufs scharfem Blick und rascher Auffassungsgabe entging nicht die Verblüffung seiner schönen Mitbürgerinnen und ihre Ursache.
»Meine Damen«, sagte er, »es ist ein unglücklicher Zeitpunkt, Ihnen all diese Fragen zu stellen, doch ich wollte Sie so schnell wie möglich beruhigen, was die Lage betrifft, in die Sie durch unseren Sieg unversehens geraten sind.«
»Oh, Monsieur«, erwiderte die ältere der Schwestern, »es war unhöflich von uns, Ihnen nicht sofort zu antworten, und nun bitten wir Sie inständig, uns zu fragen, was Sie wollen, denn Sie scheinen besser als wir zu wissen, was wir erfahren müssen.«
»Ein Wort von Ihnen hätte uns fortgeschickt, Mademoiselle«, sagte Surcouf, »und ein Wort genügt, damit wir bleiben. Sie sagten, Sie seien auf der Fahrt nach Rangun gewesen; das liegt im Königreich Pegu jenseits des Ganges. Ich kann nicht versprechen, Sie dorthin zu bringen, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich Sie und Ihre Schwester auf der Île de France absetzen werde, von wo Sie ohne Schwierigkeiten in das Reich der Birmanen weiterreisen können. Wenn der Unglücksfall, der Ihnen widerfahren ist, Sie in Geldnot versetzen sollte, hoffe ich, dass Sie mir die Ehre erweisen, mich in Ihr Vertrauen zu ziehen.«
»Danke, Monsieur; mein Vater dürfte Wechsel in beträchtlicher Höhe mit sich geführt haben.«
»Ist es indiskret, Sie zu fragen, wie Monsieur Ihr Vater hieß?«
»Er war der Vicomte de Sainte-Hermine.«
»Dann ist er es, Mademoiselle, der bis 1792 in der königlichen Marine Dienst tat und in diesem Jahr um seine Entlassung nachkam?«
»So ist es, Monsieur. Seine Ansichten vertrugen sich nicht mit einem fortgesetzten Dienst für die Republik.«
»Er entstammte einer jüngeren Linie. Das Familienoberhaupt war ein Graf von Sainte-Hermine, der 1793 guillotiniert wurde und dessen zwei Söhne ebenfalls für die Sache der Royalisten gestorben sind.«
»Sie sind mit der Geschichte unserer Familie so vertraut wie wir selbst, Monsieur; können Sie uns sagen, was aus seinem dritten Sohn wurde?«
»Hatte er denn einen dritten Sohn?«, fragte Surcouf.
»Ja, und er verschwand auf die rätselhafteste Weise. Am Abend der Unterzeichnung seines Ehevertrags mit Mademoiselle Claire de Sourdis wurde vergeblich nach ihm gesucht, als er unterschreiben sollte. Niemand hat ihn je wieder gesehen oder gesprochen.«
»Ich muss gestehen, dass mir alldas völlig unbekannt war.«
»Wir wuchsen zusammen auf, bis er acht Jahre alt war. Mit acht Jahren hat er sich mit meinem Vater eingeschifft und ist bis 92 bei ihm geblieben. Dann wurde er zu seiner Familie gerufen und hat uns verlassen. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Hätte es die Revolution nicht gegeben, wäre er Seemann geworden wie mein Vater.« Das junge Mädchen unterdrückte ein Schluchzen.
»Weinen Sie, Mademoiselle, weinen Sie nur«, sagte Surcouf. »Es tut mir leid, dass ich mich zwischen Sie und Ihren Kummer gedrängt habe. Ich führe die Standard, besser gesagt, ich schicke sie unter einem Prisenkapitän zur Île de France; dort wird sie verkauft, und dort werden Sie, wie Ihnen zu erklären ich bereits die Ehre hatte, zuverlässig Gelegenheit finden, sich nach Rangun bringen zu lassen.«
Surcouf verbeugte sich mit größter Hochachtung und verließ die Kabine.
René folgte ihm; doch als er über die Schwelle trat, war ihm, als sehe die jüngere der Schwestern ihn an, als habe sie ihm etwas zu sagen. Er blieb stehen und streckte ihr die Hand entgegen.
Mit einer unbedachten Regung ergriff das junge Mädchen seine Hand, führte sie an seine Lippen und sagte: »O Monsieur, bei allem, was Ihnen heilig ist, versuchen Sie, den Kommandanten dazu zu bewegen, dass unser Vater nicht ins Meer geworfen wird.«
»Ich werde ihn darum bitten, Mademoiselle«, sagte René, »aber ich bitte auch Sie und Ihre Schwester um einen Gefallen.«
»Welchen? Oh, sagen Sie ihn, sagen Sie ihn!«, riefen die beiden Mädchen.
»Ihr Vater gleicht einem meiner Verwandten, den ich sehr geliebt habe und den ich nie wiedersehen werde. Gestatten Sie, dass ich Ihren Vater küsse.«
»Oh! Von ganzem Herzen, Monsieur«, sagten die Mädchen.
René näherte sich dem Leichnam, senkte ein Knie, beugte den Kopf zu dem Toten, küsste ihn ehrfürchtig auf die Stirn und verließ den Raum mit einem erstickten Schluchzen.
Die zwei Schwestern blickten ihm verwundert nach. Der Abschied eines Sohnes von seinem Vater hätte nicht zärtlicher und ehrerbietiger sein können als Renés Abschied von dem Vicomte de Sainte-Hermine.
57
Das Sklavenschiff
Als Surcouf und René wieder an Deck kamen, waren die Spuren des Gefechts fast ganz beseitigt. Die Verwundeten hatte man in das Lazarett hinuntergebracht, die Toten waren ins Meer geworfen, das Blut war aufgewischt worden. René berichtete Surcouf den Wunsch der zwei jungen Mädchen, dass man ihren Vater nicht dem Meer überantworten, sondern bei der ersten Landung an Land bringen möge.
Es widersprach allen Gesetzen der Marine, doch in vergleichbaren Fällen war solchen Wünschen stattgegeben worden. Madame Leclerc, anders gesagt: Pauline Bonaparte, hatte auf diese Weise den Leichnam ihres Ehemannes von Santo Domingo zurückgebracht.
»Einverstanden«, sagte Surcouf. »Da der Kapitän der Standard gefallen ist, wird Monsieur Bléas das Kommando des Prisenschiffs übernehmen und erhält seine Kajüte. Sollte eine weitere Offizierskajüte frei sein, wird man die Damen Sainte-Hermine darin unterbringen und den Leichnam ihres Vaters in einem Eichensarg in ihrer früheren Kabine.«
René überbrachte diese Nachricht den jungen Mädchen, die auf der Stelle Surcouf danken wollten.
Die ältere der beiden hieß Hélène, die jüngere Jane. Hélène war neunzehn Jahre alt, Jane sechzehn.
Beide waren Schönheiten, doch verschiedener Art.
Hélène war blond, und die Weiße ihrer Haut war nur mit der einer Blüte vergleichbar, die der Jesuit Camelli drei Jahre zuvor aus Japan nach Frankreich mitgebracht hatte und die in den großen Gewächshäusern unter dem Namen Kamelie Verbreitung zu finden begann. Ihr Haar war von einem Goldton, der im Sonnenlicht einen ganz eigenen Zauber erhielt, und bildete eine Aureole um ihre Stirn, wie der Duft eine Blüte umwölkt; ihre weißen, rundlichen, zierlichen Hände waren unter den fast durchsichtigen Nägeln von rosiger Färbung; ihre Figur war die einer Nymphe, ihr Fuß der eines Kindes.
Jane war von vielleicht weniger ebenmäßiger Schönheit als ihre Schwester, aber anziehender; ihr kleiner, eigensinniger Mund hatte die Frische einer Rose, die man mit den Fingern presst; ihre Nase mit den nervösen Nasenflügeln war weder von griechischem noch von römischem Schnitt, sondern ganz und gar französisch; ihre Augen strahlten in dem dunklen Feuer des Saphirs, und ihre Haut hatte, ohne braun zu sein, die Färbung parischen Marmors, der lange der attischen Sonne ausgesetzt war.
Den zwei jungen Mädchen war das Interesse, das Surcouf ihnen entgegenbrachte, so wenig entgangen wie die Bewegung, die René beim Anblick ihres toten Vaters gezeigt hatte; die Tränen, die aus den Augen des jungen Mannes quollen, als er die Stirn des Verstorbenen küsste, waren nicht unbemerkt geblieben; deshalb erklärten sie, keine Wünsche zu haben, sondern Surcouf in allen Belangen freie Hand geben zu wollen.
Surcouf hatte bereits an Bord der Standard die Kajüte des ersten Offiziers putzen lassen; nun bat er die jungen Mädchen, von ihrem toten Vater Abschied zu nehmen. In diesen Breiten ist es geboten, einen Leichnam so schnell wie möglich im Sarg einzuschließen; der Sarg würde in der ehemaligen Kabine der Familie bleiben, die Töchter des Toten würden die Kajüte des ersten Offiziers bewohnen. René wurde von Surcouf gebeten, sich darum zu kümmern, dass die Habseligkeiten der Kinder in ihr neues Domizil gebracht wurden, und alles für sie zu tun, was in seiner Macht stand.
Hélène und Jane betraten ihre neue Kajüte; René wartete vor der Tür, damit sie sich ungestört ihrem Schmerz hingeben konnten.
Nach einer Stunde kamen sie heraus, mit schmerzgeschwellter Brust, die Augen voller Tränen; Jane hatte kaum Kraft zu gehen und ergriff Renés Arm; ihre Schwester, mit mehr Seelenstärke versehen, trug ihre Schmuckschatulle und die Brieftasche ihre Vaters; beiden war bewusst, welches Zartgefühl der junge Mann bewiesen hatte, indem er sie sich ungestört ihrem Schmerz hingeben ließ, doch nur Hélène konnte ihn ihres Dankes versichern, denn Jane hinderte das Schluchzen am Sprechen.
René brachte die zwei Mädchen in das Zimmer, das für sie vorbereitet worden war, und ließ sie allein, um die letzten Dienste zu überwachen, die man ihrem Vater erwies.
Zwei Stunden darauf hatte der Schiffszimmermann einen Sarg aus Eichenholz gezimmert, in den man den Leichnam des Vicomte von Sainte-Hermine bettete, dann wurde der Sarg zugenagelt.
Als die Mädchen den ersten Hammerschlag hörten, errieten sie seinen Grund und wollten zu ihrer früheren Kabine eilen, um ihren Vater ein letztes Mal zu sehen, doch vor ihrer Schwelle trafen sie auf René; er hatte die letzte Regung ihres Pflichtbewusstseins erahnt und wollte sie daran hindern, sich weiterem Kummer auszusetzen. Er nahm sie in die Arme, brachte sie in ihr neues Zimmer zurück und führte sie zueinander; sie fielen einander schluchzend in die Arme und sanken auf ein Kanapee. Dann legte René Janes Hand in die von Hélène, küsste respektvoll beide Hände und verließ den Raum.
All sein Handeln war von so großer Keuschheit und die Bekanntschaft der jungen Leute hatte unter so entsetzlichen Umständen begonnen, dass weder Hélène noch Jane, noch René sich einen Begriff davon machten, wie schnell die Ereignisse eine Vertraulichkeit unter ihnen bewirkt hatten, die ganz und gar geschwisterlich war.
Am nächsten Tag fuhren beide Schiffe nebeneinander der Île de France entgegen. Vierzig Korsaren waren von Bord der Revenant auf die Standard übergewechselt. Bléas hatte das Kommando über das Prisenschiff erhalten, und Surcouf, der ahnte, wie wichtig den beiden jungen Mädchen die Anwesenheit eines Freundes oder wenigstens eines mitfühlenden Herzens war, hatte René gestattet, sich Bléas anzuschließen.
Am übernächsten Tag nach dem Seegefecht zwischen der Revenant und der Standard wurde der Revenant eine Slup gemeldet, deren Verfolgung sie aufnahm. Die Slup versuchte zuerst zu entkommen, doch als ein Kanonenschuss die Aufforderung, sie solle beidrehen, unterstrich, drehte sie bei.
Die Slup legte backbords an, und nun wurden René und die zwei Schwestern von der Poop aus Zeugen eines abscheulichen Schauspiels: Zwei bedauernswerte Kreaturen lagen im Sterben trotz der Bemühungen eines jungen Negers, der ihnen ein Gebräu einflößte, das Zauberer mit ebenholzschwarzer Haut bereitet hatten; etwas weiter entfernt wärmten sich fünf junge und fast nackte Negerinnen in der Hitzeglut einer Sonne, die europäische Frauen getötet hätte und die sie wollüstig genossen. Eine von ihnen wollte den Hunger eines Kindes stillen, das sie in den Armen hielt, doch es saugte vergebens an der leeren Mutterbrust.
Beim Anblick der Matrosen der Revenant, die das Schiff enterten, sprangen vier der Frauen auf und flohen; die fünfte wollte ihnen folgen, fiel jedoch entkräftet nieder und ließ ihr Kind los. Der Offizier hob es auf und legte es neben seine Mutter; er war auf der Suche nach dem Kapitän dieses Schiffs, in dem er auf den ersten Blick vor allem an der Höhe der Masten ein Sklavenschiff erkannt hatte.
In der Tat entdeckte man im untersten Schiffsraum vierundzwanzig bedauernswerte Schwarze, die in einer unerträglichen Lage zusammengepfercht und angekettet waren.
Aus der Tür, der einzigen Öffnung, durch die ein Luftaustausch möglich war, strömte ein mephitischer Geruch, der Übelkeit erregte.
Als das Beiboot das Schiff verließ, dessen Flagge es als amerikanisches Schiff auswies, beorderte Surcouf René und Bléas mit einem doppelten Signal an Bord der Revenant.
Die jungen Mädchen fragten sich bange, was dieses Manöver bezweckte und warum das Signal erfolgte. René erklärte ihnen, dass der Kapitän des gekaperten Schiffs offenbar mit Sklaven handele, der Sklavenhandel ohne besondere Genehmigung jedoch verboten sei und dass man an Bord der Revenant einen Kriegsrat einberufen werde, um über dieses Vergehen zu richten.
»Und wenn er für schuldig befunden wird«, fragte Jane mit bebender Stimme, »welche Strafe wird ihm dann auferlegt?«
»Nun«, sagte René, »dann läuft er Gefahr, gehängt zu werden.«
Jane stieß einen Schrei des Entsetzens aus.
Da sich das Beiboot am Fuß der Leiter befand, die Matrosen mit erhobenen Riemen warteten und Bléas bereits eingestiegen war, blieb René nur mehr Zeit, sich in das Boot hinunterzuhangeln.
Die anderen Offiziere hatten sich bereits versammelt, als Bléas und René erschienen. Man brachte den amerikanischen Kapitän in den Raum, der als Gerichtssaal diente; er war ein groß gewachsener Mann, dessen kräftige Statur von übermenschlicher Kraft kündete; er sprach nur Englisch, und deshalb hatte Surcouf René als Dolmetscher herbeibeordert. Als er René rufen gehört hatte, der Kapitän sei tot und man solle die Flagge senken, und als er gesehen hatte, dass die Engländer ohne Widerrede gehorchten, war ihm klar geworden, dass René das Englische wie seine Muttersprache sprach.
Der amerikanische Kapitän hatte Papiere mitgebracht, aus denen hervorging, dass er Amerikaner und in der Handelsschifffahrt tätig war; doch vergebens verlangte man von ihm jene Papiere, die bewiesen hätten, dass sein Schiff zu den acht Schiffen seiner Nation zählte, die von den europäischen Seemächten dazu ermächtigt waren, dem Sklavenhandel nachzugehen. Als er zugab, dieses Papier nicht zu besitzen, erklärte man ihm, welches Verbrechen er begangen hatte, als er die Unseligen ihrer Heimat und ihrer Familie entriss, mit Gewalt oder mittels Täuschung.
Man befand den amerikanischen Kapitän für schuldig und verurteilte ihn zum Tode.
Der Tod von Sklavenhändlern ist so grausam wie schändlich; sie werden an der Rah ihres Schiffs erhängt oder an der Rah des Schiffs, das das ihre überwältigt hat.
Als das Urteil verkündet war, gab man dem amerikanischen Kapitän eine Stunde Zeit, damit er sich auf den Tod vorbereiten konnte. Er vernahm sein Todesurteil, ohne die geringste Regung zu zeigen; man ließ ihn in dem Raum mit einer Wache an jeder Tür, denn man fürchtete, er könne sich ins Meer stürzen, um dem schändlichen Tod am Galgen zu entgehen.
Er verlangte Papier, Feder und Tinte, um seiner Frau und seinen Kindern eine Nachricht zu senden; dieser Bitte wurde stattgegeben. Er begann zu schreiben.
Während der ersten zehn oder zwölf Zeilen blieb seine Miene reglos, doch allmählich verdüsterte Besorgnis seine Züge, bis er nicht mehr sehen und schreiben konnte, weil die unterdrückten Tränen hervorquollen und das Papier netzten, auf das er seinen Abschiedsbrief schrieb.
Daraufhin verlangte er, Surcouf zu sprechen.
Surcouf kam sogleich zu ihm, begleitet von René, der ihm noch immer als Dolmetscher diente.
»Sir«, sagte der Amerikaner, »ich hatte meinen Abschiedsbrief an Frau und Kinder zu schreiben begonnen, doch in dem Wissen, wie entsetzlich es für sie wäre, aus meinem Mund zu erfahren, welch schändlichem Gewerbe ich aus Liebe zu ihnen nachgegangen bin, so dass der Bericht meines Todes und seiner Ursache ihr Leid nur gesteigert hätte, möchte ich Ihnen eine Bitte unterbreiten. In dem Schreibtisch meiner Kabine finden Sie einen Geldbetrag von vier- bis fünftausend Francs in Gold. Ich hatte gehofft, mit meinen achtzig Gefangenen und meiner Slup fünfundvierzigtausend oder fünfzigtausend Francs zu erwirtschaften, einen ausreichenden Betrag, um in Übersee einem ehrlichen Gewerbe nachzugehen, was mir erlaubt hätte, die schwarze Spur zu tilgen, mit der ich mein Leben befleckt habe. Gott hat es nicht so gewollt. Meine Slup und meine Gefangenen gehören Ihnen, aber die fünftausend Francs, die Sie in meiner Schublade finden werden, sind mein persönliches Eigentum. Ich bitte Sie inständig mit der letzten Bitte eines Seemanns, diese fünftausend Francs meiner Frau und meinen Kindern auszuhändigen, deren Anschrift Sie auf dem angefangenen Brief finden, und ihnen nur Folgendes mitzuteilen: ›Von Kapitän Harding, der beim Überqueren des Äquators den Tod gefunden hat.‹ Mein Tun, so tadelnswert es ist, kann bei mitfühlenden Herzen die Entschuldigung finden, dass es dem Zweck diente, eine vielköpfige Familie in schwierigen Umständen zu unterstützen. Nun werde ich wenigstens ihr Leid nicht mehr mit ansehen müssen. Ich hätte nie aus freien Stücken den Tod gesucht, doch da er mich nun ereilt, nehme ich ihn hin, nicht als Strafe, sondern als Wohltat.«
»Sind Sie bereit?«
»Ich bin bereit.«
Er erhob sich, schüttelte den Kopf, um die letzten Tränen aus seinen Wimpern zu entfernen, schrieb die Adresse seiner Frau nieder – Mrs. Harding, Charlestown – und überreichte Surcouf den Brief mit den Worten: »Ich bat Sie um Ihr Wort, Sir, wollen Sie es mir geben?«
»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Monsieur«, erwiderte Surcouf, »was Sie wünschen, wird geschehen.«
Daraufhin machte Surcouf ein Zeichen, und ein Trommelwirbel ertönte. Die Stunde war gekommen; angesichts des nahen Todes gewann der Kapitän seine ganze Kaltblütigkeit zurück. Ohne die geringste Gemütsbewegung zu zeigen, nahm er seine Krawatte ab, öffnete den Hemdkragen und betrat festen Schritts den Teil des Schiffs, wo alles für die Hinrichtung vorbereitet war.
Tiefes Schweigen herrschte an Deck, denn solche Präliminarien des Todes gebieten allen Seeleuten Ehrfurcht, sogar den Korsaren.
Am Fockmast wartete ein Seil, das am einen Ende zu einer Schlinge geknüpft war und am anderen Ende von vier Männern gehalten wurde; nicht nur die Mannschaft der Revenant hatte sich an Deck versammelt, auch die zwei anderen Schiffe hatten beigedreht, und die Zuschauer drängten sich an Deck, auf der Poop und auf den Rahen.
Der amerikanische Kapitän steckte seinen Kopf in die Schlinge und wandte sich dann an Surcouf: »Ziehen Sie es nicht in die Länge, Sir«, sagte er. »Warten heißt leiden.«
Surcouf trat zu ihm und befreite seinen Kopf aus der Schlinge.
»Ihre Reue ist nicht geheuchelt, Monsieur«, sagte er zu ihm. »Nichts anderes wollte ich erreichen; es ist vorbei, Sie haben Ihre Strafe erlitten.«
Der amerikanische Kapitän legte Surcouf eine zitternde Hand auf die Schulter, warf verwirrte Blicke um sich, brach zusammen und fiel in Ohnmacht.
Ihm war widerfahren, was bisweilen den Tapfersten widerfährt: Stark im Angesicht von Schmerz und Leid, wurde er angesichts der Freude von Schwäche überwältigt.
58
Wie der amerikanische Kapitän anstelle der fünftausend Francs, die ihm zustanden, fünfundvierzigtausend Francs erhielt
Die Ohnmacht des amerikanischen Kapitäns währte nicht lange. Keine Sekunde lang hatte Surcouf ernsthaft in Betracht gezogen, das Todesurteil vollstrecken zu lassen. Nachdem er mit dem erfahrenen Blick des Kriegers erkannt hatte, aus welch vortrefflichem Holz dieser Mann geschnitzt war, war es ihm darum zu tun gewesen, in dessen Geist einen dauerhaften Eindruck zu hinterlassen, und das war ihm gelungen. Sein Entschluss hatte festgestanden: dem vormaligen Sklavenhändler nicht nur das Leben zu retten, sondern ihn obendrein nicht gänzlich zu ruinieren.
Surcouf ordnete daher an, Kurs auf Rio de Janeiro zu nehmen, das achtzig bis neunzig Meilen in südwestlicher Entfernung lag.
Rio de Janeiro war einer der profitabelsten Sklavenmärkte ganz Südamerikas, und es stand außer Frage, dass Kapitän Harding dort so manchen Sklavenhändler kannte. Sobald Surcouf in der Bucht Anker geworfen hatte, ließ er ihn an Bord der Revenant holen.
»Monsieur«, sagte er zu ihm, »als Sie im Begriff standen, Ihr Leben zu verlieren, hatten Sie nur eine Bitte: die, dass man Ihrer Witwe die fünftausend Francs aushändigen möge, die sich in Ihrer Schublade befinden; heute will ich Ihnen einen einträglicheren Handel vorschlagen. Sie befinden sich in einem Hafen, in dem Sie die achtzig Negersklaven, die Ihnen geblieben sind, mit größtem Vorteil veräußern können; ich ermächtige Sie, dies zu tun und den Erlös zu behalten.«
Harding machte eine überraschte Geste.
»Warten Sie, Monsieur«, fuhr Surcouf fort. »Ich habe auch eine Bitte an Sie. Einer meiner Männer, mein Sekretär – eigentlich eher mein Freund als mein Bediensteter -, hat Interesse an Ihrer kleinen Slup.«
»Sie können sie ihm geben, Sir«, sagte Harding. »Wie alles, was ich besaß, gehört sie Ihnen.«
»Gewiss, doch René ist so stolz, dass er sie weder von mir noch von Ihnen als Geschenk annehmen würde; er wird darauf bestehen, Ihr Schiff zu kaufen; es liegt ganz in Ihrer Hand, in Anbetracht dessen, was Sie soeben sagten – dass diese Brigg Ihnen nicht mehr gehöre -, dem Mann, der Ihnen das Schiff abkaufen will, das er beanspruchen könnte, ohne etwas dafür zu bezahlen, einen günstigen Kaufpreis anzubieten.«
»Sir«, erwiderte Harding, »Ihr Betragen in dieser Sache ist mir Richtschnur für das meine: Setzen Sie den Preis für meine Slup fest, und ich werde sie ihm für die Hälfte des Schätzpreises abtreten.«
»Ihre Slup, Monsieur, ist zwischen achtundzwanzigtausend und dreißigtausend Francs wert. René wird Ihnen fünfzehntausend Francs zahlen, und Sie werden ihm dafür die Schiffspapiere übereignen und das Recht, unter amerikanischer Flagge zu segeln.«
»Wird es nicht zu Schwierigkeiten kommen«, fragte Harding, »wenn man merkt, dass der Schiffseigner Franzose ist?«
»Wem soll es auffallen?«, fragte René, der in seiner Funktion als Dolmetscher an dem Gespräch teilgenommen hatte.
»Es ist nicht so einfach«, sagte Harding, »die englische Sprache so gut zu sprechen, dass niemand merkt, dass man kein Engländer ist, insbesondere für einen Franzosen. Dieser Herr ist der erste Franzose«, fuhr er fort und deutete auf René, »dem ich begegnet bin, der sich ohne Weiteres als Engländer ausgeben könnte.«
»Nun, Monsieur, da ich es bin, der Ihr Schiff zu erwerben wünscht«, sagte René, »sind keine Schwierigkeiten dieser Art zu gewärtigen. Lassen Sie den Konsul Ihres Landes den Kaufvertrag vorbereiten, und bringen Sie Ihr Geld und Ihre übrige Habe an Land. Hier haben Sie einen Wechsel auf fünfzehntausend Francs, einzulösen bei dem Bankhaus David &Söhne in New York. Geben Sie mir eine Quittung.«
»Aber den Wechsel«, sagte Harding, »können Sie mir geben, wenn ich den Vertrag bringe.«
»Sie müssen sich vorher vergewissern können, dass er auch gedeckt ist, denn Monsieur Surcouf und ich wollen heute Abend oder spätestens morgen früh in See stechen.«
»Wie lautet der Name des Käufers?«, fragte Harding.
»Ganz wie Sie wollen«, erwiderte René lachend. »Fielding aus Kentucky, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Harding erhob sich und fragte, wann es René recht sei, den Vertrag zu unterzeichnen.
»Sagen Sie mir, wann Sie sich bei Ihrem Konsul einfinden wollen, und ich werde dort sein.«
Surcouf wurde befragt und sagte, er gedenke erst am nächsten Morgen abzulegen. René und Kapitän Harding verabredeten sich daraufhin für vier Uhr nachmittags. Um fünf Uhr war die Runner of New York John Fielding aus Kentucky übereignet. Um sechs Uhr hatte Kapitän Harding seine fünfzehntausend Francs erhalten, und um sieben Uhr waren zweihundert Matrosen beziehungsweise Soldaten der englischen Marine, die in Rio de Janeiro bleiben wollten, dem britischen Konsul anvertraut worden, um gegen eine gleich große Anzahl französischer Gefangener ausgetauscht zu werden. Und am nächsten Tag waren alle drei Schiffe bei Tagesanbruch bereit, in See zu stechen, und segelten gemeinsam dem Kap der Guten Hoffnung entgegen.
Wie von Surcouf beschlossen, verließen die jungen Mädchen die Revenant und kamen auf die Standard, wo René über sie wachen konnte. Beide hatten ihn voller Freude begrüßt, denn allein und hilflos hätten sie nie und nimmer die Reise nach Rangun bewältigen können. Keine der beiden war je zuvor in Indien gewesen; Hélène, die ältere der Schwestern, hatte in London einen Offizier der indischen Armee kennengelernt, der in Kalkutta stationiert war, und die Familien hatten vor der Abreise der jungen Mädchen und ihres Vaters vereinbart, dass Hélène de Sainte-Hermine und Sir James Asplay in Indien das Band der Ehe knüpfen sollten. Jane, die jüngere, sollte mit ihrem Vater den Besitz weiterführen, bis auch sie verheiratet wäre; je nachdem, ob das junge Ehepaar mit dem Vater zusammenwohnen oder ob dieser abwechselnd bei der einen und der anderen Tochter wohnen wollte, würde man Rangoon House behalten oder verkaufen.
All diese Pläne hatte der Tod des Vicomte de Sainte-Hermine zunichtegemacht. Ein neuer Plan war vonnöten; und in ihrer Trübsal über die Heimsuchung, die sie ereilt hatte, waren seine Töchter außerstande, ihre Zukunft zu planen. Nichts Besseres konnte ihnen also geschehen, als zu dem Zeitpunkt, da ein Vater ihnen fehlte, auf einen jungen Mann zu treffen, der ihnen mit brüderlicher Zuneigung begegnete. Und dank des guten Wetters, das Surcouf von Rio de Janeiro bis zum Kap der Guten Hoffnung die Treue hielt, gestalteten sich die Überquerung des Ozeans und das Überwechseln von einer Welt in eine andere wie ein harmloser Spaziergang. Nach und nach stellte sich zwischen den drei jungen Leuten eine behutsame Vertraulichkeit ein, die in Hélène zu ihrer großen Freude die Hoffnung weckte, in dem bezaubernden René den Mann gefunden zu haben, der Jane bald genug nach ihrer eigenen Hochzeit zu seiner Gattin machen würde.
Die beiden Schwestern waren musikalisch, doch seit dem Tod ihres Vaters hatte keine von ihnen das Klavier angerührt. Oft lauschten sie ein wenig wehmütig den Seemannsliedern, während das Schiff auf den Flügeln der Passatwinde wie von allein seinem Ziel entgegenzueilen schien.
Während einer dieser schönen Nächte, die nichts mit Dunkelheit oder Finsternis zu tun haben, sondern nur des Tageslichts ermangeln, wie Chateaubriand bemerkte, erklang von der Schanze eine jugendliche Stimme, die ein kummervolles bretonisches Lied sang. Bei den ersten Tönen legte Hélène René die Hand auf den Arm, um ihn um Schweigen zu bitten; es war die Geschichte eines jungen Mädchens, das unter der Schreckensherrschaft den Edelmann seines Dorfes rettet und an Bord eines englischen Schiffs bringt, von der Gewehrkugel einer Wache tödlich getroffen wird, weil es auf deren »Wer da?« nicht antwortet, und in den Armen des Geliebten stirbt. Als die klagenden Töne verstummten, baten die jungen Mädchen mit Tränen in den Augen René, den Sänger um das Lied zu bitten. René erwiderte, dies sei nicht nötig, er glaube sich der Worte zu entsinnen, und um die Melodie zu rekonstruieren, benötige er nur ein Klavier, liniertes Papier und eine Schreibfeder. Sie begaben sich in Hélènes Kabine. René senkte den Kopf in die Hände, besann sich einen Moment lang und begann dann zu schreiben; ohne innezuhalten schrieb er das Lied von Anfang bis Ende nieder, stellte das Geschriebene an den Notenständer des Klaviers und begann mit sanfter und ausdrucksvoller Stimme das bezaubernde Duett zu singen.
Bei der Reprise des letzten Couplets hatte René die Worte: »Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn dennoch!« so inbrünstig gesungen, dass man hätte meinen können, diese naiven Worte drückten seine eigene Geschichte aus und seine gewöhnliche Melancholie sei dem Tod seiner Geliebten oder deren Verlust für immer geschuldet; der schmerzliche Klang seiner Stimme vibrierte in den Herzen der beiden Mädchen, berührte ihre zartesten und wehmütigsten Fibern und verband sie mit seinem Herzen.
Die Uhr an Bord zeigte die zweite Stunde nach Mitternacht, als René in seine Kabine zurückging.
59
Die Île de France
Wenige Stunden später, um fünf Uhr morgens, rief der Matrose im Ausguck: »Land in Sicht!« Der Tafelberg war in Sichtweite.
Der Wind war günstig, und die Schiffe passierten im Verlauf des Tages das Kap der Guten Hoffnung. Am Kap Agulhas erfasste lebhafter Wind die kleine Flotte und beförderte sie im Handumdrehen ostwärts und außer Sichtweite festen Landes. Man nahm wieder Kurs auf die Île de France, und vor Ende des Tages erblickte man den Piton des Neiges auf der Insel Réunion.
Im Jahr 1505 beschloß Dom Emmanuel, König von Portugal, an der indischen Küste einen Vizekönig oder Gouverneur zu etablieren. Den Posten erhielt Dom Francesco de Almeida, der fünf Jahre später nahe dem Kap der Guten Hoffnung von den Hottentotten dahingemetzelt wurde, als er sich anschickte, nach Europa zu fahren.
Doch seit dem ersten Jahr der Regentschaft de Almeidas, in dem Dom Pedro Mascarenhas die Île de France und die Île de Bourbon entdeckte, kamen die Portugiesen niemals auf den Gedanken, sich auf einer dieser beiden Inseln dauerhaft niederzulassen, solange sie Herrscher in diesen Breiten waren, anders gesagt: das ganze siebzehnte Jahrhundert hindurch, und der einzige Vorteil, den die Inselbewohner von dem Besuch der Fremden hatten, waren ein paar Ziegenherden, Affen und Schweine, die von den Portugiesen auf den Inseln ausgesetzt wurden; im Jahr 1598 überließen sie die Inseln den Holländern.
Als Portugal unter die Herrschaft Philipps II. geraten war, wanderten die Portugiesen in Scharen nach Indien aus. Da sie sich ihres Vaterlandes beraubt wähnten, erklärten die einen sich für unabhängig, die anderen wurden Piraten, die nicht mehr im Dienst der Herrscher ihres Landes standen.
Im Jahr 1595 legte Cornelius de Houtman den Grundstein zu der Macht, welche die Holländer auf diesen Inseln entfalten sollten. Nach und nach bemächtigten sie sich aller Eroberungen der Portugiesen und Spanier im Indischen Ozean, darunter der »Ilha do Cirne« und der Maskarenen. Admiral van Neck war der Erste, der die Ilha do Cirne 1598 betrat, die damals unbewohnt war.
Die holländische Flotte war am 1. Mai 1600 von Texel aus unter dem Kommando des Jacob Cornelius van Neck in See gestochen; die Namen der einzelnen Schiffe sind uns erhalten; und der Admiral taufte die Ilha do Cirne oder Cerné-Insel auf den Namen Mauritius zu Ehren ihres Statthalters, des Grafen Moritz von Nassau. Die Holländer, die diese Insel nie zuvor betreten hatten, ließen zwei Schaluppen zu Wasser, um die Insel zu erkunden und ihre Häfen zu begutachten, damit man wusste, ob sie sich für größere Schiffe eigneten; eine der Schaluppen gelangte bis in den großen Hafen, und man stellte fest, dass sein Becken tief genug war und an die fünfzig Schiffe aufnehmen konnte; am Abend brachten die Matrosen bei ihrer Rückkehr zum Schiff des Admirals mehrere große und eine Vielzahl kleine Vögel mit, die sich mit der Hand hatten einfangen lassen; außerdem hatten sie einen Süßwasserfluss entdeckt, der aus den Bergen kam und Wasserreichtum versprach.
Da der Admiral nicht wissen konnte, ob die Insel bewohnt war, und es ihm an Zeit mangelte, sie in Ruhe zu erkunden, weil er viele Kranke an Bord hatte, ließ er eine größere Abteilung Leute an Land gehen, die sich einen Stützpunkt suchten, an dem sie vor Überraschungsangriffen sicher waren.
Mehrere Tage lang sandte der Admiral Schaluppen zur Erkundung der anderen Inselteile aus; die Mannschaften begegneten nur überaus friedfertigen Vierfüßlern, die Reißaus vor ihnen nahmen, und zahlreichen Vögeln, die Menschen so wenig gewohnt waren, dass sie nicht wegzulaufen versuchten, wenn man sie einfing. Doch eine Seilfähre, die Stange einer Schiffswinde und eine Großrah bezeugten, dass sich am Ufer dieser Insel ein Schiffsunglück ereignet haben musste.
Besonders pittoresk anzusehen war diese Insel, weil sie allenthalben von hohen Bergen bedeckt war, die das satte Grün dichter Wälder färbte und deren Gipfel oftmals Wolken dem Blick entzogen. Der steinige Boden war so dicht bewachsen, dass man sich kaum einen Weg durch das Unterholz bahnen konnte; es gab Bäume aus dunklem Holz, das dem herrlichsten Ebenholz in nichts nachstand, und andere von einem lebhaften Rotton sowie einem dunklen Gold wie Bienenwachs; die zahlreichen Palmen boten erfrischende Nahrung; ihr Mark schmeckte wie Rüben und konnte mit derselben Sauce zubereitet werden wie diese; aus dem Holz, das auf der Insel so reichlich vorhanden war, konnten die Seeleute bequeme Hütten errichten, in denen die Kranken schnell genasen, was durch die gesunde Luft zusätzlich gefördert wurde.
Das Meer wiederum war von so großem Fischreichtum, dass man das Netz nur auszuwerfen brauchte, um es bis zum Bersten gefüllt einzuholen. Eines Tages fingen die Leute des Admirals einen Rochen von so gewaltiger Größe, dass sich daraus zwei Mahlzeiten für eine ganze Schiffsbesatzung bereiten ließen. Die Schildkröten waren so groß, dass sich bei einem Sturm sechs Männer unter einen leeren Panzer kauern konnten.
Der holländische Kommandant ließ an einem Baum ein Schild anbringen, das mit dem holländischen Wappen, dem Wappen Zeelands und dem Wappen Amsterdams als Schnitzerei versehen war und mit der Inschrift in portugiesischer Sprache: Christianos reformados. Dann ließ er ein Gelände von vierhundert Klafter Umfang einzäunen und auf dem Gelände diverse Gemüse aussäen und anpflanzen; außerdem wurde Geflügel auf der Insel ausgesetzt, damit nachfolgende Besucher dieses schönen Eilands sich mit anderem Proviant als nur den einheimischen Erzeugnissen versehen konnten.
Am 12. August 1601 schickte Kapitän Hermansen eine Schaluppe nach Mauritius, um Wasser und Nahrungsmittel aufzunehmen, die an Bord seines Schiffs rar geworden waren; die Schaluppe kam erst nach einem ganzen Monat wieder und brachte einen Franzosen mit, der berichtete, welch merkwürdige Abenteuer er erlebt hatte.
Er hatte einige Jahre zuvor in England an Bord eines Schiffs angeheuert, das mit zwei anderen Schiffen zusammen nach Indien in See gestochen war. Eines der drei Schiffe war in einem Sturm am Kap der Guten Hoffnung mit Mann und Maus untergegangen; die Mannschaften der zwei verbliebenen Schiffe waren so dezimiert, dass man beschloss, nur das seetüchtigere zu behalten und das andere zu verbrennen; bald darauf jedoch wüteten Skorbut und Typhus so fürchterlich unter den Unglücklichen, dass nicht einmal mehr genug Seeleute für den Betrieb dieses einen Schiffs übrig waren.
Das Schiff strandete an der Küste Timors südlich der Molukken, und dabei kam die ganze Besatzung ums Leben bis auf den Franzosen, vier Engländer und zwei Neger. Trotz ihrer Mittellosigkeit gelang es den Schiffbrüchigen, sich einer Dschunke zu bemächtigen, und sie fassten den befremdlichen Entschluss, nach England zurückzukehren. Zu Beginn verlief ihre Reise wie gewünscht, doch die Neger, die sich fern ihrem Heimatland sahen, konspirierten, um das Schiff in ihre Gewalt zu bringen, und als ihre Pläne entdeckt wurden, sprangen sie vor Verzweiflung und aus Furcht, bestraft zu werden, ins Meer.
Nachdem die verbliebene Mannschaft mehreren Stürmen entkommen war, wurde sie zuletzt an das Ufer der Insel Mauritius geschwemmt; doch obwohl ihr Leben selbst dann in höchster Gefahr gewesen wäre, wenn unter ihnen größte Einigkeit geherrscht hätte, waren Zwistigkeiten zwischen ihnen an der Tagesordnung; nachdem sie acht Tage auf Mauritius verbracht hatten, schlug der Franzose vor, sie sollten dort bleiben, bis der Himmel ihnen Hilfe schicken würde. Die Engländer aber wollten nicht abwarten, sondern ihre Reise fortsetzen; da sie in der Mehrzahl waren, setzten sie ihr Vorhaben in die Tat um, doch da der Franzose entschlossen war, sein Vorhaben auszuführen, stachen seine Kameraden in See und überließen ihn auf der einsamen Insel seinem Schicksal. Dort hatte er sich seit beinahe drei Jahren aufgehalten und von Schildkrötenfleisch und Früchten ernährt; seine Körperkraft war ungemindert, und er war so stark wie die Matrosen an Bord der holländischen Schiffe; doch einen Teil seiner geistigen Fähigkeiten hatte er eingebüßt, was man im Gespräch mit ihm schnell bemerkte. Seine Kleider waren nur mehr Fetzen, und er war fast nackt.
Offenbar hatten die Holländer der Insel im Jahr 1606 einen Besuch abgestattet, doch bis 1644 hatten sie dort keine Niederlassung errichtet. Trotz aller Ungewissheit über die ersten Siedler scheint manches dafür zu sprechen, dass sie sich aus den Reihen der Piraten rekrutierten, die seinerzeit den Indischen Ozean heimsuchten.
Mit Gewissheit sagen lässt sich, dass van der Master 1648 Gouverneur von Mauritius war. François Leguat wiederum erzählt in seinem Reisebericht, dass bei seiner Ankunft auf der Insel Rodriguez ein Monsieur Lameocius Gouverneur von Mauritius gewesen sei und dass im Jahr 1690 Rodolphe Déodati aus Genf diesen Posten bekleidet habe, als Leguat bei seiner Rückkehr von Rodriguez auf Mauritius festgehalten wurde. Zwischen 1693 und 1696 brachten einzelne Franzosen, die Madagaskar seines unbekömmlichen Klimas wegen verließen, gelbe und schwarze Frauen auf die Insel Mascarenhas, die sie in Ermangelung weißer Gefährtinnen heirateten. Flacourt bemächtigte sich der Insel im Namen des Königs und hisste die französische Flagge, wo zuvor die portugiesische geweht hatte; er gab der Insel den Namen Île de Bourbon, hinterließ in der Neugründung Männer und Frauen und setzte als Befehlshaber einen Schützling mit Namen Payen ein. Die neuen Kolonisten fanden fruchtbaren Boden vor, den sie mit Fleiß bestellten. Zuerst ernährten sie sich von Fisch, Reis, Schildkröten, Süßkartoffeln und anderen Gemüsen; den Genuss von Schlachtfleisch versagten sie sich gänzlich, damit die Herden wuchsen, und sie führten in diesem Winkel des Paradieses, der auf die Erde gefallen war, das entzückendste und friedlichste Leben.
Vier englische Piraten namens Avery, England, Condon und Patisson ließen sich mitsamt einem Teil ihrer Mannschaft auf der Insel nieder, nachdem sie auf dem Roten Meer und an den Küsten Arabiens und Persiens ein Vermögen angehäuft hatten. Der König Frankreichs erteilte ihnen Pardon, und einer dieser Abenteurer, der 1657 gekommen war, lebte bis zum Jahr 1763. Während die Insel Bourbon, stolz auf ihren neuen Namen, unter den Franzosen gedieh, verkümmerte Mauritius unter den Holländern, die diese Kolonie vernachlässigten und sie 1712 aufgaben, denn ihre Aufmerksamkeit hatte sich auf ihre neue Niederlassung am Kap der Guten Hoffnung verlagert. Am 15. Januar 1715 nutzte Kapitän Dufresne diesen Umstand, setzte an die dreißig Franzosen auf der Insel ab und verlieh ihr den Namen Île de France: Und in der Folge bewirkten der blühende Zustand der beiden Inseln, die günstige Beschaffenheit ihrer Häfen, die Fruchtbarkeit des Bodens und die gute Luft, dass man ernsthaft erwog, eine Kolonie zu gründen. Monsieur de Beauvillier, Gouverneur der Insel Bourbon, entsandte 1721 den Chevalier Garnier de Fougerey, Kapitän der Triton, dorthin; dieser ergriff am 23. September im Namen des Königs Besitz von ihr und ließ einen Fahnenmast von vierzig Fuß Höhe errichten, an dem eine weiße Fahne mit lateinischer Inschrift gehisst wurde. Am 28. August 1726 wurde Monsieur Dumas, der auf der Insel Bourbon wohnte, zum Gouverneur beider Inseln ernannt. Die Verwaltung der Inseln wurde aufgeteilt, und Monsieur Maupin wurde zum Gouverneur der Île de France ernannt.
Der wahre Vater, Begründer, ja Gesetzgeber der jungen Kolonie war jedoch Monsieur Mahé de la Bourdonnais. Er betrat sein kleines Reich im Jahr 1735. Mag die Geschichte ihn vergessen haben, so hat der Roman sein Gedächtnis gerächt.
Bei seiner Ankunft musste der neue Gouverneur erfahren, dass die Gerichtsbarkeit der Île de France derjenigen der Insel Bourbon unterstellt war; Monsieur de la Bourdonnais brachte Urkunden mit, die der Île de France die gleichen strafrechtlichen Befugnisse einräumten wie der Nachbarinsel.
Während der elf Jahre der Regierung des Monsieur de la Bourdonnais waren diese Befugnisse allerdings ein überflüssiger Luxus, denn kein einziges Gerichtsverfahren wurde auf der Insel anberaumt; der einzige Makel, der Mauritius befleckte, waren die entlaufenen Negersklaven. Monsieur de la Bourdonnais rekrutierte aus gefügigen Negern eine berittene Polizei, mit der er gegen widerspenstige Neger vorging. Dann pflanzte er zuerst Zuckerrohr auf der Île de France, und als Zweites gründete er Baumwollfabriken und Indigofärbereien. Ihre Erzeugnisse wurden auf den Märkten von Surate und Mocha, in Persien und in Europa abgesetzt.
Die von Monsieur de la Bourdonnais gegen 1735 gegründeten Zuckerrohrfabriken erwirtschafteten fünfzehn Jahre später jährliche Einnahmen in Höhe von sechzigtausend Francs. Er ließ Maniok aus Brasilien und Santiago del Nuevo Extremo holen, doch die Siedler auf Mauritius weigerten sich, die neue Pflanze anzubauen, und der Gouverneur hatte keine andere Wahl, als jeden Einwohner gesetzlich zu verpflichten, von jedem seiner Sklaven auf dreihundert Fuß Land Maniok anpflanzen zu lassen.
So kommt es, dass die Île de France alles, was sie ist, Monsieur de la Bourdonnais verdankt. Er ließ Straßen und Wege anlegen; er ließ mittels Ochsengespannen Bauholz und Steine zum Hafen schaffen, damit dort Häuser gebaut werden konnten; er ließ die Arsenale errichten, die Batterien, die Befestigungen, die Kasernen, die Mühlen, die Kais, die Kontore, die Kramläden und ein Aquädukt von dreihundert Klafter Länge, welches das Süßwasser zum Hafen, in die Krankenhäuser und an das Meerufer bringt. Bis dahin war den Bewohnern der Île de France der Schiffsbau so unbekannt gewesen, dass sie auf die Hilfe fremder Schiffszimmermänner angewiesen waren, deren Schiffe zufällig im Hafen lagen, wenn ihre Fischerboote leckten. Er brachte sie dazu, ihm zu helfen, eine Seestreitkraft zu schaffen, wozu die Insel Holz in Hülle und Fülle beitrug: In den Wäldern wurden die Bäume gefällt und auch für die spätere Verwendung zugeschnitten, und innerhalb von zwei Jahren hatte man genug Holz für die bezweckten Arbeiten.
Im Jahr 1737 führte Monsieur de la Bourdonnais Pontons zum Entladen und Kielholen der Schiffe ein; er ließ Boote und große Schaluppen als Transportkähne bauen; er erfand neue Leichterschiffe zum Transport von Wasser und eine Vorrichtung, mit der sich Schaluppen und Boote aus dem Meer in eine Position heben ließen, in der sie ohne großen Aufwand ausgebessert werden konnten. Mit dieser Vorrichtung konnte man ein Schiff in nur einer Stunde kalfatern, säubern und wieder flottmachen. Er ließ eine Brigg bauen, die sich als ausgezeichnetes Schiff erwies; im Jahr darauf ließ er zwei Nachfolgemodelle anfertigen und ließ ein Schiff von fünfhundert Tonnen vom Stapel.
Er tat zu viel des Guten, was notgedrungen üble Nachrede auf den Plan rief. Er begab sich nach Paris, um sich zu verteidigen, was ihm nicht schwerfiel: Alle gegen ihn ins Feld geführten Verdächtigungen konnte er im Handumdrehen zerstreuen, und da die Rede von einem bevorstehenden Zerwürfnis zwischen England und Holland ging, fasste er den Entschluss, Schiffe auszurüsten, mit denen er den Handel beider gegnerischer Mächte stören wollte; dieser Plan wurde zwar gnädig aufgenommen, nicht aber in die Tat umgesetzt, und 1741 verließ Monsieur de la Bourdonnais Paris mit dem Patent eines Fregattenkapitäns in der Tasche und mit dem besonderen Auftrag, das Schiff Seiner Majestät, die Mars, zu befehligen.
Doch 1742 wurde Frieden geschlossen, und Monsieur de la Bourdonnais kehrte zur Île de France zurück. Neue Anklagen wurden gegen ihn erhoben, und abermals machte er sich nach Frankreich auf. In Pondicherry traf er auf Monsieur Pierre Poivre, der Pfeffer, Zimt und verschiedene Bäume nach Frankreich brachte, deren Rinde sich zum Färben eignet.
Monsieur Pierre Poivre wurde 1766 von dem Herzog von Choiseul zum Oberverwalter der Île de France und der Insel Bourbon ernannt; er ließ auf ihnen den Brotfruchtbaum anbauen, und es gelang ihm, in den ihm anvertrauten Kolonien den Anbau der Gewürze Muskat, Zimt, Pfeffer und Nelken einzuführen. Heute wachsen allein auf Bourbon vierhunderttausend Nelkenbäume, deren Blütenknospen in Asien denen von den Molukken vorgezogen werden; und der Ampalisbaum, das Echte Rosenholz, der Talgbaum, der Teestrauch aus China, der Blut- oder Blauholzbaum, der Korallenstrauch, der ceylonesische Zimtbaum und die Zimtkassia aus Kochinchina, die Varietäten der Kokospalme, der Dattelpalme, des Mangobaums und Pimentbaums sowie Eiche, Tanne, Weinrebe, Apfelbaum und Pfirsichbaum, die aus Europa eingeführt wurden, der Avocadobaum, der von den Antillen stammt, der Mabolobaum von den Philippinen, der Palmfarn von den Molukken, der Seifenbaum aus China und der Mangostanbaum, dessen Früchte als die besten der Welt gelten, wurden alle der Île de France von ihrem Gouverneur oder besser Oberverwalter Monsieur Poivre geschenkt.
Nach einer Reihe hervorragender Gouverneure, deren jeder seinen Stein zum Fundament dieser prachtvollen Kolonie beitrug, wurden die blühenden Inseln von Monsieur Magallon-Lamorlière seinem Nachfolger General Decaen anvertraut, doch dieser erhielt sie zugleich mit dem Krieg gegen England. Seit Eröffnung dieses Krieges waren die Île de France und Réunion die einzigen Zufluchtsorte für französische Schiffe im Indischen Ozean, und dort ließen ein Surcouf, ein L’Hermite oder Dutertre ihre Prisen verkaufen und ihre Schiffe reparieren; nicht selten kreuzten in Sichtweite englische Schiffe, die nur darauf warteten, den Korsaren ihre Beute streitig zu machen.
Surcouf war folglich nicht wenig erstaunt, als er nach dem Ruf: »Land in Sicht!« die Groß-Obermarsrah erklomm und von Port Savanne bis zur Pointe Quatre-Cocos einen glatten Meeresspiegel erblickte, obwohl einzelne englische Schiffe sich am anderen Ende der Insel vor der Baie de la Tortue oder der Baie du Tamarin aufhalten mochten.
Surcouf, der zum vierten Mal das »indische Kythera« erreichte, erkannte die Insel durch den Dunst, der für alle stark bewaldeten Inseln charakteristisch ist, an der Montagne des Créoles und an der Bergkette, die von Grand Port bis zum Morne aux Bambous reicht.
Wer an der Île de France nur anlegt, um sich mit Lebensmitteln oder Wasser zu versorgen, kann sich manchmal zwischen den Häfen von Grand Port und von Port Louis nicht entscheiden; wer jedoch wie Surcouf kommt, um sein Schiff ausbessern zu lassen oder eine Prise zu verkaufen, weiß, wo er anlegen will. Die Einfahrt in die Bucht von Grand Port ist ein Leichtes dank der Passatwinde, die neun Monate des Jahres hindurch die Bäume der Insel nach Westen biegen, wie im Süden Frankreichs der Mistral die Bäume nach Süden biegt, doch die Ausfahrt ist unter solchen Bedingungen schier unmöglich.
Nachdem Surcouf sich vergewissert hatte, dass kein Engländer in Sicht war, gelangte er an der Pointe-du-Diable vorbei und hielt Kurs nach Nordosten, um den Untiefen auszuweichen; er fuhr an den großen Wäldern von Savanne vorbei, an der Montagne Blanche, am Morne Faïence und an den Hügeln von Flacq, durchquerte die Meerenge zwischen Île de France und Île d’Ambre und hielt Westnordwestkurs, um Cap Málheureux zu umfahren. Danach ging es an der Pointe au Vaquois und an der Pointe aux Canonniers vorbei und in den Hafen von Port Louis. Längst schon hatte die Signalstation die Ankunft einer Fregatte, einer Brigg und einer Slup gemeldet, und Neugierige mit Ferngläsern verfolgten ihre Einfahrt von Hügeln und Türmen.
Die Schiffe warfen Anker am Hafeneingang, und ihre Besatzungen warteten auf den Besuch der Quarantänebehörde, die sich alsbald einfand und ihnen die Erlaubnis erteilte, in den Hafen einzufahren; in ihrer Begleitung kam eine Vielzahl kleiner Kähne mit Früchten und Erfrischungen jeder Art. Nach erhaltener Erlaubnis und freudiger Begrüßung durch die Lenker der kleinen Boote ordnete Surcouf die Einfahrt in den Hafen zur Anlegestelle am Quai Chien-de-Plomb an, doch sein Name, von den Bootsführern weitergesagt, weckte in den zahlreichen Zuschauern Nationalstolz und so manche Erinnerung, so dass die Standard, die Revenant und die Runner of New York unter den Jubelrufen und dem Beifall aus unzähligen Kehlen vor Anker gingen.
60
An Land
Im Hafen von Port Louis an Land zu gehen, ist ein Kinderspiel: Am Ende des Hafenbeckens von beträchtlicher Tiefe steigt man vom Schiff auf den Kai, als setzte man über einen Bach. Keine zehn Schritte weiter befindet man sich auf der Place du Gouvernement, dann geht man am Regierungspalast vorbei, lässt die Intendanz mit ihrem prachtvollen, unvergleichlichen Baum zur Rechten liegen, steigt die Rue du Gouvernement zum Champ de Mars hinauf, und kurz bevor man die Kirche erreicht, gelangt man gegenüber der heutigen Place du Théâtre zum Grand Hôtel des Étrangers.
Das Grüppchen, das sich vor dem Hotel einfand, bestand aus Surcouf mit Mademoiselle de Sainte-Hermine, René mit Jane am Arm sowie Bléas und einigen rangniedrigeren Offizieren. Die schönste Suite des Hotels wurde den jungen Damen gegeben, die als Erstes nach einer Näherin verlangten, um sich Trauerkleidung anfertigen zu lassen. Der Eindruck des Verlusts, den sie erlitten hatten, war noch lebhaft, doch die Begleitumstände des tragischen Geschehens, der Ausblick in die Unendlichkeit von Meer und Himmel und Renés zartfühlende Anteilnahme und interessante, fesselnde und abwechslungsreiche Konversation hatten als Balsam das Herzeleid der jungen Mädchen zwar nicht geheilt, aber gelindert.
Als René sie fragte, was sie zu tun beabsichtigten, erwiderten sie, sie wollten keinen Fuß aus dem Haus setzen, bevor sie ihre Trauerkleidung hätten; Trauerkleidung sei ihnen auf dem Schiff nicht vordringlich erschienen, doch in einer Stadt müssten sie sich schämen, in Kleidern umherzugehen, die ihren Kummer und ihre Trauer nicht anzeigten. Zugleich erklärten sie, dass ihr erster Ausgang der Pamplemousses-Gegend gelten solle.
Der Leser wird sich bei der Erwähnung dieses Namens denken können, dass sie den Hütten aus Paul und Virginie einen ehrfurchtsvollen Besuch abstatten wollten. Bernardin de Saint-Pierres Roman war mehr als zehn Jahre zuvor erschienen, doch in Hélène und Jane hatte die Lektüre dieser bezaubernden Idylle, die man nachgerade für eine modernisierte Fassung von Daphnis und Chloe halten könnte, einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen.
Paul und Virginie war eines der Werke, die eine Gesellschaft zweiteilen: Die einen werden zu seinen fanatischen Befürwortern, die anderen weisen es voller Abscheu von sich, und beide Parteien stehen nicht an, regelrechte Gefechte auszutragen.
Jeder weiß, dass der Verfasser, voller Zweifel an seinem Talent, im Begriff gewesen war, sein Buch gar nicht drucken zu lassen, nachdem er im Salon Madame Neckers daraus vorgelesen hatte und auf höfliches Desinteresse gestoßen war. Monsieur de Buffon hatte sich sichtlich gelangweilt, Monsieur de Necker hatte gegähnt, und Monsieur Thomas war eingeschlafen.
Das hatte Bernardin de Saint-Pierre dazu bewogen, seinen Roman nicht zu veröffentlichen. Es kam ihn schwer an, seine beiden Kinder im Stich zu lassen, doch er hatte sich zu diesem Entschluss durchgerungen und sich vorgenommen, das Manuskript zu verbrennen, dessen Vorhandensein ihn entsetzlich quälte, da es ihn an eine der finstersten Enttäuschungen seines Lebens erinnerte.
So stand es um Bernardin de Saint-Pierre, der noch immer zögerte, sein geliebtes Manuskript den Flammen zu überantworten, nachdem die erlesensten Geister seiner Zeit es verworfen hatten, als ihn eines Tages Joseph Vernet aufsuchte, der bekannte Maler, und ihn fragte, was ihn bedrücke, als er seine kummervolle Miene sah. Bernardin erzählte ihm alles und fand sich auf die drängenden Bitten seines Freundes bereit, ihm aus dem Manuskript vorzulesen.
Vernet lauschte mit unbeteiligter Miene bis zum Schluss. Bernardin hingegen wurde immer unsicherer und aufgeregter, bis seine Stimme merklich zitterte. Nach dem letzten Wort hob er den Blick. »Und?«, fragte er.
»Lieber Freund«, erwiderte Vernet und drückte ihn an sein Herz, »Sie haben da nichts weniger verfasst als ein Meisterwerk!«
Vernet urteilte weder als Kenner noch als geistreicher Mensch, sondern mit dem Herzen, und deshalb täuschte er sich nicht, sondern fällte das gleiche Urteil, das die Nachwelt fällte.
Seitdem haben zwei neue Romane, effektvoller geschrieben und gestaltet, den Erfolg von Paul und Virginie zu überschatten versucht, verfasst von einem ebenfalls höchst talentierten Mann, dessen Talent jedoch dem Bernardins völlig entgegengesetzt war: Ich meine Chateaubriands René und Atala. Diese Romane verschafften sich ihren Rang, doch Paul und Virginie behielt den seinen.
Und die Schauplätze, an denen sich diese schlichte Geschichte ereignet hatte, wollten Hélène und Jane de Sainte-Hermine unbedingt aufsuchen. Da die Näherin ihnen versprochen hatte, die Trauerkleidung am nächsten Tag genäht zu haben, kam man überein, die geheiligte Pilgerreise am Tag darauf zu machen.
René wollte zudem für seine jungen Freundinnen eine Lustpartie vorbereiten, die den elegantesten Ausflügen in die Wälder von Fontainebleau oder Marly in nichts nachstehen sollte.
Er ließ zwei Sänften aus Ebenholz und chinesischer Seide anfertigen. Für sich erstand er ein Pferd aus dem Kapland, für Bléas und Surcouf mietete er die besten Pferde, die zur Verfügung standen; und den Inhaber des Hotels beauftragte er, ihm zwanzig Schwarze zu besorgen, acht als Träger für die Sänften, zwölf als Träger der Vorräte. Speisen würde man am Ufer der Rivière des Lataniers, und schon am Vorabend ließ René einen Tisch, Tischwäsche und Stühle hinbringen.
Ein schönes Fischerboot mit allen Utensilien würde auf jene warten, die der Jagd den Fischfang vorzogen. Da René unschlüssig war, welchen Zeitvertreib er wählen solle, begnügte er sich damit, sein Gewehr mitzunehmen und sich darauf einzustellen, das zu tun, was seine zwei schönen Begleiterinnen tun wollten.
Der Tag des Ausflugs kam, prachtvoll, wie es die Tage dieses Breitengrades fast immer sind, und um sechs Uhr morgens versammelten sich alle im unteren Saal des Hôtel des Étrangers, bevor die Hitze unerträglich wurde.
Die Sänften und ihre Träger warteten auf der Straße; daneben schnaubten drei Pferde, vier Neger trugen auf dem Kopf Behältnisse aus Weißblech mit Lebensmitteln, und acht weitere Schwarze standen bereit, ihre Gefährten abzulösen. René ließ Surcouf und Bléas ihre Pferde aussuchen, und als mittelmäßige Reiter wie fast alle Seeleute entschieden sie sich für die Tiere, die ihnen am sanftmütigsten erschienen. Das Pferd aus dem Kapland blieb für René übrig. Bléas, kein übler Reiter, wollte sich René gewachsen zeigen, doch Renés Pferd, genannt »der Kaffer«, zeigte sich zwar ungnädig beim Besteigen, doch sobald René im Sattel saß, waren er und sein Reittier wie zu einer Einheit verschmolzen.
Auf der Île de France haben solche Ausflüge einen ganz eigenen Charme. Da die Wege zu jener Zeit sehr uneben waren, wurden die Frauen in der Sänfte befördert, und die Männer ritten; die Neger wiederum, die sich fast nackt bewegten, trugen an großen Feiertagen eine Art Badehose, die ihnen bis zum Knie reichte. Acht Mann trugen die Sänften, und sie marschierten los, einen großen Stock in der Hand, um das Gleichgewicht zu halten. Die vier Neger, die mit den Behältnissen betraut waren, in denen sich das Zubehör für die Mahlzeit befand, machten sich als Nächste auf den Weg, im Rhythmus zu einem kreolischen Lied eher trauriger als fröhlicher Natur.
Der Weg war bezaubernd: zur Rechten die sich allmählich verflachenden Bergketten im Nordosten der Insel, dann oberhalb des Pieter Both die Montagne du Pouce, deren Ersteigung noch niemand gewagt hatte, und danach ein kleines Tal, genannt Enfoncement des Prêtres, herrlich in der Hochebene gelegen, als hinge es in der Luft, ein begrüntes Amphitheater, an dem man sich nicht sattsehen konnte. Und unterwegs stieß man immer wieder auf Häuschen und Hütten farbiger Bewohner.
Dann überquerten die Reisenden den Lataniers-Fluss und erreichten Terre-Rouge, wo Bambushaine, Farbholzbäume und duftende Beerensträucher sie begrüßten. Immer wieder kreuzten ihren Weg Schwärme farbenprächtiger Papageien, Affen, die von Baum zu Baum turnten, und Hasen, die auf der Insel so zahlreich waren, dass die Inselbewohner sie mit Stöcken erschlugen und von Turteltauben und kleinen Wachteln, wie sie nur auf dieser Insel vorkommen, jagen ließen.
Zuletzt gelangte die Reisegruppe zu einem Stück einstmals kultivierten Landes, auf dem noch die Überreste zweier kleiner Hütten zu erkennen waren. Anstelle von Weizen, Mais und Süßkartoffeln bot sich dem Auge der Anblick eines ausgedehnten Blumenteppichs, hie und da unterbrochen von kleinen Erhebungen, die mit leuchtend bunten Blumen geschmückt waren und an Altäre erinnerten.
Im Norden sah man bis zu dem Berg namens Montagne de la Découverte, auf dem sich die Signalstation befand. Der Kirchturm überragte die dichten Bambushorste der weiten Ebene, und weiter hinten erstreckte sich ein Wald bis zum Inselufer. Richtete man den Blick geradeaus, sah man die Baie du Tombeau, ein wenig weiter rechts das Cap Malheureux und dahinter das offene Meer, auf dem einzelne bewohnte Inseln erkennbar waren, in deren Mitte Point-de-Mire wie eine Bastion aus den Wogen aufragte.
Das Grab, in dem Paul und Virginie ruhten, betreute ein alter Priester, der die Grabstätte in ein Paradies aus Blumen und Begrünung verwandelt hatte.
Es war das erste Anliegen der Besucher, den Grabstein dieser Ruhestätte aufzusuchen. Jeder verrichtete schweigend seine Andacht an diesem Grabmal, von dem die zwei jungen Mädchen sich nur schweren Herzens trennten. Die Männer, weniger poetisch gestimmt, sahen voller Vorfreude dem Wildreichtum der Insel und den Jagdfreuden entgegen, die er ihnen versprach. Einige der Träger dienten ihnen als Führer, und man kam überein, sich in einer Stunde am Lataniers-Fluss zu versammeln, wo die Mittagsmahlzeit bereit sein würde. René oblag es, über die beiden jungen Damen zu wachen. Jane hatte Bernardin de Saint-Pierres Roman mitgebracht, und René las am Grab der Heldin einige Kapitel daraus vor.
Die Sonne begann allmählich recht stark zu brennen, und die zwei Mädchen und ihr Ritter sahen sich genötigt, den schattenarmen Ort zu verlassen.
Unsere Touristen hatten sich kaum Zeit genommen, die Landschaft zu betrachten. Wer unterwegs in Armenien mit einem Mal auf das verlorene Paradies stieße, hätte kaum weniger Anlass zur Verblüffung als der Reisende, der sich zum ersten Mal in die Gegend mit Namen Pamplemousses verirrt. Alles, was sie zu sehen bekamen, weckte die ungeheuchelte Bewunderung der drei jungen Leute. Zum ersten Mal bekamen sie Zuckerrohrfelder zu sehen, bepflanzt mit den biegsamen, glänzenden, knotigen und faserigen Halmen von neun bis zehn Fuß Höhe mit ihren seidig spröden Blättern.
Neben den Zuckerrohrfeldern und gewissermaßen als ihre Ergänzung lagen Kaffeeplantagen, deren Beeren, wenn es nach Madame de Sévigné gegangen wäre, wie Racine längst aus der Mode gekommen wären, und die stattdessen in jenen Tagen seit einhundertzwölf Jahren Europa einen Sinnengenuss verschafften, wie Racine seit zweihundert Jahren den Liebhabern der Poesie geistigen Genuss verschaffte. Was die drei jungen Leute vor allem beeindruckte, war die Freigebigkeit, mit der die Natur an jedem Baum köstliche Früchte wachsen ließ. Sie brauchten nur die Hand auszustrecken, um Mandeln, Rosenäpfel oder Avocados zu pflücken. Von Weitem sahen sie ihre Begleiter, die am Lataniers-Fluss die Mittagsmahlzeit zubereiteten.
Kein Getränk hatte jemals köstlicher gemundet als die drei Glas Wasser, die aus diesem geschöpft wurden.
Die Jäger waren noch nicht zurückgekehrt; doch zehn Minuten darauf verrieten Gewehrschüsse ganz in der Nähe, dass sie nicht weit sein konnten.
Es war erst zehn Uhr vormittags, aber die frische und klare Luft hatte allen Reisenden großen Appetit gemacht. Außerdem war der Anblick des gedeckten Tischs nur allzu verführerisch: Die Seeleute waren bis zum Meer gegangen und hatten Muscheln und Meerestiere gesammelt, darunter kleine Austern, die – wie in Genua – an den Zweigen und Holzstücken serviert wurden, an denen sie hafteten.
Der Hotelier des Hôtel des Étrangers, der mit dem Hauptgang der Mahlzeit betraut war, hatte seine heilige Aufgabe vollendet erfüllt und ein halbes Lamm, ein Viertel von einem Hirschkalb und Hummer von ausgesuchter Frische bringen lassen.
Der Fischgang wurde mit unerhört großen, köstlich mundenden Fischen bestritten, von denen man sich in Frankreich keine Vorstellung machen kann.
Die besten Weine, die man auf der Insel hatte auftreiben können, lagerten zur Kühlung an den tiefen Stellen des Flusses.
Die Jäger brachten einen jungen Hirsch, einige Hasen und große Mengen Rebhühner und Wachteln. Die Köche sicherten sich diesen zusätzlichen Proviant für das Abendessen, denn den Reisenden hatte der Ausflug bisher so gut gefallen, dass sie wie aus einem Mund gerufen hatten: »Bleiben wir bis zum Abend!«
Dieser Vorschlag war auf keinen Widerspruch gestoßen, und man war übereingekommen, im Freien zu speisen, sich bis zwei Uhr in der Frische der Bäume am Fluss zu erquicken und danach zu Pferde aufzubrechen, um die Stelle der Küste zu besuchen, an der die Saint-Géran in Paul und Virginie gekentert war. Damit wäre die Pilgerfahrt vollendet, denn man hätte den Geburtsort, den Schauplatz des Kenterns und das Grab der Romanfiguren besichtigt.
Nie zuvor hatten René und seine Reisegefährten eine so üppige Vielfalt an Früchten gekostet, die sämtlich in Europa unbekannt waren. Die Neugier erhielt den Appetit wach und entschuldigte ihn, und so saß man bis um zwei Uhr zu Tisch.
Da die Schwarzen großzügig verpflegt worden waren und auch mit Arrak nicht gespart worden war, fanden sie sich pünktlich ein, um ihre Arbeit zu tun, da sie hofften, für gute Dienste weiterhin großzügig entlohnt zu werden.
Man machte sich wieder auf den Weg, der nun die Hochebene und Papayahaine verließ und in Dickichte führte, in denen die Neger immer wieder mit Macheten einen Pfad bahnen mussten. Die Träger gingen mit geschmeidigen Schritten, die trotz der schlechten Wege die jungen Damen in den Sänften kein bisschen durchschüttelten.
Nach etwa einer Dreiviertelstunde erreichten die Reisenden die Küste vor der Île d’Ambre, anders gesagt die Stelle, an der die Saint-Géran zwischen Festland und Insel Havarie erlitt.
Nichts an der Landschaft kündete von dem traurigen Ende der Pastorale von Bernardin de Saint-Pierre, doch die Bewegung, die unsere Reisenden ergriff, war darum um nichts geringer als die am Grab der Liebenden. Alle blickten gebannt und klopfenden Herzens zum Ort des Geschehens und fragten die Seeleute, wie es zu dem Unglück habe kommen können, als mit einem Mal an der Stelle, an der das Schiff gesunken war, Getöse vernehmbar wurde und die Wasseroberfläche wogte und spritzte.
Die Ursache war schnell erkannt: Zwei riesige Untiere kämpften im Wasser miteinander, ein Walfisch mittlerer Größe und sein Todfeind, der Schwertfisch. Man hätte meinen können, die zwei Gladiatoren des Meeres hätten für ihren Zweikampf den Augenblick abgepasst, in dem die Besucher das Meeresufer erreichten.
Es war ein langer und unerbittlicher Kampf. Der riesige Wal erhob sich fast aufrecht im Wasser, dräuend wie ein Kirchturm, und stieß zwei gewaltige Wasserfontänen aus, die nach und nach schwächer wurden und sich blutig färbten, bis sie als rosenfarbener Regen fielen und den nahen Sieg des kleineren der beiden Kombattanten verhießen. Der wendigere Schwertfisch verstand es in der Tat, den Wal zu attackieren, als besäße er die Gabe der Ubiquität, und stieß ihm seine Schwertspitze in die Seite, ohne dem Gegner Zeit zu lassen, sich zu wehren. Dann bäumte der Wal sich im Todeskampf auf und warf sich auf seinen Widersacher, den er wahrscheinlich erdrückte, denn dieser ward nicht wieder gesehen. Der Wal wiederum erstarrte nach einigen letzten Zuckungen und verschied, indem er ein lautes Heulen ausstieß, das auf merkwürdige Weise an den Schrei eines Menschen erinnerte.
61
Die Rückkehr (1)
Leconte de Lisle, der, wie es heißt, von der Académie Française als Kandidat in Betracht gezogen wird und der offenbar auf der Insel Bourbon, der Île de France oder in Indien gelebt hat, zeichnet uns in einer entzückenden Dichtung mit dem Titel »Le Manchi« das Bild einer jungen Frau, die in ihrer Sänfte spazieren getragen wird:
So kamst du aus den Bergen hinab zum Gottesdienst
Im sanften, milden Morgenlicht.
In deiner Jugendanmut Rosenduft,
Getragen von deinen Indern gemessenen Schritts.
Möge unser Leser sich nicht dazu versteigen zu glauben, der gemessene Schritt unserer Träger hätte das Geringste mit den Versen des Dichters gemein. Nichts ist weniger poetisch als ihre wilden Gesänge, nichts ist weniger melodisch als die Töne, in denen sie erklingen. Wenn der primitive Mensch eines in wenigen Worten ausgedrückten Gedankens und einer schlichten Melodie habhaft geworden ist, wiederholt er beides ohne Unterlass, und dies befriedigt seinen Geist und sein Ohr gleichermaßen. Hélènes und Janes Träger schöpften folglich keinerlei Inspiration aus der Schönheit der beiden Fremden und besangen nicht etwa die dunkleren Augen und Haare der einen oder die blonden Haare und blauen Augen der anderen, sondern begnügten sich mit einem Singsang, den ein Ausruf beendete, der nicht unähnlich dem Seufzer klang, mit dem der Bäcker sein Brot knetet:
Da Herrin geschafft
Bergauf … uff!!!
Wenn es bergab geht, müssen sie nur ein einziges Wort ändern, und sie singen:
Da Herrin geschafft
Bergab... uff!!!
Von Zeit zu Zeit wechselten die Ersatzträger mit den anderen Trägern den Platz; man setzte sich wieder in Bewegung, und der immer gleiche monotone und klagende Gesang ertönte, bis das Ziel erreicht war.
Es kommt vor, dass ein verliebter Dichter, der nach seiner Geliebten schmachtet, die gewohnten Grenzen des Liedes oder der Elegie zu sprengen versucht und den ersten vier Versen vier weitere hinzufügt. Ein anderer, in ähnlicher Gemütsverfassung, fügt abermals vier hinzu, ein dritter wiederum vier, und nach und nach wird aus dem Klagegesang des Ersten eine Dichtung, an deren Entstehung alle beteiligt sind, vergleichbar den homerischen Gesängen. Und das Gedicht erhält eine neue Bestimmung: Ob traurig oder fröhlich, wird es zu einem Tanzlied, das die Bamboula begleitet, den Cancan der Neger, der weniger Bein zeigt, aber aufreizender ist als unser Cancan.
Für gewöhnlich tanzen die Neger vor dem Tisch der Herrschaften, während diese speisen. An diesem Tisch befinden sich oft junge Mädchen, zwölf bis fünfzehn Jahre alt, was in den Kolonien einem Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren in Europa entspricht. Für diese jungen Mädchen sind die Tänze unterhaltsam, ein heiterer Anblick, der keinen tiefen Eindruck hinterlässt und die Phantasie nicht erhitzt.
Als nach der Rückkehr vom Lataniers-Fluss der letzte Gang der Mahlzeit aufgetragen wurde, war auch die Zeit für den Negertanz gekommen; eine Kapelle wurde zusammengestellt, um den Tisch wurde ein Kreis freigehalten, und jeder Neger verwandelte sich in einen Kerzenleuchter, indem er einen Krummholzzweig in die Hand nahm – einem Rebstock nicht unähnlich, und dieses Holz brennt umso besser, je grüner es ist -, anzündete und mit dieser Fackel die Tanzfläche von dreißig Fuß Umfang und zehn Fuß Durchmesser beleuchtete. Dann betrat eine Negerin die freie Fläche und begann folgendes naive, vielleicht ein wenig zu naive Lied zu singen:
Tanzt Callada,
Zizim, bumm, bumm;
Tanzt Bamboula,
Heissassa, ja!
Alle Neger und Negerinnen wiederholten den Refrain, den die Vorsängerin gesungen hatte, und wiegten sich dazu, als tanzten sie auf der Stelle, genau wie die Solistin auf der Tanzfläche. Diese sang nun:
Die Sonntag in die Stadt ich geh
Und suche nette Zeitvertreib
Und hübsche junge Mann ich seh
Macht schöne Aug und gute Zeit.
Alle wiederholten den Refrain:
Tanzt Callada,
Zizim, bumm, bumm;
Tanzt Bamboula,
Heissassa, ja!
Und daraufhin sprangen die Neger auf die Tanzfläche und tanzten.
Bald war das Gedränge so dicht, dass den Tänzern Einhalt geboten werden musste. Sie gehorchten, verließen die Tanzfläche, und auch die Sängerin reihte sich ein; auf die leere Tanzfläche trat nun Bambou, Surcoufs schwarzer Diener, und sang in dem kreolischen Dialekt von Martiniqe:
Zizim, tralala,
Zizim, tralala,
Zizim, tralala.
Freunde, tanzt die Bamboula.
Kein Arbeit nix, ich mir nix denk,
Kein Schufte nix, ich mir nix denk,
Wenn Strafe setzt, ich mir nix denk,
Mein Schatz sein Schmatz, ich gerne denk.
Obwohl Bambou im Dialekt der Insel Martinique gesungen hatte, verstanden die Neger der Île de France ihn ohne Schwierigkeiten und wiederholten den Refrain und tanzten dazu noch leidenschaftlicher als zuvor. Mehrmals hatte René, der die Wendungen verstand und auch die Gesten, die jungen Mädchen gefragt, ob sie sich nicht zurückziehen wollten, doch diese sahen in dem Singen und Tanzen nur ein unterhaltsames Spektakel und baten, bleiben zu dürfen. Als aber die Nacht hereinbrach, wurden auf einen Befehl Renés die Sänften für die Damen und die Pferde für die Herren gebracht, und das Zeichen zum Aufbruch wurde gegeben.
Und nun beendete ein Schauspiel, auf das niemand gefasst war, den herrlichen Tag und krönte ihn mit einer prachtvollen Prozession. Die zwei- bis dreihundert Neger, die wie Raubtiere durch den Geruch des frischen Fleischs angelockt worden waren und sich mit den üppigen Jagdüberschüssen versorgt hatten, wollten ihre Dankbarkeit bezeigen, indem sie ihre Gastgeber zurückgeleiteten.
Jeder von ihnen versah sich mit einem Zweig jenes Holzes, in dessen Schein die entlaufenen Negersklaven Paul und Virginie zur letzten Ruhe bringen, und in Begleitung dieses Fackelzugs machten die Reisenden sich auf den Rückweg nach Port Louis.
Es lässt sich kaum etwas Malerischeres denken als diese wandelnde Illumination, die auf ihrem Weg die herrlichsten Landschaften in ihr Licht tauchte, Landschaften, die sich ununterbrochen veränderten: Im einen Augenblick bot sich dem Auge eine mit dichten Baumgruppen bestückte Ebene, im nächsten ragte ein Berg empor, über dem man das Kreuz des Südens funkeln sah, und im wieder nächsten gaben Berge und Wälder unversehens den Blick auf die endlose Weite des Meeres frei, dessen unbewegte Oberfläche den silbrigen Schein des Mondes wie ein Spiegel zurückwarf. Das Licht der Fackelträger störte mannigfaltiges Wild auf, Hirsche, Wildschweine, Hasen, bei dessen Anblick Freudenrufe laut wurden und die Fackeln die Jagdbeute einzukreisen versuchten, woraufhin diese vor ihren Verfolgern ausriss, so dass deren Fackeln ein langes Band aus Feuer bildeten; wenn das Tier ihnen dann entkam, verstreuten sich die einzelnen Flammen und sammelten sich wieder zum Gefolge der Reisenden; doch am vielleicht bemerkenswertesten an diesem Rückweg war, dass er mitten durch den Wohnort der Malabaren führte. Die Île de France, Zuflucht für Menschen aus ganz Indien, besaß auch eine malabrische Bevölkerung; diese Flüchtlinge von der südöstlichen Küste Indiens, die an das arabische Meer grenzt, haben sich zu einem eigenen Stadtteil zusammengefunden, in dem sie unter sich leben und sterben, wenn man es so nennen will. In einigen Häusern brannte noch Licht, doch in allen Fenstern und Türöffnungen zeigten sich die schönen olivbraunen Gesichter der Frauen mit ihren großen schwarzen Augen und seidigen Haaren. Fast ausnahmslos waren die Frauen in lange Gewänder aus Leinen oder Batist gekleidet, goldene oder silberne Armringe an den Armen und Ringe an den Zehen, so dass man sie mit ihren ebenmäßigen Zügen und in ihren langen weißen Gewändern für ausgegrabene römische oder griechische Statuen hätte halten können.
Vom Viertel der Malabaren ging es zurück in die Rue de Paris und von dieser in die Rue du Gouvernement, wo der Hotelier des Hôtel des Étrangers seine Gäste vor der Tür mit allen Ehrenbezeigungen empfing.
Die zwei jungen Mädchen waren sichtlich ruhebedürftig, denn so sanft die Bewegung der Sänfte ist, ermüdet sie den, der daran nicht gewöhnt ist, beträchtlich. Hélène und Jane verabschiedeten sich daher alsbald von René, nicht ohne ihm für den herrlichen Tag zu danken, den er ihnen verschafft hatte. In ihrem Zimmer nahm Hélènes Gesicht wieder den melancholischen Ausdruck an, den sie bislang unterdrückt hatte, und in einem Ton des Kummers, nicht des Vorwurfs, sagte sie zu ihrer Schwester: »Jane! Jane, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir für unseren Vater beten.«
Jane schossen die Tränen aus den Augen, sie warf sich ihrer Schwester in die Arme, kniete dann neben ihrem Bett nieder, bekreuzigte sich und flüsterte: »O Vater, vergebt mir!«
Wovon sprachen diese Worte?
Zweifellos von einer neuen Empfindung, die in ihrem Herzen keimte und die im Verein mit ungewohnten Belustigungen und dem Ortswechsel die Erinnerung an ihren Vater überschattet hatte.
62
Die Runner of New York
Am nächsten Tag sprach René bei Surcouf vor, sobald es hell war; Surcouf lag noch im Bett, war aber schon wach.
»Mein lieber René«, sagte Surcouf, als René eintrat, »Sie laden uns zu einem Frühstück im Grünen ein und verwöhnen uns mit einem wahrhaft königlichen Festschmaus. Das Frühstück im Grünen hätte ich angenommen, aber ich muss Sie warnen, dass Bléas und ich übereingekommen sind, uns die Kosten für diesen Ausflug mit Ihnen zu teilen.«
»Verehrter Kommandant«, sagte René, »ich will Sie um einen Gefallen bitten, der mich verpflichten wird, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um Sie zufriedenzustellen.«
»Sprechen Sie, mein Lieber, und sofern die Sache nicht völlig unmöglich ist, sei Ihre Bitte Ihnen im Voraus gewährt.«
»Ich möchte Sie bitten, mich unter einem beliebigen Vorwand an die Küste von Pegu zu schicken. Sie sind auf der Île de France monatelang festgehalten, und ich bitte Sie um sechs Wochen Urlaub; danach werde ich mich Ihnen anschließen, wo immer Sie sich befinden mögen.«
»Ich verstehe«, sagte Surcouf und lachte. »Ich habe Sie zum Vormund der zwei hübschen Mädchen ernannt, deren Vater wir unbeabsichtigt getötet haben, und Sie wollen Ihre Vormundschaft mit größter Gründlichkeit erfüllen.«
»Was Sie sagen, ist so unwahr nicht, Monsieur Surcouf; doch als jemand, der in Ihren Gedanken mehr liest, als Ihre Worte sagen, will ich Ihnen verraten, dass mich nicht die Liebe zu dieser Fahrt veranlasst, zu der ich bereits entschlossen war, als ich dem Sklavenhändler sein Schiff abkaufte, vorausgesetzt, ich erhielte Ihre Erlaubnis. Ich weiß nicht, wie mein Geschick beschaffen ist, doch es würde mich verdrießen, der indischen Küste so nahe gewesen zu sein, ohne eine der famosen Tigeroder Elefantenjagden mitgemacht zu haben, die den Teilnehmern ein stärkeres Lebensgefühl vermitteln, weil sie dem Tod ins Auge geblickt haben. Und bei dieser Gelegenheit will ich die zwei Waisen nach Hause geleiten, denen ich eine Anteilnahme entgegenbringe, deren Grund ich niemals verraten werde. Sie denken an Liebe, verehrter Kommandant; ich zähle noch keine sechsundzwanzig Jahre, doch mein Herz ist so tot, als zählte ich ihrer achtzig. Ich bin dazu verurteilt, mir die Zeit zu vertreiben, mein lieber Surcouf. Und ich würde sie mir gern damit vertreiben, dass ich etwas Außergewöhnliches erlebe. Mein Herz, das keine Liebe empfinden kann, will ich mit anderen Empfindungen beleben; erlauben Sie mir, sie zu suchen, und helfen Sie mir, sie zu finden, indem Sie mich für eine Zeit von sechs Wochen bis zu zwei Monaten beurlauben.«
»Und wie wollen Sie fahren?«, fragte Surcouf. »Etwa mit Ihrer Nussschale?«
»Ja, ganz genau«, erwiderte René. »Sie wissen, dass ich das Schiff unter amerikanischer Flagge und mit amerikanischen Papieren gekauft habe. Mein Englisch ist so tadellos, dass kein Engländer oder Amerikaner es wagen würde, meine Herkunft aus London oder New York zu bezweifeln. Die Amerikaner sind mit aller Welt im Frieden. Ich fahre unter amerikanischer Flagge. Man wird mich meiner Wege ziehen lassen, und wenn nicht, dann werde ich mich ausweisen. Was sagen Sie dazu?«
»Und Sie wollen Ihre zwei schönen Begleiterinnen in einem Schiff fahren lassen, das eine Ladung Negersklaven befördert hat?«
»Verehrter Kommandant, in zwei Wochen werden Sie die Runner of New York nicht wiedererkennen; äußerlich wird sie sich nicht verändert haben bis auf einen neuen Anstrich; doch im Inneren wird sie sich dank der erlesenen Hölzer und der prachtvollen Stoffe, die ich gestern erstand, in ein wahres Kleinod verwandelt haben, vorausgesetzt, Sie gewähren mir den erbetenen Urlaub.«
»Ihr Urlaub«, erwiderte Surcouf, »war Ihnen gewährt, sobald Sie darum baten.«
»Dann bleibt mir nur noch, Sie um die Adresse des besten Schiffsausstatters zu bitten, den Sie in Port Louis kennen.«
»Ich werde mich für Sie verbürgen, junger Freund«, sagte Surcouf, »und sollten die Kosten höher ausfallen als von Ihnen kalkuliert, werde ich für die Differenz aufkommen, egal in welcher Höhe.«
»Für diesen neuen Freundschaftsdienst wäre ich Ihnen gerne zu Dank verpflichtet, verehrter Kommandant, doch allein mit der Adresse wäre ich schon zufrieden.«
»Ha, dann müssen Sie Millionär sein!«, rief Surcouf, der seine Neugier nicht länger zügeln konnte.
»Ein wenig mehr als das«, erwiderte René nonchalant, »und wenn Sie jetzt so freundlich wären, mir zu sagen, wann es Ihnen recht wäre, und falls Sie im Übrigen jemals meine Dienste in finanzieller Hinsicht benötigen sollten...«
»Darauf können Sie sich verlassen, und wäre es nur, um die Tiefe Ihrer Tasche auszuloten!«
»Nun gut«, sagte René, »wann wäre es Ihnen recht, verehrter Kommandant?«
»Sogleich, wenn Sie wollen«, erwiderte Surcouf und sprang aus dem Bett.
Zehn Minuten später gingen die zwei Gefährten die Hauptstraße hinunter, den Quai du Chien-de-Plomb entlang und betraten die Werkstatt des besten Schiffsbauers von Port Louis.
In Port Louis war Surcouf fast so bekannt wie in Saint-Malo.
»Oh!«, rief der Schiffsbauer. »Unser geschätzter Monsieur Surcouf!«
»Ja, Monsier Raimbaut, und ich bringe Ihnen einen guten Auftrag, wie mir scheint.«
Surcouf zeigte dem Schiffsbauer Renés Slup, die gegenüber von Trou-Fanfaron in den Wellen schaukelte.
»Monsieur«, sagte er, »das ist die Slup eines meiner Freunde, die es außen zu überholen und innen zu einem Schmuckstück umzubauen gilt; für diesen Auftrag dachte ich an Sie, und deshalb sind wir hier.«
Der Schiffsbauer dankte Surcouf, ging hinaus, sah zu dem Schiff hinüber, indem er sich die Augen mit der Hand schirmte, und sagte: »Das muss ich mir näher ansehen.«
»Nichts leichter als das«, erwiderte René. Und er rief einem Matrosen an Deck der Slup zu: »He da, auf der Slup! Schickt uns ein Boot herüber.«
Das Boot wurde zu Wasser gelassen, zwei Matrosen sprangen hinein und ruderten zu Surcouf; wenige Augenblicke später wurden die drei Männer zur Slup übergesetzt. Surcouf stieg als Erster aus, als befände er sich auf seinem eigenen Schiff, und René und der Schiffsbauer Monsieur Raimbaut folgten ihm.
Monsieur Raimbaut holte seinen Maßstab hervor, maß alles aus und fragte René, welche Veränderungen er wünsche. Zu verändern gab es nichts, nur zu verschönern: Die Aufteilung seiner Räume ergab zwei kleine Kammern vorschiffs nahe der Luke, ein Esszimmer und ein großes Schlafzimmer mit zwei Betten, welches das ganze Heck einnahm und sich ohne Weiteres in zwei Zimmer teilen ließ.
»Monsieur Raimbaut«, sagte René, »Sie werden mir diese Räume mit Teakholz vertäfeln; für die vorderen Räume mag Mahagoniholz genügen; das Esszimmer wünsche ich aus Ebenholz mit goldenen Intarsien und alle Verzierungen aus unvergoldetem Kupfer, damit sie jederzeit geputzt werden können. Veranschlagen Sie Ihre Kosten, Monsieur Surcouf wird den Preis mit Ihnen aushandeln; in zwei Wochen will ich mit dem Schiff in See stechen. Ich zahle Ihnen die Hälfte auf der Stelle und die zweite Hälfte beim Stapellauf.«
»Gevatter Raimbaut, schlagen Sie ein!«, sagte Surcouf.
»Wie soll ich das können? Die Arbeiten würden einen Monat in Anspruch nehmen.«
»Das interessiert mich nicht«, sagte René. »Ich brauche meine Slup in vierzehn Tagen, und was die Kosten betrifft, verlasse ich mich auf Ihre Rechnung und darauf, dass Sie mit Monsieur Surcouf das Schiff begutachten werden.«
Kaum hatten sie sich an Deck der Slup begeben, sahen sie auf Höhe der Standard eine Kutsche anhalten, der zwei junge Damen entstiegen; sie riefen ein Boot herbei und ließen sich zu Surcoufs Prisenschiff übersetzen.
»Nanu«, sagte Surcouf. »Wer sind die Damen, die uns zu so früher Stunde einen Besuch machen?«
»Erkennen Sie sie denn nicht?«, fragte René.
»Nein«, sagte Surcouf.
»Das sind die Damen Sainte-Hermine, die am Sarg ihres Vaters beten wollen; stören wir sie nicht in diesem frommen Tun; wenn sie wieder an Deck kommen, können wir sie begrüßen.«
Sie warteten einige Minuten; da die Schaluppe den Kai berührte, sprangen sie vom Schiff auf die Kaimauer, gingen zur Standard, bedeuteten dem Bootsführer, der die jungen Damen gefahren hatte, er solle sie später zurückbringen, und kletterten steuerbords das Fallreep hinauf.
Als sie an Deck ankamen, hörten sie den Hilferuf eines badenden Matrosen: »Hilfe, Kameraden, Hilfe! Ein Hai!«
Alle Blicke richteten sich auf den Badenden, der auf das Schiff zuschwamm und in dessen Kielwasser die Rückenflosse eines Hais zu sehen war, die immer näher kam.
»Nur Mut! Wir kommen!«, erscholl es von Deck, doch mit gebieterischer Geste unterbrach René das Stimmengewirr und rief: »Niemand rührt sich von der Stelle! Ich übernehme die volle Verantwortung!«
In diesem Moment kamen die Schwestern Sainte-Hermine wieder an Deck, durch das Geschrei neugierig gemacht; sie sahen, wie René die Hand zur Brust führte, um sich seines Dolchs zu vergewissern, den er an einer Silberkette umhängen hatte, wie er sich seiner Jacke und seiner Weste entledigte, sich auf die Reling schwang und mit dem Ruf: »Nur Mut, Kamerad, schwimm weiter!« ins Wasser sprang.
Jane erbleichte und stieß einen Schrei aus; Hélène musste sie fast tragen, bis sie die Poop erreichte, wo Surcouf ihr die Schwester abnahm.
Sie kamen gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie René an die Wasseroberfläche zurückkehrte, den Dolch zwischen den Zähnen; dann tauchte er wieder und kam diesmal zwischen Seemann und Hai zum Vorschein, keine drei Meter von dem Ungeheuer entfernt. Ein drittes Mal verschwand er im Wasser, in Richtung des Raubfischs, und plötzlich bäumte dieser sich auf und peitschte das Wasser mit seinem Schwanz wie unter schrecklichen Schmerzen; um ihn herum färbte sich alles blutig. Ein Freudenschrei stieg vom Schiffsdeck auf. René tauchte einen Meter hinter dem Hai wieder auf, doch nur um Luft zu holen; kaum war er untergetaucht, peitschte der Hai das Wasser nochmals mit seinem Schwanz, drehte sich in seinen Zuckungen auf den Rücken und enthüllte seinen weißen Bauch mit einem einen Meter langen klaffenden Schnitt.
Unterdessen hatten die Matrosen, ohne zu fragen oder Befehle abzuwarten, ein Boot zu Wasser gelassen und ruderten René entgegen, der seinen Dolch in die Scheide zurückgesteckt hatte und zum Schiff schwamm, ohne sich weiter um den Hai zu scheren, der sich vor Schmerzen wand und krümmte. Er traf auf das Boot, zwei Matrosen halfen ihm hinein, umarmten ihn herzlich, warfen ihre Mützen in die Luft und riefen: »Hoch lebe René!«
An Bord wiederholten alle den Hochruf, die Seeleute und sogar die zwei Mädchen, die mit ihren Taschentüchern winkten.
Der leichtsinnige Matrose, der sich gegen den Rat seiner Kameraden ins Wasser gewagt hatte, war an einem Tau, das man ihm zugeworfen hatte, an Bord zurückgeklettert.
Renés Ankunft an Deck der Standard kam einem Triumph gleich. Bis dahin hatte es unter seinen Kameraden vereinzelte Eifersüchteleien auf den reichen, schönen, gebildeten jungen Mann gegeben, dessen Überlegenheit sich bei jeder Gelegenheit bemerkbar machte, doch als sie gesehen hatten, wie er für einen armen Teufel sein Leben aufs Spiel setzte, war ihre Begeisterung grenzenlos, und die Eifersucht verwandelte sich in Bewunderung und Dankbarkeit.
René wiederum dämpfte den Freudentaumel nach Kräften und eilte zu der Poop, wo Hélène mit Tränen in den Augen die halb ohnmächtige Jane mit Riechsalz zu beleben versuchte, während Surcouf ihr die fühllosen Hände rieb.
Als René sich näherte, ergriff Jane seine Hand, küsste sie, stieß einen Schrei aus und verbarg ihr Gesicht an der Brust ihrer Schwester.
»Holla!«, sagte Surcouf staunend. »Entweder haben Sie den Teufel im Leib, oder Sie sind des Lebens überdrüssig, dass Sie ein Husarenstück nach dem anderen vollbringen!«
»Mein lieber Kommandant«, erwiderte René, »man hat mir erzählt, wenn ein Neger in Gondar von einem Hai angegriffen werde, tauche er unter das Tier und schlitze ihm mit einem Messer den Bauch auf; ich wollte mich vergewissern, ob das wahr sein kann.«
In diesem Moment stieg Monsieur Raimbaut, der den Auftrag nachgerechnet und als eingefleischter Kaufmann für nichts anderes Augen und Ohren gehabt hatte, zu ihnen hinauf und reichte René ein Blatt Papier.
René warf nur einen Blick auf die Endsumme, die achttausendfünfhundert Francs betrug, und hielt das Blatt Surcouf hin.
Während die zwei Schwestern und vor allem Jane René mit atemlosem Staunen betrachteten, examinierte Surcouf Monsieur Raimbauts Kalkulation mit größter Aufmerksamkeit.
Dann gab er René das Blatt zurück und sagte: »Wenn man fünfhundert Francs abzieht, ist der Betrag korrekt.«
»Aber«, fragte René, »wird die Slup auch in fünfzehn Tagen fertig sein?«
»Ich gebe Ihnen mein Wort«, sagte Monsieur Raimbaut.
»Geben Sie mir Ihren Bleistift, Monsieur«, sagte René.
Der Schiffsbaumeister reichte ihm seinen Bleistift. René schrieb unter die Kalkulation:
Bei Vorlegen dieses Papiers wird Monsieur Rondeau an Monsieur Raimbaut den Betrag von viertausend Francs auszahlen und bei Fertigstellung der Slup zwei Wochen darauf den Betrag von viertausendfünfhundert Francs.
Surcouf wollte ihn mit einer Geste unterbrechen, doch René schrieb unbeirrt weiter:
Die fünfhundert Francs sind als Belohnung unter den Arbeitern zu verteilen.
RENÉ,
Matrose an Bord der Standard
63
Der Vormund
Der Wagen brachte Kapitän Surcouf, den Matrosen René und die Schwestern zum Hôtel des Étrangers zurück. Zwei Stunden später klopfte der Hausdiener bei René und fragte, ob er die Demoiselles de Sainte-Hermine zu empfangen wünsche oder sie lieber aufsuchen wolle.
René war der Ansicht, es sei schicklicher, dass er sie aufsuchte und nicht sie zu ihm kamen.
Der Hausdiener ging zurück, von René gefolgt, den er ankündigte. Die beiden Schwestern empfingen ihn in sichtlicher Verlegenheit.
»Ich glaube«, sagte Hélène lächelnd, »es ist meine Aufgabe, als ältere Schwester das Wort zu ergreifen.«
»Mademoiselle, erlauben Sie, dass ich mich über die Feierlichkeit Ihrer Worte wundere.«
»Monsieur, Traurigkeit wäre vielleicht zutreffender als Feierlichkeit: Die Lage, in der sich zwei verwaiste Mädchen befinden, die dreitausend Meilen von ihrer Heimat entfernt mit dem Leichnam ihres Vaters unterwegs sind und noch die Kleinigkeit von tausend oder zwölfhundert Meilen vor sich haben, ist sicherlich alles andere als heiter, wie Sie zugeben werden.«
»Sie sind verwaist, gewiss«, sagte René. »Sie haben noch tausend Meilen zurückzulegen, auch das ist gewiss; doch Sie besitzen einen treuen und ehrerbietigen Bruder, der gelobt hat, über Sie zu wachen, und der sein Wort ohne Abstriche halten wird. Ich dachte sogar, wir wären übereingekommen, dass Sie sich um nichts mehr kümmern müssten und es mir überlassen würden, für Ihre Sicherheit zu sorgen.«
»Das haben Sie bis jetzt getan, Monsieur«, sagte Hélène, »aber wir dürfen die überwältigende Güte, die Sie uns bislang bezeigt haben, nicht länger ausnutzen.«
»Ich dachte, Sie erwiesen mir die Gunst, mich über Sie wachen zu lassen, bis wir Rangun erreichen, das heißt bis Sie Ihren Besitz betreten, und dementsprechend habe ich meine Vorkehrungen getroffen; doch wenn Sie es vorziehen, den Vormund abzulehnen, den Surcouf für Sie gewählt hat, verzichte ich jederzeit auf diesen ehrenvollen Titel. Es wäre mir eine Freude gewesen, wäre die Wahl auf mich gefallen, doch um keinen Preis wollte ich mich aufdrängen.«
»Oh, Monsieur René!«, rief Jane.
»Gewiss wäre es uns ein Vergnügen«, unterbrach ihre Schwester sie, »uns unter dem Schutz eines Mannes zu wissen, der so gütig wie großherzig und tapfer ist, doch es steht uns nicht zu, Ihre Ziele unserer alleinigen Bequemlichkeit zu opfern. Wir bitten Sie als Einziges, uns einem Kapitän anzuvertrauen, der zum Reich der Birmanen fährt und der uns an einem Küstenabschnitt absetzen kann, wo wir eine Eskorte mieten können, die uns zum Fluss Pegu bringt.«
»Wenn Ihnen dies tatsächlich lieber wäre als das, was ich Ihnen vorschlug, Mademoiselle, dann steht es mir nicht zu, Einwendungen zu erheben, sondern ich werde auf der Stelle, wenn auch mit größtem Bedauern, von dem Vorhaben Abstand nehmen, das ich hegte, seit wir uns kennenlernten, und das mir zwei Monate lang selige Tagträume beschert hat. Denken Sie nach; ich harre Ihrer Befehle und werde sie ausführen.«
René erhob sich, nahm seinen Hut und schickte sich an, sich von den Schwestern zu verabschieden.
Doch mit einer instinktiven, unüberlegten Bewegung warf Jane sich zwischen ihn und die Tür.
»Oh, Monsieur«, sagte sie, »Gott behüte, dass Sie uns für undankbar genug halten, alles, was Sie schon für uns getan haben und noch für uns tun wollen, nicht mit tiefstem Dank zu betrachten! Meine Schwester und ich erschrecken nur ein wenig, wenn wir bedenken, welch große Verpflichtung wir einem Fremden gegenüber eingehen.«
»Einem Fremden gegenüber!«, wiederholte René. »Mademoiselle, Sie sind grausamer als Ihre Schwester, denn sie hatte dieses Wort nicht auszusprechen gewagt.«
Jane sagte mit ruhigerer Stimme: »O weh, warum ist es nur so schwierig für ein Mädchen in meinem Alter, dem Vater oder Mutter immer das Denken abgenommen haben, zu sagen, was es denkt! Oh! Mag meine Schwester mich ruhig schelten, ich werde Sie nicht gehen lassen, solange Sie uns für so herzlos halten müssen.«
»Aber Jane«, sagte Hélène, »Monsieur weiß sehr wohl …«
»Nein, Hélène«, versetzte Jane, »nein, Monsieur weiß keineswegs; ich habe es nur zu deutlich an der Miene gesehen, mit der er sich erhoben hat, um sich von uns zu verabschieden, und an der Stimme gehört, mit der er angeboten hat, uns dem Schutz eines anderen zu überantworten.«
»Jane! Jane!«, sagte Hélène mahnend.
»Oh! Monsieur mag denken, was er will«, rief Jane, »solange er uns nicht für undankbar und kaltherzig hält!« Dann wandte sie sich an René und sagte flehend: »Nein, Monsieur, aus dem Mund meiner Schwester sprach die Schicklichkeit, doch aus meinem Mund werden Sie die Wahrheit vernehmen. Die Wahrheit sieht so aus: Meine Schwester fürchtet – und darüber haben wir uns schon des Öfteren den Kopf zerbrochen -, meine Schwester fürchtet, eine Abwesenheit von zwei Monaten oder länger könnte Ihnen zum Nachteil bei Monsieur Surcouf gereichen; sie fürchtet, Sie könnten durch Ihre Freundlichkeit Ihren eigenen Interessen schaden, und es wäre ihr lieber, dass wir unser ganzes Vermögen verlören, als dass Sie auf eine Beförderung verzichten müssten, die Sie so unstreitig verdient haben.«
»Lassen Sie mich zuerst diese Befürchtungen Mademoiselle Hélènes zerstreuen. Monsieur Surcouf hat mich selbst als Ihren Vormund vorgeschlagen, als mein Herz mich zu Ihrem Bruder erklärte; mit seiner Zustimmung habe ich die kleine Slup gekauft, die Sie nach Rangun bringen soll und auf der Sie keine der Gefahren zu gewärtigen hätten, die Ihnen auf der Standard drohen könnten, da die Slup unter neutraler Flagge fährt. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, dass Monsieur Surcouf heute Morgen den Preis der Verschönerungen festgesetzt hat, die ich daran vornehmen lassen will. Auf keinem anderen Schiff, welcher Größe auch immer, wären Sie so behaglich untergebracht wie auf der Runner of New York.«
»Aber Monsieur«, wagte Hélène schüchtern einzuwenden, »dürfen wir zulassen, dass Sie acht- oder zehntausend Francs ausgeben, was Sie andernfalls niemals getan hätten, nur damit es uns an keiner Bequemlichkeit mangelt?«
»Sie täuschen sich, meine Damen«, widersprach René. »Nicht Sie reisen nach Indien, sondern ich. Die Île de France oder die Insel Réunion zu besuchen, ist nicht Indien besuchen. Ich bin leidenschaftlicher Jäger; ich habe gelobt, auf Pantherjagd zu gehen, auf Tigerjagd und auf Elefantenjagd, und ich will mein Wort halten, weiter nichts. Mein Angebot, Sie zu Ihren Besitzungen zu bringen, können Sie annehmen oder ablehnen, doch das ändert nichts daran, dass ich nach Indien fahren werde. Man hat mir glaubhaft versichert, dass die Ufer des Flusses Pegu von einem Wildreichtum ohnegleichen im ganzen Königreich Birma sind. Und nicht zuletzt harrt Ihrer, teure Schwestern, nach der Ankunft eine letzte und schmerzliche Pflicht. Bisher hatten Sie mir diese fromme Pflicht anvertraut; wollen Sie mir nicht den traurigen Liebesdienst erweisen, mich zu Ende bringen zu lassen, was ich begonnen habe, statt uns unversehens so schroff zu trennen und mir für den Rest meines Lebens eine Erinnerung vorzuenthalten, die mir besonders teuer sein würde?«
Unterdessen sprachen Janes gefaltete Hände und tränenvolle Augen eine noch beredtere Sprache, bis Hélène zu guter Letzt nachgab und René die Hand reichte, woraufhin Jane sich Hélènes Hand bemächtigte und sie mit Küssen bedeckte.
»Jane! Jane!«, sagte Hélène leise.
Jane senkte den Blick und sank auf ihren Stuhl.
»So aufrichtige Freundschaftsangebote länger abzuweisen, wäre schändlich«, sagte Hélène, »und deshalb nehmen wir sie dankbar an und versprechen, uns ein Leben lang Ihres brüderlichen Schutzes zu entsinnen.«
Hélène erhob sich und neigte den Kopf vor René, womit sie andeutete, dass sein Besuch lange genug gedauert habe.
René verbeugte sich, salutierte und ging.
Von diesem Augenblick an hatte René nur noch eines im Sinn: die Runner of New York so schnell wie möglich segelfertig zu sehen. Im Tausch gegen ihre alten gusseisernen Kanonen bot Surcouf René fünf Kupferkanonen von der Standard an.
Fünfzehn Mann genügten als Besatzung für die Slup, und die Mannschaften der Standard und der Revenant boten – selbstverständlich mit Surcoufs Erlaubnis – von sich aus an, auf Renés Runner of New York Dienst zu tun.
Unglücklicherweise konnte man die Mannschaft eines amerikanischen Schiffs nicht gut aus Franzosen zusammensetzen; René heuerte zehn Amerikaner an und wählte aus Surcoufs zwei Mannschaften fünf Männer aus, die Englisch sprachen. Surcouf gab ihm obendrein als Lotsen seinen Quartiermeister Kernoch mit, der schon zweimal an der Mündung des Ganges gewesen war und sich dort auskannte; die Matrosen, die René zum Zeichen ihres Danks für seine Großzügigkeit bei der Abreise aus Saint-Malo und für seine Tapferkeit als Lebensretter ein Geschenk machen wollten, fanden bei dem besten Waffenschmied von Port Louis ein englisches Gewehr mit gezogenem Lauf; da sie wussten, dass René auf Tiger- und Pantherjagd gehen wollte und nur einen Stutzen und ein gewöhnliches Gewehr besaß, legten sie zusammen und kauften das englische Gewehr, das sie ihm am Tag vor seiner Abreise überbrachten.
Auf den Gewehrlauf hatten sie eingravieren lassen: »Von den Matrosen Surcoufs ihrem tapferen Kameraden René verehrt.«
Kein Geschenk hätte dem jungen Seemann eine größere Freude machen können! Wiederholt hatte er sich darüber geärgert, dass er nicht rechtzeitig daran gedacht hatte, genug Waffen mitzunehmen, und nun, als er im Begriff stand, die Île de France zu verlassen, kam das Jagdgewehr wie ein Geschenk des Himmels sowohl für seinen Waffenschrank als auch zur Befriedigung seiner Eitelkeit.
Am vereinbarten Tag übergab Monsieur Raimbaut René die mit ausgesuchtem Geschmack eingerichtete Slup. Die Hölzer von der Île de France sind so erlesen, dass es neben ihnen keines weiteren Schmucks bedarf. Die Kajüten der zwei jungen Damen, deren Möblierung René persönlich ausgewählt hatte, waren die reinsten Wunderwerke an Geschmack und Eleganz; die Schwestern hatten sich um nichts kümmern müssen; der Sarg ihres Vaters war von der Standard auf die Runner of New York gebracht und in eine kleine, schwarz ausgekleidete Kapelle gestellt worden. Erst danach suchte René Hélène und Jane auf und teilte ihnen mit, dass er nur auf ihre Anweisung warte, um die Segel zu setzen. Die Schwestern waren zum Aufbruch bereit; sie bestellten eine feierliche Totenmesse, nach der man an Bord der Runner of New York zu Mittag speisen wollte, bevor man in See stach. Am nächsten Tag betraten Hélène und Jane in Begleitung Surcoufs um zehn Uhr vormittags die Kirche, und da bekannt war, dass die Seelenmesse für einen französischen Kapitän gelesen wurde, nahmen alle hochrangigen Persönlichkeiten der Île de France, alle Kapitäne, Offiziere und alle Matrosen der in Port Louis ankernden Schiffe an dem Gottesdienst teil, der ein eher militärisches als ziviles Gepräge hatte.
Nach einer Stunde gingen die jungen Mädchen, weiterhin von Surcouf und René begleitet, zu Fuß zum Hafen.
Im Namen der jungen Damen hatte René Surcouf, Bléas und Kernoch zum Mittagessen eingeladen. Alle Schiffe im Hafen waren beflaggt wie an einem Feiertag, und die Runner of New York, das kleinste und eleganteste unter all diesen Schiffen, hatte an ihrem einzigen Mast, an ihren zwei Rahen und an ihrem Bugspriet sämtliche Wimpel gesetzt, die sie an Bord hatte. Es wurde eine traurige Mahlzeit, obwohl jedermann sich bemühte, heiter zu sein, und obwohl auf Befehl des Generals Decaen, des Gouverneurs der Insel, die Garnisonskapelle auf dem Kai alle Nationalhymnen spielte.
Dann ging ein Beben durch die Runner of New York; die Schaluppen der Standard und der Revenant schleppten sie zur Hafeneinfahrt als letzten Dienst, den die Seeleute ihrem Kameraden erwiesen; Schaluppen und Schiff folgten dem gewundenen Verlauf des Hafens, und die Zuschauer folgten ihnen auf dem Kai, so weit er reichte.
Nach etwa tausend Schritt machten die Schaluppen halt. Die Slup war segelfertig. Während die Taue eingeholt wurden, leerten die Matrosen der Schaluppen ein letztes Glas auf die Runner of New York und ihren Kapitän und riefen: »Auf eine glückliche Reise für Kapitän René und die Demoiselles de Sainte-Hermine!«
Das Schiff fuhr an der Baie de la Tombe entlang und verschwand hinter der Pointe aux Canonniers.
Und bald war von seinem Kielwasser keine Spur mehr zu sehen.
64
Die malaiischen Piraten
Nach sechs Tagen guter Fahrt, während deren kein einziges Schiff gesichtet worden war, überquerte man abermals den Äquator. Das Einzige, worunter die schönen Damen auf der Reise zu leiden hatten, war die unerträgliche Hitze im Schiffsinneren. René hatte jedoch in der Kajüte seiner Passagierinnen zwei Badewannen unterbringen lassen, und dank dieser Maßnahme konnten sie die heißesten Stunden des Tages glimpflich überstehen.
Abends stiegen sie an Deck; der Wind frischte auf, und der unerbittlichen Sonnenglut des Tages folgte ein kühler und köstlicher Abendwind voller Meeresdüfte. Dann wurde an Deck gespeist, und dank der Geschicklichkeit, mit der man sich frischen Fisch verschaffte, und der unerschöpflichen Fülle an Lebensmitteln, die auf den Seychellen und den Malediven an Bord genommen wurden, fand man sich so gut versorgt, wie man es zu Lande gewesen wäre.
Dann setzten die herrlichen Schauspiele des abendlichen und nächtlichen Himmels in diesen sengend heißen Breiten ein. Auf dem Indischen Ozean sind die Sonnenuntergänge von unvergleichlicher Pracht. Kaum ist die Sonne im Meer verschwunden, scheint sie als Staub wiederzukommen und sich wie goldener Sand über die blaue Weite des Himmels zu verteilen.
Als Nächstes fesselt das Meer den Blick und bietet ein Schauspiel, das kaum minder faszinierend ist als die übrige Schöpfung.
Der Aufenthalt mitten auf dem Ozean ist weit weniger eintönig, als im Allgemeinen angenommen wird; hat man sich daran gewöhnt, ins Wasser zu blicken, entdeckt man eine Vielzahl an Wunderdingen, die dem ungewohnten Auge verborgen bleiben; das Studium der unzähligen Lebewesen, von denen es im Meer wimmelt und die bisweilen bis zur Oberfläche aufsteigen, ihre staunenswerte Menge, die Vielfalt ihrer Formen, ihrer Farben, ihres Gesellschaftswesens und ihrer Gepflogenheiten bieten dem Reisenden ein weites Feld der Beobachtung und der Forschung.
Bislang war man mit sanftem Wind gefahren, doch gegen acht Uhr abends, bei hellem und hohem Mond, klarem und heiterem Himmel stiegen am Horizont mit einem Mal Wolken auf, die bald in höhere atmosphärische Schichten gelangten. Nun bot der Himmel den Anblick eines finsteren und tiefen Steinbruchs: Furchterregende Wolken verdeckten den Mond, der sich vergebens gegen sie zu behaupten suchte; bisweilen riss ein Stück des dunklen Schleiers auf und ließ Mondstrahlen hindurchdringen, die sogleich erstickt wurden; andere, grünspanfarbene Wolken wurden von Blitzen durchzuckt; einzelne dicke Regentropfen klatschten auf das Schiff; in der Ferne war Donnergrollen zu vernehmen; dichte Wolken ballten sich am Himmel; die Finsternis wurde undurchdringlich, der Wind heulte und tobte, die Dunkelheit ließ sich geradezu greifen, und das Schiff durchpflügte das Wasser schneller als je zuvor.
Auf einmal lag vor dem Schiff eine breite silberne Schärpe auf dem Meer ausgebreitet; sobald die Stelle erreicht wurde, sah man zahllose Wasserwesen, insbesondere Quallen, auf den Wellen schaukeln; andere Medusen in tieferen Meeresschichten waren nicht nur anders, sondern entgegengesetzt geformt; an der Wasseroberfläche drehten sie sich wie Zylinder aus Feuer, weiter unten wanden sie sich als Schlangen von fünf bis sechs Fuß Länge; bei jedem Zusammenziehen und Ausdehnen sprühten Lichtbündel auf, und das ganze Tier schien in Flammen zu stehen; nach und nach jedoch verloren sie ihr phosphoreszierendes Leuchten und nahmen rötliche, rosige, orangegelbe, grünliche und bläuliche Färbung an, bis sie eine herrliche Seegrasfarbe zeigten. René sah, mit welcher Neugier seine Freundinnen das Schauspiel verfolgten, und es gelang ihm, mehrere Medusen zu fischen, die er in ein Gefäß mit Meerwasser gab; eine einzige Qualle strahlte so hell, dass man in ihrem Licht fast einen ganzen Abend hindurch schreiben und lesen konnte.
Jeden Abend betrachtete René von der Poop oder vom Fenster der Kajüte der Damen aus stundenlang diese goldenen und silbernen Wogen, die sich in alle Richtungen im Meer bewegten. Sie schimmerten umso heller, je aufgewühlter das Meer und je dunkler die Nacht war, und bisweilen sah man dann Mollusken von unvorstellbaren Ausmaßen, manche darunter von fünfzehn oder zwanzig Fuß Durchmesser.
Im Lichtschein dieses schwimmenden Meerleuchtens waren verschiedenste andere Meerestiere zu sehen, vor allem Meerbrassen und Bonitos, die keine Leuchtkraft besaßen und als dunkle Massen in dem brennenden Meer schwammen. Das Kielwasser des Schiffs bildete ebenfalls eine feurige Spur. Die Slup schien nicht länger die Wassermassen zu teilen, die sie durchquerte, sondern sich wie ein Pflug in einen Boden aus glühender Lava zu versenken, aus dem bei jedem Einschnitt Feuergarben hochsprühten.
Nach elftägiger Fahrt war man auf Höhe der Malediven angekommen, als der Mann im Ausguck bei schwachem südöstlichem Wind rief: »Obacht, eine Piroge!« Auf diesen Ruf eilte Kernoch an Deck, wo René mit einem Fernglas in der Hand hin- und herging.
»Und wo?«, wollte Kernoch wissen.
»In Lee; sie hält auf uns zu.«
»Mit Ausleger oder ohne?«
»Mit.«
»Alles bereit?«, fragte Kernoch, an den Waffenmeister gewandt.
»Ja, mein Kommandant«, erwiderte dieser.
»Sind die Kanonen geladen?«
»Ja, mein Kommandant, drei mit Kugeln und drei mit Kartätschenladung.«
»Und die Jagdkanone?«
»Der Kanonier erwartet Ihre Befehle.«
»Ein Drittel mehr als die gewöhnliche Ladung und achtzig Pfund Kugeln. Lassen Sie die Gewehre an Deck bringen.«
»Ho, ho, Meister Kernoch«, sagte René, »welche Laus ist Ihnen über die Leber gelaufen?«
»Monsieur René, würden Sie mir Ihr Fernglas ausleihen?«
»Jederzeit«, sagte René und reichte es ihm, »es ist ein ausgezeichnetes englisches Glas.«
Kernoch richtete es auf die Piroge.
»Meiner Treu, dachte ich es mir doch!«, rief er. »Sie ist mit sieben oder acht Schurken bemannt.«
»Und so ein Spielzeug macht Ihnen Sorgen, Kernoch?«
»Nicht unbedingt; aber wenn ich den Pilotfisch sehe, dann macht mir nicht der Pilotfisch Sorgen, sondern der Hai.«
»Und zu welchem Hai gehört dieser Pilotfisch?«
»Zu irgendeiner Eingeborenen-Perahu, die sicher nichts dagegen hätte, sich ein hübsches Schiff wie die Runner of New York unter den Nagel zu reißen und unsere schönen Passagierinnen zu nötigen, mehrere tausend Rupien Lösegeld zu bezahlen.«
»Nun«, sagte René, »mich dünkt wahrhaftig, dass die Piroge Kurs auf uns nimmt.«
»Da täuschen Sie sich nicht.«
»Was hat sie vor?«
»Sie will uns auskundschaften, unsere Kanonen zählen, herausfinden, wie viel Mann wir sind, und feststellen, ob wir leicht oder schwer zu verdauen sind.«
»Teufel auch! Aber sehen Sie, dass sie in fünf Minuten in Gefechtsdistanz angekommen sein wird?«
»So ist es, und ich denke, Sie sollten keine Zeit mehr verlieren, sondern die Gewehre holen lassen, wenn Sie ihr einen Gruß schicken wollen.«
René rief einen Matrosen herbei, der als ziviler Matrose diente und den jedermann an Bord den Pariser nannte.
Als typisches Pariser Kind war er für alles zu gebrauchen, er hatte von allem ein bisschen Ahnung und fürchtete sich vor nichts; er tanzte die Gigue, dass sich sogar die Amerikaner totlachten, schlenkerte beim Tanzen mit den Beinen und konnte notfalls das Florett führen.
»François«, sagte René zu ihm, »holen Sie aus meiner Kajüte meinen Stutzen, mein zweiläufiges Gewehr und meine Pistolen, und bringen Sie Pulver und Kugeln mit.«
»Kommt es zu einem Wortwechsel mit den Rußkäfern, mein Kommandant?«, fragte François.
»Ich befürchte es«, sagte René. »Als Pariser bist du mit allen Sprachen vertraut; sprichst du zufällig auch Malaiisch?«
»Nicht die Bohne.«
Er stieg die Luke hinunter und pfiff unterwegs Veillons au salut de l’Empire.
François war glühender Bonapartist und litt unter der Demütigung, mit »Engländern« zusammen zu dienen; er hatte eine Erklärung verlangt, sein Kommandant hatte ihm mitgeteilt, dass ihn das nichts angehe, und das hatte er hingenommen. Fünf Minuten später kam er mit den gewünschten Waffen zurück; da die Piroge stetig und geschwind näher kam, machte René sich sofort daran, seinen Stutzen zu laden; das Gewehr mit gezogenem Lauf und die Pistolen waren bereits mit Kugeln versehen.
Der Stutzen, eine herrliche, von Lepage gefertigte Waffe, war von einer für jene Tage sagenhaften Schussweite: Auf sieben- bis achthundert Schritt konnte man einen Menschen tödlich treffen.
René steckte sich die Pistolen in den Gürtel, ergriff den Stutzen und gab das Gewehr François.
Die Piroge näherte sich noch immer; sie befand sich keine zweihundert Schritt vom Heck der Runner entfernt.
René ließ sich von Kernoch das Sprachrohr geben. »Heda!«, rief er auf Englisch. »Geben Sie sich zu erkennen! Hier ist die Runner of New York.«
Die Antwort bestand darin, dass ein Mann in der Piroge die Reling erkletterte und eine unanständige Gebärde machte.
René senkte den Lauf seines Stutzens, legte das Gewehr an und feuerte, fast ohne zu zielen.
Der Mann bäumte sich auf und stürzte ins Meer.
Die Besatzung der Piroge stieß Zornesrufe und Drohungen aus.
»Kernoch«, sagte René, »kennen Sie Romulus?«
»Nein, Monsieur René. Stammt er aus Saint-Malo?«
»Nein, mein lieber Kernoch, aber er war dennoch ein großer Mann, und wie alle großen Männer neigte er zu unüberlegten Handlungen. In einer Zornesanwandlung hat er seinen eigenen Bruder erschlagen. Da es ein großes Verbrechen ist, seinen Bruder zu erschlagen, und so ein Verbrechen nicht ungesühnt bleibt, brach eines Tages, als er eine Truppenparade abnahm, ein gewaltiger Sturm aus, und in diesem Sturm verschwand er! … Lassen Sie sich nicht lange bitten, zielen Sie mit der Jagdkanone, und lassen Sie die Piroge so spurlos verschwinden wie Romulus.«
»Kanoniere an der Jagdkanone«, rief Kernoch, »seid ihr bereit?«
»Ja«, erwiderten sie.
»Wohlan, dann feuert, sobald die Piroge in Sicht kommt!«
»Wartet!«, rief René. »François, sagen Sie den Damen, dass sie sich nicht ängstigen sollen; sagen Sie ihnen, dass wir nur unsere Kanonen ausprobieren.«
François verschwand in der Luke und war eine Minute später wieder da.
»Sie sagen, es sei recht so, und bei Ihnen, Monsieur René, würden sie sich nie ängstigen.«
Das Vierundzwanzigergeschütz, das beweglich war, hatte die Piroge verfolgt und auf kaum zweihundert Schritt Entfernung gefeuert.
Man hätte meinen können, Renés Befehl sei aufs Wort befolgt worden: Von der Piroge war nichts mehr zu sehen als Treibgut und Menschen im Todeskampf, die einer nach dem anderen von den Haien in die Tiefe gezogen wurden.
Im selben Augenblick rief der Mann im Ausguck: »Die Perahu!«
»Und wo?«, fragte Kernoch.
»Luvwärts.«
In der Tat sah man eine riesige Perahu von sechzig Fuß Länge wie eine Schlange herangleiten: Dreißig Ruderer und vierzig bis fünfzig Kämpfer waren zu sehen, und zweifellos lagen noch viele mehr auf dem Bauch versteckt.
Sobald die Perahu die Meerenge verlassen hatte, nahm sie Kurs auf die Slup.
»Seid ihr bereit?«, fragte René die Kanoniere.
»Wir erwarten Ihre Befehle, Kommandant«, erwiderte der Oberkanonier.
»Ein Drittel mehr Kartätschenladung und Achtzig-Pfund-Kugeln.«
Und da Wind aufkam, was das Manöver erleichterte, sagte Kernoch: »Haltet euch bereit zu wenden, wenn ich es befehle.«
»Gleicher Kurs?«, fragte der Rudergänger.
»Ja, aber langsamer, damit es nicht aussieht, als wollten wir vor einem so erbärmlichen Gegner die Flucht ergreifen.«
Segel wurden gerefft, und die Slup verlangsamte ihre Fahrt.
»Sind Sie bereit zu wenden?«, rief Kernoch dem Rudergänger zu.
»Wie ein Kreisel wird sie wenden, mein Kommandant, seien Sie unbesorgt.«
Inzwischen waren die einzelnen Personen auf der Perahu zu erkennen. Ihr Anführer stand auf dem nach innen gebogenen Bug und fuchtelte drohend mit seinem Gewehr.
»Wollen Sie ihm nicht das Maul stopfen, Monsieur René?«, fragte Kernoch. »Das Herumgehampel dieses Burschen geht mir ganz entsetzlich auf die Nerven.«
»Lassen Sie ihn noch ein wenig näher kommen, lieber Freund; wir wollen uns nicht vor ihm blamieren. Bei diesen Burschen muss jeder Schuss sitzen. François, lassen Sie Piken an Deck bringen, damit wir das Entern abwehren können.«
François stieg die Luke hinunter und kam mit zwei Matrosen wieder, welche die Arme voller Piken hatten. Sie wurden steuerbords verteilt, denn dort würden die Piraten zu entern versuchen.
»Schicken Sie zwei Mann mit Musketen in den Mastkorb, lieber Kernoch«, sagte René.
Der Befehl wurde sofort ausgeführt.
»Kernoch«, sagte René, »sehen Sie nur, was für Kapriolen unser Mann jetzt vollführen wird.« Und er schoss mit seinem Stutzen.
Der Mann am Bug der Perahu breitete die Arme aus, ließ sein Gewehr fallen und stürzte rückwärts nieder. Die Kugel hatte ihn in die Brust getroffen.
»Bravo, mein lieber Monsieur René; und ich werde ihnen jetzt eine Überraschung bereiten, auf die sie ganz gewiss nicht gefasst sind.«
René reichte den Stutzen François zum Laden.
Kernoch sagte leise etwas zu den zwei stärksten Männern der Mannschaft, und laut rief er dem Steuermann zu: »Bereit zum Wenden!« Dann verließ er schnell seine Wachtbank, um mit dem Oberkanonier zu sprechen.
»Passen Sie gut auf, Valter«, sagte er zu ihm, »wir vollführen jetzt eine ganze Wende.«
»Jawohl, Kommandant.«
»Für einen Augenblick wird Ihr Geschütz die Perahu von vorne bis hinten im Visier haben: Diesen Augenblick müssen Sie nutzen. Er wird nur eine Sekunde dauern, aber in dieser Sekunde müssen Sie feuern.«
»Oho, ich verstehe«, sagte der Richtkanonier. »Ha! Monsieur Kernoch, Sie sind mir ein rechter Spaßvogel!«
Ein neuer Mann hatte sich am Bug der Perahu aufgerichtet, und ein erneuter Schuss schickte ihn in die Tiefen des Meeres. Unterdessen führte die Slup ihr Manöver aus.
Und dann ertönte eine Salve, und an Bord der Perahu sanken die Männer von vorne bis hinten nieder wie geschnittene Ähren.
»Bravo!«, sagte René, und auf Englisch rief er: »Heda! – Mein lieber Kernoch«, fügte er hinzu, »noch so eine Salve, und der Wortwechsel dürfte beendet sein.«
An Bord der Perahu herrschte blankes Entsetzen. Mehr als dreißig Tote lagen auf dem Schiffsboden, und ihre Kameraden waren damit beschäftigt, die Toten über Bord zu werfen und sich gefechtsbereit zu machen, so gut es ging.
Wenige Minuten später prasselte eine Ladung Kugeln und Pfeile auf die Slup ein, ohne großen Schaden anzurichten. Etwa zwanzig Ruderer legten wieder los, und die Perahu kam näher.
Unterdessen hatte Kernoch seine Überraschung für die Malaien vorbereitet, ein Abtakelungsgeschoss aus vier Kettenkugeln, das in einem Netz steuerbords am äußersten Ende der Fockrah angebracht war.
Die Perahu befand sich nunmehr etwa hundert Schritte von der Slup entfernt, und zwar im rechten Winkel zu ihr.
»Steuerbord Feuer!«, rief Kernoch.
Die drei Sechzehnergeschütze schossen ihre Kartätschenladungen ab und rissen drei klaffende Lücken in die Reihen der Ruderer und der überlebenden Piraten.
Kernoch beschloss, die Sache zu beenden, und rief dem Untersteuermann zu: »Kommen lassen.«
Die Entfernung zwischen den Schiffen verringerte sich zusehends unter ohrenbetäubendem Musketenfeuer; dann war ein Pfeifton zu vernehmen, und die Kettenkugeln in ihrem Netz krachten auf die Perahu und zertrümmerten sie, als brächen sie einem Kaiman das Rückgrat. Vierzig bis fünfzig Überlebende zappelten im Meer und suchten die Rettung, indem sie sich an allem festhielten, was sie erreichen konnten.
Und nun begann der eigentliche Kampf, der schreckliche, erbitterte Kampf von Mann zu Mann. Die Piken stießen immer wieder in das Wasser, das sich um die Slup mehr und mehr rötete.
Mitten in dem Getümmel war es René, als höre er auf einmal Frauenschreie. Tatsächlich kamen Jane und Hélène an Deck gestürzt, bleich, in Todesangst, mit aufgelösten Haaren.
Zwei Malaien hatten das Kajütenfenster eingeschlagen, waren in die Kajüte gesprungen und verfolgten die Mädchen mit gezücktem Dolch.
Jane warf sich René in die Arme und rief: »Retten Sie mich, René, retten Sie mich!«
Sie hatte kaum ausgesprochen, als die zwei Piraten tödlich getroffen zu Boden sanken, der eine an Deck, der andere in der Luke.
René übergab Jane ihrer Schwester und richtete die verbliebenen zwei Schüsse seiner Pistole auf zwei Köpfe, die über der Reling auftauchten; dann ergriff er eine Pike, forderte François auf, sich um die zwei Schwestern zu kümmern, und stürzte sich wieder in das Schlachtgetümmel.
65
Die Ankunft
Der Kampf hatte sein Ende erreicht. Von den fast hundert Piraten, welche die Slup überfallen hatten, waren nur wenige am Leben geblieben; fast ausnahmslos verwundet, erwarteten sie Gnadenschuss oder Gnadenstoß. Danach würde das Meer das Werk des Feuers vollenden.
»Alle Segel setzen!«, rief Kernoch. »Und Kurs nach Norden.«
Die Windfahne wurde gehisst, und das Schiff flog in die Richtung, die ihm der Kompass wies, so gehorsam wie ein Pferd, dem man die Sporen gibt.
Die letzten Überlebenden klammerten sich an die Trümmer der Perahu oder streckten vergebens den Arm danach aus und wurden von den Haien zerrissen. Bis zur Küste waren es noch mehr als zweihundert Meilen.
Kernoch war der Held des Tages. Seinem Einfall war es zu verdanken, dass die Perahu zerschmettert worden und ihre Besatzung im Meer verstreut worden war. Denn wer weiß, was mit der Runner of New York geschehen wäre, wenn die sechzig Piraten Gelegenheit gefunden hätten, sie zu entern.
René kehrte zu den Schwestern zurück, die auf den Stufen zur Poop saßen. Mit seinen im Wind flatternden Haaren und seinem von Dolchstößen zerfetzten Hemd war er schön wie ein homerischer Held, als er sich auf seine blutige Pike stützte. Bei seinem Anblick stieß Jane einen mit Bewunderung gemischten Freudenruf aus. Sie streckte ihm die Arme entgegen und rief: »Zum zweiten Mal haben Sie uns das Leben gerettet!«
Doch statt diese naive Avance mit einer Umarmung und einem Kuss zu erwidern, nahm René nur ihre Hand und drückte sie an seine Lippen.
Hélène sah ihn an; ihr Blick verriet, wie dankbar sie ihm für seine ritterliche Zurückhaltung war. »Meine Dankbarkeit«, sagte sie, »ist zwar weniger exaltiert als die meiner Schwester, aber darum nicht geringer, glauben Sie mir. Gott ist sogar in dem Schmerz, den er uns zufügt, voller Güte: Er nimmt uns unseren Vater und gibt uns dafür einen Bruder, einen Beschützer, einen Freund, einen Mann, der – wie soll ich es sagen – unserer Dankbarkeit Grenzen setzt, sobald sie ihm zu groß erscheint. Was hätten wir ohne Sie anfangen sollen, Monsieur?«
»Ein anderer wäre an meiner Stelle gewesen«, erwiderte René. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich Ihrer nicht erbarmt hätte. In Ermangelung meiner Person wäre ein Engel vom Himmel herabgestiegen, um Ihnen als Beschützer zu dienen.«
Unterdessen hatte François Renés Waffen aufgesammelt und brachte sie ihm.
»François, bringen Sie das alles in meine Kajüte«, sagte René. »Zum Glück müssen wir uns dieser elenden Vernichtungswaffen jetzt nicht mehr bedienen.«
»Sachte, sachte, Monsieur«, sagte der Pariser, »rümpfen Sie nicht die Nase über Ihre Waffen: Wenn Sie sie handhaben, machen Sie keine halben Sachen. Sehen Sie nur die zwei Burschen, die gerade ins Wasser geworfen wurden« – und er deutete auf die beiden Malaien, die in die Kajüte der Mädchen eingedrungen waren und sie bis an Deck verfolgt hatten – »die können ein Lied davon singen.«
»Beeilt euch, Leute«, rief René den Matrosen zu, die das Deck scheuerten. »Beeilt euch, und dass kein Tropfen Blut an Deck übrig bleibt! Kapitän Kernoch erlaubt, dass ich euch drei Flaschen Arrak ausgebe, die ihr auf sein Wohl und das der Damen leeren könnt, und dass ich euch dreifachen Sold für den heutigen Tag bezahle. Kommen Sie, meine Damen, steigen wir auf die Poop oder gehen wir in Ihre Kajüte, doch mir scheint, zuerst sollte unser Zimmermann in Ihrer Kajüte nach dem Rechten sehen. An Ihrer Stelle würde ich mich auf das Oberdeck begeben. Oder nehmen Sie mit meiner Kajüte vorlieb, bis die Ihre wieder bezugsfertig sein wird.«
»Steigen wir auf die Poop«, sagte Hélène.
Sie stiegen hinauf, setzten sich und blickten auf das Meer hinaus. Gottes Werke trösten fast immer über die der Menschen hinweg.
»Wenn man bedenkt«, sagte René, der sich an die Stirn schlug, »dass sich hier vorhin Männer mit Messern und Dolchen gegenseitig abgeschlachtet haben und dass ich für den Geringsten unter ihnen mein Leben aufs Spiel setzen würde, wenn er sich jetzt in Gefahr befände!«
Hélène seufzte und setzte sich neben ihrer Schwester und René auf eine Bank.
»Aber«, sagte dieser ohne Übergang, »haben Sie denn in Frankreich keinen einzigen Verwandten, dem ich von Ihnen berichten und den ich bitten könnte, sich um Sie zu kümmern?«
»Die Geschichte unserer Familie ist traurig, denn sie ist vom Tod gefärbt. Zuerst verstarb unsere Tante; sie ging ihrem Ehemann voraus, der mit drei Söhnen hinterblieb und miterleben musste, dass der älteste füsiliert und der zweite unter schrecklichen Umständen guillotiniert wurde; was mit dem jüngsten geschah, das ist ein Geheimnis, das zu lüften unser Vater nichts unversucht gelassen hat, doch sein Schicksal bleibt wie von einem Schleier verhüllt. Am selben Abend, an dem er seinen Ehevertrag unterzeichnen sollte, verschwand er spurlos wie eine Legendengestalt, die sich in Luft auflöst und nie wieder gesehen wird.«
»Und den jungen Mann haben Sie nie kennengelernt?«, fragte René.
»O doch, ich erinnere mich sogar an ihn, obwohl wir noch sehr jung waren; er diente eine Zeit lang unter meinem Vater, als dieser Kapitän war; er war ein liebenswerter Knabe in seiner Steuermannsjungenuniform mit dem Dolch an der Seite und dem Dreispitz auf dem Kopf. Damals war er zwölf oder dreizehn, und ich war sechs oder sieben Jahre alt. Meine Schwester war zu jung, um sich so gut an ihn zu erinnern wie ich. Mein Vater – darüber können wir ruhig sprechen, da all das verflossen und vergangen ist – hatte sogar vorgehabt, unsere Familien durch engere Bande zu vereinigen. Ich weiß noch, dass wir uns nicht nur als Cousin und Cousine betrachteten, sondern gewissermaßen als Verlobte. Solche Jugendträume muss man vergessen, vor allem wenn es nur Leid bedeuten würde, sich ihrer zu entsinnen. Als wir erfuhren, dass der arme Junge verschwunden war, stellten wir alle Nachforschungen an, die in unserer Macht standen, doch vergeblich, und mein Vater gelangte zu dem Schluss, dass er ums Leben gekommen sein müsse. Dann ereigneten sich die schrecklichen Todesfälle Cadoudals, Pichegrus und des Herzogs von Enghien. Angewidert von den Zuständen in Frankreich, beschloss mein Vater, sich nur noch mit den Ländereien zu befassen, die er am anderen Ende der Welt besaß und von denen es hieß, allein indem man Reis säe, könne man dort reich werden. In London lernten wir Sir James Asplay kennen, der seit sieben oder acht Jahren in Indien lebt und unser Nachbar ist, wie man in Indien eben Nachbar ist, auf zwei- bis dreihundert Meilen Entfernung, denn er ist in Kalkutta stationiert. Er hat den indischen Boden untersucht, und er weiß, was man am besten anbaut; er ist ein hervorragender Jäger, und sein größter Wunsch ist es, sich ein unabhängiges Reich von sechzig Meilen Radius zu schaffen. Ich dagegen bin so ehrgeizlos wie Hamlet, und wäre mein Reich so klein wie eine Nussschale, wäre ich darin glücklich, vorausgesetzt, meine Schwester wäre es auch.«
Nach diesen Worten legte Hélène ihrer Schwester sanft den Arm um die Schulter und küsste sie zärtlich.
René hatte ihr mit größter Aufmerksamkeit zugehört; hin und wieder hatten sich seiner Brust Seufzer entrungen, als wären in ihm ganz ähnliche Erinnerungen geweckt worden.
Schließlich erhob er sich, ging mit großen Schritten auf der Poop hin und her und setzte sich dann wieder neben die Schwestern, wobei er ein Lied aus der Feder Chateaubriands summte, das in jenen Tagen sehr beliebt war:
Wie süß ist die Erinnerung
An meiner Kindheit Heimatort!
Ach, Schwester, wie schön war die Zeit
In Frankreich!
O mein Land, meine größte Liebe seist
Du allezeit.
Alle drei waren schweigend in ihre Gedanken vertieft, und wer weiß, wie lange sie so geschwiegen hätten, wäre nicht François gekommen, um zu sagen, dass das Mittagessen angerichtet sei, und da die Kampfhandlungen im Speisezimmer ihre Spuren hinterlassen hatten, wurde ausnahmsweise in der Kajüte Monsieur Renés gespeist.
Die Demoiselles de Sainte-Hermine hatten dieses Zimmer nie zuvor betreten; voller Staunen sahen sie, mit wie viel künstlerischem Geschmack es eingerichtet war. René, der ein ausgezeichneter Zeichner war, hatte Aquarelle von allen Landschaften und Sehenswürdigkeiten angefertigt, die ihn beeindruckt hatten. Zwischen zwei Landschaftsaquarellen befanden sich kostbare Waffen, und an der gegenüberliegenden Wand war eine Sammlung von Musikinstrumenten angebracht. Die Schwestern traten neugierig näher, denn beide waren musikalisch. Es gab eine Gitarre, ein Instrument, das Jane spielte. Hélène hingegen war eine mehr als passable Pianistin, doch seit dem Tod ihres Vaters wäre sie nicht im Traum darauf verfallen, die Tasten eines Klaviers zu berühren, obwohl es in ihrer gemeinsamen Kajüte ein solches Instrument gab.
Die Musik schuf ein neues Band zwischen den drei jungen Leuten. Auch in Renés Kajüte gab es ein Klavier, doch René spielte darauf in ganz eigener Manier; die effektvolleren Stücke der großen Meister jener Zeit spielte er nie, sondern nur leise, klagende Melodien, die ausdrückten, was sein Herz empfand: »Une fièvre brûlante« von Grétry oder »Dernière pensée« von Weber, doch häufiger noch war ihm das Klavier nur ein Echo der Erinnerungen, die niemand mit ihm teilte. In solchen Augenblicken schlug seine Hand so wohlklingende Akkorde an, dass es war, als erzeugte sie nicht Töne, sondern als spräche sie eine eigene Sprache.
Oftmals hatten die Schwestern nachts leise harmonische Klänge vernommen, die sie für das Rauschen des Winds im Tauwerk oder für ein Zusammentreffen nächtlicher Geräusche gehalten hatten, wie sie die Seereisenden des Altertums als Gesang der Meeresgottheiten deuteten, doch nie wäre ihnen der Gedanke gekommen, dass diese Seufzer einer unbestimmbaren und zugleich unerschöpflichen Traurigkeit von einer Menschenhand und den kalten Tasten eines Klaviers hervorgebracht sein könnten.
Nach dem Mittagessen blieb man in Renés Kajüte, um sich nicht an Deck den unbarmherzigen Sonnenstrahlen auszusetzen, und René zeigte den Schwestern das Klavier und die Instrumente an der Wand; doch als er sah, dass die Augen der Mädchen sich mit Tränen füllten, dachte er an den Leichnam ihres Vaters, den er zusammen mit ihnen in unbekannte Länder brachte, die voller Gefahren waren.
Und die Finger des jungen Mannes erweckten auf dem Klavier die melancholische Melodie, die Weber in Wien komponiert hatte. Wie die Gedichte André Chéniers und Millevoyes war diese Musik etwas völlig Neues in dieser neuen, von Revolutionen erschütterten Welt, die so vieles zu beweinen hatte. Unwillkürlich erstarb die Melodie zu schlichten Akkorden, die noch melancholischer und kummervoller waren. Als Webers Lied verklungen war, bewegten sich Renés Finger wie von allein weiter und spielten statt der Träumereien des Komponisten seine eigenen Phantasien. In solchen Improvisationen, die man nicht erlernen kann, offenbarte sich die Seele des jungen Mannes ganz und gar. Wer vermeint, in der Musik lesen zu können wie in einem Buch, der konnte in dieses Klavierspiel blicken wie durch eine Wolke, die ein schönes Tal oder eine üppige Ebene in eine eigene Welt verwandelt, in der die Bächlein nicht rauschen, sondern seufzen, und die Blumen weinen, statt zu duften. Diese Musik war so ungewohnt und so unerwartet für die Schwestern, dass ihnen Tränen die Wangen hinunterliefen, ohne dass sie es merkten. Als Renés Finger unvermutet innehielten – denn solche Akkorde kennen keine zeitliche Beschränkung -, erhob Jane sich von der Bank und kniete vor Hélène nieder.
»Oh, liebe Schwester«, sagte sie, »ist so eine Musik nicht genauso tröstlich und genauso fromm wie ein Gebet?«
Hélène antwortete nur mit einem Seufzer und einer zärtlichen Umarmung, mit der sie ihre Schwester an ihr Herz drückte.
Es war nicht zu leugnen, dass die Schwestern seit einiger Zeit Gedanken und Gefühle empfanden, die sie sich nicht erklären konnten.
So vergingen die Tage, als hätten die jungen Leute kein Zeitgefühl.
Eines Morgens rief der Mann im Ausguck: »Land in Sicht!« Wenn Renés Berechnungen zutrafen, musste es sich dabei um Birma handeln. Er rechnete nochmals, und das Ergebnis bestätigte die Vermutung.
Kernoch sah den Rechenkunststücken zu, ohne das Geringste davon zu verstehen; er fragte sich, wie jemand wie René, der noch nie auf einem Schiff gefahren war, eine so schwierige Arbeit so selbstverständlich verrichten konnte, eine Arbeit, die er, Kernoch, niemals hätte meistern können.
Man setzte Segel und nahm Kurs auf die Mündung des Flusses Pegu. Die Küste war so niedrig, dass sie von der Meeresoberfläche kaum zu unterscheiden war.
Bei dem Ruf »Land!« waren die beiden Schwestern an Deck gekommen, wo sie René mit dem Fernglas in der Hand vorfanden; er reichte ihnen das Glas, doch da sie es nicht gewohnt waren, den Meereshorizont zu betrachten, sahen sie anfangs nichts als die unendliche Weite des Ozeans. Doch je näher sie der Küste kamen, umso deutlicher tauchten wie Inseln Berggipfel auf, die in der klaren Luft noch aus größter Ferne erkennbar waren.
Das Schiff setzte am Großmast eine neue Flagge und gab zwölf Kanonenschüsse ab, die von der Kanone des Forts sogleich erwidert wurden. Dann bat Kernoch um einen Lotsen. Bald darauf sah man aus dem Fluss von Rangun ein kleines Schiff kommen, das den gewünschten Mann brachte. Er begab sich an Bord. Auf die Frage, welche Sprache er spreche, erwiderte er, er stamme weder aus Pegu noch aus Malakka, sondern aus Chiang Saen, und um dem König von Siam nicht tributpflichtig zu sein, habe er sich nach Rangun abgesetzt und sich dort zum Lotsen ausgebildet; da er ein wenig Englisch radebrechte, konnte René ihn so weit ausfragen. Renés erste Frage hatte der Schiffbarkeit des Flusses Pegu gegolten, denn die Runner of New York hatte einen Tiefgang von neun bis zehn Fuß.
Der Lotse mit Namen Baba erklärte, der Fluss sei etwa zwanzig Meilen weit befahrbar, ungefähr bis zu einer Siedlung, die einem französischen Grundbesitzer gehöre. Diese Siedlung, die nur aus einigen Bauernhäuschen oder Hütten bestand, trug den Namen Rangoon House, und die Reisenden erkannten darin zweifelsfrei den Besitz des Vicomte de Sainte-Hermine. Renés kleine Slup segelte unter amerikanischer Flagge, doch sie wurde eingehend untersucht, denn sie sah den Handelsschiffen, die in dieser Weltgegend verkehrten, so unähnlich, dass die Behörden erst nach einem dritten Besuch an Bord die Fahrt den Fluss entlang erlaubten.
Es war schon spät am Tag, als die Reisenden Rangun erreichten und den Rangun-Fluss querten, der in einen Seitenarm des Irrawaddy mündet; dann ging es den Fluss Pegu entlang, der in dem Bergland weiter südlich entspringt und nach einem Verlauf von fünfundzwanzig bis dreißig Meilen zwischen Irrawaddy und Sittang in den Rangun-Fluss mündet. Bei Siriam, der ersten Stadt, die man erreichte, wurde angehalten, damit frischer Proviant besorgt werden konnte – Hühner, Tauben, Wassergeflügel und Fisch. Wenn der Wind weiterhin stetig aus Süden blies, konnte das kleine Schiff in zwei Tagen Pegu erreichen; änderte er aber die Richtung, wären Schleppkähne nötig, um es nach Pegu zu bringen, und dies würde die Fahrzeit wenigstens verdoppeln. Niemand wäre auf die Idee verfallen, der bejammernswerten Stadt Rangun einen Besuch abzustatten, der einstigen Landeshauptstadt mit einer Bevölkerung von hundertfünfzigtausend Seelen, in der mittlerweile nur mehr siebentausend Bewohner verblieben sind. Von dem alten Glanz ist nichts geblieben als der Buddha-Tempel, der bei der Plünderung der Stadt verschont wurde und der in der Landessprache Shwedagon-Pagode heißt, was »goldenes Heiligtum« bedeutet.
Der Fluss Pegu war an der Stelle, an der die Slup in ihn hineinfuhr, etwa eine Meile breit, doch schon bald verengte er sich zwischen den dschungelbewachsenen Ufern, bis er kaum breiter war als die Seine zwischen Louvre und Institut, und den Reisenden war nur zu bewusst, dass diese grüne Wildnis von zehn bis zwölf Fuß Höhe, also gleicher Höhe wie die Poop des Schiffs, von wilden Tieren jeder Art bewohnt sein musste. Der Mastkorb des Schiffs überragte die höchsten Bäume des Dschungels um fünf, sechs Meter, und von dieser luftigen Höhe aus waren zur Linken und Rechten des Flusses sumpfige Ebenen zu sehen, die sich auf der einen Seite bis zum Wüstensaum des Sittangs erstreckten und auf der anderen bis zu der Kette von Städten, die am Irrawaddy liegen.
René war sich sehr wohl im Klaren darüber, dass die Fahrt auf einem so ufernahen Fluss eine gefährliche Sache war, und er beschloss, persönlich an Deck Wache zu halten, wozu er sich sein Gewehr und seinen dopelläufigen Stutzen bringen ließ. Als der Abend hereinbrach, kamen die Schwestern herauf, um sich mit René auf die Poop zu setzen. Neugierig auf die Wirkung einer Jagdfanfare in diesen einsamen Weiten, ließ René sein Jagdhorn bringen. Von Zeit zu Zeit wurden aus der Wildnis laute Geräusche hergetragen: Offenbar fanden erbitterte Kämpfe zwischen ihren Bewohnern statt. Aber um was für Bewohner mochte es sich handeln? Vermutlich um Tiger, Kaimane und jene langen Boas, die ein Rind mit ihrer Umschlingung ersticken können, ihm die Knochen brechen und es verschlingen, ohne innezuhalten.
Die immer wieder von einem nicht für menschliche Ohren bestimmten Gebrüll unterbrochene Stille hatte etwas so Erschreckendes und zugleich Feierliches, dass die beiden Mädchen René mehrmals davon abhielten, das Horn anzusetzen. Und dann ertönte ein Hornsignal: dunkel, vibrierend, herausfordernd; es erklang, als schwebte es über den Baumwipfeln und breitete sich aus, bevor es sich in den Weiten dieser Einöde verlor, der weder Gott noch Mensch einen Namen verlieh. Bei diesen ungewohnten Klängen verstummte und verharrte alles ringsum; es war fast, als schwiegen die wilden Tiere, um das ihren Ohren fremde und neue Geräusch besser zu vernehmen.
Der Wind war günstig, und es wurden keine Schleppkähne benötigt. Mit einem Mal rief der Matrose im Ausguck: »Barke voraus!«
In dieser Gegend drohte von überall Gefahr. René beruhigte seine Begleiterinnen, ergriff dann sein Gewehr und trat an die Brüstung der Poop, um mit eigenen Augen zu sehen, worum es sich handelte.
Die Schwestern hatten sich erhoben, bereit, sich beim ersten Zeichen Renés in ihre Kajüte zu begeben. Die Nacht war mondhell, und der Vollmond beschien ein Hindernis auf dem Fluss, das in der Tat einer Barke ähnlich sah.
Es bewegte sich wie von allein und folgte der Strömung des Flusses. Es kam näher und wurde zunehmend erkennbar, bis René sah, dass es sich um einen entwurzelten Baum handelte. Da an diesem allem Anschein nach leblosen Gegenstand nichts Beunruhigendes war, rief René die Schwestern an die Brüstung. Der Baum war nur mehr an die zwanzig Schritte von der Slup entfernt, als René ein Glühen wie von zwei feurigen Kohlen wahrnahm; er hatte noch nie einen Panther zu sehen bekommen, begriff jedoch, dass sich ein solches Tier auf dem Baum befinden musste. Vielleicht hatte es in der Baumkrone auf der Lauer gelegen, als ein Windstoß den Baum entwurzelt und in den Fluss geworfen hatte. In seinem ersten Schrecken hatte es sich an dem Baum festgekrallt, und nun wusste es sich keinen Rat, wie es an das Ufer zurückgelangen konnte.
»Wenn meine Schwester Hélène den Wunsch nach einem schönen Bettvorleger haben sollte«, sagte René, »muss sie es nur sagen.«
Er zeigte auf den Panther, der seinerseits die Reisenden bemerkte, sein Fell sträubte und fauchend die Zähne bleckte, so dass er eine größere Gefahr für diese bedeutete als sie für ihn.
René legte sein Gewehr an, doch Hélène hinderte ihn daran, den Schuss abzugeben. »Oh«, sagte sie, »verschonen Sie das arme Tier!«
Die erste Regung des weiblichen Herzens ist immer das Mitleid.
»Sie haben recht«, murmelte René, »es wäre blanker Mord.«
Baum und Slup kreuzten sich, und man hörte, wie die Äste und Zweige am Schiffsrumpf raschelten.
Plötzlich stieß der Untersteuermann einen markerschütternden Schrei aus.
»Flach auf den Boden!«, rief René in dem Befehlston, der keinen Widerspruch zulässt.
Das Gewehr, dessen Lauf auf seiner Schulter ruhte, glitt blitzschnell in seine linke Hand; ein Schuss löste sich und in der nächsten Sekunde ein zweiter.
Die Schwestern hielten einander schutzsuchend umarmt; sie hatten erraten, was geschehen war. Der durch seinen Zwangsaufenthalt auf dem Baum ausgehungerte Panther war mit einem Satz zum Schiff gesprungen und auf der Reling gelandet. Bei diesem Geräusch hatte der Untersteuermann sich umgedreht und die wilde Bestie erblickt, die auf der Reling kauerte und nur einen weiteren Satz tun musste, um sich auf ihn zu stürzen; deshalb hatte er den Schrei ausgestoßen, den René gehört und mit zwei Kugeln in den Leib des Panthers beantwortet hatte.
Mit einem Sprung war René, das Gewehr noch in der Hand, zwischen Untersteuermann und Panther; das Tier war tot: Eine der beiden Kugeln hatte sein Herz getroffen.
66
Pegu
Als der Gewehrschuss ertönte, eilten alle an Deck, denn man rechnete mit einem abermaligen Angriff malaiischer Piraten. Das Gute an vergangenen Schrecknissen ist die Vorsicht, die sie einen für die Zukunft lehren.
Kernoch, der sich kurz aufs Ohr gelegt hatte, war als einer der Ersten an Deck und fand den Untersteuermann und den Panther nebeneinander vor, beide reglos und totengleich.
Als Erstes kümmerte man sich um den Untersteuermann, denn es stand zu befürchten, dass der Panther ihn mit einem Prankenhieb verletzt hatte, doch er war unversehrt, während der Panther durch Renés zweiten Schuss auf der Stelle getötet worden war.
Der Schiffsmetzger enthäutete den Panther mit größter Sorgfalt. Das Fell war für Hélène bestimmt, doch Jane bettelte sie so flehend an, dass sie es ihr überließ.
Das Schiff hatte noch keinen Halt eingelegt, und da der Wind weiterhin günstig war, segelte man weiter langsam flussaufwärts.
Die zwei Schwestern gingen zitternd in ihre Kajüte zurück; ihre Begeisterung für das herrliche Land, in dem sie leben würden, hatte sich merklich gedämpft. René blieb bis um drei Uhr morgens bei ihnen; jeden Augenblick glaubten sie hinter ihrem Fenster die furchterregende Fratze einer blutrünstigen wilden Bestie zu sehen.
Die restliche Nacht verbrachten sie zitternd und zagend und ständig neuer Schrecknisse gewärtig. Sobald es hell wurde, kehrten sie an Deck zurück, wo sie ihren Beschützer anzutreffen hofften.
Sie hatten sich nicht getäuscht; sobald René sie sah, rief er: »Kommen Sie, kommen Sie! Ich wollte Sie schon wecken lassen, damit Ihnen der unvergleichliche Anblick dieser zwei Pagoden im Sonnenaufgang nicht entgeht. Die nähere Pagode ist die von Dagoung, und man erkennt sie an ihrer goldenen Spitze und ihrem vergoldeten Schirm; wir müssen nachts ganz nahe an ihr vorbeigekommen sein.«
Die zwei Schwestern betrachteten die Pagoden voller Bewunderung; besonders malerisch war die Pagode von Dagoung anzusehen, welche die umliegende Gegend beherrscht, denn sie ist auf einer Terrasse auf einem Berggipfel errichtet. Zu dieser Terrasse führt eine Treppe mit mehr als hundert Steinstufen.
René hatte nicht zu viel versprochen: Die goldene Pyramide auf ihrem gewaltigen Piedestal bot einen überwältigenden Anblick, als die ersten Sonnenstrahlen sie berührten. Aus den dichten Wäldern ringsum war die ganze Nacht hindurch Gebrüll und Geheul ertönt, und der Dschungel, der den Fluss säumte, machte einen keineswegs vertrauenerweckenden Eindruck. Aus ihm hatte man nachts Alligatoren schreien gehört, was in etwa klingt wie das Geschrei eines Kindes, das erwürgt wird. Hin und wieder wurden die Wälder von großen Reisfeldern unterbrochen, die eine ganz bestimmte Klasse von Landesbewohnern bestellen, die sich hauptsächlich der Landwirtschaft widmen und Karainer oder Karen genannt werden; sie haben sehr schlichte Sitten, sprechen eine eigene Sprache, sind überaus fleißig und führen ein einfaches, bäuerliches Leben. Sie wohnen in Dörfern, deren Häuser auf Pfosten oder Pfählen errichtet sind. Untereinander wahren sie stets Frieden, und aus den Streitigkeiten der Regierung halten sie sich heraus.
Der Fluss war so fischreich, dass die Matrosen lediglich ein paar Angelschnüre ins Wasser hängen mussten, um genug Fische für die Abendmahlzeit der ganzen Besatzung zu fangen. Einige von ihnen wollten das Fleisch des Panthers kosten. Es war ein junges Tier, eineinhalb oder höchstens zwei Jahre alt, und der Koch verarbeitete seinen Rücken zu Koteletts, doch selbst mit den kräftigsten Zähnen konnte man das zähe Fleisch nicht von den Knochen lösen.
Am übernächsten Tag erreichten die Reisenden Pegu ohne weitere Zwischenfälle bis auf den erbitterten Kampf eines Alligators mit einem Kaiman vor dem Bug der Slup, dem mit einem Schuss Kartätschenladung, der beide Kombattanten in Stücke riss, ein Ende gemacht wurde.
Schiffe von mehr als zehn bis zwölf Fuß Tiefgang müssen in Pegu anhalten, denn bei Ebbe würden sie eine Meile weiter flussaufwärts auf Grund laufen.
Für die Abwicklung der Zollformalitäten wurde das Schiff dem Zamindar überantwortet, einem Vertreter des Kriegsministeriums.
Die Reisenden wurden in einen Stadtpalast gebracht, der »Palast der Fremden« hieß, weil er als Unterkunft für die seltenen Reisenden bestimmt war, die sich nach Pegu verirrten.
Als René die Wohnräume dieses Palasts zu sehen bekam, erklärte er, er bleibe lieber auf der Slup, um von dort aus alles Erforderliche für die Reise zu den Ländereien des Vicomte de Sainte-Hermine in die Wege zu leiten; diese Ländereien wurden in der Landessprache als »Land des Betels« bezeichnet, so reichlich wuchs dort die Betelnusspalme.
Die Ankunft einer Slup mit sechzehn Kanonen und unter amerikanischer Flagge, der Flagge eines Landes, das im indischen Ozean alllmählich einen guten Ruf genoss, sorgte in Pegu für große Aufregung. Schon am nächsten Tag fand sich als erster Besucher der Dolmetscher des Herrschers ein. Er hatte den Auftrag, dem Kapitän Früchte als Geschenk des Shabundar von Pegu zu bringen und ihm mitzuteilen, dass der Nak-Kann und der Seredogee ihm am Tag darauf ebenfalls einen Besuch abstatten würden.
In weiser Voraussicht derartiger Besuche hatte René auf der Île de France Stoffe und Waffen gekauft, so dass er dem Shabundar ein schönes Gewehr zum Geschenk machen konnte. Das Entzücken des Besuchers über diese Waffe nutzte René, um ihn zu bitten, ein Auge auf die Slup zu haben, was diesem in seiner Funktion als Verwaltungsbeamter ein Leichtes sein musste.
Während der ganzen Dauer dieses Besuchs kaute der von zwei Sklaven mit einem silbernen Spucknapf begleitete Shabundar unentwegt Betel und bot seinem Gastgeber davon an.
René kaute die duftenden Blätter, als wäre er ein wahrer Brahmane, doch sobald der Shabundar ihn verließ, spülte er sich den Mund mit Wasser und ein paar Tropfen Arrak, denn als gepflegter Mann legte er Wert auf weiße Zähne.
Am nächsten Tag fanden sich wie angekündigt der Nak-Kann und der Seredogee ein.
Im Königreich Pegu ist es Sitte, andere nicht zu überraschen; der Titel Nak-Kann, der die Funktion eines Polizeipräfekten bezeichnet, heißt wörtlich »Ohr des Königs«, während Seredogee einen Sekretär bezeichnet.
Beide kamen ebenfalls in Begleitung ihrer Spucknapfträger. Obwohl auch sie ohne Unterlass kauten und spuckten, war das Gespräch diesmal interessanter. René erhielt zufriedenstellendere Auskunft über den Stand der Dinge auf dem Besitztum seiner schönen Mitreisenden. Er erfuhr, dass man allein mit dem Anbau von Betelnusspalmen, deren Produkt man in das übrige Indien verkaufen konnte, mindestens fünfzigtausend Francs erlösen konnte, ganz davon abgesehen, dass sich der gleiche Betrag mit dem Anbau von Reis und Zuckerrohr erwirtschaften ließ. Das Landgut lag etwa fünfzig englische Meilen von Pegu entfernt; um es zu erreichen, musste man allerdings Wälder durchqueren, in denen es von Tigern und Panthern wimmelte, und zudem wurde gemunkelt, Banditen aus Siam und Sumatra hätten ihre Schlupfwinkel in diesen Wäldern und machten den Aufenthalt dort noch gefährlicher als die wilden Tiere.
Die zwei Besucher waren sehr ähnlich gekleidet: der eine in Violett, der andere in Blau; beide trugen ein langes Gewand, das an allen Rändern und Säumen mit Goldfäden bestickt war.
René überreichte dem Sekretär des Königs einen goldbestickten Teppich und dem Ohr Seiner Majestät ein schönes Paar Pistolen aus einer Versailler Waffenschmiede.
Während des ganzen Besuchs hatten die beiden Regierungsbeamten sich nicht aus der Hocke erhoben; der Sekretär, der Englisch sprach, diente seinem Begleiter als Dolmetscher.
Seit der Ankunft unserer Reisenden in Pegu war so viel von Betel die Rede, dass es an der Zeit sein dürfte, Näheres über diese Pflanze zu berichten, in welche die Inder noch vernarrter sind als die Europäer in den Tabak.
Die Betelnusspalme ist eine Schlingpflanze, die sich dem Efeu vergleichen lässt; ihre Blätter sehen aus wie die des Zitronenbaums, wenngleich sie spitzer und länglicher sind; die Betelnuss ähnelt der Frucht des Wegerichs, und sie wird den Blättern vorgezogen. Die Pflanze wird wie die Weinrebe angebaut und wie diese an Stützpfählen gezogen. Bisweilen verbindet man sie mit der Arekapalme und gewinnt so bezaubernde Lauben; die Betelpflanze wird in ganz Südostindien angebaut, hauptsächlich in den Küstenregionen.
Die Inder kauen Betelblätter zu jeder Tagesstunde und sogar nachts; da die Blätter jedoch bitter schmecken, wenn sie ohne Beigabe zerstampft werden, fügen die Connaisseure ihnen etwas Arekanuss und Kalk hinzu, die in das Blatt eingewickelt werden. Wohlhabende versetzen ihren Betel sogar mit Kampfer aus Borneo, mit Aloe, Moschus und grauem Ambra.
Der solchermaßen präparierte Betel ist von so köstlichem Geschmack und von so lieblichem Duft, dass die Inder ganz versessen darauf sind. Jeder, der es sich leisten kann, labt sich daran. Manche kauen auch Arekanuss mit Zimt und Nelken, doch diese Mischung reicht geschmacklich nicht an die heran, die aus Arekanuss und etwas Kalk im Betelblatt besteht. Nach dem ersten Kauen spucken die Inder eine rote Flüssigkeit, die ihre Farbe der Arekanuss verdankt. Durch den ständigen Betelgebrauch ist ihr Atem süß und so wohlriechend, dass er fast den Raum parfümiert, in dem sie sich aufhalten, doch das ständige Betelkauen verdirbt ihre Zähne, schwärzt sie und bewirkt Karies und Zahnausfall. Es gibt Inder, die mit fünfundzwanzig Jahren keinen einzigen Zahn mehr im Mund haben, weil sie so übermäßig dem Betel zusprechen.
Wenn man sich voneinander verabschiedet, schenkt man einander Betel in einem seidenen Beutel, und wer nicht von jenen, mit denen er für gewöhnlich verkehrt, Betel zum Geschenk erhalten hat, der hat sich noch nicht gebührend verabschiedet. Niemand würde es wagen, das Wort an eine Person von Rang zu richten, ohne sich den Mund mit Betel parfümiert zu haben. Es gilt sogar als unhöflich, ohne diese Vorsichtsmaßnahme mit seinesgleichen zu sprechen. Auch die Frauen sind große Betelkauerinnen, und sie nennen den Betel Liebespflanze. Man genießt Betel nach den Mahlzeiten, und man kaut Betel, während man Besuche macht. Man hat immer Betel zur Hand, man bietet Betel an, wenn man einander begrüßt – kurzum, der Betel spielt zu jeder Tages- oder Nachtzeit eine herausragende Rolle im Leben der indischen Völker.
Kaum hatten die zwei Betelkauer sich verabschiedet, kam das Gerücht auf, die Slup gehöre einem reichen Amerikaner, der Pistolen, Teppiche und doppelläufige Gewehre verschenke, und schon bald waren die Klänge einheimischer Musik zu vernehmen.
René ließ seine beiden Reisegefährtinnen rufen; er hatte ihnen die Langeweile der Ansprachen erspart, doch nun wollte er ihnen das Vergnügen der Musik nicht vorenthalten.
Die Schwestern kamen an Deck, nahmen Platz auf der Poop und sahen, wie sich drei Barken mit Musikern näherten; jede der Barken enthielt eine eigene kleine Kapelle aus drei Flöten, zwei Zimbeln und einer Art Trommel. Der Ton der Flöten ähnelte dem unserer Oboen. Die Musikanten befanden sich in einem kleinen Pavillon am Bug der Barke, während die Ruderer jeweils zu zweit weiter hinten saßen. Das Heck mit dem Flaggenmast war mit dem religiösen Schmuck tibetischer Kuhschwänze verziert.
Die Musik war nicht kunstvoll, doch um nichts weniger bezaubernd. René bat die Musiker, einige Stücke zu wiederholen, damit er die Melodie festhalten konnte.
Jede der Barken wurde mit zwölf Talks entlohnt (ein Talk entspricht in etwa drei Francs und fünfzig Centimes).
René hatte es sich vom ersten Tag an angelegen sein lassen, die Reise zum Besitztum des Vicomte de Sainte-Hermine in die Wege zu leiten. Das einzige Transportmittel waren Pferde und Elefanten; und der Shabundar hatte ihm erklärt, dass er eine Eskorte von mindestens zehn Mann benötigen werde.
Da sich jedoch jedermann auf einen großen Feiertag vorbereitete, war kaum damit zu rechnen, dass ein Landesbewohner sich vor diesem wichtigen Ereignis freiwillig aus Pegu entfernen würde. Der Shabundar hatte René aber versprochen, ihm für die Tigerjagd abgerichtete Pferde oder Elefanten zu leihen, sobald die Feierlichkeiten, die aus einer Prozession zu der großen Pagode bestanden, beendet waren; er würde die Reittiere so lange behalten können, wie er sie benötigte; Pferde und Pferdeführer kosteten zwanzig Talks und Elefanten und Elefantenführer dreißig.
Nachdem René dem Shabundar versichert hatte, nur von ihm Pferde oder Elefanten zu mieten, bot dieser ihm den Fensterplatz in einem Haus an, das an der Treppe zwischen der Hauptstraße und der großen Pagode lag.
Als René in Begleitung der zwei Schwestern kam, um die Prozession zu verfolgen, stellte er voller Erstaunen fest, dass der Shabundar Sorge getragen hatte, den Raum mit Teppichen und Stühlen auszustatten.
Zahlreiche Männer und Frauen nahmen an der Feier teil, und zwischen Sonnenaufgang und zehn Uhr vormittags stiegen an die dreißigtausend Menschen die Treppe hinauf; jeder brachte eine Opfergabe mit, die seiner Frömmigkeit und seinem Portemonnaie entsprach. Die einen trugen einen Baum, dessen Äste sich unter dem Gewicht der Geschenke für die Priester bogen: Betel, Konfitüren und Süßigkeiten. Andere schleppten Krokodile und Riesengestalten aus Pappe mit, von zierlichen Pyramiden überragt, die mit allen möglichen Geschenken bedeckt waren. Elefanten aus Pappkarton, bemaltem Papier und Wachs vervollständigten die Gaben für die Pagode, die hauptsächlich aus Feuerwerkskörpern, Sternen und Früchten bestanden. Alle Ortsansässigen hatten ihre Sonntagstracht angelegt, meistenteils aus Seidenstoffen gefertigt, die denen unserer Manufakturen nicht nur gleichwertig, sondern oft genug überlegen sind. Die birmanischen Frauen, frei wie Europäerinnen, verschleiern ihr Gesicht nicht. Bedauerlicherweise müssen wir gestehen, dass sie dieses Privileg dem Umstand ihrer völligen Missachtung durch die Männer verdanken; die Männer in Birma halten Frauen für niedrigere Wesen, eine Art Zwischending, nicht Mensch, nicht Tier. Vor Gericht hat die Aussage einer Frau keinerlei Beweiskraft, und die Frauen müssen ihre Aussage von der Tür aus machen, denn den Gerichtssaal dürfen sie nicht betreten.
Die Birmanen verkaufen ihre Frauen an Fremde; in diesem Fall aber sind die Frauen, die nur ihrem Ehemann gehorchen, keineswegs entehrt, denn sie entschuldigt zum einen die Pflicht zum Gehorsam und zum anderen die Erfordernis, ihre Familie zu unterstützen.
In Rangun und Pegu gibt es Kurtisanen, und wir scheuen uns nicht, dieses Thema anzusprechen, da es uns angelegen ist, die Sitte anzuprangern, die verlangt, dass diejenigen, die in diesen Häusern dienen, in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Nicht aus Faulheit oder Verdorbenheit gehen die jungen Mädchen dem schändlichen Gewerbe nach, das sie auch in den zivilisiertesten Städten mit Schimpf und Schande bedecken muss. Das Gesetz, das in Birma für Schuldner gilt, ist das gleiche wie im Rom der Zwölftafelgesetze: Jeder Gläubiger ist Herr über seinen Schuldner oder über die Familie seines Schuldners, sofern dieser seine Schuld nicht zu begleichen vermag; er kann ihn als Sklaven verkaufen, und wenn Ehefrau und Töchter des Schuldners hübsch sind, verkauft er diese armen Geschöpfe, die man »Töchter des Bankrotts« nennen könnte, an die Leiter oder Leiterinnen der Bordelle, die ihm den besten Preis für diese Ware zahlen. In früheren Zeiten gab es eine andere Klasse von Hetären anderen Ursprungs, und diese Frauen hießen »Frauen des Götterbildes«.
Wenn eine Frau gelobt hatte, einen Knaben zu gebären, und statt seiner von einer Tochter entbunden wurde, trug sie diese zu dem Götterbild und ließ sie dort liegen. Da das Mädchen dem Tempel nicht auf der Tasche liegen dufte, wurde es als Tempelhure den vorbeikommenden Fremden angeboten. Die Eingeborenen nannten solche Frauen devadasi (»Sklavinnen des Götterbildes«), die Fremden nannten sie bajadere, was sowohl Tanzmädchen als auch Kurtisane bedeutet.
67
Die Reise
Als die Festlichkeiten vorbei waren, erinnerte René den Shabundar an sein Versprechen, und schon am nächsten Tag erblickte er auf dem Kai vor seiner Slup drei Elefanten und ihre Führer. Der amerikanischen Besatzung vertraute René nicht genug, um die Runner of New York ihrer Obhut zu überlassen; wenn er hingegen Kernoch und seine sechs Bretonen auf dem Schiff zurückließ, konnte er sich auf den Hass zwischen den Nationen verlassen, was die Wachsamkeit betraf, und auf die bretonische Treue, falls es zu Handgreiflichkeiten kommen sollte. Aus diesem Grund nahm er nur François mit auf die Reise, seinen treuen Pariser.
Zwei Elefanten mit ihren Palankins, deren jeder bis zu vier Personen Platz bot, genügten für René und seine Begleiterinnen. Darüber hinaus nahm er zur Sicherheit die Zehn-Mann-Eskorte mit, zu denen der Shabundar ihm geraten hatte.
Jeder Mann und jedes Pferd würde ihn zehn Talks am Tag kosten; zwei zusätzliche Pferde für René und François würden mitgeführt werden, damit die beiden reiten konnten, wenn sie des Geschaukels in dem Palankin überdrüssig waren.
Der Führer der Eskorte rechnete mit einer dreitägigen Reise.
Da man unterwegs keine Dörfer besuchen würde, wurden zwei Pferde mit Vorräten beladen. Unterwegs wollte man durch die Jagd Abwechslung in den Speiseplan bringen.
Kernoch, dem die birmanischen Behörden für den Fall einer Auseinandersetzung mit seiner Mannschaft ihre Unterstützung zugesagt hatten, blieb zuversichtlich und beruhigt in Pegu zurück, während die kleine Karawane einem Nebenfluss des Pegu nach Osten folgte.
Am ersten Abend kampierte man vor dem Wald, in den man sich am Tag darauf wagen musste; noch war man in Nähe des Flusses, aus dem man sich mit Süßwasser für die weitere Reise versorgte.
Die Palankins konnten vom Rücken der Elefanten genommen und auf den Boden gestellt werden, wo sie als Zelte dienten, in denen die jungen Damen hinter ihren Moskitonetzen schlafen konnten.
Ein großes Feuer wurde entzündet, um Schlangen und andere gefährliche Tiere fernzuhalten. Der Führer der Eskorte behauptete, die Elefanten machten Wachen überflüssig, da diese klugen Tiere aus Instinkt Alarm schlügen, sobald irgendein Feind sich näherte.
René vertraute dieser Auskunft jedoch nicht, sondern wollte persönlich die Wache übernehmen; für die erste Hälfte der Nacht teilte er sich selbst ein, für die zweite François.
Die Fähigkeit der Elefanten, Gefahren zu wittern, war ihm allerdings nicht unbekannt.
Nach und nach machte René sich die zwei Kolosse gewogen, indem er ihnen frische Zweige voller Grün und apfelähnliche Früchte brachte, die sie sehr lieben. Diese intelligenten Tiere unterscheiden nach kürzester Zeit ohne Schwierigkeiten zwischen einem Menschen, der ihnen Nahrung bringt, weil er dafür zuständig ist und weil er ihr Elefantenführer ist, und einem Menschen, der ihnen aus Zuneigung den Luxus schenkt, der jedem denkenden Wesen unentbehrlich ist, so unentbehrlich, dass der Mensch ihn bisweilen dem Notwendigsten vorzieht. Da René keine Eifersucht wecken wollte, brachte er beiden Elefanten stets die gleiche Menge Leckereien.
Die Elefanten beäugten René zuerst mit einem gewissen Misstrauen, da ihnen die Beweggründe dieses Fremden für seine Zuwendung unerklärlich waren, doch sie ließen es sich schmecken. Dann führte René sie zu den beiden Schwestern, die ihnen ein paar frische Zuckerrohrhalme reichten, welche die Elefanten mit ihrem Rüssel gewandt entgegennahmen und mit sichtlichem Genuss verspeisten. Vor der Abreise hatte René einen kleinen Vorrat an Leckereien besorgen lassen, mit denen er sich die Zuneigung der Elefanten sichern wollte.
Die Nacht war ruhig; nur ab und zu kamen Panther ans Wasser, um zu trinken, und der eine oder andere Kaiman verließ den Dschungel auf der Suche nach Jagdglück; der wachhabende Elefant meldete diese Zwischenfälle zuverlässig, denn auch die Elefanten hatten sich die Nachtwache geteilt, ganz wie René und François, allerdings mit größerem Vertrauen in den Kameraden, als René es seinem Pariser Freund entgegenbrachte.
Um Mitternacht ging der Elefant, der bis dahin gewacht hatte, in die Knie und schlief ein, woraufhin sein Kamerad aufstand und die Wache übernahm.
Bei Tagesanbruch ließ der zweite Elefant ein Trompeten ertönen, das die Reisenden weckte.
In der Überzeugung, dass ihnen kein Ungemach widerfahren konnte, hatten die Schwestern so unbesorgt geschlafen, als wären sie zu Hause in ihrem Mädchenzimmer. Ausgeruht erhoben sie sich und atmeten die frische und duftende Morgenluft.
René trat zu ihnen; er hielt ein Büschel jener Pflanzen im Arm, an denen Elefanten sich besonders gern delektieren.
Hélène und Jane hatten sich den zwei riesigen Tieren bisher nicht ohne Furcht genähert, doch als sie sahen, wie freundlich die Tiere sie beäugten, verloren sie jede Furcht, ergriffen die Pflanzen, die René ihnen reichte, und fütterten die Elefanten, die mit genussvollem Grunzen fraßen. Als alles Grün vertilgt war, streichelten die Elefanten René mit ihren Rüsseln, denn sie hatten sehr wohl begriffen, dass er die Mädchen dazu gebracht hatte, ihnen die wohlschmeckenden Zweige zum Fressen zu geben.
Als die Kolosse gefressen hatten, blickten sie nach rechts und nach links, wie um anzudeuten, dass es noch an etwas fehle. Es handelte sich um das Zuckerrohr, das sie über alles liebten. Da sie völlig zu Recht danach verlangten, holte René die Halme und gab sie Hélène und Jane, damit diese die Elefanten bedienten, die genüsslich ihre Leckerei verzehrten.
Nach einem leichten Frühstück wurde die Tagesreise in zwei Abschnitte unterteilt: Die erste Pause sollte um elf Uhr vormittags an einem See erfolgen, wo man die größte Tageshitze abwarten wollte; die zweite Pause war für sieben Uhr abends an einer Lichtung vorgesehen, wo man die Nacht zu verbringen beabsichtigte.
Die zwei Schwestern stiegen wieder auf ihren Elefanten, der ob der Ehre, die ihm widerfuhr, sehr geschmeichelt wirkte. René und François bestiegen ihre Pferde, und François folgte René mit wenigen Schritten Abstand neben dem Elefanten der zwei Schwestern. Der Führer setzte sich an die Spitze der Gruppe, und die zehn berittenen Garden begleiteten ihre Schützlinge zur Linken und zur Rechten. Der zweite Elefant, auf dem nur sein Führer ritt, folgte dem ersten. In dem Wald war es so finster und die Atmosphäre war so bedrohlich, dass René sich um seine Freundinnen Sorgen machte, mochte alles andere ihm noch so gleichgültig sein. Er ließ den Führer kommen, der ein wenig Englisch sprach.
»Müssen wir in diesem Teil der Wälder«, fragte René, »mit Überfällen von Räubern rechnen?«
»Nein«, erwiderte der Führer, »in diesem Teil der Wälder gibt es keine Räuber.«
»Und welche Gefahren drohen uns hier?«
»Wilde Tiere.«
»Und was sind das für wilde Tiere?«
»Tiger, Panther und riesige Schlangen.«
»Gut«, sagte René, »reiten wir weiter.« Dann wandte er sich an François und sagte: »Hole mir zwei ordentliche Stücke Brot aus unseren Vorräten.«
François brachte ein in zwei Hälften geteiltes Brot.
Kaum wurden die Elefanten des Brots ansichtig, schienen sie zu wissen, dass es für sie bestimmt war.
Der Elefant mit dem leeren Palankin, der hinter dem anderen ging, näherte sich René, so dass dieser zwischen den zwei Kolossen gefangen war.
Die zwei Schwestern beugten sich voller Entsetzen aus ihrem Palankin. Noch ein Schritt eines der Elefanten, und René und sein Pferd würden zwischen den zwei Kolossen erdrückt.
René beruhigte die Mädchen mit einem Lächeln und zeigte ihnen die Brotstücke. Die Elefantenrüssel waren nicht bedrohlich erhoben, sondern umschlangen den jungen Mann zärtlich und liebevoll.
René ließ sich bitten wie eine Kokotte, die sich ziert, um die Gunst, die sie gewährt, kostbarer zu machen, und enthielt den Elefanten den leckeren Bissen einen Augenblick lang vor, bis er beiden das heißbegehrte Brotstück gab.
Dies war ein neuer Baustein zur Errichtung des Freundschaftstempels zwischen René und den riesigen Vierfüßlern.
»Was hat Ihnen unser Führer vorhin geantwortet?«, fragte Hélène.
»Jedem anderen als Ihnen würde ich sagen, er hätte behauptet, der Wald sei wildreich und wir müssten uns keine Sorgen ob unserer Verpflegung bis zum Land des Betels machen. Doch da Sie eine tapfere Reisegefährtin sind, will ich Ihnen die Wahrheit sagen, und die lautet, dass er uns empfiehlt, nachts kein Auge zuzumachen, es sei denn, verlässliche Augen wachten über uns. Sie können dennoch ruhig schlafen, denn ich werde über Sie wachen.«
Seit sie in dem Wald weilten, war ihnen, als wären sie in einer Kirche; die Reisenden senkten die Stimme, als fürchteten sie, belauscht zu werden. Das Tageslicht war entschwunden, als wäre es bereits sechs Uhr abends, der Blätterhimmel der Bäume war so dicht, dass kein Vogelgezwitscher zu vernehmen war, und man hätte meinen können, die Nacht bräche herein, allerdings ohne die gewohnten Geräusche der Tiere, die erwachen, wenn der Tag endet, und deren Sonnenschein die Finsternis ist, denn im Dunkeln lieben sie, fressen sie und trinken sie, tagsüber aber schlafen sie.
Wahrhaftig furchterregend war die Gewalt dieser Natur, wo ein Sturm eine Sandwüste zu einem Ozean aufwühlt, wo ein einziger Baum einen ganzen Wald ausmacht und wo in den finstersten Tiefen des Waldes, in die gewiss nie ein Lichtstrahl dringt, Blüten in schillerndsten Farben und betörende Düfte anzutreffen sind, indes andere Pflanzen, die im Schatten darben und nur in der Sonne gedeihen, dem Licht entgegenstreben, sich an jedem erstbesten Zweig festhalten, weiterklettern, den Baumwipfel erreichen und dort ihre Blüten öffnen, als wären es in Smaragd eingefasste Rubine oder Saphire; auf den ersten Blick könnte man sie für die Blüten der riesigen Bäume halten, so groß und mächtig wirken sie, doch wenn man ihren Stamm sucht, sieht man eine schmächtige Liane, so dünn wie eine Drachenschnur. In diesen Urwäldern ist alles geheimnisumwoben, doch diese Aura des Geheimnisvollen führt zur schwermütigsten aller Vorstellungen, der des Todes.
Denn der Tod ist dort allgegenwärtig. In jenem Gebüsch lauert der Tiger, auf jenem Ast kauert der Panther. Der weiche, gewundene Stengel, der aussieht wie ein sechs oder acht Fuß über dem Boden gekappter Baum, ist der Kopf einer Schlange mit zusammengerolltem Körper, die ihr Opfer über eine Entfernung von fünfzehn bis zwanzig Fuß erreicht, wenn sie losschnellt. Jener See dort, so ungetrübt wie ein großer Spiegel, beherbergt neben den uns bekannten tödlichen Bewohnern, den Kaimanen, Krokodilen und Alligatoren, auch den riesigen Kraken, den noch kein Fischer vom Grund des Sees an die Oberfläche zu ziehen vermochte und der ein Pferd samt Reiter verschlingen kann, wenn er das Maul aufreißt. Denn wir befinden uns nunmehr in Indien, in dem fruchtbarsten und tödlichsten Teil unseres Universums.
All diese Überlegungen stellte René an, während er unter dem stummen und dunklen Blätterdach voranschritt, das hin und wieder ein schwacher Sonnenstrahl mühsam durchdrang. Mit einem Mal gelangte man aus dem trübsten Dämmerlicht in die strahlendste Helligkeit, als höbe sich ein Vorhang: Die Reisenden waren in Sichtweite des Sees angekommen; um ihn zu erreichen, mussten sie eine Blumenwiese überqueren, wie man sie nur aus Träumen kennt – ein wahres Stück Paradies, das auf die Erde gefallen war. Dichte Blumenhecken, von keinem Botaniker je klassifiziert, verströmten einen so überwältigenden Duft, dass begreifbar wurde, dass man daran sterben konnte. Die Vögel erinnerten an Fabelwesen mit ihren unerhörten Schreien, ihrem smaragdgrünen, rubinroten und saphirblauen Gefieder, und am Horizont erstreckte sich der See wie ein azurblauer Teppich.
Ein Ausruf des Wohlbehagens entrang sich allen Reisenden, als sie nach dem finsteren Wald diese friedvolle Wiese und den prachtvollen See erblickten; die Brust weitete sich, man konnte wieder frei atmen.
Man überquerte die Wiese; schlängelnde Bewegungen im Gras verrieten, dass man Reptilien aufgescheucht hatte. Der Führer, immer auf der Hut, erschlug mit seinem Stock eine kleine Schlange von kaum einem Fuß Länge und mit einem Muster aus gelben und schwarzen Vierecken, deren Biss tödlich ist und die in birmanischer Sprache Schachbrettschlange heißt.
Der Führer erklärte den Reisenden eine Besonderheit des Bisses dieser Giftschlange: die nämlich, dass das Opfer unabhängig von der Tageszeit des Bisses entweder abends bei Sonnenuntergang oder morgens bei Sonnenaufgang stirbt.
Keiner der Reisenden und keines ihrer Reittiere wurde gebissen, und nicht viel später erreichten sie das Seeufer, an dem die Mittagsrast vorgesehen war.
Unterwegs hatte René im Gras Vögel geschossen, die aussahen wie Rebhühner, und Gazellen von Hasengröße. Als guter Pariser hatte François seine Kochkünste in der Vorstadt erworben und konnte mit Gazellen und Rebhühnern recht vernünftig umgehen.
Es erübrigt sich zu sagen, dass René wie gewohnt die Elefanten betreute; als er sah, wie gierig sie die Rüssel nach den Blättern eines Baums ausstreckten, dessen große weiße und rote Blüten wie Fuchsien aussahen, sie aber nicht erreichten, fragte er François, ob seine Ausbildung zum Pariser Gassenjungen ihn auch gelehrt habe, Bäume zu erklettern. Als der andere bejahte, drückte René ihm ein Gartenmesser in die Hand und bat ihn, so viele Zweige wie möglich zu schneiden.
Die Elefanten sahen diesem Vorgehen voller Freude zu, und sie streichelten liebkosend Renés Hände.
René hieß die zwei jungen Mädchen absteigen, und sie beobachteten mit großem Vergnügen die Herausbildung eines Instinkts, der dem menschlichen Denken so nahe kommt. Kaum hatten sie den Boden betreten, stürzten die Elefanten sich auf die Zweige und begannen zu schmausen, unterbrochen von genussvollem Schmatzen und liebevollen Blicken, mit denen sie René und seinen Freundinnen ihren Dank bezeigten.
Alle genossen die Mittagsmahlzeit und die Ruhepause, die sich anschloss, ohne jede bange Vorahnung. Unvorstellbar, dass an einem so schönen Tag in einer so schönen Umgebung irgendeine Gefahr lauern sollte.
68
Der Königspython
An dem Seeufer, dem die Reisenden folgten, wuchs dichtes Gestrüpp, das in Dschungel überging.
Auf seinen Erkundungsgängen in das Unterholz hatte François ein paar Pfauen aufgescheucht, und er wollte unbedingt einige dieser Vögel erlegen, um aus ihrem Gefieder Fächer für die zwei Schwestern machen zu lassen.
Er bat René, nach der Mahlzeit diesem Zeitvertreib nachgehen zu dürfen.
René wusste, dass der Pfau im Dschungel dort weilt, wo auch der Tiger weilt; darauf wies er François hin, doch als typischer Pariser Leichtfuß dachte dieser sogleich, es müsse noch viel vergnüglicher sein, einen Tiger zu erlegen, und er nahm seinen Entersäbel und eines von Renés doppelläufigen Gewehren und begab sich in den Urwald.
Er hatte noch keine zehn Schritte getan, als René bereute, einem so unerfahrenen Jäger gestattet zu haben, allein in den Dschungel zu gehen; da an ihrem Lagerplatz alles ruhig wirkte, machte er François ein Zeichen, auf ihn zu warten, denn bevor er aufbrach, wollte René sich vergewissern, dass den Schwestern kein Ungemach widerfahren würde.
Die Mädchen saßen im Gras und boten einen bezaubernden Anblick inmitten der Wilden, die sie begleiteten. René gab jedem der Elefanten ein Stück Brot zu fressen; dann führte er die zwei Kolosse zu einem Baum, dessen riesige, dicht belaubte Zweige sich bis auf zwanzig Fuß hinunterwölbten, wies auf die beiden Schwestern und sagte zu den Elefanten, als wären sie seiner Sprache mächtig: »Bewacht sie gut.«
Die Mädchen lachten über diese Vorsichtsmaßnahme, die ihnen recht übertrieben vorkam, da sie keine Gefahr drohen sahen.
Bevor er sie verließ, schärfte René ihnen alle möglichen Verhaltensmaßregeln ein, darunter die, dass sie sich im Fall des Angriffs durch ein wildes Tier zwischen die Beine der Elefanten flüchten sollten, die eine uneinnehmbare Festung darstellten.
René führte ein anderer Wunsch in den Dschungel als der, einen Pfau zu erlegen; wie wir wissen, hatte er bereits mit einigen indischen Ungeheuern zu tun gehabt, doch einem Tiger war er noch nicht begegnet. Er drückte beiden Schwestern die Hand, eilte hinter François her und verschwand mit ihm im dichten Unterholz.
Das Unterholz verwandelte sich schnell in unwegsamen Dschungel, durch den man sich ohne Hilfe einer Machete keinen Weg bahnen konnte.
François hatte schon seinen Säbel gezückt, als René einen frisch gebahnten Pfad entdeckte, auf dem verstreute Knochen verrieten, dass ein großes fleischfressendes Tier vor wenigen Stunden den Dschungel durchstreift hatte.
René rief François und betrat den Pfad.
Sein Gefährte folgte ihm.
Nach mehreren Windungen des Pfades unter dem Blätterdach, das sich wie eine Kuppel über ihren Häuptern wölbte, gelangten sie zur Höhle des Tiers. Es handelte sich um das Lager eines Tigerpaares, doch beide Majestäten waren ausgegangen; zwei kleine Tiger, kaum größer als dicke Katzen, spielten knurrend miteinander.
Als sie der fremden Geschöpfe ansichtig wurden, zeigten die kleinen Tiger ihre Krallen und fauchten, doch René streckte die Hand aus, packte eines der Jungen am Nacken und warf es François mit den Worten zu: »Da, nimm!« Dann ergriff er das zweite Junge und verließ schnellen Schritts den Bau, in dem er wehrlos gewesen wäre. Die Tigerjungen knurrten und maunzten, als wollten sie sich bei ihrer Mutter über die Vertraulichkeiten beklagen, die man sich mit ihnen erlaubte.
Im selben Augenblick erklang wenige hundert Schritte entfernt ein furchterregendes Brüllen. Das war die Mutter, die das Geschrei ihrer Kinder beantwortete.
»Raus aus dem Dschungel, raus aus dem Dschungel!«, rief René, »sonst sind wir verloren!«
François ließ sich nicht lange bitten, denn das Brüllen machte ihm klar, in welcher Gefahr sie sich befanden. Er rannte los, ohne den kleinen Tiger loszulassen, den er nach Frankreich mitnehmen und dem Pariser Zoo verkaufen wollte, und bald befand er sich außerhalb des Dschungels und in dem Saum aus Büschen am Waldesrand.
Abermals ertönte Gebrüll, diesmal aus nur mehr hundert Schritt Entfernung.
Zwanzig Schritte vor den Jägern befanden sich ein Baum und ein Strauch.
»Lass den kleinen Tiger los«, rief René und ließ die eigene Beute fallen. »Spring auf den Baum, ich nehme den Busch!«
Kaum hatten die beiden ihren Posten bezogen, ertönte ein drittes Brüllen, das sich diesmal ausnahm, als entlüde sich über ihren Köpfen ein Gewitter, und eine Tigerin sprang zwanzig Schritt von ihnen entfernt auf den Boden, als wäre sie hergeflogen und nicht gelaufen.
Für einen Augenblick zögerte sie sichtlich zwischen Mutterliebe und Rachsucht, bis die Mutterliebe siegte. Sie kroch auf ihren Nachwuchs zu und miaute wie eine Katze, doch es war ein fürchterliches Miauen.
Dabei bot sie François ihre ungeschützte Seite, und dieser legte an und schoss.
Die Tigerin, überraschend getroffen, tat einen Luftsprung und fiel zu Boden.
François hatte ihr die linke Schulter zerschmettert.
Die Tigerin erkannte schnell, welcher der zwei Schützen auf sie geschossen hatte, denn ihn umhüllte noch der Rauch; sie wendete sich in seine Richtung und tat trotz ihrer Verletzung einen gewaltigen Sprung auf ihn zu.
François hielt es für klüger, sie nicht noch näher kommen zu lassen, und feuerte den zweiten Gewehrlauf ab. Die Tigerin wälzte sich auf den Rücken, stieß ein grauenerregendes Röcheln aus, wälzte sich unter großer Anstrengung auf den Bauch und zerfurchte mit der gesunden Pfote den Boden, während sie die Zähne ins Gras grub, welches das Blut aus ihrer Schnauze rötete.
»Es hat sie erwischt! Es hat sie erwischt, Monsieur René«, rief François so freudig wie ein Kind, das sein erstes Kaninchen zur Strecke gebracht hat.
»Nimm dich in Acht, du Dummkopf«, herrschte René ihn an, »und lade sofort dein Gewehr nach!«
»Aber wozu, Monsieur René, wo sie doch mausetot ist?«
»Und der Tiger, ist der auch tot, du Schwachkopf? Hörst du ihn denn nicht?«
Kein Laut hat das menschliche Ohr je so erschreckt wie das Gebrüll, das sie nun vernahmen.
»Lade dein Gewehr, lade es endlich, und nimm hinter mir Aufstellung«, sagte René eindringlich. Als er jedoch sah, dass sein Begleiter vor Freude, Erregung oder Furcht so stark zitterte, dass er das Pulver auf dem Boden verstreute, statt es in den Gewehrlauf zu schütten, reichte er ihm sein geladenes Gewehr und nahm das andere Gewehr an sich.
Innerhalb einer Minute waren beide Gewehrläufe mit Pulver und Kugeln versehen, und die Gewehre wurden abermals getauscht.
»Er brüllt nicht mehr«, flüsterte François René zu.
»Und er wird auch nicht mehr brüllen«, sagte René. »Da sein Weibchen nicht geantwortet hat, weiß er, dass es entweder tot oder in einen Hinterhalt geraten ist. Um nicht ebenfalls gefangen zu werden, wird er versuchen, die Falle zu erkunden. Vorsicht! Wir müssen wachsam sein.«
»Pst!«, flüsterte François René ins Ohr. »Ich höre Zweige knacken.«
Im selben Augenblick drückte René seine Schulter und zeigte mit dem Finger auf den riesigen Kopf des Tigers, der geduckt am Ende des Pfades im Dschungel erschien. Nachdem er seinen Bau leer vorgefunden hatte, war er lautlos aus dem Wald geschlichen.
François nickte zum Zeichen, dass er ihn gesehen hatte.
»Auf Philipps rechtes Auge«, sagte René laut. Und er feuerte.
Mehrere Sekunden lang vernebelte der Rauch die Sicht.
»Da ich noch lebe«, sagte René gelassen, »nehme ich an, dass der Tiger tot ist.«
In der Tat sah man den Tiger röchelnd letzte Zuckungen vollführen.
»Warum sagten Sie vorhin, bevor Sie schossen: ›Auf Philipps rechtes Auge‹? Hieß dieser Tiger am Ende Philipp?«
»Nein«, sagte René, »er hieß vermutlich Tiger, und deshalb muss man sich vor ihm in Acht nehmen.«
Der Tiger war tödlich getroffen; man musste sich nicht mehr vor ihm fürchten, sondern konnte in Ruhe abwarten, dass der Tod sein Werk verrichtete. Es dauerte nicht lange, und der Tiger hatte sein Leben ausgehaucht, obwohl ihn nur eine Kugel getroffen hatte; sein Weibchen mit zwei Kugeln im Leib hatte länger gekämpft als er. Allerdings war Renés Kugel in das rechte Auge des Untiers gedrungen, wie der Meisterschütze angekündigt hatte, und auf diesem Weg unmittelbar in das Gehirn gelangt, was den sofortigen Tod des Tigers bewirkte, während man eine Viertelstunde lang hatte warten müssen, bis das Weibchen seinen letzten Seufzer tat.
Die zwei Jäger verharrten eine Weile in der Hoffnung, dass ihre Gewehrschüsse einige ihrer Begleiter anlocken würden, sei es nur aus Neugier, doch sie warteten vergebens; daraufhin beschlossen sie, zu ihren Reisegefährten zurückzukehren und mit einem Pferd die Kadaver der zwei Tiger abzuholen.
François jedoch wollte sich um nichts in der Welt von seiner Beute trennen; er warf sich das geladene Gewehr über die Schulter, ergriff jedes der beiden Tigerchen, wie er sie nannte, am Genick, wartete, dass René sein Gewehr nachlud, und machte sich mit ihm auf den Weg zum See, der höchstens einen Kilometer weit entfernt war.
Sie hatten kaum hundert Schritte getan, als ein Ruf wie Fanfarenklang im Wald widerhallte, gefolgt von einem zweiten ebensolchen Ton.
Die zwei jungen Männer sahen einander ratlos an. Dieser Ruf war ihnen völlig unbekannt. Welches Tier mochte ihn ausgestoßen haben?
Mit einem Mal schlug René sich an die Stirn. »Ach!«, rief er. »Unsere Elefanten rufen um Hilfe!«
Und er eilte so schnell davon, dass François es aufgab, mit ihm Schritt halten zu wollen.
René hatte sich in der Richtung nicht getäuscht, und er erreichte den See keine zwanzig Schritte von der Stelle entfernt, an der er die zwei Schwestern zurückgelassen hatte. Er blieb stehen, wie versteinert von dem schaurigen Schauspiel, das sich seinen Augen bot.
Die Eskorte hatte sich in einiger Entfernung zerstreut. Die Schwestern saßen noch immer am Fuß des Baums, hielten einander umarmt und waren vor Angst wie gelähmt. Die zwei Elefanten waren als Einzige auf dem Posten geblieben und hielten mit ihren erhobenen Rüsseln eine riesige Boa in Schach, die sich um einen der niedrigsten Äste des Baums gewickelt hatte, unter dem die Mädchen saßen, und ihren abscheulichen Kopf hin und her wiegte, ohne den Blick von den Mädchen abzuwenden, die sich wie hypnotisiert nicht von der Stelle rührten.
Die Elefanten standen kampfbereit, um die kostbare Fracht zu beschützen, die ihnen anvertraut war. Die Männer der Eskorte hatten die Flucht ergriffen, denn mit Säbeln und Piken als einzigen Waffen waren sie einem solchen Gegner nicht gewachsen.
Als die Elefanten René erblickten, trompeteten sie vor Freude.
Der Mann, den sie gerufen hatten, hatte ihren Ruf gehört und war gekommen. Mit einem Blick erfasste René, was zu tun war. Er legte sein Gewehr hin, sprang zu den beiden Mädchen, nahm sie in die Arme wie zwei Kinder und übergab sie François, der gerade aus dem Wald kam und dem er einschärfte, sich um sie zu kümmern.
»So«, sagte er mit einem Seufzer der Erleichterung, dann ergriff er sein Gewehr: »Meister Python, nun zu uns! Jetzt wollen wir sehen, ob die Kugeln eines Lepage den Pfeilen eines Apoll ebenbürtig sind!«
Der Blick der Boa war den zwei jungen Mädchen gefolgt; offenbar wollte die Riesenschlange nicht kampflos auf ihre Beute verzichten. Gleichzeitig wusste sie jedoch, welchen Kampf sie mit den zwei Kolossen auszufechten hätte, die sich ihr in den Weg stellen würden.
Die Schlange ließ ein Zischen ertönen, das wie das Sausen des Sturmwinds klang. Stinkender Geifer troff aus ihrem Maul, ihre blutunterlaufenen Augen sandten Blitze aus, wenn sie den Kopf bewegte, und ihr Hals, die schmalste Stelle des Körpers einer Boa, war so dick wie ein Fass.
Die Windungen des Schlangenkörpers verloren sich in Astwerk und Laub des Baums.
René stemmte beide Beine auf den Boden. Er hatte es mit einem Gegner zu tun, den er mit dem ersten Schuss erlegen musste; er zielte auf das aufgerissene Maul und gab beide Schüsse ab. Der Baum wackelte unter den Zuckungen des Ungeheuers, das in die Zweige zurückkroch und von dem Laub verdeckt war, das wie bei einem Erdbeben geschüttelt wurde.
François kam herbeigeeilt, streckte René sein geladenes Gewehr hin und nahm ihm das leergeschossene ab.
»Bring die zwei Damen so weit weg wie möglich«, sagte René, »und lass mir deinen Entersäbel da.«
François gehorchte und führte die jungen Mädchen weg.
Die Elefanten hielten ihre Rüssel noch immer erhoben und verfolgten die Schlange mit dem Blick. Außer René sahen alle dem Schauspiel voller Schauder zu.
René hatte dafür keine Zeit.
Die Elefanten trampelten auf den Boden, als wollten sie die Schlange aus ihrem Versteck locken.
Und schon erschien sie: Ihr scheußlicher, unförmiger, blutverschmierter Kopf glitt den Baumstamm hinunter.
Zwei neue Gewehrsalven trafen das Reptil.
Ob aus Entkräftung oder bewusstlos durch die vierfache Verwundung – das Tier hatte offenbar die Herrschaft über seine Bewegungen verloren und stürzte wie ein Erdrutsch zu Boden.
Wenn die Pagode von Rangun über ihrer granitenen Basis eingestürzt wäre, hätte dies kaum lauter gedonnert und die Erde kaum vernehmlicher erschüttert.
Sobald die fühllos, aber nicht kraftlos gewordene Boa den Boden berührte, entrollte sie sich wie eine Feder, doch da sie in Reichweite eines Elefanten geriet, ohne ihn zu sehen, setzte dieser den Fuß auf ihren zerschundenen Kopf; sie bäumte sich mit aller Kraft auf, um der schrecklichen Umklammerung zu entkommen, doch Gewicht und Kraft des Elefantenfußes waren zu stark, und die Riesenschlange wand sich wie ein Wurm, der zertreten wird, und schlang sich um die Masse, die sie berührte.
Der zweite Elefant erkannte die Gefahr, in die sein Gefährte geraten war, und versuchte, die Schlange mit seinem Rüssel zu packen; die Boa jedoch, die den ersten Elefanten nur mit einem Drittel ihres Körpers umschlungen hatte, wand ihren beträchtlichen Rest um den zweiten Elefanten.
Für einen Augenblick bot das Gewirr unförmiger Körpermassen eine ins Riesenhafte vergrößerte Parodie der Laokoongruppe.
Die Elefanten brüllten vor Schmerzen, und René wirkte wie ein Pygmäe mitten unter diesen vorsintflutlichen Kolossen, doch andererseits verfügte er als Mensch über die Gabe des Denkens, und die konnte ihm zum Sieg verhelfen.
Er hob den Entersäbel auf, den François ihm vor die Füße geworfen hatte, und als durch die äußerste Anstrengung beider Elefanten ein Stück der Boa zwischen ihnen gestreckt war und keinen von ihnen berührte, erhob René den scharfen Säbel und teilte mit einem Schlag wie ein Homerischer Halbgott oder wie einer der Helden aus Tassos Befreitem Jerusalem das Reptil in zwei Hälften, die sich zwar noch regten, kraftlos jedoch, und bald zu Boden fielen.
Einer der Elefanten ließ sich halb erstickt in die Knie sinken; der andere blieb stehen, wenngleich er schwankte und die Luft mit schrillem und schmerzlichem Keuchen einsog.
René lief zum See, füllte seinen Hut mit Wasser und flößte es dem stehenden Elefanten in kleinen Schlucken ein; der kniende Elefant musste erst zu Atem kommen. Dann rief René die Elefantenführer herbei und eilte zu den jungen Mädchen, die bleich vor Todesangst warteten. Er nahm sie in die Arme und drückte sie an die Brust wie zwei Schwestern. Bei dieser Umarmung berührte Janes Mund Renés Lippen, doch er wendete schnell sein Gesicht ab, und Jane stieß einen tiefen Seufzer aus.
69
Die Wegelagerer
Im ersten Augenblick gab sich jeder seinen Empfindungen hin.
René, der noch immer die zwei Schwestern stützte, setzte sich mit ihnen auf einen kleinen Rasenfleck.
Wachsam aus Vorsicht, ließ er sich von François sein neugeladenes Gewehr geben.
François’ Gewehr und Entersäbel lagen noch auf dem Schlachtfeld.
Zartfühlend wie eine Gouvernante holte René einen goldgefassten Kristallflakon mit Riechsalz aus der Tasche und reichte ihn den jungen Damen.
Sobald sie sich beruhigt hatten, war Hélène als Erste imstande, René zu antworten, der wissen wollte, wie es dazu gekommen war, dass die Schlange so nahe heranschleichen konnte, ohne dass sie zu fliehen versuchten.
Nach der Mittagsmahlzeit und im Vertrauen auf den Schutz ihrer zwei riesigen Wächter waren die Mädchen eingeschlummert.
Nach einiger Zeit hatte Hélène im Schlaf ein sonderbares Unwohlsein verspürt. Ein süßlicher, übelkeiterregender Geruch war ihr aufgefallen, ihr war gewesen, als hörte sie Entsetzensschreie, doch erst als die Elefanten wie ein Erdbeben zu trampeln begonnen hatten, war es ihr gelungen, die Augen zu öffnen. Und da hatte sie keine zwanzig Fuß entfernt den scheußlichen Kopf des Untiers erblickt, das sie mit aufgerissenem Maul anstarrte.
Der ekelerregende Geruch und Gifthauch des Schlangenatems hing noch in der Luft.
Hélène hatte ihre Schwester geweckt und hatte fliehen wollen, doch es war ihr nicht gelungen, sich aufzurichten, und voller Schrecken hatte sie sich daran erinnert, dass Schlangen über die Macht der Hypnose verfügen und die Fähigkeit haben, Vögel vom Baum fallen zu lassen und Tiere anzulocken, die sie zu verspeisen gedenken.
Hélène erinnerte sich, in den vor Kurzem erschienenen Reiseberichten Lillants gelesen zu haben, wie der berühmte Reisende Gefahr gelaufen war, einer solchen Hypnose zu erliegen, die er nur durch das Abfeuern eines Gewehrschusses zu durchbrechen vermocht hatte.
Hélène hatte rufen wollen, um Hilfe rufen, doch wie in einem Albtraum war kein Wort über ihre Lippen gekommen.
Mit dem Blick hatte sie nach René gesucht, und als sie ihn nicht fand, hatte sie ihr Schicksal für besiegelt gehalten.
Von da an hatten sich Wahrnehmung und Einbildung vermischt bis zu dem Augenblick, da sie spürte, dass sie weggezogen wurde, und sich in Renés Armen wiederfand, als sie die Augen öffnete.
Sobald sie aus dem Blickfeld und der magnetischen Anziehung der Schlange entfernt war, war sie ihrer Sinne wieder mächtig, doch das Ende des Kampfes war so schrecklich anzusehen gewesen, dass sie die Augen erneut geschlossen hatte.
Nun, da sie sich unversehrt neben demjenigen wiederfand, der gelobt hatte, sie zu beschützen, fehlten ihr die Worte, auszudrücken, was sie empfand.
Jane lauschte den Worten ihrer Schwester, ohne selbst etwas zu sagen; dass sie bei Bewusstsein war, entnahm René dem Zittern ihres Körpers, dem unwillkürlichen Druck ihrer Hand und den stillen Tränen, die unter ihren Lidern hervorquollen und ihre Wangen hinabrannen.
Als das erste Erstaunen über den herkulischen Kampf nachließ, konnte François die Aufmerksamkeit auf sich und seine zwei Tigerjungen lenken, und er berichtete, wie er das Tigerweibchen mit zwei Gewehrschüssen getötet hatte, während Monsieur René den Tiger mit einem einzigen Schuss erlegt hatte.
Die beiden prachtvollen Tigerfelle sollten nicht verloren sein, und René bot zehn Talks für diejenigen, die es wagten, die Trophäen zu holen, auf Pferden oder auf einer Tragbahre aus Stangen. Die Soldaten der Eskorte entschieden sich für die Tragbahre, und da alle sich meldeten, verdoppelte René das Preisgeld, damit sowohl diejenigen, welche die toten Tiere holten, als auch diejenigen, die zurückblieben, belohnt wurden.
François wollte sein Gewehr und seinen Säbel von der Kampfstätte holen, doch er sah, dass die zwei Elefanten sie herbrachten und René zu Füßen legten.
François ergriff seine Waffen und ging an der Spitze des Zuges in den Dschungel.
Nun musste René den Kampf mit den zwei Tigern schildern. Er tat es einfacher und bescheidener, als ein Jäger aus dem Faubourg Saint-Denis sich vor staunendem Publikum der Jagd auf ein Kaninchen im Wald von Vésinet rühmt.
Die Tiger wurden dort vorgefunden, wo sie das Leben ausgehaucht hatten, und in einem wahren Triumphzug auf die Lichtung gebracht.
Unterdessen hatten sich die Zurückgebliebenen die Zeit damit vertrieben, die tote Schlange zu messen; sie hatte einen Meter Durchmesser und war sechsundvierzig Fuß lang.
Die Elefanten waren interessant zu beobachten. Sie wussten, dass René ihnen ganz offenkundig das Leben gerettet hatte. Mit unvorstellbar zarten Gesten streichelten sie ihn mit ihren Rüsseln, und Hélène stand mit ihnen auf so vertrautem Fuß, dass sie sich von ihnen die Handschuhe ausziehen ließ, was sie mit staunenswerter Geschicklichkeit ausführten.
Die Stunde des Aufbruchs war gekommen. Man verließ die bezaubernde Landschaft, in der sich Szenen von einer Gewalttätigkeit abgespielt hatten, wie sie nur Gottes Auge in tiefster Wüsteneinsamkeit je zu sehen bekommen haben mochte.
Die jungen Mädchen nahmen in ihrem Palankin Platz, und René und François bestiegen den zweiten Elefanten, der sich von dieser Gunst überaus geschmeichelt zeigte.
Die Begleiter führten die Pferde am Zügel.
Nach wenigen Stunden näherte man sich wieder dem Wald, den man gegen elf Uhr vormittags verlassen hatte. Er barg das gleiche Halbdunkel und die gleichen Schrecknisse unheimlicher Natur wie der Wald zuvor, doch vermehrt durch das Wissen der Reisenden, die erlebt hatten, dass die Gefahren, die sie erwarteten, keine Ammenmärchen, sondern handfeste Wirklichkeit waren.
Auf der Stelle traf man alle Vorkehrungen, um ein sicheres Lager für die Nacht einzurichten. Kleine Bäume wurden gefällt, aus denen man Pfosten schnitt, die zu einer Umfriedung von fünfzehn Fuß Durchmesser in den Boden gerammt wurden. Die Palankins wurden wie gewohnt abgestellt, und die jungen Mädchen richteten sich darauf ein, die Nacht darin zu verbringen. Das Abendessen bestand aus zwei Gazellen, die François unterwegs erlegt hatte und deren Blut er auffing und seinen zwei Tigerjungen anstelle von Muttermilch zu trinken gab, was sie sich gerne gefallen ließen. Um wilde Tiere fernzuhalten, entfachte man außerhalb der Umfriedung Feuer, die man von innen unterhalten konnte. Zu diesem Zweck schichtete man trockenes Holz auf, denn bekanntlich ist eine Brustwehr von sechs bis sieben Fuß Höhe nur ein unzulänglicher Schutz gegen Tiger oder Panther, ein Feuer hingegen hält sie auf Abstand.
Verglichen mit dem vorausgegangenen Tag, verlief die Nacht ruhig; durch die Zwischenräume der Brustwehr sah man zwar Augen wie glühende Kohlen funkeln, und ganz in der Nähe hörte man Gebrüll, das die Herzen der Reisenden heftig klopfen machte, doch angesichts der Erlebnisse der vorausgegangenen Stunden war dies so unbedeutend, dass die Wächter nicht einmal ein Feuer entzündeten. Zudem hatten François und René sich die Nachtwache geteilt, während die Elefanten tapfer nacheinander Wache standen.
Um sechs Uhr morgens waren alle auf den Beinen; noch am selben Tag wollte man den Wohnort der zwei Schwestern erreichen. Es galt nur mehr, den Teil des Dschungels zu durchqueren, der weniger seiner wilden Tiere als der dort lauernden Banditen wegen gefürchtet war.
Die Banditen hausten in den Bergen, denen der Fluss Pegu entspringt, und wenn sie verfolgt wurden, war ihre Zuflucht das Dorf Taungu. Die Plantage der Schwestern Sainte-Hermine befand sich nahe diesen Bergen am Ufer des Sittang, und dieser Umstand machte einen Teil ihres Werts aus, da ihre Erzeugnisse auf dem Fluss bis zum Meer transportiert werden konnten.
Nach einem leichten Frühstück machten sich die Reisenden auf den Weg. Diesmal bestiegen René und François ihren Elefanten, dessen Palankin sie in ein wahres Munitionsdepot verwandelt hatten. Die Befürchtung, Wegelagerern zu begegnen, vor denen es die jungen Mädchen zu beschützen galt, hatte René einen Plan eingegeben, in dem die Elefanten eine Rolle spielten, denn er vertraute darauf, dass seine dickhäutigen Freunde ihn nicht im Stich lassen würden.
Gegen elf Uhr erreichte man eine Stelle, die sich zum Ausruhen anbot: die Ruinen eines Dorfs, das die Wegelagerer verwüstet hatten, welche die Umgebung besetzt hielten und sich in kleinen Kontingenten von zwölf bis fünfzehn Mann schnell von einem Ort zum anderen bewegten.
Während sich die Reisenden den Dorfruinen näherten, darauf gefasst, mit Banditen zusammenzutreffen, hatte René seine Vorkehrungen wie ein General getroffen und die Befehle für den Fall eines Angriffs gegeben. Es sollte jedoch ein Zwischenfall eintreten, der all seine Vorsichtsmaßnahmen überflüssig machte.
Als man sich zum Mittagessen niedergelassen hatte, hörte man Schüsse aus vielleicht einem halben Kilometer Entfernung, die offenbar vom Ufer des Sittang-Flusses ertönten. Allem Anschein nach lieferte sich eine andere Reisegruppe ein Gefecht mit den Banditen. René ließ sogleich sechs Mann auf einem Elefanten Platz nehmen, sprang selbst auf ein Pferd, befahl François, das andere zu besteigen, und eilte in Richtung der Schüsse. Sie gelangten an das Flussufer und sahen eine Barke, die von drei anderen Barken aus angegriffen wurde.
In der angegriffenen Barke befanden sich zwei Engländer, gut erkennbar an ihren roten Uniformen mit goldenen Epauletten; sie waren von einer zehnköpfigen Eskorte begleitet, die wie Renés Eskorte nur mit Piken bewaffnet war.
Die Wegelagerer hingegen hatten mehrere schlechte Gewehre, und jede ihrer drei Barken war mit einem Dutzend Männer bemannt.
Zwei der Barken versuchten, die Barke der Reisenden zu entern; aus der dritten warf man Gefallene in den Fluss.
Augenscheinlich waren die Feuerwaffen der Engländer denen der Räuber weit überlegen, doch ebenso unübersehbar war, dass sie ohne die unerwartete Hilfe den zahlreichen Angreifern unterliegen mussten.
»Nur Mut, Kapitän«, rief René in tadellosem Englisch, »manövrieren Sie Ihr Boot an unser Ufer. Wer auf Sie anlegt, ist ein toter Mann.«
Tatsächlich knallten zwei Schüsse, und zwei Banditen fielen. René tauschte mit François das Gewehr, und wieder fielen zwei Banditen.
»Lade«, ordnete René an und zog eine Pistole aus dem Gürtel.
Eine der Räuberbarken hatte an der des englischen Offiziers angelegt, und ein Bandit schickte sich an, von dem einen Boot in das andere zu springen, doch ein Pistolenschuss sandte ihn in den Fluss.
Die zwei Engländer feuerten mit ihren doppelläufigen Gewehren, als sie sahen, wie tatkräftig man ihnen zu Hilfe kam, und drei weitere Räuber sanken nieder.
Unterdessen hatte der Elefant begriffen, was man von ihm erwartete. Er war zum Fluss hinuntergestiegen, ohne sich an seinem Elefantenführer und den sechs Männern auf seinem Rücken zu stören. Und da der Fluss nicht tief war, hatte er den Vorderfuß auf eine der Barken gestellt und sie versenkt. Die Männer der Besatzung, die auftauchten, erschlug er einen nach dem anderen mit seinem Rüssel, und die Männer der Eskorte halfen mit ihren Piken nach.
Mit neuem Mut kämpften die Engländer so unverdrossen, dass sie mit jedem Schuss einen Wegelagerer trafen. Nach wenigen Minuten hatten die Banditen die Hälfte ihrer Leute eingebüßt und mussten den Rückzug antreten.
Ihr Anführer gab den Befehl zum Rückzug, doch kaum hatte er ihn ausgesprochen, fiel er tot nieder. Sein Befehl hatte seine Position verraten, und René hatte ihn mit einem letzten Pistolenschuss gerichtet.
Nun verwandelte sich die Flucht der verbliebenen Räuber in ein heilloses Durcheinander: Gewehrschüsse rissen neue Lücken in die Reihen der Fliehenden. Die Barke der Engländer legte am Ufer an, der Offizier trat an Land, von René mit den Worten begrüßt: »Sir, ich bedaure zutiefst, dass niemand da ist, der uns miteinander bekannt machen kann.«
»Sie haben sich so eindrucksvoll eingeführt«, sagte der Engländer und drückte René die Hand, »dass Sie auf einen Zeremonienmeister getrost verzichten können. Darf ich Sie fragen, wo wir uns befinden und wie weit es bis zu Rangoon House ist, dem Ziel unserer Reise?«
»Sie befinden sich zwei bis drei Meilen von den Ländereien des Vicomte de Sainte-Hermine entfernt und höchstens eine Viertelmeile von unserer Karawane, die ich verließ, als ich Ihre ersten Gewehrschüsse hörte. Sollten Sie wünschen, sich uns anzuschließen und Ihre Reise auf dem Landweg zu beenden, könnte ich Ihnen je nach Wahl ein Pferd oder einen Elefanten als Reittier anbieten, denn auch wir sind auf dem Weg zur Plantage des Vicomte.«
»Ich nehme das Pferd«, sagte der englische Offizier, »das ist weniger prahlerisch; und gern füge ich hinzu, wie sehr ich mich freue, am anderen Ende der Welt einem Landsmann zu begegnen, der so tapfer und ein so hervorragender Schütze ist.«
René konnte ein Lächeln über den Irrtum des Offiziers nicht verbergen; er übergab ihm die Zügel seines eigenen Pferdes und rief François zu: »François, geben Sie auf meine Waffen Acht und folgen Sie uns mit dem Elefanten.«
Dann sprang er auf das zweite Pferd, deutete in die Richtung des Lagers und sprengte im Galopp voraus. Nach nicht einmal fünf Minuten war der Lagerplatz erreicht, wo die übrigen Reisenden wohlbehalten angetroffen wurden.
Jane aber machte sich so große Sorgen, dass sie nicht in ihrem Palankin hatte warten wollen. Sie und ihre Schwester hatten ihn verlassen und waren den Reitern entgegengewandert, als sie das Hufgetrappel hörten.
René und der Engländer stiegen formvollendet vom Pferd; René ergriff die Hand des Engländers, verbeugte sich vor Mademoiselle de Sainte-Hermine und sagte: »Miss Hélène, ich habe die Ehre, Ihnen Sir James Asplay vorzustellen«, und an den Engländer gewendet: »Sir James Asplay, ich habe die Ehre, Ihnen Miss Hélène de Sainte-Hermine und ihre Schwester Miss Jane vorzustellen.«
Dann verließ er die jungen Leute, um sie ungestört der Wiedersehensfreude zu überlassen.
Jane schenkte René einen Blick, in dem sich ein Rest Besorgnis mit dem Ausdruck zärtlichster Liebe mischte, bevor sie ihrer Schwester folgte. Ihre Worte hatte sie noch im Zaum, doch weder ihr Herz noch ihren Blick.
Zehn Minuten später trat Sir James zu René, der gerade die Kammern und Läufe seiner Gewehre mit einem Taschentuch putzte, und sagte mit einer Verbeugung: »Monsieur, das volle Ausmaß meiner Dankesschuld ist mir jetzt erst bekannt; Mademoiselle Hélène hat es mir berichtet, und sie bittet mich, Ihnen zu sagen, wie ungern sie sich Ihrer Gesellschaft beraubt sieht.«
René gesellte sich wieder zu den anderen, und zwei Stunden darauf, als die Dunkelheit hereinbrach, begrüßte das Gebell einer Hundemeute die Ankunft der Karawane auf den Ländereien des Vicomte de Sainte-Hermine.
In dem Wissen, wie traurig es für die jungen Mädchen gewesen wäre, drei Tage lang mit einem Sarg zu reisen, dem Sarg des eigenen Vaters, hatte René Sorge getragen, dass die sterblichen Überreste des Vicomte von einer gesonderten Eskorte drei Tage später in das Land des Betels gebracht wurden.
70
Die Familie des Verwalters
Seit etwa eineinhalb Stunden hatten die Reisenden bemerkt, dass sie einem halbwegs kenntlichen Weg folgten, der zu einer Niederlassung mit zahlreichen Einwohnern führte. Bei näherer Untersuchung sah man die Spuren von Elefanten, Wasserbüffeln und Pferden. Der Weg endete an einem Fallgatter, das als Tor zu einer Zugbrücke fungierte. Durch die Pfosten des Fallgatters sah man die Umrisse mehrerer Hütten, die ein Gebäude flankierten, welches allem Anschein nach das Herrenhaus dieses Miniaturdorfs war. Den Anlass für den Aufruhr unter der Hundebewohnerschaft der Anlage hatte René gegeben, indem er sein Jagdhorn gezückt und das Signal der Rückkehr von der Fuchsjagd geblasen hatte.
Sir James war zusammengezuckt, denn seit seiner Abreise aus England hatte er kein so keck geblasenes Hornsignal zu hören bekommen.
Die Hunde, die so etwas noch nie gehört hatten, und die Bewohner der Niederlassung, die mit Ausnahme des Patriarchen nicht die geringste Vorstellung von dem Instrument haben konnten, das ihre Nachtruhe störte, was sonst nur dem Gebrüll wilder Tiere vorbehalten war, waren alle miteinander herbeigeeilt, die Hunde aus ihren Winkeln, wo sie sich abends frei bewegen durften, die Menschen aus ihren Hütten, wo sie nach beendetem Tagewerk mit ihren Familien das Abendbrot aßen.
Im Herrenhaus brach Geschäftigkeit aus: Türen wurden aufgerissen, Fensterflügel knarrend geöffnet, und ein Dutzend Diener in allen Hautfarben – Neger, Inder, Chinesen – erschienen mit entzündeten Harzfackeln in der Hand.
Ein Greis ging ihnen voran. Die Fackel in seiner Hand beleuchtete sein Gesicht, und man sah, dass er an die siebzig Jahre zählen musste. Seine langen weißen Haare und der weiße Vollbart hatten zweifellos weder Schere noch Rasiermesser gesehen, seit er nach Indien gekommen war. Große schwarze Augen, die ihr Strahlen nicht verloren hatten, waren von dichten silbrigen Brauen beschattet; die Körperhaltung des Mannes war aufrecht, sein Gang fest; zehn Schritt vor dem Tor blieb er stehen.
»Gegrüßt seien die Fremden«, sagte er, »die sich meiner Gastfreundschaft anempfehlen wollen; doch da wir uns nicht in Frankreich befinden, muss ich Sie bitten, mir zu sagen, wer Sie sind, bevor ich Ihnen die Tür eines Hauses öffnen kann, das mir nicht gehört.«
»Es wäre an meinem Vater, Ihnen zu antworten«, erwiderte Hélène, »doch ihm hat der Tod die Lippen versiegelt, und er kann nicht mehr sagen, was wir nun in seinem Namen sagen. Gottes Segen sei mit dir, Guillaume Remi, und mit deiner Familie!«
»Oh! Dass mir der Himmel dies vergönnt!«, rief der Alte. »An der Stelle meines verstorbenen Herrn die jungen Herrinnen, die ich so sehnlich erwartet habe, die ich noch nie sah und die vor meinem Tod zu sehen ich nicht mehr zu hoffen wagte!«
»Ja, Remi, wir sind es«, sagten beide Schwestern wie aus einem Mund.
Dann sprach Hélène allein weiter: »Öffne schnell, lieber Remi, denn wir sind müde von unserer dreitägigen Reise, und wir bringen Gäste mit uns, die noch ermüdeter wären als wir, hätten sie nicht ihre Tapferkeit und ihre Hingabe aufrechterhalten.«
Der alte Mann lief zum Tor und rief: »Her mit euch, Jules und Bernard! Lasst uns den vornehmen Herrschaften, die zu Besuch kommen, das Tor öffnen!«
Zwei kräftige Burschen von zweiundzwanzig und vierundzwanzig Jahren eilten zum Tor, während der Alte weiterrief: »Adda, sag dem Freitag, er soll die Öfen einheizen, und dem Domingo, er soll dem fettesten Geflügel den Hals umdrehen! Bernard, was hast du am Haken? Jules, was gibt es in der Speisekammer?«
»O Vater, seien Sie unbesorgt«, sagten die Söhne, »wir haben genug Vorräte, um ein ganzes Regiment zu verköstigen, obwohl nicht einmal eine Kompanie zu sehen ist.«
René und Sir James waren vom Pferd gestiegen und halfen Hélène und Jane von ihrem Elefanten herunter.
»Süßes Herz Jesu!«, rief Remi beim Anblick der jungen Mädchen. »So hübsche Kinder! Und wie heißen Sie mit irdischem Namen, meine lieben Engel aus dem Paradies?«
Jane und Hélène nannten beide ihren Namen.
»Mademoiselle Hélène«, sagte der alte Mann, »Sie gleichen Ihrem Herrn Vater, dem Vicomte; und Sie, Mademoiselle Jane, sind Madame, Ihrer Mutter, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ach, meine geliebte Herrschaft«, fuhr er fort und schüttelte den Kopf, so dass die Tränen fielen, die an seinen Wimpern gehangen hatten, »nie werde ich sie wiedersehen! Niemals! Nicht auf Erden! Doch das ist nicht alles«, sprach er weiter, »denn so sehr wir sie auch geliebt haben, dürfen wir um der Toten willen die Lebenden nicht vernachlässigen. Wir sind auf Ihre Ankunft vorbereitet worden. Eines Tages sahen wir, was wir noch nie gesehen hatten: den Postbeamten von Pegu mit seinen Glöckchen, der uns einen Brief von Ihrem Vater brachte, meine schönen Kinder! Und in diesem Brief teilte er mir sein und Ihr bevorstehendes Eintreffen mit. In dem Brief war vermerkt, der Überbringer sei mit hundert Francs zu entlohnen, und ich habe ihm zweihundert gegeben, hundert vom Geld Ihres Vaters und hundert aus meiner Tasche, so froh war ich über die Nachricht, die er mir gebracht hatte. Sie finden daher alle Zimmer für Sie vorbereitet; seit fast sechs Monaten werden Sie erwartet. Und solange diese Zimmer nicht gefüllt waren, herrschte in meinem Herzen Leere. Gott sei gepriesen! Sie sind gekommen, und die Leere ist gefüllt.«
Den Hut in der Hand, begab der alte Mann sich an die Spitze des Zugs zu dem großen Herrenhaus, dessen Fenster soeben geöffnet worden waren. Man betrat ein großes Speisezimmer, das von oben bis unten mit Ebenholz und goldfarbenem Akazienholz vertäfelt war und dessen Parkettboden von den Negerinnen des Hauses zierlich geflochtene Matten bedeckten. Der Tisch war mit Tischtüchern und Servietten aus Aloefasern gedeckt. Auf den Tischtüchern mit der Eierschalenfarbe jungfräulichen Leinens funkelte ein Service aus Steingut in leuchtenden Farben aus dem Königreich Siam. Löffel und Gabeln waren aus einem Hartholz geschnitzt, das Metall in nichts nachstand, und englische Messer aus Kalkutta vervollständigten das Besteck.
Die Geduld und Willenskraft, deren es bedurft hatte, diese Dinge an so abgelegenem Ort zu versammeln, grenzte ans Unglaubliche, doch Hingabe und Dankbarkeit sind unerschöpflich in ihrer Findigkeit!
Die übrige Möblierung – Betten, Spiegel, Wandbehänge – war englischer Machart und kam aus Kalkutta. Die Söhne des Alten waren zweimal nach Indien und bis über den Ganges hinaus gereist und hatten mit eigens zu diesem Zweck gemieteten Schiffen in das Herrenhaus all diese Gegenstände gebracht, die nicht allein dem Notwendigen dienten, sondern auch dem Luxus.
Guillaume Remi, der Zimmermann war, hatte jedes seiner Kinder ein Handwerk erlernen lassen. Der eine war Möbeltischler geworden, der andere Schlosser, der dritte Landwirt.
Dieser dritte Sohn, den wir noch nicht kennengelernt haben, hieß Justin, und er befand sich auf Tigerjagd; einer seiner Büffel war von einem Tiger angefallen worden, der beim Fressen gestört worden war, und Justin hatte sich nahe den Resten des Büffels auf die Lauer gelegt. In seiner Eigenschaft als Landwirt und als Jäger war er dafür zuständig, den Haushalt mit Wild zu versorgen, und im Notfall waren alle drei Söhne brauchbare Soldaten, die sich überall auf der Welt als gute Schützen bewiesen hätten.
Seit Remi von dem bevorstehenden Kommen des Vicomte und seiner Töchter erfahren hatte, war der Tisch für sie gedeckt geblieben, damit sie sahen, dass man sie erwartete, zu welcher Tages- oder Nachtzeit sie auch eintreffen mochten, und Gläser und Porzellan wurden jeden Tag entstaubt und poliert.
Adda fiel die Aufgabe zu, die jungen Damen zu ihrem Zimmer zu bringen. Sie kamen aus dem Staunen nicht heraus: Wo sie eine Hütte mit Strohdach oder Lehmdach erwartet hatten, waren sie auf ein Herrenhaus gestoßen, in dem das Notwendige so reichhaltig vorhanden war, dass es fast an Überfluss grenzte.
Die jungen Männer wurden von Jules und Bernard zu ihren Räumen gebracht.
Jules hatte in Kalkutta seine Lehre gemacht und sprach Englisch, und deshalb war er dem englischen Kapitän zugeteilt worden.
Bernard, der neben dem Französischen nur einen Dialekt beherrschte, der auf Sumatra und der Halbinsel Malaysia gesprochen wird, war für René zuständig.
Und damit man uns nicht missverstehe: Die Wendungen »zugeteilt« und »zuständig« bezeichnen keinerlei Tätigkeit, die sich der des Dienstbotenstandes vergleichen ließe, und die Söhne Remis besaßen im Bewusstsein ihres Werts einen ungeschliffenen Stolz, der ihnen die Höflichkeit eines Gastgebers und nicht eines Dieners verlieh. Von Anfang an waren René und Bertrand gute Freunde. Sir James war von hochmütigerem Naturell, und es dauerte einige Zeit, bis er sich mit Jules arrangierte.
Nach einer halben Stunde wurden die Neuankömmlinge zu Tisch gerufen.
Als die Gäste das Speisezimmer betraten, fanden sie nur vier Gedecke vor. Vater, Söhne und Tochter standen an der Wand.
»Adda«, sagte Hélène mit ihrer sanften Stimme, »außer dem Gedeck Ihre Bruders, der auf der Jagd ist, fehlen vier weitere Gedecke.«
Adda sah Hélène erstaunt an. »Mademoiselle«, sagte sie, »ich verstehe Sie nicht.«
»Ein Gedeck für Ihren Vater«, sagte Hélène in beinahe gebieterischem Ton, »zwischen meiner Schwester und mir, eines für Sie zwischen diesen zwei Herren, eines zu meiner Rechten und zur Linken Janes für Ihre zwei anwesenden Brüder und ein fünftes Gedeck für Ihren Bruder, der noch auf der Jagd weilt. Ich wagte sogar zu behaupten, dass Monsieur René mir nicht widerspräche, wenn ich sagte, es würde ihn freuen, seinen Freund Monsieur François mit ihm zu Tisch sitzen zu sehen; François hat heute einen Tiger erlegt und dabei eine Gelassenheit und Selbstverständlichkeit bewiesen wie der geübteste Jäger; wer aber einen Tiger zu erlegen versteht, der hat es meiner Ansicht nach auch verdient, an jedem Tisch Platz zu nehmen, sogar an dem eines Kaisers.«
»Aber Mademoiselle«, wandte der alte Mann ein, indem er vortrat, »warum wollen Sie die Schranken zwischen Dienern und Herrschaft niederreißen? Sie können sie leugnen, doch wir werden sie niemals vergessen.«
»Meine Freunde«, sagte Hélène, »unter uns gibt es weder Diener noch Herren, denn das hat mein Vater mir beharrlich versichert. Wenn wir Sie um Ihre Gastfreundschaft bitten, erheben Sie sich von Ihrem Tisch, Sie empfangen uns, doch ist das Gastfreundschaft? Wir wollen keinen Einfluss auf Ihre Zeiteinteilung oder Ihre Gewohnheiten nehmen, doch wir bitten Sie, uns heute Abend die Ehre zu erweisen, mit uns zu speisen.«
»Wenn Mademoiselle es verlangt«, sagte Remi, »gehorchen wir ihr, Adda.«
Und er schlug auf ein Tamtam, dessen lautes Dröhnen die Diener herbeirief, und vier Neger präsentierten sich.
»Befehlen Sie«, sagte Remi zu Hélène.
Hélène befahl, fünf weitere Gedecke aufzulegen, und zeigte, wo sie aufgelegt werden sollten.
Die zwei Schwestern rückten auseinander, so dass der Greis zwischen ihnen sitzen konnte; seine zwei Söhne setzten sich zu Hélènes rechter und Janes linker Seite. Die beiden Franzosen waren ebenfalls auseinandergerückt, und mit französischer Galanterie bot René Adda einen Stuhl an.
Dann wurde François gerufen, der nach ein wenig Zieren sah, dass ihm keine Wahl blieb, und sich dareinschickte, gegenüber dem Gedeck des abwesenden Jägers Platz zu nehmen.
Erst da beachteten die Besucher Adda; ihre Schönheit war so außergewöhnlich, dass sogar die zwei Französinnen einen leisen Ruf der Bewunderung ausstießen.
Mit ihren großen schwarzen Augen, ihrem leicht bräunlichen Teint, ihren glatten schwarzen Haaren, die an Rabengefieder erinnerten, mit ihren kirschroten Lippen und ihren Zähnen wie Perlen war Adda die Verkörperung einer indischen Venus; ihre Arme und Hände waren vom Ebenmaß einer Statue, und gekleidet war sie in einen Sari aus bengalischer Seide, dessen dünne Falten keine der Beschönigungen europäischer Gewänder erlaubten. Solche Gewänder legen die Bildhauer über den Marmor ihrer Statuen, Gewänder, die alle Liebesgeheimnisse verraten, welche die Keuschheit ihnen anvertraut. Addas Anmut war von jener Art, wie sie nicht nur Frauen, sondern auch wilde Tiere auszeichnet. Sie hatte sowohl etwas vom Schwan als auch von der Gazelle und daneben Feuer und Geist zutiefst französischer Prägung. Sie war das glanzvolle Ergebnis der Kreuzung zweier Rassen.
Niemand wäre auf den Gedanken verfallen, Adda Komplimente zu ihrer Schönheit zu machen. Man bewunderte sie wortlos.
Die vier Negerdiener hatten soeben den ersten Gang abgetragen, als die Hunde wieder laut zu bellen begannen.
Alle blickten erstaunt auf, doch Remi sagte: »Beachten Sie sie nicht, es ist nur Justin, der nach Hause kommt.«
Mit einem Mal schwoll das Geheul der Hunde an. Die Brüder nickten einander zu.
»Hat er den Tiger erlegt?«, fragte René.
»Ja«, erwiderte Remi, »und er bringt sein Fell mit, was die Hunde in Raserei versetzt.«
In diesem Augenblick wurde die Zimmertür geöffnet, und der älteste der drei Brüder, ein schöner junger Mann von herkulischer Gestalt, mit rotblondem Haupthaar und Bart, erschien auf der Schwelle, gekleidet in einen Kittel nach gallischer Art, der ihm bis zu den Knien reichte und gegürtet war, und wie auf einem antiken Bildnis mit dem Kopf des Tigers bekrönt, dessen Tatzen sich über seiner Brust kreuzten.
Diese Erscheinung war so fremdartig und unerwartet, und der Anblick dieses Antlitzes, an dem die Blutstropfen des Tiers hinabrannen, war so gebieterisch, dass alle Anwesenden sich erhoben.
Justin jedoch verneigte sich an der Tür, ging auf Hélène zu, beugte ein Knie und sagte: »Mademoiselle, seien Sie so gnädig, den Fuß auf diesen Teppich zu setzen, den ich Ihrer würdiger wünschte.«
71
Das irdische Paradies
Im Jahr 1780 und ungefähr fünfundzwanzig Jahre vor dem oben Berichteten war der Vicomte de Sainte-Hermine als Kapitän der Victoire mit einem Geheimauftrag zu dem König von Pegu entsandt worden, der sein Reich kurz zuvor von dem Reich Ava abgespalten hatte. Sein Auftrag war, am Golf von Bengalen, das heißt am Westufer des neuen Königreichs, ein Territorium von sieben oder acht Meilen Ausdehnung zwischen dem Fluss Metra und dem Meer zu finden, um dort eine französische Kolonie zu errichten. König Ludwig XVI. hatte Waffen, Geld und sogar französische Ingenieure angeboten, um dem neuen Königreich in den Sattel zu helfen.
Der neue Herrscher hieß Mondirawia-paja. Als intelligenter Mann erklärte er sich einverstanden, doch um dem Vicomte de Sainte-Hermine zu beweisen, wie ernst es ihm mit der Bindung an Frankreich war und wie sehr er den Vicomte schätzte, bot er ihm an, sich unter den bewohnten Teilen des Königreichs einen Landstrich auszusuchen, auf dem er eine Handelsniederlassung gründen konnte.
Der Vicomte de Sainte-Hermine hatte an Bord der Victoire einen sehr gescheiten Zimmermann, den Sohn eines alten Dieners seines Vaters.
Dieser Zimmermann hieß Remi; das einzige Buch, das er je gelesen hatte – mehr noch, das er ohne Unterlass immer wieder las -, war Robinson Crusoe. Die Lektüre von Defoes Roman war ihm so sehr in den Kopf gestiegen, dass er jedes Mal, wenn an einer Insel angelegt wurde, die seinem Geschmack entsprach, den Vicomte de Sainte-Hermine anflehte, ihn mit seinem Werkzeug an Land abzusetzen, ihm ein Gewehr samt Pulver und Kugeln mitzugeben und ihn seinem Schicksal zu überlassen.
Monsieur de Sainte-Hermine hatte kein Privatvermögen erworben; er wusste, wie reich der Boden der Ländereien war, die ihm angeboten wurden, und er beschloss, das Angebot des Königs anzunehmen, sich umzusehen und seine Wahl zu treffen, sollte sich etwas Geeignetes finden. Zudem bedeutete dies, dass er Remi seinen Wunsch erfüllen konnte, ohne auf seine Dienste verzichten zu müssen.
Vermutlich legte er den gleichen Weg zurück, den wir zuvor mit seinen zwei Töchtern, deren jüngere damals noch gar nicht geboren war, siebzehn Jahre später zurückgelegt haben, bis er die Stelle erreichte, die wir gegen Beginn des Jahres 1805 als Land des Betels bezeichnet finden.
Die Lage der Ländereien war vortrefflich, und der Vicomte war sich dieser Vorteile bewusst. Über den Fluss Pegu war man mit Rangun und Siriam verbunden, über den Fluss Sittang mit dem Archipel von Mergi und über den Fluss Thalawadi mit Mataban und der Westküste von Siam. Die Gegend war von der Natur befestigt. Sie bildete eine Halbinsel, von den Zuflüssen des Sittangs fast ganz umschlossen. Mit dem Festland war sie nur auf eine Breite von wenigen hundert Metern verbunden. Ganz offenkundig war bereits versucht worden, systematisch Landwirtschaft zu betreiben, denn dem Betel, der in Indien nicht heimisch ist, begegnete man dort auf Schritt und Tritt.
Monsieur de Sainte-Hermine entschied sich für diesen Ort. Die Halbinsel umfasste ein Gebiet von etwa zwei Meilen Länge auf eine halbe oder eine Viertelmeile Breite. Er fertigte einen genauen Plan der Gegend mit allen Maßverhältnissen an und sagte zu dem König von Pegu, wenn dieser ihm tatsächlich das erwähnte Wohlwollen bezeigen wolle, würde er all seine Wünsche übertreffen, sollte er ihm das Stück Land schenken, das seine Zeichnung abbildete.
Der Gegenstand der Landkarte nahm sowohl auf dem Papier als auch im Königreich Pegu so wenig Platz ein, dass der König nicht säumte, die Bitte des Vicomte de Sainte-Hermine zu erfüllen. Er versah die Schenkung mit offiziellen Weihen, besiegelte sie, und der Vicomte de Sainte-Hermine war Eigner von drei Meilen Landbesitz im Königreich Pegu.
Remi hatte die Verhandlungen mit aller Seelenpein verfolgt, die der Neid uns eingeben kann. Als der Vertrag unterzeichnet, besiegelt und abgesegnet war, fand er sich vor Monsieur de Sainte-Hermine ein, der ihn ernsten Blicks ansah.
»Mein lieber Remi«, sagte der Vicomte, »ich hoffe, dass du nun glücklich bist.«
»Ich bin immer glücklich, wenn Ihnen Gutes widerfährt, mein Kommandant«, erwiderte Remi.
»Aber das Gute, um das es sich hier handelt, widerfährt nicht mir.«
»Was wollen Sie damit sagen?« Und Remi, der zu verstehen begann, errötete und begann zu zittern. »Großer Gott, Kommandant«, rief er, »unmöglich! Wie soll das möglich sein?«
»Nun, weiß Gott, du wirst alleiniger Besitzer dieses riesigen Landstrichs sein, denn du wirst ihn verwalten. Du wirst nicht wissen, wann oder ob ich wiederkommen werde. Wenn ich nicht wiederkomme und meine Kinder keinen Anspruch auf das Land erheben werden, wird es dir allein gehören. Sollte ich oder sollten meine Erben wiederkommen, werden wir teilen, was an Erträgen erzielt wurde und zu erwarten ist. Ich überlasse dir fünftausend Francs, zehn Gewehre, drei Fass Pulver, dreihundert Pfund Munition und alles Werkzeug, das dir ohnehin zusteht. Verlange einen oder zwei Sklaven oder vier, ich gebe sie dir.«
»Ich will keinen Einzigen«, sagte Remi, »aber Sie wissen, dass Ihnen bei Ihrer Rückkehr, wann auch immer, weder ein Viertel noch die Hälfte all dessen gehören wird, sondern alles!«
»Schon gut!«, sagte der Vicomte. »Das werden wir beizeiten regeln.« Und er drückte Remi die Hand und verließ ihn in einem Wald, in dem der Zimmermann den Grundriss der ersten Häuser, die er zu errichten gedachte, ersann.
Es war zehn Uhr vormittags, als Remi sich angesichts der reichen und kraftvollen Natur mit Gott allein befand. Er sah sich um und sagte voller Stolz: »Über all das bin ich König!«
Doch wie eine Antwort auf seinen Ausruf war ein Brüllen zu vernehmen. Es war ein Tiger, der sagte: »Mag sein! Doch wenn du König bist, bin ich dein Herr.«
Da Remi mit derartigen Einwendungen gerechnet hatte, als er von seinem neuen Reich Besitz ergriff, erschütterte ihn das Gebrüll nicht allzu sehr; er suchte sich einen Baum, dessen Äste fast bis zum Erdboden reichten, und bis zum Einbruch der Dunkelheit hatte er um den Baumstamm herum eine Hütte errichtet, die ihm als Schutz vor etwaigen Angriffen wilder Tiere dienen konnte; für den Fall des Falles hatte er oben eine kaminähnliche Öffnung gelassen, durch die er in die höheren Äste hinaufklettern konnte, und dort oben hatte er sich aus zwei Brettern einen Hochsitz gezimmert, neben dem er einige seiner Gewehre geladen unterbrachte. Danach machte er sich über die Nahrungsmittel her, die der Vicomte ihm dagelassen hatte.
Remi war rundum glücklich: Zum ersten Mal war er sein eigener Herr, und wie Augustus kam er sich vor, als wäre er Herrscher über das Universum.
Das Gebrüll, das er am Morgen vernommen hatte, war vergessen. Ein Wogen im Gras, keine sechzig Fuß entfernt, rief es ihm in Erinnerung.
Von da an ließ er den Blick nicht mehr von der Stelle, an der er die Bewegung erblickt hatte, doch er aß weiter.
Im Gras kauerte ein Panther, der im Unterschied zu Remi nicht in der glücklichen Lage war, sich über sein Abendessen herzumachen, sondern es noch erjagen musste.
Remi war mit den Sitten großer Raubkatzen nicht sonderlich vertraut, und er begnügte sich einstweilen damit, sich zu vergewissern, dass der unterste Ast in Reichweite seines Fußes und der dritte Ast von unten in Reichweite seines Armes war.
Er setzte den Fuß auf den untersten Ast, ergriff mit der Hand den dritten Ast und begann, den Baum zu erklimmen; als er seinen Hochsitz erreichte, der sich in etwa fünfundzwanzig Fuß Höhe befand, ließ er sich mit der gleichen Gemütsruhe nieder, als befände er sich in einer verschlossenen Festung.
Der Panther hatte Remi gewittert. Er kroch vorwärts, den Bauch am Boden, wie eine Katze, die sich an einen Vogel anschleicht.
Zwanzig Schritte von dem Baum entfernt krümmte der Panther den Rücken und tat einen Sprung, der ihn zwei Meter unterhalb von Remi in die Äste beförderte.
Remi hatte seine Zimmermannsaxt im Gürtel stecken; er nutzte den Augenblick, in dem der Panther eine Pfote ausstreckte, um sich an dem Baumstamm festzukrallen, und schlug ihm mit einem wendig und kraftvoll geführten Axthieb die Pranke ab, die von Ast zu Ast polterte, bis sie auf den Boden fiel.
Der Panther brüllte vor Schmerzen und Wut laut auf und streckte die zweite Pfote aus, die Remi mit einem zweiten, nicht minder kräftigen und sicheren Axthieb der ersten hinterherschickte.
Der Panther stieß ein zweites Brüllen aus, verlor das Gleichgewicht und fiel mit lautem Krachen von dem Baum.
Remi ergriff eines seiner Gewehre, und während das Tier noch von seinem Sturz benommen war, schoss er ihm eine Kugel in den Kopf. Dann stieg er hinunter, nahm sein Messer, enthäutete den Panther fachgerecht, nagelte die zwei Pfoten an die Tür seiner Hütte, wie die Bauern es mit Wolfstatzen tun, und setzte sich wieder an seine Mahlzeit.
»Was für ein Aufhebens um manche Dinge gemacht wird«, sagte er sich, »wenn man sie nur aus der Ferne kennt, und wenn man sie von Nahem sieht, ist nichts weiter dabei!«
Das ließen die Panther sich gesagt sein; mochte Remi sie des Abends, des Morgens oder des Nachts fauchen und brüllen hören, wagte sich doch keiner in Sichtweite der Hütte.
Nach und nach hatte sich die Hütte erstaunlich verändert: Was zuerst nur ein Haufen Zweige gewesen war, hatte im Lauf eines Monats die Gestalt einer befestigten Blockhütte angenommen; solide Deckenbalken trugen einen Speicher, der über eine Leiter erreicht wurde. Sechs miteinander verfugte Bretter bildeten ein Feldbett, und ein Tisch mit vier festen Beinen sowie ein Holzschemel stellten fürs Erste die weitere Möblierung dar.
Eines Vormittags sah Remi eine Karawane seiner Hütte entgegenwandern. Der Vicomte de Sainte-Hermine hatte nach seiner Ankunft in Pegu daran gedacht, dem Einsiedler all das zu schicken, woran er sicherlich Mangel litt.
Er schickte ihm Reis, Weizen, Mais, einen Hengst und eine Stute, Kuh und Ochsen, Eber und Bache, einen Hahn und sechs Hühner sowie einen riesengroßen Hütehund samt Hündin und Kater und Katze und, nicht zu vergessen, eine Getreidemühle, wie sie auf Schiffen benutzt wird.
Remi erschrak zuerst beim Anblick dieser Güter: Wo sollte er all die neuen Mitbewohner unterbringen? Zum Glück hatte der Vicomte seiner Sendung zusätzliche Nägel und Schlösser hinzugefügt sowie zahllose Gerätschaften, die Remi sich in der Wildnis nicht besorgen konnte.
Es war nicht daran zu denken, innerhalb von vierundzwanig Stunden, ja nicht einmal innerhalb von acht Tagen einen Stall für die Tiere zu bauen; stattdessen errichtete Remi um die Hütte herum einen Palisadenzaun, der hoch und eng genug war, um ein Entwischen zu vereiteln.
Am ersten Tag blieben die Tiere angebunden; am zweiten Tag war der Palisadenzaun fertig, der an die hundert Fuß Umfang oder dreiunddreißig Fuß Durchmesser aufwies. Die Tiere wurden hineingetrieben und eingesperrt. Der Hahn setzte sich sogleich auf einen der Pfosten und machte es sich zur Aufgabe, als Wache zu dienen und die Tageszeit zu verkünden. Die Hühner legten vom ersten Tag an Eier.
Die Männer, die diese Karawane hergebracht hatten, ließen sich von Remi verköstigen. Der Vicomte de Sainte-Hermine hatte sie im Voraus entlohnt. Remi gab ihnen obendrein einige Talks als Belohnung und schickte sie zurück.
Am Tag nach ihrer Abreise wurden Kuh, Pferde, Schweine, Kalb, Hunde, Katzen und Hühner ins Freie gelassen.
Die Hunde und Katzen besannen sich sogleich ihrer Berufung zum Haustier; die Hunde bezogen links und rechts neben der Eingangstür Posten, die Katzen kletterten zum Speicher hinauf.
Dieser Speicher war eine Rüstkammer im Kleinen; für den Fall einer Belagerung waren die zehn Gewehre mit Kugeln geladen zur Hand nebst Patronen zum Nachladen, die nur darauf warteten, zu Todesboten zu werden.
Von diesem Speicher aus hatte man einen ungehinderten Blick über die ganze Umgebung; durch kleine, geschickt angebrachte Schießscharten konnte man in alle Richtungen feuern, ohne sich den Salven der Belagerer auszusetzen.
Die größeren Tiere grasten draußen. Die Hühner pickten in der Nähe des Hauses ihre Würmer.
Am Abend brachte der Instinkt die Tiere in die Umfriedung zurück: Aus dem besorgten Krähen des Hahns und dem Bellen der Hunde konnte man erraten, dass ein Tiger oder ein Panther um den Zaun herumschlich.
Doch weder tagsüber noch nachts ließ sich einer dieser Räuber blicken.
Remi musste sich jedoch eingestehen, dass seine vielen Mitesser allmählich mehr Arbeit machten, als er allein bewältigen konnte; bisweilen, wenn er seine Schwäche beklagte, dachte er sich, dass eine Frau in seiner entstehenden Kolonie nicht fehl am Platz wäre – nicht allein, um ihm Hoffnung einzuflößen, sondern auch, um ihm bei den zahlreichen Arbeiten zu helfen, die es zu verrichten galt.
Eines Nachts, als diese Gedanken, die er für das Werk des bösen Feindes hielt, ihn besonders hartnäckig gequält hatten, weckten ihn vor Tagesanbruch das Krähen seines Hahns, das Gebell seiner Hunde und Gewehrschüsse, die vom Flussufer zu kommen schienen.
Remi ergriff ein Gewehr, steckte Patronen ein und eilte zum Sittang, von seinen Hunden gefolgt.
Am Ufer lagen drei Tote, die offenbar von den Wegelagerern überfallen worden waren, die auf dem Fluss in den Westen von Siam zu fahren pflegten.
Remi rief, doch niemand antwortete; als es hell war, sah er ein menschliches Wesen neben den Toten knien, steif und reglos wie eine Statue.
Er ging hin; es war eine junge Inderin von zwölf oder dreizehn Jahren; sie kniete neben einem etwa vierzigjährigen Mann, der tot am Boden lag, von einer Kugel in der Brust niedergestreckt.
Remi, der seit zwei Monaten in dieser Einöde lebte, wirkte mit seinen langen Haaren und seinem struppigen Bart selbst wie ein Brigant.
Doch das junge Mädchen bezeigte bei seinem Anblick keinerlei Furcht, sondern wies auf den Toten, senkte wieder den Kopf und brach in Tränen aus.
Remi wartete einige Zeit, damit das Mädchen sich ausweinen konnte. Dann bedeutete er ihm, aufzustehen und ihm zu folgen.
Das Mädchen erhob sich, stieß drei Rufe aus, auf die keine Antwort erfolgte, legte mit jugendlicher und ungekünstelter Anmut Hand und Kopf an Remis Schulter und ging im gleichen Schritt neben ihm her.
Eine Dreiviertelstunde später erreichten sie den Palisadenzaun.
Die Tiere drängten sich am Tor, seit sie die beiden erblickt hatten, und scharten sich voller Wiedersehensfreude um sie, als sie eintraten.
Der Hund bellte, das Schwein grunzte, die Kuh muhte, das Pferd wieherte, die Katze miaute, der Hahn krähte.
Eva betrat das irdische Paradies, und jedes Tier begrüßte sie auf seine Manier. Nur der Mensch schwieg, doch als er die Tür seines Hauses öffnete, klopfte sein Herz wie nie zuvor.
72
Die Kolonie
Remi trug mehrere Armvoll eines Farngewächses, das um das Haus herum üppig wucherte, auf den Speicher, legte das Pantherfell darüber, schnitzte zwei weitere Schemel, und der Speicher wurde zum Gemach der neuen Eva.
Remi war es, als sähe er die junge Birmanin zum ersten Mal, und was er sah, bezauberte ihn: Sie trug ein weites himmelblaues Gewand mit einer Seidenkordel als Gürtel, am Halsausschnitt und an den weiten Ärmeln bestickt; Sandalen aus geflochtenem Stroh bekleideten ihre kindlichen Füße; ihre bloßen Hände, deren Haut nur um weniges dunkler war als die des Gesichts, waren reizend geformt, und ihr aufmerksamer Blick war voller Dank für Remi und schien zu besagen: »Wenn das Unglück mich schon zu dir gebracht hat, was kann ich für dich tun?«
Remi seinerseits war bereit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das junge Mädchen von dem Unglück abzulenken, das ihm widerfahren war; und ihre beiderseitige Bereitschaft ermöglichte ihnen, sich schon bald mit birmanischen und französischen Brocken über die grundlegenden Bedürfnisse radebrechend zu verständigen.
Das Mädchen stammte zweifellos aus einem bäuerlichen Volk, denn es kümmerte sich sofort um die Tiere; es gab Remi zu verstehen, dass Eber und Bache getrennt untergebracht werden mussten, und noch am selben Tag wurde der Schweinestall gebaut. Das Kalb war groß genug, um die Milch seiner Mutter nicht mehr zu benötigen, die es aus Genusssucht oder Bequemlichkeit noch immer trank. Remis neue Gefährtin flocht aus Pflanzenfasern Körbe von so feiner Beschaffenheit, dass sie die Milch so gut auffangen konnten wie ein Gefäß aus Holz oder Steingut; sie sammelte die Eier ein und unterteilte die Hühner in Legehennen und Bruthennen, so dass nie Mangel an frischen Eiern und Küken bestehen würde.
Doch weit wichtiger war Evas Entdeckung, dass die Schlingpflanze, die überall ringsum wuchs, Betel war. Da sie auch mit Mais und Weizen vertraut war, unterwies sie Remi darin, Mais anzupflanzen und Weizen zu säen.
Die neuen Arbeiten, die Remi erlaubten, das junge Mädchen nicht aus den Augen zu verlieren, sagten ihm sehr zu. Eva weilte seit kaum zwei Monaten in seinem Haus. Remi lernte, die Getreidemühle zu benutzen, und lehrte die Frau des Hauses backen. Die Butter und der Käse, die sie bald aus der überschüssigen Milch gewann, mehrten das Wohlergehen des Haushalts.
Sie verstand sich darauf, aus Aloefasern Netze und Angelruten zu flechten und weitere Gerätschaften für den Fischfang zu fertigen, der schon bald zu ihrer Nahrung beitrug. Zu guter Letzt erkannte Remi, dass die Meierei so groß geworden war, dass man sie ohne Hilfe nicht mehr betreiben konnte, und er beschloss, nach dem nur fünfzehn Meilen entfernten Taungu zu fahren, um zu sehen, ob er dort ein paar Neger kaufen oder ein paar Dienstboten anwerben konnte.
Außerdem wollte er sich erkundigen, ob sich der Betel, den Eva hergestellt hatte, gewinnbringend verkaufen ließ, denn eine beträchtliche Menge dieses Betels war ohne Weiteres jedes Jahr zu erwirtschaften.
Eines Morgens wurde das Pferd nicht auf die Weide gelassen, sondern gesattelt, aufgezäumt und von Remi bestiegen, doch er musste feststellen, dass die Stute, die es gewohnt war, ihren Gefährten zu begleiten, die Reise mitmachen wollte; sie wurde ebenfalls gesattelt und gezäumt, und dann wurde das Zauntor geöffnet.
Doch nun stellte sich Eva vor die Toröffnung, streckte die Arme aus, als Remi an ihr vorbeireiten wollte, brach in Tränen aus und wiederholte immer wieder einige der wenigen Wörter Französisch, die sie beherrschte: »Mit dir, mit dir, mit dir!«
Remi, den es ohnehin schwer angekommen war, seine Eva mehrere Tage lang ganz allein zurückzulassen, fürchtete, dass ihr in seiner Abwesenheit ein Leid angetan werden könne. Bei einem Überfall wäre sie nicht in der Lage gewesen, die kleine Siedlung gegen Angreifer zu verteidigen. Und wenn Remi sich schon entscheiden musste, wollte er lieber Gefahr laufen, Haus und Tiere zu verlieren als seine Eva. Folglich versteckte er Gewehre und Munition, die er als seinen kostbarsten Besitz betrachtete, in einer Felsspalte, denn mit ihrer Hilfe konnte er sich wiederbeschaffen, was ihm möglicherweise gestohlen wurde. Um die Tiere musste er sich keine Sorgen machen – sie waren es gewohnt, sich ihre Nahrung selbst zu suchen. Aus seinem Geldversteck nahm er fünfundzwanzig Louisdor mit.
Erleichtert, mit Geist und Herz nicht zurückblicken zu müssen, überließ er seine kleine Meierei dem Schutz Gottes. Remi besaß einen Kompass, den er benutzte, um die Richtung nach Taungu einzuschlagen. Nebenflüsse des Sittangs mussten überquert werden. Remi wollte eine Furt suchen, doch seine junge Freundin bedeutete ihm, dies sei unnötig, denn sie könne schwimmen. Die beiden näherten sich dem Ufer, nahmen einander an der Hand und trieben ihre Pferde in den Fluss.
Am Abend desselben Tages erreichten sie Taungu.
In Ortschaften fern den großen Städten verwenden die Peguaner kein Münzgeld, sondern kleine Barren, die man nach ihrem Klang darauf untersucht, ob sie aus reinem Gold bestehen oder aus einer Legierung, denn für gewöhnlich dient in Birma mit seinen Silberminen reines Gold nur zum Vergolden der Pagodendächer.
Und nun erwies sich, wie nützlich Eva für Remi sein konnte: Sie sprach Birmanisch und würde für ihn dolmetschen; zudem gab es eine Vielzahl kleiner Dinge, die sie für ihre entstehende Siedlung benötigten, an die Remi jedoch niemals gedacht hätte.
Am wichtigsten aber war, dass Evas Betel großen Anklang fand und als Tauschwährung für den Kauf aller Vorräte ausreichte und dass die Händler, die ihn erstanden, eine nächste Lieferung bestellten, die in drei Monaten erfolgen konnte.
Beim nächsten Mal musste Eva sich nicht nach Taungu aufmachen, denn der Händler wollte die Lieferung persönlich in der Siedlung abholen, die auf diese Weise den Namen »Land des Betels« erhielt.
Remi kaufte zwei Neger und zwei Negerinnen. Zwei junge Männer, die sich auf den Reisanbau verstanden, wurden angestellt und zwei Frauen, die Eva bei der Tierhaltung und der Herstellung des Betels helfen sollten.
Zuletzt wurden zwei Wasserbüffel erstanden, Männchen und Weibchen, die einen Pflug ziehen sollten, den Remi zu bauen beabsichtigte. Eine Pflugschar aus Teakholz würde die eiserne Pflugschar ersetzen.
Die Rückreise nahm drei Tage in Anspruch, weil die Dienerschaft und die Tiere nur im Schrittempo den Pferden folgen konnten. Der Fluss wurde ohne Zwischenfälle überquert, und man gelangte in Sichtweite der kleinen Behausung.
Kaum hatten die Tiere ihre Besitzer erkannt, sprangen Hund und Hündin ihnen entgegen, gefolgt von den anderen Tieren bis auf den Hahn, der auf dem Zaun sitzen blieb, die Hühner, die weiter ihre Küken begluckten, und Kater und Katze, die so gravitätisch wie ägyptische Gottheiten links und rechts neben der Tür thronten.
Nichts war während der Abwesenheit ihrer Herrschaft vorgefallen, und im Haus wie draußen war alles unangetastet.
Froh über das gute Ende seiner Reise, streckte Remi die Arme aus, um dem Himmel zu danken. Eva, die glaubte, er habe die Arme für sie geöffnet, warf sich unschuldig an seine Brust. Remi drückte sie an sein Herz, und zum ersten Mal fanden sich ihre Lippen, und sie wechselten einen Kuss.
Von diesem Augenblick an wich Remis Menschenscheu nach und nach, er las nicht mehr im Robinson, und die einzige Spur der Lektüre war die, dass einer der zwei Neger den Namen Freitag erhielt.
Von diesem Augenblick an wurde auch die Arbeit verteilt, jeder hatte seine Aufgabe, und die Tage verliefen gleichförmiger.
Remi baute seinen Pflug, spannte seine Ochsen davor und pflügte ein Dutzend Morgen Land, das er bestellte.
Neben einem so schwierigen Werkstück wie einem Pflug war eine Egge ein wahres Kinderspiel. Remi eggte sein Dutzend Morgen, und der Weizen gedieh.
Einer der jungen Männer, die er als Helfer für die Landarbeit angestellt hatte, entdeckte eine sumpfige Stelle, die sie mit Gräben durchzogen und zum Reisfeld machten.
Der Zweite, der sich in der Jagd und im Fischfang geschickt zeigte, wurde mit der Verköstigung des Haushalts beauftragt; da es Wild und Fische im Überfluss gab, verwendete er seine freie Zeit darauf, einer der Negerinnen bei Anbau und Kultivierung der Betelpflanzen zu helfen, in die Remi so große Hoffnungen setzte.
Eva und die zweite Negerin sorgten für die Tiere und den Haushalt.
Dank der zusätzlichen Arbeitskräfte nahm die kleine Kolonie einen raschen Aufschwung. Die Neger, die zuvor unter Zwang nur unwillig unter Schlägen gearbeitet hatten, arbeiteten hier, wo sie eher wie Diener als wie Sklaven ernährt und behandelt wurden, von morgens bis abends, und alle Mienen waren fröhlich bis auf die des Hausherrn; der Grund für Remis finstere Miene war nicht mehr die Menschenscheu, sondern ein schlimmeres Übel, nämlich die Liebe.
Eva ihrerseits liebte Remi mit ganzem Herzen und in aller Unschuld. Weder ihre Zärtlichkeiten noch ihre Worte ließen daran den geringsten Zweifel. Doch gerade diese Erwiderung seiner Gefühle schnitt ihm ins Herz; hätte Eva ihn nicht geliebt, ihm nichts davon gesagt, dann wäre Remi Manns genug gewesen, seine Liebe zu bezwingen; doch die eigene Liebe und Evas Liebe zu bezwingen, ging über seine Kräfte.
Eine Frage beginnt sich auf den Mienen meiner Leser zu malen, die da lautet: Warum...?
Und bevor sie ausgesprochen wird, will ich sie beantworten: Weil Remi als wackerer Mann und guter Christ, ehelicher Sohn des Mathurin Remi und der Claudine Perrot, um nichts in der Welt seinen ältesten Sohn zum Ahnvater illegitimer Sprösslinge machen wollte.
Sein innerer Kampf zwischen Versuchung und Gewissen wogte am erbittertsten, als eines Abends die Hunde anschlugen – nicht aufgeregt, als gelte es eine Gefahr zu melden, sondern sanft, gewissermaßen brüderlich, als wollten sie einen Freund anmelden. Remi ging öffnen. An die Tür klopfte in der Tat ein Bruder, denn es war ein Mönch, ein französischer Jesuit, der in China das Wort Gottes predigen wollte und dort höchstwahrscheinlich den Tod finden würde.
»Seid doppelt willkommen, Pater«, begrüßte Remi ihn freudig, »denn Sie bringen uns gewiss mehr, als wir Ihnen je vergelten könnten.«
»Was kann ich Ihnen Außergewöhnliches bringen, meine lieben Kinder?«, fragte der Mann Gottes.
»Sie bringen dem jungen Mädchen das Seelenheil und mir das Glück; sie ist Heidin, Sie werden sie heute Abend taufen; ich liebe sie, und Sie werden uns morgen trauen.«
Die christliche Unterweisung der Frischbekehrten dauerte nicht lange. Sie wurde gefragt, ob sie an einen anderen Gott als den Gott Remis glaube, und sie sagte Nein. Sie wurde gefragt, ob sie in der gleichen Religion wie Remi leben und sterben wolle, und sie sagte Ja.
Am selben Abend verkündete Remi, dass der nächste Tag ein Feiertag sein werde, an dem nicht gearbeitet werden solle. Dann führte er den Jesuitenpater auf einen kleinen Hügel, auf dem ein Kreuz stand, vor dem Remi morgens und abends fromm seine Andacht verrichtete. »Pater«, sagte er zu dem Priester, »dort werden Sie uns morgen den Segen geben, und ich gebe Ihnen mein Wort, dass dort eine Kapelle stehen wird, bevor ein Jahr vergangen sein wird.«
Am Tag darauf wurde in Anwesenheit der zwei Neger, der zwei Negerinnen und der zwei Peguaner zwischen Remi und Eva das Band der Ehe geschlossen.
Die Taufe ging der Eheschließung unmittelbar voraus, so dass Eva gar keine Zeit gehabt hatte, gegen eines der beiden Sakramente zu sündigen, nicht einmal in Gedanken.
Am selben Tag setzte der Jesuit seine Reise fort, nachdem er nach alter Sitte den Herrn und die Herrin des Hauses, die Diener, die Tiere und das Haus gesegnet hatte.
Die Tiere hatten nicht auf den Segen gewartet, um sich fortzupflanzen. Das Kalb war zu einem stattlichen Stier herangewachsen, das Wasserbüffelweibchen hatte ein Junges bekommen, die Stute ein Fohlen, die Katzen hatten sechs Kätzchen, die Hunde zehn Welpen, der Schweinenachwuchs ließ sich gar nicht mehr zählen, und Schweinchen, die im Wald ausgesetzt worden waren, wurden dort zu Wildschweinen.
Der Zeitpunkt nahte, an dem der Betelhändler kommen wollte; er brachte weitere Händler mit, die sich sehr zufrieden mit den Ertragserwartungen der Plantage zeigten. Der Händler, mit dem Remi sich verständigt hatte, brachte das vereinbarte Geld mit, doch da der Ertrag das Dreifache dessen betrug, was man ausgemacht hatte, erlöste Remi damit nicht neuntausend Talks, sondern weit mehr, denn die zwei anderen Händler hatten sich in weiser Voraussicht mit Säcken voll der kleinen Goldbarren versehen, die in Birma als Währung dienen.
Die Händler schlugen Remi ein Abkommen vor: Sie erklärten sich bereit, ihm jedes Jahr fünfzehntausend Talks zu bezahlen, und er sollte ihnen für zwölftausend Talks Betel liefern und für den Rest Mais, Reis und Weizen. Fiele die Ernte eines der Getreide zu mager aus, stünde es Remi frei, den Unterschied in Betel zu begleichen.
Die Händler erklärten sich bereit, zwei Wasserbüffel, vier Neger, zwei Negerinnen und zwei Peguaner für Remis Siedlung zu schicken. Einer der Peguaner musste Schlosser sein, der andere Möbeltischler.
Neun Monate und ein paar Tage nach der Abreise des wackeren Jesuiten wurde Eva von einem Jungen entbunden, der auf den Namen Justin getauft wurde. Eine der Negerinnen war Hebamme, und sie erledigte ihre Aufgabe mit Bravour.
In der Kapelle auf dem Hügel, wo Remi getraut worden war, taufte er mit eigener Hand sein erstes Kind; offenbar brachte es ihm Glück, dass er sein Gelübde gehalten hatte, denn im Jahr darauf und im übernächsten Jahr wurden zwei weitere Söhne auf die Namen Jules und Bernard getauft.
Dann vergingen drei Jahre, und ein Mädchen erhielt den Namen Adda.
Unterdessen blühte die kleine Kolonie weiter; mehr als eine Meile Landes wurde inzwischen bebaut. In der Faktorei waren achtzehn Bedienstete und Sklaven beschäftigt, ganz abgesehen von einem Dutzend Negerkinder und kleiner Mestizen, die je nach ihrem Alter mitarbeiteten oder, wenn sie dafür zu jung waren, mit den Kätzchen und Welpen spielten und die Hühner jagten.
Remis Ältester war für den Beruf des Landwirts sowie für Fischfang und Jagd bestimmt. Bernard, der zweite, ging bei dem Schlosser in die Lehre, und der jüngste Sohn Jules war Lehrling des Möbeltischlers, den Remis Vertragspartner zu ihm geschickt hatten.
Es erübrigt sich, den wachsenden Wohlstand der kleinen Kolonie im Einzelnen nachzuzeichnen. Es kam jedoch eine Zeit, als die Hütten nicht mehr ausreichten, und Remi beschloss, an ihrer Stelle ein großes Herrenhaus zu errichten, das Haus des Vicomte, und um dieses Haus herum kleinere Häuser für sich selbst und alle anderen Angestellten oder Bediensteten.
Remi entwarf das Haus, das für den Vicomte bestimmt war, und alle legten bei seinem Bau mit Hand an, als stünde das Kommen des Vicomte bevor; die jüngeren Söhne konnten unter Anleitung ihrer Meister ebenfalls mitarbeiten. Remi verwendete seine ganze Zimmermannskunst auf das Herstellen der Deckenbalken und Verandaböden. Und während Eva das Innere des Hauses mit Stoffen bespannte, die man aus Prome, Pegu und sogar aus Kalkutta hatte kommen lassen, wurde das übrige Dorf erbaut, das mehr als fünfzehn Häuser zählte.
Zwei Jahre dauerte es, dieses große Werk zu vollbringen; doch da der Wohlstand der Kolonie beständig wuchs und man fünfzehntausend bis achtzehntausend Talks – anders gesagt, an die sechzigtausend Francs – aus den Einkünften auf den Bau verwenden konnte, ging die Arbeit noch schneller vonstatten, als man jemals erwartet hätte.
Remis drei Söhne waren zu schönen und kräftigen jungen Männern und gewandten Schützen herangewachsen.
Zweimal war die kleine Kolonie von Räubern überfallen worden; doch aus den vier Blockhäusern an den vier Ecken der Anlage war den Briganten ein Willkommen bereitet worden, das ihnen jede Lust auf einen neuerlichen Besuch vergällt hatte.
Vor allem Justin war der Schrecken aller Räuber menschlicher wie tierischer Herkunft. Sprach sich herum, dass im Umkreis von drei Meilen ein Tiger oder ein Panther gesichtet worden war, schulterte Justin sein Gewehr, steckte sich die Axt seines Vaters in den Gürtel und kam erst wieder, wenn die Raubkatze erlegt war.
Als er nun das Speisezimmer betrat, das Tigerfell über Kopf und Schultern geworfen, und jenen begegnete, die seit so langer Zeit erwartet worden waren, hatte er soeben seinen elften Tiger zur Strecke gebracht. Ein Jahr zuvor hatte ein großes Unglück die stattliche Familie und die Bediensteten und Sklaven der kleinen Kolonie heimgesucht: Remis Ehefrau, die Mutter der drei schönen jungen Männer und des schönen Mädchens, war gestorben.
73
Das Begräbnis des Vicomte de Sainte-Hermine
Da wir nun wissen, wie es zu der Plantage des Vicomte de Sainte-Hermine im Land des Betels kam, können wir den Faden unserer Erzählung wieder aufnehmen.
Wir müssen unseren Lesern nicht eigens vor Augen führen, welche Wirkung der Anblick dieser patriarchalischen Familie, die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts die Sitten und Gebräuche der Araber aus biblischen Zeiten pflegte, auf die zwei Schwestern, Sir Asplay und René ausübte.
Abraham ließ sich nicht altehrwürdiger denken, als Remi es war, Rebekka konnte kaum schöner gewesen sein als Adda, und David und Jonathan waren nicht stolzer vorstellbar, als es Bernard und Jules waren, indes Samson, der einen Löwen mit den Händen zerriss, indem er seinen Rachen aufriss, nicht tapferer und mutiger gewesen sein konnte als Justin.
So zogen sich Hélène und Jane in ihr Zimmer und die zwei jungen Männer in ihre Räume zurück, während sie voll des Staunens über alles waren, was sie zu sehen bekommen hatten, und sich vor der bescheidenen Größe ihrer Gastgeber innerlich verneigten. Am nächsten Tag kam Adda, um zu erfahren, wie sie die Nacht verbracht hatten, und um zu fragen, ob ihr Vater seine jungen Herrinnen aufsuchen dürfe; nach erteilter Erlaubnis stieg der Greis mit langsamem, gewichtigem Schritt die Treppe hinauf und trat mit einem Büchlein in der Hand ein, um seine Abrechnung vorzulegen.
»Meine jungen Damen«, sagte er, »wenn ein Gläubiger und ein Schuldner sich nach vierundzwanzig oder fünfundzwanzig Jahren wiedersehen, dann muss der Schuldner als Allererstes seine Schulden benennen und sie bezahlen.«
Die jungen Mädchen sahen einander verwundert an.
»Davon hat unser Vater nie ein Wort geäußert«, sagte Hélène. »Wenn er irgendetwas gedacht haben sollte, dann eher, dass er Ihr Schuldner sei und nicht Sie der seinige; für diesen Fall hat er uns lediglich geraten, das Anwesen zu verkaufen und den Erlös mit Ihnen zu teilen.«
Remi brach in Gelächter aus. »Solche Bedingungen kann ich nicht annehmen, meine Damen, denn damit würde ich meinem ehrenwerten Herrn die bescheidenen Dienste, die ich geleistet habe, allzu teuer verkaufen. Nein, Mademoiselle, wenn es Ihnen nicht zu beschwerlich fällt, werden Sie mit mir kommen und sich mit eigenen Augen von dem Zustand Ihres Vermögens überzeugen. Ihre Schwester wird Sie selbstverständlich begleiten, und wenn die beiden Herren sich anschließen sollten, wäre es mir ein Vergnügen, in Gegenwart so vieler Zeugen wie möglich Rechenschaft vor Ihnen abzulegen.«
Die Schwestern wechselten einen Blick und gelangten zu der Ansicht, dass sie die Sache lieber unter sich abmachen wollten. Sie wollten den treuen Diener fürstlich entlohnen und befürchteten, ein Mann, der als Verlobter kein Fremder mehr ist, könnte Einwendungen gegen die Freigebigkeit erheben, die sie üben wollten.
»Wir kommen allein mit Ihnen, mein ehrwürdiger Freund«, sagte Hélène, »wenn Sie vorausgehen und uns den Weg zeigen.«
Die Greis ging einige Schritte vor ihnen bis zu einer kleinen Tür; er schloss sie auf und bedeutete den Schwestern einzutreten. Die Kammer war als vielleicht einziger Raum des ganzen Hauses aus Stein gemauert; die Fenster waren vergittert, und die Kammer enthielt nichts als zwei kleine Eisentonnen von einem Fuß und von drei Fuß Höhe; beide waren mit Eisenketten in ihren Wandnischen gesichert und ruhten auf Eisenträgern, die in die Wand eingemauert und mit Eisenringen versehen waren.
Der Greis holte einen Schlüssel hervor und sperrte ein Vorhängeschloss auf, um den Deckel der größeren Tonne öffnen zu können.
Er hob den Deckel an und klappte ihn zurück, und Hélène und ihre Schwester erblickten voller Erstaunen zahllose Goldbarren von Kleinfingergröße. Die zwei Schwestern schmiegten sich aneinander und sahen den alten Mann fragend an.
»Meine Damen«, sagte dieser, »in diesem Fass dürfte sich etwas mehr als eine Million befinden.«
Die zwei jungen Mädchen erbebten. »Aber wie kann das sein?«, fragte Hélène. »Das viele Gold kann uns unmöglich gehören.«
»Und doch ist es nichts als die Wahrheit«, erwiderte der Greis. »Seit mehr als zwanzig Jahren verwalte ich Ihr Vermögen mit Gewinn, und im Lauf der Jahre hat es zwischen fünfzig- und fünfundfünfzigtausend Francs abgeworfen; ich habe nicht nachgezählt, und man müsste eine Aufstellung machen, aber abgesehen vom Wert der Siedlung, müssten sich an die neunzigtausend Francs in dem Fässchen befinden.«
Die zwei Schwestern sahen einander sprachlos an.
Der Alte holte einen zweiten Schlüssel hervor und öffnete das zweite Fässchen. Es war bis zur Hälfte mit Rubinen, Karfunkeln, Saphiren und Smaragden gefüllt, denn wie bereits gesagt, dienen in Birma Goldbarren und Edelsteine als Münzgeld.
Der Alte griff in das Fass und ließ eine funkelnde Kaskade aus der Hand gleiten.
»Was ist das?«, fragte Hélène. »Haben Sie Harun al Raschids Schatzkammer entdeckt?«
»Nein«, erwiderte der Alte, »doch ich dachte mir, dass Gold überall nur wert ist, was es wiegt, während diese Juwelen zwar ungeschliffen sind, aber in Frankreich sicherlich das Doppelte einbringen. Nach hiesigem Preis sind es Steine für ungefähr dreihunderttausend Francs.«
»Und worauf wollen Sie hinaus?«, fragte Hélène lächelnd, während Jane geistesabwesend in ihre eigenen Gedanken versunken war.
»Ich will darauf hinaus, meine lieben Herrinnen, dass dieses Gold und diese Edelsteine Ihnen genauso gehören wie das Land, die Menschen, die Tiere und die Erträge der Kolonie.«
»Mein teurer Freund«, sagte Hélène, »ich weiß, welche Vereinbarungen zwischen Ihnen und meinem Vater getroffen wurden. ›Remi‹, sagte er, als Sie sich trennten, ›da Sie unbedingt hier bleiben wollen, lasse ich Sie gewähren; gründen Sie mit den wenigen Mitteln, die ich Ihnen überlassen kann, eine Niederlassung, und wenn ich wiederkomme oder ein Mitglied meiner Familie als mein Rechtsnachfolger kommt, werden Sie gerecht teilen. ‹ Leider, lieber Remi, komme ich als seine Erbin, um Sie im Namen meines Vaters zu bitten, mit uns zu teilen: Die Hälfte all dessen, was Ihnen gehört, gehört meiner Schwester und mir, die andere Hälfte aber ist Ihr Besitz.«
Tränen rannen die Wangen des alten Mannes hinunter.
»Nein!«, widersprach er vehement. »Nein, so kann Ihr ehrwürdiger Vater es nicht gemeint haben – oder er rechnete nicht damit, wie viel Gewinn diese Plantage abwerfen würde, als er das Abkommen mit mir traf. Bedenken Sie, dass wir nur arme Bauern sind, die überglücklich wären, ihren Lebensunterhalt weiterhin in Ihrem Dienst zu erwirtschaften und sich versorgt zu wissen.«
Hélène sah Remi mit einem nunmehr ernsten Blick an. »Remi«, sagte sie, »Sie vergessen, dass Sie Ihren Kindern keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn Sie sich uns gegenüber zu großzügig zeigen. Ihre Kinder haben wie Sie, weniger lange als Sie, gewiss, doch in dem Maß, wie es ihr Alter und ihre Kraft zuließen, unser gemeinsames Vermögen erwirtschaftet, und nun ist es meine Aufgabe, ihre Rechte zu verteidigen und durchzusetzen!«
Remi versuchte zu widersprechen, doch in diesem Augenblick wurde zum Essen gerufen; drei Schläge auf einen chinesischen Gong verkündeten, dass aufgetragen war.
Hélène ließ Jane vorangehen und nahm Remis Arm.
Remi schloss die Kammer hinter ihnen ab, und sie gingen die Treppe hinunter.
Keine fürstliche Tafel war je prächtiger gedeckt als der Tisch im Speisezimmer: Indische Pfauen, goldene chinesische Fasane und birmanische Perlhühner entfalteten auf dem Tisch die prunkvollen Fächer ihrer Schwanzfedern; das Dessert war eine Zusammenkunft der erlesensten Früchte: Mangos, Guaven, Zuckerbananen, Ananas, Durian, Avocados, Jackfrucht und Rosenäpfel; als Getränke gab es ausschließlich Palmwein und Pampelmusenorangeade, und diese Getränke, die tief in der Erde gelagert wurden, waren so kühl und frisch wie eisgekühlter Likör.
Da zum Haus kein Obstgarten gehörte, hatten die drei Brüder am Vorabend verabredet, in den Wäldern, die das urbar gemachte Land umschlossen, Früchte zu sammeln. Justin war den Fluss mehr als zwei Meilen entlanggegangen, um Mangos zu pflücken, die nur an jener Stelle wuchsen, und hatte im Dschungel am Ufer des Sittangs die Fährten mehrerer Tiger erspäht.
Diese Nachricht weckte in den jungen Leuten Jagdfieber, und man vereinbarte, in einigen Tagen eine Tigerjagd zu veranstalten und zwar unter Mitnahme der Elefanten, damit die Damen die Jäger begleiten konnten.
Diesen Vorschlag hatte Jane gemacht, und er war auf ungeteilten Beifall gestoßen; nur Hélène hatte sie traurig angesehen und gemurmelt: »Arme Schwester!«
Wahrhaftig war Jane alles andere als übertrieben mutig, doch mehr als alles andere fürchtete sie sich davor, René allein auf diese schreckliche Jagd gehen zu lassen, tagelang Todesängste um seinetwillen auszustehen und ihn nicht um sich zu haben.
René versuchte, ihr das Vorhaben auszureden, doch er stimmte sie nur traurig, ohne sie zu überzeugen. Hélène jedoch verschob die geplante Jagd auf einen späteren Zeitpunkt. Täglich erwartete man die Eskorte mit dem Leichnam des Vicomte, und die Begräbnisfeierlichkeiten mussten ihren Lauf nehmen, bevor an Vergnügungen zu denken war.
Als sie vom Tisch aufstanden, berichtete Hélène Sir James und René, was zwischen ihr und Remi verhandelt worden war und dass sie trotz seiner Einwendungen darauf bestanden hatte, dass die Vereinbarungen so eingehalten wurden, wie sie einst getroffen worden waren. Beide stimmten ihr zu.
»Und so kommt es«, sagte Hélène lächelnd, »dass Jane, ohne sich dessen gewahr zu sein, denn sie hat auf kein Wort unseres Gesprächs Acht gegeben, eine Erbin geworden ist, was nicht von Nachteil sein kann, denn einen Ehemann für sie wird man in dieser Eindöde nicht leicht auftreiben.«
»Sie hätte ebenso umsichtig sein sollen wie Sie, liebe Hélène«, sagte Sir James, »und sich einen Verehrer aus Europa mitbringen sollen.«
Beider Blicke richteten sich auf René, der auf die Anspielung nicht einging, sondern sich nur ein verhaltenes Lächeln gestattete, das eher traurig als fröhlich war.
Die Aufmerksamkeit der drei wurde schnell durch das Tun von Remis Söhnen abgelenkt.
Unter dem Schatten eines prachtvollen Affenbrotbaums hoben sie ein Becken aus, in das sie einen Wasserlauf umleiten wollten, der in den Fluss mündete, so dass er es füllte und ein herrliches Bad für die Schwestern bildete, die damit der Mühe enthoben wurden, hundert Schritte weit zu gehen, um die Bäder zu erreichen. Es war das Bestreben dieser vortrefflichen Familie, ihren Gästen den Aufenthalt so erquicklich wie möglich zu machen.
Als die jungen Leute zum Herrenhaus zurückkehrten, sahen sie Jane in der Tür sitzen, den Blick geistesabwesend auf Adda gerichtet, die zwei birmanische Hündchen abrichtete; diese Hündchen sollten Hélène und Jane bei ihren Spaziergängen begleiten.
In Pegu gibt es zwei sehr verschiedenartige Pferderassen; die eine stammt aus dem unteren Teil des Landes mit seinem feuchten, sumpfigen Boden, der sich von Arakan bis nach Tenasserim erstreckt; in dem Delta, das die zahllosen Arme des Irrawaddy bilden, findet man nur kleinwüchsige Pferde von unansehnlicher Gestalt und ohne Feuer, doch sobald man den trockenen Boden von Henzada erreicht, stößt man auf eine Rasse kleinwüchsiger Pferde, die zierlich und ausdauernd sind.
Im Übrigen ist im Lande Birma der Elefant das Beförderungsmittel par excellence für wichtige Persönlichkeiten; altertümliche Fuhrwerke, von Wasserbüffeln oder Ochsen gezogen, werden auf kurzen Strecken verwendet, und das Pferd ist ein Luxusgegenstand.
In der Siedlung gab es fünf, sechs Pferde, doch nur Adda und die jungen Männer ritten sie; außer ihnen bestieg sie niemand, oder sagen wir lieber: wagte niemand, sie zu besteigen.
Adda, ein halbwildes Geschöpf, das von einem Damensattel noch nie gehört hatte, ritt wie ein Mann; ihr enger Rock war an den Seiten geschlitzt, und darunter trug sie ein enges Beinkleid, das bis zu den Knöcheln reichte. Mit ihrem geschmeidigen Körper ohne Korsett, der sich allen Bewegungen des Pferdes anschmiegte, und ihren im Wind wehenden Haaren sah sie aus wie eine der Thessalierinnen, von denen Phädra spricht und deren Locken beim Laufen neben dem erhobenen Wurfspieß wehten.
Die zwei Schwestern bewunderten neidlos die anmutigen Bewegungen ihrer schönen Gastgeberin, erklärten sich jedoch außerstande, jemals auf die gleiche Weise zu Pferde zu sitzen.
Adda erwiderte, das sei nicht von Belang und René oder James solle einen französischen Sattel zeichnen, den ihr Bruder, der Möbeltischler, dann herstellen werde.
In diesem Augenblick verließ den Wald ein Zug, der aus einem Elefanten, vier Pferden und einem Dutzend Männer bestand. Der Elefant war mit schwarzen Draperien behängt.
Die jungen Mädchen stiegen auf den Belvedere, der das Haus überragte, und vergewisserten sich, dass es sich nur um die Eskorte handeln konnte, die den Leichnam ihres Vaters hergeleitete.
Mit Gongschlägen wurden alle Bewohner zusammengerufen; dann wurde das Tor geöffnet, und man erwartete den Trauerzug. Als der Elefant mit dem Sarg auf dem Rücken in den Hof kam, knieten die Schwestern nieder, und die anderen taten es ihnen gleich.
Der Shabundar von Pegu, der sich anerboten hatte, alle Einzelheiten des Begräbnisses zu regeln, hatte zwei jesuitischen Missionaren vorgeschlagen, sich der Eskorte anzuschließen, um auf diese Weise gefahrlos den Wald voller Raubtiere zu durchqueren.
Zum Dank für den Schutz wollten die Priester die Totengebete am Sarg des Vicomte de Sainte-Hermine sprechen.
Der Sarg wurde in die kleine Kapelle getragen. Anstelle von Kerzen brannten Fackeln aus harzhaltigem Holz vierundzwanzig Stunden lang und ersetzten das Gepränge einer veritablen Trauerkapelle, so gut es eben ging.
Die Totenmesse wurde mit größter Feierlichkeit gelesen.
Danach wurde der Leichnam des Vicomte in dem Felsengrab nahe Evas Grabstätte beigesetzt.
Mehrere Tage lang herrschte in der ganzen Kolonie Schwermut und Trauer, die durch die Erinnerung an den gewalttätigen und vorzeitigen Tod des Vicomte geweckt worden war.
Und tagelang konnte Jane nach Herzenslust weinen, ohne dass sie nach dem Anlass ihres Kummers gefragt wurde.
Am übernächsten Tag nahmen die beiden Jesuiten ihre Reise nach China wieder auf.
74
Tiger und Elefanten
In den Tagen unmittelbar nach der Beisetzung des Vicomte de Sainte-Hermine gebot das Zartgefühl den jungen Leuten, keine neuen Vergnügungen zu ersinnen und den geplanten Jagdausflug nicht zu erwähnen. Dieser Jagdausflug an das Ufer des Sittangs, wo Justin auf Tigerfährten gestoßen war, erforderte umsichtige Vorbereitungen.
Jules, der Möbeltischler, wurde beauftragt, hölzerne »Türme« von einem Meter Höhe zu bauen, die vier bis fünf Personen Platz boten, und Bernard, der Schlosser, war damit beschäftigt, mehrere Piken zu schmieden, wie sie in Bengalen zur Wildschweinjagd benutzt werden.
René hatte es sich angelegen sein lassen, die Freundschaft mit den Elefanten zu vertiefen. Jeden Tag führte er Omar und Ali, wie er die zwei Dickhäuter nannte, eigenhändig aus ihrem Stall.
Im Freien ließ er sich von ihnen hochheben, gebot ihnen, in die Knie zu gehen, kletterte auf ihre Rücken und ließ sich von ihnen mit dem Rüssel absetzen. Beide kamen, wenn er sie mit Namen rief; und zu guter Letzt konnte er sie nach Belieben in Zorn versetzen oder beruhigen, und beide gehorchten ihm jedes Mal aufs Wort.
Acht bis zehn Tage später waren die »Türme« gezimmert und die Piken geschmiedet, doch man wartete noch einige Tage länger.
Schließlich war es Jane, die fragte: »Monsieur René, was ist mit der Tigerjagd?«
René verbeugte sich vor Jane und ihrer Schwester und antwortete: »Meine Damen, Sie befehlen, und ich gehorche.«
Der darauffolgende Sonntag wurde festgesetzt; der Ort, wo die Jagd stattfinden sollte, befand sich in kaum zwei Wegstunden Entfernung; wenn man um sechs Uhr morgens ankommen wollte, musste man lediglich um vier Uhr aufbrechen.
Um vier Uhr morgens am vereinbarten Tag war jedermann zum Aufbruch bereit.
Zuerst wurden die Türme mit massiven Ketten versehen, die mehrmals um Bauch und Rücken der Elefanten geführt wurden. Um die Türme herum hängte man Behältnisse mit Munition und Lebensmitteln sowie Gefäße mit Trinkwasser.
Dann wurden die Waffen inspiziert. Justin und seine Brüder besaßen nur Kommissgewehre mit Bajonett.
René gab Justin seinen Stutzen mit gezogenem Lauf. Er hatte ihn schon mehrmals damit schießen lassen, ohne zu verraten, dass er ihm das Gewehr zum Geschenk machen wollte, und Justin hatte die Treffsicherheit der Waffe begeistert gelobt.
Die Jagdgesellschaft verteilte sich wie folgt: Justin ritt; Sir James, Jules und Hélène bestiegen den Elefanten Omar, Jane, Bernard und René seinen Gefährten Ali. In jedem der Türme kam zusätzlich ein Diener unter, der den Sonnenschirm hielt. Sir James lieh Jules eines seiner zwei Manton-Gewehre, und zwei Lanzen wurden in ihrem Turm aufgestellt.
Jane, René und Bernard nahmen in ihrem Turm Platz und rammten zwei Piken in den Holzboden des Gehäuses. René hatte seine zwei doppelläufigen Pistolen im Gürtel stecken; er wollte Bernard eine geben, doch dieser erwiderte, mit so einer Waffe sei er nicht vertraut.
Die Elefantenlenker setzten sich auf den Kopf der Tiere, so dass die Ohren der Dickhäuter ihnen als Panzer dienten. Statt des Eisenhakens, mit dem sie sonst die Tiere lenkten, bekamen sie eine Pike ausgehändigt, die auch zur Verteidigung einzusetzen war.
Treiber hatte man aus Furcht vor Unfällen nicht hinzuziehen wollen, doch zwölf Bedienstete hatten sich freiwillig gemeldet; angeführt und befehligt wurden sie von François, der als Waffen nur ein Kommissgewehr mit Bajonett und den sagenhaften Entersäbel mit sich führte, mit dem René die Boa in zwei Teile gehauen hatte.
Eine Meute von einem Dutzend Hunden, die auf Tiger abgerichtet waren, folgte den Jägern.
Sir James, der in der Umgebung von Kalkutta bereits mehrmals an solchen Jagden teilgenommen hatte, wurde zum Leiter der Expedition erklärt.
Man legte ungefähr zwei Meilen zurück, ohne etwas zu bemerken. Dann gelangte man zu dem Dschungel, in dem Justin die Fährten entdeckt hatte. Die Hunde winselten unruhig, die Elefanten hoben den Rüssel, und Justins Pferd begann zu tänzeln, machte unerwartete Ausfälle, stellte die Ohren auf und schnupperte. François feuerte seine Männer an, doch diese zögerten, in den Dschungel einzudringen, obwohl er ihnen vorausging.
Daraufhin rief er die Hunde, die ihm brav folgten.
»Vorsicht!«, warnte Sir James. »Der Tiger ist nicht mehr weit!«
Kaum hatte er ausgesprochen, jaulte einer der Hunde erbärmlich.
Und ein tiefes, grollendes Brüllen ertönte.
Wer noch nie das Knurren eines Löwen und das Brüllen eines Tigers vernahm, der kennt zwei der erschreckendsten Geräusche der Natur nicht. Es sind Laute, die nicht allein über den Gehörgang, sondern geradezu durch alle Poren unserer Haut in uns eindringen.
Das Gebrüll wurde von verschiedenen Stellen des Dschungels aus erwidert: Man hatte es mit mehr als einem Tiger zu tun.
Die Gewehre wurden geladen; dann bellten alle Hunde wie verrückt, als könnten sie den Tiger nicht nur riechen, sondern auch sehen.
»Der Tiger kommt!«, rief François.
Fast gleichzeitig sprang mit einem Satz wie ein Blitz ein prachtvoller, voll ausgewachsener Königstiger aus dem Dschungel.
Mit seinem ersten Sprung hatte er eine Entfernung von zwanzig Metern zurückgelegt, doch als scheute er die Berührung des Erdbodens oder als schnellte er wie eine Feder zurück, sobald er den Boden berührte, war er wieder im Wald und in der Deckung verschwunden.
Alle Tiere wirkten eingeschüchtert, nur Justins Pferd zeigte mehr Zorn als Furchtsamkeit. Während des kurzen Erscheinens der Raubkatze blähte es die dampfenden Nüstern und warf ihr einen zornfunkelnden Blick zu. Man hätte meinen können, es hätte sich auf den Tiger gestürzt, hätte sein Reiter es nicht zurückgehalten.
Es ließ sich kaum ein bewundernswerterer Anblick denken als dieser Reiter ohne Steigbügel, ohne Sattel, ohne Decke auf seinem Pferd, das Stimme und Knien seines Herrn noch rascher gehorchte als dem Zügel.
Alle Blicke waren auf Justin geheftet, der barhäuptig, mit halb entblößter Brust und hochgerollten Ärmeln wie ein numidischer Reiter mit einer Hand die Mähne seines Pferdes hielt und mit der anderen seine Pike, als plötzlich unter den Rufen der Treiber, dem Schall von Büffelhörnern und dem Gebell der Hunde ein zweiter Tiger den Wald verließ, nicht mit einem Sprung wie der erste, sondern dicht am Boden schleichend wie auf der Flucht.
Zehn Fuß außerhalb des Dschungels angekommen, sah der Tiger die Elefanten vor sich und duckte sich, um zum Sprung anzusetzen.
Die jungen Mädchen riefen erschrocken: »Ein Tiger! Ein Tiger!« Die Elefanten gingen in Verteidigungsstellung; die Jäger legten an, um zu feuern, doch da sahen sie Justin und sein Pferd wie einen Blitz vorbeisausen.
Zwei Schritte vor dem Tiger, der nicht wusste, wie ihm geschah, stieß Justin einen Schrei aus, spornte sein Pferd an, das mit einem gewaltigen Sprung über die Raubkatze setzte, und mitten im Sprung schleuderte Justin seine Pike mit solcher Wucht, dass sie den Tiger an den Boden nagelte.
Einige Schritte weiter hielt er sein Pferd an, drehte sich um und sagte: »Bitte sehr, Messieurs, jetzt sind Sie an der Reihe. Mir genügt dieser hier.«
Und er reihte sich hinter den Elefanten ein.
Der Tiger brüllte markerschütternd und versuchte sich aufzurichten, doch die Pike hatte nicht nur seinen Körper aufgespießt, sondern sich tief in den Erdboden gebohrt, als wäre sie mit übermenschlicher Kraft geschleudert worden, und ihr hölzerner Schaft durchdrang den Leib des Tigers.
Daraufhin begann das unselige Tier zu toben und sich zu winden, biss in den Schaft der Pike und zerbrach ihn.
Doch dies waren die letzten Zuckungen gewesen; der Tiger stöhnte auf, erbrach Blut und hauchte sein Leben aus, noch immer an den Boden geheftet. Als wäre sein letztes Geheul eine Beschwörung gewesen, ihn zu rächen oder wenigstens seine Gegner zu bekämpfen, erschien der erste Tiger wieder auf sechzig Schritt Entfernung und tat zwei gewaltige Sprünge; er war nun den Jägern so nahe, dass er nur ein drittes Mal losschnellen musste, um einen der Elefanten anzuspringen.
Doch dazu blieb ihm keine Zeit; kaum hatte er seinen zweiten Sprung getan, wurden zwei Schüsse auf einmal abgefeuert.
Der Tiger fiel zur Seite.
Sir James hatte ihn seitlich anvisiert und neben der Schulter getroffen. René hatte frontal auf ihn gezielt und ihm die Stirn zertrümmert.
Der Tiger war mausetot.
Sogleich, als hätte die Detonation der Schüsse sie angelockt, sprangen drei neue Tiger unter grauenvollem Gebrüll aus dem Dschungel; doch als hätten sie begriffen, was geschehen war, und befürchteten, von den Jägern aufs Korn genommen zu werden, wenn sie innehielten, beschrieben sie unablässig Kreise im Gras, um den Gegner, mit dem sie sich messen mussten, auszukundschaften und einzuschätzen.
Die Jäger waren viel zu erfahren, um zu schießen, wo keine Aussicht auf Erfolg bestand. Sie warteten, bis die Tiger mit ihren Kapriolen fertig waren.
Nach einigen Sekunden sprang eine der Bestien Renés Elefanten von der Seite an, damit der Elefant sie nicht mit dem Vorderfuß treffen konnte.
René blieb genug Zeit, mit einer seiner Pistolen zu zielen und zu feuern, doch er traf den Tiger nur am Schenkel, und dieser Streifschuss fachte den Ingrimm des Raubtiers noch mehr an. Mit funkelnden Augen und geiferndem Maul krallte es seine Pranken in die Seite des Elefanten und versuchte, an ihm hinaufzuklettern, doch der Koloss schüttelte es einfach ab. Das ermöglichte René, einen zweiten Schuss auf den Tiger abzugeben, der ihn diesmal am Hals traf. Der Elefant ging auf den Tiger zu, schützte seinen Rüssel vor dessen Tatzen, indem er ihn hochhielt, und versuchte, ihn mit seinen riesigen Füßen zu zertreten, doch der Tiger entkam dieser Gefahr, indem er sich am Geschirr des Elefanten festzukrallen versuchte. Bernard auf der anderen Seite des Turms hielt vergeblich Ausschau nach dem Tiger, und Jane, die sich um René mehr Sorgen machte als um die eigene Sicherheit, beugte sich weit aus dem Turm hinaus. Glücklicherweise stieß der Elefantenlenker dem Tiger seine Pike in die Brust, um sein Bein aus den Krallen des für die Jäger unsichtbaren Tiers zu befreien. Der Tiger ließ das Bein los und stürzte zu Boden. Kaum lag er dort, stellte der Elefant ihm einen Vorderfuß auf den Kopf und trat zu.
Doch nun befanden sich Sir James, Hélène und Jules in noch größerer Gefahr, denn während ein Tiger ihren Elefanten von vorne angriff, war ein zweiter von hinten auf den Rücken ihres Trägers gesprungen und hielt sich fest. Doch er hatte die Rechnung ohne René gemacht, dem er seine linke Seite ungeschützt darbot, und René legte an, drückte ab und schoss ihm eine Kugel ins Herz.
Zuerst bäumte der Tiger sich auf dem Elefantenrücken auf, dann verbiss er sich in seine eigene Wunde und fiel hinunter.
Der Kopf des ersten Tigers war nur noch wenige Fuß von Hélène entfernt, als Sir James die beiden Läufe seines Gewehrs gegen das Tier hielt und sie abfeuerte. Kugeln, Pulver und Feuer fraßen sich in den Körper des Tigers, der tödlich getroffen zu Boden fiel.
Die Jagdgesellschaft konnte aufatmen.
Fünf Tiger waren erlegt.
François kam mit seinen Treibern und den Hunden aus dem Dschungel zurück; zwei Männer fehlten: Dem einen hatte einer der Tiger den Kopf zerschmettert, dem anderen war von einer der Bestien die Brust aufgerissen worden, als sie ihnen im Wald in die Quere gekommen waren. Der Tod hatte die beiden so schnell ereilt, dass sie nicht einmal aufschreien konnten, oder ihr Todesschrei war in dem Getümmel aus Elefantentrompeten, Hundegebell und Rufen der anderen Treiber untergegangen.
Als die Treiber jedoch die fünf Tiger erblickten, die auf dem Boden lagen, dachten sie nicht länger an ihre toten Freunde. Die Bengalen und Birmanen sind so besessene Tigerjäger, dass in ihren Augen zwei getötete Menschen kein zu hoher Preis für fünf tote Tiger sind.
Die Elefanten waren beide verletzt, doch nicht schwerwiegend.
Auf ihrem kleinen birmanischen Pferd, das dem Pferd ihres Bruders Justin glich, kam Adda der Karawane entgegengeritten und preschte dann im Galopp zum Herrenhaus zurück, um zu melden, dass die vier Besucher und ihre Brüder unversehrt und wohlbehalten waren.
Die Elefanten Omar und Ali hatten sich erneut um die Schwestern verdient gemacht. Hélène äußerte deshalb den Wunsch, sie zu erwerben, denn sie wollte die intelligenten Tiere zum Schutz und zur Verteidigung des Hauses einsetzen. René erklärte den Schwestern, sie könnten die Elefanten auf der Stelle als ihr Eigentum betrachten; er versprach ihnen, über den Shabundar als Mittelsmann alles Erforderliche mit dem Besitzer der Elefanten zu regeln.
Am Abend litt Jane unter Fieber, was die anderen den Strapazen dieses Tages zuschrieben. Ihre Schwester blieb bei ihr.
René und Sir James plauderten miteinander.
Adda, von ihnen gebeten, sich nach Janes Befinden zu erkundigen, berichtete, sie habe Schluchzen vernommen, als sie sich dem Zimmer näherte, und sei aus Furcht, indiskret zu sein, nicht weitergegangen.
Sir James, dem nicht verborgen blieb, wie groß Renés Anteilnahme an Janes Kummer war – Adda hatte nur Janes weinende Stimme gehört -, versprach René, gleich als Erstes am nächsten Tag für ihn in Erfahrung zu bringen, was diesen Kummer ausgelöst hatte.
In diesem heißen Erdteil sind die Nächte von köstlicher Kühle. Die beiden jungen Männer ergingen sich bis um ein Uhr auf der Veranda; durch die Musselinvorhänge sahen sie wie einen Stern im Nebel das zitternde Licht der Kerze in Janes Zimmer.
So wie René sich fast alle Bereiche der Naturwissenschaften angeeignet hatte, hatte er auch alle Gelegenheiten genutzt, die sich boten, sich auf den Gebieten der Chirurgie und der Heilkunde kundig zu machen. Dies war seinen Reisegefährten nicht verborgen geblieben, und deshalb war René bekümmert, aber nicht erstaunt, als Sir James ihn am nächsten Morgen in Hélènes Auftrag bat, Jane aufzusuchen, deren Leiden sich von Stunde zu Stunde verschlimmerte.
Angesichts des vertrauten Umgangs, der zwischen René und den Schwestern herrschte, wäre es lächerlich gewesen, dieser Bitte nicht nachzukommen.
Offenbar hatte Jane ausdrücklich verlangt, allein mit René zu sprechen, denn als dieser Hélène zu ihrer Schwester begleiten wollte, erwiderte Hélène, sie glaube, dass ihre Anwesenheit bei einem so vertraulichen Gespräch störe.
René ging allein die Treppe hinauf; er klopfte leise an die Tür, und eine bebende Stimme antwortete: »Treten Sie ein.«
75
Janes Leiden
Jane lag auf einer Chaiselongue; alle Jalousien ihres Zimmers waren geschlossen, damit die Dunkelheit für Kühle sorgte und ein gelegentlicher Windhauch frische Luft hereinbrachte.
Als Jane René eintreten sah, richtete sie sich auf und streckte ihm die Hand entgegen.
»Sie wollten mich sehen, liebe Schwester«, sagte René, »und hier bin ich.«
Jane wies auf einen Stuhl am Kopfende ihrer Chaiselongue und ließ sich mit einem Seufzer der Erschöpfung zurücksinken.
»Als wir gestern zurückkehrten«, sagte sie, »und als meine Schwester den Wunsch aussprach, die zwei tapferen Tiere zu besitzen, die uns so große Dienste erwiesen haben, baten Sie sie nicht nur, die Tiere als unser Eigentum zu betrachten, sondern Sie sprachen auch von Ihrem Wunsch, uns in wenigen Tagen zu verlassen.«
»So ist es«, sagte René, »denn ich darf meine Abreise nicht länger hinausschieben. Mein Kommandant war so großzügig, mich so lange zu beurlauben, bis ich Sie sicher in Ihr neues Zuhause gebracht haben würde. Dies ist geschehen. Und ich danke Gott, dass Ihnen und Ihrer Schwester auf dieser beschwerlichen Reise kein Haar gekrümmt wurde. Ihre Schwester hat den Beschützer wiedergefunden, dessen Ankunft sie erwartete, und der nächste Priester, der auf seinem Weg nach China oder Tibet vorbeikommt, wird sie trauen.«
»Ebendarum geht es«, sagte Jane, »denn meine Schwester würde sich freuen, wenn Sie bis zu ihrer Trauung bleiben könnten.«
René bedachte Jane mit einem traurigen Blick; dann nahm er eine ihrer Hände in seine Hände und sagte: »Jane, Sie sind ein Engel, und ich muss sehr gewichtige Gründe haben, wenn ich Ihnen diese Bitte nicht erfüllen kann.«
»Sie schlagen sie also ab?«, fragte Jane seufzend.
»Ich muss es«, sagte René.
»Gestehen Sie, dass Sie mir den wahren Grund Ihrer Abreise nicht nennen wollen.«
René sah Jane in die Augen. »Soll ich Ihnen den Grund sagen, was es auch sein mag?«, fragte er.
»Ja, was es auch sein mag«, erwiderte Jane, »sagen Sie ihn; die Wahrheit mag bisweilen das schmerzlichste Heilmittel sein, aber sie ist das zuverlässigste. Ich bitte Sie darum!«
»Jane«, sagte René unter Aufbietung größter Selbstbeherrschung, »zu Ihrem großen Unglück lieben Sie mich.«
Jane stieß einen Schrei aus.
»Und zu meinem großen Unglück«, fuhr René fort, »kann ich nicht der Ihre sein.«
Jane verbarg ihr Gesicht in den Händen und brach in Schluchzen aus.
»Jane, ich hätte gewünscht, Ihnen nicht sagen zu müssen, was ich soeben sagte«, sprach er weiter, »aber als Ehrenmann musste ich so handeln, wie ich es tat.«
»Genug«, sagte Jane, »lassen Sie mich.«
»Nein«, sagte René, »ich werde Sie nicht so zurücklassen, sondern Sie werden die Ursache dafür erfahren, und dann können Sie über mich und über Ihre eigenen Gefühle urteilen.«
»René«, sagte Jane, »Sie sehen meine Schwäche, die zu leugnen ich nicht vermocht habe; Sie sagen, dass uns ein unüberwindliches Hindernis trennt, das unsere Vereinigung unmöglich macht. Beenden Sie, was Sie begonnen haben! Sie haben die Wunde geschlagen, nun müssen Sie sie auch ausbrennen.«
»Lassen Sie sich von mir mit den sanften Händen eines Bruders berühren, Jane, und nicht mit den harten Händen eines Chirurgen. Vergessen Sie, dass ein Schleier zerrissen wurde und dass ich durch diesen Riss sah, was Sie vor mir zu verbergen suchten. Geben Sie Ihre Hände in meine Hände, legen Sie Ihren Kopf an meine Schulter. Um nichts in der Welt wünschte ich, dass Sie mich nicht mehr liebten, Jane! Ich wünschte nur, Sie liebten mich mit einer anderen Art von Liebe. Sie sind 1788 geboren, teure Freundin; Sie waren zwei Jahre alt, als Ihre Familie einen jungen Verwandten namens Hector de Sainte-Hermine aufnahm, der sich mit Ihrem Vater einschiffen und unter ihm das Seemannsgewerbe erlernen sollte; dieser Hector war der dritte und jüngste Sohn des Grafen von Sainte-Hermine, des älteren Bruders Ihres Vaters. Wenn Sie sich daran nicht erinnern können, erinnert Ihre Schwester Hélène sich gewiss noch.«
»Auch ich kann mich daran erinnern«, sagte Jane, »aber was hat dieser junge Mann mit dem unüberwindlichen Hindernis zu schaffen, das uns voneinander trennt?«
»Lassen Sie mich alles sagen, liebe Jane, denn wenn ich es getan habe, darf nicht der leiseste Zweifel an meiner Ehrlichkeit bestehen.
Der Knabe fuhr mit Ihrem Vater zur See, unternahm drei Reisen mit ihm und begann am Seemannsstand Geschmack zu finden, als die Revolution ausbrach und sein Vater ihn gegen Ende des Jahres 1792 nach Hause zurückbeorderte. Sie erinnern sich vielleicht an den Abschied von ihm, Jane, denn es war ein schmerzlicher und tränenreicher Abschied; es schnitt ihm ins Herz, sich von der Cousine zu trennen, die er seine kleine Frau nannte.«
Ein Blitz zuckte durch Janes Gehirn.
»Unmöglich!«, rief sie und starrte René fassungslos an.
»Hector«, fuhr René unbeirrt fort, ohne Janes Verblüffung zu beachten, »kehrte in das Haus seiner Eltern zurück, um mitzuerleben, wie sein Vater enthauptet, sein ältester Bruder füsiliert und sein zweitältester Bruder guillotiniert wurde. Treu dem Gelöbnis, das er abgelegt hatte, folgte er ihnen im Verfechten der royalistischen Sache. Dann kam der Frieden; alles schien beendet, und Hector konnte die Augen öffnen, sich umsehen, lieben und hoffen.«
»Und er verliebte sich in Mademoiselle de Sourdis«, sagte Jane mit tonloser Stimme.
»Und er verliebte sich in Mademoiselle de Sourdis«, wiederholte René.
»Aber was geschah dann?«, fragte Jane. »Wie kam es, dass er verschwand, als er den Ehevertrag unterschreiben sollte, und dass man nie in Erfahrung bringen konnte, warum und wohin? Was wurde aus ihm? Wo ist er?«
»Als er im Begriff war, den Ehevertrag zu unterzeichnen, kam ein Freund, der ihn aufforderte, sich an sein Gelöbnis zu erinnern; er hatte sein Wort gegeben, und lieber wollte er sein Glück verlieren und sein Leben aufs Spiel setzen, als zu zaudern, wenn es darum ging, sein Wort zu halten. Er warf die Feder hin, mit der er unterschreiben wollte, verließ den Raum, ohne gesehen zu werden, und folgte dem Ruf der Stimmen seines toten Vaters und seiner toten Brüder. Er wurde festgenommen und dank der Protektion eines Mächtigen nicht erschossen, wie er es erbeten hatte, sondern drei Jahre im Temple-Gefängnis festgehalten. Nach drei Jahren erfuhr der Kaiser, der ihn für tot gehalten hatte, dass er noch lebte, doch da er der Ansicht war, drei Jahre Gefängnis seien keine ausreichende Bestrafung für jemanden, der gewagt hatte, sich gegen ihn aufzulehnen, verurteilte er ihn dazu, als einfacher Soldat oder als einfacher Matrose zu dienen, ohne jede Hoffnung auf Beförderung.
Hector, der seine ersten Schritte unter Ihrem Vater in der Marine gemacht hatte, bat, in die Marine eintreten zu dürfen, und es wurde ihm gestattet.
Hector entschied sich gegen die Kriegsmarine und für einen Kaperfahrer, auf dem es größere Freiheiten gab; er machte sich auf nach Saint-Malo und heuerte bei Surcouf auf dessen Brigg Le Revenant an.
Sie wissen, wie der Zufall es fügte, dass die Standard, auf der Sie mit Ihrer Schwester und Ihrem Vater als Passagiere reisten, der Revenant begegnete. Sie sahen das Gefecht mit an, in dessen Verlauf Ihr Vater den Tod fand.
Wie gesagt war Hector Mitglied der Mannschaft Surcoufs. Er hörte den Namen des Vicomte de Sainte-Hermine. Er sah den toten Vicomte, er hörte Ihren Wunsch, dass der Leichnam Ihres Vaters nicht ins Meer geworfen werde; er sprach mit Surcouf und erreichte, dass man den Toten an Bord behielt; Surcouf ermächtigte ihn sogar, Sie auf Ihrem weiteren Weg zu begleiten und Sie erst zu verlassen, wenn er sich vergewissert haben würde, dass Sie und Ihre Schwester sicher in Ihrem Zuhause angekommen waren.
Und nun wissen Sie alles, liebe Jane. Das Übrige muss ich Ihnen nicht erzählen; ich muss aber darauf zählen können, dass Sie selbst Ihrer Schwester gegenüber striktestes Stillschweigen wahren.
Dieser Knabe, der unter Ihrem Vater die Grundlagen der Ausbildung zum Seemann erlernt hat, den es so sehr schmerzte, Sie zu verlassen, als er im Jahr 92 zu seiner Familie zurückgerufen wurde, der erleben musste, dass sein Vater enthauptet, sein ältester Bruder erschossen und sein zweitältester Bruder guillotiniert wurde – dieser junge Mann, der trotz des schrecklichen Schicksals seiner Brüder den gleichen Weg beschritt wie sie, der, als er den Krieg beendet wähnte, Madamoiselle de Sourdis seine Liebe gestand, der nach seiner unter so viel Aufsehen gescheiterten Eheschließung in seinem Herzen gelobt hat, niemals einer anderen Frau anzugehören als ihr, der mit der Waffe in der Hand gefangen, doch nicht füsiliert wurde, sondern drei Jahre lang im Temple-Gefängnis eingekerkert war, den der Kaiser zu guter Letzt begnadigte, wenn auch unter der Bedingung, dass er als gemeiner Soldat in das Heer oder als gemeiner Matrose in die Marine eintrat: Dieser junge Mann, meine liebe Jane, ist der Graf von Sainte-Hermine, er ist Ihr Cousin, und ich bin es!«
Und er glitt neben Janes Chaiselongue auf die Knie, ergriff ihre Hände und bedeckte sie mit Küssen und Tränen.
»Entscheiden Sie selbst«, sagte René, »kann ich der Ehemann einer anderen als Mademoiselle de Sourdis’ werden, ohne mich an allem zu versündigen, was ehrenhaft im Herzen eines Menschen ist?«
Jane stieß ein ersticktes Schluchzen aus, legte ihre kraftlosen Arme um den Hals ihres Cousins, drückte mit eiskalten Lippen einen Kuss auf seine Stirn und fiel in Ohnmacht.
76
Der Aufschub
Als René sah, dass Jane ohnmächtig wurde, war seine erste Regung die, einen Flakon mit Riechsalz aus der Tasche zu holen, um ihn ihr unter die Nase zu halten; dann erwog er jedoch, dass er sie nur wieder dem Schmerz aussetzte, wenn er sie ins Leben zurückholte, und dass er besser daran tue, auf die Natur zu vertrauen, die Jane helfen würde, während des Betäubungsschlafs ihrer Sinne die Kraft wiederzuerlangen, deren sie beim Erwachen bedurfte, so wie der Tag seine Kraft aus dem Dunkel der Nacht und den Tränen des Morgens schöpft.
Wahrhaftig kündete schon bald ein leiser Seufzer an, dass Jane im Begriff war, das Bewusstsein wiederzuerlangen, und René, an dem sie lehnte, konnte zählen, wie viele Herzschläge zwischen Tod und Leben liegen. Zuletzt schlug sie die Augen auf und flüsterte, noch ohne zu wissen, wo sie sich befand: »Oh, ist mir wohl!«
René schwieg; es war noch zu früh, die ersten, schwachen Lichtstrahlen der Rückkehr Janes in das Bewusstsein mit dem kalten, harten Tageslicht der Wirklichkeit zu vertreiben; stattdessen verlängerte er wie durch Hypnose den undefinierbaren Zustand, der weder Tod noch Leben ist und in dem die Seele gewissermaßen über dem Körper schwebt.
Dann kehrten Janes Gedanken einer nach dem anderen zurück und mit ihnen das Wissen um ihre Situation. Ihre Verzweiflung war kummervoll und sanft wie die jener, die unverschuldet ein Unglück trifft, und wandelte sich bald in Resignation. Tränen entquollen ihren Augen, doch ohne Heftigkeit und ohne Schluchzen, wie im Frühjahr der Lebenssaft aus einem jungen Baum rinnt, dem die Axt versehentlich eine Wunde zugefügt hat. Als sie die Augen öffnete und den jungen Mann neben sich sah, sagte sie: »Ach, René, Sie sind bei mir geblieben, das ist gütig von Ihnen; aber Sie haben recht, so kann es nicht länger weitergehen, um Ihretwillen wie um meinetwillen. Bleiben Sie noch einen Augenblick, lassen Sie mich Kraft aus Ihrer Nähe und aus Ihrer Berührung schöpfen, und Sie werden sehen, dass ich alles tun werde, was Vernunft und Willen im Verein zu tun vermögen. Was Ihr Geheimnis betrifft, müssen Sie nichts befürchten, es ist in meinem Herzen so tief begraben, wie es die Toten in ihren Gräbern sind, und glauben Sie mir, René, dass ich trotz meines Schmerzes, trotz allen Leides, das ich erlitten habe und noch erleiden werde, niemals wünschen könnte, Ihnen nicht begegnet zu sein. Wenn ich meine gegenwärtigen Kümmernisse mit dem Leben vergleiche, das ich führte, bevor ich Sie sah, und das ich führen werde, wenn ich Sie nicht mehr sehe, ist mir mein gegenwärtiges Leben mit allem Leid, das es mit sich bringt, tausendmal teurer als das farblose Leben von früher oder das ziellose Leben künftiger Zeiten. Ich werde jetzt allein mit der Erinnerung an Sie in meinem Zimmer bleiben. Gehen Sie hinunter; sagen Sie den anderen, dass ich nicht kommen werde, sagen Sie, es sei nichts Ernstes, ich sei nur unwohl, müde, weiter nichts, sagen Sie, Sie hätten mir geraten, im Bett zu bleiben; schicken Sie mir Blumen herauf, kommen Sie mich besuchen, wenn Sie die Zeit erübrigen können, ich werde Ihnen für alles dankbar sein, was Sie für mich tun können.«
»Soll ich Ihnen gehorchen«, sagte René, »oder soll ich trotz Ihrer Bitte bleiben, bis Sie wieder bei Kräften sind?«
»Nein, gehorchen Sie; erst wenn ich sagen werde: ›Gehen Sie nicht‹, wird es an der Zeit sein, nicht auf mich zu hören.«
René erhob sich, küsste seiner Cousine mit ungeheuchelter Zärtlichkeit die Hand, blieb einen Augenblick lang stehen und sah sie traurig an, dann ging er zur Tür, verharrte abermals, um sie anzusehen, und ging hinaus.
Einzig Hélène war aufgefallen, wie ernst die Erkrankung ihrer Schwester zu sein schien, die sie weder Erschöpfung noch überstandenen Gefahren zuschrieb, sondern der wahren Ursache, die sie zu erahnen begann.
Hélène war von sanftmütigem und bezauberndem Wesen, doch eher kühl als feurig, und ihre Verbindung mit Sir James war keine Liebesheirat. Sie hatte Sir James in der vornehmen Welt kennengelernt und in ihm den dreifachen Adel von Geist, Geburt und Herzen gefunden; Sir James hatte ihr gefallen, doch ihre Liebe zu ihm war nicht so ausschließlicher Natur, dass Glück oder Unglück ihres Lebens von ihrer Vereinigung abhingen. Er seinerseits hegte ähnlich temperierte Gefühle für seine Braut; er war zum vereinbarten Zeitpunkt aus Kalkutta gekommen, doch eher wie ein Ehrenmann, der sein Wort hält, als wie ein Liebender, der sich nach der Geliebten verzehrt. Eine Weltreise hätte er ebenso pünktlich absolviert wie die Reise von vier-, fünfhundert Meilen von Kalkutta zum Land des Betels; doch hätte er nach vollbrachter Weltreise keine Hélène vorgefunden, hätte ihn das zwar verwundert, da in seinen Augen jede Frau aus gutem Hause ebenso unverbrüchlich ihr Wort hält wie ein Gentleman, aber es hätte ihn nicht in Verzweiflung gestürzt. Diese zwei Herzen waren füreinander geschaffen; diese zwei Menschen waren für ein ungetrübtes Eheglück geschaffen.
Mit Jane verhielt es sich anders. Jane mit ihrer reichen Phantasie, ihrem Hitzkopf, ihrem feurigen Herzen musste lieben und wiedergeliebt werden; auf den Augenschein gab sie nichts; die schlichte Seemannskleidung Renés hatte ihr kein Kopfzerbrechen bereitet; sie hatte keine Überlegungen angestellt, ob er reich oder arm, Edelmann oder Bürgersmann sei; wie ein rettender Engel war er vor ihr erschienen, als sie sich verzweifelt gegen die Umarmung und Küsse eines Piraten wehrte; sie hatte gesehen, wie er sich ins Meer stürzte, um einen einfachen Matrosen, den seine Kameraden im Stich gelassen hatten, vor dem Rachen eines Hais zu retten, und sie hatte gesehen, wie er dieses Ungeheuer, das alle Seeleute mit Schrecken erfüllt, attackiert und überwältigt hatte; sie hatte erlebt, dass er um ihretwillen und um ihrer Schwester willen eine Reise von fünfzehnhundert Meilen unternommen hatte, in deren Verlauf er gegen malaiische Piraten, gegen Tiger, gegen Riesenschlangen und gegen Räuber gekämpft hatte, und sie hatte gesehen, dass er in seiner Güte das Gold verschenkte wie ein Nabob. Genügte das nicht? Obendrein war er jung, schön, distinguiert. Sie hatte sofort gewusst, dass die Vorsehung und nicht der Zufall sie zusammengebracht hatte, und sie hatte sich in ihn verliebt, wie ein Mensch ihrer Gemütsverfassung zum ersten Mal liebt, mit allen Fibern ihres Herzens. Und nun musste sie die Hoffnung aufgeben, dass ihre Liebe Erwiderung fand, diese Hoffnung, die sie vom ersten Tag ihrer Bekanntschaft bis zu jenem Augenblick gehegt hatte, der ihr Renés Herz und ihr eigenes Herz ganz und gar enthüllte. Was sollte sie nun anfangen, viertausend Meilen von Frankreich entfernt in einer Einöde, in der Renés Abreise sie doppelt einsam zurücklassen würde? Wie glücklich war doch ihre Schwester! Sie liebte und wurde geliebt.
Eine Liebe wie die Sir James Asplays hätte ihrer Liebe niemals genügt. Warum muss es so leidenschaftliche Herzen geben, wenn ihnen kein besseres Los beschieden ist, als in der Einsamkeit zu leben und in der Kälte eines Lebens ohne Sonne zu vergehen?
Eine Frau, die nie schön war, war nie jung, aber eine Frau, die nie geliebt wurde, hat nicht gelebt.
In ihrer Verzweiflung biss Jane in ihre tränennassen Batisttaschentücher, an deren Rand sie sich eines fernen Tages die ineinander verschlungenen Initialen ihres und Renés Namens erträumt hatte.
So verging der Tag.
Janes Unwohlsein diente ihr als Vorwand, die anderen nicht sehen zu müssen, doch Hélène, die ihren wahren Zustand zu erraten begonnen hatte, ließ, was ungewöhnlich genug war, Jane fragen, ob sie sie empfangen wolle.
Jane ließ ihr ausrichten, es sei ihr recht, und kurz darauf hörte sie im Flur die Schritte ihrer Schwester.
Sie unterdrückte ihre Tränen und versuchte zu lächeln, doch sobald sie die geliebte Schwester erblickte, vor der sie noch nie Geheimnisse gehabt hatte, brach sie in Schluchzen aus, breitete die Arme aus und rief: »O Schwester, ich bin so unglücklich! Er liebt mich nicht, und er wird uns verlassen!«
Hélène schloss die Tür, schob den Riegel vor und eilte zu Jane, die sie umarmte.
»Oh!«, rief Hélène. »Warum hast du mir nichts von dieser Liebe erzählt, solange noch Zeit war, sie zu unterdrücken?«
»Ach!«, sagte Jane. »Ich habe ihn vom ersten Augenblick an geliebt.«
»Und ich in meiner Selbstsucht«, sagte Hélène, »war nur mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt, statt auf dich Acht zu geben, wie es meine Pflicht als ältere Schwester und zweite Mutter gewesen wäre! Und wie blind war ich, auf den Anstand dieses Mannes zu vertrauen!«
»O nein, Hélène, ihm darfst du keinen Vorwurf machen«, rief Jane, »der Himmel ist unser Zeuge, dass er nichts getan hat, um meine Liebe zu wecken, und dass ich mich in ihn verliebt habe, weil er für mich der schönste, der ritterlichste und der tapferste Mann der Welt ist!«
»Und er hat gesagt, dass er dich nicht liebt?«, fragte Hélène ungläubig.
»O nein, o nein! Er weiß, wie sehr mich das verletzen würde.«
»Er ist also verheiratet?«
Jane schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie.
»Ist es eine Frage seines Ehrgefühls?«, fragte Hélène. »Hält er dich für zu vornehm und zu reich, um dich zur Frau eines einfachen Korsarenoffiziers zu machen?«
»Er ist vornehmer und reicher als wir, liebe Schwester!«
»Dann steckt hinter dieser Geschichte ein Geheimnis?«, fragte Hélène.
»Mehr als das, ein Bündel von Geheimnissen!«, erwiderte Jane.
»Die du mir nicht verraten darfst?«
»Ich habe es gelobt.«
»Armes Kind, sag mir nun, was ich für dich tun kann.«
»Sorge dafür, dass er so lange wie möglich bei uns bleibt; jeder weitere Tag, den er hierbleibt, ist ein Tag Leben, den ich gewonnen habe.«
»Und du willst ihn sehen, bis er abreist?«
»Sooft ich kann.«
»Bist du deiner denn so sicher?«
»Nein, aber ich bin seiner sicher!«
Das Fenster stand offen, und Hélène trat hin, um es zu schließen. Im Hof sah sie Sir James, der mit einigen staubbedeckten Männern sprach, die offenbar eine lange Reise hinter sich hatten; sie unterhielten sich lebhaft und wirkten fröhlich.
Sir James bemerkte Hélène am Fenster und rief: »Ah, meine Teure, kommen Sie, kommen Sie, ich habe eine gute Nachricht für Sie!«
»Geh schnell, Hélène«, sagte Jane, »und komme bald wieder, damit du mir die gute Nachricht erzählen kannst. – Ach!«, murmelte sie, »für mich gibt es keine gute Nachricht, und niemand wird mich je rufen, um mir etwas Freudiges mitzuteilen.«
Fünf Minuten später kam Hélène zurück. Jane hob den Blick und lächelte sie traurig an. »Liebe Schwester«, sagte sie, »ich habe mich darauf besonnen, dass mein Leben doch nicht ohne Glück ist, denn mein Glück ist die Anteilnahme an deinem Glück. Komm, setz dich zu mir, und erzähl mir, was dir Schönes widerfahren ist.«
»Du hast sicherlich erraten«, sagte Hélène, »warum wir die Priester weiterziehen ließen, die für unseren Vater die Totenmesse gehalten haben, ohne dass wir unsere Ehe von ihnen hätten segnen lassen, nicht wahr?«
»Ja«, erwiderte Jane, »es wäre euch pietätlos erschienen, von denselben Stimmen die Totenmesse und die Hochzeitsmesse sprechen zu lassen.«
»Ja. Und nun entschädigt Gott uns: Ein italienischer Priester mit Namen Pater Luigi, der in Rangun wohnt, macht alle paar Jahre eine Rundreise durch das Land, um fromme Taten zu vollbringen; und von den Leuten im Hof, die gerade aus Pegu kommen und sich als Tagelöhner verdingen wollen, hat Sir James erfahren, dass Pater Luigi in wenigen Tagen hier sein wird. Ach, liebe Jane, was für ein schöner Tag wäre es gewesen, wenn er vier Menschen gleichzeitig hätte glücklich machen können!«
77
Die Nächte Indiens
Von diesem Augenblick an war das Leben für Jane nur mehr eine Abfolge widersprüchlicher Sinneswahrnehmungen. War René in ihrer Nähe, lebte sie mit allen Fibern ihres Wesens; war er fern, verließ sie alle Kraft, bis ihr Herz kaum noch zu schlagen schien.
René, der sie mit aller Zärtlichkeit des Freundes und Verwandten liebte, machte sich keine Illusionen über den Ernst ihres Zustands. Der junge Mann voll unwiderstehlicher Anziehungskraft war keineswegs unempfänglich für den betörenden Einfluss eines schönen und leidenschaftlich liebenden jungen Mädchens, dessen Blick, dessen Händedruck und dessen Seufzer sein armes Leben in die Pulsadern des geliebten Mannes flößten. Sich mit sechsundzwanzig Jahren der Liebe zu verweigern, in der Blüte des Lebens und der Jugend, wenn Himmel, Erde, Blumen, Luft, Windhauch und die berauschenden Reize des Orients einem zurufen: »Liebe!«, das heißt, allein gegen alle Kräfte der Natur anzukämpfen.
Man könnte es so ausdrücken, dass René sich einer Prüfung unterzog, die er unmöglich bestehen konnte und die er dennoch immer wieder siegreich bestand.
Im ersten Stock des Hauses gab es ein großes mittleres Zimmer, von dem die Schlafzimmer abzweigten; dieses Zimmer hatte einen Balkon nach Westen und einen nach Osten; und auf einer der beiden Veranden verbrachten Jane und René den schönsten Teil ihrer Nächte. Jane liebte Blumen anstelle von Perlen, Edelsteinen und Diamanten, die unbeachtet in ihren Schatullen lagen, und sie flocht sich Halsketten aus einer lieblichen und bezaubernden Blume namens mhogry, ohne die Zaubermacht ihres Dufts zu ahnen oder gar absichtsvoll einzusetzen. Diese Blume ähnelt im Aussehen sowohl dem Jasmin als auch dem Flieder und im Duft der Tuberose und dem Pfeifenstrauch; ihr Blütenkelch, weiß, rosa oder gelb, sitzt auf einer hohen Blütenkrone, durch die ein Faden gezogen wird, und dieser Blütenschmuck hüllt seine Trägerin in ein köstliches und erregendes Parfum.
Die Maurinnen Algiers und der afrikanischen Küste können mit ihren Kronen und Gürteln aus Orangenblüten eine Ahnung von diesem duftenden Schmuck vermitteln.
Die Nächte Indiens sind zu bestimmten Zeiten prachtvoll und zauberhaft; Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind von atemberaubender Schönheit: Der Himmel durchläuft alle Färbungen, wie sie der kundigste Feuerwerker nicht zu ersinnen vermöchte. An schönen Frühlings- und Herbsttagen, wenn man von diesen Jahreszeiten sprechen will, die weder sichtbar noch spürbar sind, gleicht das Aufgehen des Vollmonds einem Sonnenaufgang an unseren farblosen westlichen Tagen. Ist die Sonne aus Feuer, ist der Mond aus Gold; sein Umfang ist riesig; wenn er am Scheitelpunkt steht, kann man in seinem Schein so bequem lesen, schreiben oder jagen wie am helllichten Tag. Die Herrlichkeit der indischen Nächte liegt vor allem in ihrem Abwechslungsreichtum: Die einen sind so finster, dass man keine zwei Schritte weit sehen kann, die anderen unterscheiden sich fast nicht vom Tag und nur durch ihren bestirnten Himmel und eine unendliche Vielfalt an bei uns unbekannten Sternbildern, die den Himmel bedecken. Die Himmelskörper wirken in diesen Nächten näher, zahlreicher, strahlender als in unserer Hemisphäre, und der Mond überstrahlt ihr Licht nicht etwa, sondern scheint es durch sein Leuchten noch zu verstärken.
Andere Nächte – wobei ich zögere, von Nächten zu sprechen, da dieses Wort dem Phänomen, das es bezeichnen soll, so wenig gerecht wird -, sind wahre Polarnächte, die das ganze Himmelsgewölbe in Brand setzen: Kaum sind hinter den spärlichen Wolken, die über dem Azur des Himmels ziehen, die purpurnen Strahlen der untergehenden Sonne erloschen, kaum ist die Dämmerung vergangen wie im Theater der Vorhang zwischen zwei Bühnenbildern, steigt vom Boden eine milchige Helligkeit auf, erfüllt die Landschaft von Horizont zu Horizont und erzeugt jene schönen weißen Nächte ohne erkennbare Lichtquelle, die der große russische Dichter Puschkin besungen hat. Naht das Tageslicht? Bricht die Nacht herein? Niemand vermöchte es zu sagen: Die Körper werfen keine Schatten, die Lichtquelle, die diese eigenartige Helligkeit erzeugt, ist nicht zu erkennen, ein unbekanntes Fluidum umwallt den Betrachter, die Phantasie schwingt sich auf bis zu den höchsten Gewölben des Firmaments, das Herz fühlt sich von göttlicher Zärtlichkeit durchdrungen, und die Seele verspürt jene Unendlichkeitsanwandlungen, die den Glauben an die Existenz des Glücks wecken.
Unterdessen bewegen sich die Zweige und verströmen süße Düfte, leises Rauschen regt sich in den höchsten Baumwipfeln wie im bescheidensten Rasenflor, die Blüten überlassen ihr Parfum dem Windhauch, und dieser bringt in glühenden Schwaden den Wohlgeruch Millionen verschiedener Blumen mit, den Weihrauch, den die Natur dem Altar jenes universellen Gottes darbringt, der viele Namen, aber nur ein Wesen hat.
Die zwei jungen Leute saßen nahe nebeneinander; Janes Hand lag in Renés Hand; bisweilen verharrten sie stundenlang so, ohne zu sprechen; Jane berauschte sich, René träumte.
»René«, sagte Jane, den Blick zum Himmel gerichtet und in wehmütiges Sinnen versunken, »ich bin glücklich. Warum kann Gott mir dieses Glück nicht gewähren? Es würde mir genügen.«
»Und genau darin, Jane«, erwiderte René, »besteht unsere Schwäche als Menschen, als armselige niedrigere Wesen: Anstelle eines Gottes der Welten, der die universelle Harmonie durch das Gleichgewicht der Himmelskörper bewirkt, haben wir uns einen Gott nach unserem Bild geschaffen, einen persönlichen Gott, von dem jedermann Rechenschaft verlangt, nicht über die großen atmosphärischen Katastrophen, sondern über unsere kleinen privaten Missgeschicke. Wir beten zu Gott, zu einem Gott, den unser menschlicher Geist nicht fassen kann, den man mit menschlichem Maß nicht messen kann, der nirgends sichtbar ist und dennoch, wenn es ihn gibt, überall weilt; wir beten zu ihm, wie unsere Vorfahren zu ihrem Hausgott beteten, einem ellenlangen Figürchen, das sie immer vor Augen und zur Hand hatten, wie der Inder zu seinem Götzen betet und der Neger zu seinem Talisman; wir fragen ihn, je nachdem ob wir erfreut oder bekümmert sind: Warum hast du dies getan? Warum hast du nicht das getan? Unser Gott antwortet nicht, er ist uns zu fern, und unsere kleinen Kümmernisse kümmern ihn nicht. Und dann behandeln wir ihn ungerecht, wir werfen ihm die Missgeschicke vor, die uns widerfahren, als hätte er sie über uns gebracht, und als wären wir es nicht zufrieden, bloß unglücklich zu sein, handeln wir gottlos und gotteslästerlich.
Sie, meine liebe Jane, wollen von Gott wissen, warum er uns nicht so nebeneinander belässt, wie wir jetzt sitzen, und Sie bedenken nicht, dass Sie die Zeit mit der Ewigkeit verwechseln. Wir sind armselige Atome, mitgerissen von den Umstürzen einer Nation, zermalmt zwischen einer endenden und einer beginnenden Welt, mitgerissen von einem Königtum, das sich zugrunde richtet, und einem Reich, das sich erhebt. Fragen Sie Gott, warum Ludwig XIV. mit seinen Kriegen Frankreich die Männer geraubt hat, warum er das Staatsvermögen mit seinen prunkvollen Launen aus Marmor und Bronze ruiniert hat. Fragen Sie ihn, warum er eine katastrophale Politik betrieben hat, um am Ende einen Ausspruch zu tun, der, als er ihn tat, schon nicht mehr zutraf: ›Es gibt keine Pyrenäen mehr.‹ Fragen Sie ihn, warum er unter dem Einfluss der Launen einer Frau und unter der Knute eines Priesters das Edikt von Nantes widerrufen und Holland und Deutschland reich gemacht hat, indem er Frankreich ruinierte. Fragen Sie ihn, warum Ludwig XV. das verhängnisvolle Werk seines Großvaters fortgesetzt hat und eine Herzogin Châteauroux, eine Marquise d’Étioles, eine Gräfin du Barry geschaffen hat. Fragen Sie ihn, warum er gegen jede geschichtliche Vernunft dem Rat eines bestochenen Ministers folgte und es einer österreichischen Prinzessin ermöglicht hat, den französischen Thron zu besteigen, als hätte er vergessen, dass eine Allianz mit Österreich dem Lilienbanner noch nie Glück gebracht hat. Fragen Sie ihn, warum er Ludwig XVI. statt mit königlichen Eigenschaften mit der biederen Gesinnung eines braven Bürgers bedacht hat, aber ohne die Achtung vor dem eigenen Wort, ohne die Festigkeit des Familienvaters; fragen Sie ihn, warum er zugelassen hat, dass ein König einen Eid schwört, den er nicht zu halten gedenkt, warum er zugelassen hat, dass dieser König sich im Ausland Unterstützung gegen seine Untertanen suchte, und warum er einen erhabenen Kopf auf das Schafott gebracht hat, das für gewöhnliche Verbrecher bestimmt ist.
Denn dort, meine arme Jane, finden Sie den Beginn unserer Geschichte. Dort erfahren Sie, warum ich nicht bei Ihrer Familie bleiben konnte, in der ich doch einen Vater und zwei Schwestern gefunden hatte. Dort erfahren Sie, warum mein Vater auf dem Schafott starb, das noch vom Blut des Königs gerötet war, warum mein ältester Bruder füsiliert wurde, warum mein zweitältester Bruder guillotiniert wurde, warum ich, als Nächster an der Reihe, ein gegebenes Versprechen zu halten, ohne Begeisterung und ohne Überzeugung einem Weg gefolgt bin, der mich in ebenjenem Augenblick, als ich des Glücks teilhaftig zu werden wähnte, all meinen Hoffnungen entriss und für drei Jahre in das Temple-Gefängnis verbannte, um mich danach der geheuchelten Milde eines Mannes auszuliefern, der mein Leben dem Unglück überantwortete, indem er mich begnadigte. Wenn Gott Ihnen antwortete und wenn er die Frage beantwortete, warum er Ihnen nicht erlaubt, so zu leben, wie es Ihnen genügen würde, dann könnte er sagen: ›Bedauernswertes Kind, mit den unendlich geringfügigen Ereignissen Ihrer beider Leben, die Sie zufällig zusammengebracht haben und ebenso zufällig trennen, habe ich nichts zu schaffen.‹«
»Aber glauben Sie denn nicht an Gott, René?«, rief Jane entsetzt.
»Gewiss doch, Jane, aber ich glaube an einen Gott, der die Welten erschafft, der ihnen ihren Weg im Äther weist und aus ebendiesem Grund keine Zeit hat, sich mit Unglück oder Wohlergehen zweier armseliger Atome zu befassen, die auf der Oberfläche unseres Globus dahinkriechen. Jane, meine arme Freundin, ich habe drei Jahre damit zugebracht, all diese Rätsel zu ergründen; ich bin auf der einen Seite des Lebens in diese unergründlichen Geheimnisse eingetaucht und auf der anderen hinausgelangt, ohne erfahren zu haben, wie und warum wir leben, wie und warum wir sterben, und ich dachte mir, dass Gott ein Wort ist, das ich benutze, um zu bezeichnen, was ich suche; das wahre Wort wird mir einst der Tod sagen, wenn er nicht noch stummer ist als das Leben.«
»O René«, flüsterte Jane, die ihren Kopf auf die Schulter des jungen Mannes sinken ließ, »diese Philosophie ist zu schwer für meinen schwachen Verstand; ich glaube lieber, das ist einfacher und weniger hoffnungslos.«
78
Die Hochzeitsvorbereitungen
René hatte viel gelitten, und dies bedingte seinen Lebensüberdruss und seine Todesverachtung. Mit zweiundzwanzig Jahren, in einem Alter, in dem sich das Leben dem Menschen eröffnet wie ein Blumengarten, hatte dieses Leben sich ihm verschlossen: Er hatte sich mit einem Mal in einem Kerker wiedergefunden, wo vier Gefangene den Freitod gewählt und den die übrigen Insassen fast vollzählig gegen das Schafott eingetauscht hatten. In seiner Sicht der Dinge war Gott ungerecht, denn Gott bestrafte ihn dafür, dass er Beispiel und Gebot seiner Familie befolgt hatte, das in der Aufopferung für das Königtum bestand; er hatte viel lesen und viel nachdenken müssen, um zu begreifen, dass Hingabe und Aufopferung außerhalb der Gesetze bisweilen Verbrechen sein können und dass nur die Aufopferung, die dem Vaterland gilt, Gott ein Wohlgefallen ist; als Nächstes war er sich darüber klar geworden, dass Gott – worunter er den Schöpfer der Abertausende von Welten verstand, die sich im Weltraum bewegen – keineswegs ein individueller Gott ist, der die Geburt jedes einzelnen Menschen in seinen Büchern verzeichnet und zugleich das Geschick dieses Menschen entscheidet.
Und falls er sich täuschen sollte, falls entgegen jeder Wahrscheinlichkeit dieser Gott doch so wäre und folglich ungerecht und blind, wenn das Leben der Menschengeschöpfe keineswegs eine Abfolge materieller Zufälle wäre, den Launen des Schicksals ausgeliefert, dann würde er eben gegen diesen Gott, über den sich zu beklagen niemand das Recht hat, kämpfen und Gott zum Trotz ein ehrbarer Mensch sein.
Die Prüfung hatte lange gewährt, und er war aus ihr hervorgegangen, wie der Stahl aus der Härtung hervorgeht: unzerbrechlich und geläutert; sein Kinderglaube war Stück für Stück von ihm abgefallen wie die schlecht verbundenen Teile einer Rüstung während eines Kampfes, doch wie Achill benötigte er nun keine Rüstung mehr. Das widrige Geschick, diese unnachsichtige Mutter, hatte ihn in den Styx getaucht; er verabscheute das Böse aus Kenntnis des Bösen und benötigte, um Gutes zu tun, keine Hoffnung auf Vergeltung; da er nicht an Gottes unmittelbaren Schutz für den Menschen in Gefahren, denen der Mensch sich aussetzt, glaubte, hatte er die Verteidigung seines Lebens seiner Kraft anvertraut, seiner Geschicklichkeit und seiner Kaltblütigkeit. Er hatte die äußerlichen Eigenschaften, die man von der Natur erhält, von der moralischen und körperlichen Ertüchtigung gesondert, für die man selbst verantwortlich ist. Sobald dieses Denken in seinem Geist verankert war, hatte er aufgehört, Gott für die kleinen Geschehnisse seines Lebens zur Rechenschaft zu ziehen; er tat nichts Böses, weil er das Böse verabscheute, und er tat Gutes, weil dies zu den Pflichten gehört, die dem Menschen von der Gesellschaft auferlegt sind.
Von einem solchen Mann konnte Jane mit Fug und Recht sagen: »Ich verlasse mich nicht auf mich, sondern auf ihn.« Und um die wenige Zeit zu nutzen, die René noch in ihrer Gesellschaft weilen würde, verließ Jane ihn tagsüber so selten wie möglich; sie unternahmen lange gemeinsame Ausritte in die Umgebung der Siedlung, von denen sie erst zurückkamen, wenn der Gong sie zurückrief oder die Hitze sie dazu nötigte. Nachmittags ritten sie wieder aus und wagten sich bisweilen weiter weg, als ratsam war, doch wenn Renés Gewehr an seinem Sattelbogen hing und seine Pistolen im Halfter steckten, fürchtete Jane sich vor nichts.
Zudem wirkte sie seit einiger Zeit völlig furchtlos und schien die Gefahr sogar eher zu suchen als zu scheuen.
Jeden Abend saßen die zwei jungen Leute auf der Veranda des Salons; dort unterhielten sie sich stundenlang über philosophische Themen, die Jane einen Monat zuvor nicht verstanden und folglich auch nicht debattiert hätte. Vor allem sie kam immer wieder auf das große Geheimnis des Todes zu sprechen, das Hamlet ausgelotet, aber nicht erhellt hat; ihre Gedanken waren inzwischen von staunenswerter Klarheit, Sicherheit und Entschiedenheit; ihr Geist, der sich nie zuvor mit vergleichbaren Fragen beschäftigt hatte, erfasste sie mit einer Unmittelbarkeit, die Jane erlaubte, Renés Gedanken zumindest zu begreifen, wenn auch nicht unbedingt zu teilen.
Rein äußerlich wirkte Jane unverändert; sie war ein wenig bleicher, ein wenig trauriger, ihr Blick war ein wenig fiebriger, mehr nicht. Gegen Ende fast jeder ihrer nächtlichen Sitzungen auf dem Balkon ließ sie den Kopf auf Renés Schulter sinken und entschlummerte. Dann verharrte René regungslos und betrachtete im strahlenden Mondlicht voller Herzbeklemmung das junge und schöne Mädchen, das sich Trauer und Unglück zum Geschick erwählt hatte. Und wenn der Schlaf in seiner Indiskretion eine Träne zwischen ihren Lidern entschlüpfen ließ, die in wachem Zustand ihr Wille zurückgehalten hätte, dann seufzte er, wendete den Blick zum Himmel und fragte sich leise, ob das Leiden auf unserer Erde vielleicht der Preis für das Glück in einer anderen Welt war.
So vergingen die Tage und die Nächte. Nur Jane wurde jeden Tag trauriger und jeden Tag bleicher.
Eines Morgens kam Pater Luigi an, von den einen so ungeduldig erwartet und von den anderen so sehr gefürchtet.
Diesmal konnte Jane die Empfindungen, die seine Ankunft in ihr auslösten, nicht verbergen, und sie ging in ihr Zimmer, warf sich auf ihr Bett und brach in Tränen aus.
Nur René bemerkte ihre Abwesenheit; sein Verhältnis zu Jane war freundschaftlich geblieben, aber es war eine Freundschaft von höchster Zärtlichkeit, eine Freundschaft, die umsichtiger und besorgter war, als es eine gewöhnliche Liebe gewesen wäre. Hätte ein Fremder gesehen, wie Renés Blick nicht von Jane wich, wie René erbebte, wenn sie erbebte, erbleichte, wenn sie erbleichte, hätte er ihn für ihren Verlobten halten müssen, der seiner Hochzeit voller Ungeduld entgegensah.
Pater Luigi wusste, dass er erwartet wurde; einer der Männer, die sein Kommen angekündigt hatten, war nach Pegu zurückgeschickt worden, um ihm als Führer zu dienen, und er war allein mit diesem Mann aufgebrochen, ohne Furcht und im Vertrauen auf Gottes Schutz.
Es war Dienstag; man kam überein, die Hochzeit am kommenden Sonntag zu feiern, so dass die vier dazwischenliegenden Tage darauf verwendet werden konnten, das Brautpaar auf den Hochzeitssegen vorzubereiten.
Wie gesagt war nur René Janes Verschwinden aufgefallen; er ging zu ihrem Zimmer, öffnete die Tür mit der Vertrautheit eines Bruders und fand Jane schluchzend und verzweifelt auf ihrem Bett vor.
Sie wusste, dass der Tag, der Hélène das Glück brachte, ihr selbst das Unglück beschied, denn sobald Hélène und Sir James Asplay verheiratet waren, gab es keinen Grund mehr, René zurückzuhalten, und keinen Grund mehr für René, bei ihnen zu bleiben.
René nahm sie in die Arme, trug sie zu einem Fenster, öffnete es, strich ihr die Haare aus dem Gesicht und küsste sie sanft auf die Stirn.
»Nur Mut«, flüsterte er, »nur Mut, meine teure Jane!«
»Ach, Sie haben leicht von Mut reden«, erwiderte sie schluchzend. »Sie verlassen mich und werden eines Tages zu derjenigen zurückkehren, die Sie lieben; ich verlasse Sie und werde Sie nie wiedersehen, nie.«
René drückte sie an sein Herz, ohne zu antworten; was hätte er antworten sollen? Sie sagte die Wahrheit!
Ihm war, als müsse er ersticken; sein Herz zog sich zusammen, stille Tränen rannen ihm aus den Augen.
»Sie sind so gut«, sagte Jane, strich ihm mit der Hand über die Lider und führte die Hand an den Mund, als wolle sie die Tränen trinken, die sie netzten.
Jane war gewiss sehr unglücklich, doch vielleicht war René noch unglücklicher als sie; wenn er bedachte, dass er an ihrem Unglück schuld war und nichts tun konnte, um seine Freundin zu trösten, stand ihm nichts Besseres zu Gebote als banale Phrasen, vor denen das Herz zurückschreckt; es gibt Situationen, in denen unser Verstand machtlos ist; wir spüren, wie wenig er ausrichten kann und dass nur das Herz das Herz trösten kann.
Beide schwiegen, jeder in seine Gedanken versunken, und da beide an das Gleiche dachten, nämlich an eine unglückliche Liebe, verstanden sie einander schweigend besser, als sie es mit Worten gekonnt hätten.
Ohne in Jane verliebt zu sein, empfand René eine kummervolle Wollust unter dem Schwall ihrer Liebe. Da er sein Leben nicht mit Claire verbringen konnte, war Jane die einzige Frau, mit der er es gerne verbracht hätte. Unterdessen vergingen die Stunden und die Tage, und mit jedem Tag wurde Jane noch trauriger und liebte ihn noch mehr.
Die Hochzeitsvorbereitungen steigerten Janes Leid noch, denn nur Hélène wusste um ihren Kummer, während die anderen erwarteten, sie fröhlich zu sehen.
Bernard hatte einen Baum namens Tsitschu angezapft und einen Lack erhalten, der so fest und durchsichtig war wie der berühmte Japanlack.
Die Sklaven hatten auf dem Kaula-Tschu Muschelschalen voller Wachs gesammelt, das von einem Wurm namens Pelatschong ausgeschieden wird und aus dem man Kerzen macht, die so rein und durchsichtig wie die feinsten Wachskerzen sind.
Eine Dschungelfrucht, die in riesigen Trauben wächst, hatte man geerntet, denn aus ihr wird ein alkoholisches Getränk bereitet, das die Neger und die Inder der unteren Kasten über alles lieben.
Keine dieser Vorbereitungen wurde vor Jane verheimlicht, und jede dieser Vorbereitungen, die ihrer Schwester ein Glück verhießen, auf das sie selbst nie hoffen konnte, brach ihr das Herz, obwohl sie ihre Schwester zärtlich liebte.
Am Abend des Samstags war Jane Gemütsbewegungen ausgesetzt, die René nicht entgingen.
Er sah sie aufstehen und den Raum verlassen; er wartete einige Sekunden, dann erhob er sich und folgte ihr; sie konnte nur zu ihrem Zimmer gegangen sein. Er betrat die Treppe, und auf der vierten Stufe sah er Jane ohnmächtig liegen; er hob sie auf und trug sie in ihr Zimmer. Für gewöhnlich kam Jane zu Bewusstsein, wenn man ihr bei solchen Ohnmachten Riechsalz gab. Diesmal erwachte sie nicht. Jane lag auf Renés Knien, die Brust an seiner Brust; ihre Hand war so kalt wie Marmor; ihr Herz schlug nicht mehr; Renés Mund befand sich wenige Zentimeter von Janes Mund entfernt, und er erriet instinktiv, dass er nur seinen Atem in die Brust des jungen Mädchens einhauchen musste, um ihm Leben einzuflößen; er erriet, dass sie wie unter einem elektrischen Stromstoß zusammenzucken würde, wenn er seine Lippen auf die ihren drückte. Er wagte weder das eine noch das andere zu tun, denn vielleicht war er seiner selbst weniger sicher, als Jane glaubte; bei ihrem Anblick – so jung, so bleich, so todesnah – schmolz sein Herz, und Tränen fielen aus seinen Augen auf Janes Gesicht. Und wie eine verdorrende Blume sich unter Tautropfen wieder belebt, hob Jane den Kopf und öffnete die Augen.
»Aber wenn Sie nicht mehr da sein werden! Wenn Sie nicht mehr da sein werden!«, rief das Mädchen mit schmerzerfüllter Stimme. »Was wird dann aus mir? Oh, lieber will ich sterben!«
Auf diese Worte folgte ein heftiger Nervenzusammenbruch.
René wollte das Zimmer verlassen und Hilfe holen, doch Jane klammerte sich an ihn. »Lassen Sie mich nicht allein«, flehte sie, »ich will ja gerne sterben, aber ich will, dass Sie da sind.«
René setzte sich neben sie, nahm sie in die Arme und wiegte sie sanft, bis sie wieder bei Sinnen war.
Hélène und Sir James waren zu glücklich, um an andere zu denken, insbesondere wenn diese anderen nicht anwesend waren.
Bis um zwei Uhr morgens blieben René und Jane auf dem Balkon; jedermann im Haus war auf den Beinen, jedermann war mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Die drei Brüder hatten Bäume in voller Blüte gefällt, die sie zu einer Allee vom Haus bis zu der Kapelle aufgestellt hatten. Es sollte eine Überraschung für Hélène und Sir James sein, und deshalb errichteten sie ihr Kunstwerk zwischen zehn Uhr abends und drei Uhr morgens. Als Jane, auf Renés Arm gestützt, in ihr Zimmer zurückging, sah sie, wie der letzte Baum aufgestellt wurde.
»Die armen Blumen!«, sagte René. »Statt das ganze Frühjahr zu blühen, werden sie in drei Tagen tot sein!«
»Ich kenne jemanden, der länger als ein Frühjahr zu leben gehabt hätte«, flüsterte Jane, »und der vor ihnen tot sein wird.«
79
Die Hochzeit
Als René früh am nächsten Morgen Jane besuchen und sich nach ihrem Zustand erkundigen wollte, sah er Hélène den Flur entlanggehen und das Zimmer ihrer Schwester betreten.
Das gutherzige junge Mädchen hatte ein schlechtes Gewissen, weil es seine Schwester am Vortag etwas vernachlässigt hatte; nun wollte es sie bitten, ihm diese Nachlässigkeit zu verzeihen, die nicht etwa Kaltherzigkeit entsprang.
Der Tag war kaum angebrochen, und im ganzen Haus herrschte noch Stille, denn alle waren spät zu Bett gegangen.
Die zwei jungen Mädchen verbrachten mehr als eine halbe Stunde in enger schwesterlicher Umarmung.
René hörte, wie Hélène Janes Zimmer verließ. Daraufhin schlich er lautlos bis zu ihrer Zimmertür, und als er Jane drinnen schluchzen und leise seinen Namen wiederholen hörte, fragte er durch die Tür: »Kann ich Ihnen etwas bringen, darf ich eintreten?«
»O ja«, erwiderte Jane, »ja, ich muss Sie sehen, kommen Sie herein.«
Er trat ein.
Jane saß in ihrem Bett, in einen weiten Batistmorgenrock gekleidet, einen Beutel voller Rubine, Saphire und Smaragde halb auf ihren Schoß ausgeleert; sie wählte die größten und schönsten unter den Edelsteinen aus und steckte sie in einen kleinen parfümierten Beutel aus Saffianleder, der mit zwei Buchstaben bestickt war.
Diese zwei Buchstaben waren ein C und ein S.
»Kommen Sie«, sagte sie zu René, »setzten Sie sich zu mir.«
René trug einen Stuhl an das Kopfende ihres Betts.
»Meine Schwester ist eben gegangen«, sagte sie, »sie ist sehr glücklich; was sie bekümmert, ist nur, dass ich meine Tränen nicht verbergen konnte. Sie wollte von mir wissen, wann Sie abreisen werden; ich habe ihr gesagt, dass es morgen sein wird, denn morgen werden Sie Abschied von uns nehmen, nicht wahr?« Und bei diesen Worten versuchte sie ihre Stimme zu beherrschen.
»Sie baten mich, bis zum Tag nach der Hochzeit zu warten.«
»Und Sie waren so unendlich gütig zuzustimmen. Glauben Sie mir, ich bin Ihnen sehr dankbar, mein lieber René. Sie hat mich auch gefragt, ob sie Sie für einige Tage länger zurückzuhalten versuchen soll, aber ich habe ihr gesagt, dass Sie Ihre Entscheidung getroffen haben und dass die Sache endlich ein Ende haben muss.«
»Ein Ende haben muss, liebe Jane? Was verstehen Sie darunter?«
»Ich verstehe darunter, dass ich leide, dass ich Ihnen Leid bereite, dass unsere ganze Situation ausweglos ist und dass ein Aufschub Ihrer Abreise um drei oder fünf Tage nichts anderes bedeuten würde, als dass wir uns dann eben drei oder fünf Tage später trennen müssten. Einen Aufschub des Todes erbittet man nur, wenn man am Leben hängt.«
René seufzte tief und erwiderte nichts, denn er war der gleichen Ansicht wie Jane, doch ihn verwunderte ihr Mut, die Situation so unumwunden zu benennen.
Jane leerte den Rest der Juwelen auf ihr Bett und sortierte auch diese. Die Konzentration, mit der sie diese Arbeit verrichtete, die Sorgfalt, mit der sie die größten und schönsten Steine aussortierte, war so herzzerreißend, dass René nicht wagte, sie zu fragen, was sie mit diesen Edelsteinen zu tun gedenke.
Das Tageslicht drang nun in das Zimmer; im Haus wurden Schritte und Geräusche laut; Jane reichte René die Hand und bedeutete ihm, es sei an der Zeit, dass er in sein Zimmer zurückging.
René küsste die Hand, die Jane ihm reichte, und verließ das Zimmer. Seine Gemütsverfassung war kaum weniger kummervoll als die des jungen Mädchens.
In seinem Zimmer legte René seinen Morgenrock ab, zog sich an und ging hinunter.
Das Pferd, das Justin ohne Sattel und ohne Zaumzeug zu reiten pflegte, graste ungestört auf der Wiese vor dem Haus. René trat näher, hielt dem Pferd eine Handvoll Gras hin und pfiff leise.
Das Pferd fraß das Gras aus seiner Hand, und René nutzte diese Ablenkung, um ihm auf den Rücken zu springen.
Das Pferd tat einen gewaltigen Sprung; doch sobald sich Renés Schenkel um seine Seiten schlossen, war es in seiner Macht, und kein Aufbäumen und kein Bocken konnte seinen Reiter abschütteln.
Bis dahin hatte nur Justin dieses Pferd besteigen können, ohne abgeworfen zu werden, und deshalb hieß es »Unbezwingbarer«.
Ein Fenster wurde aufgerissen, und eine Stimme rief: »Um Himmels willen, René! Niemand wagt sich auf dieses Pferd, es wird Ihr Tod sein!«
Doch in kaum fünf Minuten war der Unbezwingbare bezwungen und fromm wie ein Lamm.
René wickelte sich eine Handvoll Haare der Mähne des Tiers um die Hand, die er als Zügel benutzte, und lenkte das Pferd unter Janes Fenster, wo er es zwang, trotz seiner Widerspenstigkeit in die Knie zu gehen; doch kaum ließ er die Mähne los, bäumte es sich auf und raste davon, René auf seinem Rücken; das Pferd folgte einem Pfad, der eine spitze Kehre machte, und an dieser Kehre traf es auf eine alte Negerin; René lenkte das Pferd mit Knie und Hand zur Seite, doch es gehorchte nicht schnell genug und berührte die alte Frau an der Schulter, so dass sie stürzte.
Sie schrie auf, doch René war bereits abgesprungen und half ihr auf die Beine.
Sie war nicht verletzt, und jemand anders als René hätte sich gar nicht um sie gekümmert, denn eine alte Negerin wird überall und besonders in Indien so gering geschätzt, dass jeder erstbeste Weiße sich berechtigt glaubt, sie niederzutrampeln; René in seiner Güte jedoch gab ihr einen der kleinen Goldbarren, die in Indien als mindere Währung verwendet werden; er war vielleicht fünfzehn bis zwanzig Francs wert. Die Negerin wollte ihm die Hände küssen.
Als er sah, dass sie unbeschwert gehen konnte und unverletzt war, pfiff er den Unbezwingbaren herbei, sprang ihm auf den Rücken und ritt zum Haus zurück.
Justin erwartete René, um ihn zu beglückwünschen. Er hatte mit angesehen, wie René das Pferd bestiegen und gezähmt hatte, das bisher niemand außer ihm hatte reiten können.
Sie plauderten noch, als die alte Frau, der René begegnet war, in den Hof kam und einige der Dienstboten etwas fragte. Nachdem sie geantwortet hatten, betrat sie das Haus und war nicht mehr zu sehen.
»Wer ist diese Frau?«, fragte René.
Justin zuckte die Schultern. »Das ist eine Hexe«, antwortete er. »Wer zum Teufel mag diese Giftmischerin herbestellt haben?« Dann sah er, dass René noch seine Morgenkleidung trug, indes Sir James in Galauniform die Treppe herunterkam. »Ich glaube, Sie werden sich verspäten, Monsieur René«, sagte Justin, »die Trauung ist für zehn Uhr vormittags angesetzt.«
René zog seine Uhr hervor, die Viertel vor neun anzeigte. »Ach, schon gut«, sagte er, »ich habe mehr als genug Zeit.«
Dennoch ging er ins Haus. Zu seinem großen Erstaunen sah er die Negerin aus Janes Zimmer treten, als er den Salon durchquerte. Was hatte sie dort zu suchen?
Er trat zu ihr und stellte ihr Fragen; sie bedeutete ihm jedoch mit Kopfbewegungen, dass sie ihn nicht verstehe, und ging weiter.
René wollte Jane aufsuchen und sie befragen, doch ihre Zimmertür war abgeschlossen, und als René sie bat, ihm zu öffnen, erwiderte Jane nur: »Unmöglich, ich kleide mich gerade an.«
René ging in sein Zimmer; in wenigen Minuten hatte er seine Morgenkleidung gegen seine elegante Korsarenuniform eingetauscht.
Er ging hinunter und fand im Speisezimmer den Priester vor.
Seit man wusste, dass der Priester kommen würde, war Adda damit beschäftigt gewesen, ein Messgewand für ihn anzufertigen, denn die Vorstellung, dass er in seinem schwarzen Gewand die Trauung vollzöge, war für sie zu traurig. Mittels einer Wasserpflanze, deren Saft in Indien dazu dient, Priestergewänder golden zu färben, war es ihr gelungen, durch Färben und Sticken ein Messgewand herzustellen, das selbst in Europa als Kunstwerk gegolten hätte.
Pater Luigi hatte sich nie zuvor so prunkvoll ausstaffiert gesehen, und er strahlte vor Freude.
Um zehn Uhr brannten die Kerzen auf dem Altar. Alle Mitglieder des Haushalts waren anwesend.
Jane war so entkräftet, dass der Priester vorschlug, sie solle sich auf jemanden stützen, um zur Kirche zu gelangen; sie stützte sich auf Renés Arm.
Es muss kaum eigens gesagt werden, dass es im Land des Betels kein Standesamt gab. Es wurde keine Ziviltrauung vorgenommen, sondern nur eine kirchliche Trauung.
Die Allee aus blühenden Bäumen, die von der Haustür bis zur Tür der Kapelle führte, setzte alle in Erstaunen, ausgenommen jene, die sie angelegt hatten; man hätte meinen können, sie wäre über Nacht herbeigezaubert worden.
Die Heiratsurkunde und der Ring waren aus Europa mitgebracht worden.
Nachdem der Priester dem jungen Paar die traditionellen Fragen gestellt hatte und beide sie beantwortet hatten, steckte er Hélène den Ring an den Finger; im selben Augenblick seufzte Jane auf und sank auf das Betpult vor ihr.
René reichte ihr verstohlen ein Fläschchen mit Riechsalz. Jane wusste, wie schmerzlich es für alle anderen sein musste, wenn sie ihren Kummer so unverhüllt zur Schau stellte, und sie nahm all ihre Selbstbeherrschung zusammen, so dass es aussah, als hätte sie nur niederknien wollen.
Allein Hélène und René wussten, wie es wirklich um sie stand.
Jane wollte am Hochzeitsschmaus teilnehmen, doch ihre Kräfte ließen sie im Stich; sie musste aufstehen und den Tisch verlassen.
René wechselte einen Blick mit Hélène; sie bedeutete ihm zu bleiben, doch nach fünf Minuten sagte sie laut: »René, sehen Sie doch bitte nach Jane; Sie sind gewissermaßen unser Hausarzt, und ohne die arme Jane, die seit einiger Zeit recht leidend ist, hätten Sie fast nichts mehr zu tun.«
René sprang von seinem Stuhl auf und eilte zu Janes Zimmer.
Er fand sie auf dem Boden liegend vor; weder Chaiselongue noch Bett hatte sie erreicht.
Er ergriff sie unter den Achseln, schleppte sie zum Fenster und bettete sie in einen Sessel.
Er fühlte ihren Puls; ihr Herz klopfte nicht, sondern jagte; von tiefster Schwäche ging ihr Zustand in heftigste Erregung über, und sobald die fieberhafte Erregung nachließ, verfiel sie wieder in eine Betäubung, die noch erschreckender war als die Raserei.
Es war nicht zu übersehen, dass diese schöne menschliche Maschinerie einen schwerwiegenden Fehler aufwies und nicht mehr den Gesetzen des Lebens entsprechend funktionierte, sondern den willkürlichen Launen dieses Fehlers gehorchte.
»O Jane«, sagte René verzweifelt, »wollen Sie sich denn das Leben nehmen?«
»Ach«, erwiderte Jane, »wenn ich genug Zeit hätte, würde ich mir nicht das Leben nehmen, sondern von ganz allein sterben.«
80
Eurydike
Auf diese Antwort ließ sich nichts erwidern, denn die Verzweiflung, die in diesem jungen Herzen herrschte, war so übermächtig, dass man ihm nur voller Mitgefühl zur Seite stehen konnte. Janes Kummer und Schmerz hatten ein solches Ausmaß erreicht, dass René es für geraten hielt, sie den ganzen Tag nicht mehr aus den Augen zu lassen.
Die Stunde des Abendessens kam; Hélène löschte alle Spuren der Freude von ihrer Miene und ging zu Jane, um sie zu fragen, ob sie herunterkommen wolle; sie fand sie in einem Zustand so großer Erschöpfung vor, dass sie erkannte, dass ihrer Schwester in ihrem Gemütszustand mit Abwechslung nicht zu helfen war. Deshalb bat Hélène René, bei Jane zu bleiben, denn nichts als die Ursache so überwältigenden Herzeleids konnte dieses wenigstens besänftigen, wenn schon nicht kurieren.
René seinerseits war zutiefst bedrückt; ihm blieben keine Worte, die er zu Jane hätte sagen können; er seufzte, sah sie an und hielt ihre Hände, denn sie hatten untereinander zu einer Sprache gefunden, die mehr sagte als alle Worte, die sie hätten tauschen können. Hätte René geglaubt, einige Tage Aufschub seiner Abreise würden Jane etwas nützen, dann hätte er sich dieser Notwendigkeit ohne zu zögern gebeugt; was ihn entfernte, war ein moralisches Gebot, das für manche Geister schwerer wiegt als alles andere. Und Jane hatte sich zu der gleichen Ansicht durchgerungen: Seit einer Woche wartete sie nur noch auf den Montag; nach diesem Montag interessierte sie nichts mehr; sie war wie eine Uhr, die für die Dauer von acht Tagen aufgezogen worden war und deren Uhrwerk nach Ablauf dieser Zeit den Dienst versagen würde.
Das Gerücht von Janes Erkrankung hatte sich im Haus verbreitet; da alle sie liebten, waren alle tiefbekümmert; gleichzeitig war jeder der Meinung, dass ihr Leiden sich einem bösen Zauber verdanken müsse, den die Schlangenbeschwörerin über sie gesprochen hatte.
Als Schlangenbeschwörerin wurde die Negerin bezeichnet, die René umgeworfen hatte und die am selben Tag aus Janes Zimmer gekommen war. René hörte all diese Gerüchte, die in den unteren Rängen der Bediensteten die Runde machten, doch er erinnerte sich auch an die Worte, die Justin entfahren waren, als sie die Negerin erblickt hatten: »Wird uns denn nie ein vernünftiger Gewehrschuss von dieser Giftmischerin befreien?«
Als René zum Abendessen hinunterging, denn Jane hatte ihn darum gebeten, damit wenigstens er den anderen Gesellschaft leistete, fragte er Justin über die alte Negerin aus, obwohl er besser als alle anderen wusste, was die Ursache für Janes Leiden war.
Die Alte wurde »Schlangenbeschwörerin« genannt, weil sie die Fähigkeit besaß, die giftigsten Reptilien einzuschläfern und zu berühren, doch das war noch nicht alles: Es hieß auch, sie sei mit allen Eigenschaften der Giftkräuter vertraut, jener, die Menschen auf der Stelle töten oder Tiere langsam dahinsiechen lassen. Was konnte Jane mit dieser Frau zu schaffen haben?
Als René zu der Kranken zurückging, wollte er sie dies fragen; doch als er sich wieder in Gegenwart dieses Engels der Reinheit befand, kamen ihm die Worte nicht über die Lippen, während gleichzeitig ein unbenennbares und unabweisbares Gefühl des Schreckens sein Herz bedrängte. Ängste, die man für Vorausahnungen zu halten pflegt, bestürmten seinen Geist, und sein Herz zog sich so schmerzlich zusammen, dass er einen leisen Schrei ausstieß, der Jane erschreckte.
Er setzte sich zu ihr; wie ein Vater sein Kind tröstet, das er zu verlieren fürchtet, drückte er sie ans Herz, küsste sie auf die Stirn und küsste ihr die Hände; diese Liebesbezeigungen waren so zärtlich und zugleich so frei von jeder Sinnlichkeit, dass Jane sie nicht missverstand; doch da sie solche Zärtlichkeiten nicht gewohnt war, kostete sie ihren Zauber mit allen Sinnen und verspürte neues Leben in ihren Adern, das ihren Puls schlagen ließ und ihre Wangen rötete, und sie dankte René für seine fürsorgliche Freundschaft.
Die Nacht kam. Die beiden jungen Leute begaben sich auf die Veranda, wo sie ihren gewohnten Platz einnahmen. Als hätte sich alles verschworen, der armen Jane Frieden zu schenken, hatte es nie eine schönere Nacht gegeben, hatte nie ein leuchtenderer Himmel die Dunkelheit erhellt und die Nacht zu nichts weiter als dem Fehlen des Tageslichts verringert. Der Mond war nicht zu sehen, und die Sterne waren bewölkt, doch überall erstrahlte ein Licht, dessen Ursprung nicht zu erkennen war. Der Windhauch trug Wolken eines herben, durchdringenden und erregenden Parfums herbei, das die Nerven kitzelte, die Adern belebte, die Lunge weitete und den Organismus mit dem eigentümlichen Lebenselixier belebte, dessen Macht nur verstehen kann, wer die glühende Atmosphäre geatmet hat, der man nirgends als in Asien und besonders in Indien begegnet.
René dachte, er hätte in seinen Gesprächen mit Jane alle Fragen und Antworten über die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Lebens und über die Unsterblichkeit der Seele erschöpft.
René war Pantheist; er glaubte an das Weiterbestehen der Materie, weil er wusste, dass ein Sandkorn unter Millionen Sandkörnern zerquetscht wird, aber nicht verschwindet; doch an die Seele glaubte René nicht, weil er sie noch nie in irgendeiner Gestalt zu sehen bekommen hatte und weil er an nichts glaubte, was man nicht sehen oder berühren kann.
Bichat war vor Kurzem gestorben, nachdem er diese Frage behandelt und gelöst hatte; sein schönes Buch über Leben und Tod war während Renés Haft erschienen, und René hatte diese Widerlegung der Gedanken Galls und Spurzheims mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen. Je länger er seine Theorie des Materialismus entwickelte, desto heftiger flossen die stillen Tränen aus Janes Augen und bildeten auf ihren Wangen zwei perlmuttfarbene Bäche.
»René, Sie glauben also«, sagte sie, »dass wir uns ein für alle Mal trennen werden und einander niemals wiedersehen werden?«
»Das will ich nicht behaupten, Jane«, erwiderte René. »Der Zufall hat uns ein erstes Mal zusammengeführt; Sie können nach Paris kommen, ich kann nach Indien zurückkehren, und der Zufall kann uns wieder zusammenbringen.«
»Ich werde nie nach Frankreich reisen«, sagte Jane traurig, »und Sie werden nie nach Indien zurückkommen; unsere Herzen wurden in diesem Leben durch die Kraft Ihrer Liebe zu einer anderen Frau getrennt, und unsere Körper werden für alle Ewigkeit durch die undurchdringliche Erde getrennt bleiben. Sie sagten vorhin, Sie glaubten an nichts, was man nicht sehen oder berühren kann, aber an Ihre Liebe zu Claire de Sourdis muss ich glauben, obwohl sie unsichtbar und unberührbar ist.«
»Gewiss, aber der Gegenstand dieser Liebe ist berührbar und sichtbar. Ich glaube auch an Ihre Liebe zu mir, Jane, obwohl ich sie nicht sehen kann, denn sie umhüllt mich wie die Wolken, die in der Äneis die Götter verbergen.«
»Sie haben recht, René«, sagte Jane, wischte sich die Augen mit ihrem Taschentuch und hielt es auf die Augen gedrückt. »René«, fuhr sie fort und erhob sich, »ich bin grausam und selbstsüchtig; ich quäle Sie mit meinem Unglück und mache Sie unglücklich. Bis morgen, René; morgen werden wir voneinander Abschied nehmen; schwächen Sie meine Seele nicht vor diesem entscheidenden Augenblick, denn ich werde all meine Kraft benötigen, so wie Sie vielleicht die Ihre.«
»Gehen Sie in Ihr Zimmer zurück, Jane?«
»Ja, ich muss mich im Gebet sammeln. Das Gebet ist keine Heilung, ich weiß, aber es betäubt wie das Opium. Sie müssen mir jedoch eines versprechen.«
»Und das wäre, liebe Jane?«
»Dass Sie nicht abreisen werden, ohne vorher Abschied von mir zu nehmen; ich brauche einen langen und tröstlichen Abschied; ich muss wie gewohnt an Ihrer Schulter einschlafen können, nur diesmal in der Gewissheit, nie wieder zu erwachen.«
René verließ Jane fast gegen seinen Willen; er verspürte eine Vorahnung, die er sich nicht erklären konnte; er brachte Jane bis zu ihrer Zimmertür, hielt sie lange an seine Brust gedrückt und ging zu seinem Zimmer, wobei er mehrere Male innehielt, weil ihm war, als hätte Jane nach ihm gerufen. Als er sein Zimmer erreicht hatte, konnte er nicht einschlafen; ihm war zumute, als erwarte ihn ein großes Unglück.
Er trat an das Fenster seines Zimmers in der Hoffnung, dort frischere Nachtluft zu atmen. Tatsächlich schien vom Boden die erste morgendliche Kühle aufzusteigen, während das weißliche Leuchten, das die Nacht erhellte, schwand und einem grauen Nebel wich. Im selben Augenblick war ihm, als höre er, wie die Tür von Janes Zimmer geöffnet wurde, und schon wollte er seine eigene Tür öffnen und hinübereilen, um zu sehen, ob Jane wohlauf sei, als er sich eines Besseren besann und in seinem Zimmer blieb, um nicht den Eindruck zu erwecken, er spioniere hinter ihr her. Da er keine weiteren Geräusche vernahm, trat er wieder an sein Fenster; unterdessen war es draußen noch nebliger geworden, doch das hinderte ihn nicht daran, Jane zu erkennen, die in ihrem Morgenmantel das Haus verließ und sich zögerlichen Schritts der Wiese näherte, als gehe sie barfuß. Sein erster Gedanke war, dass Jane in einem Anfall von Somnambulismus handelte, ohne zu wissen, was sie tat, doch diesen Gedanken verwarf er bald. Jane ging keineswegs mit den steifen, feierlichen und gespenstischen Schritten einer Schlafwandlerin, sondern setzte ängstlich einen Fuß vor den anderen und zuckte zusammen, wenn sie auf einen spitzen Stein trat; außerdem hob sie einmal den Kopf und blickte schnell zu Renés Fenster hinauf, doch er konnte sich rechtzeitig verbergen, so dass sie ihn nicht sah.
Indem sie allein und so leicht bekleidet das Haus verließ, tat Jane nicht nur etwas Ungewohntes, sondern auch etwas Unbedachtes: Der Geruch der vielen Braten für das Hochzeitsbankett hatte möglicherweise wilde Tiere angelockt, die sich in einem Busch oder im hohen Gras versteckten und das junge Mädchen jederzeit anfallen konnten.
René streckte die Hand aus, tastete im Dunkeln nach seinem geladenen Gewehr und trat wieder zum Fenster.
Nun hatte er den Eindruck, als nähere sich Jane eine schwarze Masse, deren Form er nicht erkennen konnte, weil sie sich in der Dunkelheit verlor. Jane schien sich nicht vor ihr zu fürchten, sondern ihr im Gegenteil zu bedeuten, zu ihr zu treten. War es ein Mann? Eine Frau? René hätte es nicht zu sagen vermocht, doch dann hörte er Jane einen klagenden, durchdringenden Schrei ausstoßen; sie ließ sich auf ein Knie sinken und wälzte sich dann am Boden wie unter heftigen Schmerzen. Als René sah, dass der schwarze Schatten in den nahen Waldrand zu verschwinden versuchte, zweifelte er nicht länger daran, dass Jane ein Leid angetan worden war, und er legte an und feuerte.
Ein zweiter Schrei erklang, nicht weniger klagend und durchdringend als der erste, und der Meuchelmörder, ob Mann oder Frau, wälzte sich am Boden und blieb nach einigen heftigen Zuckungen tot liegen.
René warf sein Gewehr in das Zimmer, eilte die Treppe hinunter, sah, dass Jane alle Türen hatte offen stehen lassen, lief zu dem jungen Mädchen, das er auf dem Rasen liegen sah, hob es hoch und trug es ins Haus.
Der Schuss hatte alle geweckt; sie hatten ihn für das Signal eines nächtlichen Überfalls gehalten und eilten nun herbei, die erstbeste Waffe in der Hand. Justin war als Erster zur Tür gelangt, gefolgt von einigen Sklaven, die Fackeln trugen.
René hielt Jane in den Armen und trug sie ins Haus, ohne die Schlange zu beachten, die Jane gebissen hatte und noch von ihrem Fuß hing.
»Die Schachbrettschlange!«, rief Justin, der das Reptil mit beiden Händen ergriff und seinen Kopf an der Wand zerschmetterte. »Die Wunde muss sofort ausgesaugt werden!«
»Ich werde mich um sie kümmern«, sagte René, der Jane in ihr Zimmer trug, »suchen Sie nach einem Gegenmittel; die Neger kennen oft Geheimmittel gegen das Schlangengift.«
»Er hat recht«, sagte Justin. »Reitet los, sucht überall nach der alten Hexe und bringt sie her, tot oder lebendig!«
Unterdessen hatte René Jane in ihr Zimmer gebracht und auf ihr Bett gelegt; an ihrem Fuß, der so weiß und kalt war wie Marmor, sah er zwei Wunden, klein wie Nadelstiche, aus denen winzige Blutstropfen gedrungen waren, und er begann wie ein Schlangenbeschwörer des Altertums das Blut aus der Wunde zu saugen.
Unterdessen machte sich Ratlosigkeit um Janes Bett herum breit; die Leidende lag mit geschlossenen Augen da, die Hände über der Brust gekreuzt, als wäre sie bereits tot; doch René spürte am Zittern und Zucken des Fußes unter seinen Lippen, dass Jane entsetzliche Schmerzen litt. Nach und nach hatten sich alle Bewohner des Hauses in Janes Zimmer eingefunden, und als René erschöpft den Blick hob, sah er in der ersten Reihe Hélène stehen, blasser als die Sterbende, auf Sir James gestützt, der ebenso bleich war wie sie.
»Sir James«, sagte René, »seien Sie so gut und holen Sie unverzüglich aus meiner kleinen Reiseapotheke ein Fläschchen mit Riechsalz und eine Lanzette.«
Sir James eilte in Renés Zimmer und brachte das Erbetene.
Um die Wunde herum hatte sich bereits ein Kreis von der Größe eines Fünf-Francs-Stücks gebildet.
René verlangte ein Glas Wasser, in das er ein paar Tropfen Riechsalz gab; dann ergriff er die Lanzette und machte mit chirurgischer Gewandtheit einen kreuzförmigen Einschnitt, aus dem schwarzes, fauliges Blut drang; dann saugte er wieder an der Wunde und drückte mit dem Daumen darauf, bis das Blut rot und gesund herausquoll, woraufhin er die Wunde mit dem ätzenden Mittel behandelte.
»Dem Herrn sei gedankt!«, rief Hélène. »Sie ist noch am Leben!«
»Sie wird erst morgen sterben«, flüsterte Justin, »zu der Stunde, zu der sie heute gebissen wurde.«
René nutzte das Lebenszeichen, das Jane gegeben hatte, um sie zu nötigen, das Glas Wasser mit Riechsalz zu leeren, das er vorbereitet hatte.
In diesem Augenblick kamen die Männer, die ausgeschickt worden waren, um nach der schwarzen Hexe zu suchen, und meldeten, dass man ihren Leichnam nahe der Stelle entdeckt hatte, an der Jane aufgefunden worden war.
»Oh!«, rief René. »Als ich Janes Schrei vernahm und sie zu Boden stürzen sah, dachte ich, sie wäre einem Meuchelmord zum Opfer gefallen; ich hatte mein Gewehr zur Hand, also habe ich abgedrückt und die Frau getötet.«
»Sie Bedauernswerter«, sagte Justin leise zu ihm, »Sie haben den einzigen Menschen getötet, der sie zu retten vermocht hätte.«
»Armes geliebtes Kind!«, rief René, der Jane an die Brust drückte und in Tränen ausbrach.
»Beweine mein Schicksal nicht«, sagte Jane leise, so leise, dass niemand anders sie verstehen konnte; »hast du nicht gehört, was Justin sagte: dass mir noch vierundzwanzig Stunden Lebenszeit vergönnt sind?«
»Was soll das heißen?«, fragte René.
»Das soll heißen, mein geliebtes Herz«, flüsterte Jane, »dass mir vierundzwanzig Stunden Zeit bleiben, dir ohne Umschweife zu erklären, dass ich dich liebe! Der Tod soll mir willkommen sein; ich zählte auf ihn, aber ich ahnte nicht, wie wohlwollend er sein würde.«
In diesem Augenblick betrat der Priester das Zimmer. Niemand hatte ihn rufen lassen, und er hatte eben erst erfahren, was geschehen war.
Jane sah ihn aus dem Augenwinkel. »Lasst mich mit dem heiligen Mann allein«, sagte sie, und leise sagte sie zu René: »Komm zurück, wenn er gegangen ist; ich will auf keine Minute meiner vierundzwanzig Stunden verzichten.«
Alle verließen das Zimmer.
Draußen gab man sich dem Kummer hin, den man zuvor verborgen hatte.
Hélène, die halb ohnmächtig in den Armen ihres Mannes lag, wurde in ihr Zimmer eher getragen als geführt, und alle waren von dem Geschehen so überrascht, dass die Verblüffung den Tränen Einhalt gebot.
René ging auf die Veranda des Salons, auf der noch die zwei Sessel nebeneinander standen, wie sie verlassen worden waren; er setzte sich auf seinen Sessel, legte seinen Kopf auf Janes Sessel und überließ sich einem Schmerz, der vielleicht tiefer war als alles, was er zuvor empfunden hatte.
Denn indem er sich den zurückgelegten Weg vergegenwärtigte, erkannte er, wie Jane in aller Ruhe ihren Tod für die Stunde vorbereitet hatte, zu der er sie verlassen würde; die Frau, die sie hatte kommen lassen und die ihre schmutzige Liebe zum Geld mit ihrem Leben bezahlt hatte, nachdem sie geholfen hatte, Janes Tod vorzubereiten – war sie nicht die nubische Sklavin, der Kleopatra den Auftrag erteilt hatte, ihr in einem Korb mit Feigen die Viper zu bringen, die sie töten sollte?
Dieser Tod war für die festgesetzte Stunde geplant worden.
Da Jane ihm am Vorabend das Versprechen abgenommen hatte, nicht abzureisen, ohne es ihr vorher zu sagen, damit sie Abschied von ihm nehmen konnte, bedeutete dies, dass der Abschied kein gewöhnlicher Abschied war, sondern ein Abschied für die Ewigkeit; Jane hatte alle Vorkehrungen getroffen: Sie wusste, dass sämtliche Bewohner des Hauses, Menschen wie Tiere, die Hexe verabscheuten, und sie zweifelte nicht daran, dass ein nächtlicher Besuch der Hexe im Hof bellende Hunde und aufgeregte Domestiken zur Folge haben musste; deshalb hatte sie beschlossen, sich selbst auf den Weg zu machen und die Hexe mit nackten Beinen und Füßen aufzusuchen, damit die Schlange sie beißen und das Gift seine Wirkung ungehindert entfalten konnte.
Und statt sich zu beklagen, wie wenig Zeit Gott ihr ließ, um mit René zusammenzusein, frohlockte sie, dass sie vierundzwanzig Stunden lang die Größe ihrer Liebe zu ihm ausdrücken konnte; nach diesen vierundzwanzig Stunden würde der Tod die allzu feurigen Worte, die ihr entschlüpft sein mochten, läutern. Ihre Beichte dauerte nicht lange; indem sie sagte: »Ich liebe René«, hatte sie ihre einzige Sünde bekannt. Der Priester verließ ihr Zimmer, als der Tag zu dämmern begann; er hatte keine halbe Stunde an ihrem Sterbebett verbracht.
Als der Priester aus Janes Zimmer kam, ging er zu René und sagte: »Gehen Sie zu dem heiligen Kind, das Sie liebt; es wird Ihnen nicht schwerfallen, es mit dem Tode auszusöhnen.«
René ging in Janes Zimmer zurück und sah, dass sie ihn mit ausgestreckten Armen erwartete.
»Setzen Sie sich zu mir, mein Geliebter«, sagte sie, »und lassen Sie sich zuerst sagen, dass Sie mich bis zum Augenblick meines Todes nicht mehr verlassen werden.«
»Zeigen Sie mir zuerst Ihren Fuß«, sagte René, »damit ich weiß, wie es um Sie steht.«
»Wozu? Ist mein Todesurteil etwa nicht gefällt? Ich habe nur noch dreiundzwanzig Stunden zu leben; ich verlange weder Aufschub noch Begnadigung; ich bin glücklich.«
»Was hat der Priester Ihnen denn gesagt?«
»Eine Menge guter Dinge, ohne mich zu überzeugen. Er wollte mir Hoffnung machen; er sagte, uns umgäben unsichtbare Geister, die in der Luft schweben und die wir nicht erkennen können, weil sie so durchsichtig sind wie die Atmosphäre, in der sie sich bewegen. Diese Geister sind die Seelen derer, die uns geliebt haben, sie umgeben uns, sie berühren uns, sie flüstern uns unbegreifliche Worte zu, wenn wir wach sind, und sie sprechen zu uns, wenn wir schlafen; sie wissen, was wir noch nicht wissen können, denn sie können in die Zukunft sehen: daher die befremdlichen Enthüllungen und Vorausahnungen, deren Kenntnis diejenigen, die uns zu sehr lieben, vor uns nicht verbergen können. Dann sagte er, gewiss glaubten wir nur, was wir sehen können, wenngleich uns eine Vielzahl von Beweisen die Schwäche und das Unvermögen unserer Sinne vor Augen geführt hätten. Vor der Erfindung des Mikroskops – das heißt annähernd sechstausend Jahre lang – blieb unseren Augen die Hälfte der Wesen verborgen, die dieses Instrument sichtbar gemacht hat; der Erste, der seinen Blick auf die Welt des unendlich Kleinen richtete und eine Ahnung davon hatte, dass diese Welt endlos ist, wurde darüber wahnsinnig. Nun denn! Eines Tages, so hat der Priester mir erklärt, wird man vielleicht ein Instrument erfinden, mit dessen Hilfe man das unendlich Durchsichtige sehen kann, wie einst das unendlich Kleine sichtbar gemacht wurde. Und dann werden wir uns auf anderem Weg als über die Sprache mit diesen Luftgeistern verständigen, deren Vorhandensein nur die Dichtung erahnen konnte. Ja, mein lieber René, diese Vorstellung, dass meine Seele Sie weiter begleiten wird, dass ich Sie auch als Tote begleiten kann, dorthin gehen kann, wohin Sie gehen, mich mit der Luft vermischen, die Sie atmen, in dem Wind sein, der Ihre Haare bewegt – diese Hoffnung, so absonderlich sie erscheinen mag, hat mir unendlich große Freude bereitet. Hat Shakespeare nicht gesagt: ›Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt‹?«
Janes Stimme war bei den letzten Worten allmählich erstorben, und sie ließ ihren Kopf auf Renés Schulter sinken.
»Leiden Sie?«, fragte René.
»Nein, ich glaube nicht. Ich werde nur immer schwächer; der Fuß, in den ich gebissen wurde, ist wie aus Eis, mit diesem Fuß werde ich zuerst ins Grab steigen, die Kälte wird allmählich in mir heraufsteigen, und wenn sie mein Herz erreicht, werde ich mein Bett gegen das ewige Ruhelager eintauschen.«
Als René spürte, dass sie einschlief, hörte er auf, mit ihr zu sprechen, damit sie im Schlaf Kraft für den letzten Kampf sammeln konnte. Ihr Schlaf war unruhig, von Aufbäumen und unverständlichem Gestammel unterbrochen.
Hélène kam herbei; die Tür des Zimmers stand offen; sie streckte den Kopf zur Tür herein und fragte wortlos, wie es ihrer Schwester gehe.
René zeigte ihr die Schlafende, die an seiner Schulter ruhte; sie trat ein und küsste Jane auf die Stirn.
»Großer Gott, Hélène«, sagte René, »Sie kennen die Leute des Hauses, kann man denn nichts tun, um der Armen wenigstens die Schmerzen zu lindern, wenn man ihr sonst nicht helfen kann?«
»Ach! Denken Sie, ich hätte nicht jedermann gefragt, selbst den Unwissendsten? Alle haben mir gesagt, der Tod sei nicht schmerzhaft, aber unausweichlich. Sagen Sie ihr, lieber René, dass ich sie mit Ihnen nicht aus Gleichgültigkeit allein lasse, sondern weil ich ihre letzten Freuden nicht schmälern will.«
Dann beugte sie sich abermals über ihre Schwester und küsste sie nochmals auf die Stirn, bevor sie auf Zehenspitzen den Raum verließ.
Doch während Hélène sich entfernte, schlug Jane langsam die Augen auf; für einen Augenblick sah sie starr geradeaus, dann seufzte sie und sagte: »Oh, lieber René, was für einen schönen Traum habe ich eben geträumt! Ich sah, wie ich Sie jetzt vor mir sehe, einen schönen Engel aus dem Himmel, strahlend vor Licht, der an mein Bett kam und mich auf die Stirn küsste und zu mir sagte: ›Schwester, komm mit uns, wir warten auf dich!‹ Dann küsste er mich noch einmal und flog davon.«
Ihr die Wahrheit zu sagen, wäre grausam gewesen, und René sagte nichts.
»Aber nun, mein geliebter René«, fuhr Jane fort, »will ich Sie etwas fragen. Als mein Entschluss bereits gefasst war, Ihre Abreise nicht zu überleben, sahen Sie mich doch Edelsteine aussuchen und in einen Beutel stecken, nicht wahr?«
»Ja, Jane, und ich wollte Sie fragen, was Sie da taten, aber ich dachte mir, diese Frage wäre indiskret.«
»Ihre Zurückhaltung habe ich bemerkt«, sagte Jane, »aber da es noch nicht an der Zeit war, Ihnen zu enthüllen, was ich vorhatte, wollte ich nichts sagen.«
»Der Beutel«, sagte René, »trug zwei handgestickte Initialen, ein C und ein S.«
»Diese Buchstaben machten Sie nachdenklich, nicht wahr?«
»Es sind die Initialen von Claire de Sourdis.«
»In der Tat«, sagte Jane, »ist dieser kleine Beutel für meine Cousine Claire de Sourdis bestimmt. Wenn es eines Tages so weit sein wird, dass Napoleon Ihnen verzeiht, was Sie getan haben, und wenn es Ihnen gelingen wird, eine Position zu erlangen, die Ihrer würdig ist, wird Mademoiselle de Sourdis Ihre Frau werden; und dann werden Sie zu ihr sagen: ›In den Ländern des heißen Atems und der glühenden Leidenschaften begegnete ich zwei jungen Mädchen, meinen Cousinen; zuerst rettete ich ihnen die Ehre und dann das Leben; aus Ihrer Nähe verbannt, obwohl ich ohne Unterlass an Sie dachte, weihte ich ihnen mein Leben. Die eine der beiden, die Jüngere, war so unglücklich zu sterben; ich liebte sie zärtlich, aber mein Herz gehörte nicht ihr, sondern Ihnen. Sie starb an ihrer Liebe, denn es war eine Liebe von der Art, wie sie tötet, wenn sie nicht zum Leben befähigt; doch vor ihrem Tod nahm sie diesen Beutel, der zu ihrem Privatvermögen gehörte und der nun Edelsteine für drei Garnituren enthält: Rubine, Saphire und Smaragde; sie hat die Steine aus der zehnfachen Menge ausgewählt; sie hat Ihre Initialen eigenhändig auf den Beutel gestickt und hat ihn mir überreicht, als sie im Sterben lag, denn es ist ihr Hochzeitsgeschenk, ein Geschenk, das Sie nicht zurückweisen können, da die Hand, die es darbietet, aus dem Grab kommt. Seien Sie nicht eifersüchtig auf sie; ich habe sie nie geliebt, und auf Tote ist man nicht eifersüchtig.‹«
René begann zu schluchzen. »Ach, Jane, schweigen Sie«, sagte er, »schweigen Sie.«
»Jedes Mal, wenn Sie sie in einer der drei Garnituren sehen, werden Sie gezwungen sein, an mich zu denken.«
»O Jane, Jane«, rief René, »wie können Sie denken, dass ich Sie jemals vergessen könnte?«
»Ich bin durstig, geben Sie mir Wasser.«
Das Bedürfnis zu trinken war der einzige Wunsch, den sie seit dem Morgen mehrmals geäußert hatte.
René reichte ihr ein Glas Wasser, das sie gierig leerte.
Janes Stirn umwölkte sich wieder; sie wurde zunehmend schwächer.
»Hat sich denn niemand nach mir erkundigt?«, fragte sie. »Meine Schwester Hélène scheint sich meinem Wunsch, mit Ihnen allein zu bleiben, mehr als bereitwillig zu fügen.«
Es bekümmerte René zu sehen, dass Jane Hélène allen Ernstes Gleichgültigkeit vorwarf, und er machte sich Vorwürfe, ihr Hélènes Besuch verschwiegen zu haben. »Machen Sie Ihrer Schwester keine Vorwürfe«, sagte er, »sie kam, als Sie schliefen.«
»Oh!«, sagte Jane, und ein Lächeln trat auf ihr Gesicht. »Dann habe ich mich nicht getäuscht, sondern es war Hélène, die ich in meinem Traumgesicht sah und für einen Engel hielt. Liebe Hélène, ihr fehlt nicht viel zum Engel, kaum mehr als die Flügel.«
»Jane«, sagte René, »ich werde Sie keine Sekunde lang allein lassen, aber Sie fügen den Menschen, die Sie lieben, großen Schmerz zu, indem Sie sich weigern, sie zu sehen, indem Sie zeigen, dass sie Ihnen gleichgültig sind, indem Sie nichts von ihnen wissen wollen.«
»Sie haben recht, René, rufen Sie alle herbei.«
René legte ihren Kopf behutsam auf das Kissen zurück und ging Hélène holen.
»Setzen Sie sich wieder zu mir«, sagte Jane. »Niemand außer Ihnen hat das Recht, bis zu meinem Tod an meiner Seite zu bleiben. Heute Nacht werde ich sagen, dass ich schlafen will, alle werden gehen, und Sie werden mich auf die Veranda tragen, damit ich dort, wo wir so glückliche Stunden verbracht haben, von dem Himmel, den Sternen, der Schöpfung und von Ihnen Abschied nehmen kann.«
Auf der Treppe erklangen die Schritte der Besucher, die an Janes Bett beten wollten; als Erste kam ihre Schwester Hélène, gefolgt von Sir James und dem Priester. Ihnen folgten der alte Remi, seine drei Söhne, die Tochter Adda und François. Nach François kamen die Dienstboten: das birmanische Gesinde, die Neger und Negerinnen.
Alle knieten nieder, René am Kopfende des Sterbebetts. Der Priester stand als Einziger mitten unter den Knienden. Pater Luigi war eine würdevolle Erscheinung, und er fand in jeder Situation die richtigen Worte. Sein Gebet war der bewegende Abschied eines jungen Mädchens von allem Unbekannten, von den Geheimnissen der Liebe, vom Glück der Ehe, von den Freuden der Mutterschaft; und diesen irdischen Freuden stellte er das göttliche Glück gegenüber, das den Erwählten des Herrn vorbehalten ist.
Jane wurde zum zweiten Mal ohnmächtig.
Der Priester sagte als Erster: »Ich glaube, wir ermüden die Kranke nur unnötig; niemand benötigt weniger Bittgebete, um in den Himmel zu gelangen, als dieses keusche Kind.«
Bei Jane blieben nur René, Hélène und Sir James zurück. René gab ihr Riechsalz; Jane zuckte zusammen, machte einige fahrige Bewegungen, schlug die Augen auf und lächelte; sie sah sich von allen umgeben, die sie geliebt hatten, die sie noch liebten, und in der Kapelle des Hauses wartete ihr Vater auf sie; sie streckte Hélène die Hand hin, und Hélène warf sich abermals in ihre Arme.
»Meine liebe Hélène«, sagte Jane, »du weißt, dass ich nicht länger leben konnte; ich habe die arme Frau, deren Tod ich verschuldet habe, nach der leichtesten Todesart gefragt, und sie nannte mir den Biss der Schachbrettschlange; wenn ich sterbe, dann, weil ich sterben wollte, beklag mich also nicht. Hätte René mich heute verlassen, wäre ich vor Schmerz und Kummer gestorben; nun verlasse ich ihn zuerst und aus freien Stücken; das Unglück, das man selbst herbeiführt, ist immer erträglich, und nur mit dem Unglück, das unser Pech uns beschert, können wir uns nicht abfinden. Sieh doch, wie ruhig ich bin, wie glücklich; abgesehen von der Blässe müsste man beinahe denken, wir hätten die Rollen getauscht. Du weinst, und ich lächle. Meine liebe Hélène, damit mein Tod so sein wird, wie ich ihn mir erträumt habe, muss ich so sterben wie in diesem Augenblick, an Renés Schulter gelehnt; seine geliebte Hand muss meine Hände für die Ewigkeit auf meiner Brust falten. Du hast noch lange Jahre des Glücks vor dir, liebe Hélène, ich habe nur mehr wenige Minuten. Lass mich mit ihm allein, liebe Schwester; er wird dir sagen, wenn es so weit ist, dass alles zwischen uns auf Erden vorbei ist. Gott gebe, dass wir einander im Jenseits wiederfinden!«
Hélène umarmte Jane ein letztes Mal, und Sir James drückte ihre Hände; ein schmerzliches Zucken glitt über seine ebenmäßigen Züge, und eine Träne entschlüpfte seinen Lidern, bevor er Hélène in den Arm nahm und an sein Herz gedrückt aus dem Zimmer führte, als fürchtete er, der Tod könnte sie ihm streitig machen.
Die Nacht war hereingebrochen, und obwohl kein Licht in dem Zimmer entzündet worden war, war es so hell, als herrschte nur Dämmerung.
»Die Stunde naht unwiderruflich«, sagte Jane, »ich spüre, wie die Kälte mich übermannt und ins Grab zieht; ich leide nicht, sondern ich spüre nur, dass ich nicht länger leben kann.«
Sie deutete auf ihren Gürtel und sagte: »Von jener Stelle an lebe ich nicht mehr; bring mich auf unseren Balkon; dort will ich Abschied von dir nehmen, dort will ich sterben.«
René nahm Jane in die Arme, trug sie auf den Balkon und setzte sie auf seine Knie.
Draußen schien sie wieder Atem und neues Leben zu schöpfen. Die Nacht war so hell und klar wie die Nacht davor. René sah auf der Wiese den Weg, den Jane gegangen war; er sah, wie die Negerin sich ihr näherte; er hörte den Schrei, den das junge Mädchen ausstieß, als es niederfiel; und er sah, wie die Negerin sich nach seinem Schuss auf dem Boden wälzte: All diese Dinge, die nicht nur in seiner Erinnerung, sondern auch vor seinen Augen vorbeizogen, brachten ihn zum Schluchzen. Er drückte Jane an sein Herz und rief: »O Jane! Geliebte Jane!«
Jane lächelte. »Wie klug von dir«, sagte sie, »das nicht schon vorgestern gesagt zu haben, denn dann wäre ich nie und nimmer bereit gewesen zu sterben.«
Sie schwieg für einen Augenblick und betrachtete René und den Himmel, so dass es aussah, als vergrößerte ihr Auge sich.
»Nimm mich noch einmal in die Arme, René«, sagte sie, »denn mir ist, als entglittest du mir in weite Ferne.«
»O nein!«, rief René. »O nein, ich drücke dich im Gegenteil mit all meiner Kraft an die Brust.«
»Wenn das so ist«, sagte Jane, »dann bin ich in der Umarmung des Todes gefangen. Kämpfe um mich, René, kämpfe um mich.«
Sie schlang ihre Arme um Renés Hals und verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. René senkte seinen Kopf auf ihren Kopf.
Nach wenigen Sekunden spürte er, wie sie zusammenzuckte.
»Ah!«, rief sie. »Ah, sie beißt mich mitten ins Herz, sie beißt mich mitten ins Herz!«
Und mit einer Bewegung zog sie Renés Kopf zu sich und presste ihre Lippen auf die seinen. »Adieu«, sagte sie. »Adieu!« Und kaum hörbar fügte sie hinzu: »Auf Wiedersehen – vielleicht.«
Dann sank sie mit ihrem ganzen Gewicht auf Renés Arm.
René sah sie an: Ihre Augen waren geöffnet; man hätte meinen können, sie sähe noch; er legte die Hand auf ihr Herz, und es schlug nicht mehr; er hielt seine Wange vor ihren Mund: Ihr Atem war versiegt, der letzte Atemzug, der sein Gesicht gestreichelt hatte, hatte die Seele fortgetragen.
René blieb einige Minuten lang sitzen und betrachtete sie; noch immer wähnte er, ein Wort oder eine Bewegung könnten einen letzten Lebensfunken in ihr wecken.
Aber sie war tot und blieb tot.
Er trug sie in ihr Zimmer zurück, legte sie auf ihr Bett, kreuzte ihr die Hände über der Brust und schlug auf den Gong.
Die anderen kamen angelaufen, allen voran Hélène und Sir James.
»Es ist vorbei«, sagte René.
Alle brachen in Tränen aus; Hélène trat an das Bett und wollte Jane die Augen schließen.
»O nein!«, sagte René und schob Hélènes Arm sanft beiseite. »Sie wissen doch, dass sie mich darum gebeten hat, ihr diesen Dienst zu erweisen.«
Und er schloss ihre Augen, die sich erst wieder im Licht jener unbekannten Fackel öffnen werden, welche die Seele durch die Ewigkeit geleitet.
Nach dieser frommen Handlung eilte René aus dem Zimmer mit den Worten: »Bleiben Sie bei der Toten; wenn der Leichnam eine Seele enthielt, dann nehme ich sie mit mir.«
Denn einer der beiden wusste zu dieser Stunde um das Geheimnis des großen Mysteriums, über das sie sich unter den nächtlichen Sternen so oft unterhalten hatten.
René hatte Jane nicht wie ein Liebender geliebt, sondern wie ein zärtlicher und liebevoller Freund und Bruder. Dieser Mann aus Erz, der einen Menschen erschoss wie einen Hund und der den Toten so gleichgültig zu seinen Füßen liegen sah, als wäre er tatsächlich ein Hund, musste allein sein, um zu weinen.
Janes Todesart und die klimatischen Bedingungen erforderten ein baldiges Begräbnis. Der Priester blieb bei der Toten. Hélène ging in ihr Zimmer und beendete ihre Hochzeitsnacht damit, dass sie in den Armen ihres Ehemannes ihre Schwester beweinte. Der alte Remi und seine drei Söhne kümmerten sich um das Begräbnis; während Justin die Kapelle mit Blumen ausschmückte, versorgte Adda den Leichnam, den sie auf einer Unterlage aus Aloegewebe in den von Jules und Bernard gezimmerten Teakholzsarg legte und mit frischen Zweigen umkränzte.
Um fünf Uhr nachmittags an diesem Tag rief der Gong zur traurigen Beerdigung. Alle Bewohner der Siedlung versammelten sich im Hof vor dem Tor, wo die Tote aufgebahrt war. Gebete wurden gesprochen, und dann trugen vier junge Mädchen den Sarg in die Kapelle.
René hatte die zwei Elefanten freigelassen; als wüssten sie, welcher Trauerfall sich ereignet hatte, waren sie an allen Trauernden vorbeigewandert und hatten sich wie zwei steinerne Kolosse stumm und reglos der allgemeinen Trauer angeschlossen, als wäre ihnen das Hinscheiden des jungen Mädchens bewusst oder als ahnten sie zumindest, welch großer Schmerz die Anwesenden bewegte.
Jane wurde in die Felsspalte gelegt, in der bereits Eva und der Vicomte de Sainte-Hermine ruhten; und wie bei primitiven Völkern beendete die Trauerfeierlichkeiten eine Mahlzeit, an der alle teilnahmen, auch die niedrigsten Sklaven der Niederlassung.
Nun, da Jane tot war, wollte René seine Abreise nicht länger hinausschieben, und am Tag nach dem Begräbnis kündigte er sie an. Ungeachtet aller Dienste, die er den Schwestern geleistet hatte, musste seine Anwesenheit Kummer und Trauer auslösen. Hélène wusste sehr wohl, dass Janes Liebe zu dem jungen Mann sie in den Tod getrieben hatte; da sie jedoch Renés Geschichte und seinen wahren Namen nicht kannte, konnte sie nicht umhin, ihn für den Tod ihrer Schwester verantwortlich zu machen. Unter ihren lebhaftesten Dankesbezeigungen erwähnte sie die Ausgaben, die René die Reise nach Birma gekostet haben musste, doch er lächelte nur und küsste ihr die Hand, so dass sie begriff, dass sie all das besser auf sich beruhen ließ. Als hätte sie das vorausgesehen, reichte sie René daraufhin eine Schatulle, die Jules angefertigt hatte und die mit Juwelen gefüllt war. René jedoch holte traurig den Beutel hervor, den Jane bestickt hatte, küsste ihn, öffnete ihn und zeigte Hélène den Inhalt.
Dann leerte er Hélènes Schatulle auf den Tisch, suchte den schönsten Saphir aus und sagte: »Stein der Trauer, er wird mir für einen Ring dienen, den ich nie ablegen werde.«
Hélène hielt René ihre Wangen hin.
»Oh«, sagte er, »das ist etwas anderes, das ist das Geschenk einer Schwester an ihren Bruder.«
Und er küsste sie.
Am nächsten Tag war alles für seinen Aufbruch bereit. Die Eskorte war dieselbe wie bei der Herreise. Nur die Elefanten, die Jane zu behalten gewünscht hatte, ließ René zurück, und als Sir James in der Hoffnung, mehr Glück zu haben als Hélène, ihren Preis erfragen wollte, sagte René: »Jane bat mich um die Elefanten, ich habe sie ihr geschenkt, und damit gehören sie Ihnen.«
Am Tag darauf wartete die Eskorte bei Tagesanbruch im Hof. Einen Augenblick lang fragte man sich, wo René stecken mochte; in seinem Zimmer war niemand anzutreffen. Man wollte sich schon auf die Suche machen, als er aus der Kapelle trat: Er hatte den Rest der Nacht an Janes Sarg verbracht.
Einen letzten Besuch galt es den Elefanten Omar und Ali abzustatten, die zuerst glaubten, René wolle sie holen, um sie mitzunehmen, doch schnell begriffen, dass es sich so nicht verhielt, und da sie nicht weltgewandt genug waren, um ihren Schmerz zu verbergen, bezeigten sie ihn René mit den deutlichsten und ergreifendsten Zeichen.
Man trennte sich, wo man einander begegnet war. Sir James bestand darauf, René sein schönstes Manton-Gewehr zu schenken, der das Geschenk mit einer seiner Büchsen erwiderte. Hélène hatte ihm bereits das schönste Geschenk dargeboten, das in ihrer Macht lag, und ihm ihre Wangen zum Kuss gereicht.
Da keine Frauen zu der Eskorte zählten, konnte man sich für die Reise vom Land des Betels nach Pegu mit einem Zwischenhalt begnügen. Man wollte am Ufer des Sees übernachten und am nächsten Tag Pegu erreichen.
René und François bestiegen die kleinen birmanischen Pferde, die so erstaunlich zäh und ausdauernd sind; die Eskorte, die zu Fuß folgte, zeichnete sich durch fast noch größere Ausdauer aus.
Gegen Mittag wurde tief im Waldesinneren eine kurze Pause eingelegt, damit man der größten Hitze entging. René, den die drei Brüder reichlich mit Betel versehen hatten, gab seinen Männern eine ordentliche Portion davon und versprach ihnen gleiche Rationen für den Abend und den nächsten Tag.
Gegen fünf Uhr abends erreichten sie den See.
Kaum waren sie angekommen, konnten einige Neger und Inder der Versuchung nicht widerstehen, ein kühles Bad zu nehmen, obwohl Kaimane in allen Größen wie Baumstämme auf der Wasseroberfläche zu sehen waren; die Männer mussten nur ihren blauen Rock ablegen, der von der Taille bis zum Knie reicht, um sich in Badekleidung zu befinden.
Sie ließen ihre Schurze fallen und sprangen ins Wasser.
Unterdessen hielten René und François mit dem Gewehr in der Hand Wache und richteten den Blick abwechselnd auf den See und auf den dichten Wald, der an ihn grenzte.
81
Die Rückkehr (2)
Mit einem Mal stieß einer der Neger einen Schrei aus und verschwand im Wasser; offensichtlich hatte ein Kaiman sich hinterrücks angeschlichen und den Bedauernswerten an einem Bein in die Tiefe gezogen.
Die anderen schwammen eilig zum Ufer, als sie diesen Schrei des Entsetzens und der Todesangst vernahmen; in knappem Abstand zum letzten Schwimmenden wurde das Wasser von einem grauenerregenden Saurier aufgepeitscht, doch der Schwimmer verdoppelte angesichts der Gefahr seine Schnelligkeit und erreichte das Ufer unversehrt.
Kaum hatte er sich dort aufgerichtet, sah man den Kopf des Kaimans aus dem Wasser auftauchen, und die Echse krallte sich mit beiden Vorderpfoten in den Erdboden; der Neger, der zehn Schritt Vorsprung hatte, rannte aus Leibeskräften auf René zu.
»Ja, was ist denn los?«, rief René lachend.
»Kaiman will machen lecker Essen aus mir«, erwiderte der Neger.
Unterdessen war der Kaiman an Land gekrochen und schickte sich an, den Neger zu verfolgen, in ebenjener Absicht, die der Fliehende ihm unterstellte.
»Oho!«, sagte René. »Greifen Kaimane Menschen auch außerhalb des Wassers an?«
»So aussieht, Massa, vor allem, wenn schon gefressen Menschenfleisch; jetzt er kommt! Jetzt ihn jagen!«
»Aber du hast doch gar keine Waffen«, sagte René.
»Nix Waffen nötig«, sagte der Neger, und dann, an seine Gefährten gewendet: »Ich nix nötig Waffen; kommt ihr anderen, hier Baum, ist alles, was ich brauche.«
Der Kaiman hatte nicht etwa den Rückzug angetreten, sondern innegehalten, als er sah, dass der Neger bei drei oder vier Tieren seiner Spezies Hilfe fand, und nun überlegte er offenbar, ob er sich weiter vorwagen solle.
Der Neger kam so nahe an dem Kaiman vorbei, dass dieser in dem Glauben, seine Beute wolle ihm die Arbeit abnehmen, sein riesiges Maul aufriss, aber die Kinnladen schlossen sich laut krachend, als schlügen zwei Bretter aufeinander: Er hatte nichts als Luft erwischt.
Der Kaiman machte sich an die Verfolgung des Negers, die er mit gewaltigen Sprüngen abkürzte.
Doch der Afrikaner hatte bereits den Baum erreicht, den er seinen Kameraden als Schauplatz für den letzten Akt des Scherzes bezeichnet hatte, den er sich mit dem Kaiman erlaubte.
Es war höchste Zeit: Der Kaiman war keine zehn Schritt mehr hinter ihm. Der Neger nahm Anlauf und erkletterte den Baum mit der Gewandtheit eines Affen, der eine Stange erklimmt.
René wähnte den Neger außer Gefahr, als er sah, dass der Kaiman sich wie eine Rieseneidechse an dem Baumstamm aufrichtete und nach dem Neger schnappen wollte.
Der Neger rettete sich auf einen der waagerechten Äste des Baums. Der Kaiman, dessen Appetit durch die Verfolgung und die Erschwernisse der Jagd gewaltig geschärft war, wagte sich ebenfalls auf den Ast vor.
Nun schien das Schicksal des Negers besiegelt zu sein, und alle Zuschauer begannen um sein Leben zu bangen, doch schon hielt er sich am Ende des Asts fest und sprang gewandt zu Boden.
Sogleich liefen seine Freunde herbei, um ihm zu helfen; sie ergriffen den Ast und schüttelten ihn mit so kräftigen und abrupten Bewegungen, dass dem Kaiman trotz seiner niedrigen Stirn zu dämmern begann, dass er in der Falle saß.
Und indem er verriet, wie unwohl ihm zumute war, gab er zu verstehen, dass er begriff, dass er nicht dafür geschaffen war, auf Bäume zu klettern; er legte sich flach auf den Ast, krallte sich mit allen vier Pfoten daran fest und versuchte, trotz der Stöße, die ihn erschütterten, sein Gleichgewicht zu wahren; zuletzt jedoch drehte er sich um den Ast wie ein lockerer Sattel um den Bauch des Pferdes und fiel zu Boden.
Da er reglos liegen blieb, stürzten die Neger sich auf ihn: Er war auf den Kopf geprallt und hatte sich dabei die Halswirbel gebrochen.
Eine Stunde später saßen die Männer der Eskorte um ein großes Feuer und aßen Kaimanfleisch, anstatt dass der Kaiman Menschenfleisch fraß.
Die Nacht brach schnell herein. René befahl seinen Männern, Holz zu sammeln oder zu schlagen, damit ein großes Feuer entzündet werden konnte, das Reptilien, wilde Tiere und Kaimane fernhielt.
Diese Vorsichtsmaßnahme war umso vernünftiger, als der Geruch des Abendessens alle Freunde rohen oder gebratenen Fleisches unwiderstehlich anlocken musste.
Innerhalb von zehn Minuten war genug Holz für die ganze Nacht gesammelt. René ließ aus diesem Holz eine Art Verschanzung errichten, die leicht zu entflammen war, wenn das Feuer an irgendeiner Stelle erlosch.
Dann wurde der Betel verteilt, um für gute Laune zu sorgen, und danach forderte René seine Leute auf, in Ruhe zu schlafen, da er und François über sie und an ihrer Stelle wachen würden.
Das Feuer war entzündet, und die Nacht schritt voran, begleitet von ihrem unheimlichen Konzert aus Tigergebrüll, Panthergemaunze und Kaimangeschrei, das wie Kindergeschrei klingt; alles ringsum schien eine Stimme zu finden, um die Menschen zu bedrohen: Wald, Wasser und Dschungel schienen das Schlachtfeld eines Heers von Dämonen zu werden, die voller Ingrimm übereinander herfielen, um sich untereinander zu zerfleischen; die Luft wurde zuallerletzt bevölkert, doch gegen elf Uhr flatterten eulengroße Fledermäuse über die Flammen und mischten ihre schrillen Schreie in die abscheuliche Symphonie, von Rauchschwaden begleitet, als entstiegen sie dem Höllenschlund.
Es hätte eines Herzens bedurft, das mit dem dreifachen Erz umgürtet war, von dem Horaz spricht, um nicht beim Ertönen dieses zügellosen Lärms zu erzittern. François, so wacker er war, spürte, wie ihn aller Mut verließ; er stützte sich mit einer Hand auf Renés Arm und deutete mit der anderen auf zwei Lichter, die sich in einer Entfernung von dreißig Schritten im Wald bewegten.
»Still«, sagte René, »ich sehe sie.«
Und er legte sein Gewehr so unbeschwert an, als zielte er auf eine Zielscheibe, und schoss.
Ein furchterregendes Gebrüll war die Antwort auf Renés Schuss; und als wäre dieses Gebrüll ein Signal, wurde es von allen Seiten erwidert, die das kleine Lager am See einschlossen.
»Wirf mehr Holz ins Feuer«, sagte René.
François gehorchte.
Die Birmanen und Inder waren aufgesprungen, die einen auf ein Knie, die anderen aufrecht auf beide Füße.
»Wer von euch ist bereit, einen Baum zu besteigen und alle Äste abzuhacken?«, fragte René auf Birmanisch.
Eine Birmane trat vor, bat François um seinen Entersäbel und erkletterte mit affengleicher Gewandtheit den Baum, der dem Lager am nächsten stand. Sogleich fielen die Äste und Zweige so geschwind, dass außer Frage stand, wie eilig es dem Holzhacker damit war, seiner Aufgabe nachzukommen. Glücklicherweise war es ein Baum mit harzhaltigem Holz, und kaum waren die ersten Zweige ins Feuer gelangt, loderten die Flammen auf und bildeten einen wahren Schutzwall, der das Lager vom Wald abschirmte.
Doch dort, wohin René seinen Schuss abgefeuert hatte, erklang weiterhin Gebrüll: sei es, dass der verwundete Tiger sich nicht dareinschicken wollte zu sterben, sei es, dass das Tier nach der Gewohnheit seiner Art als Männchen sein Weibchen oder als Weibchen sein Männchen bei sich hatte. René lud das Gewehr nach und ließ François die vier weiteren Gewehre in Bereitschaft halten, die sein Arsenal bildeten. Dann ergriff er glühende Zweige und warf sie in das Geäst eines harzhaltigen Baums, ähnlich dem, der das Feuer so prächtig genährt hatte. Der Baum fing Feuer. Innerhalb weniger Sekunden brannte er lichterloh vom Fuß bis zum Wipfel und beleuchtete die ganze Umgebung auf fünfzig Schritt im Umkreis wie ein Feuerwerk.
Man sah, wie am Seeufer zwei Kaimane herbeikrochen, die sich unbemerkt anzuschleichen versuchten.
René ging auf die Riesenechsen zu, die vor dem Feuer unschlüssig zurückscheuten. Ihre großen dummen Augen blickten erstaunt drein; unter der allzu starken Hitze zogen ihre Körper sich zusammen. Die Augen waren so groß wie Fünf-Francs-Stücke, und mehr benötigte René nicht. Er schickte eine Kugel in das nächste Auge, keine zehn Schritt von ihm entfernt; sein Besitzer bäumte sich heftig auf und fiel dann auf den Rücken.
Der Neger, der tagsüber den Kaiman gejagt hatte, nahm einen Zweig in die Hand, dessen Ende brannte, und stieß ihn dem Untier wie einen Spieß in den Rachen. Unter entsetzlichem Gebrüll löschte das Ungeheuer die Feuersbrunst, indem es sich in den See stürzte.
Sein Begleiter trat erschrocken den Rückzug an, als er sah, was seinem Gefährten widerfahren war, und suchte Zuflucht im Wasser.
Der Baum brannte noch immer; brennende Zweige fielen herab und setzten das trockene Gras und kleinere Bäume in Brand. Schnell wuchs das Flammenmeer und bildete eine weite Umfriedung; der Wind, der vom See her blies, trieb die Flammen vor sich her. Je weiter sich das Feuer voranfraß, desto lauter wurde das Geschrei der Tiere, die es überraschte.
Inmitten dieses Geschreis war das Zischen und Rascheln der Schlangen zu vernehmen, die auf der Flucht mit ihrer Schuppenhaut an den Baumstämmen entlangglitten.
»Wohlan«, sagte René, »liebe Freunde, ich denke, wir können jetzt ruhig schlafen.«
Und er legte sich mitten in dem Flammenkreis zur Ruhe und schlief nach fünf Minuten so tief und fest, als befände er sich in der Kabine seiner Slup.
82
Doppelte Prise
Am nächsten Morgen erwachte René bei Tagesanbruch.
François hingegen hatte als treuer Wächter die ganze Nacht kein Auge zugetan. Kein Tier, nicht einmal ein Kaiman, hatte sie heimzusuchen gewagt.
Sobald René wach war, gab er den Befehl zum Aufbruch und verteilte Arrak und Betel an seine Männer.
Zum Glück waren die Pferde angebunden gewesen und hatten nicht fliehen können, als die Feuersbrunst den See wie einen riesigen Spiegel beschienen hatte.
Die Tiere, die in der Tiefe dieses Binnenmeeres lebten, hatten das ungewohnte Schauspiel sicherlich befremdet verfolgt. Der Wald brannte eine halbe Meile weit, und der See sah aus wie ein Flammenmeer.
Als es hell wurde, waren keine wilden Tiere mehr in der Nähe; kein Tigergebrüll war zu vernehmen, kein Schlangengezischel, kein Kaimangejaule; tiefe Stille herrschte, nachdem alle Lebewesen der Feuersbrunst entflohen waren, die man hie und da noch in der Ferne knistern hörte.
Alle Männer der Eskorte betrachteten René voller Bewunderung. Die Nacht raubt dem Kühnsten den Mut, und mancher, der tasgsüber jeder Gefahr, die er sehen kann, unerschrocken die Stirn bietet, erzittert im Dunkeln vor dem, was er nicht sehen kann und was ihm harmlos erschiene, könnte er es sehen.
René jedoch war von besonderem Schlag und kannte keine Furcht.
Man machte sich wieder auf den Weg.
Niemand hätte eingestanden, dass Angst und Furcht ihm das Herz bedrückten, doch alle wanderten so geschwind, als wollten sie den unseligen Wald so bald wie möglich hinter sich lassen.
Gegen zwei Uhr nachmittags wurde der Waldrand erreicht, und alle atmeten auf; man erwog, anzuhalten und zu essen, doch erst als man den Wald verlassen hatte, wagte man, in die Tat umzusetzen, was im Dschungel selbst den Mutigsten tollkühn erschienen wäre.
In der Ebene und im hellen Tageslicht jedoch merkten alle, dass sie seit Sonnenaufgang auf den Beinen waren, ohne einen Bissen gegessen zu haben. Man setzte sich fröhlich und holte aus den Vorräten, die am Sattel eines der Pferde hingen, eine gebratene und geräucherte Antilopenkeule; jeder schnitt sich eine Scheibe ab und verzehrte sie zu einem Glas Arrak.
Es waren nur mehr drei bis vier Stunden Marsch durch die Ebene mit vereinzelten Büschen, wo sich wilde Tiere tagsüber kaum aufhielten. Die Karawane setzte ihren Weg bis nach Pegu ohne weitere Zwischenfälle fort.
Renés Slup lag im Hafen vor Anker, wie er sie hinterlassen hatte. Er gab sich zu erkennen, und sogleich wurde von der Runner of New York eine Jolle hergeschickt, um ihn an Bord zu bringen. Auf dem Schiff erwartete ihn der Mann, mit dem er die Bezahlung für Eskorte, Pferde und Elefanten ausgehandelt hatte.
Am selben Abend wurde alles beglichen, und in Gegenwart des Shabundars bezahlte René dem Besitzer der Sklaven und der Tiere, die ihn zum Land des Betels gebracht hatten, den vereinbarten Betrag.
Da für die zwei Elefanten, die René Hélène als Geschenk zurückgelassen hatte, kein Preis ausgehandelt worden war, ließ man den Shabundar einen Preis festsetzen.
Nichts hielt René nunmehr in Birma zurück, in einem Land, in das ihn allein der Zufall geführt hatte. Die Verpflichtung, die er gegenüber den Damen Sainte-Hermine empfunden hatte, war abgegolten, und es gab keinen Grund für ihn, länger in Birma zu bleiben. So wurde am nächsten Tag derselbe Lotse engagiert, mit dem man den Fluss Pegu landeinwärts gekommen war und der in der Erwartung, dass man ihn eines Tages wieder benötigen würde, um flussabwärts zu fahren, in Ruhe abgewartet und für drei oder vier Sous am Tag Reis gegessen hatte, bis René seine Geschäfte im Land des Betels beendete und ihn in Pegu wieder an Bord nahm.
Es war der 22. Mai 1805.
René hatte nicht die geringste Ahnung von den Dingen, die in Frankreich vor sich gegangen waren, seit er vor einem Jahr Saint-Malo an Bord der Revenant verlassen hatte.
Keine menschlichen Bande, keine Familienbande bestehen zu unserem Vaterland, und doch hat es als unser aller Mutter Rechte auf uns, die uns so innig mit ihm verbinden wie mit der Mutter, aus deren Schoß wir geboren wurden. Zudem hatte René Frankreich zu einem Zeitpunkt verlassen, als große Dinge sich anbahnten. Bonaparte war entschlossen gewesen, in England einzufallen. Hatte er sein Vorhaben ausgeführt, hatte er es aufgegeben? Das hatte niemand René in Indien sagen können, doch sobald er zur Île de France zurückkehrte, würde er dort sicherlich Surcouf vorfinden und von ihm erfahren, was seither geschehen war. Dank der günstigen Strömung, welche die Runner of New York dem Meer entgegenführte, dauerte es nur drei Tage, um von Pegu nach Rangun zu gelangen, und am vierten Tag fuhr das Schiff auf das offene Meer hinaus.
René nahm Kurs auf die Nordwestspitze der Insel Sumatra. Nach zehn Tagen kam Aceh in Sicht und wurde noch am selben Abend umfahren, so dass man sich auf der unermesslichen Wasserwüste befand, die sich von Sumatra bis zu den Tschagos-Inseln ausdehnt.
Am nächsten Tag rief der Mann im Ausguck bei Tagesanbruch: »Schiff in Sicht!« René sprang an Deck, das Fernrohr in der Hand.
Auf Höhe der nördlichsten Tschagos-Insel waren drei Schiffe zu sehen; zwei segelten miteinander auf die Tschagos-Inseln zu, das Dritte kam ihnen entgegen. Die zwei ersten schätzte René als Kauffahrer ein, doch man darf nicht vergessen, dass Kauffahrer zu jener Zeit so schwer bewaffnet waren wie Schiffe der Kriegsmarine.
Doch besondere Aufmerksamkeit weckte das dritte Schiff, das den zwei anderen entgegenfuhr. Bauweise und Aufmachung ließen nicht den geringsten Zweifel daran, dass dieses wendige, schnelle Schiff dazu bestimmt war, schwerfälligere Beute zu verfolgen und einzuholen.
René reichte François sein Fernglas und sagte nur nachdrücklich: »Schau!«
François nahm das Fernglas, sah hindurch und konnte einen Freudenschrei kaum zurückhalten; er sah René an, der lächelte, gab ihm das Fernglas zurück und murmelte: »Meiner Treu, wahrhaftig!«
Im selben Augenblick gab das dritte Schiff einen Kanonenschuss ab, und inmitten des Rauchs entfaltete sich ein Banner.
»Siehst du«, sagte René, »die Fahne der Republik.«
Die zwei Schiffe, die dem dritten entgegenkamen, erwiderten den Schuss mit Kanonensalven und hissten die Flagge des Vereinigten Königreichs.
»Alle Segel setzen!«, rief René. »Und haltet Kurs auf den Ort des Gefechts!«
Die Schiffe befanden sich etwa zwei Meilen seewärts der Tschagos-Inseln, und es wehte so wenig Wind, dass die Gefechtsgegner, die einander beschossen, bald von einer Rauchwolke eingehüllt waren; der schwache Nordostwind, der auf diese Schiffe keine Wirkung hatte, konnte jedoch einem leicht gebauten und wendigen Schiff wie der Runner of New York, wenn es vor dem Wind segelte, zu einer ansehnlichen Geschwindigkeit verhelfen.
Die Rauchwolke um die drei kämpfenden Schiffe wurde immer dichter. Der unablässige Kanonendonner der Geschütze, den das malaiische Ufer zurückwarf, klang wie heftiges Gewittergrollen. Das Gefecht dauert seit einer Stunde an, als René seiner Mannschaft befiehlt, sich in den Kampf zu stürzen, und allen anderen voraus in den schwarzen Rauch springt; die Kanoniere haben mit glimmender Lunte in der Hand Posten bezogen, als René zwischen zwei Rauchschwaden am Heck eines der beiden englischen Schiffe den Namenszug Louisa entziffert.
Was schert ihn, welcher Nationalität die Männer an Bord sind! Er weiß nur, dass das Schiff gegen ein französisches Schiff kämpft, und das ist alles, was er wissen muss!
»Feuer von Steuerbord!«, befiehlt René, der sein Schiff dicht neben die Louisa manövriert.
Die sechs Steuerbordgeschütze der Runner of New York schießen wie aus einem Rohr. Dann überholt die Runner of New York die Louisa, auf der noch niemand begriffen hat, was gerade geschieht, und René lässt seine zwei Hauptgeschütze ihre Kanonenkugeln über die ganze Länge des gegnerischen Schiffs abfeuern.
Ein schreckliches Krachen ertönt: Der gekappte Fockmast ist auf das Deck der Louisa gestürzt.
Durch den sich stetig verdichtenden Rauch und den Gefechtslärm hört René eine wohlbekannte Stimme, die ihre Leute zum Entern auffordert.
Unterdessen verfängt sich der Bugspriet der Runner of New York in den Wanten des zweiten, unbekannten englischen Schiffs; René schert sich nicht darum, sondern greift zu seinem Sprachrohr und fordert seine Mannschaft ebenfalls auf, den Engländer zu entern.
Im selben Augenblick erblickt er zwischen zwei Rauchschwaden einen englischen Offizier auf der Wachtbank des Schiffs, mit dem sein Schiff verfangen ist; er lässt das Gewehr sinken, nimmt es in die linke Hand, legt an, schießt und sieht, wie der Engländer von der Wachtbank rollt.
»Bereit zum Entern, Freunde, bereit zum Entern!«, ruft René abermals und springt als Erster auf den Bugspriet, während an die zehn Mann, von François angeführt, die Wanten entlangklettern, sich an den Schoten zum Bugspriet hinunterhangeln und ihrem Kapitän an Deck des gegnerischen Schiffs folgen.
Die verblüfften Engländer fragen sich, woher diese Männer kommen, die wie vom Himmel fallen, als René mit donnernder Stimme auf Englisch befiehlt: »Geben Sie sich zu erkennen! Zeigen Sie Flagge!«
Der erste Offizier des englischen Schiffs hebt den Arm, um die Ordre rückgängig zu machen, doch sein Arm fällt herunter, die Stimme versagt ihm den Dienst, denn eine Pistolenkugel hat seine Schläfen durchdrungen.
Die englische Flagge wird gesetzt, und diesmal ruft René auf Französisch: »Stellt die Kampfhandlungen ein, Freunde, der Engländer hat sich ergeben.«
Dann lauscht er: Stille überall.
Man wartet ab, bis der Wind den dichten Rauchschleier lüftet, der die Schiffe voreinander verbirgt und nach und nach als Spirale um die Masten aufsteigt; die zwei englischen Schiffe ergeben sich, und nach einigen Minuten sieht René den französischen Kapitän, der auf dem Deck eines der gegnerischen Schiffe steht und den Fuß auf die englische Fahne gesetzt hat.
Er hatte sich nicht getäuscht: Es war Surcouf.
Beide stießen einen Freudenruf und einen Triumphruf aus; ihre ausgestreckten Hände konnten sich noch nicht berühren, doch die Namen, mit denen die Freunde einander begrüßten, bewiesen, dass sie einander erkannt hatten.
83
Rückkehr zum Quai Chien-de-plomb
Weder Surcouf noch René wagten zu Anfang, die gekaperten Schiffe zu verlassen; doch sobald alle Formalitäten erfüllt waren, die Offiziere ihr Wort gegeben hatten, François zum Kapitän der Louisa und Édeux, der erste Offizier Surcoufs, zum Kapitän des Dreimasters The Triton ernannt waren, ließen Surcouf und René Jollen zu Wasser, um den Freund zu besuchen.
Auf halbem Weg begegneten sie sich. René sprang in Surcoufs Boot und in Surcoufs Arme.
Sie vereinbarten, den ganzen Tag miteinander zu verbringen und abends miteinander zu speisen; nun rühmte jeder seinen Koch nach Leibeskräften, um dem Freund das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Doch Surcouf befand, dass Renés Speisenkarte verlockender klinge als seine eigene, und man kam überein, an Bord der Runner of New York zu speisen.
In wenigen Worten unterrichtete René Surcouf von seiner Reise nach Birma, berichtete ihm von den Jagdabenteuern, den Überfällen bei Tag und Nacht, den Kämpfen mit den malaiischen Piraten, dem Zweikampf mit der Riesenschlange und dem Tod der armen Jane, ohne näher auf die Todesumstände einzugehen, und zuletzt schilderte er seine Abreise aus dem Land des Betels, die Feuersbrunst im Wald und den Überfall der Kaimane und Tiger.
Surcouf konnte vor Begeisterung kaum still sitzen. »Das ist das Schöne an einem Landgang«, sagte er, »man kann sich so recht nach Herzenslust vergnügen; ich hatte in der Zwischenzeit ein paar Handgemenge mit Engländern, die sich allesamt wie die Tölpel überwältigen ließen, aber heute hatte ich den Kopf im Rachen des Löwen stecken, bis die Vorsehung dich schickte, damit du ihm den Kiefer ausrenkst. Stell dir vor, ich war mit den beiden Engländern so beschäftigt, dass ich dein Kommen gar nicht bemerkt habe – und das, obwohl ich mich immer damit gebrüstet habe, die schärfsten Augen von allen Seefahrern aus Saint-Malo zu haben, Bretonen wie Normannen! Du kannst dir denken, mit welchem Erstaunen ich die Musik deiner Sechzehnergeschütze vernahm, als sie in das Orchester einstimmten. Aber du kannst dir auch denken, dass ich deine Stimme erkannt habe, sobald ich sie hörte, selbst wenn du Englisch sprachst. Weißt du, was wir heute gekapert haben?«
»Meiner Treu, nein!«, sagte René. »Ich habe nicht für die Prise gekämpft, sondern um dir zu Hilfe zu kommen.«
»Ha, mein Lieber!«, rief Surcouf. »Wir haben eine Prise gemacht, mit der wir den ganzen Ozean vom Kap der Guten Hoffnung bis zum Kap Hoorn pfeffern könnten; Pfeffer für drei Millionen, von denen eine dir und deinen Leuten gehört.«
»Und was soll ich mit einer Million anfangen? Du weißt, dass es mir nicht um deinen Pfeffer gegangen ist.«
»Ja, und was ist mit deinen Männern? Du kannst die Million ablehnen, aber du kannst nicht den Anteil ablehnen, der achtzehn oder zwanzig armen Teufeln zusteht, die auf ihr Prisengeld zählen, um die restlichen Tage ihres Lebens ihre Suppe salzen und pfeffern zu können. Überlasse ihnen deinen Anteil an der Prise, wenn du unbedingt willst, dann machen sie ein gutes Geschäft, denn sie bekommen fünfhunderttausend Francs zusätzlich. Aber ihren Anteil darfst du ihnen nicht vorenthalten.«
»Du gibst ihnen also meinen Anteil!«
»Ob du oder ich, was macht das schon aus? Wen kümmert es, woher die halbe Million kommt, solange sie sie erhalten? Aber deine erste Frage war, was in Frankreich vor sich geht, ob Seegefechte oder Schlachten zu Land ausgetragen werden. Ich weiß davon nicht das Geringste, denn der Kanonendonner gelangte nicht bis zum Indischen Ozean. Ich weiß nur, dass Seine Heiligkeit der Papst sich nach Paris begeben hat, um dem Kaiser Napoleon seinen Segen zu geben. Von einer Landung in England habe ich jedoch nichts gehört, und wenn ich Seiner Majestät dem Kaiser einen Rat geben darf, dann kann ich ihm nur empfehlen, sich auf seinen Soldatenberuf zu besinnen und uns unseren Seemannsberuf zu überlassen!«
Renés Schiff war noch nicht lange unterwegs, und folglich gab es an Bord frische Nahrung und saftige Früchte, die den Offizieren der Revenant köstlich munden mussten.
Surcouf hatte während Renés Abwesenheit ein Abenteuer mit einem Hai erlebt. Sein Bericht bewies, dass er wie René in keiner Gefahr die Nerven verlor, mochte sie sich noch so ungewohnt oder überraschend präsentieren.
Wenige Tage nach Renés Abreise hatte Surcouf sich wieder auf die Jagd nach feindlichen Schiffen gemacht. Während seines Aufenthalts vor der Seychellen-Insel Mahé hatte eine Piroge einen Hai aus dem Schlaf geweckt, und der Hai hatte mit einem Schlag seines Schwanzes die Piroge zwischen Praslin und La Digue zum Kentern gebracht; die Überlebenden, die das Wrack erklommen, hatte das Meeresungeheuer bis auf den Schiffsführer verschlungen. Die Opfer des Hais gehörten zu Surcoufs Mannschaft.
Das traurige Ereignis hatte die Besatzung des Kaperschiffs anfangs tief beeindruckt – insbesondere den Kapitän, der als Einziger dem Rachen des Raubtiers entkommen war. In seiner Seelenpein hatte er sogar der Muttergottes ein Gelübde getan. Doch Seeleute mit ihrer harten und anstrengenden Arbeit haben nicht das beste Gedächtnis.
Von Insel zu Insel ging man den gewohnten Tätigkeiten nach, wechselte Matrosen aus und erwarb neuen Proviant.
Als auf der Insel Mahé ein längerer Aufenthalt eingelegt wurde, lud ein Bewohner der Insel, der mit Surcouf aus früheren Zeiten befreundet war, ihn und einige seiner Offiziere zum Abendessen in die Niederlassung ein, die er vor einigen Jahren im Westteil der Insel gegründet hatte. Die Gäste machten sich in einem der Boote der Revenant auf den Weg, den sie in bemerkenswert kurzer Zeit bewältigten.
Der Tag verging fröhlich bis zu dem Zeitpunkt, der für die Rückkehr der Gäste vorgesehen war; Surcoufs Boot fuhr zuerst los, vollbeladen mit Proviant für die Fortsetzung der Kaperfahrt. Ein Offizier und Surcoufs Leibdiener Bambou nutzten die Gelegenheit, zu ihrem Schiff zurückzugelangen. Surcouf hatte dem Neger sein Gewehr und seine Jagdtasche überlassen, die er auf Ausfahrten immer mit sich führte.
Die größte Piroge der Siedlung verließ das Ufer, mit Gästen vollbesetzt und geleitet von dem Amphitryon des Hauses, der Surcouf, dem ersten Offizier und Arzt Millien und dem Gefreiten Joachim Viellard die Ehre erwies, sie zu ihrem Schiff zu geleiten.
Die Piroge umrundete die Nordspitze der Insel Mahé; der Wind erstarb, als das Tageslicht erlosch, und bewegte die Meeresoberfläche kaum noch. Schon waren die Stückpforten der Revenant zu sehen, deren frischer Anstrich die letzten Sonnenstrahlen widerspiegelte, und vier kräftige Neger ruderten die Piroge über die klaren Wasser des Meeressockels, der in diesem Archipel von Haien bevölkert ist, die für ihre Größe und ihre Gefräßigkeit berüchtigt sind.
Unvermittelt tauchte im Kielwasser der Piroge eines jener Meeresungeheuer auf, dessen riesiger Kopf Menschenfleisch in so großer Nähe erschnupperte, dass der Bootsführer – niemand anders als unser Amphitryon – sich nicht anders zu helfen wusste, als dem Tier einen gewaltigen Schlag mit seinem Ruder zu verpassen.
Der Hai ließ sich davon nicht entmutigen, sondern schwamm voller Fressgier an der Piroge vorbei, die er an Länge übertraf, umrundete sie und machte sich bereit, die einladende Beute von der Seite aus anzugreifen und zu verschlingen.
Mit einem gewaltigen Schwanzhieb brachte er das große Boot zum Schaukeln, was die Mannschaft und die Gäste erschreckte, die sich bange fragten, wie der Kampf mit einem so verbissenen Gegner enden würde, der unverdrossen immer neue Angriffe ausführte und sich von den Schlägen, die auf ihn niederprasselten, nicht abschrecken ließ.
Bei einer seiner Wendungen zeigte der Hai sein weit aufgerissenes Maul auf Höhe des Schandecks, und Surcouf nahm ein Ei aus dem Proviantkorb, den der Gastgeber ihm als Geschenk mitgegeben hatte, und warf es mit aller Kraft in den offenen Rachen. Das Wurfgeschoss glitt in den Schlund des Riesenfischs wie ein appetitliches Hors-d’œuvre, das der Hai sich offenbar schmecken ließ, denn daraufhin klappte er seinen Kiefer zu, tauchte ab und verschwand in der Tiefe.
Als die Gefahr vorbei war, lachten alle über das Scharmützel und ganz besonders über das Geschoss, das dem Vielfraß[5] das Maul gestopft hatte, und sie nahmen sich vor, ihm bei der nächsten Begegnung ein veritables Omelett zu servieren.[6]
Surcouf hatte sein viertes Gefecht hinter sich, seit er die Île de France verlassen hatte, und seine Mannschaft war auf siebzig Mann geschrumpft. Er beschloss, sofern René einverstanden war, zur Île de France zurückzufahren.
René konnte sich nichts Besseres wünschen.
Am 26. Mai überquerten die Revenant und die Runner of New York den Äquator und kehrten in die nördliche Hemisphäre zurück.
Am 20. Juni riefen die Männer im Ausguck beim ersten Tageslicht: »Land in Sicht!«
Als die Sonne den Horizont erreichte, wurden die Gebirge in der Ferne sichtbar, und am nächsten Tag befanden sich die Schiffe zur gleichen Stunde zwischen Flacq und der Île d’Ambre.
Dann sahen sie die Bucht, vor der die Saint-Géran gekentert war, und da keine englischen Schiffe die Zufahrt zur Insel erschwerten, lenkte Surcouf seine kleine Flotte zur Île Plate und manövrierte sie zwischen ihr und dem Point-de-Mire hindurch. Sobald er diese Untiefen hinter sich hatte, nahm er Kurs auf die Pavillons-Anlegestelle.
Auf Höhe der Baie du Tombeau kam der Lotse an Bord und erklärte ihm, dass aufgrund des bevorstehenden Krieges zwischen Frankreich und England keine englischen Schiffe vor der Insel kreuzten.
Surcouf, René und ihre zwei Prisenschiffe konnten also ungehindert in den Hafen von Port-Louis einfahren und am Quai Chien-de-Plomb vor Anker gehen.
84
Besuch beim Gouverneur
Für die ganze Île de France bedeutete die Rückkehr Surcoufs und Renés mit so gewaltigen Prisen einen Freudentag.
Unter allen französischen Kolonien ist die Île de France die dem Mutterland vielleicht am engsten verhaftete. Ein französischer Dichter – er dichtet in Prosa, doch das tat auch Chateaubriand – hatte ihr mit seinem Roman Paul und Virginie einen poetischen und literarischen Firnis verliehen, der sie doppelt zur Tochter der Metropole Paris machte. Ihre wackeren, abenteuerlustigen, einfallsreichen und liebevollen Siedler waren voller Bewunderung für die großen Ereignisse, die wir in Frankreich erlebt, und die großen Kriege, die wir geführt hatten. Sie liebten uns nicht nur des Nutzens wegen, den ihnen Schiffe und Waren brachten, die wir bei ihnen verkauften, sondern auch, weil es ihre Wesensart ist, alles Großartige zu lieben und zu bewundern.
Seit nunmehr sechzig Jahren heißt die Île de France Mauritius und gehört zu England. Seit sechzig Jahren sind drei Generationen vergangen, und noch heute ist die Île de France in ihrem Herzen ebenso französisch, wie sie es war, als das Lilienbanner oder die Trikolore über Port Louis und Port Bourbon flatterten.
Nun denn, heute, da die Namen all jener bretonischen und normannischen Helden fast ganz aus unserem Gedächtnis geschwunden sind und wir uns nur undeutlich an einen Surcouf, einen Cousinerie, einen L’Hermite, einen Hénon oder Le Gonidec erinnern, gibt es in ganz Port Louis kein einziges Kind, das nicht ihre Name auswendig aufsagen und ihre Taten berichten könnte – Taten, neben denen die der Flibustiere im Golf von Mexiko verblassen müssen. Und im Unglück fanden unsere Seeleute auf der Île de France ebenso warmherzige Aufnahme wie im Glück. Wie oft räumte ihnen nicht auf ihre bloße Unterschrift der bekannte Bankier Monsieur Rondeau die Möglichkeit ein, ihren Verlust wettzumachen und ihre Schiffe für zweihunderttausend oder sogar zweihundertfünfzigtausend Francs ausbessern zu lassen?
Zweifellos waren unsere wackeren Seeleute untereinander von größter Solidarität, und wenn einer seine Verpflichtungen nicht erfüllen konnte, kamen ihm zehn andere zu Hilfe.
René, der den Seemannsstand so eingehend erkundet hatte, der jeder Gefahr die Stirn bot und der wusste, welch ausgezeichneten Rat für seine Laufbahn Monsieur Fouché ihm gegeben hatte, wusste auch, dass er mit dem höchsten Lob seiner Vorgesetzten zum Leutnant auf einem Kriegsschiff der kaiserlichen Marine ernannt worden wäre, wenn er nur die Hälfte dessen, was er als erster Offizier bei Surcouf oder als Kapitän seiner eigenen kleinen Slup vollbracht hatte, als erster Offizier an Bord eines Schiffs der französischen Kriegsmarine geleistet hätte.
Doch was er geleistet hatte, hatte er vor den Augen eines Mannes getan, dessen Herz nicht einmal der Schatten eines Neidgefühls streifte. Surcouf, dem die Leitung einer Fregatte angeboten worden war, kannten und schätzten alle Offiziere der französischen Marine. Eine Empfehlung aus seinem Mund konnte René den Weg auf jedes Schiff ebnen; René musste lediglich nach Europa zurückkehren und unter einem der herausragenden Kapitäne Dienst tun, die Schiffe wie die Tonnant, die Redoutable, Bucentaure, Fougueux, L’Achille oder die Téméraire befehligten. Dafür würde er eine Empfehlung Surcoufs benötigen, die dieser ihm sicherlich nicht verweigern würde.
Surcouf war mit General Decaen, dem Gouverneur der Île de France, bekannt; er besuchte ihn und bat ihn um eine Audienz am nächsten Tag für einen seiner tapfersten Offiziere, der nach Frankreich zurückkehren wollte, um an den Kämpfen teilzunehmen, die sich auf die Meere Spaniens und des Nordens verlagerten. Er erzählte dem Gouverneur mit aller Begeisterung, die ihm zu Gebote stand, wie René sich beim Kapern der Standard geschlagen hatte und dass er seinen Anteil an der Prise geopfert hatte, um zwei junge Französinnen, deren Vater an Bord ebendieses Schiffes umgekommen war, nach Birma zu bringen.
Birma, in verschiedene Königreiche unterteilt, war nicht nur in Europa so gut wie unbekannt, sondern auch auf der Île de France, obwohl es sich lohnte, dieses Land zu kennen, das fast als Einziges dem Druck Englands widerstanden hatte.
General Decaen erwiderte, er werde sich glücklich schätzen, den tapferen Mann zu empfangen, den Surcouf ihm empfahl.
Am nächsten Tag fand sich René zur vereinbarten Stunde bei dem Gouverneur ein; er nannte dem Türsteher seinen Namen, doch dieser zögerte, ihn einzulassen. Das Zögern entging René nicht, und er fragte den Türsteher nach dem Grund.
»Sind Sie wirklich der erste Offizier Monsieur Surcoufs und der Kapitän der Runner of New York?«
»Der bin ich allerdings.«
Das Zögern des guten Mannes war umso begreiflicher, als die Uniform bei Korsaren nicht obligatorisch war und René sich nach der Mode der Zeit gekleidet hatte, mit jener angeborenen Eleganz, die er nicht ablegen konnte, selbst wenn er sich bemüht hätte, die Klasse zu verbergen, in der er geboren und aufgewachsen war. Da er sich nicht weiter Gedanken um sein Auftreten auf der Île de France gemacht hatte, war er so gekleidet, als wollte er die Gräfin von Sourdis oder Madame Récamier besuchen.
General Decaen, dem ein Monsieur René, erster Offizier bei Surcouf, angekündigt wurde, erwartete einen Seebären, einen vierschrötigen Kerl mit borstigem Haupthaar, ungepflegtem Kinn- und Backenbart und in einer Aufmachung, die eher malerisch als elegant war. Stattdessen sah er einen schönen jungen Mann mit blassem Teint, sanftem Blick, lockigem Haar, tadellosen Handschuhen und mit dem Anflug eines Schnurrbarts.
General Decaen hatte sich erhoben, als Monsieur René angekündigt wurde, doch als er ihn erblickte, blieb er sprachlos stehen.
René hingegen trat mit der Ungezwungenheit eines Mannes von Welt auf ihn zu, der es gewohnt ist, in den vornehmsten Salons zu verkehren, und begrüßte den General mit vollendeter Anmut.
»Monsieur«, sagte der General voller Erstaunen, »sind Sie der Mann, von dem unser wackerer Korsar Surcouf mir gestern erzählt hat?«
»Du lieber Himmel«, sagte René, »General, Sie machen mir Angst. Wenn er Ihnen etwas anderes vorgegaukelt hat als einen schlichten Burschen von vier- bis fünfundzwanzig Jahren, der in seinem Gewerbe nicht sonderlich kundig ist, da er es erst seit einem Jahr ausübt, ziehe ich mich jederzeit gerne zurück und räume ein, dass ich das Interesse nicht verdiene, das mir auf seine Empfehlung hin entgegenzubringen Sie die Güte hatten.«
»Nein, Monsieur«, erwiderte der General, »meine Verwunderung hat nichts Kränkendes, sondern ist die wortlose Anerkennung, die ich Ihnen als Mann und als Weltmann zolle. Bisher war ich des Glaubens, Korsar könne nur sein, wer mit jedem Wort einen Fluch äußert, seinen Hut schief trägt und mit gespreizten Beinen geht, als wäre er keinen festen Boden unter den Füßen gewohnt; verzeihen Sie mir, dass ich mich so geirrt habe, und sagen Sie mir, welchem Glücksfall ich die Ehre Ihres Besuchs verdanke.«
»General«, sagte René, »Sie können mir einen großen Gefallen erweisen; Sie können mir zu einem ehrenvollen und geziemenden Tod verhelfen.«
»Sie wollen sterben, Monsieur«, sagte der General, der ein Lächeln unterdrücken musste, »in Ihrem Alter, mit Ihrem Vermögen, Ihrer Eleganz, mit den Erfolgen, die Sie in der vornehmen Welt zweifellos bereits hatten und noch haben werden! Sie belieben zu scherzen...«
»Fragen Sie Surcouf, ob ich im Angesicht des Gegners nicht mit allen Kräften den Tod suche.«
»Monsieur, Surcouf hat mir die unglaublichsten Dinge von Ihrem Mut, Ihrer Gewandtheit und Ihrer Kraft berichtet; und deshalb bezweifelte ich, als ich Sie sah, dass Sie derjenige seien, von dem man mir erzählt hatte, denn Surcouf hat mir nicht nur von Ihrem Mut angesichts menschlicher Gegner berichtet, sondern von einem noch weit selteneren Mut, dem angesichts wilder Tiere. Wenn man ihm Glauben schenken will, haben Sie in Ihren jungen Jahren Taten vollbracht, die den zwölf Taten des Herakles in nichts nachstehen.«
»Mein Verdienst ist denkbar gering, General; wer den Tod nicht nur nicht fürchtet, sondern es als größtes Glück sähe, ihn zu finden, ist so gut wie unbesiegbar, sieht man von einer unberechenbaren Kugel ab. Zudem hatte ich nur mit Tigern zu tun, und der Tiger ist zwar grausam, aber feige. Jedes Mal wenn ich mich einer dieser Raubkatzen gegenübersah, habe ich sie mit dem Blick fixiert, bis sie den Blick senken musste. Ob Mensch oder Tier, wer den Blick senken muss, ist der Besiegte.«
»Wahrhaftig, Monsieur«, sagte der General, »ich bin entzückt, Sie kennenzulernen, und wenn Sie mir die Ehre erweisen wollen, mit mir zu speisen, werde ich Sie mit Madame Decaen bekannt machen und Sie bitten, meinem Sohn die Hand zu geben und ihm einige Ihrer Jagdabenteuer zu erzählen.«
»Ich nehme Ihre Einladung mit Vergnügen an, General; einem armen Teufel von Matrosen widerfährt selten genug die Ehre, mit einem Mann Ihres Ranges zu tun zu haben.«
»Armer Teufel von einem Matrosen«, wiederholte der General lachend, »der als Prisenanteil den Betrag von fünfhunderttausend Francs erhält! Erlauben Sie mir zu sagen, dass Sie zumindest in finanzieller Hinsicht alles andere als ein armer Teufel sind.«
»Das erinnert mich an etwas, was ich Ihnen zu sagen vergaß, General, dass ich nämlich das Gewerbe des Korsaren nur als Liebhaberei ausübe und deshalb meine Prisenanteile auf wohltätige Zwecke zu verwenden pflege. Von meinen fünhunderttausend Francs überlasse ich meinen Kameraden vierhunderttausend; gestatten Sie mir, Ihnen die verbliebenen hunderttausend zu überantworten, damit Sie sie an notleidende Franzosen verteilen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, oder an verarmte Seemannswitwen. Gestatten Sie es?«
Und bevor der General Zeit gehabt hätte zu antworten, beugte René sich über einen Tisch, ergriff ein Blatt Papier und schrieb mit überaus aristokratischer Handschrift folgende Notiz von ziemlich aristokratischem Geist:
Monsieur Rondeau, Bankier
Rue du Gouvernement in Port Louis
Monsieur, haben Sie die Güte, auf bloßes Vorlegen dieser Zahlungsanweisung Monsieur General Decaen, Gouverneur der Île de France, den Betrag von hunderttausend Francs auszuzahlen. Er weiß, wozu das Geld zu verwenden ist.
Port Louis, 23. Juni 1805.
General Decaen nahm den Zettel und las ihn.
»Aber bevor ich von diesem Schreiben Gebrauch mache, sollte ich den Verkauf Ihrer Prise abwarten.«
»Das ist unnötig, General«, erwiderte René gelassen, »ich habe bei Monsieur Rondeau Kredit für einen Betrag in dreifacher Höhe dessen, was ich ihn an Sie auszuzahlen bitte.«
»Dann seien Sie so gut, ihn vorher benachrichtigen zu lassen.«
»Das ist nicht nötig; die Auszahlung erfolgt auf bloße Vorlage des Schreibens, und Monsieur Rondeau wurde von meinem Pariser Bankier Monsieur Perrégaux ein Doppel meiner Unterschrift übermittelt.«
»Haben Sie seit Ihrer Rückkehr Monsieur Rondeau gesehen oder ihm ihre Ankunft mitteilen lassen?«
»Ich habe nicht die Ehre, ihn zu kennen, General.«
»Würden Sie ihn gern kennenlernen?«
»Mit größtem Vergnügen, General; er gilt als äußerst liebenswürdiger Mann.«
»Das ist er. Würden Sie gerne heute mit ihm zusammen bei mir speisen?«
»General, wenn er zu Ihren Freunden zählt, wüsste ich nicht, was dagegen spräche.«
In diesem Augenblick trat Madame Decaen ein, und René erhob sich.
»Madame«, sagte der General, »darf ich Ihnen Monsieur René vorstellen, den ersten Offizier Kapitän Surcoufs, der so nobel gekämpft und dabei wahrscheinlich unserem Freund aus Saint-Malo die Freiheit und das Leben gerettet hat? Er erweist uns die Ehre, heute mit seinem Bankier Monsieur Rondeau bei uns zu speisen, auf den er mir einen Wechsel über hunderttausend Francs ausgestellt hat, die ich auf Almosen für verarmte Franzosen und Seemannswitwen verwenden soll. Dieser frommen Aufgabe werden Sie nachkommen, Madame; danken Sie Monsieur René und lassen Sie ihn Ihre Hand küssen.«
Madame Decaen reichte René voller Verblüffung die Hand; René neigte sich über die Hand, berührte sie mit der Fingerspitze und gleichzeitig mit den Lippen, trat einen Schritt zurück und verneigte sich zugleich zum Abschied.
»Aber Monsieur«, sagte der General, »Sie vergessen, dass Sie mich um etwas bitten wollten!«
»Oh«, sagte René, »nun, da ich die Ehre haben werde, Sie später am Tag wiederzusehen, gestatten Sie mir, Sie einstweilen nicht länger aufzuhalten.«
Er verneigte sich vor dem General, der vor Verblüffung sprachlos war, vor Madame Decaen, die noch verblüffter war als ihr Ehemann, und ging, während die beiden einander ratlos anblickten und in den Augen des anderen nach der Erklärung dieses befremdlichen Rätsels suchten.
General Decaen folgte René auf dem Fuß zu Surcouf, den er einlud, mit seinem ersten Offizier und dem Bankier Monsieur Rondeau bei ihm zu speisen.
Der General hatte vergessen, René die Essenszeit zu nennen: zwischen halb vier und vier Uhr nachmittags.
Kaum war General Decaen gegangen, suchte Surcouf René in seiner Kabine auf. »Was ist geschehen, lieber Freund?«, fragte er ihn. »Der Gouverneur hat mich soeben mit dir und Rondeau zum Essen eingeladen.«
»Nichts weiter ist geschehen, als dass der Gouverneur ein Mann von ausgesuchten Umgangsformen ist und weiß, welche Freude er mir damit macht, dass er dich einlädt.«
85
Die Armenkollekte
Mit militärischer Pünktlichkeit fanden sich Surcouf und René um halb vier in der Residenz des Gouverneurs ein.
René hätte lieber wenigstens eine Viertelstunde länger gewartet, doch Surcouf hatte ihm erklärt, dass der Gouverneur selbst um halb vier zu speisen pflege und auf Gäste, die nicht rechtzeitig erschienen, nicht gut zu sprechen sei.
René war der Ansicht, dass unter den gegebenen Umständen den Gästen eine gewisse Freizügigkeit eingeräumt sei, doch Surcouf war so unerbittlich, dass sie an die Tür der Gouverneursresidenz klopften, als Surcoufs Uhr halb vier anzeigte.
Die beiden Gäste wurden in den Salon geführt, wo niemand sie erwartete.
Madame Decaen beendete ihre Toilette, der General beendete seine Korrespondenz, und Monsieur Alfred Decaen war mit seinem Diener ausgeritten und noch nicht zurückgekehrt.
»Siehst du, mein lieber Surcouf«, sagte René und ergriff seinen Freund am Ellbogen, »ich war doch nicht der Hinterwäldler, für den du mich halten wolltest, und wir hätten sehr wohl noch eine Viertelstunde Zeit gehabt, bevor man uns der Unhöflichkeit gegenüber unseren Gastgebern bezichtigt hätte.«
Eine Tür wurde geöffnet, und der General trat ein. »Verzeihen Sie, meine Herren«, sagte er, »aber als vorbildlicher Mann des Schreibtischs hat Rondeau mich gebeten, bis um vier Uhr zu warten, denn zu dieser Stunde schließt er sein Büro, und in den zehn Jahren, die er seine Arbeit bei uns ausübt, war er immer der Letzte, der es verließ. Sie können nach eigenem Belieben hier auf ihn warten oder sich im Garten ergehen. Da kommt mein Sohn, der gerade vom Pferd steigt und sich umkleiden muss, bevor er sich zu Tisch begeben kann.«
Der General öffnete ein Fenster und rief: »Presto, presto! Wir erwarten dich auf der Terrasse am Meeresufer.«
Sie gingen in den Garten, wo man durch überdachte Alleen die Terrasse erreichte.
Es war ein bezaubernder Ort, der einen Blick von der Bête-à-Mille-Pieds bis zur Bucht von Grande-Rivière bot. An beiden Enden der Terrasse waren Zelte aufgebaut, das eine als Rüstkammer, mit Masken und Floretten verziert, das andere als Schützenzelt mit Schießscheiben, Puppen, Zielscheiben und allem, was man benötigt, um die kunstvollsten Schießkünste zu beweisen.
Der General und seine Gäste betraten wie zufällig die Rüstkammer.
»Hier sehen Sie sich in Ihrem Element, Monsieur René«, sagte der General, »denn Surcouf beteuerte, dass Sie nicht nur ein erstrangiger Fechter seien, sondern ein allen anderen überlegener Fechter.«
René verzog den Mund. »General«, sagte er, »mein Kommandant Surcouf bringt mir eine väterliche Zuneigung entgegen; hörten Sie auf ihn, wäre ich der hervorragendste Reiter, der kundigste Fechter und der beeindruckendste Pistolenschütze seit den Zeiten des Chevalier de Saint-Georges. Ich wagte nicht einmal zu bezweifeln, dass er alles versucht hätte, mich mit dem berühmten Mulatten zusammenzubringen, um mich über ihn triumphieren zu sehen. Leider sind die Augen eines Freundes ein verzerrendes Vergrößerungsglas, was die guten Eigenschaften betrifft, während die Untugenden bis zur Unkenntlichkeit verkleinert werden. Ich ziele wie jedermann, vielleicht etwas besser als die meisten derer, die erschossen werden, aber weiter reicht meine Überlegenheit nicht. Und was das Fechten betrifft, dürften meine Fähigkeiten einigermaßen eingerostet sein, da ich kein Florett mehr in Händen hielt, seit ich zur See fahre.«
»Weil du keinen Gegner gefunden hast, der deiner würdig gewesen wäre!«, widersprach Surcouf. »Geh mit gutem Beispiel voran!«
»Wie, Sie wollen nicht, Monsieur Surcouf?«, sagte der General. »Sie gelten doch als guter Fechter.«
»In Saint-Malo, mein General, in Saint-Malo! Und selbst dort habe ich meinen Ruf eingebüßt, als Monsieur das Florett ergriff.«
In diesem Augenblick kam Monsieur Decaens Sohn herein. »Komm her, Alfred«, sagte sein Vater, »und lass dir von Monsieur Surcouf eine Lektion erteilen. Du bildest dir ein, mit dem Degen umgehen zu können, und Monsieur Surcouf ist dafür bekannt. Nun, ich hoffe, dass er dir nun coram publico zeigen wird, was für ein Laffe du bist.«
Der junge Mann lächelte; mit der Zuversicht der Jugend holte er zwei Florette und zwei Masken, reichte ein Florett und eine Maske Surcouf und sagte: »Mein Herr, wenn Sie meinem Vater und vor allem mir den Gefallen erweisen wollten, um den er Sie bittet, wäre ich Ihnen unendlich verbunden.«
Surcouf sah sich beim Wort genommen und hatte keine andere Wahl, als die Herausforderung anzunehmen; er legte Hut und Rock ab, setzte die Maske auf, verneigte sich vor dem General und sagte: »Zu Befehl, mein General und Monsieur Alfred.«
»Meine Herren«, sagte der General und lachte, »Sie dürfen darauf rechnen, ein Duell zu erleben wie das zwischen Dares und Entellus. Oh, Monsieur Rondeau«, sagte er, »Sie kommen im rechten Augenblick! Meine Herren, ich darf Sie mit Monsieur Rondeau bekannt machen, der sich ebenfalls des Rufs eines unserer besten Schützen erfreut, denn hierzulande ist jedermann waffenkundig, sogar ein Bankier. Lieber Monsieur Rondeau, ich darf Ihnen Monsieur Surcouf vorstellen, den Sie seit Langem kennen, und Monsieur René, den Sie noch nicht kennen, der aber, wie mir scheint, geschäftliche Beziehungen mit Ihnen unterhält...«
»Oh«, sagte Monsieur Rondeau, »handelt es sich um Monsieur René de...«
»René ohne Titel«, fiel ihm René ins Wort, »was ihn nicht daran hindert, sich als zu Ihren Diensten zu erklären, wenn Sie gestatten.«
»Ich bitte Sie, Monsieur«, sagte Monsieur Rondeau, der die Daumen in die Armausschnitte seiner Weste steckte und den Bauch vorstreckte, »ich stehe zu Ihren Diensten, jedenfalls bis zum Betrag von dreihunderttausend Francs und sogar darüber hinaus.«
René verneigte sich. »Wir halten die anderen Herren auf«, sagte er. »Meine Herren, kreuzen Sie die Klingen.«
Surcouf und Monsieur Alfred Decaen gingen in Auslage, der eine so reglos wie eine Statue – es erübrigt sich zu sagen, dass dies Surcouf war -, der andere mit der Zuversicht und der Anmut der Jugend.
Trotz des unterschiedlichen Fechtstils – einerseits ernsthaft, streng, ein wenig starr, mit den einfachsten Paraden, andererseits mit immer neuen Ausfällen und Finten, mit Bein- und Handbewegungen und unnötigen Ausweichbewegungen, die Klinge abwechselnd im Terz und im Quart führend – war keiner der Kontrahenten dem anderen erkennbar überlegen.
Nach zehnminütigem Gefecht hatte der junge Mann Surcouf einmal getroffen, und Surcouf hatte ihn zweimal getroffen.
Alfred verneigte sich vor Surcouf, gab sich geschlagen und reichte das Florett dem Bankier.
Wie Monsieur Decaen gesagt hatte, war zu jener Zeit auf der Île de France jedermann waffenkundig, sogar ein Bankier. Monsieur Rondeau entledigte sich seines Überrocks, holte seine Brieftasche hervor, die er in die Hosentasche beförderte, und ging in Auslage.
Das Gefecht zwischen ihm und Surcouf war von größter Ausgewogenheit: Beide trafen den Gegner zweimal, und Surcouf nahm zuletzt die Maske ab und reichte sein Florett René.
»Mein lieber Surcouf«, sagte dieser, »du weißt, wie ungern ich vor Zuschauern fechte, besonders vor so sachkundigen Zuschauern wie diesen. Erlasse es mir, nach dir zu fechten, und erlaube mir, mich auf den Ruf zurückzuziehen, den ich dir verdanke und den ich nur demolieren würde, indem ich ihn aufrechtzuerhalten versuchte.«
»Meine Herren«, sagte Surcouf, »obwohl ich mit René so gut befreundet bin, habe ich ihn nur einmal fechten sehen, und damals gab er die gleichen Gründe an, es nicht zu tun, wie heute. Seien wir ihm also so gefällig, wie er es uns nicht sein will, und geben wir seiner Bescheidenheit nach. Zudem«, fügte er hinzu, »scheint mir, als hörte ich, dass man uns zu Tisch ruft.«
Ein Lächeln des Triumphs zeigte sich auf dem dicken Gesicht Monsieur Rondeaus, das aufblühte wie eine Pfingstrose.
»Wenn Monsieur«, sagte er, »mir nicht die Ehre erweisen will, die Klinge mit mir zu kreuzen, wollen wir es auf später verschieben.«
René verneigte sich, und Surcouf hängte Maske und Florett dort auf, wo er sie geholt hatte.
In der Tat war zum Essen gerufen worden, denn nun sah man Madame Decaen die ersten Stufen des Perrons hinunterkommen.
Die Herren begaben sich zum Haus; der Sohn Monsieur Decaens eilte wie ein Schüler, der seine Mutter seit dem Morgen nicht mehr gesehen hat, zu Madame Decaen und warf ihr die Arme um den Hals.
Man begrüßte einander, wechselte einige Artigkeiten, und als alle darauf warteten, dass der Kavalier für Madame Decaen benannt werde, sagte der General: »Monsieur René, reichen Sie Ihren Arm Madame Decaen.«
René verneigte sich, reichte Madame Deacen seinen Arm und führte sie in das Speisezimmer.
Wie üblich verlief der erste Gang unter dem ausschließlichen Geklirr von Gabeln und Löffeln auf den Tellern; dann lehnte Monsieur Rondeau sich zurück, seufzte tief und wohlig und sagte zu René: »Monsieur René, in der Pause des Theaterstücks gestern habe ich im Café de la Comédie ein Eis zu mir genommen, und da ich sah, dass Neugierige einen Mann umringten, habe ich zugehört, was dieser Mann zu erzählen hatte; offenbar war es ein Matrose, der aus Birma zurückkam. Er tischte so ungeheuerliche Lügenmärchen über seinen Kapitän auf, dass ich mir das Lachen nicht verbeißen konnte.«
»Und was hat er behauptet, Monsieur Rondeau?«, fragte René.
»Er hat behauptet, sein Kapitän hätte mit einem einzigen Hieb eines Entersäbels eine Boa zerteilt, die zwei Elefanten zu erdrücken drohte.«
»Und darüber mussten Sie lachen, Monsieur Rondeau?«
»Aber gewiss doch!«
»Ich kann Ihnen versichern, dass Sie es nicht zum Lachen gefunden hätten, wenn Sie dabei gewesen wären.«
»Halten Sie mich für einen Feigling, Monsieur René?«
»Das habe ich nicht behauptet, Monsieur, doch es gibt Dinge, deren Anblick die Tapfersten einschüchtert. Und derjenige, den Sie gestern hörten, der zwei Tigerjunge am Genick aus dem Dschungel mitgebracht hat und der wie ein Kind zu zittern begann, als er die abscheuliche Schlange erblickte – dieser Mann ist alles andere als ein Feigling, das kann ich Ihnen versichern.«
»Aber ein Scherzbold war er auf jeden Fall«, erwiderte Monsieur Rondeau, »denn er sagte, die Schlange wäre mindestens siebenundfünfzig Fuß lang gewesen.«
»Nicht er hat sie gemessen, ich war es«, erwiderte René gelassen.
»Also sind Sie sein Kapitän?«
»Ja, Monsieur, falls dieser Mann zufällig François heißt.«
»O ja, ja doch, so wurde er von den anderen genannt. Und die Schlange hat tatsächlich zwei Elefanten erdrosselt?«
»Dass sie sie erdrosselt hat, will ich nicht behaupten, aber ich weiß, dass die Knochen der Elefanten knackten, als würden sie von einem Jagdhund zerbissen, obwohl die Schlange in den letzten Zügen lag, denn ich hatte ihr bereits mit zwei Kugeln den Kopf zerschmettert.«
Madame Decaen warf ihrem Gast einen erstaunten Blick zu, und Alfred betrachtete ihn mit unverhohlener Neugier.
»Aber wenn Sie von meinem Freund René gehört haben«, sagte Surcouf, »dann haben Sie noch viel sagenhaftere Dinge zu hören bekommen. Am hiesigen Quai Chien-de-Plomb hat er sich vor den Augen aller einen Kampf mit einem Hai geliefert, der für den Hai ebenso schlecht ausging wie für die Boa.«
»Wie«, sagte Monsieur Rondeau, »Sie waren es, der den Hai entleibt hat, der den Matrosen verfolgte?«
»Ja, Monsieur, aber wie Sie wissen, ist so etwas nicht weiter schwierig; es erfordert nur ein wenig Geschick und ein scharfes Messer.«
»Der Mann hat noch eine andere Geschichte erzählt«, fuhr der wackere und ehrbare Monsieur Rondeau fort, der offenbar beschlossen hatte, sich zum Narren zu machen, koste es, was es wolle. »Er hat erzählt, sein Kapitän hätte auf einen Tiger angelegt, der zwanzig Fuß entfernt aus dem Dschungel kam, und bevor er schoss, hätte er gesagt: ›Auf Philipps rechtes Auge.‹ Ich weiß nicht mehr recht, ob es das rechte oder das linke Auge war, aber das macht nichts, denn der Matrose hatte den Sinn dieser Worte ebenso wenig verstanden wie ich.«
General Decaen brach in Gelächter aus.
»General«, sagte René, »seien Sie so gütig, Monsieur Rondeau die Geschichte des Aster zu erzählen; erzählte ich sie, liefe ich Gefahr, für einen Aufschneider gehalten zu werden.«
»Mein lieber Monsieur Rondeau«, sagte der General, »Aster war ein sehr gewandter Bogenschütze der Stadt Amphipolis, der von Philipp schlecht behandelt wurde; er verließ seine Heimat und ließ sich in Methone nieder, das bald darauf von Philipp belagert wurde. Aster aber wollte sich an Philipp rächen, und da er wollte, dass Philipp davon erfuhr, schrieb er auf einen Pfeil: ›Von Aster auf Philipps rechtes Auge.‹ In der Tat verlor Philipp nicht nur sein rechtes Auge, sondern dachte gar, er müsse an der Verletzung sterben. Und er ließ einen Pfeil in die Stadt schicken, auf dem stand: ›Wenn Methone fällt, wird Aster gehängt.‹ Der makedonische König nahm Methone ein und hielt sein Wort. Das ist die Geschichte, Monsieur Rondeau, und ich versichere Ihnen, dass sie zumindest historisch verbürgt ist.«
»Teufel auch, Teufel auch! Aber so eine Geschicklichkeit kann sich mit der Ihrigen messen, Monsieur René!«
»Ich sehe schon, Monsieur Rondeau«, sagte René, »dass Sie nicht lockerlassen und sich mit meiner Weigerung zu fechten nicht abfinden wollen. Nach dem Essen stehe ich zu Ihrer Verfügung, und wenn Sie sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklären, will ich Ihnen mein Wort geben, dass Ihnen der Waffengang früher lästig fallen wird als mir.«
Von diesem Augenblick an unterhielt man sich wieder über andere Gegenstände; doch Madame Decaen und Alfred, die begierig darauf waren, Rondeau unterliegen zu sehen, beeilten sich, das Gespräch zu beenden, und schlugen vor, Café und Digestif in der Rüstkammer servieren zu lassen.
Man begab sich dorthin, und Monsieur Rondeau, dessen Bauch sich stärker zu runden begann, als seine Eitelkeit gutheißen konnte, trat voller Selbstvertrauen als einer der Ersten in den Raum.
»Was schlagen Sie vor, Monsieur René?«, fragte der General.
»Sagten Sie mir nicht, General, dass Madame Decaen die Schutzherrin der Armen sei?«, fragte René und verbeugte sich bei diesen Worten vor Madame Decaen. »Ich schlage deshalb vor, dass Monsieur Rondeau und ich jedes Mal, wenn einer von uns fünfmal getroffen wird, ohne zu parieren, tausend Francs bezahlen.«
»Oho!«, sagte Monsieur Rondeau und lachte unmäßig, »diese Wette kann ich halten.«
Monsieur Rondeau ergriff ein Florett, rieb die Klinge an seiner Schuhsohle, fuhr damit durch die Luft, bog sie, und da die Waffe ihm offenbar zusagte, ging er in Auslage.
René ergriff die erstbeste Waffe, salutierte und ging ebenfalls in Auslage. »Bitte sehr, Monsieur«, sagte er.
Monseur Rondeau führte schnell hintereinander drei Hiebe, die sein gutes Augenmerk und seine sichere Hand bewiesen, doch alle drei Hiebe parierte René mühelos.
»Nun bin ich an der Reihe«, sagte René.
Die Kombattanten gingen wieder in Auslage, und diesmal fielen die Hiebe wie drei Blitze.
»Eins, zwei, drei«, zählte René laut mit.
Jeder der Hiebe hatte Monsieur Rondeau touchiert.
René wendete sich zu den Zuschauern um, die einstimmig riefen: »Drei Treffer!«
»Nun wieder Sie, Monsieur«, sagte René, »doch ich sage Ihnen im Voraus, dass ich Paraden und Riposten nur mit geraden Stößen führen werde; ich sage es im Voraus, damit Sie mich nicht für raffinierter oder kundiger halten, als ich bin, und Sie sich nicht mit Ihren Paraden verkünsteln.«
Monsieur Rondeau verbiss sich ein Lächeln und sagte: »Ich bin bereit, Monsieur.«
In der Tat führte er zwei Hiebe, die René wie vorausgesagt mit zwei geraden Stößen als Riposten erwiderte.
Die zweite Riposte war unbestreitbar erfolgt, denn das Florett war an der Brust des Bankiers zerbrochen.
»Madame«, sagte René, der sich vor Madame Decaen verneigte, »Monsieur schuldet Ihnen tausend Francs für die Armen.«
»Ich bestehe auf meiner Revanche«, sagte Monsieur Rondeau.
»Mit Vergnügen«, erwiderte René. »Gehen wir in Auslage.«
»O nein, nicht mit dem Florett! Mit dem Florett sind Sie mir haushoch überlegen; versuchen wir es mit Pistolen.«
Alfred holte sogleich Pistolen herbei.
»Wir schießen mit jeder Pistole nur einmal, nicht wahr?«, sagte René zu Monsieur Rondeau. »Nicht dass man in Port-Louis denkt, die Insel würde belagert.«
»Einverstanden«, sagte Monsieur Rondeau. »Worauf wollen wir zielen?«
»Warten Sie«, sagte René, »das ist ganz einfach.«
Und ohne sich die Mühe zu machen zu zielen, ergriff er eine der Pistolen, feuerte und schoss die Kugel in den Stamm einer etwa fünfundzwanzig Schritt entfernten Palme.
»Sehen Sie das Einschussloch?«, fragte er Monsieur Rondeau.
»O ja, ganz deutlich«, erwiderte dieser und griff zu einer Pistole.
»Die Kugel, die dem Loch am nächsten kommt, hat gewonnen«, sagte René.
»Einverstanden«, sagte Monsieur Rondeau.
Er zielte so sorgfältig, dass man merkte, wie ernst er seine Revanche nahm, und seine Kugel traf den Baumstamm einen Fingerbreit neben der ersten Kugel.
»Ha!«, sagte der Schütze und wiegte sich in den Hüften, »gar nicht so übel für den Schuss eines Bankiers.«
René ergriff ebenfalls eine Pistole, zielte und schoss.
»Sehen Sie nach, meine Herren, und entscheiden Sie, wer am besten getroffen hat.«
General Decaen, Surcouf, Alfred und selbstverständlich Monsieur Rondeau liefen voller Neugier zu dem Baum, der als Zielscheibe gedient hatte.
»Ha, meiner Treu!«, rief Monsieur Rondeau. »Entweder sehe ich nicht richtig, oder Sie haben nicht einmal den Baum getroffen!«
»Sie sehen nicht richtig, Monsieur«, antwortete René.
»Wie das? Ich sehe nicht richtig?«, fragte Monsieur Rondeau.
»Ja, denn Sie suchen an der falschen Stelle. Sehen Sie im ersten Einschussloch nach.«
»Und dann?«, fragte Monsieur Rondeau.
»Da finden Sie eine Kugel.«
»So ist es.«
»Holen Sie sie heraus.«
»Hier ist sie.«
»Jetzt fassen Sie noch einmal hinein.«
»Wieso soll ich noch einmal hineinfassen?«
»Tun Sie es einfach.«
Monsieur Rondeau suchte und erstarrte vor Verblüffung.
»Sind Sie auf eine zweite Kugel gestoßen?«, fragte René.
»So ist es, Monsieur!«
»Richtig! Ich habe die zweite Kugel auf die erste gefeuert, denn näher als in dasselbe Loch konnte ich sie nicht schießen.«
Schweigen trat ein; sogar Surcouf musste diese schier unglaubliche Gewandtheit bestaunen.
»Wünschen Sie eine dritte Revanche mit dem Gewehr, Monsieur Rondeau?«, fragte René.
»Ha, meiner Treu, nein!«, erwiderte dieser.
»Dabei wollte ich Ihnen etwas ganz Einfaches vorschlagen.«
»Und was wäre das?«
»Eine der Fledermäuse, die über uns fliegen, mit dem Gewehr zu erlegen.«
»Sie schießen mit dem Gewehr auf Fledermäuse?«, fragte Monsieur Rondeau.
»Warum nicht?«, erwiderte René. »Ich schieße ja auch mit der Pistole auf sie.«
Und mit diesen Worten nahm er die vierte, noch nicht abgeschossene Pistole und holte eine Fledermaus aus der Luft, deren Pech sie in die Nähe der Rüstkammer geführt hatte.
Auch an diesem Abend kam René nicht dazu, dem Gouverneur der Île de France zu sagen, um welchen Gefallen er ihn bitten wollte.
86
Aufbruch
Am Tag darauf fand René sich um elf Uhr vormittags zum dritten Mal im Regierungspalast ein.
Diesmal wurde er nicht als Gast willkommen geheißen, sondern als Freund. Renés offenes, ungekünsteltes und großzügiges Wesen hatte den Gouverneur der Insel für ihn eingenommen, und nun kam ihm Monsieur Decaen mit ausgebreiteten Armen entgegen und befahl den Türstehern, niemanden vorzulassen.
»Diesmal wird man uns nicht stören, lieber Monsieur René; ich habe nicht vergessen, dass ich Ihnen einen Gefallen schuldig bin, der meine Dankesschuld mindern wird. Was wünschen Sie von mir?«
»Ich sagte es Ihnen bereits, General, ich wünsche mir eine Gelegenheit, ums Leben zu kommen.«
»Mein lieber Monsieur René«, sagte der General schulterzuckend, »kommen Sie wieder auf diesen Scherz zurück?«
»Ich scherze nicht im Geringsten«, sagte René, »sondern ich bin des Lebens so überdrüssig, wie man es nur sein kann; wäre ich verrückt oder verdrießlich genug, würde ich mir eine Kugel in den Kopf schießen, aber das wäre der lächerliche Tod eines Umnachteten, der niemandem etwas nützen würde. Stürbe ich dagegen für Frankreich, wäre mein Tod nützlich und ruhmvoll, und ich wäre ein Held. Machen Sie mich zum Helden, mein General, es wird nicht weiter schwierig sein.«
»Was brauchen Sie dafür?«
»Zuallererst brauche ich die letzten Neuigkeiten aus Frankreich. Ich habe von einer Koalition gegen Frankreich gehört. In Kalkutta war dies das Tagesgespräch. Wissen Sie, wie es in dieser Sache steht, und können Sie mir mehr darüber mitteilen?«
»Ich dachte, wir wären immer noch in Boulogne und damit beschäftigt, Flachboote zu bauen und durch den Nebel des Ärmelkanals London zu observieren.«
»Aber dass es Krieg geben wird, glauben Sie, General, oder?«
»Mehr als das, ich bin fest davon überzeugt.«
»Sehr gut! Und nicht ich preise mich Ihnen an, General, sondern mein Lob wird von Freunden gesungen, fast dürfte ich sagen, sogar von Feinden. Können Sie sich vorstellen, dass jemand wie ich, der weder Gott noch Teufel fürchtet, der vier Sprachen spricht, der bereit ist, auf Anweisung Wasser oder Feuer zu durchqueren, unserem Land von Nutzen sein kann?«
»Ob ich mir das vorstellen kann? Zum Henker, davon bin ich felsenfest überzeugt! Und wenn das meine Hilfe dabei sein soll, dass Sie sich um Ihr Leben bringen, dann verfügen Sie über mich.«
»Bliebe ich mit meiner Slup mit zwölf Kanonen hier, wäre ich von keinerlei Nutzen; ich stürbe unbekannt und unnütz, wie ich vorhin sagte. Fände ich aber Gelegenheit, die Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, einzusetzen, dann könnte ich mir einen Namen machen, es zu etwas bringen und das Ziel erreichen, das Gegenstand all meines Bestrebens ist.«
»Nun gut, und wie kann ich Ihnen dabei helfen?«, fragte der Gouverneur.
»Sie können Folgendes tun: Sie können schriftlich festhalten, dass das Gute, das Sie über mich gehört haben, der Ruf der Tapferkeit, den ich mir in Indien erworben habe, Sie veranlassen, mich nach Frankreich zu schicken und mich zu empfehlen...«
»Dem Minister?«, unterbrach ihn der General.
»O nein! Auf gar keinen Fall, nein, im Gegenteil: dem Kapitän des erstbesten Kriegsschiffs, dem ich begegnen werde. Mit einer solchen Empfehlung von Ihnen wird jeder Kapitän mich freudig als Offizier an Bord nehmen. Auf diesen Rang habe ich ein Recht, denn unter Surcouf habe ich als erster Offizier kommandiert, und ich habe als Kapitän einer Kriegsslup die Fahrt nach Indien unternommen. Ich weiß wohl, dass mein Schiff nicht allzu groß ist, doch wenn mir mit einer Slup gelungen ist, was man mit einer Brigg bewerkstelligt, dann beweist das, dass ich mit einer Brigg leisten kann, was man mit einer Korvette vermag, und mit einer Korvette, was man mit einem Linienschiff vermag.«
»Das, worum Sie mich bitten, ist allzu unerheblich, mein lieber René«, sagte der General. »Ich würde gern etwas mehr für Sie tun. Zuerst werde ich Ihnen Ordre erteilen, nach Europa zurückzukehren, weil Sie dort Frankreich zu Diensten sein können, und ich werde Ihnen Empfehlungsschreiben für drei Kapitäne von Linienschiffen mitgeben, die gute Freunde von mir sind: Lucas, Kommandeur der Redoutable, Cosmao, Kommandeur der Pluton, und Infernet, Kommandant der Intrépide. Wo immer Sie ihnen begegnen werden, können Sie an Bord gehen und sich darauf verlassen, zehn Minuten später Ihren Platz in der Offiziermesse zugewiesen zu bekommen. Kann ich noch etwas anderes für Sie tun?«
»Ich danke Ihnen; indem Sie tun, was Sie sagten, machen Sie mich überglücklich.«
»Wie wollen Sie nach Frankreich zurückgelangen?«
»Dafür brauche ich keine Hilfe, mein General; die kleine Slup, die ich befehlige und die es mit dem schnellsten englischen Segelschiff aufnehmen kann, ist mein Eigentum; sie fährt unter amerikanischer, also neutraler Flagge. Ich spreche zu gut Englisch, um mich als Amerikaner ausgeben zu können, doch das würde nur einem Amerikaner auffallen. Ich werde in den nächsten Tagen aufbrechen und meinen Anteil an der Prise den achtzehn Männern hinterlassen, die mich nach Birma begleitet haben. Sie werden das Geld entgegennehmen, und sobald die Männer zur Île de France zurückkehren, einzeln oder zusammen, werden sie von ihnen ausbezahlt. Ein Einziger soll mehr erhalten, als ihm zusteht, nämlich François, der mit mir in Pegu war; er soll das Doppelte seines Anteils bekommen.«
»Sie werden uns zum Abschied besuchen, nicht wahr, Monsieur René?«
»General, diese Ehre werde ich haben, wenn ich Ihnen eigenhändig die Aufstellung dessen überbringen werde, wie viel jedem meiner Männer zusteht. Ich würde es mir nie verzeihen, abzureisen, ohne Madame Decaen meine Aufwartung gemacht und Monsieur Alfred meiner Freundschaft versichert zu haben.«
»Wollen Sie sie nicht gleich sehen?«, fragte der General.
»Ich will sie nicht stören«, erwiderte René.
Er verbeugte sich vor dem Gouverneur und ging.
Als René auf seinem Schiff ankam, erwartete ihn dort der Bankier Rondeau. Trotz aller Ungemach, die ihm am Vortag widerfahren war, hatte er nicht vergessen, dass es sein Gewerbe war, Geld zu verdienen, und er wollte René bitten, ihm seinen Prisenanteil zu verkaufen, was René ermöglichen würde, seine Mannschaft auszuzahlen, bevor er Port-Louis verließ.
René begriff, dass dies in der Tat weitaus bequemer wäre, als Männer mitzunehmen, die nach Port-Louis zurückkehren mussten, um ihren Anteil aus dem Verkauf der Prise und den Anteil, den ihnen ihr Kapitän zusätzlich schenkte, abzuholen.
René und Monsieur Rondeau vereinbarten, dass der Mannschaft ihre fünfhunderttausend Francs Prisengeld ausbezahlt würden und dass die vierhunderttausend Francs, die nach Abzug der hunderttausend Francs für die Armen blieben, unter Renés achtzehn Begleitern aufgeteilt würden, wobei François einen doppelten Anteil erhalten würde.
Monsieur Rondeau bot an, die Million unverzüglich zu bezahlen und einen Diskont von zwanzigtausend Francs zu berechnen.
René war einverstanden, gab dem Bankier eine Quittung über zwanzigtausend der dreihunderttausend Francs seines Guthabens bei ihm und ließ Madame Decaen auf der Stelle die hunderttausend Francs für die Armen überbringen, während er es Rondeau überließ, seine zweitausend Francs Wettschulden nach eigenem Ermessen zu begleichen; dann verabredete er sich mit seinen Männern für den nächsten Tag.
Am nächsten Tag fanden sich seine achtzehn Männer zur Mittagsstunde bei ihm ein.
Als Erstes erklärte René, er wolle ihnen im Voraus und vor Verkauf der Prise ihren auf fünfhunderttausend Francs geschätzten Anteil ausbezahlen. Dann fügte er hinzu, dass er hunderttausend Francs aus seinem eigenen Prisenanteil dem Gouverneur überlasse, der sie an invalide Seemänner, Witwen und Waisen verteilen werde; und unter dem Staunen und der Bewunderung, die sich in Freudenrufen Luft machten, deren Aufrichtigkeit unstreitig war, sagte er als Drittes, dass er seinen Kameraden zum Dank für ihre Treue und ihre Aufopferung die restlichen vierhunderttausend Francs überlasse und lediglich einen doppelten Anteil für François vorgesehen habe, der ihn zum Land des Betels begleitet hatte und dort mit ihm geblieben war.
Dann verkündete er, sie würden am übernächsten Tag mit ihm nach Frankreich aufbrechen, und forderte sie auf, ihren Ehefrauen so viel Geld wie möglich mitzubringen, was ein Leichtes sei, da jeder von ihnen mehr als sechzigtausend Francs besitze, wenn man die vorhergehenden Prisen einrechnete.
Sie alle hatten ihren Anteil erhalten, in französischem Gold oder in englischen Banknoten, und sie verließen René, beide Hände auf die Hosentaschen gedrückt, als fürchteten sie, ihr Gold oder ihr Papiergeld sei aus unerklärlichen Gründen in der Lage, sich aus eigenem Willen auf und davon zu machen.
Die Ankunft der Runner of New York war unauffällig gewesen, doch der Aufbruch ihrer Besatzung war ein ohrenbetäubendes Spektakel. Mit sechzigtausend Francs in der Tasche nach Hause zurückzufahren unter neutraler Flagge, was die Hoffnung erlaubte, den Heimathafen zu erreichen, ohne mit größeren Gefahren rechnen zu müssen als solchen, wie sie Wasser und Wetter den Seeleuten bereiten: Ein so unerhörtes Glück konnte nur mit den lärmendsten Freudenbezeigungen gewürdigt werden, und das wurde es.
Die Lawine, die sich von der Place du Théâtre zum Meer wälzte, lieferte noch Jahre später Gesprächsstoff in Port-Louis, und nicht wenige Ereignisse wurden auf den Tag datiert, an dem die Mannschaft der Runner of New York ihre Anteile ausbezahlt bekommen hatte.
Wie angekündigt fand René sich am übernächsten Tag im Regierungspalast ein, wo er sich mit ungeheucheltem Schmerz von der vortrefflichen Familie des Generals verabschiedete, die ihn wie ein Kind des Hauses aufgenommen hatte und hinter seiner makellosen Vornehmheit und dem schlichten Namen René ein verborgenes Geheimnis erahnt hatte, das René nicht enthüllen durfte, das jedoch tatsächlich bestand.
Dem Sohn des Hauses brachte René als Geschenk seine zweiläufigen Pistolen mit; er bat ihn, sie als Andenken anzunehmen, und demonstrierte dem jungen Mann die Treffsicherheit der Pistolen, indem er vier Kugeln abschoss, die auf zwanzig Fuß Entfernung von einer Messerklinge gespalten wurden.
Die Empfehlungsschreiben des Gouverneurs waren vorbereitet; als Lob übertrafen sie alles, was René sich hätte erhoffen können. General Decaen erteilte darin den Befehl – soweit es ihm zustand, denn als Gouverneur in Indien hatte er ein gewisses Mitspracherecht in Marineangelegenheiten -, den jungen Kapitän der Runner of New York auf dem ersten Kriegsschiff, dem er begegnete, als Offizier aufzunehmen.
Der Gouverneur erkundigte sich, wann der Anker gelichtet werden solle, und versprach, an den Quai zu kommen, um dort Abschied von der Mannschaft und dem Kapitän der Slup zu nehmen.
Der Anker sollte um Punkt drei Uhr gelichtet werden. Seit der Mittagsstunde drängten sich die Neugierigen auf dem Quai Chien-de-Plomb.
René hatte seinen Matrosen nicht befohlen, um zwei Uhr an Bord zu sein, sondern er hatte sie darum gebeten; er hatte hinzugefügt, er werde sich erkenntlich zeigen, wenn sie sich klaren Kopfes und kalten Blutes einfänden, so dass sie alle Manöver tadellos ausführen konnten. Er hatte den Ehrgeiz, das in keinem Seehafen der Welt je gesehene Schauspiel einer Schiffsbesatzung zu bieten, deren Mitglieder sechzigtausend Francs pro Mann mit sich führten, ohne dass ein einziger Betrunkener darunter war. Was er mit dem strengsten Befehl nicht erreicht hätte, erlangte er mit seiner freundschaftlichen Bitte.
René hatte seine Männer wissen lassen, welche Ehre ihnen der Gouverneur erwies, indem er ihrer Abfahrt beiwohnte, und sie hatten, ohne René einzuweihen, sechs Schleppkähne bestellt, die neben den Rudergängern Banner und Musikanten enthielten.
Der Gouverneur ließ seine Schaluppe an Renés Schiff anlegen, und als im Augenblick des Aufbruchs an Bord eine Salve abgefeuert wurde und die Kapelle den »Chant du départ« anstimmte, wurden auf ein Zeichen des Gouverneurs als Antwort auf die Salve vom Fort Blanc aus sechzehn Kanonenschüsse abgefeuert; dann glitt das Schiff langsam die Fahrrinne entlang, bis es nach einer Viertelmeile Segel setzen konnte; nun wurde aufgefiert, und das Boot des Gouverneurs legte an und nahm die Familie des Generals Decaen in Empfang, die es zum Quai Chien-de-Plomb zurückbrachte, begleitet von den sechs Kähnen mit Musikern.
Die Runner of New York nahm Kurs nach Süden und verschwand bald darauf in den ersten Abendnebeln.
87
Was sich unterdessen in Europa ereignete
Nun dürfte es allmählich an der Zeit sein, unsere Leser mit den Ereignissen vertraut zu machen, die sich unterdessen in Europa abspielten und von denen der Gouverneur René nichts hatte erzählen können, da er auf seiner abgelegenen Insel nichts davon gehört hatte.
Wir erinnern uns, wie wir Napoleon verlassen haben.
Nach dem Sieg an den Pyramiden, der Ägypten das Staunen gelehrt hatte, nach dem Sieg von Marengo, mit dem er Italien unterworfen, Deutschland in Schrecken versetzt, Spanien an seinen kaiserlichen Umhang geheftet und Holland dem französischen Kaiserreich einverleibt hatte, war es Napoleons Trachten gewesen, die Träume eines alles umfassenden Reiches, die vor Akko zunichtegeworden waren, in Sichtweite der Klippen von Dover zu verwirklichen, ohne zu ahnen, dass der Mann, der die französische Flotte bei Abukir vernichtend geschlagen hatte, auch am Ärmelkanal die Pläne durchkreuzen sollte, die er zuvor an der syrischen Küste durchkreuzt hatte; dieser Mann war Nelson.
Es dürfte an der Zeit sein, unseren Lesern diesen sonderbaren Günstling des Schicksals in seinem wahren Licht zu zeigen, diesen Mann, dessen brutale Siege ihn für einen Augenblick auf gleiche Höhe mit dem Genius jenes Mannes brachten, den zu bekämpfen seine Bestimmung war.
Diesem Mann war nur die Lebensspanne zugemessen, die ihm erlaubte, seine Aufgabe zu erfüllen und England vor einer der größten Gefahren zu retten, die diesem Land seit den Tagen Wilhelms des Eroberers gedroht hatten.
Schildern wir den Menschen Nelson, und schildern wir, welche Verkettung von Ereignissen bewirkte, dass er kurzzeitig in der modernen Welt den Platz usurpieren konnte, den in der Antike ein Pompejus einem Julius Cäsar abgetrotzt hatte.
Nelson hatte am 20. September 1758 das Licht der Welt erblickt. Zu dem Zeitpunkt, den wir mittlerweile erreicht haben, war er folglich siebenundvierzig Jahre alt.
Sein Geburtsort war das Dorf Burnham Thorpe in der Grafschaft Norfolk; sein Vater war der Dorfpfarrer, seine Mutter starb jung und hinterließ elf Kinder. Ein Onkel Nelsons, der in der Marine diente, war mit dem Hause Walpole verwandt, und er nahm ihn als Seekadetten auf seinem Kriegsschiff Redoutable mit vierundsechzig Kanonen in Dienst. Merkwürdig am Leben dieses Mannes, an dem so vieles merkwürdig ist, deucht uns der Umstand, dass er an einer Kugel starb, die von einem französischen Kriegsschiff aus abgefeuert wurde, das den gleichen Namen trug wie sein erstes Schiff und das wie dieses mit vierundsechzig Kanonen bestückt war.
Die erste Fahrt Nelsons ging zum Pol, wo das Schiff, auf dem er sich befand, sechs Monate lang im Eis gefangen war. Während einer seiner Erkundungen der Umgebung traf er auf einen Eisbären, mit dem er sich einen Kampf auf Leben und Tod lieferte. Das Untier hätte ihn zwischen seinen Pfoten erdrückt, wäre nicht einer seiner Kameraden Zeuge dieses ungleichen Kampfes geworden und ihm zu Hilfe geeilt; der Kamerad steckte dem Tier sein Gewehr ins Ohr und drückte ab, so dass der Bär tot umfiel.
Nelson überquerte den Äquator, verirrte sich in einem peruanischen Urwald, schlief am Fuß eines Baums ein, wurde von einer Giftschlange gebissen, wäre an diesem Biss fast gestorben und behielt davon sein Leben lang fahle Flecken am Körper zurück, die dem Muster der Schlange ähnelten.
In Kanada begegnete er seiner ersten Liebe und wollte seine erste große Torheit begehen.
Um die Frau, die er liebte, nicht zu verlassen, wollte er als Fregattenkapitän demissionieren. Seine Offiziere überwältigten sie ihn und fesselten ihn wie einen Übeltäter oder Wahnsinnigen; dann brachten sie ihn auf einem Pferd zu seinem Schiff, wo sie ihm erst mitten auf dem Ozean die Freiheit wiedergaben.
Angenommen, Nelson hätte seinen Dienst quittiert und die Demission wäre angenommen worden: Dann hätte Bonaparte Akko eingenommen, es hätte kein Akko und kein Trafalgar gegeben; unsere Marine wäre nicht vom Übergewicht der englischen Marine erdrückt worden, sondern hätte siegreich gegen sie gekämpft, und wir hätten uns aufgemacht, uns die Welt zu unterwerfen, wovon uns nur der Arm dieses einen Mannes abgehalten hat.
Als Nelson nach London zurückkehrte, heiratete er eine junge Witwe namens Mrs. Nisbett; er liebte sie mit der Leidenschaft, die in seiner Seele schnell und heftig entflammte, und als er wieder in See stach, nahm er ihren Sohn Joshua aus erster Ehe mit.
Als Toulon den Engländern ausgeliefert wurde, war Horatio Nelson Kapitän der Agamemnon; er wurde mit seinem Schiff nach Neapel entsandt, um König Ferdinand und Königin Caroline die Einnahme unseres wichtigsten Marinehafens zu melden.
Sir William Hamilton lernte ihn am Königshof kennen, nahm ihn mit nach Hause, ließ ihn im Salon warten, ging zu seiner Frau und sagte: »Mylady, ich bringe Ihnen einen kleinen Mann mit, der sich keiner Schönheit rühmen kann, doch ich müsste mich sehr täuschen, wenn er nicht eines Tages Englands größter Held und der Schrecken all seiner Feinde sein wird.«
»Und wie können Sie das wissen?«, fragte Lady Hamilton.
»Das errate ich aus den wenigen Worten, die wir getauscht haben. Er wartet im Salon, gehen Sie zu ihm und heißen Sie ihn willkommen, meine Teure; ich habe noch nie einen englischen Offizier in meinem Haus zu Gast gehabt, aber ich will nicht, dass er anderswo logiert als in meinem Haus.«
Und Nelson wohnte in der englischen Botschaft, die an der Ecke zwischen dem Fluss und der Via de Chiaia liegt.
Das ereignete sich im Jahr 1793. Nelson war damals ein Mann von vierunddreißig Jahren, schmächtig, wie Sir William gesagt hatte, mit bleichem Teint und blauen Augen und mit jener Adlernase, durch die sich der geborene Krieger auszeichnet und die Cäsar und dem großen Condé das Aussehen eines Raubvogels verleiht, und mit dem kräftigen Kinn, das Hartnäckigkeit verrät, die bis zum Starrsinn reichen kann. Haare und Bart waren von mattem Blond, schütter und ungleichmäßig verteilt.
Nichts lässt vermuten, dass Lady Hamilton bei dieser ersten Begegnung Nelsons Äußeres anders beurteilt hätte als ihr Ehemann; die überwältigende Schönheit der Botschaftergattin allerdings tat ihre Wirkung. Nelson verließ Neapel mit der Verstärkung, die am Hof beider Sizilien zu erbitten seine Aufgabe gewesen war, und bis zur Besinnungslosigkeit in Lady Hamilton verliebt.
Diese Liebe gereichte Nelson zur Schande.
Emma Lyon hatte zu jener Zeit bereits das letzte Schamgefühl verloren.
Suchte Nelson den Tod bei der Einnahme von Calvi, bei der er ein Auge verlor, oder bei der Expedition nach Teneriffa, bei der er einen Arm verlor, um sich von dieser Liebe zu befreien? Tat er es aus Ehrgeiz? Oder aus Ruhmsucht? Wir wissen es nicht; doch bei beiden Anlässen setzte er sein Leben so kaltblütig aufs Spiel, dass man nicht umhinkommt zu denken, er habe nicht sonderlich daran gehangen.
Am 16. Juni 1798 kam er zum zweiten Mal nach Neapel und fand sich zum zweiten Mal in Gegenwart Lady Hamiltons wieder.
Für Nelson war es ein kritischer Zeitpunkt: Er hatte den Auftrag, die französische Flotte im Hafen von Toulon zu blockieren und kein Schiff entrinnen zu lassen, und er hatte mit ansehen müssen, wie ihm diese Flotte entkommen war und Malta erobert hatte, bevor sie in Alexandria dreißigtausend Mann an Land gebracht hatte.
Doch das war noch nicht alles: Nelsons Geschwader war von einem Sturm gebeutelt worden, sein Schiff war in Seenot geraten, es hatte ihm an Wasser und an Lebensmitteln gemangelt, und es war völlig ausgeschlossen gewesen, die Franzosen weiter zu verfolgen; vielmehr hatte das Geschwader in Gibraltar Zuflucht suchen müssen, um die notwendigsten Ausbesserungsarbeiten durchzuführen und sich mit Proviant zu versorgen.
Nelson war so gut wie verloren: Einen Mann, der seit einem Monat im Mittelmeer – anders gesagt, in einem etwas größeren Teich – auf der Suche nach einer Flotte von dreizehn Kriegsschiffen und siebenundachtzig Transportschiffen war, der er sich nicht nur nicht an die Fersen heften konnte, sondern von der er bislang nicht die geringste Spur entdeckt hatte, konnte man mit Fug und Recht für einen Verräter halten; nun musste er den Hof der Könige beider Sizilien dazu bewegen, ihm zu erlauben, in den Häfen von Messina und Syrakus Proviant und in Kalabrien Holz an Bord zu nehmen, um die zerbrochenen Masten und Rahen zu ersetzen. Die Könige Neapels und beider Sizilien hatten jedoch einen Friedensvertrag mit Frankreich unterzeichnet, und dieser Vertrag erlegte ihnen strikteste Neutralität auf; Nelsons Bitte zu erfüllen hätte geheißen, gegen diese Neutralität zu verstoßen und den Vertrag zu brechen.
Ferdinand und Caroline verabscheuten die Franzosen jedoch so abgrundtief und hatten ihnen so unerbittlichen Hass geschworen, dass sie in ihrer Unbesonnenheit Nelson alles gewährten, was er verlangte; in dem Wissen, dass nur ein glanzvoller Sieg ihn retten konnte, verließ Nelson Neapel, verliebter denn je zuvor, verrückter denn je zuvor, besinnungsloser denn je zuvor und mit dem Schwur, zu siegen oder sein Leben zu verlieren.
Er siegte und hätte beinahe sein Leben verloren.
Kein Seegefecht seit der Erfindung des Pulvers und der Verwendung von Kanonen hatte die Meere zum Schauplatz einer ähnlich verheerenden Niederlage gemacht.
Von den dreizehn Kriegsschiffen der französischen Flotte waren nur zwei den Flammen und dem Feind entkommen.
Ein Schiff, die Orient, war explodiert; ein anderes Kriegsschiff und eine Fregatte waren gesunken, und neun Schiffe waren gekapert worden. Nelson hatte sich als wahrer Held erwiesen: Während des ganzen Gefechts hatte er den Tod gesucht, doch der Tod hatte ihn verschmäht; dennoch hatte er eine schwere Verletzung davongetragen: Eine Kanonenkugel, abgefeuert von der untergehenden Guillaume Tell, hatte eine Rahe der Vanguard zerschmettert, und die zerschmetterte Rahe hatte Nelson an der Stirn getroffen, als er den Kopf hob, um zu sehen, was der Grund für das schreckliche Krachen war, das er vernahm; das zersplitterte Holz hatte ihn gewissermaßen skalpiert und ihm die Stirnhaut über das gesunde Auge geschoben, worauf er unter dem Gewicht der Rahe wie ein zu Tode getroffener Stier in seinem Blut auf Deck gestürzt war.
Nelson wähnte sich tödlich getroffen und ließ den Schiffskaplan rufen, um die letzte Ölung zu empfangen und dem Kaplan die letzten Worte an seine Familie zu sagen; mit dem Priester kam jedoch der Arzt, der Nelsons Kopf untersuchte, befand, dass der Schädel unverletzt war, die Haut an ihre Stelle zurückbeförderte und ihn mit einer schwarzen Binde verband. Nelson ergriff das Sprachrohr, das seiner Hand entglitten war, und machte sich mit dem Ruf: »Feuer!« wieder an sein Vernichtungswerk.
Der Hass dieses Mannes auf Frankreich war von der Kraft eines Titanen beseelt.
Am 2. August um acht Uhr abends waren von der französischen Flotte nur noch zwei Schiffe übrig, die sich nach Malta flüchteten.
Ein Schnellsegler brachte dem Hof in Sizilien und der englischen Admiralität die Nachricht von Nelsons Sieg und von der Vernichtung unserer Flotte.
Ganz Europa brach in Jubel aus, der bis nach Asien tönte – so verhasst waren die Franzosen, so großer Abscheu wurde der Französischen Revolution entgegengebracht.
Insbesondere am Hof von Neapel gab man sich einem wahren Freudentaumel hin, nachdem man vor Angst schier von Sinnen gewesen war.
Wie man sich denken kann, war Lady Hamilton die Empfängerin des Briefs, in dem Nelson seinen Sieg verkündete, einen Sieg, der dreißigtausend Franzosen, darunter Bonaparte, in Ägypten festsetzte.
Bonaparte, der Mann von Toulon, der Mann des 13. Vendémiaire, der Mann von Montenotte, von Dego, von Arcole und Rivoli, der Bezwinger Beaulieus, Wurmsers, Alvinczys und Erzherzog Karls, der Schlachtengewinner, der in kaum zwei Jahren mehr als hundertfünfzigtausend Gefangene gemacht hatte, hundertsiebzig Fahnen erobert, fünfhundertfünfzig großkalibrige Kanonen, sechshundert Feldgeschütze und fünf Pontoniereinheiten erbeutet hatte, dieser Mann voller Ehrgeiz, der Europa mit einem Maulwurfshügel verglichen und behauptet hatte, große Reiche und große Revolutionen habe es nur im Orient gegeben, der abenteuerlustige Hauptmann, der als Neunundzwanzigjähriger bereits berühmter war als Hannibal oder Scipio und Ägypten erobern wollte, um nicht hinter Alexander oder Cäsar zurückzustehen – dieser Mann sieht sich ausgesondert, weggeschoben, von der Liste der Kombattanten gestrichen; in dem großen Kriegsspiel ist er mit einem Mal auf einen vom Glück begünstigteren oder geschickteren Gegenspieler gestoßen. Auf dem gewaltigen Schachbrett des Nils mit Obelisken als Bauern, Sphinxen als Springern, Pyramiden als Türmen, wo die Narren Kambyses heißen, die Könige Sesostris und die Königinnen Kleopatra, wurde er schach und schachmatt gesetzt!
Man kann den Schrecken, den die vereinten Namen Frankreichs und Bonapartes den europäischen Herrschern in die Glieder jagten, auf kuriose Weise an den Geschenken ermessen, die Nelson von diesen Herrschern erhielt, von Herrschern, die vor Freude außer sich gerieten, als sie Frankreich erniedrigt sahen und Bonaparte verloren wähnten.
Ihre Auflistung ist ein Leichtes, denn wir entnehmen sie einer von Nelson eigenhändig verfassten Notiz.
Von George III. erhielt er die Pairswürde verliehen und eine Goldmedaille.
Vom Unterhaus erhielt er für sich und seine direkten Erben den Titel eines Barons Nelson of the Nile and of Burnham Thorpe, verbunden mit einer Rente von zweitausend Pfund Sterling ab dem 1. August 1798, dem Tag der Schlacht in der Bucht von Abukir.
Vom Oberhaus erhielt er die gleiche Rente zu den gleichen Bedingungen.
Vom irischen Parlament erhielt er eine Pension von tausend Pfund Sterling.
Von der Ostindien-Kompanie erhielt er eine einmalige Prämie von zehntausend Pfund Sterling.
Vom türkischen Sultan erhielt er eine diamantenbesetzte Spange mit einer seltenen Feder, auf einen Wert von zweitausend Pfund Sterling veranschlagt, sowie eine kostbare Pelzmantille im Wert von tausend Pfund Sterling.
Von der Mutter des Sultans erhielt er eine diamantengeschmückte Dose, auf einen Wert von zwölfhundert Pfund Sterling geschätzt.
Vom König von Sardinien erhielt er eine diamantenbesetzte Tabaksdose, auf ebenfalls zwölfhundert Pfund Sterling veranschlagt.
Von der Insel Zante erhielt er einen Degen mit goldenem Griff und einen Spazierstock mit goldenem Knauf.
Von der Stadt Palermo erhielt er eine Tabaksdose und eine goldene Kette auf silbernem Tablett.
Und von seinem Freund Benjamin Hallowell, Kapitän auf der Swiftsure, erhielt er ein ausgemacht englisches Geschenk, ein Glanzstück unserer Liste, das wir keinesfalls mit Schweigen übergehen wollen. Wir erinnern uns, dass die Orient in die Luft gesprengt worden war; Hallowell hatte den Großmast bergen und an Bord seines Schiffs bringen lassen; aus diesem Mast und seinen Beschlägen ließ er den Schiffsschreiner und den Schiffsschlosser einen Sarg zimmern und beschlagen, mit einer Plakette versehen, die folgendes Echtheitszertifikat enthielt:
Ich bestätige, dass dieser Sarg ausnahmslos aus Holz und Eisen gefertigt ist, die von dem Schiff L’Orient stammen und in der Bucht von Abukir auf das von mir befehligte Schiff Seiner Majestät gebracht wurden.
BEN HALLOWELL
Den solchermaßen beglaubigten Sarg machte er Nelson zum Geschenk und legte folgendes Begleitschreiben bei:
An den ehrenwerten Sir Nelson, Ritter des Bath-Ordens
Mein werter Herr, in Begleitung dieses Schreibens übersende ich Ihnen einen Sarg, der aus dem Mast des französischen Schiffs L’Orient gefertigt ist, damit Sie, wenn Sie dereinst dieses Leben verlassen, vorerst in Ihren eigenen Trophäen ruhen können. Daß dieser Tag noch in weiter Ferne weilen möge, ist aufrichtiger Wunsch Ihres gehorsamen und ergebenen Dieners
BEN HALLOWELL
Verschweigen wir nicht, dass von allen Geschenken, die ihm gemacht wurden, dieses letzte Nelson am meisten berührt zu haben scheint; er nahm es mit merklicher Befriedigung entgegen und ließ es in seiner Kabine an der Wand aufstellen, unmittelbar hinter dem Sessel, auf dem er zu sitzen pflegte, wenn er speiste. Ein alter Diener, den dieses posthume Möbel mit Kummer erfüllte, konnte den Admiral dazu bewegen, es auf das Unterdeck bringen zu lassen.
Als Nelson die entsetzlich zugerichtete Vanguard gegen die Fulminant eintauschte, blieb der Sarg monatelang auf der Back stehen, bis man einen Platz für ihn fand. Als die Offiziere der Fulminant eines Tages das Geschenk Kapitän Hallowells bewunderten, rief Nelson ihnen aus seiner Kajüte zu: »Bewundern Sie nur nach Herzenslust, meine Herren, aber für Sie ist er nicht bestimmt.«
Und sobald sich die Gelegenheit ergab, ließ Nelson den Sarg nach England zu seinem Möbelbezieher schicken, den er bat, ihn umgehend mit Samt auszuschlagen, da angesichts des Gewerbes, das er ausübte, jederzeit die Notwendigkeit eintreten konnte, den Sarg zu gebrauchen, und er ihn unbedingt gebrauchsfertig zur Hand haben wollte.
Es erübrigt sich zu sagen, dass Nelson, als er sieben Jahre später bei Trafalgar fiel, in seinem Sarg beerdigt wurde.
Doch kehren wir zu unserer Erzählung zurück.
88
Emma Lyon
Als Strafe für den Sieger von Abukir und von Trafalgar hat Gottes Gerechtigkeit Sorge getragen, dass der Name Emma Lyon für alle Zeiten mit dem Namen Nelson verbunden bleiben wird.
Wir berichteten, dass Nelson ein Schnellboot mit der Nachricht von dem Sieg bei Abukir nach Neapel und London geschickt hatte.
Sobald Emma Nelsons Siegesmeldung erhalten hatte – denn an sie war sie gerichtet -, eilte sie zu Königin Caroline und hielt ihr den geöffneten Brief hin. Die Königin warf einen Blick auf das Schreiben und stieß einen Freudenruf oder eher ein Freudengebrüll aus.
Und ohne sich um den französischen Botschafter Garat zu scheren, der Ludwig XVI. sein Todesurteil vorgelesen hatte und den das Direktorium zweifellos als Warnung an die Adresse der neapolitanischen Monarchen als Botschafter zu ihnen geschickt hatte, befahl die Königin, die glaubte, von Frankreich nichts mehr zu befürchten zu haben, dass nachdrücklich, ostentativ und unbekümmert alle Vorbereitungen zu treffen seien, um Nelson wie einen Triumphator in Neapel zu empfangen.
Caroline, die nicht müde wurde zu verkünden, sie sei Nelson stärker verpflichtet als andere, da sie sich doppelt bedroht gesehen hatte – einerseits durch die Anwesenheit französischer Truppen in Rom, andererseits durch die Proklamation der Römischen Republik -, wollte nicht hinter den anderen Souveränen zurückstehen und ließ ihren Liebhaber, den Premierminister Acton, dem König die Ernennung Nelsons zum Herzog von Bronte (benannt nach einem der drei Kyklopen, die den Donner schmieden) zum Unterzeichnen vorlegen, verbunden mit einer Jahresrente von dreitausend Pfund Sterling, indes der König Nelson beim Überreichen der Ernennungsurkunde das Schwert verehrte, das Ludwig XIV. seinem Sohn Philipp V. geschenkt hatte, als er nach Spanien aufbrach, um dort König zu sein, und das dieser wiederum seinem Sohn Don Carlos geschenkt hatte, als er aufbrach, um Neapel zu erobern.
Neben seinem unermesslichen historischen Wert wurde dieses Schwert, das nach den Worten Karls III. nur in die Hände von Verteidigern oder Rettern des Königreichs beider Sizilien gelangen durfte, der Diamanten wegen, die es verzierten, auf einen materiellen Wert von fünftausend Pfund Sterling geschätzt, anders gesagt hundertfünfundzwanzigtausend Francs.
Die Königin hatte sich vorbehalten, Nelson ein Geschenk zu machen, dem in seinen Augen kein Titel und keine Gunst aller Könige der Welt gleichkommen konnten: Sie hatte sich vorbehalten, ihm Emma Lyon zu schenken, den Gegenstand seiner glühendsten Träume seit fünf Jahren.
Am Morgen des Tages, an dem Nelson in Neapel erwartet wurde, hatte die Königin Emma Hamilton die dunkelbraunen Haare aus der Stirn gestrichen, einen Kuss auf die engelsgleiche Stirn gedrückt, hinter der sich so viele Lügen verbargen, und hatte zu ihrer Freundin gesagt: »Liebste Emma, damit ich König bleiben kann und du Königin bleiben kannst, müssen wir diesen Mann für uns gewinnen, und damit wir ihn gewinnen, musst du dich ihm hingeben.«
Emma hatte den Blick gesenkt, ohne zu antworten, hatte die Hände der Königin ergriffen und mit leidenschaftlichen Küssen bedeckt.
Wir müssen erklären, wie es möglich war, dass Caroline Marie es wagen konnte, sich Lady Hamilton, der Gattin des englischen Botschafters, mit einem solchen Wunsch oder besser Befehl zu nähern.
Emma war die Tochter einer armen Bäuerin aus Wales. Zeitlebens wusste sie weder ihr Alter noch den Ort ihrer Geburt. Soweit sie sich überhaupt erinnern konnte, entsann sie sich ihrer selbst als eines dreioder vierjährigen Kleinkinds, das mit nackten Füßen mitten in Nacht und Nebel einen Pfad in den Bergen eines nördlichen Landes geht, sich mit seiner kleinen eisig kalten Hand an den Kleidern seiner Mutter festhält, einer armen Bäuerin, die das Kind trug, wenn es vor Müdigkeit nicht mehr gehen konnte oder wenn es Bäche zu überqueren galt, die den Weg kreuzten.
Sie entsann sich, dass sie unterwegs unter Hunger und Kälte gelitten hatte.
Und sie entsann sich, dass ihre Mutter, als sie durch ein Dorf kamen, vor der Tür eines Hauses wohlhabender Leute oder vor einer Bäckerei stehen geblieben war und mit flehender Stimme um etwas Geld gebettelt hatte, das ihr fast nie gegeben wurde, oder um etwas Brot, das man ihr fast immer gab.
Zuletzt erreichten die zwei Reisenden das Ziel ihrer Wanderung, die kleine Stadt Flint. Dort waren Emmas Mutter und ihr Vater John Lyon geboren. John Lyon hatte auf der Suche nach Arbeit die Grafschaft Flint verlassen und war nach Cheshire gegangen. Seine Arbeit war ihm nicht gut bekommen. John Lyon war jung und arm gestorben, und seine Witwe kehrte in ihren Heimatort zurück in der Ungewissheit, ob die Heimat sich ihr wohltätig oder herzlos erweisen würde.
Und wie in einem Traum sah Emma sich wieder an einem Berghang, an dem sie eine kleine Herde von vier, fünf Schafen hütete, die an einer Quelle tranken, in der Emma sich spiegelte, um zu sehen, wie ihr die Blumenkränze standen, mit denen sie sich schmückte.
Dann kam ein kleiner Geldbetrag in den bescheidenen Haushalt, den ein Graf Halifax gespendet hatte und der sowohl für den Unterhalt der Mutter als auch für die Erziehung der Tochter bestimmt war.
Nun wurde Emma in ein Mädchenpensionat gesteckt, dessen Uniform aus einem Strohhut, einem himmelblauen Kleid und einer schwarzen Schürze bestand.
Dort blieb sie zwei Jahre lang; nach diesen zwei Jahren holte ihre Mutter sie zurück; sie konnte die Kosten für die Pension nicht mehr aufbringen, denn der Graf von Halifax war mittlerweile gestorben und hatte sie in seinem Testament nicht bedacht.
Emma musste sich damit abfinden, sich als Kindermädchen im Haus eines gewissen Thomas Hawarden zu verdingen, dessen Tochter als junge Mutter gestorben war und drei Kinder hinterlassen hatte.
Als sie eines Tages mit den Kindern spazieren ging, machte sie eine Bekanntschaft, die ihr ganzes Leben verändern sollte. Eine berühmte Londoner Kurtisane namens Miss Arabell und deren damaliger Liebhaber, ein begabter Maler namens Romney, waren stehen geblieben, weil der Maler eine walisische Bäuerin zeichnen wollte und Miss Arabell ihm dabei zusehen wollte.
Die Kinder, mit denen Emma des Weges kam, näherten sich den beiden auf Zehenspitzen, um zu sehen, was der Maler tat. Emma folgte ihnen. Der Maler drehte sich um, erblickte sie und stieß einen Ruf der Bewunderung aus. Emma war dreizehn Jahre alt, und noch nie hatte Romney eine größere Schönheit gesehen.
Er fragte sie aus, wer sie sei und was sie tue. Die rudimentäre Erziehung, die sie erhalten hatte, erlaubte ihr, diese Fragen mit einer gewissen Anmut zu beantworten; er wollte wissen, wie viel ihr dafür bezahlt werde, dass sie die Kinder von Mr. Hawarden hütete. Sie erwiderte, sie werde dafür mit Kleidung, Nahrung, Unterkunft und zehn Shilling im Monat entlohnt.
»Kommen Sie nach London«, sagte der Maler, »und ich werde Ihnen zehn Guineen für jede Skizze geben, die Sie mich von Ihnen machen lassen.«
Er reichte ihr eine Karte, auf der stand: »Edward Romney, Nummer 8, Cavendish Square.«
Und Miss Arabell nahm eine kleine Börse mit einigen Goldstücken aus ihrem Gürtel und bot sie Emma an.
Das Mädchen nahm die Karte, die es sorgfältig in seinem Busen verbarg, wehrte die Börse ab, und da Miss Arabell insistierte und sagte, es werde das Geld für die Reise nach London benötigen, sagte es: »Ich danke Ihnen, gnädige Frau, aber wenn ich nach London gehe, werde ich es mit dem Ersparten tun, das ich bereits besitze und das ich vermehren werde.«
»Mit den zehn Shilling, die Sie monatlich erhalten?«, fragte Miss Arabell lachend.
»Ja, Madam«, erwiderte das Mädchen.
Und so endet das Abenteuer.
Nun, es endet beinahe, denn ganz im Gegenteil wird dieser Tag Früchte tragen. Sechs Monate später befand Emma sich in London, doch Romney war verreist. In Ermangelung des Malers suchte sie Miss Arabell auf, die sie als Gesellschafterin einstellte.
Miss Arabell war die Mätresse des Prinzregenten, hatte also den Gipfelpunkt in der Karriere einer Kurtisane erreicht.
Emma blieb zwei Monate lang bei der schönen Kurtisane, las alle Romane, die ihr in die Hände fielen, besuchte alle Theater, und wenn sie in ihrem Zimmer war, übte sie die Rollen und die Ballettschritte, die sie gesehen hatte; was für andere nur ein Zeitvertreib war, wurde für sie zur ganztägigen Beschäftigung; sie war vor Kurzem fünfzehn Jahre alt geworden und stand in der Blüte ihrer Jugend und Schönheit; ihre geschmeidige, gefällige Gestalt war wie geschaffen für jede Pose, und ihre natürliche Grazie war der Kunst der gewandtesten Tänzerinnen ebenbürtig. Ihr Gesicht, das sich durch alle Widrigkeiten des Lebens die unberührte Färbung der Kindheit erhalten hatte, den jungfräulichen Schmelz der Unschuld, und das der Wandelbarkeit ihrer Physiognomie die verblüffendste Ausdrucksvielfalt verdankte, war in melancholischer Stimmung Ausdruck ungehemmten Schmerzes und in fröhlicher Stimmung reinstes Strahlen. Man hätte meinen können, dass sich in der Reinheit der Züge die Unschuld der Seele offenbarte, und ein großer Dichter unserer Tage, den es dauerte, diesen himmlischen Spiegel zu besudeln, sagte deshalb von ihrem ersten Fehltritt: »Sie strauchelte nicht ins Laster, sondern in Unbesonnenheit und Güte.«
Der Krieg, den England zu jener Zeit gegen die amerikanischen Kolonien führte, hatte seinen Höhepunkt erreicht, und das Pressen war in all seiner Unbarmherzigkeit an der Tagesordnung.
Der Bruder einer Freundin Emmas, ein gewisser Richard, wurde gegen seinen Willen gepresst und genötigt, Seemann zu werden.
Seine Schwester Fanny lief zu Emma und bat sie um Hilfe. Sie war überzeugt, dass niemand den Bitten einer so schönen Person widerstehen konnte.
Sie flehte Emma an, mit ihren Reizen dem Admiral John Payne den Kopf zu verdrehen; heiter kleidete Emma sich in ihr vornehmstes Gewand und suchte in Begleitung ihrer Freundin den Admiral auf.
Sie erhielt, worum sie bat, doch John Payne tat ihr den Gefallen nicht umsonst, und Emma bezahlte Richards Freiheit zumindest mit ihrem Dank, wenn nicht gar mit ihrer Liebe.
Als Mätresse des Admirals Payne bekam Emma ein eigenes Haus, eigene Dienstboten und eigene Pferde, doch dieser Reichtum war so funkelnd und vergänglich wie ein Meteor. Der Admiral stach in See, und Emma musste mit ansehen, wie das Schiff ihres Liebhabers, das am Horizont entschwand, all ihre goldenen Träume auf Nimmerwiedersehen entführte.
Doch Emma war keine Dido, die sich eines wankelmütigen Äneas wegen das Leben nahm. Einer der Freunde des Admirals, Sir Harry Fatherson, ein reicher und stattlicher Edelmann, bot Emma an, standesgemäß für sie aufzukommen. Den ersten Schritt auf der Bahn des Lasters hatte Emma bereits getan; sie nahm das Angebot des Lords an und war eine ganze Saison lang die ungekrönte Königin der Jagdpartien, der Festlichkeiten und Bälle; doch am Ende der Saison war sie von ihrem zweiten Liebhaber vergessen, durch ihre zweite Liebschaft besudelt und geriet nach und nach in so großes Elend, dass sie sich keinen anderen Rat mehr wusste als den, sich am Haymarket als Straßendirne zu verdingen, dem erbärmlichsten aller Orte, an denen sich unselige Geschöpfe den Passanten feilbieten.
Emmas Glück wollte, dass die verabscheuenswürdige Kupplerin, an die sie sich gewendet hatte, um in das Gewerbe der öffentlichen Verderbnis aufgenommen zu werden, von dem vornehmen und züchtigen Betragen ihres neuen Zöglings so beeindruckt war, dass sie sie nicht wie die anderen zur Dirne abrichtete, sondern sie zu einem berühmten Arzt brachte, der in ihrem Haus verkehrte.
Es handelte sich um den bekannten Doktor Graham, einen dem schönen Geschlecht zugeneigten Wunderdoktor und Scharlatan, der den Schönheitskult als Religion zur Erbauung der jungen Leute Londons praktizierte.
Emma kam ihm vor Augen: Er hatte seine Venus Astarte gefunden, verkörpert in einer keuschen Venus.
Für diesen Fund zahlte er viel Geld, doch es war ihm das Geld wert; er legte sie auf das Lager des Apollon, bedeckte sie mit einem Schleier, der durchsichtiger war als jener Schleier, mit dem Vulkan Venus vor den Blicken des ganzen Olymp gefangen hatte, und ließ in alle Zeitungen einrücken, dass er endlich das einzigartige und unerreichte Exemplar menschlicher Schönheit besitze, das ihm bislang zum Beweis seiner Theorien gefehlt hatte.
Auf diesen Appell an die Wollust und die Wissbegier eilten alle Anhänger der Religion der Liebe, deren Kult in aller Welt praktiziert wird, in das Kabinett des Doktor Graham.
Der Triumph war überwältigend: Weder Malerei noch Skulptur hatten je zuvor ein solches Meisterwerk hervorgebracht; Apelles und Phidias mussten sich geschlagen geben.
Maler und Bildhauer pilgerten zum Tempel des Wunderdoktors. Romney, der nach London zurückgekehrt war, kam wie die anderen und erkannte das Mädchen wieder, das er in Wales gesehen hatte. Er malte es in jedweder Verkleidung: als Ariadne, als Bacchantin, als Leda und als Armida, und in der Bibliothèque impériale besitzen wir eine Sammlung von Stichen, auf denen das bezaubernde Geschöpf in allen wollüstigen Haltungen dargestellt ist, welche die sinnliche Antike erfunden hat.
Der junge Sir Charles Grenville aus der vornehmen Familie jenes Warwick, den man den Königsmacher nannte, Neffe Sir William Hamiltons, kam aus Neugier, erblickte Emma Lyon und entflammte angesichts ihrer überwältigenden Schönheit in Liebe. Der junge Lord machte Emma die verlockendsten Versprechungen, doch sie behauptete, dem Wunderdoktor Dank zu schulden, widerstand allen Verführungsversuchen und erklärte, sie sei nur bereit, ihren Liebhaber zu verlassen, um einem Ehemann zu folgen.
Sir Charles gab Emma sein Wort als Edelmann, sie zu heiraten, sobald er mündig wurde. Und Emma war einverstanden, sich von ihm entführen zu lassen.
Das Liebespaar lebte wie Mann und Frau, und auf Sir Charles’ Ehrenwort hin wurden drei Kinder geboren, die durch die Eheschließung legitimiert werden sollten.
Durch Veränderungen in dem Ministerium, zu dessen Mitarbeitern Grenville zählte, verlor er den Posten, dem er den Großteil seiner Einkünfte verdankte. Glücklicherweise geschah dies erst nach drei Jahren Zusammenlebens, als Emma dank der Unterweisung durch die besten Londoner Lehrer gewaltige Fortschritte im Musizieren und Zeichnen gemacht hatte; und nicht nur in der Muttersprache drückte sie sich nun gewandt aus, sondern sie sprach auch Französisch und Italienisch, konnte Verse rezitieren wie eine zweite Mrs. Siddons und beherrschte die Kunst der Pantomime und des Posierens.
Grenville war nicht bereit, seine Ausgaben zu verringern, obwohl er sein Einkommen eingebüßt hatte, sondern schrieb seinem Onkel und bat ihn um Geld. Den ersten Gesuchen gab der Onkel statt; doch dann erwiderte Sir William auf ein weiteres Ersuchen, er stehe im Begriff, nach London zu reisen, und wolle die Reise nutzen, um sich mit den Finanzen seines Neffen zu befassen.
Diese Ankündigung erschreckte die zwei jungen Leute nicht wenig; Sir Williams Ankunft wurde von ihnen im gleichen Maße herbeigesehnt wie gefürchtet. Und eines Tages wurde er bei ihnen vorstellig, ohne sich vorher angekündigt zu haben. Er hielt sich seit acht Tagen in London auf.
Diese acht Tage hatte Sir William darauf verwendet, Auskünfte über seinen Neffen einzuholen, und diejenigen, die er befragt hatte, hatten nicht gesäumt, ihm zu erklären, dass an den Missständen und der finanziellen Misere seines Neffen eine Straßendirne schuld sei, mit der er drei Kinder habe.
Emma zog sich in ihr Zimmer zurück und ließ ihren Geliebten mit seinem Onkel allein; dieser sagte ihm klipp und klar, dass er entweder auf der Stelle auf Emmy Lyon verzichten müsse oder von ihm enterbt werden würde.
Dann verabschiedete er sich und gab seinem Neffen drei Tage Bedenkzeit.
Die letzte Hoffnung des jungen Paares war Emma selbst; sie musste versuchen, Sir William dazu zu bewegen, seinem Neffen zu verzeihen, indem sie ihm vor Augen führte, wie verzeihlich seine Leidenschaft war.
Und statt die Kleidung anzulegen, die ihrer neuen gesellschaftlichen Stellung entsprach, kleidete Emma sich wie in ihrer Jugend in das Kleid aus grobem grauem Wollstoff und setzte einen Strohhut auf; alles Übrige würden ihre Tränen, ihr Lächeln, ihr Mienenspiel, ihre Zärtlichkeit und der Klang ihrer Stimme tun.
Emma wurde von Sir William vorgelassen und warf sich ihm zu Füßen; ob geschickt einstudiert oder durch Zufall: Der Hut glitt ihr vom Kopf, und ihr schönes kastanienbraunes Haar fiel ihr auf die Schultern.
Im Kummer war sie noch bezaubernder als im Glück.
Der alte Archäologe, der bis dahin nur attischen Marmor und klassische griechische Statuen geliebt hatte, sah zum ersten Mal, dass Schönheit aus Fleisch und Blut die kalte und bleiche Schönheit der Göttinnen des Praxiteles und des Phidias übertreffen konnte. Die Liebe, für die er bei seinem Neffen kein Verständnis aufgebracht hatte, eroberte sein Herz und ergriff mit solcher Gewalt Besitz von ihm, dass er sich nicht einmal dagegen zu sträuben versuchte.
Die Schulden seines Neffen, Emmas niedrige Herkunft, ihr skandalöses Zusammenleben, Emmas sattsam bekannte Laufbahn, die Käuflichkeit ihrer Zärtlichkeiten – alles, sogar die Kinder, die Frucht ihrer Liebe, war Sir William hinzunehmen bereit unter der einzigen Bedingung, dass Emma ihm den völligen Verzicht auf jegliche Würde mit ihrem Besitz vergalt.
Emma hatte weit mehr bewirkt, als sie zu hoffen gewagt hätte; doch diesmal beharrte sie auf ihren eigenen Bedingungen: Ein Eheversprechen hatte sie mit dem Neffen vereinigt, und sie erklärte, dass sie Sir William nur als dessen anerkannte Ehefrau nach Neapel begleiten wolle.
Sir William war mit allem einverstanden.
In Neapel tat Emmas Schönheit ihre gewohnte Wirkung; sie erstaunte nicht nur, sie verblüffte.
Sir William, der gelehrte Altertumsforscher und Mineraloge, Botschafter Großbritanniens, Milchbruder und Freund Georges III., versammelte in seinem Haus die vornehmste Gesellschaft der Hauptstadt des Königreichs beider Sizilien in wissenschaftlicher, politischer und künstlerischer Hinsicht. Emma mit ihrem künstlerischen Temperament lernte innerhalb weniger Tage, was sie über Politik und Wissenschaften wissen musste, und schon bald besaßen Emmas Ansichten für die Habitués in Sir Williams Salon nachgerade Gesetzeskraft.
Das war noch nicht der Gipfel ihres Triumphs. Kaum war sie bei Hofe eingeführt worden, erklärte Königin Caroline Marie sie zu ihrer Busenfreundin und machte sie zu ihrer engsten Gefährtin. Nicht genug damit, dass sich die Tochter Maria Theresias in aller Öffentlichkeit mit einer Prostituierten vom Haymarket abgab, sich in deren Gesellschaft und in der gleichen Toilette wie diese in der Kutsche auf der Via Toledo und der Via Chiaia zeigte, nein, nach den Abendgesellschaften, in deren Verlauf die wollüstigsten und zügellosesten Posen der antiken Kunst nachgeahmt worden waren, ließ sie Sir William ausrichten, sie könne sich von ihrer Freundin nicht trennen und werde sie ihm erst am nächsten Morgen zurückschicken, was ihn mit nicht geringem Stolz erfüllte.
Mitten unter diesen Ereignissen, die am Hof von Neapel so gewaltigen Widerhall fanden, sah man Nelson erscheinen, sich auszeichnen und den alt gewordenen Majestäten neue Zuversicht verleihen. Diese Könige, die mit der Hand ihre wackelnde Krone festzuhalten versuchten, hatten nach seinem Sieg bei Abukir neue Hoffnung zu schöpfen begonnen. Caroline Marie, eine Frau, die es nach Reichtum, Macht und Einfluss gelüstete, war nicht gesonnen, sich die Krone wegnehmen zu lassen. Es kann daher wenig erstaunen, dass sie den Zauber, den ihre Freundin ausübte, für ihre Zwecke einsetzen wollte, und am Morgen desselben Tages, an dem sie diese mit Nelson, dem neuen Stützpfeiler des Despotismus, zusammenführte, zu ihr sagte: »Dieser Mann muss uns gehören, und damit er uns gehört, musst du du ihm gehören.«
Sollte es Lady Hamilton denn schwerfallen, ihrer Freundin Caroline Marie mit Horatius Nelson einen Dienst zu erweisen, wie ihn Emma Lyon ihrer Freundin Fanny Strong mit Admiral Payne erwiesen hatte?
Im Übrigen musste es den Sohn des armen Dorfpfarrers von Burnham-Thorpe, den Mann, der seine Größe dem eigenen Mut und seinen Ruf seinem Genius verdankte, einen glanzvollen Lohn für seine Verstümmelungen und für seine Verwundungen dünken, dass dieser König, diese Königin, dieser Hofstaat sich vor ihm verneigten und ihm zum Lohn für seine Siege das herrliche Geschöpf übereigneten, das er so leidenschaftlich liebte.
89
In welchem Kapitel Napoleon erkennen muss, dass die Menschen manchmal schwerer zu lenken sind, als es das Glück ist
Wir wissen, welches Ergebnis die Feierlichkeiten hatten, die zu Ehren Nelsons veranstaltet wurden.
Außer sich vor Zorn angesichts solcher Dreistigkeit, verlangte der französische Botschafter seine Papiere und reiste ab. Ferdinand IV. wollte Frankreich nicht die Genugtuung verschaffen, als Erster zum Angriff zu schreiten; er machte sich mit einer stattlichen Armee von fünfundsechzigtausend Mann auf den Weg, traf auf Championnet mit zwölftausend Soldaten und wurde bei diesem ersten Gefecht so vernichtend geschlagen, dass er die Flucht ergriff und erst in Neapel haltmachte.
Championnet verfolgte ihn mit der Inbrunst, wie sie die republikanischen Generäle damals bewiesen. Fünf- bis sechstausend Lazzaroni versuchten das zu tun, was die fünfundsechzigtausend Soldaten des Königs von Neapel nicht vermocht hatten, boten den Franzosen die Stirn, verteidigten die Stadt drei Tage lang und ermöglichten zuletzt die Flucht der königlichen Familie und des englischen Botschafterehepaars aus Neapel.
Die Flucht führte nach Sizilien.
Eines Tages machte sich Kardinal Ruffo in königlichem Auftrag und als Alter Ego des Königs aus Messina auf, um Neapel zurückzuerobern. Währenddessen befand sich Napoleon in Ägypten, wo er durch die Vernichtung seiner Flotte bei Abukir festsaß; die Franzosen waren in Italien geschlagen worden und verloren ihren Ruf der Unbesiegbarkeit.
Ruffo eroberte Kalabrien zurück, danach Neapel und machte erst an der Grenze zu Rom halt.
Ferdinand kehrte nach Neapel zurück, doch ihm voraus ging eine Liste von hundert Personen, die er zum Tode verurteilt hatte, noch bevor sie vor Gericht erscheinen sollten.
Caracciolo hatte als Admiral seine Demission eingereicht und sich als neapolitanischer Bürger genötigt gesehen, seinen Dienst zu verrichten; das war der einzige Vorwurf, den man ihm machen konnte. Kein Gericht hätte gewagt, ihn zu verurteilen; Nelson aber nahm für einen Kuss seiner Emma und für ein Lächeln der Königin das Amt des Henkers auf sich.
Er ließ Caracciolo in seinem Versteck aufspüren, ließ ihn an Bord der Foudroyant bringen, und dort wurde gegen jedes Gesetz der Menschlichkeit ein neapolitanischer Admiral von einem englischen Admiral abgeurteilt und an der Fockrahe seines eigenen Schiffs aufgeknüpft.
Man könnte erwarten, dass Nelson nach seiner Rückkehr in London für die schändlichen Gefälligkeiten, die er dem Hof von Neapel erwiesen hatte, zumindest öffentlich getadelt worden wäre, aber nichts dergleichen geschah.
Als er mit Lady Hamilton nach England zurückkehrte, wurde dort im Gegenteil dem Sieger von Abukir und Neapel ein triumphaler Empfang bereitet: Alle Schiffe auf der Themse hissten seine Flagge, und die Regierung und die Londoner Gilden hießen ihn mit Grußadressen willkommen, als hätte er das Vaterland gerettet; das Volk heftete sich voller Begeisterung an seine Fersen und feierte ihn in der ganzen Stadt mit Ovationen und spontanen Triumphzügen.
In der Umgebung von London erwarb er ein Lusthaus mit Namen Merton House; dort versteckte er seine Liebe, seinen Ruhm und seine Gewissensbisse; Emma Lyon gebar ihm eine Tochter, die auf den Namen Horatia getauft wurde.
Der Krieg in der Ostsee rief ihn in den Dienst zurück; er befehligte die Flotte, die den Hafen von Kopenhagen unterwarf und die dänische Flotte in Brand steckte. Bei dieser Seeschlacht geschah es, dass er, als er die Ordres des Admirals signalisiert bekam, das Fernrohr vor das erblindete Auge hielt und sagte: »Ich sehe nichts«, obwohl man ihm beteuerte, der Admiral befehle, das Feuer einzustellen.
Diese Antwort, würdig eines Alarik oder eines Attila, die bei allen zivilisierten Völkern bestraft worden wäre, umkränzte seinen Namen in London mit Ruhm und im übrigen Europa mit Schrecken.
Er kehrte im Triumph nach England zurück und wurde vom König zum Ritter geschlagen.
Er war das einzige Gegengewicht, das Großbritannien gegen Napoleon aufbieten konnte. Dieser setzte jedoch seinen Zweikampf gegen England fort.
Seit achtzehn Monaten hatte Napoleon in allen französischen und holländischen Häfen alles angesammelt, was eine Landung in England befürchten ließ. Fünf- bis sechshundert Kanonenboote lagen zwischen Dünkirchen und Abbeville einsatzbereit im Hafen; sie konnten jederzeit die in Boulogne am Ufer kampierenden Truppen übersetzen und die Küste Großbritanniens mit einer Armee überschwemmen, die so unüberwindlich gewesen wäre wie das Heer Wilhelms des Eroberers.
England belächelte zwar die Nussschalen Monsieur Bonapartes, wie es seine Flotte zu nennen beliebte, doch die bedrohliche Truppenansammlung in seiner Sichtweite nahm es ernst. Seine Geschwader überwachten den Ärmelkanal und schnitten unseren Kanonenbooten den Weg nach London ab.
Napoleon wollte den Angriff auf dem Seeweg erst wagen, sobald er eine Flotte von sechzig bis achtzig Kriegsschiffen vereinigt hatte, die im Ärmelkanal die Schlacht gegen England aufnehmen konnte. Wenig kümmerte ihn der Ausgang des Gefechts, Sieg oder Niederlage, solange er die englische Flotte einen Tag lang ablenken und ungehindert hundertfünfzigtausend oder zweihunderttausend Soldaten an Land absetzen konnte. Doch die französischen Schiffe waren durch die britische Seeblockade in den Häfen von Escaut und Brest, in Toulon und in Cadiz festgesetzt; um sich zu einer Flotte zusammenzufinden, die es mit der englischen Flotte aufnehmen konnte oder ihr gar überlegen war, hätten sie einer schier unvorstellbaren Mischung aus Zauberkraft, Schläue und Kühnheit bedurft. Doch keiner unserer Admiräle in Frankreich, Holland oder Spanien war der herausragende Geist, der befähigt gewesen wäre, mit dem Mut der Verzweiflung jene heroischen Manöver zu vollbringen, die aller Wahrscheinlichkeit spotten[7].
Furchtsamen Geistes, wenn auch tapferen Herzens, verloren sie angesichts der Verantwortung, der sich zu stellen von ihnen verlangt wurde, jeden Mut. Sie begriffen nicht, was der Befehl bedeutete, der lautete: »Lassen Sie sich schlagen, wenn Sie den Gegner nicht schlagen können, aber kämpfen Sie!« Sie begriffen nicht, dass es um jeden Preis zu verhindern galt, dass die englische Flotte London Entsatz brachte, und dass es Napoleons gegen England gerichteten Invasionsplänen diente, wenn die englischen Schiffe fünfhundert Meilen vom Ärmelkanal entfernt aufgehalten wurden.
Der Krieg zu Lande erfordert nichts als Tapferkeit; der Seekrieg erfordert Heldenmut und Umsicht.
Ein besiegtes, dezimiertes, in die Flucht geschlagenes Heer sammelt sich, ordnet sich, bildet sich neu, aber ein gestrandetes oder verbranntes Geschwader reißt seine Besatzung mit in das Verderben und hinterlässt nur brennendes Treibgut an der Meeresoberfläche.
Das wussten die Engländer so gut wie Napoleon. Ohne die geringste Aussicht darauf, seine verstreuten Geschwader zusammenzuziehen, träumte er davon, aus den Häfen von Toulon und Brest zwei Geschwader mit vierzig- bis fünfzigtausend Kombattanten an Bord auslaufen zu lassen und sie auf zwei Wegen in den Indischen Ozean zu führen. Diese beiden Flotten würden unweigerlich die Engländer als Verfolger auf den Plan rufen, und während die englischen Geschwader damit beschäftigt wären, ihre indischen Seewege zu schützen, gäbe ihm dies möglicherweise genug Zeit, seine Landungstruppen über den Ärmelkanal zu bringen und zu tun, was Cäsar und Wilhelm der Eroberer vor ihm getan hatten.
Doch das schiere Ausmaß dieses Vorhabens hatte seine Geduld bald ermüdet; er war auf ein anderes Vorhaben zurückgekommen, das sich einfacher und erfolgversprechender ausnahm. Es bestand darin, den Hauptteil der englischen Geschwader aus dem Ärmelkanal wegzulocken; auf Napoleons Befehl war Admiral Villeneuve, dem er das Oberkommando über die vereinten französischen und spanischen Seestreitkräfte übertragen wollte, mit dreizehn Kriegsschiffen und einigen Fregatten aus dem Hafen von Toulon ausgelaufen.
In Cadiz hatte er sich mit den spanischen Geschwadern unter Admiral Gravina vereinigt, und von dort hatte er den Atlantik überquert und sich vor den Antillen dem Geschwader Admiral Missiessys angeschlossen, das sechzig Kriegsschiffe stark war; Admiral Ganteaume, der die Flotte von Brest kommandierte, hatte Befehl, den ersten Sturm zu nutzen, der den englischen Admiral Cornwallis daran hindern würde, vor Brest zu kreuzen, und sich bei Martinique Villeneuve, Gravina und Missiessy anzuschließen. Diese Flotte sollte den Engländern ihre Besitzungen auf den Antillen streitig machen, sollte dann alle Segel setzen und Kurs auf Frankreich nehmen, verfolgt von den englischen Geschwadern, und sich mit diesen in europäischen Gewässern ein Seegefecht liefern, nach dessen Verlauf sie in den Ärmelkanal segeln sollten, siegreich oder geschlagen, um sich an der Invasion Englands zu beteiligen.
Unglücklicherweise hielt die anhaltende Flaute Ganteaume in Brest fest. Villeneuve kehrte in europäische Gewässer zurück mit dem Befehl, sich vor Brest ein Gefecht mit Cornwallis zu liefern und so Ganteaume aus der Blockade zu befreien, dessen Seestreitkräfte mit den seinen zu vereinen und mit den sechzig vereinigten Kriegsschiffen die britische Seestreitkraft am Eingang des Ärmelkanals zu bekämpfen, unabhängig von ihrer Größe.
»Die Engländer«, rief Napoleon und ballte die Faust wie Ajax, »wissen nicht, was sich über ihrem Kopf zusammenbraut: Wenn ich zwölf Stunden lang Herr über den Ärmelkanal bleibe, wird es England gegeben haben.«[8]
Als Napoleon diesen Jubelruf ausstieß, befand er sich in Boulogne und hatte einhundertachtzigtausend Mann vor sich, die den Kontinent besiegt hatten und einen letzten Sieg ins Auge fassten.
Napoleon wusste nur zu gut, dass die Zeit gegen ihn arbeitete; er wusste, dass ihm nur wenige Tage blieben, um der Kriegserklärung durch Österreich und der Erhebung ganz Deutschlands zuvorzukommen. Er zweifelte nicht daran, dass Villeneuve bereits vor Brest kreuzte, doch stattdessen hatte dieser nach dem katastrophalen Ausgang einer bei Nacht und Nebel erfolgten nächtlichen Seeschlacht zwei spanische Schiffe den Engländern überlassen und sich auf den Weg nach Ferrol gemacht, um dort seine Schiffe ohne Not zu überholen, statt seine Befehle zu befolgen, die Blockade vor Brest zu durchbrechen, sich mit Ganteaume zu verbinden und so schnell wie möglich im Ärmelkanal zu erscheinen.
Napoleon war außer sich vor Zorn. Er spürte, dass das Glück seinen Händen entglitt. »Brechen Sie auf«, schrieb er dem im Hafen von Brest gefangenen Ganteaume, »brechen Sie auf, und wir werden an einem Tag sechs Jahrhunderte der Unterlegenheit und der Schmach gerächt haben, brechen Sie auf. Niemals werden meine Land- und Seesoldaten ihr Leben für ein größeres Ziel aufs Spiel gesetzt haben.«
»Brechen Sie auf«, schrieb er Villeneuve, »brechen Sie auf, ohne eine Sekunde zu verlieren, brechen Sie auf und fahren Sie mit meinen vereinten Geschwadern in den Ärmelkanal ein; wir sind alle bereit, alle sind für die Landung eingeschifft, und in vierundzwanzig Stunden wird alles geschehen sein.«
Man kann diesen Briefen deutlich entnehmen, wie ungeduldig ein Mensch vom Schlag Napoleons war; als er erfuhr, dass Villeneuve sich tatenlos im Hafen von Cadiz versteckte und dass Ganteaume hilflos im Hafen von Brest festsaß, beschimpfte er Villeneuve als Dummkopf und Feigling, der nicht einmal fähig sei, eine Fregatte zu kommandieren.
»Dieser Mann ist blind vor Angst«, sagte er.
Der Marineminister Decrès war ein Freund Villeneuves; und da Villeneuve außer Reichweite war, hielt Napoleon sich an Decrès schadlos.
»Ihr Freund Villeneuve«, schrieb er ihm, »wird vermutlich zu feige sein, Cadiz zu verlassen. Entsenden Sie Admiral Rosily, der das Kommando über das Geschwader übernehmen wird, falls dieses noch nicht aufgebrochen sein sollte, und befehlen Sie Admiral Villeneuve, nach Paris zurückzukehren und mir Rechenschaft über sein Tun abzulegen.«
Minister Decrès brachte es nicht über sich, Villeneuve die Unglücksnachricht zu übermitteln, die ihn jeder Möglichkeit, sich zu rehabilitieren, beraubt hätte, sondern er begnügte sich damit, ihm Rosilys Abreise mitzuteilen, ohne ihm den Grund dafür zu nennen. Er riet Villeneuve auch nicht, Segel zu setzen, bevor Rosily in Cadiz eintreffen würde, obwohl er hoffte, dass dies geschehen werde, und in dem Zwiespalt zwischen seiner Freundschaft zu Villeneuve, dessen Versagen er deutlich erkannte, und seiner Loyalität zum Kaiser, dessen gerechten Zorn er verstand, beging er den Fehler, für keine Seite Partei zu ergreifen und alles Weitere dem Zufall zu überlassen.
Villeneuve jedoch erriet bei der Lektüre des Briefs des Ministers, was dieser ihm zu verschweigen versuchte; am meisten kränkte ihn die unverdiente Schmähung, ein Feigling zu sein; zu jener Zeit war die französische Marine in einem desolaten Zustand und sich ihrer Schwäche nur allzu bewusst, und zugleich eilte Nelson ein solcher Ruf des Wagemuts und der Tollkühnheit voraus, dass jede Flotte, die ihn zum Gegner hatte, sich von vornherein geschlagen gab.
Villeneuve war entschlossen, zum Aufbruch zu rüsten; er brachte seine Truppen an Land, damit sie sich ausruhten, und um die Kranken pflegen zu lassen. Admiral Gravina ließ die Hälfte seiner Kriegsschiffe zurück, da sie in kaum seetüchtigem Zustand waren, und tauschte sie gegen die besten Schiffe des Arsenals von Cadiz aus.
Der ganze September wurde auf diese Vorbereitungen verwendet; Schiffe und Ausrüstung der Flotte waren jetzt weitaus besser als zuvor, doch die Männer blieben dieselben.
Unsere Mannschaften waren seit acht Monaten auf See und hatten in dieser Zeit an Erfahrung gewonnen. Einige Kapitäne waren hervorragend, doch unter den Offizieren waren allzu viele, die der Handelsschifffahrt entstammten und weder die Kenntnisse noch den Geist der Kriegsmarine besaßen; am meisten aber mangelte es unserer Marine an einer systematischen Seekriegstaktik, die mit den neuen Kampfmethoden der Engländer mithalten konnte, denn statt wie im traditionellen Seegefecht zwei Schlachtlinien zu bilden, die sich parallel bewegten und in denen jedes Schiff seinen Platz beibehielt und das gegenüberliegende Schiff beschoss, hatte sich Nelson zur Gewohnheit gemacht, kühne Vorstöße zu wagen und als einzige Ordnung die gelten zu lassen, die Ergebnis der unterschiedlichen Geschwindigkeit der Schiffe war.
Er warf sich auf die gegnerische Flotte, zerteilte sie, schnitt den einen Teil vom anderen ab und feuerte im Nahkampf, ohne sich darum zu scheren, ob er die eigenen Leute traf, bis der Gegner sich ergab oder sank.
Unterdessen schrieb Napoleon, der undeutlich zu ahnen begann, dass seine Invasion Englands scheitern könnte, auch wenn er es noch nicht glauben wollte, einen Brief an Monsieur de Talleyrand, in dem er neue Vorhaben andeutete, Vorhaben, die noch im ungreifbaren Nebel der Träume schwebten.
»Es ist geschehen«, schrieb er ihm, »meine Flotten sind auf dem Meer und außer Sicht; wenn sie in den Ärmelkanal zurückkehren, bleibt noch genug Zeit, ich schiffe mich ein, ich gehe in England an Land, ich zertrenne in London den Knoten der Koalitionen. Wenn sich meine Admiräle aber stattdessen als gesinnungslose Gesellen erweisen und ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, dann werde ich mit zweihunderttausend Mann in Deutschland einmarschieren; ich werde Wien einnehmen, die Bourbonen aus Neapel verjagen, und sobald der Kontinent befriedet ist, werde ich auf das Meer zurückkehren und es ebenfalls befrieden.«
Am 18. September erfuhr Napoleon in La Malmaison von der Kriegserklärung des österreichischen Kaisers an die Adresse Frankreichs. Frankreich erwiderte im nämlichen Ton.
Mit der für ihn charakteristischen Schnelligkeit im Handeln gibt Napoleon die Kanalüberquerung auf, die in dem Augenblick scheiterte, als sie hätte gelingen können, und widmet sich mit allen Kräften dem Vorhaben des Kontinentalkriegs, das er seit zwei Wochen hegt.
Nie zuvor hatte er über vergleichbare Mittel verfügt. Nie zuvor hatte sich ein so weites Operationsfeld vor seinen Augen entfaltet. Zum ersten Mal war er frei, wie es Alexander und Cäsar gewesen waren. Jene seiner Waffengefährten, die ihre Eifersucht unbequem gemacht hatte – Moreau, Pichegru, Bernadotte und so weiter -, hatten sich durch schuldhaftes oder unvorsichtiges Handeln selbst ausmanövriert. Napoleon waren nur Offiziere geblieben, die sich seinem Willen unterwarfen und zugleich im höchsten Grade alle Eigenschaften in sich vereinigten, die für die Ausführung seiner Vorhaben erforderlich waren.
Seine Armee, die nach vier Friedensjahren der Tatenlosigkeit überdrüssig war, die es nach nichts sehnlicher verlangte als nach Gefechten, die zehn Jahre Krieg und drei Jahre Feldlager geformt hatten, war für die anstrengendsten Märsche ebenso bereit wie für die gefahrvollsten Unternehmungen.
Doch diese Armee, die so vortrefflich vorbereitet war, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, ihresgleichen habe es zu keiner anderen Zeit in Frankreich gegeben, diese Armee musste in Windeseile zur Mitte des Kontinents gebracht werden.
Das war das Problem.
90
Der Hafen von Cadiz
Am 17. Oktober 1805, als der Kaiser bereits zwei Kanonen und acht Fahnen nach Paris hatte schicken lassen, die bei der Schlacht von Günzburg erobert worden waren, als er München betreten, Ulm belagert und die Schlacht von Elchingen geschlagen hatte, die Marschall Ney seinen Herzogstitel bescheren sollte – am Tag ebendieser Schlacht und am Vortag der Schlacht, nach der er dem Senat vierzig Fahnen schicken sollte, fuhr eine Slup unter amerikanischer Flagge in den Hafen von Cadiz ein, in dem die ganze Flotte Admiral Villeneuves lag.
Sobald sich die Slup im Hafen befand, erkundigte man sich danach, wo die Redoutable ankerte, und als man erfuhr, dass diese unterhalb der Festung vor Anker lag, wohin die Slup nicht gelangen konnte, ließ man ihre beste Jolle zu Wasser und setzte ihren Kapitän in die Jolle, der sich zur Redoutable rudern ließ.
Als er sich dem Kriegsschiff näherte, forderte der wachhabende Offizier ihn auf, sich zu erkennen zu geben. Er erwiderte, sein Schiff sei die Runner of New York und der Kapitän überbringe Kapitän Lucas Neuigkeiten aus Indien und Briefe des Gouverneurs der Île de France.
Sogleich wurde Kapitän Lucas benachrichtigt, trat an Deck und bedeutete dem Offizier in der Jolle, er möge an Bord kommen.
Dieser Offizier war niemand anders als René.
Unverzüglich kletterte er die Leiter hinauf und war an Deck.
Kapitän Lucas empfing ihn höflich, doch mit jener überlegenen Autorität, die insbesondere in der Marine Grundbestandteil der Etikette ist. Er fragte den Besucher, ob dieser unter vier Augen mit ihm zu sprechen wünsche, und als René bejahte, forderte er ihn auf, ihn in seinen Salon zu begleiten.
Kaum hatten die zwei Männer den Raum betreten und die Tür geschlossen, reichte René dem Kapitän das Schreiben des Gouverneurs.
Lucas überflog das Schreiben nur kurz.
»Mein Freund General Decaen«, sagte er zu René, »empfiehlt Sie mir in so warmen Worten, dass mir nichts anderes zu tun bleibt, als Sie zu fragen, welchen Gefallen ich Ihnen erweisen kann.«
»Kommandant, Sie werden in wenigen Tagen an einem großen Seegefecht teilnehmen; ich habe bisher nur kleine Gefechte miterlebt, und ich muss gestehen, dass ich nur zu gerne in einer großen europäischen Auseinandersetzung mitkämpfen würde, in der ich mir ein wenig Ruhm erwerben könnte, denn mein Name ist nur im Indischen Ozean bekannt.«
»Ja«, sagte Lucas, »das ist wahr, wir werden eine große Schlacht schlagen, und jeder Teilnehmer kann darauf vertrauen, sich dabei auszuzeichnen, ob er in ihr umkommt oder sie überlebt. Darf ich – nicht in offizieller Funktion, sondern im Rahmen einer freundschaftlichen Plauderei – einige Einzelheiten aus Ihrer Vergangenheit auf See erfahren?«
»Wie Sie sehen, Kommandant, ist meine Vergangenheit auf See keine zwei Jahre alt. Ich habe bei Surcouf gedient. Ich habe an dem berühmten Kampf teilgenommen, in dem er mit hundert Mann Besatzung und sechzehn Kanonen die Standard gekapert hat, die achtundvierzig Kanonen und vierhundertfünfzig Mann an Bord hatte; danach war ich Kapitän dieser kleinen Slup und habe eine Fahrt nach Birma unternommen; als ich zur Île de France zurückkam, hatte ich das Glück, Surcouf gegen zwei englische Schiffe zu Hilfe zu kommen und eines dieser beiden Schiffe einzunehmen, das mit sechzehn Kanonen und sechzig Mann Besatzung ausgestattet war, obwohl ich nur über achtzehn Leute verfügte.«
»Surcouf kenne ich gut«, sagte Lucas, »er ist einer unserer kühnsten Korsaren.«
»Hier habe ich ein Schreiben von ihm für den Fall, Ihnen zu begegnen.«
Und René reichte dem Kapitän der Redoutable den Brief, den Surcouf ihm mitgegeben hatte.
Lucas las jede Zeile mit größter Aufmerksamkeit.
»Monsieur«, sagte er zu René, »Sie müssen ein außergewöhnlicher Mensch sein, denn sonst würde Surcouf Sie nicht in den höchsten Tönen loben; er schreibt mir, Sie hätten von ihrem Prisenanteil von fünfhunderttausend Francs vierhunderttausend Francs Ihren Matrosen überlassen und hunderttausend den Armen der Île de France, was bedeutet, dass Sie von Haus aus sehr wohlhabend und für die Marine geboren sein müssen, da Sie, wie man mir mitteilt, Ihre Laufbahn als einfacher Korsar begonnen haben, um sich schneller hochzudienen als in der kaiserlichen Marine. Leider kann ich Ihnen an Bord der Redoutable nur die Stelle eines dritten Leutnants anbieten.«
»Das ist weit mehr, als ich zu hoffen gewagt hätte, Kommandant, und ich nehme dankbar an. Wann kann ich meinen Dienst antreten?«
»Sobald Sie wollen!«
»Sobald wie möglich, Kommandant: Es riecht verteufelt nach Pulver, und ich bin mir sicher, dass ich in spätestens drei bis vier Tagen die große Schlacht erleben werde, derentwegen ich aus der anderen Hemisphäre hergekommen bin. Mein Schiff ist zu klein, um Ihnen von Nutzen zu sein; ich kehre an Bord zurück, schicke das Schiff nach Frankreich und komme wieder.«
Lucas erhob sich und sagte mit einem wohlwollenden Lächeln: »Ich erwarte Sie, Leutnant.«
René schüttelte ihm voller Wärme beide Hände, sprang die Leiter hinunter und kehrte an Bord seiner Slup zurück.
Dort rief er François in seine Kajüte.
»François«, sagte er zu ihm, »ich bleibe hier; ich vertraue dir meine Slup an, die du nach Saint-Malo zurückbringen sollst. Ich gebe dir ein Portefeuille mit, das mein Testament enthält; wenn ich falle, wirst du in diesem Testament bedacht sein. Außerdem nimm diesen Beutel mit Edelsteinen mit; wenn ich falle, wirst du diesen Beutel Mademoiselle Claire de Sourdis überbringen; sie wohnt bei ihrer Mutter, der Gräfin von Sourdis, im Hôtel de Sourdis, das an den Quai und an die Rue de Beaune angrenzt.
In dem Beutel ist ein Brief, der die Herkunft der Edelsteine erklärt; aber öffne das Testament und überbringe den Beutel nur, wenn mein Tod dir stichhaltig bewiesen werden kann. In den Schiffspapieren habe ich deinen Namen als den des gegenwärtigen Besitzers eintragen lassen. Wache ein Jahr lang über das Schiff; in der Schublade meines Sekretärs wirst du zwölf Rollen Goldstücke zu jeweils tausend Francs finden, und drei davon sollen dir helfen, dieses Jahr zu überstehen. Falls die Engländer dich festhalten sollten, wirst du die amerikanische Nationalität deines Schiffs ins Feld führen, und wenn man dich fragen sollte, was aus mir geworden ist, wirst du antworten, ich sei unterwegs auf Nelsons Flotte gestoßen und auf einem seiner Schiffe an Bord gegangen. Adieu, mein lieber François, lass dich umarmen, lass mir meine Waffen holen und versuche, ohne Schiffbruch nach Saint-Malo zu gelangen. Sobald du dort ankommst, wirst du Madame Surcouf und der Familie Nachricht von Robert geben.«
»Das heißt«, sagte François, der sich mit seiner Pratze von Hand und mit dem Jackenzipfel die Augen wischte, »das heißt, dass Sie mich nicht gern genug haben, um mich mitzunehmen, obwohl ich Ihnen bis an das Ende der Welt und noch weiter gefolgt wäre. Oh, Himmelsapperlott! Es bricht mir das Herz, Sie zu verlassen!«
Und der Wackere begann zu schluchzen.
»Ich verlasse dich«, fuhr René unbeirrt fort, »weil ich dich für meinen einzigen Freund halte, weil du der einzige Mensch bist, auf den ich mich verlassen kann, weil dieses Portefeuille eine halbe Million enthält und der Beutel Edelsteine im Wert von mehr als dreihunderttausend Francs und weil ich in dem Wissen, dass diese Gegenstände dir anvertraut sind, so unbesorgt sein kann, als wären sie in meinen Händen. Lass uns einander die Hand drücken, wie es wackeren Leuten geziemt. Lass uns einander lieben, wie es wackeren Herzen geziemt. Laß uns einander umarmen als gute Freunde!... Du wirst mich an Bord der Redoutable bringen, und du wirst der Letzte sein, von dem ich Abschied nehme.«
François musste einsehen, dass an Renés Entschluss nicht zu rütteln war. René ergriff seine Waffen, die nurmehr aus seinem Stutzen, einem zweiläufigen Gewehr und seiner Enteraxt bestanden; dann ließ er die Mannschaft an Deck antreten, verkündete ihr, was er zu tun beabsichtigte, und forderte die Männer auf, ihren Kameraden François als Anführer anzuerkennen.
Ungeheuchelter Kummer war das Ergebnis seiner Ansprache; doch René bot ihnen an, zu gleichen Bedingungen, das heißt zu normalem Sold, ein Jahr lang in Saint-Malo an Bord der Runner of New York zu bleiben; und so bestieg er unter lautstarken Treuebezeigungen in Begleitung von François und sechs Ruderern die Jolle.
Zehn Minuten später war er bei Kapitän Lucas.
In Gegenwart des Kapitäns nahm er Abschied von François.
Eine der größten Empfehlungen eines Menschen sind die liebevollen Gefühle, die seine Untergebenen ihm entgegenbringen. Und da René von seinen Leuten vergöttert wurde, vermittelten François’ Tränen und der Kummer der anderen Matrosen dem Kapitän ein anschauliches Bild von der Beliebtheit seines dritten Leutnants bei seiner früheren Mannschaft. Und beim Abschied nahm Kapitän Lucas eine schöne Meerschaumpfeife von der Wand und schenkte sie François.
François, der nicht wusste, wie er seine Dankbarkeit ausdrücken sollte, schluchzte noch heftiger und ging, ohne ein Wort herausgebracht zu haben.
»Diese Art zu zeigen, welche Meinung man von anderen hat, gefällt mir nicht übel«, sagte Lucas. »Sie müssen ein guter Junge sein, wenn man Sie so liebt. Setzen wir uns und plaudern wir.«
Und zur Einladung setzte er sich als Erster und begutachtete Renés Waffen.
»Zu meinem Bedauern«, sagte René, »habe ich meine Waffen unter meinen Freunden auf der Île de France verteilt, sonst hätte ich Ihnen ein Geschenk machen können, das Ihrer würdig wäre, doch nun besitze ich nichts mehr als diese drei Dinge, wählen Sie...«
»Es heißt, Sie seien ein ausgezeichneter Schütze«, sagte Lucas. »Behalten Sie die Gewehre, ich nehme die Axt, der ich beim nächsten Kampf Ehre zu machen gedenke.«
»Apropos«, sagte René, »wenn die Frage nicht zu indiskret ist: Wann wird das sein?«
»Meiner Treu«, sagte Lucas, »lange kann es nicht mehr dauern. Der Kaiser hat Villeneuve anweisen lassen, mit der vereinigten spanischen und französischen Flotte in See zu stechen, Kurs auf Cartagena zu halten, um dort den Konteradmiral Salcedo aufzunehmen, und von Cartagena nach Neapel zu fahren, um die Truppen an Land abzusetzen, die sich der Armee des Generals Saint-Cyr anschließen sollen. ›Wir wünschen‹, hat der Kaiser hinzugefügt, ›dass Sie überall, wo Sie auf einen zahlenmäßig überlegenen Gegner treffen, unverzüglich angreifen. Führen Sie eine Entscheidung herbei; Sie werden wissen, dass Voraussetzung für den Erfolg dieser Operationen Ihr umgehender Aufbruch von Cadiz ist. Wir rechnen darauf, dass Sie alles tun werden, um umgehend in Aktion zu treten, und wir legen Ihnen in diesem wichtigen Unterfangen größtmögliche Kühnheit und größte Tatkraft ans Herz.‹ Der Kaiser war Villeneuve gegenüber denkbar offen, denn der Admiral zählt in seinen Augen zu jenen, denen man die Sporen geben muss und nicht Zügel anlegen. Gleichzeitig hat er angeordnet, dass Vizeadmiral Rosily aus Paris abreiste und in Cadiz, falls er dort die Flotte vorfände, das Kommando über die vereinigte Flotte übernähme, die Admiralsflagge am Großmast der Bucentaure setzte und Admiral Villeneuve nach Frankreich zurückschickte, wo dieser sich für seine Kampagne würde rechtfertigen müssen.«
»Hoho!«, sagte René. »Das ist starker Tobak.«
Lucas fuhr fort: »Der Kriegsrat hat sich bei Admiral Villeneuve versammelt; die Admiräle und Divisionskommandeure, die Konteradmiräle Dumanoir und Magon, die Kapitäne Cosmao, Maistral, Devillegris und Prigny vertreten das französische Geschwader; sie werden über den Zustand jedes einzelnen Schiffs und zu ihren Hoffnungen und Befürchtungen befragt.«
Beim Reden war Lucas auf- und abgegangen; unvermittelt blieb er vor René stehen. »Kennen Sie die Worte des Kaisers?«, fragte er.
»Nein, mein Kommandant, ich weiß von nichts, denn seit zwei Jahren habe ich keinen Fuß nach Frankreich gesetzt.«
»Er sagte: ›Die Engländer werden recht kleinlaut sein, wenn es in Frankreich zwei oder drei Admiräle gibt, die den Tod suchen.‹ Und ohne Admiräle zu sein«, fuhr Lucas fort, »können wir Seiner Majestät doch in wenigen Tagen beweisen, dass es in Ermangelung von Admirälen, die den Tod suchen, immerhin Kapitäne gibt, die den Tod nicht scheuen.«
An dieser Stelle waren Lucas und René in ihrem Gespräch angelangt, als ein Offizier eintrat.
»Kapitän«, sagte er zu Lucas, »es wird signalisiert, dass alle Kapitäne sich an Bord des Admiralsschiffs zu begeben haben.«
»Sehr gut, lassen Sie die Jolle klarmachen«, erwiderte Lucas.
Als die Jolle bereit war, stieg er hinunter, und ebenso wie die Jollen der fünf oder sechs anderen Kapitäne, die nicht an der Sitzung des Kriegsrats teilgenommen hatten, fuhr sie zu der Bucentaure.
René ließ sich unterdessen die Unterkunft des dritten Leutnants zeigen, dessen Stelle er einnehmen sollte. Es war eine hübsche Kajüte, größer und bequemer als seine Kapitänskajüte an Bord der Runner of New York.
Kaum hatte er seine Koffer untergebracht, kehrte Kommandant Lucas an Bord zurück. René wollte ihn nicht aufsuchen, ohne gerufen worden zu sein, doch nach dem Gespräch, das sie geführt hatten, zweifelte er nicht daran, dass der Kapitän ihm die Ehre einer zweiten Unterhaltung erweisen würde.
Er täuschte sich nicht: Fünf Minuten nach seiner Rückkehr ließ der Kapitän ihn rufen.
René wartete ehrerbietig, dass sein Vorgesetzter das Wort an ihn richtete.
»Wohlan!«, sagte Lucas. »Die Schlacht wird morgen oder übermorgen stattfinden. Der Admiral hat geantwortet: ›Wenn der Wind es erlaubt, werde ich schon morgen aufbrechen.‹ Im selben Moment wurde ihm die Nachricht überbracht, dass Nelson sechs seiner Schiffe Kurs auf Gibraltar hat nehmen lassen; daraufhin hat Admiral Villeneuve Admiral Gravina zu sich gebeten, und nach kurzer Beratung mit Gravina hat er alle Kapitäne rufen lassen, die bei der Beratung nicht zugegen gewesen waren, und ihnen Ordre erteilt, Segel zu setzen. Das war das Signal, dem ich Folge geleistet habe.«
»Werden Sie mir eine bestimmte Aufgabe zuteilen?«, fragte René.
»Wissen Sie«, sagte Lucas, »Sie kennen weder mein Schiff noch meine Männer. Machen Sie sich erst einmal mit ihnen vertraut. Sie haben den Ruf eines guten Schützen; suchen Sie sich einen hochgelegenen Standpunkt, von dem aus Sie das Deck des Schiffs, das wir angreifen werden, gut im Blick haben. Schießen Sie so viele goldene Epauletten ab, wie Sie können, und wenn es ans Entern geht, folgen Sie einfach Ihrer Eingebung. Ich behalte Ihre Axt, die mir gut zupasskommt. Ich habe angeordnet, dass mein Entersäbel in Ihre Kajüte gebracht wird. Er ist zu groß für mich«, fügte Lucas hinzu und lachte über seine geringe Körpergröße, »aber er ist genau das Richtige für Sie.«
Die Männer verabschiedeten sich voneinander, und René zog sich in seine Kajüte zurück.
Dort fand er einen herrlichen Damaszenersäbel aus Tunis mit breiter, gebogener Klinge vor, aus jenem gehärteten Stahl geschmiedet, der erlaubt, mit einer bestimmten Bewegung des Handgelenks einen indischen Schal in der Luft zu zerschneiden.
Im Augenblick des Aufbruchs musste man jedoch feststellen, dass in den zweieinhalb Monaten Aufenthalt im Hafen von Cadiz nicht wenige Männer Geschmack am Desertieren gefunden hatten; insbesondere die Spanier hatten fast ein Zehntel ihrer Besatzung eingebüßt.
Den ganzen Tag suchte man in den Straßen von Cadiz möglichst vieler Deserteure habhaft zu werden, doch viele waren schon auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Um sieben Uhr morgens am 19. Oktober setzten sich die vereinigten Seestreitkräfte in Bewegung.
Nelson erfuhr davon; er befand sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Großteil der englischen Flotte ungefähr sechzehn Meilen in westnordwestlicher Richtung von Cadiz entfernt.
Er wusste, dass Villeneuve ihm entfliehen konnte, wenn er vor den Engländern in die Meerenge gelangte, und deshalb hielt er Kurs darauf, um Villeneuve die Durchfahrt zu versperren.
Doch die Ausfahrt aus dem Hafen von Cadiz ist nicht einfach. Sechs Jahre vor Admiral Villeneuve hatte Admiral Bruix drei Tage gebraucht, um den Hafen zu verlassen.
Windstille und Gegenströmung vereitelten den Aufbruch der Armee, und im Verlauf des 19. Oktobers gelang es nur acht bis zehn Schiffen, aufs offene Meer hinauszukommen.
Am Tag darauf ermöglichte leichter Südostwind dem Geschwader die Ausfahrt; das schöne Wetter war über Nacht dichter Bewölkung gewichen, und man rechnete mit stürmischen Winden aus südwestlicher Richtung; hielt die Brise lange genug an, konnte sie die vereinigte Flotte bis zum Kap von Trafalgar und in günstige Winde führen; wenn der Sturm dann erst ausbrach und von Osten nach Südwesten blies, käme er Villeneuve gerade recht.
Um zehn Uhr morgens hatten die letzten französischen und spanischen Schiffe den Hafen von Cadiz verlassen. Die englische Flotte befand sich wenige Meilen vom Kap von Spartel entfernt und bewachte die Einfahrt in die Meerenge.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Villeneuve den Entschluss gefasst, nicht mehr zurückzuweichen, und schrieb als letzte Depesche an Marineminister Decrès: »Das ganze Geschwader ist ausgelaufen... Der Wind bläst aus Südsüdwest; ich glaube jedoch, dass er nicht lange anhalten wird. Man hat mir achtzehn Segel signalisiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Sie als Nächstes von den Einwohnern von Cadiz hören werden... Ich habe in dieser Sache, wertester Herr, nichts zum Ratgeber genommen als den glühenden Wunsch, den Absichten Seiner Majestät nachzukommen und alles zu tun, was in meiner Macht steht, um den Verdruss auszuräumen, den die Geschehnisse der letzten Kampagne Seiner Majestät eingeflößt haben. Sollte dieser Feldzug gelingen, wird es mich schwer ankommen, nicht zu glauben, dass es so vorherbestimmt war und dass alles von der Vorsehung zum größten Nutzen und Frommen Seiner Majestät eingerichtet war.«
91
Der kleine Vogel
Zwei Monate vor der Zeit, die wir erreicht haben, war Nelson felsenfest davon überzeugt gewesen, seine militärische Laufbahn ein für alle Mal beendet zu haben. Er hatte sich mit Lady Hamilton in die herrliche Landschaft von Merton zurückgezogen. Lord Hamilton war gestorben, und das einzige Hindernis eines Ehebunds der zwei Liebenden war die Existenz von Mrs. Nisbett, die Nelson einige Jahre zuvor geheiratet hatte.
Wie gesagt hatte Nelson nicht die Absicht, noch einmal in See zu stechen; der Triumphe überdrüssig, des Ruhmes müde, mit Ehrungen überhäuft, versehrt und verstümmelt, verlangte es ihn nur noch nach Einsamkeit und Frieden.
In der Hoffnung, beides in Merton zu finden, hatte er alles, was ihm lieb und teuer war, von London auf seinen Landsitz bringen lassen.
Die schöne Emma Lyon war sich der Zukunft gewisser denn je, als ein Blitzschlag sie aus ihren süßen Träumen riss.
Am 2. September 1805, keine zwölf Tage nach Nelsons Heimkehr, wurde um fünf Uhr morgens in Merton an die Tür geklopft. Nelson, der vermutete, dass es sich um eine Botschaft der Admiralität handelte, sprang aus dem Bett und ging den Besucher empfangen.
Es war Kapitän Blackwood (»schwarzes Holz«); er kam in der Tat von der Admiralität und brachte die Nachricht, dass die vereinigten Flotten Frankreichs und Spaniens, die Nelson so lange verfolgt hatte, im Hafen von Cadiz festsaßen.
Nelson, der Blackwood erkannte, rief: »Blackwood, ich wette, Sie bringen mir Neuigkeiten von den vereinigten Flotten und die Nachricht, dass ich sie vernichten soll.«
Nichts anderes sollte Blackwood ihm mitteilen, denn nichts anderes erwartete man von ihm.
Alle Zukunftsträume Nelsons hatten sich in Luft aufgelöst; er sah nichts anderes mehr vor sich als den kleinen Winkel der Erde oder eher des Meeres, der die vereinigten Flotten Frankreichs und Spaniens barg, und freudestrahlend sagte er immer wieder zu seinem Besucher: »Blackwood, Sie können sich darauf verlassen, dass ich Villeneuve einen Denkzettel verpassen werde, den er so bald nicht vergessen wird.«
Zuerst hatte er nach London abreisen und den Feldzug vorbereiten wollen, ohne Emma gegenüber auch nur ein Wort von der neuen Aufgabe zu verlieren, die ihm übertragen worden war.
Erst im letzten Augenblick wollte er ihr alles sagen. Doch da sie mit ihm zusammen das Bett verlassen hatte und ihr aufgefallen war, wie geistesabwesend er sich seit dem Gespräch mit Blackwood zeigte, führte sie ihn in einen Winkel des Gartens, den er ganz besonders liebte und den er seine Wachtbank nannte.
»Was beschäftigt Sie, mein Freund?«, fragte sie ihn. »Irgendetwas macht Ihnen Sorgen, und Sie wollen es mir nicht sagen.«
Nelson zwang sich zu einem Lächeln. »Was mich beschäftigt, ist, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Welche Wünsche sollte ich noch haben, der ich Ihre Liebe genieße und inmitten meiner Familie lebe? Ich würde weiß Gott keinen roten Heller dafür geben, dass der König mein Onkel wäre.«
Emma fiel ihm ins Wort. »Ich kenne Sie, Nelson«, sagte sie, »und Sie müssen sich keine Mühe geben, mich zu täuschen. Sie wissen, wo die gegnerische Flotte sich befindet, Sie betrachten sie als Ihre Beute, und Sie wären der unglücklichste aller Menschen, wenn ein anderer als Sie den tödlichen Schlag gegen sie führte.«
Nelson sah sie an, als wollte er sie etwas fragen.
»Nun denn, mein Lieber«, fuhr Emma fort, »vernichten Sie diese Flotte und beenden Sie, was Sie so gut begonnen haben; dieser letzte Schlag wird Sie für die zwei Jahre voller Mühen entschädigen, die Sie hinter sich haben.«
Nelson sah seine Geliebte noch immer schweigend an, doch auf seiner Miene begann sich eine Dankbarkeit abzumalen, die in Worten kaum auszudrücken gewesen wäre.
Emma sagte: »Mag der Schmerz Ihrer Abwesenheit mich noch so heftig treffen, bieten Sie Ihre Dienste Ihrem Vaterland an, wie Sie es stets getan haben, und brechen Sie unverzüglich nach Cadiz auf. Ihre Dienste wird man dankbar annehmen, und Ihr Herz wird seinen Frieden wiederfinden. Sie werden einen letzten und glorreichen Sieg erringen, und Sie werden in der glücklichen Gewissheit zurückkehren, hier Frieden und Würde vereint vorzufinden.«
Nelson sah sie noch immer schweigend an, doch nach einigen Sekunden rief er mit nassen Augen: »Hochherzige Emma! Gute Emma! Ja, du hast in meinem Herzen gelesen, ja, du hast meine Gedanken erraten. Ohne Emma gäbe es keinen Nelson. Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin; noch heute werde ich nach London aufbrechen.«
Die Victory, mit dem optischen Telegraphen herbeibeordert, befand sich noch am gleichen Abend auf der Themse, und am nächsten Tag wurde alles für die Abreise vorbereitet.
Die Liebenden blieben noch zehn Tage lang zusammen. Die letzten fünf Tage verbrachte Nelson fast ausschließlich bei der Admiralität; am 11. September besuchten sie ein letztes Mal ihr geliebtes Merton, verbrachten den ganzen Tag des 12. Septembers ungestört und übernachteten dort.
Eine Stunde vor Tagesanbruch stand Nelson auf und ging in das Zimmer seiner Tochter, beugte sich über ihr Bett und betete leise und tränenreich, was ihn sehr erleichterte.
Nelson war ausgesprochen religiös.
Um sieben Uhr morgens verabschiedete er sich von Emma; sie begleitete ihn zu seinem Wagen; dort drückte er sie lange an sein Herz; sie weinte heftig, versuchte jedoch, durch die Tränen zu lächeln, und sagte: »Kämpfen Sie nicht, ohne den kleinen Vogel gesehen zu haben.«
Um einen Menschen zu ermessen, muss man ihn nicht in seiner Größe beurteilen, sondern in seinen Schwächen.
Dies ist die Legende von Nelsons kleinem Vogel: Als Emma Lyon zum ersten Mal den »Helden des Nils« erblickte, wie Nelson damals genannt wurde, kam er wie gesagt gerade von der Seeschlacht von Abukir zurück. Sie wurde ohnmächtig, als sie ihn umarmte. Nelson ließ sie in seine Kabine bringen, und als sie wieder zu sich kam, flog ein kleiner Vogel zum Fenster herein und setzte sich Horatio auf die Schulter.
Als Emma die Augen aufschlug, die vielleicht nie ganz geschlossen gewesen waren, fragte sie: »Was ist das für ein kleiner Vogel?«
Nelson lächelte und antwortete: »Das, gnädige Frau, ist mein guter Geist. Als dieser Baum geschlagen wurde, um zu einem Schiffsmast zu werden, war in seinen Zweigen ein Nest bengalischer Finken; jeder meiner Siege wurde mir von einem Besuch dieses bezaubernden kleinen Sängers angekündigt, wo ich mich auch befand. Zweifellos harrt meiner abermals ein Sieg, denn sonst würde der kleine Vogel mich nicht besuchen.
Aber der Tag, an dem ich mich in den Kampf begebe, ohne ihn am Vortag oder am Tag der Entscheidung gesehen zu haben, wird mein Unglück besiegeln, dessen bin ich mir gewiss.«
Und wahrhaftig verkündete ihm der kleine Vogel seinen schönsten Sieg, den Sieg über Emma Lyon.
Bei der Bombardierung Kopenhagens hatte ihn der Gesang des Vögleins geweckt, ohne dass er hätte sagen können, wie der Vogel in seine Kajüte gelangt war.
Deshalb hatte Emma nun zu ihm gesagt, er solle nicht kämpfen, ohne den kleinen Vogel gesehen zu haben.
Am nächsten Morgen hatte Nelson Portsmouth erreicht, und am 15. September war er in See gestochen.
Das Wetter war jedoch so schlecht, dass die Victory trotz Nelsons Ungeduld genötigt war, zwei ganze Tage in Sichtweite der englischen Küste zu kreuzen.
Diese Verzögerung erlaubte Nelson, vor seiner endgültigen Abreise der Geliebten zwei Briefe zukommen zu lassen, die voller Zärtlichkeit an sie und an ihre Tochter gerichtet waren, in denen sich jedoch auch traurige Vorahnungen bemerkbar machten.
Als das Wetter zuletzt günstig war, konnte er den Ärmelkanal verlassen, und am 20. September um sechs Uhr abends erreichte er die englische Flotte vor Cadiz, die aus dreiundzwanzig Linienschiffen unter dem Kommando Vizeadmiral Collingwoods bestand.
Am selben Tag war Nelsons sechsundvierzigster Geburtstag.
Am 1. Oktober schrieb er Emma in dem nachfolgend abgedruckten Brief, dass er sich mit Collingwood vereinigt hatte und dass ihn eine der nervösen Störungen quälte, die ihn immer wieder heimsuchten, seit er von einer Schlange gebissen worden war.
Sein Brief lautet:
1. Oktober 1805
Meine vielgeliebte Emma,
es ist mir ein Trost, zur Feder zu greifen und Ihnen ein paar Zeilen zu schreiben, denn gegen vier Uhr morgens hatte ich einen meiner schmerzhaften Krämpfe, der mir jede Kraft geraubt hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass einer dieser Anfälle mich eines Tages das Leben kosten wird. Doch der Anfall ist vorbei und hat nur ein Gefühl großer Schwäche hinterlassen. Seit sieben Uhr abends war ich mit Schreiben beschäftigt, und vermutlich hat die Erschöpfung den Anfall ausgelöst.
Am 20. September habe ich spätabends die Flotte erreicht und konnte mich erst am nächsten Morgen mit den anderen besprechen. Meine Anwesenheit wurde nicht nur vom Kommandanten der Flotte, sondern offenbar von jedem einzelnen Besatzungsmitglied begrüßt, und als ich den Offizieren meinen Schlachtplan dargelegt habe, war es für sie wie eine Offenbarung, die sie in Begeisterungsstürme ausbrechen ließ. Einige haben sogar Tränen vergossen. Es war etwas Neues, etwas Besonderes, etwas Einfaches, und wenn wir diesen Plan gegen die französische Flotte zur Anwendung bringen können, sollte der Sieg uns gewiss sein: ›Sie weilen inmitten von Freunden, die Ihnen vorbehaltlos vertrauen!‹, riefen alle Offiziere. Mag sein, dass es den einen oder anderen Judas unter ihnen gibt, doch die Mehrzahl ist zweifellos glücklich, dass ich sie anführe.
Soeben erhielt ich Briefe des neapolitanischen Königspaars als Erwiderung auf meine Briefe vom 18. Juni und vom 12. Juli. Kein Wort an Sie! Dieses Königspaar würde wahrlich sogar die personifizierte Undankbarkeit erröten machen! Abschriften dieser Briefe lege ich meinem Brief bei, der bei erster Gelegenheit nach England abgehen wird und Ihnen sagen wird, wie sehr ich Sie liebe.
Der kleine Vogel hat sich noch nicht gezeigt, aber ich habe keine Zeit vergeudet.
Mein verstümmelter Körper weilt hier; mein ganzes Herz weilt bei Ihnen.
H. N.
Genau einen Monat nachdem Nelson zu Collingwoods Flotte gestoßen war, erhielt Admiral Villeneuve wie gesagt von der französischen Regierung den Befehl, in See zu stechen, die Meerenge zu durchqueren, Truppen an der Küste Neapels abzusetzen und in den Hafen von Toulon zurückzukehren, nachdem er zuvor das Mittelmeer von allen englischen Schiffen befreit haben würde.
Die vereinigte Flotte aus dreiunddreißig Linienschiffen, achtzehn französischen und fünfzehn spanischen, zeigte sich erstmals am Sonntag, dem 20. Oktober, um sieben Uhr morgens bei leichtem Wind.
Am Vormittag desselben Tages schien das Seegefecht unmittelbar bevorzustehen, und Nelson schrieb zwei Briefe, einen an seine Geliebte, den anderen an Horatia.
Meine teuerste und vielgeliebte Emma, soeben erfuhr ich, dass die gegnerische Flotte den Hafen verlassen hat; der Wind ist sehr schwach, und ich habe wenig Hoffnung, sie vor dem morgigen Tag einzuholen; möge der Kriegsgott unsere Mühen mit einem überwältigenden Sieg krönen. Siegreich oder tot, ich vertraue darauf, dass mein Name Ihnen und Horatia nur umso teurer werden wird, denn ich liebe Sie beide mehr als mein Leben.
Beten Sie für Ihren Freund
NELSON
Dann schrieb er an Horatia:
An Bord der Victory, 19. Oktober 1805
Mein geliebter Engel, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, seit ich Ihr Briefchen vom 19. September erhielt. Es freut mich sehr, dass Sie ein braves Mädchen sind und dass Sie meine teure Lady Hamilton gern haben, die Sie abgöttisch liebt. Geben Sie ihr einen Kuss von mir. Die vereinigte gegnerische Flotte verlässt den Hafen von Cadiz, soweit ich weiß; deshalb beeile ich mich, Ihren Brief zu beantworten, meine liebe Horatia, denn Sie sollen wissen, dass ich immer an Sie denke. Ich vertraue darauf, dass Sie für mein Seelenheil beten, für meinen Ruhm und für meine baldige Rückkehr nach Merton.
Empfangen Sie, mein liebes Kind, den Segen Ihres Vaters.
NELSON
Am nächsten Tag fügte er seinem Brief an Emma folgendes Postskriptum hinzu:
20. Oktober, morgens
Wir erreichen den Eingang der Meerenge; vierzig Segel sollen in der Ferne zu sehen sein. Ich nehme an, dass es dreiunddreißig Linienschiffe und sieben Fregatten sind, und da der Wind sehr kalt ist und das Meer sehr unruhig, glaube ich, dass sie vor Einbruch der Nacht in den Hafen zurückkehren werden.
Und als Nelson zuletzt die vereinigte gegnerische Flotte erblickte, schrieb er in sein privates Notizbuch:
Möge der Allmächtige, dem ich auf den Knien huldige, im Interesse des unterdrückten Europas England einen umfassenden und überwältigenden Sieg schenken, und möge er uns die Gnade gewähren, dass keine Verfehlung der siegreich Kämpfenden den Sieg schmälert. Was mich betrifft, empfehle ich mein Leben meinem Schöpfer an. Möge der Segen des Herrn auf meinen Bestrebungen ruhen, treu meinem Land zu dienen. Ihm allein überantworte ich die heilige Sache, zu deren Verteidigung mich zu berufen er die Gnade hatte. Amen! Amen! Amen!«
Und nach diesem Gebet in seiner Mischung aus Mystik und Begeisterung, die zu manchen Zeiten unter der rauen Schale des Seefahrers sichtbar wurde, setzte er sein letztes Testament auf:
21. Oktober 1805,
im Angesicht der vereinigten Flotte Frankreichs und Spaniens in etwa zehn Meilen Entfernung zu uns.
In Anbetracht des Umstands, dass Emma Lyon, Witwe Sir William Hamiltons, weder vom König noch von der Nation je die erheblichen Dienste gedankt wurden, die sie dem König und der Nation geleistet hat, erinnere ich ausdrücklich daran, dass es Lady Hamilton erstens im Jahr 1799 gelang, sich Kenntnis von einem Brief des Königs von Spanien an seinen Bruder, den König von Neapel, zu verschaffen und zu erfahren, dass der König von Spanien England den Krieg zu erklären beabsichtigte, woraufhin der Premierminister Sir John Jervis den Befehl erteilen konnte, die spanischen Arsenale und die spanische Flotte zu vernichten, sofern sich Gelegenheit dazu bot, und wenn nichts dergleichen geschehen ist, dann trägt daran Lady Hamilton kein Verschulden; dass zweitens die britische Flotte unter meinem Kommando kein zweites Mal nach Ägypten hätte zurückkehren können, wenn nicht Lady Hamilton ihren Einfluss auf die Königin von Neapel dahingehend verwendet hätte, dem Gouverneur von Syrakus den Befehl erteilen zu lassen, unserer Flotte zu gestatten, sich in den Häfen Siziliens mit allem zu versehen, was sie benötigte, so dass ich auf diesem Weg alles erhielt, was ich brauchte, und die französische Flotte vernichten konnte.
Deshalb lege ich es meinem König und meinem Vaterland anheim, Lady Hamilton für ihre Dienste zu belohnen und für ihren Unterhalt aufzukommen.
Außerdem empfehle ich meine Adoptivtochter Horatia Nelson dem Wohlwollen der Nation, und ich wünsche, dass sie künftig den Namen Nelson tragen wird.
Dies sind die einzigen Gunstbeweise, um die ich den König von England bitte, nun ich im Begriff stehe, mein Leben für mein Vaterland einzusetzen. Möge Gott meinen König und mein Vaterland und alle, die mir teuer sind, in seine Obhut nehmen!
NELSON
Die Vorkehrungen, die Nelson traf, um die Zukunft seiner Geliebten zu sichern und zu festigen, beweisen hinlänglich, dass ihn Todesahnungen beschäftigten. Um seinem Testament noch mehr Nachdruck zu verleihen, rief er Hardy, seinen Flaggkapitän, und Blackwood, den Kapitän der Euryalus, der ihn in Merton abgeholt hatte, herbei und ließ sie das Testament als Zeugen unterschreiben. Beider Namen finden sich im Bordbuch neben Nelsons Namen eingetragen.
92
Trafalgar
Zu jener Zeit, also am 21. Oktober 1805, war in Frankreich nur ein Vorgehen in Seegefechten bekannt: sich dem Feind in einer langen Schlachtlinie zu nähern, am besten mit günstigem Wind, das jeweils gegenüber befindliche gegnerische Schiff zu beschießen und es zu zerstören oder von ihm zerstört zu werden, je nachdem, wie der Zufall entschied.
Es gab noch andere Grundsätze, beinahe Glaubensregeln, die den Kampf für unsere Feinde gefahrloser machten als für uns.
Die von der Marine veröffentlichten offiziellen Anweisungen wiesen mit allem Nachdruck darauf hin, erstes und vornehmstes Ziel eines Seegefechts sei, das Schiff des Gegners abzutakeln und zu entmasten.
»Bei Gefechten mit den Franzosen«, schreibt der englische General Sir Edward Douglas, »ist uns immer wieder aufgefallen, dass die Takelage unserer Schiffe weitaus schwerer beschädigt wurde als der Schiffsrumpf.«
Hinzu kam die Überlegenheit der englischen Artillerie; die englischen Kanonen ließen sich dreimal so schnell laden und abfeuern wie die unseren. Als Ergebnis dieser Diskrepanz übersäten die Engländer unsere Schiffsdecks mit Toten, während unsere Kanonenkugeln, die auf Masten und Tauwerk zielten, oft genug ergebnislos verschossen wurden. Ein englisches Kriegsschiff mit vierundsiebzig Kanonen hingegen feuerte bei jeder Breitseite dreitausend Pfund Eisen in die Luft, die pro Sekunde fünfhundert Meter zurücklegten. Wenn diese dreitausend Pfund Eisen auf einen Schiffskörper trafen, anders gesagt: auf ein Hindernis, das sie durchschlagen und zu Splittern zertrümmern konnten, die todbringender waren als die Kugeln selbst, dann zermalmten sie den Schiffsrumpf, setzten die Kanonen außer Gefecht und töteten jeden, der ihnen in den Weg kam.
Diesem Hagel von Kanonenkugeln, schrieb Nelson an die Admiralität, verdanke England seine unumschränkte Herrschaft auf dem Meere und er selbst verdanke ihm seinen Sieg bei Abukir fünf Jahre zuvor.
Was die Formation der Schlachtlinie betrifft, hatte Nelson diese seit Langem aufgegeben und durch eine Gefechtsordnung ersetzt, die bei uns noch unbekannt war. Er bildete Kolonnen aus seinen Schiffen, die zu einem V oder Spitzkeil angeordnet waren, um die französische Schlachtlinie zu durchbrechen; sein eigenes Schiff erhielt dabei die Position an der Spitze dieses makedonischen Keils mit der Aufgabe, die feindliche Schlachtlinie aufzubrechen, von beiden Seiten aus zu feuern und sich dann zurückzuziehen; die zweite Kolonne sollte genauso vorgehen, und bevor den abgeschnittenen gegnerischen Schiffen Hilfe zuteilwerden konnte, waren sie vernichtet.
In dem Kriegsrat, den Admiral Villeneuve zwei Tage früher abgehalten hatte, hatte er gesagt: »Das Bestreben all unserer Schiffe muss sein, den angegriffenen Schiffen Beistand zu leisten und dem Schiff des Admirals nachzueifern, das ihnen darin Vorbild sein wird. Jeder kommandierende Kapitän muss sich mehr auf seine Tapferkeit und seine Liebe zum Ruhm verlassen als auf die Signale des Admirals, der selbst in den Kampf verwickelt und vom Rauch verdeckt ist und vielleicht keine Gelegenheit findet, Signale setzen zu lassen:
Jeder Kapitän, der nicht mitten im Gefecht ist, befindet sich nicht an seinem Posten, und das Signal, das ihn dorthin zurückruft, wird für alle Zeiten seine Ehre beflecken.«
Nelson hatte gesagt: »Ich werde meine Flotte in zwei Kolonnen aufteilen und dann zwei verschiedene Schlachten schlagen: einen Angriffskampf, den ich Collingwood überlassen werde, und einen Verteidigungskampf, den ich selbst übernehmen werde. Villeneuve wird seine Schlachtlinie voraussichtlich fünf bis sechs Meilen breit entfalten; ich werde mich auf ihn werfen und seine Linie in zwei Teile spalten, woraufhin Collingwood dem Gegner zahlenmäßig überlegen sein wird, sich aber allein mit ihm auseinandersetzen muss.
Die englische Flotte besteht aus vierzig, die französisch-spanische Flotte aus sechsundvierzig Schiffen. Collingwood wird mit sechzehn Schiffen zwölf gegnerische Schiffe angreifen, ich werde mit den verbleibenden vierundzwanzig die übrigen vierunddreißig des Gegners in Schach halten, und mehr als das: Ich werde nahe dem Zentrum der gegnerischen Linie die Schiffe angreifen, die das Flaggschiff des Kommandanten umgeben, und werde auf diese Weise Admiral Villeneuve von seiner Armee abschneiden und ihn daran hindern, seine Befehle der Vorhut zu übermitteln.
Sobald der Kommandant der zweiten Kolonne mit meinen Absichten vertraut ist, obliegen ihm unumschränkt Führung und Kommando seiner Kolonne; er wird seinen Angriff so vortragen, wie er es für richtig hält, und jeden Vorteil nutzen, bis es ihm gelungen sein wird, die Schiffe, gegen die er kämpft, gekapert oder vernichtet zu haben. Ich werde Sorge tragen, dass die anderen Schiffe des Gegners ihn dabei nicht stören. Und falls die Kapitäne unserer Flotte während des Kampfgeschehens die Signale ihres Admirals nicht vollständig erkennen oder verstehen, mögen sie unbesorgt sein, denn sie können nichts falsch machen, solange sie ihr Schiff zum Nahkampf mit einem gegnerischen Schiff führen.«
Bei dieser einfachen, aber überzeugenden Darlegung der wirkmächtigsten Prinzipien einer Kriegsführung zur See wurde im Beratungsraum der Victory, in dem sich die Offiziere und Kapitäne des Geschwaders versammelt hatten, begeisterter Beifall laut.
»Man hätte meinen können«, schreibt Nelson an die Admiralität, »eine elektrische Entladung hätte die Anwesenden getroffen. Einzelne Offiziere waren zu Tränen gerührt. Alle sprachen sich für den Angriffsplan aus; er wurde als neu, unerwartet und leicht zu verstehen und auszuführen erachtet, und vom ranghöchsten Admiral bis zum einfachsten Kapitän riefen alle wie aus einem Mund: ›Der Gegner ist verloren, wenn es uns gelingt, zu ihm aufzuschließen.‹«
Im Gegensatz zu Nelson, der sich schon im Voraus als Sieger sah, ging Villeneuve ohne jede Zuversicht in die Schlacht. In seiner Flotte, die aus so vielen tapferen Männern bestand, voller Hingabe, erfahren und fähig, spürte er ein zerstörerisches Fluidum, ohne dass er es genauer hätte benennen können.[9] Seinen Befürchtungen lag die Erinnerung an Abukir zugrunde, und die mangelnde Erfahrung zur See unserer Offiziere, die mangelnde Gefechtserfahrung unserer kommandierenden Kapitäne, die mangelnde Zuversicht der Soldaten und der mangelnde Zusammenhalt unter ihnen war Gegenstand der Briefe, die er ununterbrochen absandte.
Der leichte Wind, der die Schiffe Villeneuves und Gravinas aus dem Hafen geführt hatte, war unvermittelt erstorben; durch die Unerfahrenheit einiger spanischer Schiffe, die leewärts abgefallen waren, als sie zu reffen versuchten, war die vereinigte Flotte aufgehalten worden und entfernte sich nun allmählich von der Küste.
Nelson, den seine Fregatten vom Auslaufen unserer Flotte unterrichtet hatten, eilte bereits mit vollen Segeln zum Kampf herbei. Doch heftige Böen wurden bald von einer neuen Windstille abgelöst, und die Nacht brach herein, bevor sich die zwei Flotten in Gefechtweite befanden.
An verschiedenen Decks waren Feuer zu sehen; wiederholte Kanonenschüsse, die Admiral Villeneuve durch die Reihenfolge ihres Ertönens zeigten, dass er seinem Gegner nicht verheimlichen konnte, welchen Weg er zurücklegte, führten ihm die Notwendigkeit vor Augen, seine Flotte in eine kompaktere Schlachtordnung zu bringen.
Am nächsten Tag ließ der Admiral gegen sieben Uhr morgens das Signal geben, die gewohnte Schlachtordnung zu bilden.
Als Nelson sah, was geschah, wusste er, dass die von ihm ersehnte Schlacht noch am selben Tag stattfinden würde. Er ließ die Möbel für den Kampf verstauen und das Porträt Lady Hamiltons von der Wand abnehmen und im Zwischendeck vor eventuellen Einschüssen in Sicherheit bringen.
Die vereinigte Flotte näherte sich in dichter Schlachtlinie und so geschwind, dass sie mit jeder Welle besser zu erkennen war.
Eine schwache Brise aus westnordwestlicher Richtung blähte unmerklich die obersten Segel der Schiffe auf den langen Wellen der Dünung als untrügliches Zeichen eines unmittelbar bevorstehenden Sturms. Die englische Flotte näherte sich mit einer Meile Geschwindigkeit in der Stunde und hatte sich, Nelsons Plan folgend, in zwei Kolonnen geteilt.
Die von Nelson befehligte Victory führte das erste Geschwader an; ihr folgten zwei Schlachtschiffe mit achtundneunzig Kanonen an Bord, die Temeraire und die Neptune, zwei bronzene Rammböcke mit der Aufgabe, die erste Lücke in der feindlichen Schlachtlinie zu eröffnen. Nach der Neptune kamen die Conqueror und die Leviathan mit jeweils vierundsiebzig Kanonen, und ihnen folgte die Britannia mit hundert Kanonen unter der Flagge des Konteradmirals Graf Northesk.
Weit abgeschlagen nach diesen Schiffen kamen die Agamemnon, eines der ersten Schiffe, die Nelson befehligt hatte, und hinter ihr im Fahrwasser der Britannia vier Schiffe mit vierundsiebzig Kanonen, die Ajax, die Orion, die Minotaur und die Spartiate.
Inzwischen hatte man Gefechtweite erreicht. In Befolgung einer Vorsichtsmaßnahme, die auf See oftmals geboten war, diesmal jedoch alles andere als ratsam war, hatte Villeneuve befohlen, erst dann zu schießen, wenn man sich in angemessener Reichweite befand; die zwei englischen Kolonnen stellten eine große Ansammlung von Schiffen dar, und jeder Schuss hätte beinahe zwangsläufig getroffen.
Gegen Mittag erreichte die sogenannte Leekolonne unter Admiral Collingwood, die mittlerweile der nördlichen Linie in Luv, der sogenannten Wetterkolonne unter Nelson, eine Viertelstunde im Voraus war, etwa die Mitte unserer Linie auf Höhe der spanischen Santa Ana. Collingwoods Royal Sovereign folgten die Belleisle und die Mars, an welche die Tonnant und die Bellerophon dicht aufschlossen, und mit einer Kabellänge Entfernung zur Bellerophon kamen die Colossus, die Achilles und die Polyphemus; etwas weiter zur Rechten fuhr die Revenge, gefolgt von der Swiftsure, der Thunderer und der Defence; die Dreadnought und die Prince, zwei schlechte Segler, bewegten sich zwischen den beiden Kolonnen, gehörten aber zu Collingwoods Geschwader.
Die englischen Schlachtschiffe waren mit insgesamt eintausendeinhundertachtundvierzig Kanonen bestückt, das französische Geschwader mit eintausenddreihundertsechsundfünfzig Kanonen und das spanische Geschwader mit eintausendzweihundertsiebzig Kanonen.
Admiral Villeneuve hatte seine Flagge auf der Bucentaure gesetzt; die Flagge des spanischen Admirals Gravina wehte an Bord der Principe de Asturias, die mit einhundertzwölf Kanonen bestückt war. Konteradmiral Dumanoir befehligte die Formidable, Konteradmiral Magon die Algésiras; zwei prachtvolle spanische Dreidecker, die Santissima Trinidad mit hundertdreißig Kanonen und die Santa Ana mit hundertzwölf Kanonen, waren die Flaggschiffe der Konteradmiräle Cisneros und Alava.
Zehn Schiffe waren durch die Flaute und die Dünung in ihrem Vorankommen so gehemmt, dass sie ihren Platz in der Schlachtordnung nicht einnehmen konnten und hinter der Schlachtlinie gewissermaßen eine zweite Reihe bildeten. Es waren dies die Neptune, Scipion, Intrépide, Rayo, Formidable, Duguay-Trouin, Mont-Blanc und San Francisco de Asis.
Die drei größten Schlachtschiffe hatten sich in unmittelbarer Nähe zur Bucentaure positioniert; vor dem Flaggschiff Admiral Villeneuves befand sich die Santissima Trinidad, dahinter die Redoutable und unter dem Wind und zwischen Bucentaure und Redoutable die Neptune.
Als Kapitän Lucas erkannte, an welcher Stelle die Wetterkolonne unter Führung der Victory und die Leekolonne unter Führung der Royal Sovereign aufeinandertreffen sollten, manövrierte er seine Redoutable so, dass sie sich zu dem entsprechenden Zeitpunkt zwischen der Bucentaure und der Santa Ana befinden würde. Neben ihm stand ein junger Offizier auf dem Oberdeck, den niemand kannte und der niemand anders war als unser René.
René war mit einem Entersäbel und mit seinem Stutzen bewaffnet.
Nelson stand auf dem Oberdeck der Victory zusammen mit Blackwood, dem Kapitän der Euryalus; Blackwood war ihm so lieb und teuer wie sein Flaggkapitän Hardy, und beiden vertraute er uneingeschränkt.
In diesem Augenblick geschah es, dass Nelson einen der Offiziere herbeirief und zu ihm sagte: »Mister Paskoe, geben Sie folgendes Signal an alle Schiffe unserer Flotte: ›England expects that every man will do his duty!‹« (»England erwartet, dass jeder seine Pflicht tun wird.«)
Nelson trug einen blauen Anzug und hatte all seine Orden an die Brust geheftet: den Bath-Orden, den Sizilianischen Ritterorden des heiligen Ferdinands, das Ordenskreuz der Johanniter oder Malteser und den türkischen Halbmondorden.
Kapitän Hardy trat zu ihm. »Um Himmels willen, Kommandant«, sagte er, »wechseln Sie bitte die Kleidung; dieser Putz an Ihrer Brust muss Sie zur Zielscheibe für alle Scharfschützen machen.«
»Dafür ist es zu spät«, sagte Nelson. »Man hat mich in dieser Kleidung gesehen, und es würde nichts nützen, sie zu wechseln.«
Daraufhin wurde er gebeten, an seine Stellung als Oberkommandierender zu denken und sein Schiff nicht als Erstes mitten in die dichtgedrängte Phalanx der vereinigten Flotte zu steuern.
»Lassen Sie«, sagte Hardy, »die Leviathan, die Ihrem Schiff folgt, mit ihm den Platz tauschen und das erste Feuer der Franzosen auffangen.«
»Ich habe nichts dagegen, dass die Leviathan uns überholt, wenn sie es kann«, erwiderte Nelson lächelnd, und dann sagte er zu Hardy: »Bis dahin lassen Sie alle Segel setzen.«
Erst zu diesem Zeitpunkt verließen seine Kapitäne das Deck der Victory und kehrten auf ihre Schiffe zurück.
Als Nelson von der Leiter der Poop aus Abschied von ihnen nahm, drückte er Kapitän Blackwood liebevoll die Hand, der ihm lebhaft wünschte, er möge siegen.
Die französische Flotte stand so eng, dass kein Wasser zwischen den Schiffen zu sehen war.
»Wie viele dieser Schiffe müssen sich ergeben oder sinken, damit wir sie als Beweis eines großen Sieges betrachten?«, fragte Nelson lächelnd Blackwood.
»Nun, zwölf oder fünfzehn«, erwiderte jener.
»Das ist nicht genug«, sagte Nelson. »Ich persönlich würde mich nicht mit weniger zufriedengeben als mit zwanzig Schiffen«, doch dann verdüsterte sich seine Stirn, und er sagte zu seinem Freund: »Adieu, Blackwood. Möge der Allmächtige Sie behüten; wir werden einander nicht wiedersehen.«
Doch nicht Nelson war die Ehre vorbehalten, den ersten Schuss abzugeben. Collingwoods Leekolonne war schneller als Nelsons Wetterkolonne, die eine Kurve beschrieb. Collingwood durchbrach als Erster die Schlachtlinie der Spanier und Franzosen, und sein Flaggschiff Royal Sovereign traf auf den spanischen Dreidecker Santa Ana, ging Steuerbord an Steuerbord längsseits und überzog ihn mit einem Feuer- und Rauchhagel.
»Wackerer Collingwood!«, rief Nelson, der auf die Lücke wies, die Collingwoods Kolonne in die gegnerische Linie gerissen hatte. »Sehen Sie nur, Hardy, wie er sein Schiff ins Feuer steuert, ohne nach links oder rechts, nach vorne oder hinten zu schauen. Er hat uns den Weg eröffnet, auf in den Wind!«
Während Nelson auf der Poop der Victory diese Worte sprach, rief Collingwood mitten in dem Toben des Gefechts seinem Flaggkapitän Rotheram zu: »Oh, wie glücklich wäre Nelson, wenn er jetzt hier wäre!«
Es sollte nicht lange dauern, bis er es war. Die Kanonenkugeln von sieben Schiffen der vereinigten Flotte pfiffen ihm bereits über den Kopf, zerrissen die Segel der Victory und durchpflügten ihr Oberdeck.
Der erste Gefallene an Bord der Victory war Nelsons Sekretär, ein junger Mann namens Scott; als er mit seinem Admiral und Kapitän Hardy sprach, riss ihn eine Kanonenkugel entzwei.
Da Nelson dem jungen Mann sehr zugetan gewesen war, ließ Hardy den Leichnam sogleich entfernen, damit sein Anblick den Admiral nicht betrübte.
Fast im selben Augenblick zerstückelten zwei Stangenkugeln acht Männer an Deck.
»Oh«, sagte Nelson, »es geht zu hitzig her, um lange anzuhalten.«
Er hielt sich am Arm eines Leutnants fest, schwankte einen Augenblick lang keuchend und sagte dann: »Schon gut, schon gut, es ist vorbei.«
Die Kanonenkugeln stammten von der Redoutable.
Wie gesagt war es zu jener Zeit üblich, auf Mastwerk und Takelage zu zielen, doch Lucas teilte diese Eigenart nicht.
»Freunde«, sagte er zu den Kanonieren, bevor sie feuerten, »zielen Sie tief! Es freut die Engländer nicht, wenn sie getötet werden.«
Und sie zielten tief.
Die Victory hatte noch keinen Schuss abgegeben.
»Drei Schiffe stehen uns zur Auswahl; welches davon wollen wir ansteuern?«, fragte Hardy Nelson.
»Das nächste«, erwiderte Nelson. »Wählen Sie selbst.«
Es war die Redoutable, die bis dahin die größten Schäden an der Victory verursacht hatte. Hardy befahl den Rudergängern, die Victory so dicht wie möglich an die Redoutable heranzumanövrieren und längsseits zu gehen.
»Ich glaube«, sagte René zu Lucas, »ich sollte allmählich meinen Posten im Mastkorb beziehen.«
Und er kletterte die Wanten des Besanmasts hinauf.
Während René kletterte, spien die Geschütze beider Schiffe ununterbrochen Tod und Verderben. Als die Schiffe einander berührten, war das Geräusch so entsetzlich, als hätte eines von ihnen das andere gerammt, und das wäre auch geschehen, wenn nicht der Wind, der sich in dem Gewirr aus Segeln verfing, die Redoutable rückwärtsgeführt hätte, so dass sie die Victory mit sich zog.
Die Schiffe, die der Victory folgten, durchquerten die gegnerische Schlachtlinie durch die geschlagene Lücke, schwärmten nach links und rechts aus und trennten die Überbleibsel der vereinigten Flotte von ihrer Hauptstreitkraft ab.
Es war Mittag, als das Gefecht begann. Die Engländer hissten die Fahne des heiligen Georgs, die Spanier entfalteten das Banner Kastiliens und hängten unter ihrer Flagge ein langes Holzkruzifix auf, und unter dem siebenmal wiederholten Ruf: »Es lebe der Kaiser!« erhob sich die Trikolore über dem Bug jedes französischen Schiffs.
Daraufhin eröffnen die sechs oder sieben Schiffe in Villeneuves unmittelbarer Umgebung das Feuer auf die Victory. Die Redoutable kann sie mit ihren zweihundert feuerspeienden Mäulern nicht aufhalten. Sie gelangt bis auf Pistolenschussweite hinter die Bucentaure; eine Karronade aus einem Achtundsechzigergeschütz trifft die Bucentaure unterhalb der Back und speit eine Kanonenkugel und fünfhundert Gewehrkugeln durch die Fenster der Poop des Franzosen; fünfzig doppelte und dreifache Kartätschenladungen zerschmettern das Heck der Bucentaure, setzen siebenundzwanzig Kanonen außer Gefecht und übersäen das Schiff mit Toten und Verwundeten.
Die Victory überwindet langsam den Abstand, den das fürchterliche Feuer von der Redoutable zu mindern begann. Bord an Bord entfernen beide Schiffe sich von der Gefechtslinie; von den Mastkörben und Batterien der Redoutable wird das Feuer der Victory erwidert, und in diesem Gefecht, das eher einem Musketenfeuer als einem Artilleriefeuer ähnelt, befinden unsere Matrosen sich nun wieder im Vorteil. In kurzer Zeit sind die Planken der Victory leichenübersät; von den einhundertzwanzig Männern Besatzung des Schiffs sind nur mehr zwanzig einsatzfähig; das Zwischendeck ist voller Verwundeter und Sterbender, die unablässig hergebracht werden. Angesichts der zahllosen Verwundeten, der verstümmelten Beine und abgerissenen Arme sehen die Wundärzte einander ratlos an; der Schiffskaplan der Victory, vom Entsetzen und von seinen Gefühlen übermannt, will mit dieser Schlachtbank, wie er es noch zehn Jahre später nannte, nichts mehr zu tun haben und eilt mitten im Gefecht an Deck; durch den Rauch erkennt er Nelson und Hardy auf der Schanz. Er läuft mit ausgebreiteten Armen auf sie zu, als Nelson plötzlich wie vom Blitz getroffen zu Boden fällt.
Es war genau ein Viertel nach ein Uhr.
Ein Schuss aus dem Mastkorb am Besanmast der Redoutable hatte ihn von oben nach unten getroffen; die Kugel war in die linke Schulter eingedrungen, ohne von der Epaulette aufgehalten zu werden, und hatte die Wirbelsäule zerschmettert.
Nelson befand sich an derselben Stelle, an der sein Sekretär gestorben war, und war mit dem Gesicht in dessen Blut gestürzt. Auf seinen Arm gestützt, versuchte er, sich auf ein Knie zu erheben. Hardy stand wenige Schritte von ihm entfernt; als er ihn stürzen hört, dreht er sich um, eilt zu ihm und richtet ihn zusammen mit Sergeant Secker und zwei Matrosen auf.
»Mylord«, sagte Hardy, »ich hoffe, Sie sind nicht ernstlich verwundet.«
Nelson jedoch erwiderte: »Diesmal, Hardy, ist es um mich geschehen.«
»O nein! Das will ich nicht hoffen!«, rief der Kapitän.
»O doch«, sagte Nelson, »an der Erschütterung in meinem ganzen Körper habe ich gespürt, dass mir das Rückgrat zerschmettert wurde.«
Hardy befahl sofort, den Admiral in die Krankenstation zu bringen. Während die Seeleute ihn unter Deck trugen, bemerkte Nelson, dass die Steuerreeps durch den Beschuss zerfetzt waren. Er teilte dies Kapitän Hardy mit und befahl einem Midshipman, die zerrissenen Taue durch neue zu ersetzen.
Dann zog er sein Taschentuch heraus und legte es sich auf Gesicht und Abzeichen, damit seine Matrosen ihn nicht erkannten und nicht erfuhren, dass er verwundet war.
Als man ihn in das Zwischendeck gebracht hatte, kam der Schiffswundarzt Mr. Beatty zu ihm.
»Oh, mein lieber Beatty«, sagte Nelson, »Ihre ganze ärztliche Kunst vermag nichts für mich zu tun, denn mein Rückgrat ist zerschmettert.«
»Ich hoffe, die Verwundung ist weniger schwerwiegend, als Ihre Lordschaft denken«, sagte der Arzt.
In diesem Augenblick näherte sich der Schiffskaplan Mr. Scott; als Nelson seiner ansichtig wurde, rief er mit einer vor Schmerzen stockenden und dennoch gebieterischen Stimme: »Hochwürden, sprechen Sie zu Lady Hamilton von mir, sprechen Sie zu Horatia von mir, sprechen Sie zu meinen Freunden von mir; sagen Sie ihnen, dass ich mein Testament aufgesetzt habe und dass ich Lady Hamilton und meine Tochter Horatia meinem Vaterland vermache... Merken Sie sich, was ich Ihnen in meiner letzten Stunde sage, und vergessen Sie es nie!«
Nelson wurde auf ein Bett gelegt, man zog ihm unter großen Mühen seinen Anzug aus und bedeckte ihn mit einem Laken.
Während dieser Prozedur sagte er zu dem Wundarzt: »Doktor, ich bin verloren! Doktor, ich liege im Sterben!«
Mr. Beatty untersuchte die Wunde; er versicherte Nelson, er könne sie mit der Sonde untersuchen, ohne allzu große Schmerzen zu verursachen; er sondierte sie und stellte fest, dass die Kugel die Brust bis zur Wirbelsäule durchdrungen hatte.
Während dieser Untersuchung sagte Nelson: »Mir ist, als würde mein Leib überall durchbohrt.«
Der Arzt untersuchte den Rücken, der unversehrt war. »Mylord, Sie täuschen sich«, sagte er. »Versuchen Sie, mir zu schildern, was Sie spüren.«
»Mir ist«, sagte der Verwundete, »als stiege mir mit jedem Atemzug ein Blutschwall in die Kehle... Der untere Teil meines Körpers ist wie abgestorben... Das Atmen fällt mir schwer, und Sie mögen sagen, was Sie wollen, ich weiß, dass mein Rückgrat zerschmettert ist.«
Diese Symptome verrieten dem Arzt, dass man sich keine Hoffnungen machen konnte; doch niemand an Bord außer dem Wundarzt, Kapitän Hardy, dem Schiffskaplan und zwei Sanitätern erfuhr von der Schwere der Verwundung.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die Nelson getroffen hatte, damit die Katastrophe unentdeckt blieb, wusste man auf der Redoutable Bescheid.
Als Nelson an Deck niederstürzte, rief eine laute Stimme, die von der ganzen Schiffsbesatzung vernommen wurde, vom Besanmastkorb: »Kapitän Lucas, auf zum Entern! Nelson ist gefallen.«
93
Unstern
Lucas kletterte in die Wanten, und auf der Höhe von etwa zwanzig Fuß sah er, dass das Deck der Victory tatsächlich verlassen war.
Sofort ruft er seine Entermannschaft herbei; in weniger als einer Minute sind Back und Schanz der Redoutable voller Uniformierter, die sich auf der Poop, auf der Verschanzung und in den Wanten zum Entern bereitmachen.
Die Kanoniere der Victory lassen ihre Geschütze im Stich, um den neuen Angriff abzuwehren. Von einem Granatenhagel und Musketenfeuer empfangen, müssen sie sich ungeordnet hinter die erste Batterie zurückziehen.
Die Schnelligkeit der Victory ist ihre Rettung, und alle Versuche der französischen Matrosen, sie zu entern, sind zum Scheitern verurteilt. Kapitän Lucas befiehlt, die Haltetaue der Großrahe zu kappen und die Rahe als Brücke von Schiff zu Schiff zu legen.
Doch dem Seekadetten Yon und vier Matrosen ist es gelungen, sich über den Anker in den Schoten der Victory auf das Deck des Engländers zu ziehen. Die Entermannschaft hat gesehen, welchen Weg sie genommen haben, und will ihnen folgen, angeführt vom ersten Offizier der Redoutable, Leutnant zur See Dupotet.
Ein Mann, der sich vom Mastkorb des Besanmasts der Redoutable über das Tauwerk auf die Victory gehangelt hat, lässt sich wie ein Meteorit mitten unter sie fallen. Wird die Victory das unerhörte Schauspiel eines Admiralsschiffs bieten, das mitten im englischen Sieg von einem gegnerischen Schiff gekapert wird, obwohl jenes Schiff sechsundzwanzig Kanonen weniger an Bord hat? Doch in diesem Augenblick fegt eine entsetzliche Kugel- und Kartätschensalve über das Deck der Redoutable.
Abgefeuert hat sie die Temeraire, die sich nach erfolgreichem Durchdringen der gegnerischen Schlachtlinie unter den Bugspriet der Redoutable drängt.
Zweihundert Mann hat diese Breitseite zu Boden geschleudert.
Die Temeraire holt auf, bis sie im rechten Winkel zur Redoutable liegt, und versetzt ihr eine weitere Salve. Die französische Flagge ist weggeschossen, doch ein Mann, den kaum jemand in Kapitän Lucas’ Mannschaft kennt, eilt zu der Kiste mit Flaggen, ergreift eine neue Trikolore und versucht sie an die Rahe zu nageln.
Und als wären zwei Dreidecker nicht ausreichend, um einen Zweidecker in die Knie zu zwingen, gesellt sich ihnen ein drittes Schiff hinzu.
Die englische Neptune attackiert das Heck der Redoutable und feuert eine Breitseite ab, die ihren Fockmast und ihren Besanmast wegreißt. Auch die neue Flagge wird von dem Eisenhagel zerrissen, doch der Großmast bleibt stehen; derselbe Mann, der die Flagge an eine Rahe genagelt hatte, springt zum Großmast und nagelt eine weitere Flagge an die Großstenge. Dann bombardiert er die Temeraire mit einem Geschützhagel, der sie entmastet und fünfzig Männer tötet.
Eine neue Breitseite der Neptune reißt die Schiffswand der Redoutable auf, zerstört ihr Ruder und versetzt dem Schiffsrumpf an der Wasserlinie mehrere Einschüsse, durch die das Wasser sich in Sturzbächen in das Schiffsinnere ergießt.
Alle Offiziere sind verwundet, zehn von elf Seekadetten ringen mit dem Tod. Von sechshundertdreiundvierzig Mann Besatzung sind fünfhundertzweiundzwanzig nicht mehr kampffähig, dreihundert davon tödlich getroffen. Zuletzt trifft eine Kanonenkugel den Großmast, der umstürzt und die dritte Fahne mitnimmt.
Der Mann, der zweimal die Flagge ersetzt hat, sucht nach einer Stelle, wo er noch eine Fahne anbringen könnte, doch das Schiff ist völlig entmastet, und Lucas sagt zu ihm mit nach wie vor ruhiger Stimme: »Sinnlos, René, wir sinken.«
Die Bucentaure war in kaum weniger beklagenswerter Verfassung; sie hatte ihren Bugspriet in der Santissima Trinidad verfangen und mühte sich vergeblich, sich zu befreien; in ihrer schrecklichen Hilflosigkeit zuerst von der Victory und dann von vier weiteren Schiffen der Kolonne Nelsons unter Beschuss genommen, schossen die zwei Schiffe mit ihren mehr als zweihundert Kanonen und fast zweitausend Kombattanten aus ihren doppelten Battieren alles kurz und klein auf den vier gegnerischen Schiffen, die ihrerseits die Bucentaure und die Santissima Trinidad zu Wracks schossen.
Villeneuve, der auf seiner Poop stand, fand in der Hoffnungslosigkeit seiner Lage die Entschlusskraft, die ihm im Kampf gefehlt hatte. Im Gefechtsfeuer der Bucentaure, der Santissima Trinidad und der vier gegnerischen Schiffe wuchs Villeneuve zu ungeahnter Größe. Um sich herum sah er seine Offiziere einen nach dem anderen fallen; an seinen Standort gefesselt, musste er die vernichtenden Salven von hinten und von Backbord ertragen, ohne die Backbordgeschütze in Einsatz bringen zu können.
Nach einer Stunde des Gefechts oder eher des Todeskampfes sah Villeneuve seinen Flaggkapitän Magendi tot niederfallen. Leutnant Dandignon, der an seine Stelle getreten war, wurde verwundet und fiel, ihn ersetzte Leutnant Fournier. Großmast und Besanmast fielen nacheinander auf Deck, wo sie ein Werk der Zerstörung anrichteten. Die Flagge wurde am Fockmast gehisst, und in einer dichten Rauchwolke, die der schwache Wind um die brennenden Schiffe herum nicht zu zerstreuen vermochte, konnte der Admiral nicht mehr erkennen, was mit dem übrigen Geschwader geschah. Als die Rauchwolken kurz aufrissen und Villeneuve die nächsten Schiffe seines Geschwaders aumachen konnte – es waren zwölf, die unbeweglich im Wasser lagen -, ließ er die Signale am letzten Mast hissen, der ihm geblieben war, und befahl zu wenden und anzugreifen.
Dann wurde es wieder finster, er konnte nichts mehr erkennen, und um drei Uhr nachmittags fiel der dritte und letzte Mast seines Schiffs auf Deck und verursachte noch mehr Chaos.
Daraufhin wollte Villeneuve ein Boot zur See lassen; die Boote an Deck waren zerstört, die Boote an den Seiten des Schiffs waren durchlöchert, und die Boote, die das Wasser berührten, sanken bereits.
Das ganze Gefecht hindurch hatte Villeneuve keine Gefahr gescheut, sondern sich geradezu tollkühn Kanonenkugel, Säbelhieb oder Gewehrkugel ausgesetzt.
Das Schicksal sollte ihm den Selbstmord vorbehalten.
Das spanische Admiralsschiff, die Santissima Trinidad, musste sich, von seinen Begleitschiffen im Stich gelassen, nach vier Stunden des Kampfes ergeben, und der Rest des spanischen Geschwaders ließ sich von der Brise nach Cadiz treiben.
Unterdessen wurden auf der Victory jedes Mal Freudenrufe laut, wenn ein französisches Schiff sich ergab, und bei jedem Hurra fragte Nelson, der seine Verwundung vergaß: »Was ist passiert?«
Man sagte ihm den Grund der Freudenrufe, und der Verwundete zeigte sich sehr erfreut. Er litt unter brennendem Durst, verlangte oft zu trinken und bat darum, dass man ihm mit einem Papierfächer Luft zufächelte.
Da er Kapitän Hardy herzlich zugetan war, äußerte er wiederholt seine Besorgnis um das Leben dieses Offiziers; der Schiffskaplan und der Wundarzt versuchten seine Sorge zu zerstreuen. Sie ließen Kapitän Hardy Botschaft um Botschaft zukommen, um ihm mitzuteilen, dass Admiral Nelson ihn zu sehen wünsche, und als er nicht kam, rief Nelson ungehalten: »Sie wollen Hardy nicht rufen – nun, ich weiß, dass er gefallen ist.«
Eine Stunde und zehn Minuten nachdem Nelson verwundet worden war, kam Hardy in das Zwischendeck herunter.
Als der Admiral ihn erblickte, stieß er einen Freudenruf aus, drückte ihm liebevoll die Hand und sagte: »Nun, Hardy, wie steht der Kampf? Wie sieht es für uns aus?«
»Gut, sehr gut, Mylord«, erwiderte der Kapitän. »Wir haben bereits zwölf Schiffe genommen.«
»Ich hoffe doch, dass keines unserer Schiffe die Flagge streichen musste?«
»Nein, Mylord, kein einziges.«
Nachdem er in dieser Hinsicht beruhigt war, erinnerte Nelson sich an seinen Zustand, stieß einen Seufzer aus und sagte: »Ich bin ein toter Mann, Hardy, und mein Ende naht schnell. Bald wird alles vorbei sein. Treten Sie näher, mein Freund«, und mit leiser Stimme fügte er hinzu: »Ich bitte Sie um eines, Hardy: Schneiden Sie mir nach dem Tod meine Haare für Lady Hamilton ab, und übergeben Sie ihr alles, was mir gehört hat.«
»Ich sprach soeben mit dem Wundarzt«, sagte Hardy. »Er hat berechtigte Hoffnung, Sie am Leben zu erhalten.«
»Nein, Hardy, so ist es nicht«, erwiderte Nelson. »Versuchen Sie nicht, mich zu täuschen. Mein Rückgrat ist gebrochen.«
Die Pflicht rief Hardy an Deck zurück, und er ging, nachdem er dem Verwundeten die Hand gedrückt hatte.
Nelson verlangte nach dem Wundarzt. Dieser war damit beschäftigt, Leutnant William Ruvers zu versorgen, dem ein Bein abgeschossen worden war. Dennoch eilte er zu seinem Admiral, nachdem er seine Helfer gebeten hatte, den Verband anzulegen.
»Ich wollte nur hören, wie es um meine alten Gefährten steht«, sagte Nelson. »Was mich betrifft, Doktor, benötige ich Ihre Dienste nicht mehr. Gehen Sie nur, ich sagte ja, dass ich im unteren Teil meines Körpers nichts mehr spüre, und dieser Teil ist schon jetzt eiskalt.«
Daraufhin sagte der Wundarzt zu Nelson: »Mylord, lassen Sie mich Ihre Gliedmaßen befühlen.«
Und er berührte die unteren Gliedmaßen, die empfindungslos und wie tot waren.
»Oh«, fuhr Nelson fort, »ich weiß sehr wohl, was ich sage: Scott und Burke haben mich schon so berührt, wie Sie es tun, und ich habe ihre Berührung so wenig gespürt, wie ich die Ihre spüre. Ich sterbe, Beatty, ich sterbe.«
»Mylord«, erwiderte der Arzt, »zu meinem größten Bedauern kann ich nichts mehr für Sie tun.«
Und nachdem er dies eingestanden hatte, wandte er den Kopf ab, um seine Tränen zu verbergen.
»Ich wusste es«, sagte Nelson. »Ich spüre, wie etwas sich in meiner Brust hebt.« Und bei diesen Worten legte er die Hand auf die Stelle, die er meinte.
»Gott sei gedankt«, flüsterte er, »ich habe meine Pflicht getan.«
Der Arzt konnte dem Admiral keine Erleichterung mehr verschaffen und kümmerte sich um andere Verwundete; doch Kapitän Hardy kam wieder, nachdem er Leutnant Hill mit der schrecklichen Nachricht zu Collingwood geschickt hatte, bevor er zum zweiten Mal das Deck verließ.
Hardy beglückwünschte Nelson zu dem unzweifelhaften und entscheidenden Sieg, den er im Angesicht des Todes davongetragen hatte. Er sagte ihm, soweit er es beurteilen könne, befänden sich mittlerweile fünfzehn französische Schiffe in englischer Gewalt.
»Ich hätte darauf gewettet, dass es zwanzig wären«, murmelte Nelson, doch dann entsann er sich der Windverhältnisse und der Vorboten des Sturms, die er auf dem Meer beobachtet hatte, und er rief: »Lassen Sie Anker werfen, Hardy! Lassen Sie ankern!«
»Ich nehme an«, sagte der Flaggkapitan, »dass Admiral Collingwood das Kommando über die Flotte übernehmen wird.«
»Nicht solange ich lebe«, sagte der Sterbende und stützte sich auf den Ellbogen. »Hardy, ich befehle Ihnen, Anker zu werfen, ich verlange es.«
»Ich werde es befehlen, Mylord.«
»Tun Sie es, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, so schnell wie möglich«, und dann flüsterte er, als schämte er sich dieser Schwäche: »Hardy, Sie werden meinen Leichnam nicht ins Meer werfen lassen, nicht wahr?«
»O nein, gewiss nicht, das dürfen Sie mir glauben, Mylord«, erwiderte Hardy schluchzend.
»Kümmern Sie sich um die arme Lady Hamilton«, sagte Nelson mit schwacher Stimme, »meine geliebte Lady Hamilton. Küssen Sie mich, Hardy!«
Der Kapitän küsste ihn weinend auf die Wange.
»Ich sterbe zufrieden«, sagte Nelson, »England ist gerettet.«
Kapitän Hardy verharrte einen Augenblick lang neben dem berühmten Verwundeten in schweigender Kontemplation; dann kniete er nieder und küsste ihn auf die Stirn.
»Wer küsst mich da?«, fragte Nelson, dessen Blick bereits vom Schatten des Todes umflort war.
Der Kapitän antwortete: »Ich bin es, Hardy!«
»Gott behüte Sie, mein Freund!«, sagte der Sterbende.
Hardy ging an Deck zurück.
Nelson sah den Schiffskaplan an seiner Seite und sagte zu ihm: »Ach, Doktor, ich war nie ein verstockter Sünder«, und nach einer Pause sprach er weiter: »Doktor, ich bitte Sie inständig, erinnern Sie sich, dass ich meinem Vaterland und meinem König die Sorge für Lady Hamilton und meine Tochter Horatia als Vermächtnis hinterlasse. Vergessen Sie Horatia nie.«
Sein Durst wurde immer stärker. Er rief: »Trinken... trinken... Fächer... fächern Sie mir... reiben Sie mich.«
Die letzten Worte richtete er an den Schiffskaplan Mr. Scott, der ihm etwas Erleichterung verschafft hatte, indem er ihm mit der Hand die Brust rieb, doch seine Stimme versagte immer wieder, als seine Schmerzen stärker wurden, und zuletzt musste er alle Kraft zusammennehmen, um ein letztes Mal zu sagen: »Dem Herrn sei Dank, ich habe meine Pflicht getan.«
Nelson hatte seine letzten Worte gesprochen.
Der Wundarzt kam zurück, denn Nelsons Butler hatte ihn aufgesucht und ihm gesagt, dass sein Herr im Begriff stehe, den Geist auszuhauchen. Mister Beatty ergriff die Hand des Sterbenden: sie war kalt; er fühlte seinen Puls: er war nicht zu spüren; zuletzt berührte er seine Stirn, und Nelson öffnete sein gesundes Auge und schloss es wieder.
Nelson hatte den letzten Atemzug getan; es war vier Uhr und zwanzig Minuten nachmittags; er hatte seine Verwundung drei Stunden und zweiunddreißig Minuten überlebt.
Es mag verwundern, mit welcher Genauigkeit ich den Tod Nelsons dokumentiere, doch es erschien mir nur recht und billig, einen der größten Feldherrn der Geschichte, wenn nicht als Historiker, so doch wenigstens als Romancier bis zum Grab zu begleiten. Die Einzelheiten habe ich in keinem Buch gefunden. Ich habe mir das Protokoll seines Todes verschafft, das der Wundarzt der Victory, Mister Beatty, und der Schiffskaplan Scott unterzeichnet haben.
94
Der Sturm
Vielleicht war Nelsons Tod der Schlusspunkt der Schlacht von Trafalgar, doch wir fänden es allzu ungerecht, die Namen so vieler Tapferer unerwähnt zu lassen, die alles für ihr Vaterland gaben, indem sie starben wie er.
Wir verließen einen verzweifelten Villeneuve auf dem zerstörten Deck der Bucentaure, ohne ein einziges seetüchtiges Boot, das ihn zu einem seiner unversehrt gebliebenen Schiffe hätte bringen können – unversehrt, weil sie sich dem Feuer entzogen hatten. Hätte er eines dieser zehn Schiffe erreichen können, die sich keinem Gegner hatten stellen müssen, nachdem sie einige Salven mit Nelsons Schiffen gewechselt hatten, und hätte er sich mit dieser machtvollen Verstärkung wieder in den Kampf werfen können, dann wäre die Schlacht zweifellos weniger eklatant verloren gewesen, als es nun der Fall war.
Doch da er an die Bucentaure gefesselt war wie ein Lebender an einen Leichnam, allen Schlägen ausgesetzt, ohne einen einzigen Schlag führen zu können, sah er sich gezwungen, die Fahne zu streichen.
Daraufhin kam eine englische Schaluppe, um ihn abzuholen, und brachte ihn an Bord der Mars.
Konteradmiral Dumanoir hatte Villeneuves Signale wiederholt. Die zehn Schiffe, an die sie sich richteten, waren die Héros, deren Kapitän Poulain schon bei Beginn der Kampfhandlungen gefallen war, die San Augustin, die San Francisco de Asis, die Mont-Blanc, die Duguay-Trouin, die Formidable, die Rayo, die Intrépide, die Scipion und die Neptune.
Doch nur vier von ihnen gehorchten den Signalen ihres Kommandanten, indem sie ihre Boote als Schlepphilfen benutzten, um zu wenden. Dies waren die Mont-Blanc, die Duguay-Trouin, die Formidable und die Scipion; allerdings hatte der Konteradmiral ihnen Signal gegeben, gegen den Wind zu wenden, was ihnen ermöglicht hätte, aufzuholen und sich in das Getümmel zu stürzen, sobald es ihnen opportun erschienen wäre.
Konteradmiral Dumanoir befehligte die Formidable, und er machte sich daran, zusammen mit den anderen drei Schiffen die Schlachtlinie von Norden nach Süden entlangzufahren; dann hätte er jederzeit das Feuer gegen die Engländer eröffnen können, doch es war spät, drei Uhr nachmittags; fast überall war die Niederlage unübersehbar – die Bucentaure hatte sich ergeben, die Santissima Trinidad war manövrierunfähig, die Redoutable zum Wrack geschossen; von allen Seiten jagten die Engländer den Schiffen nach, die leewärts gefallen waren, und unterdessen fanden sich die vier Schiffe unter Dumanoirs Kommando lebhaftem Feuer ausgesetzt, das ihre Kampfkraft nicht unerheblich beeinträchtigte. Sie ließen sich von diesem Beschuss abschrecken und entfernten sich von dem Gefecht, ohne sich einzumischen.
Die Abteilung der französischen Schlachtlinie, die mit Collingwoods Kolonne zusammengetroffen war, kämpfte mit beispiellosem Mut.
Die spanischen Schiffe Santa Ana und Principe de Asturias verdienten allein einen Ehrenplatz in der Geschichte.
Nach zweistündigem Kampf hatte die Santa Ana, das erste Schiff der Nachhut, alle drei Masten eingebüßt und hatte die Royal Sovereign fast ebenso übel zugerichtet wie diese sie selbst. Sie hatte ihre Fahne gestrichen, doch erst als Admiral Alava schwer verwundet worden war.
Die Fougueux, die der Santa Ana am nächsten war, hatte keine Mühen gescheut, sie zu unterstützen und die Royal Sovereign daran zu hindern, die Schlachtlinie zu durchbrechen, doch die Monarca, die ihr hätte folgen sollen, hatte sie im Stich gelassen. Von zwei gegnerischen Schiffen in die Zange genommen, hatte die Fougueux beide kampfunfähig gemacht, und im Nahkampf mit der Temeraire hatte sie drei Enterversuche abgewehrt und von siebenhundert Mann vierhundert verloren.
Ihr Kommandant Kapitän Beaudoin war gefallen; Leutnant Bazin hatte seine Stelle eingenommen; doch die Engländer hatten einen vierten Angriff unternommen und diesmal die Schanz erobert; verwundet und blutüberströmt, von nur mehr wenigen Getreuen umringt und zur Back zurückgedrängt, hatte Bazin sich gezwungen gesehen, die Fahne zu streichen.
An der Stelle, wo die Monarca hätte kämpfen sollen, hatte die Pluton unter dem Kommando von Kapitän Cosmao ihren Platz eingenommen und sich der englischen Mars in den Weg gestellt, die sie mit heftigem Feuer bestrich, um danach zum Entern anzusetzen, als ein Dreidecker sie aufs Korn nahm und ihr Heck beschoss. Mit einem geschickten Wendemanöver war es der Pluton gelungen, dem neuen Gegner zu entkommen, ihm die Seite anstelle des Hecks zu präsentieren und ihm mehrere todbringende Breitseiten zu schicken, anstatt selbst beschossen zu werden.
Danach hatte die Pluton sich wieder ihrem ersten Gegner zugewendet, hatte ihm unter Ausnutzen des günstigen Windes zwei Masten zerschossen und ihn außer Gefecht gesetzt, und als Nächstes versuchte sie, die französischen Schiffe zu unterstützen, die gegen einen übermächtigen Gegner kämpften, nachdem ein Teil der französischen Flotte sich weit weniger pflichtbewusst als die Pluton gezeigt hatte und Kurs nach Norden genommen hatte.
Hinter der Pluton vollbrachte die Algésiras wahre Wunder an Tapferkeit. Befehligt von Konteradmiral Magon, kämpfte sie so unverdrossen wie zuvor nur die Redoutable.
Konteradmiral Magon stammte von der Île de France und aus einer Familie, die aus Saint-Malo kam. Er war jung, schön, tapfer. Als er die Trikolore hisste, hatte er seine Mannnschaft zusammengerufen und demjenigen, der als Erster den Gegner enterte, ein prachtvolles Degengehänge versprochen, das die Compagnie des Philippines ihm verehrt hatte.
Diese schöne Belohnung wollte sich jeder verdienen.
Im Wetteifer mit den Kommandanten der Redoutable, der Fougueux und der Pluton trieb Konteradmiral Magon seine Algésiras vorwärts, um den Engländern den Weg zu versperren und zu verhindern, dass sie die Schlachtlinie aufbrachen. Bei diesem Manöver traf er auf die Tonnant, ein einstmals französisches Schiff, das nach Abukir englisch geworden war und von einem mutigen Offizier namens Tiller befehligt wurde. Er nähert sich bis auf Pistolenschussweite, lässt feuern, wendet dann und rammt seinen Bugspriet in die Wanten des gegnerischen Schiffs. Nun ruft er die tapfersten seiner Matrosen beim Namen, um mit ihnen die Tonnant zu entern. Als sie alle an Deck und auf dem Bugspriet versammelt sind, fährt eine Kartätschenladung in den Menschenknäuel, und Magon wird an Arm und Oberschenkel verwundet.
Er weigert sich, seinen Posten zu verlassen, doch seine Offiziere können ihn dazu überreden, sich verbinden zu lassen, damit er weiterkämpfen kann. Zwei Matrosen bringen ihn zum Lazarett, doch da erblickt er den englischen Kapitän Tiller, der sich anschickt, an der Spitze seiner Entermannschaft auf Deck der Algésiras zu springen; Magon schüttelt seine Begleiter ab, ergreift eine Enteraxt und wirft die Eindringlinge zurück, die ihren Angriff dreimal wiederholen und dreimal abgewiesen werden. Magons Flaggkapitän Letourneur fällt vor seinen Augen, und Leutnant zur See Plassant, der den Kapitänsposten übernimmt, wird sofort verwundet.
Magon, auffällig durch seine prunkvolle Uniform, wird abermals verwundet und steht kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Er übergibt das Kommando kurzfristig an Offizier de la Bretonnière und lässt sich von zwei Matrosen in das Zwischendeck bringen.
Doch durch die klaffende Öffnung in der Seite seines Schiffs trifft ihn eine Kartätschenkugel mitten in die Brust, und er fällt im selben Augenblick wie der Fockmast, den eine Kanonenkugel zum Einsturz bringt.
Das Deck der Algésiras ist jetzt schutzlos und völlig entmastet und wird von den Engländern im Sturm geentert.
Neben der Algésiras führen vier weitere französische Schiffe mit bewundernswertem Mut einen hartnäckigen Kampf: die Aigle, die Swiftsure, die Berwick und die Achille.
Nach einem erbitterten Nahkampf mit der Bellerophon von fast einer Stunde Dauer wird die Aigle ohne ihr Zutun von ihrem Gegner abgedrängt, den einzunehmen sie im Begriff war, und gegen die Belleisle getrieben. Ihr Kommandant, der tapfere Kapitän Courège, fällt um drei Uhr, doch sein Schiff kämpft weiter und streicht die Flagge erst um halb vier Uhr unter den vereinten Salven der Revenge und der Defence.
Die Swiftsure hat zweihundertfünfzig Mann verloren. Ihr Kommandant und ihr Kapitän wurden auf der Wachtbank getötet.
Leutnant Lune übernimmt ihren Posten und stirbt wie sie. In auswegloser Lage zwischen den gegnerischen Schiffen Bellerophon und Colossus ergibt die Swiftsure sich zuletzt.
Die Berwick, kommandiert von Kapitän Camas, den James in seiner Geschichte der Marine den tapferen Kapitän Camas nennt, kämpft erfolgreich gegen die Achille und die Defence. Die drei Masten der Berwick werden an ihrem Fuß weggeschossen, doch die zwei Batterien spucken weiter Feuer, von einundfünfzig Leichen bedeckt, während zweihundert Verwundete in das Zwischendeck geschafft werden.
Kapitän Camas fällt; Leutnant zur See Guichard überlebt ihn nur um wenige Minuten, und die Berwick fällt den Engländern zur Beute.
Die Achille, die als Erste die Belleisle angegriffen hatte, findet sich alsbald selbst eingekreist und dem Beschuss aus den hundertsechsundneunzig Kanonen der drei englischen Schiffe Prince, Swiftsure und Polyphemus ausgesetzt, nachdem es Letzterer gelungen ist, die französische Neptune abzuschütteln. Kommandant Deniéport wird am Oberschenkel verwundet, will seine Wachtbank nicht verlassen und wird an seinem Posten getötet; der lichterloh brennende Fockmast stürzt um, in Brand gesetzt von den Granaten der französischen Mastwächter, und bedeckt das Deck mit seiner glosenden Masse.
Die Achille steht in Flammen, und ringsum ist kein alliiertes Schiff mehr zu sehen. All ihre Offiziere sind tot oder verwundet; ein Fähnrich zur See hat das Kommando übernommen. Er heißt Cochard und ist das einzige Überbleibsel eines Stabs heldenhafter Offiziere.
Er kämpft ohne Hoffnung, doch er kämpft weiter; die Furcht vor einer schrecklichen Explosion lässt die englischen Schiffe auf Distanz zur Achille gehen und erlaubt ihr, den Brand zu löschen, der Nebensache war, solange der Gegner sich in Gefechtweite befand. Die letzte Tat des jungen Offiziers besteht darin, die Flagge an die Gaffel zu nageln, bevor die Achille mit ihrer Mannschaft in die Luft geht.
Der Tod dieses Kindes ist kaum weniger heldenhaft als der Nelsons, mag dieser noch so ruhmreich sein.
Während Admiral Dumanoir sich mit seinen vier Schiffen davonstahl, kam ein Schiff, die Intrépide, unter seinem Kapitän Infernet kühn zurück, um sich in das tobende Gefecht zu stürzen. Seine Trikolore ist die letzte französische Flagge, die noch weht; sie kann die Leviathan und die Africa abwehren, wird von der Agamemnon und der Ajax unter Beschuss genommen, kämpft Bord an Bord gegen die Orion, versucht zweimal zu entern, wehrt selbst einen Enterversuch ab und ergibt sich erst, als die Conqueror als sechstes gegnerisches Schiff ihr den letzten Mast wegschießt und von ihren fünfhundertfünfundfünfzig Mann Besatzung dreihundert Mann außer Gefecht sind.
Das Streichen der Flagge der Intrépide war der letzte Seufzer in der Schlacht von Trafalgar.
Der Kampf war beendet, und die Schlacht war zweifelsfrei verloren. Einzelne Namen hatten ungeahnten, wenn auch posthumen Ruhm erworben und dem persönlichen Triumph inmitten der allgemeinen Niederlage neuen Glanz verschafft. Villeneuve hatte bis zuletzt nichts unversucht gelassen, um den Tod zu finden; Konteradmiral Magon hatte den Tod gefunden; Lucas hatte an der Spitze seiner Mannschaft, von der nur sechsunddreißig Männer überlebten, wie ein Löwe gekämpft, und aus einem seiner Mastkörbe hatte die Hand eines unbekannten Scharfschützen die Kugel abgeschossen, die Nelson getötet hatte. Die Achille hatte die Taten der Vengeur wiederholt; Infernet und Cosmao hatten Mut und Kühnheit ohnegleichen bewiesen.
Frankreich und Spanien hatten siebzehn Schiffe an die Engländer verloren, ein Schiff war explodiert, und sechs- bis siebentausend Tote und Verwundete waren zu beklagen.
Die Engländer konnten sich eines uneingeschränkten Sieges rühmen, doch dieser Sieg war blutig, grausam und teuer erkauft: Nelson war tot und die englische Marine war im wahrsten Sinne des Wortes enthauptet.
Nelsons Tod wog schwerer als der Verlust einer ganzen Armee.
Die Sieger hatten siebzehn Schiffe im Schlepptau, allesamt fast vollständig entmastet und leck, und hatten einen Admiral zum Gefangenen gemacht.
Wir hingegen hatten den Ruhm einer Niederlage, unerreicht in der Geschichte durch Mut und Hingabe der Unterlegenen.
Nacht und stürmisches Wetter vollendeten den Sieg der Engländer. Das Rippenwerk sechs zu Wracks geschossener Schiffe bezeugte den Mut ihrer Besatzungen. In der Dünung, die bei Sonnenuntergang mit dem Wind auffrischte, konnten sie sich kaum über Wasser halten.
Statt die Flotte ankern zu lassen, wie Nelson es so inständig verlangt hatte, verwendete Collingwood, der das Kommando über diesen Trümmerhaufen übernommen hatte, den Rest des Tages darauf, die siebzehn im Gefecht eroberten Schiffe zu bemannen, bis der Sturm und die Dunkelheit ihn überraschten, während er in den Trümmern der Gegner Nachlese hielt.
Wasser, Wind, Blitzschlag, Klippen – alle Geißeln des Himmels und des Meeres erfüllten die zwei Tage, die auf die Schlacht folgten, mit mehr Schrecknissen, als der Tag des Gefechts geboten hatte. Das aufgewühlte Meer nahm sechzig Stunden lang die drei Flotten zum Spielball, ohne zwischen Siegerin und Besiegten zu unterscheiden.
Ein Teil der von Nelsons Flotte eroberten Schiffe wurde durch die Gewalt des Meeres von den Verbindungstauen losgerissen und entfloh oder ließ sich von den Wellen an die Klippen des Kaps von Trafalgar treiben.
Die Bucentaure wurde an den Felsen der Küste zerschmettert. Die Indomptable beleuchtete mit den Feuern an ihrem Deck ihren Kurs zur spanischen Küste und sank mit Mann und Maus vor Rota. Ein einziger Schrei war zu hören, der Schrei der ganzen Mannschaft, die vom Ozean verschlungen wurde.
Als Collingwood sah, dass der Wind ihm eine Beute nach der anderen entriss, ließ er die Santissima Trinidad in Brand setzen und verbrannte mit ihr zusammen drei spanische Dreidecker, die San Augustin, die Argonauta und die Santa Ana.
Das Meer schien sich kurzzeitig zu beruhigen, der Wind schien sich für einen Augenblick zu legen, so dass man den größten Scheiterhaufen brennen sehen konnte, der jemals auf dem Meer geschwommen war.
Die Besiegten befanden sich nach der Schlacht in einer weniger gefährlichen Lage als die Sieger. Admiral Gravina mit seinen elf Schiffen hatte in Cadiz einen nahen und sicheren Hafen, die Engländer hingegen waren schon zu weit auf See, um einen Hafen anzusteuern oder zu ankern und mussten nach den Mühen des errungenen Sieges dem Meer die Stirn bieten.
Im Sturm um das nackte Überleben kämpfend, auf Schiffen, die entmastet und kaum manövrierfähig waren, mussten sie es aufgeben, Prisen zu schleppen, die noch entmasteter und seeuntüchtiger waren als die eigenen Schiffe.
Sie ließen einige der Prisen zurück, die sie genommen hatten, und der Sieg des Meeres über die Trümmer der Engländer und die eigenen Trümmer entlockte den Besiegten Jubelrufe.
Die Engländer, in deren Schlepptau sich die Bucentaure befand, übergaben sie der übrig gebliebenen französischen Besatzung, als sie sich mitsamt ihren Gefangenen von Collingwood im Stich gelassen sahen, und die Franzosen dankten dem Sturm, der sie vor der wenig erbaulichen Zukunft auf einem Gefangenenschiff gerettet hatte, errichteten Behelfsmasten auf ihrem entmasteten Schiff, behängten sie mit Segelfetzen und nahmen Kurs auf Cadiz, vom Sturmwind unterstützt.
Die Algésiras, die den Leichnam des tapferen Konteradmirals Magon mit sich führte wie die Victory die sterblichen Überreste Nelsons, wollte ebenfalls den Sturm nutzen, um sich zu befreien. Trotz aller Spuren des Kampfes, in dem sie sich so heldenhaft geschlagen hatte, hielt sie sich besser über Wasser als die anderen Prisen, weil sie ein neues Schiff war, doch sie besaß keinen einzigen Mast mehr; das Schiff, das sie schleppte, konnte kaum manövrieren und kappte zuletzt die Taue, die es zum Gefangenen seiner Beute machten. Die englischen Soldaten an Bord der Algésiras, die auf die Beute aufpassen sollten, hielten sich für verloren und feuerten eine Kanone ab, um Hilfe herbeizurufen, doch die englische Flotte war mit ihren eigenen Sorgen zu beschäftigt, um ihnen zu antworten. Daraufhin wandten sie sich an einen französischen Offizier, den zweiten Kommandanten des Schiffs, auf dem sie sich befanden.
Dieser französische Offizier war Monsieur de la Bretonnière; sie baten ihn, mit seiner Mannschaft das Schiff zu retten und ihnen allen, Engländern wie Franzosen, das Leben zu retten.
Schon bei ihren ersten Worten erkannte de la Bretonnière, welchen Nutzen er aus der Situation ziehen konnte. Er verlangte, sich mit seinen Landsleuten zu besprechen, die unten im Schiff gefangen waren. Es wurde ihm gestattet.
Er sucht die Offiziere auf und unterhält sich mit ihnen unter vier Augen. Er berichtet ihnen, was soeben geschah. Mit der schnellen Auffassungsgabe, die der große Vorzug aller Franzosen ist, begreifen sie sofort, worum es geht. Auf der Algésiras befinden sich dreißig bis vierzig bewaffnete Engländer und zweihundertsiebzig entwaffnete Franzosen, die zu allem bereit sind, um den Engländern das Schiff zu entreißen. Die Offiziere gehen zu den einfachen Gefangenen, schildern ihnen das Vorhaben, werden mit Begeisterung gehört. Monsieur de la Bretonnière soll die Engländer auffordern, sich zu ergeben; wenn sie sich weigern, sollen sich die Franzosen auf ein Zeichen hin auf sie stürzen, und wenn die Engländer kämpfen, werden sie zwar viele ihrer Gegner töten, aber die Überzahl wird den Sieg davontragen.
Kapitän de la Bretonnière kehrt zu den Engländern zurück und überbringt ihnen die Antwort seiner Gefährten.
Dass die Algésiras inmitten so großer Gefahren sich selbst überlassen wurde, hebt alle Verpflichtungen auf. Die Franzosen lassen ausrichten, dass sie sich als frei betrachteten und dass es ihren Wächtern im Übrigen unbenommen sei zu kämpfen, sollten sie dies wünschen; die französische Besatzung ist unbewaffnet und wartet doch nur auf ein Zeichen, um sich in den Kampf zu stürzen.
In ihrer Ungeduld fallen zwei französische Matrosen englische Wachen an, werden mit dem Bajonett abgewehrt, und der eine ist tot, der andere schwer verwundet. Daraufhin bricht ein unvorstellbarer Tumult aus, doch Monsieur de la Bretonnière gelingt es, ihn einzudämmen und den englischen Offizieren Zeit zum Nachdenken zu geben. Sie überlegen kurz und ergeben sich dann den Franzosen unter der Bedingung, dass man sie freilassen wird, sobald das Schiff in Frankreich ankommt.
Monsieur de la Bretonnière stellt eine letzte Bedingung: die, dass die Engländer ihm erlauben, ihre Freiheit von der französischen Regierung zu erbitten, und er verspricht ihnen, diese Bitte erfüllt zu sehen.
Daraufhin ertönen Freudenrufe auf dem Schiff, Offiziere und Matrosen nehmen ihre Posten ein, die Marsstenge werden aus ihrem Versteck geholt, von den Schiffszimmerleuten an die Maststümpfe genagelt, Segel werden zutage gefördert und angebracht, und man setzt Kurs auf Cadiz.
Die ganze Nacht hindurch wütete der Sturm, den Nelson vorausgesehen hatte, und bei Tagesanbruch verstärkte er sein Toben. Die Algésiras kämpfte den ganzen Tag gegen das Unwetter; obwohl sie keinen Lotsen an Bord hatte, gelangte sie dank eines Matrosen, der mit den Gewässern um Cadiz vertraut war, bis zum Eingang in den Hafen.
Dort angekommen, wagt das Schiff sich nicht in den Hafen hinein; ihm blieben nur mehr ein schwerer Anker und ein dickes Tau, um sich dem Wind zu widersetzen, der es zur Küste blies, wo es stranden musste; gibt der Anker nach, ist die Algésiras verloren, denn sie befindet sich wenige Kabellängen von einem gefährlichen Landvorsprung entfernt.
Die Nacht verbringt die Schiffsmannschaft in allen Todesängsten, die man sich denken kann; dann wird es Tag; nachts waren Schreie zu vernehmen, die das Sturmgetöse übertönten: Die Bucentaure ist an der Küste gestrandet, doch die Indomptable, die neben ihr geankert hatte, die Indomptable, die wenig zum Kampfgeschehen beigetragen und folglich wenig Schäden davongetragen hatte, war mit guten Ankern und starken Tauen befestigt.
Den ganzen Tag lang feuerte man auf der Algésiras Notsignale ab, um Hilfe anzufordern. Einige Barken sind so todesmutig, Hilfe zu bringen, doch sie scheitern, bevor sie das Schiff erreichen. Einer Einzigen gelingt es, anzulegen und mit einem schwachen Anker zu ankern.
Die Nacht senkt sich wieder auf das Meer; die Algésiras und die Indomptable liegen wenige Kabellängen voneinander entfernt vor Anker; der Sturm braust heftiger als zuvor; eine doppelte Flamme lenkt alle Blicke zur Indomptable, die Notsignale abfeuert: Ihre zwei starken Anker haben nachgegeben, und sie treibt im Licht ihrer Fanale wie ein Flammengespenst mit der vor Verzweiflung schier wahnsinnigen Besatzung an Bord in wenigen Fuß Entfernung an der Algésiras vorbei, bevor sie mit ohrenbetäubendem Krachen an der Küste zerschellt.
Von einem Augenblick zum nächsten verschlingt das Meer alles: die Fanale, die das Schiff beleuchten, die Schreie, die laut widerhallen.
Fünfzehnhundert Mann, die sich an Bord geflüchtet hatten, verlieren ihr Leben.
Die Algésiras, die noch an ihren kleinen Ankern hängt, erlebt zum eigenen Erstaunen, dass der nächste Tag heraufzieht und der Sturm sich legt. Sie kehrt zur Reede von Cadiz zurück, wo sie im Schlamm stranden wird, bis die nächste Flut sie aus dieser misslichen Lage befreit.
Doch sehen wir nun, was während dieser entsetzlichen Ereignisse mit der Redoutable geschah, mit ihrem Kapitän Lucas und dem dritten Leutnant René.
Erst nach dreistündigem Gefecht hatte Lucas die Flagge gestrichen; von sechshundertdreiundvierzig Mann Besatzung waren fünfhundertzweiundzwanzig außer Gefecht gesetzt: dreihundert waren tot und zweihundertzwanzig schwer verwundet. Alle Offiziere und zwei von elf Seekadetten zählten zu Letzteren.
Kapitän Lucas hatte nur eine leichte Verwundung am Oberschenkel erlitten.
Die Redoutable selbst hatte den Großmast und den Besanmast eingebüßt, ihr Heck war durch den Dauerbeschuss seitens der Tonnant so eingedrückt, dass es nur mehr ein großes Loch bildete, und die Artillerie war durch das Entern, durch den Beschuss und zuletzt durch die Explosion einer Achtzehnerkanone und einer Sechsunddreißigerkarronade völlig demontiert.
Zu beiden Seiten war das Schiff durchlöchert wie ein Spitzenkragen oder entblößt wie ein Gerippe. Die gegnerischen Kugeln, die auf keine Planken mehr trafen, die ihnen Widerstand geboten hätten, drangen in das Unterdeck ein und töteten dort bedauernswerte Verwundete, die von den Wundärzten versorgt worden waren oder auf ihre Versorgung warteten.
Das Steuerruder war im Feuer jeder Manövrierfähigkeit beraubt worden. Mehrere Lecks waren entstanden, die Pumpen arbeiteten nicht mehr, die Victory und die Temeraire hatten sich an die Redoutable geheftet, waren jedoch nicht nur außerstande, die gekaperte Redoutable zu übernehmen, sondern auch, sich von ihr zu trennen.
Gegen sieben Uhr abends kam die englische Swiftsure und nahm die Redoutable ins Schlepptau.
Als es dunkel wurde, trat René zu Kapitän Lucas und schlug ihm vor, das Schiff zu verlassen und zur spanischen Küste zu schwimmen, die nur eine Meile entfernt war.
Lucas war ein ausgezeichneter Schwimmer, doch seiner Verwundung wegen befürchtete er, die Küste nicht zu erreichen. René sagte, er übernehme die Verantwortung und sei imstande, den Kommandanten schwimmend zu stützen und an Land zu bringen.
Lucas weigerte sich jedoch, auf dieses Angebot einzugehen, und riet René, nur an sich zu denken.
René schüttelte den Kopf. »Ich bin aus Indien gekommen, um Sie zu finden, Kommandant«, sagte er, »und ich werde Sie jetzt nicht verlassen. Sollten wir getrennt werden, wohlan, dann jeder für sich. Wo werden wir einander wiedersehen? In Paris?«
»Sie werden im Marineministerium erfahren, wo ich mich befinde, lieber Freund«, erwiderte Lucas.
Daraufhin trat René näher zu ihm und sagte: »Mein geschätzter Kommandant, in meinem Gürtel habe ich zwei Rollen von jeweils fünfzig Louisdors; würden Sie mir den Gefallen erweisen, eine davon zu nehmen?«
»Ich danke Ihnen, mein wackerer Freund«, sagte Lucas, »doch in einer Schublade in meinem Schlafzimmer, falls es dieses Zimmer noch geben sollte, besitze ich etwa dreißig Louisdor, aus denen ich Ihren Anteil bezahlen wollte. Sobald Sie in Paris ankommen, säumen Sie nicht, sich nach mir zu erkundigen, denn mein Dienstgrad verschafft mir Rücksichten, welche diese Bulldoggen Ihnen gegenüber vielleicht nicht zeigen werden.«
Am nächsten Tag schickte der Kommandant der Swiftsure ein Boot, um den Kommandanten Lucas und seinen Stellvertreter Monsieur Dupotet sowie den Unterleutnant zur See Ducrès abholen zu lassen. Sollte Kapitän Lucas wünschen, einen weiteren Offizier als Begleitung mitzunehmen, konnte er ihn nennen, und er würde auf die Swiftsure gebracht werden.
Den ganzen Tag über war man mit dem Bergen beschäftigt; die Redoutable sank so schnell, dass es mit bloßem Auge zu sehen war. Glücklicherweise war es gelungen, einhundertneunzehn Mann zu bergen; zwei weitere Männer stürzten bei der Bergung ins Wasser, und einer von ihnen ertrank.
Lucas hatte René gefragt, ob er ihn begleiten wolle, und René war mit ihm an Bord der Swiftsure gebracht worden.
Man nahm Kurs auf Gibraltar, und am nächsten Tag befand man sich nahe einer der zwei Säulen des Herkules.
René hatte sich nicht anmerken lassen, dass er die englische Sprache beherrschte, und deshalb konnte er mithören, was in seiner Gegenwart auf Englisch und auf Spanisch gesagt wurde.
Auf diese Weise erfuhr er, dass die Gefangenen auf Fregatten nach England verbracht werden sollten und deshalb getrennt werden würden, da eine Fregatte nicht mehr als zusätzliche sechzig bis siebzig Mann aufnehmen konnte.
Wenige Tage später berichtete er Lucas, dass dieser seines Rangs wegen auf einem Kriegsschiff nach London gebracht werden würde, während alle Übrigen auf zwei Fregatten verteilt werden sollten, die am selben Tag nach England aufbrechen würden wie das Linienschiff mit ihrem Kapitän.
Die Engländer wollten ein Geschwader aus zwei Fregatten, einer Korvette und einem dreimastigen Kauffahrer, den man für den Krieg aufgerüstet hatte, für die Rückkehr nach Europa zusammenstellen – »nach Europa« sagen wir, weil Gibraltar eher afrikanisch als europäisch ist.
Kapitän Lucas kam auf die Prince, die weder Verluste noch Schäden erlitten hatte, weil sie nicht an der Schlacht beteiligt gewesen war.
René wurde mit etwa fünfzig Gefährten auf den Dreimaster und Kauffahrer Samson gebracht. Beim Abschied hatte Lucas ihm all seine Zuneigung bezeigt, die René sich durch die Tapferkeit erworben hatte, mit der er am Tag der fatalen Schlacht gekämpft hatte.
René und Lucas nahmen Abschied voneinander wie zwei Freunde, nicht wie Vorgesetzer und Untergebener.
Die Prince, ein guter und schneller Segler, segelte die Küste entlang und umfuhr bald Kap Finistère.
Kapitän Parker, der Kommandant der Samson, der sich seines Schiffs weniger sicher war, fuhr aufs offene Meer hinaus in Befolgung der Regel, die besagt, bei Stürmen gebe es keinen gefährlicheren Aufenthalt als nahe der Küste.
Als das Meer sich ein wenig beruhigt hatte, die Sonne sich wieder blicken ließ und man die Position des Schiffs peilen konnte, stellte man fest, dass man sich dreißig bis fünfunddreißig Meilen im Westen Irlands befand; unverzüglich nahm man Kurs in östliche Richtung. Die älteren Seeleute wussten jedoch, dass die Windstille nicht anhalten würde, und Kapitän Parker, der noch nie ein Kriegsschiff befehligt hatte, wusste nicht recht, was er tun sollte.
Unterwegs hatte er gelernt, das nautische Wissen Renés zu schätzen, den man ihm ausdrücklich empfohlen hatte, und da es nichts daran auszusetzen gab, die wenigen Gefangenen an Deck frische Luft schöpfen zu lassen, trat er auf René zu, deutete auf eine Wolkenwand, die dunkel im Westen dräute, und sagte in schlechtem Französisch: »Heute werden wir wohl spät zu abend speisen, Leutnant, ich habe aber den Koch benachrichtigen lassen.« Wieder wies er auf die schwarzen Wolken, die sich zusehends zusammenballten, und fügte hinzu: »Und hier haben wir ein Schauspiel, das verdient, betrachtet zu werden.«
»Ja«, sagte René, »vorausgesetzt, dass sein Ergebnis uns nicht zu sehr zu schaffen macht.«
Das Schauspiel war in der Tat sehenswert, doch Renés Befürchtungen waren keineswegs übertrieben.
Dichte schwarze Wolken sammelten sich in südwestlicher Richtung und bildeten bald ein ununterbrochen wachsendes Gebirgsmassiv mit allen Aspekten himmlischer Alpen: Gipfel mit schroffen Berggraten und steilen Pfaden, über die man sie erklomm; der alle anderen überragende Berg dieser phantasmagorischen Anden, vergleichbar der Spitze eines Vulkans, über die der Wind mit unvorstellbarer Schnelligkeit dahinjagte, wirkte selbst wie eine letzte Rauchwolke, wie sie Kaminen entweichen, die kurz zuvor von der Feuerwehr gelöscht wurden. Es war ein Vergnügen, diese Wolken über das strahlende Blau des Himmels zu verfolgen, denn der Himmel war oberhalb des Horizonts von prachtvollem Azur, abgesehen von jener Stelle, wo er wie vom Rauch eines Vulkans umwölkt wirkte.
»Wie auch immer«, sagte der erste Leutnant überheblich, »wenn aus dieser schwarzen Hölle etwas zusammengebraut werden sollte, wird es nicht im Handumdrehen geschehen, und wir werden genug Zeit haben, in Ruhe zu speisen und unsere Mahlzeit zu verdauen.«
»Wenn ich um Verzeihung bitten darf«, warf ein alter Matrose ein, der vorbeikam, ohne dass er gewagt hätte, sich an seinen Vorgesetzten zu wenden, »wird der Wind aus Südwesten schneller sein als Ihre Zähne oder Ihr Magen, mögen sie noch so tüchtig sein.«
»Ich bin der Ansicht dieses alten Matrosen«, sagte René, »und ich glaube nicht, dass der Sturm das Entgegenkommen besitzen wird, uns in Ruhe zu Abend speisen zu lassen; wenn ich einen Rat geben darf, dann ist es der, sich gegen den Sturm zu wappnen, der über das Schiff hereinbrechen wird wie Blitz und Hagel.«
»Aber Kapitän«, sagte ein Midshipman, der auf der Verschanzung saß, den Halsschild geschlossen und den Blick auf die schwarze Masse gerichtet, die alle so sehr beschäftigte, »es herrscht Windstille, und fast keine Wellen berühren unser Schiff; warum solche Hast?«
»Mister Blackwood, wäre Ihr Onkel an Ihrer Stelle, würde er so etwas nicht fragen; lassen Sie die Vorbramsegel reffen und umgehend streichen.«
Blackwood ordnete das Manöver an, und der alte Seemann, der sich offenbar in der Rolle des Unglückspropheten gefiel, kommentierte dies mit den Worten: »Sehr gut! Aber noch lange nicht genug.«
Der Kapitän bedachte ihn mit einem Lächeln und fuhr fort: »Sobald die Vorbramsegel gestrichen sind, lassen Sie Mars- und Toppsegel dreimal reffen und das Großsegel einholen.«
Der Befehl wurde mit der Pünktlichkeit befolgt, die das Hauptverdienst des Marinedrills ist. Am Horizont sah man Wind aufkommen, und unter seinen Schwingen kräuselte sich die Wasseroberfläche; die dunkle Stelle im Südwesten breitete sich am Himmel aus wie ein riesiger Tintenfleck; die leichte Brise war heftig und bedrohlich geworden.
»Und was würdest du jetzt tun, Alter?«, fragte der Kapitän den Ratgeber.
»Mit aller Hochachtung«, sagte der alte Matrose, »ich würde das Segelwerk noch mehr verringern und fast keine Segel gesetzt lassen.«
»Focksegel und Klüver einholen!«, rief der Kapitän.
Der Befehl wurde ausgeführt.
Die Wellen schwollen gewaltig, der Donner dröhnte.
»Zu Tisch, meine Herren, zu Tisch!«, rief ein Midshipman, der in der Luke erschien, seine Serviette in der Hand.
Er hielt sie hoch und ließ sie in der Luft wehen. »Oho!«, sagte er. »Da ist aber ein ordentlicher Wind aufgekommen; unten haben wir das nicht gemerkt.«
»Ja, aber hier oben ist es nicht zu übersehen«, erwiderte der Kapitän, »und Sie werden es unten bald genug merken.«
»Wie steht es an Deck?«, fragten die anderen Offiziere den Midshipman bei seiner Rückkehr von der Erkundung an Deck.
»Ich habe schon schöneres Wetter erlebt, als im Augenblick herrscht«, antwortete dieser.
»Kommt der Kapitän nicht zum Speisen herunter?«, fragte ein anderer.
»Nein. Er bleibt an Deck mit dem jungen Gefangenen, den uns Kapitän Lucas eigens empfohlen hat und von dem es heißt, er habe Nelson erschossen.«
»Sollten wir in Gefahr geraten«, sagte der zweite Leutnant, »gelobe ich, ihn zum Dank für diese Heldentat an den Meeresgrund zu expedieren und ihn notfalls zu begleiten.«
»Mein Lieber, Sie urteilen ungerecht«, sagte einer seiner Gefährten. »Wenn er der Schütze ist, der Nelson getötet hat, dann hat er seine Pflicht als Franzose getan. Würden Sie es verdienen, ins Meer geworfen zu werden, wenn Sie Lucas erschossen hätten? Ich weiß wohl, dass alle Lucasse der Welt keinen Nelson aufwiegen können, aber Kommandant Lucas ist dennoch ein tapferer Kapitän. Haben Sie gesehen, dass seine Uniform dreimal auf der Verschanzung der Victory aufgetaucht ist? Haben Sie gesehen, wie mitten in Rauch und Feuer seine Enteraxt wie ein Regenbogen aufblitzte? Sollten Sie ihm begegnen, bei Regen oder Sonnenschein, grüßen Sie ihn ehrerbietig und machen Sie ihm Platz; das jedenfalls täte ich.«
Während in der Offiziersmesse diese Debatte stattfand, war an Deck bleierne Stille eingetreten. Der Wind hatte sich plötzlich gelegt, und in Ermangelung seiner Unterstützung rollte das Schiff nun schwerfällig durch die Wogen; das Wasser schlug trostlos gegen den Schiffsrumpf, und wenn das Schiff mühsam aus einem Wellental auftauchte, floss das Wasser vom Oberdeck in das Meer zurück und bildete dabei eine Vielzahl funkelnder kleiner Wasserfälle.
In diesem Augenblick wäre die Flamme eines Lichts auf dem Schiffsdeck senkrecht in den Himmel aufgestiegen.
»Eine scheußliche Nacht, Kapitän Parker«, sagte der erste Leutnant, dem sein Rang erlaubte, den Kapitän anzusprechen.
»Ich habe schon erlebt, dass der Wind mit weitaus weniger Vorzeichen umgeschlagen ist«, sagte der Kapitän in beruhigendem Ton.
»Aber diesmal«, brummte der alte Seebär, dem seine vierzig Jahre auf See Vorrechte einräumten, denen nicht nur seine Kameraden, sondern auch die Offiziere sich beugten, »begleiten den Umschlag Vorzeichen, die sogar den ältesten Matrosen nachdenklich stimmen müssen.«
»Meine Herren, was können Sie noch wünschen?«, fragte der Kapitän. »Kein Lufthauch regt sich, und das Schiff ist bis auf das Vorbramsegel abgetakelt.«
»Gewiss!«, sagte der alte Matrose. »Und ich gehe noch weiter und behaupte, dass die Samson sich für einen braven Kauffahrer wacker hält. Kaum ein Schiff ihrer Größenordnung, das nicht die Flagge König Georges trägt, segelt so schnell wie sie oder gar schneller; aber dieses Wetter zu dieser Stunde muss einen alten Seemann nachdenklich stimmen. Sehen Sie dort drüben den grauen Lichtschein, der sich uns so geschwind nähert, und können Sie mir sagen, woher er kommt? Kommt er aus Amerika oder vom Nordpol? Der Mond ist es jedenfalls nicht.«
Der Kapitän trat an die Luke, wo er das Gelächter der jungen Offiziere und das Klingen ihrer Gläser hörte.
»Genug getrunken und gelacht!«, rief er barsch hinunter. »Alle Mann an Deck!«
Und unverzüglich eilten die so Angesprochenen an Deck. Sobald jeder mit eigenen Augen Himmel und Meer gesehen hatte, richtete sich alles Trachten der gesamten Mannschaft nur mehr darauf, für den Sturm gerüstet zu sein, der unaufhaltsam näher kam.
Niemand sprach ein Wort, doch jeder setzte alle Kraft und Umsicht ein, als wollten sie einander überbieten. Und kein Arm war überflüssig, für jeden gab es eine Aufgabe.
Der bleiche, unheimliche Nebel, der seit einer Viertelstunde im Südwesten aufstieg, senkte sich nun so schnell über das Schiff, als wäre er ein Rennpferd, das gewinnen wollte; die Luft hatte die Feuchtigkeit verloren, die Kennzeichen einer Brise aus Osten ist, und die Reffbänder flatterten zwischen den Masten als Vorzeichen des Sturms, der sich zusammenbraute.
Dann ertönte ein lautes und schreckliches Donnern über dem Ozean, dessen Oberfläche erstarrte und sich dann mit weiß schimmerndem Schaum bedeckte. Im nächsten Augenblick brach der Wind mit aller Gewalt über die schwerfällige, reglose Masse des Schiffskörpers herein.
In diesem Sturm war das Schiff in der Situation eines Infanterieregiments, das mitten auf einer Ebene den Ansturm einer Kavallerieschwadron erwartet.
Beim Herannahen des Sturmwinds hatte der Kommandant einige Segel setzen lassen, um den Wechsel der Windrichtung zu nutzen und Gegenwind zu bekommen. Doch das Schiff war ein Kauffahrer und kein Schnellsegler, und es gehorchte weder den ungeduldigen Wünschen des Kapitäns noch den Erfordernissen des Augenblicks. Langsam und schwerfällig verließ es seinen Kurs gen Osten, so dass es genau in die missliche Lage geriet, die ungeschützte Seite dem Anprall des Sturms darzubieten. Zum Glück für alle, die ihr Leben auf diesem ungeschützten Schiff aufs Spiel setzten, sollte es nicht die ganze Gewalt der Sturmbö auf einmal erleiden. Die wenigen Segel, die wieder gesetzt worden waren, zitterten an ihren massiven Rahen, blähten sich und erschlafften eine Minute lang abwechselnd, und dann fiel der Sturm mit ungezähmter Macht über sie her.
Der Himmel war so finster, dass man sich nur tastend bewegen konnte. Die Männer sahen einander als bleiche Gespenster im flüchtigen Schein der Blitze oder im Widerschein der schaumigen Brecher, die das Auge für einen Augenblick blendeten, bevor es neuer Finsternis ausgesetzt wurde, welche nach dem kurzen, grellen Licht umso schwärzer erscheinen musste. Alles Menschenmögliche, das man tun konnte, um die entfesselte Gewalt des Sturms in ihren Auswirkungen abzumildern, war getan worden. Nun wartete man ab und zählte die Minuten.
Vom Schlingern und Schwanken des Schiffs immer wieder gegen Masten und Verschanzung geschleudert, von abgerissenen Tauen gepeitscht, die wie unsichtbare, aber schneidende Geißeln durch die Luft sausten, erschöpft vor Anstrengung und Angst und wenig Trost in einer Hoffnung auf Rettung findend, die aberwitzig erscheinen musste, wenn man sah, dass jeden Moment neue Gefahren drohten, kauerten die Matrosen der Samson an der Luvseite des Schiffs und ließen geduckt die riesigen Wellen über sich ergehen, die vom Heck oder von der Seite hereinbrachen und das Deck kurzzeitig in eine Wasserwüste verwandelten. Kein Wort fiel, und jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt: trübsinniges Schweigen, vereinzelte Flüche, vereinzelte Wehlaute, vereinzelte Verwünschungen oder Anklagen an die Adresse des Himmels.
Das Meer spielte mit dem Schiff wie ein Riese mit einem Federball, versetzte ihm Schläge von vorne, von hinten, von seitwärts, gegen Hüften, Kopf und Flanken, von allen Seiten gleichzeitig, trug es auf den Gipfel der rollenden Berge oder stürzte es in Schluchten, aus denen ein Auftauchen unmöglich erschien.
Einer der Schläge gegen Backbord traf das Schiffsheck so kraftvoll, dass er es nach rechts drehte, wobei das Focksegel, das es nach links geführt hatte, zerstört wurde. Der Wind bemächtigte sich seiner und zerriss das fest gewebte Segeltuch wie dünnen Musselinstoff.
Kein Fetzen von dem zerlöcherten, zerrissenen, zerfetzten und weggerissenen Segel war am Mast verblieben; die Ruderpinne zerbrach, und das nach Steuerbord gebeugte Schiff wurde von solchen Wassermassen überschwemmt, dass es sich nicht aufrichten konnte.
»Was tun?«, fragte der Kommandant René.
»Anluven! Sofort anluven!«, erwiderte René.
»Anluven, auf der Stelle!«, rief Kommandant Parker so laut, dass seine Stimme durch das Sturmgetöse hindurch vernehmbar war.
Der alte Seemann, der mit seinen Ratschlägen nicht gegeizt hatte, stürzte nun mit einer neuen Ruderpinne zum Steuerruder und nahm den Posten des Untersteuermanns ein. Er befolgte den Befehl des Kapitäns schnell und zuverlässig, doch vergebens hielt er den Blick auf den Klüver gerichtet, um zu sehen, ob das Schiff das Manöver ausführte. Zweimal neigten die Masten sich dem Horizont entgegen und hoben sich anmutig in die Luft, doch beide Male wurde das Schiff von Masse und Druck des Wassers überwältigt und blieb zur Seite geneigt liegen.
»Was tun?«, fragte der Kommandant René wieder.
»Kappen!«, sagte René.
»Aufgepasst!«, rief Parker, und er befahl dem zweiten Leutnant: »Holen Sie eine Axt.«
Blitzschnell gehorchte der Leutnant und kletterte den Fockmast hinauf, um eigenhändig den Befehl des Kommandanten auszuführen; dann hob er den Arm und fragte mit fester und ruhiger Stimme: »Soll ich kappen?«
»Warten Sie! Alter Nick«, rief der Kapitän dem Steuermann zu, »gehorcht das Schiff dem Steuerruder?«
»Nein, mein Kapitän.«
»Dann kappen Sie!«, sagte Parker ruhig und bestimmt.
Ein einziger Schlag genügte; unter der Last des immensen Gewichts, das auf ihm ruhte, hatte der Mast kaum den Axthieb erhalten, als sein Holz knirschend barst, er sich wie ein entwurzelter Baum unter lautem Krachen von seiner Takelage befreite und die kurze Strecke bis ins Meer überwand.
»Fragen Sie, ob das Schiff sich aufrichtet«, soufflierte René dem Kapitän.
»Richtet es sich auf?«, rief Parker dem Mann am Steuer zu.
»Mein Kommandant, es hat sich leicht bewegt, aber der neuerliche Windstoß hat es wieder hingelegt.«
Der zweite Leutnant stand bereits am Fuß des Großmasts; ihm war die Bedeutung seiner Aufgabe bewusst.
»Soll ich kappen?«, fragte er.
»Kappen Sie!«, erwiderte der Kapitän düster.
Ein kraftvoll geführter Schlag war zu hören, gefolgt von einem schrecklichen und beeindruckenden Knirschen und Splittern, woraufhin ein zweiter und ein dritter Schlag erfolgten; Mast, Tauwerk, Segelwerk, alles stürzte ins Meer, und das Schiff, das sich im selben Augenblick aufrichtete, begann schwerfällig gegen den Wind zu segeln.
»Sie richtet sich auf! Sie richtet sich auf!«, rief die Mannschaft wie aus einem Mund, als wäre allen mit einem Mal die Zunge gelöst.
»Machen Sie das Schiff frei, damit es sich ungehindert bewegen kann«, rief der Kapitän mit bewegter Stimme, »und halten Sie sich bereit, die Marssegel einzuholen und festzumachen; lassen Sie es Fahrt aufnehmen und raume See gewinnen; doch unterdessen kappen Sie! Nur Mut, Freunde, kappen Sie, alle Mann, mit Messern, Äxten, womit auch immer!«
Und im Handumdrehen gelang es den Männern, belebt mit der Kraft und dem Mut, die ihnen die wiedererstarkende Hoffnung verlieh, die Taue zu zerhauen, an denen Splitter und Sparren hingen, bis die Samson nur mehr die Schaumkronen der Wogen berührte wie ein Vogel, dessen Flügel sich dicht über dem Wasser bewegen.
Der Wind heulte und toste, dass es wie Donnergrollen klang; die Leinen des letzten Segels, das gesetzt geblieben war, als der Sturm hereinbrach, flatterten, und das Besansegel, das auf halber Höhe beigesetzt war, blähte sich so heftig im Wind, dass es aussah, als werde es im nächsten Moment den Besanmast, der als einziger Mast geblieben war, mit sich losreißen.
René legte dem Kapitän die Hand auf den Arm und deutete auf die Gefahr. Parker nickte und rief Worte, die eher wie ein Gebet klangen als wie ein Befehl: »Dieser Mast kann der Belastung nicht lange standhalten, Leute; wenn er bei dieser Fahrtgeschwindigkeit vorwärts auf das Schiff fällt, kann es um die Samson geschehen sein. Schickt einen oder zwei Männer hinauf, um das Segel von den Rahen zu trennen.«
Der zweite Leutnant, an den dieser Befehl ergangen war, trat einen Schritt zurück. »Der Mast biegt sich wie ein Weidenzweig«, sagte er, »und er ist schon der Länge nach geborsten. Es wäre der sichere Tod, sich dort hinaufzuwagen, solange der Sturm nicht nachlässt.«
»Sie haben recht«, sagte René, »geben Sie mir Ihr Messer.«
Und bevor der zweite Leutnant ihn hätte fragen können, was er bezwecke, hatte René ihm das Messer aus der Hand genommen und kletterte die Wanten empor, deren Kabelgarn im Sturmwind so angespannt war, dass es fast zu reißen drohte.
Diejenigen, die ihm mit dem Blick folgten, begriffen seine Absicht und erkannten zugleich, um wen es sich handelte.
»Der Franzose! Der Franzose!«, riefen zehn Stimmen gleichzeitig.
Und sieben oder acht alte Matrosen, die es beschämte, einen Franzosen tun zu sehen, was keiner von ihnen zu tun gewagt hatte, eilten zu den Webeleinen der Wanten, um in den glühenden Himmel zu klettern.
»Alle Mann herunter!«, rief der Kapitän in sein Sprachrohr. »Alle Mann herunter bis auf den Franzosen!«
Die Worte erreichten die Ohren seiner Matrosen, doch in ihrer Begeisterung und Beschämung stellten sie sich taub.
René war vor ihnen oben angekommen und führte die scharfe Klinge seines Messers gegen das dicke Tau, mit dem das geblähte Segel an der Besanrah festgemacht war. Als hätte es nur auf diesen Anstoß gewartet, riss das Segel sich von seinen übrigen Leinen los und schwebte vorwärts über das Schiff hinweg wie ein Banner, das sich entfaltet; dann wurde das Schiff von einer schweren Woge emporgetragen und stürzte schwerfällig unter der Last des eigenen Gewichts und des Sturms in das Wellental.
Unter dem Aufprall zerriss ein Tau der unteren Takelage des Masts, der ein fürchterliches Knirschen ertönen ließ und sich gefährlich nach vorne neigte.
»Kommen Sie herunter!«, rief der Kapitän in sein Sprachrohr. »Klettern Sie die Stagen hinunter, schnell, beeilen Sie sich! Warten Sie nicht länger, kommen Sie herunter!«
Nur René gehorchte. So schnell wie der Donner auf den Blitz folgt, ließ er sich zum Oberdeck hinuntergleiten.
Einen Augenblick lang schwankte der Mast vor und zurück, als wollte er sich in alle Richtungen des Horizonts bewegen, doch dann gab er dem Schlingern des Schiffs nach, und alles stürzte ins Meer, wo es zerschmettert wurde: Leinen, Rahen, Taue, und schüttelte die Menschentraube ab; die einen wurden an Deck zerschmettert, die anderen verschwanden in den aufgewühlten Wogen.
»Lasst eine Schaluppe zu Wasser! Lasst eine Schaluppe zu Wasser!«, rief der Kapitän.
Doch sogleich wurden alle Mastüberreste zusammmen mit denjenigen, die sich an sie klammerten, von dem dichten Nebel verschlungen, der vom Wasser bis zu den Wolken reichte.
Der Kommandant erkannte, dass es keine Aussicht gab, die Männer im Meer zu retten, und nachdem er die auf Deck gestürzten Matrosen dem Wundarzt übergeben hatte, trat er zu René, um ihm die Hand zu reichen, und fand ihn so ruhig und gelassen vor, als wäre er völlig unbeteiligt an den letzten Geschehnissen.
Während der Kapitän sich erkundigte, ob René wohlbehalten und unversehrt war, kam ein Matrose, um zu melden, dass im Schiffsrumpf das Wasser vier Fuß hoch stand. Das Schiff war von so vielen und schweren Wellen, die in der Seemannssprache Kaventsmänner heißen, überschwemmt worden, dass der Schiffsrumpf fast zur Hälfte vollgelaufen war, bevor man einen Gedanken daran verwendet hatte.
»Unter anderen Umständen«, sagte der Kommandant, »wäre das nicht weiter von Belang; aber das Pumpen ist den Matrosen nun einmal verhasst, sie können es nicht leiden, und in ihrer Erschöpfung will ich ihnen diesen ungeliebten Dienst nicht abverlangen.«
»Kommandant«, sagte René, der dem Kapitän die Hand hinstreckte, »wollen Sie mir vertrauen?«
»Ganz und gar«, erwiderte dieser.
»Wohlan! Im Zwischendeck habe ich beinahe siebzig Mann, die sich ausruhen konnten, während Ihre Mannschaft damit beschäftigt war, ihnen das Leben zu retten, auch wenn sie dabei nicht zuletzt das eigene Leben zu retten trachtete. Nun sind meine Leute an der Reihe zu arbeiten, und Ihre Leute sollen sich ausruhen. Überlassen Sie mir meine Matrosen für vier Stunden: Und nach diesen vier Stunden wird es im Schiffsrumpf keinen Tropfen Wasser mehr geben, denn meine Männer werden in dieser Zeit für Ihre Mannschaft getan haben, was Ihre Mannschaft in den vergangenen zwei Tagen für sie getan hat.«
Infolge des Gerüchts, René sei der Schütze, der Nelson getötet hatte, und durch sein Betragen während des Sturms genoss René in den Augen der englischen Matrosen kein geringes Ansehen; wer Nelson getötet hatte, der seit vierzig Jahren gegen Frankreich, gegen den Sturm und manchmal sogar gegen Gott gekämpft hatte, der musste mehr als ein gewöhnlicher Mensch sein.
Der Kapitän nutzte eine Windstille, versammelte seine Leute an Deck und sagte: »Meine Freunde, ich habe eine schlechte Nachricht zu verkünden, denn wir haben vier bis fünf Fuß Wasser im Schiff; wenn Sie das Wasser weiter steigen lassen, wird unser Schiff vor dem nächsten Morgen sinken, wenn Sie aber zu pumpen beginnen, haben wir noch eine Chance, dieser neuen Gefahr zu entrinnen, der größten Gefahr, die uns bisher begegnet ist.«
Es kam, wie Kapitän Parker vorausgesagt hatte: Über die Hälfte der Mannschaft legte sich auf Deck und sagte, sie wolle lieber ertrinken, als sich der Mühsal des Pumpens zu unterziehen. Die andere Hälfte der Mannschaft schwieg, doch es fiel dem Kapitän nicht schwer zu sehen, dass diese Männer sich am widerspenstigsten zeigen würden, wenn er seinen Vorschlag wiederholte.
»Liebe Männer«, sagte der Kapitän, »ich weiß, wie erschöpft ihr seid und wie überaus verhasst euch diese Arbeit ist. Hier ist Leutnant René, der euch zum Dank für die Rücksicht, die ihr ihm und seinen Männern während der Fahrt entgegengebracht habt, einen Vorschlag machen will.«
Der alte Untersteuermann nahm als Erster seine Mütze ab und schwenkte sie. »Leutnant René«, sagte er, »ist ein vollendeter Seemann und tapfer wie kein zweiter! Hören wir seinen Vorschlag an!«
Und mitten in dem Sturm, auf den niemand mehr zu achten schien, rief die ganze Mannschaft wie aus einer Kehle: »Hören wir an, was Leutnant René zu sagen hat, und hurra für Leutnant René!«
René salutierte, Tränen in den Augen, und zum größten Erstaunen der ganzen Mannschaft, die ihn noch nie ein Wort auf Englisch hatte sprechen hören, sagte er so akzentfrei, als käme er geradewegs aus Suffolk herbeispaziert: »Danke! Im Gefecht sind wir Gegner, nach dem Gefecht sind wir Rivalen, doch in der Gefahr sind wir Brüder.«
Diese Worte wurden mit allseitigem Beifall aufgenommen.
»Dies ist mein Vorschlag: An Bord gibt es neunundsiebzig Gefangene, die sich zwei Tage lang ausruhen konnten, während ihr für sie gearbeitet habt; selbst wenn euer Einsatz nicht völlig selbstlos war und selbst wenn ihr während des Sturms keinen Gedanken an diese Leute verschwendet habt, bitten sie euch mit meiner Stimme, nun für euch arbeiten zu dürfen.«
Die englischen Matrosen lauschten, verstanden aber noch nicht, was er sagen wollte.
»Gebt ihnen für vier Stunden die Freiheit; in dieser Zeit werden sie für euch pumpen; innerhalb von vier Stunden wird das Schiff gerettet werden, ihr werdet alle brüderlich ein Glas Gin miteinander leeren, und jeder von ihnen wird sich wieder an seinen Posten als Gefangener begeben und sich glücklich schätzen, dass beide Seiten einander dankbar in Erinnerung behalten werden. Ich bürge mit meinem Ehrenwort für meine Männer.«
Die Engländer waren sprachlos vor Verblüffung. Ein solcher Vorschlag wäre keinem von ihnen jemals in den Sinn gekommen. Der Vorschlag, den die Gefangenen machten, ihren Gegnern das Schiff zu retten, war so großherzig, dass es eine Weile dauerte, bis sie ihn erfassten.
Doch Kommandant Parker, der mit etwas Ähnlichem gerechnet hatte, umarmte René und rief: »Meine lieben Freunde, Leutnant René übernimmt die Verantwortung für seine Männer, und ich verbürge mich für ihn.«
Daraufhin brach ein Tumult auf dem Schiff aus, der mit Worten nicht wiederzugeben ist; doch unterdessen hatte der Kapitän dem ersten Leutnant leise einen Befehl erteilt, und plötzlich sah man aus einer Luke eine erste Abteilung von zwölf Gefangenen heraufsteigen, die sich wunderten, zu solcher Stunde und bei solchem Wetter an Deck geholt zu werden; doch auf diesem Deck, das der Sturm so abgeholzt hatte, wie das Deck ihrer Redoutable im Gefecht abgeholzt worden war, erblickten sie ihren Leutnant, der lächelte und ihnen die Hände entgegenstreckte.
»Meine lieben Freunde«, sagte René, »ihr seht hier die wackeren Burschen, die seit zwei Tagen dem Sturm die Stirn geboten haben; ihr musstet den Sturm nicht erleben, um zu wissen, wie heftig er getobt hat; sie sind jetzt in Sicherheit, aber todmüde. Und im Schiffsrumpf steht das Wasser fünf Fuß hoch.«
»Stellt uns an die Pumpen«, sagte der Bootsmann der Redoutable, »und in drei Stunden wird davon nichts mehr zu sehen sein.«
René wiederholte die Worte des Bootsmanns auf Englisch; Kapitän Parker hatte mittlerweile ein Fässchen Gin holen lassen.
»Nun, meine Freunde«, sagte René zu den Engländern, »seid ihr einverstanden?«
Ein einhelliger Ruf war die Antwort. »Ja, Leutnant! Ja, wir sind einverstanden!«
Und die Männer, die einander wenige Tage zuvor erbarmungslos den letzten Blutstropfen aus dem Leib geschossen hätten, fielen einander nun, von Brüderlichkeit bewegt, in die Arme.
»Sagen Sie Ihren Leuten, dass sie sich ausruhen können«, soufflierte René Kapitän Parker. »Und tun Sie es ihnen gleich; sagen Sie mir nur, wo Sie anlegen wollen, und ich kümmere mich die nächsten vier Stunden lang um alles, sogar um das Steuern des Schiffs.«
»Wir müssten uns auf der Höhe des St.-George-Kanals befinden, und Wind und Dünung führen uns zu dem Hafen von Cork; lassen Sie einen Reservemast aufstellen, setzen Sie irgendein Segel und navigieren Sie zwischen dem zehnten und dem zwölften Längengrad Cork entgegen. Ein Glas Gin, meine Freunde«, fuhr der Kapitän fort und stieß mit René an, um mit gutem Beispiel voranzugehen.
Nach vier Stunden befand sich kein Tropfen Wasser mehr im Schiffsrumpf, die Engländer waren wieder Herr über ihr Schiff, und am nächsten Tag gingen die Überreste der Samson am Ende der Bucht und zwei Kabellängen von dem Städtchen Cork entfernt vor Anker.
95
Die Flucht
Am nächsten Tag wurde man sich dessen gewahr, dass man die französischen Gefangenen nicht auf dem Schiff lassen konnte, obwohl es so entmastet war wie eine Hulk.
Es wäre allzu leicht gewesen, ins Wasser zu springen und an Land zu schwimmen. Und waren die Gefangenen erst an Land, konnten sie auf die Zuneigung der Iren oder auf deren Abneigung gegen England vertrauen. Es war nicht damit zu rechnen, dass ein Ire jemals einen entflohenen Gefangenen französischer Nationalität verraten würde.
Schon immer hatte es dieses unausgesprochene Einverständnis zwischen den zwei Nationen gegeben. Deshalb beschloss man, die Gefangenen im Gefängnis der Stadt unterzubringen.
Als sie das Schiff verließen, trat einer der Gefangenen zu René und sagte mit einem Akzent, der keinen Zweifel an seiner irischen Herkunft ließ: »Nehmen Sie mich zum Zellengenossen, Sie werden es nicht bereuen.«
René sah den Mann an; er hatte ein offenes und ehrliches Gesicht; und als René gefragt wurde, wen er mit sich nehmen wolle, deutete er auf ihn und ließ die Übrigen sich selbst melden. Jede Zelle wurde mit acht Männern belegt.
René hütete sich, um irgendeinen Gefallen zu bitten, denn damit hätte er sich seinen Kameraden gegenüber hochnäsig gezeigt und ihnen unnötiges und unverdientes Misstrauen eingeflößt. Der Ire, der ihn gebeten hatte, in seine Zelle aufgenommen zu werden, hatte diese Bitte allem Anschein nach nur ausgesprochen, um sich ihm nützlich zu zeigen.
René wusste sehr wohl, dass ihr Weg sie von Cork unfehlbar auf die Hulken von Portsmouth führen würde, und er wusste auch, welche Schreckensorte diese abscheulichen Gefängnisschiffe waren. Doch er suchte nicht verzweifelt nach Lösungen, sondern dachte sich, dass sie sich von allein anbieten würden, und darin täuschte er sich nicht.
Kaum hatte man sie in das Gefängnis gesperrt, das in Renés Fall ein Zimmer im Erdgeschoss war, aus dem man durch ein vergittertes Fenster in einen Hof blickte, den sechzehn Fuß hohe Mauern umschlossen und in dem Tag und Nacht zwei Wachen postiert waren, trat der Ire zu René, nachdem er den Hof vom Fenster aus begutachtet hatte, und sagte zu ihm leise auf Englisch: »Wir müssen also von hier fliehen, wenn wir nicht auf die englischen Hulken verbracht werden wollen?«
»Ja«, erwiderte René, »und wir müssen es schnellstens bewerkstelligen; Geld habe ich, und wenn Geld von irgendeinem Nutzen ist, stelle ich es für meine wackeren Kameraden zur Verfügung.«
»Geld ist eine gute Sache«, sagte der Ire, »aber es gibt noch etwas Besseres.« Und er zeigte René acht Segelmacherahlen, die in acht Stuhlbeinen versteckt waren.
»Als ich sah«, sagte der Ire, »dass man uns gefangen nehmen würde, dachte ich an die Zukunft und sagte mir: ›Kein Gefängnis kann einen zurückhalten, wenn man Mut und Kraft genug hat‹, und da habe ich eine Schachtel Ahlen entwendet, acht Stuhlbeine ausgehöhlt, mir beim Schlosser eine Feile ausgeliehen, und das ist das Ergebnis.«
»Sehr gut«, sagte René, »ich sehe acht Dolche, ich sehe eine Feile, um unsere Gitterstäbe zu bezwingen, aber was ich nicht sehe, ist eine Strickleiter, um die Mauer zu überwinden.«
»Als Ire kenne ich mein Land und meine Landsleute. Unser Schiff liegt für mindestens sechs Wochen fest, bevor es wieder seetüchtig sein wird; das irische Klima wird uns früher oder später eine Nacht bescheren, in der keine englische Schildwache freiwillig draußen zum Eisblock gefriert, wenn sie nur die Tür zur warmen Stube zu öffnen braucht, wo sie die Nacht am Ofen verbringen kann. Was meine Landsleute betrifft, so bedeutet das Wort Franzose in ihren Ohren Befreier, Freund, Bruder, Verbündeter; seitens meiner Landsleute haben Sie nicht nur nichts zu befürchten, sondern sogar alles zu hoffen; Sie sagen, dass Sie Geld besitzen; das ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber niemals schaden; wir werden einen braven Burschen finden, vielleicht sogar den Gefängniswärter höchstpersönlich, der uns von der anderen Seite der Mauer aus eine Strickleiter zuwerfen wird; Sie müssen nichts weiter tun als abwarten und bereit sein. Überlassen Sie mir den Gefängniswärter, und ich kann Ihnen versichern, es wird keine acht Tage dauern, bis wir uns in Freiheit befinden, was nicht heißen soll: in Sicherheit, aber von der Freiheit bis zur Sicherheit wird es nicht mehr weit sein. Da man uns miteinander konspirieren gesehen hat, könnten Einzelne meiner Kameraden Verdacht schöpfen; sagen Sie ihnen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, worum es sich handelt, aber auch, dass sie den Mund halten und die Hoffnung nicht aufgeben sollen.«
In wenigen Worten erfüllte René die Bitte des Iren.
Daraufhin wurde die Tür geöffnet, und der Gefängniswärter erschien.
»So, so«, sagte er, »sehen wir einmal, wie viele ihr seid.«
Und er begann zu zählen. »Acht, das heißt, ich werde acht Matratzen brauchen, denn ich will euch schließlich nicht auf dem nackten Stroh schlafen lassen; wärt ihr Engländer oder Schotten, dann wäre es etwas anderes...«
»Gut gesprochen, Vater Donald!«, sagte der Ire.
Der Gefängniswärter zuckte zusammen; sein Name war in unverfälschtem Irisch ausgesprochen worden.
»Er hat nicht vergessen«, sagte der Ire, »dass er im fünfundvierzigsten Grad mit dem tapferen General MacDonald verwandt ist, unter dessen Befehl ich in Neapel und in Kalabrien gedient habe.«
»So, so«, sagte der Gefängniswärter, »bist du etwa auch Ire?«
»Das will ich wohl meinen, und zwar aus Youghal, keine zehn Meilen entfernt. Unser Vater Donald hat wohl vergessen, dass ich als Kind, was allerdings lange her ist, mehr als zwanzig Jahre, mit seinen zwei Söhnen James und Tom gespielt habe, zwei wackeren kleinen Kerlen. Was ist aus ihnen geworden, Vater Donald?«
Der Gefängniswärter fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen und sagte: »Sie wurden von den Engländern zwangsverpflichtet; James ist desertiert und wurde füsiliert; Tom fiel bei der Schlacht von Abukir, der arme Junge.«
Der Ire sah René an und bedeutete ihm mit seinem Blick, dass die Sache weniger schwierig sein würde, als sie gedacht hatten.
»Verwünschte Engländer!«, sagte er laut. »Wann werden wir uns ihrer endlich entledigen?«
»Wenn es so weit wäre«, sagte Donald mit gereckter Faust, »müsste man nicht lange nach mir rufen.«
»Sie sind katholisch?«, fragte René.
Als Antwort bekreuzigte sich der Gefängniswärter.
René trat zu ihm, nahm eine Handvoll Gold aus seiner Tasche, legte sie ihm in die Hand und sagte: »Nehmen Sie dies, mein Freund, um Messen für den Seelenfrieden Ihrer Kinder lesen zu lassen.«
»Sie sind Engländer«, sagte der Gefängniswärter, »und von Engländern nehme ich nichts.«
»Ich bin Franzose, mein wackerer Freund, ein guter Franzose, wie dein Landsmann dir bestätigen kann; und falls es auch im Jenseits Seelenmessen geben sollte, dann habe ich genug Engländer als Chorknaben für die Priester dieser Messen dorthin expediert.«
»Ist das wahr?«, fragte der Gefängniswärter seinen Landsmann.
»So wahr wie die Heilige Dreifaltigkeit«, erwiderte dieser.
Der Gefängniswärter drehte sich um und reichte René seine Hand; René drückte sie.
»Bist du jetzt einverstanden?«, fragte er.
»Alles, was Sie wünschen, mein Herr, solange Sie kein Engländer sind.«
»Das wäre also geregelt«, sagte der Ire. »Wir sind alle Freunde und sogar gute Freunde und werden einander als Kameraden nicht darben lassen. Brot und Bier nach Herzenslust und Feuer, damit wir nicht frieren müssen.«
»Und Fleisch zu allen Mahlzeiten«, fügte René hinzu, »so sieht unsere erste Woche aus.«
Und er gab dem Gefängniswächter fünf Louisdors.
»Oho«, sagte der Gefängniswächter, »ist das ein Admiral?«
»Nein«, sagte der Ire, »aber reich ist er, er hat in Indien ein Vermögen gemacht und hat sich uns kurz vor der Schlacht zugesellt.«
»Von welcher Schlacht sprichst du?«, fragte der Wärter.
»Von der Schlacht von Trafalgar, in der Nelson gefallen ist.«
»Wie!«, rief der Gefängniswärter. »Nelson ist gefallen?«
»Ja, und wenn du unbedingst willst, können wir dir die Hand zeigen, die ihn getötet hat.«
»Für heute habe ich genug, danke, lass uns morgen weiterreden.«
»Adieu, Vater Donald, auf Brot und Bier nach Herzenslust und frisches Fleisch.«
Die Gefangenen hatten an ihrem Wärter nichts auszusetzen. Schon am ersten Abend sahen sie, mit welcher Gewisssenhaftigkeit Donald erfüllte, was er ihnen versprochen hatte; am selben Abend begegneten ihnen jedoch zwei Schildwachen in dem kärglichen Hof, auf den man aus dem vergitterten Fenster ihrer Zelle sah.
Es vergingen acht Tage, in denen kein Wort zwischen den Franzosen und Meister Donald gewechselt wurde. Doch der Gefängniswärter betrat den Kerker nie, ohne sich im Flüsterton mit seinem Landsmann zu unterhalten.
»Alles steht zum besten«, sagte dieser nach jeder Unterredung.
Es wurde zunehmend kälter. Bisweilen brachen so heftige Stürme herein, dass die wachhabenden Engländer sich das ganze Unwetter über in der Wachstube verkrochen; dann bearbeitete der Ire mit seiner Feile die Gitterstäbe vor dem Fenster, und das mittlere Gitter war unten bereits durchtrennt.
Das Wetter wurde noch abscheulicher.
»Geben Sie mir hundert Francs«, sagte der Ire eines Abends zu René.
René holte fünf Louisdors aus seiner Hosentasche und gab sie dem Iren. Dieser verschwand mit dem Gefängniswärter und kam eine Stunde später zurück.
»Beten wir zu Gott, dass heute Nacht so scheußliches Wetter herrscht, dass man keinen Hund vor die Tür jagen würde«, sagte der Ire, »denn dann werden wir frei sein.«
Das Abendessen wurde gebracht, üppiger als gewohnt, und jeder konnte Fleisch und Brot als Mahlzeit für den nächsten Tag einstecken. Gegen neun Uhr abends begann es zu schneien, im Verein mit einem Nordwind, der so scharf blies, als wollte er allen Ochsen die Hörner abrasieren. Um zehn Uhr konnten die Gefangenen die Wachen im Hof nicht mehr hören, doch das mochte an dem Schnee liegen, der als dicker Teppich den Boden bedeckte. Sie öffneten das Fenster und blickten vorsichtig hinaus. Offenbar wärmten die Engländer sich am Feuer in der Wachstube, statt draußen Wache zu stehen.
Der Ire holte einen Stein aus einer Ecke und warf ihn über die Mauer. Im nächsten Augenblick wurde von der anderen Seite ein Seil über die Mauer geschleudert und hing in der Luft.
»Nun denn«, sagte der Ire, »dann wollen wir die Gitterstange vollends durchfeilen.«
»Wozu Zeit verlieren?«, sagte René und ergriff die Stange mit beiden Händen; schon beim ersten Rütteln lockerte sich der Stein, in den die Stange gemauert war.
»Das genügt mir als Waffe«, sagte René, »mehr brauche ich nicht.«
Der Ire kroch als Erster durch die so entstandene Öffnung ins Freie und erkundete den Hof; weit und breit war keinerlei Wache zu sehen; er verknotete das Seil an einem Haken in der Mauer, und das Seil spannte sich, was anzeigte, dass auf der anderen Seite jemand stand und es festhielt; dann klemmte sich der Ire sein Stuhlbein mit der Segelmacherahle zwischen die Zähne, kletterte gemächlich auf die Mauer und sprang auf der anderen Seite hinunter.
Die anderen folgten nacheinander, ohne gestört zu werden, und als der Letzte in Sicherheit war, warfen sie das Seil in den Hof.
Es war eine jener pechfinsteren nördlichen Nächte, in denen man die Hand nicht vor Augen sieht; in der Gewissheit, dass niemand sie verfolgte, bat der Ire um einen Augenblick, um sich zurechtzufinden, und lauschte angestrengt. »Dort drüben ist das Meer«, sagte er und deutete nach Osten, »besser gesagt nicht das offene Meer, dafür ist es zu leise, sondern der St.-George-Kanal; in diese Richtung wird man uns verfolgen, falls man uns verfolgt, und deshalb müssen wir uns in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Wir gehen nach Norden, bis wir Limerick erreichen; ich kenne mich in der Gegend aus und kann mich dafür verbürgen, dass wir uns nicht verirren werden; wenn wir aber einen Kompass hätten, wäre das nicht von Nachteil.«
»Bitte sehr«, sagte René und holte einen kleinen Kompass hervor, den er immer bei sich trug und der ihm in Indien schon viele gute Dienste geleistet hatte.
»Ha«, sagte der Ire, »vortrefflich! Machen wir uns auf den Weg.«
Sie mussten aus Cork hinausgelangen; glücklicherweise ist die Stadt nicht befestigt, doch eine Garnison gab es. Die Entflohenen hatten kaum hundert Schritte getan, als sie die regelmäßigen Schritte einer englischen Patrouille hörten.
Der Ire gebot Schweigen und führte sein Trüppchen ebenso regelmäßigen, wenn auch leiseren Schritts rückwärts, bis die acht Flüchtigen sich in einer Toreinfahrt in einem Gässchen verbergen konnten.
Die Patrouille marschierte so nahe an ihnen vorbei, dass sie sie mit ausgestrecktem Arm hätten berühren können, und alle hielten den Atem an. Einer der Engländer brummte: »Der Hauptmann hätte uns in der Wachstube in Ruhe lassen sollen. Selbst ein Franzose müsste den Teufel im Leib haben, wenn es ihn bei so einem Wetter nach einem Fluchtversuch gelüsten sollte.«
Das Geräusch ihrer Schritte verklang, und die Flüchtlinge verließen ihr Versteck und stahlen sich in die entgegengesetzte Richtung davon; zehn Minuten später hatten sie die Stadt Cork verlassen und spürten am Körper den scharfen Nordwind, den Hamlet auf der Terrasse von Helsingör beklagt.
Das Trüppchen machte abermals kurz halt.
»Folgt mir«, sagte der Ire, »wir befinden uns auf dem Weg nach Blarney; falls ihr dort übernachten wollt, habe ich dort Freunde, doch mir scheint es klüger zu sein, der Straße bis Mallow zu folgen, denn es ist niemand auf ihr unterwegs, und wir kommen an keinem bewohnten Haus vorbei.«
»Und kennst du jemanden in Mallow?«, fragte René.
»In Mallow kommen zehn Freunde auf jeden Einzelnen von uns.«
»Dann auf nach Mallow«, sagte René. »Das verschafft uns immerhin einen Tag Vorsprung vor denjenigen, die uns morgen früh nachsetzen werden.«
Gegen sechs Uhr morgens, eine halbe Stunde vor Tagesanbruch, erreichten sie Mallow; der Ire marschierte schnurstracks auf ein Haus zu, klopfte an die Tür, und auf die Frage: »Wer da?«, die aus einem Fenster im ersten Stock ertönte, antwortete er mit der Frage: »Wohnt hier Farrill?«
»Gewiss«, erwiderte die Stimme, »ich selbst bin es, und wer bist du?«
»Ich bin Sullivan.«
»Warte, warte, ich komme dir öffnen.«
Die Tür wurde geöffnet, und die zwei Männer umarmten einander.
Farrill bat seinen Freund einzutreten, denn dessen Gefährten standen so dicht an der Mauer, dass er sie nicht sehen konnte, und dieser sagte: »Ich bin nicht allein gekommen, sondern mit Kameraden, für die ich Gastfreundschaft bis heute Nacht erbitten muss.«
»Und wenn ihr zu zehnt wärt oder von mir aus zu hundert, sie wird euch gewährt werden – nicht so, wie Farrill sie euch angedeihen lassen wollte, sondern so, wie seine Mittel es ihm ermöglichen. Tretet ein, wer ihr auch sein mögt.«
Die Entflohenen kamen näher.
»Mein Herr«, sagte René, »wir sind französische Gefangene, die gestern Abend aus dem Gefängnis von Cork geflohen sind. Unser Kamerad Sullivan hat sein Wort für Sie verpfändet, und wir vertrauen Ihnen und geben unser Leben in Ihre Hand.«
Die Tür stand offen; Farrill machte ein Zeichen, alle traten unauffällig ein, und die Tür wurde geschlossen.
Sullivan hatte René darauf aufmerksam gemacht, dass er Farrill für seine Gastfreundschaft nichts anbieten dürfe, da jedes Angebot eine Beleidigung bedeuten würde.
Die Entflohenen hatten zehneinhalb Meilen zurückgelegt; den Tag verbrachten sie damit, zu schlafen und zu essen, um sich zu erholen.
Obwohl Farrill sichtlich alles andere als wohlhabend war, bewirtete er seine Gäste so entgegenkommend, wie er versprochen hatte, herzlich und ausreichend, wenn schon nicht opulent und prachtvoll.
Im Haushalt gab es noch Mehl und ein paar Flaschen Dubliner Bier, die zu diesem Anlass geleert wurden. Gegen sieben Uhr abends machten die Flüchtlinge sich auf den Weg. Diesmal mussten sie nachts den Weg nach Bruree zurücklegen, das heißt sieben Meilen. Das Schuhwerk zweier Flüchtlinge war in schlechtem Zustand, doch Farrill, der tagsüber ihre alten Galoschen anprobiert hatte, war es gelungen, zwei Paar neue Schuhe zu erwerben, so dass dem Marsch in dieser Hinsicht nichts entgegenstand.
Gegen fünf Uhr morgens kamen sie in Bruree an.
Sullivan hatte Sorge getragen, auf dem rechten Ufer des Flüsschens Maigue zu gehen, an dem das Dorf liegt. In der Ortschaft hatte er einen Bekannten, der nicht weniger gastfrei war als der wackere Farrill; alles verlief in etwa ähnlich wie beim ersten Mal, die Flüchtlinge tranken, aßen und schliefen nach Herzenslust und brachen noch in derselben Nacht nach Askeaton auf: Diesmal jedoch hatte Sullivans Freund sich als Führer angeboten, da der Weg durch eine Gegend führte, die schwieriger zu durchqueren war und in der Sullivan sich nicht auskannte, wie er hatte einräumen müssen.
Unter Dankesbezeigungen in seinem Namen und in dem seiner Freunde hatte er daher das Angebot seines Freundes angenommen, und von ihm geführt, erreichten sie Askeaton.
Bei dem Zauberwort: »Es sind Franzosen!« öffneten sich Arme und Türen, und sogar die Hausdrachen lächelten, obwohl die damit verbundenen zusätzlichen Kosten in einem so armen Land wie Irland alles andere als erfreulich sein mussten.
Diesmal hatte ihr Führer sie zu seinem Schwager gebracht.
Es gab daher nicht viel zu bereden, obwohl der Weg des nächsten Tages besprochen werden musste. René hatte angeboten, eine Barke zu kaufen, sie mit den notwendigen Lebensmitteln zu beladen und mit ihr nach Frankreich zurückzufahren, aber Sullivan hatte bei diesem Vorschlag den Kopf geschüttelt, denn den Bewohnern der Hafenstädte, die auf den Handel mit den Engländern angewiesen waren, vertraute er weniger als denen aus dem Landesinneren. Er vertrat deshalb den Vorschlag, eine Barke zu kapern und sie zu benutzen, egal, in welchem Zustand sie sich befand; landen konnte man notfalls jederzeit, um Vorräte einzukaufen; zudem hatte man gesehen, dass englische Soldaten den Flüchtlingen überall hinterherjagten, und an der ganzen Küste hatte sich das Gerücht verbreitet, dass acht französische Gefangene aus dem Gefängnis von Cork entwichen waren.
Man begnügte sich daher damit, in der Nacht nur vier Meilen zu marschieren und in Loghill zu nächtigen; dort erkundigte man sich nach den Schiffen, die in der Mündung des Shannon ankerten.
In Foynes gab es eine Slup, doch sie ankerte zu tief im Landesinneren; der Führer unserer Flüchtlinge riet ihnen, sich lieber eines der Schiffe zu bemächtigen, die zwischen Tarbert und der kleinen Insel gegenüber lagen.
Man vereinbarte, zwischen drei und vier Uhr morgens zu handeln. Und gegen sieben Uhr abends nahmen sie mit typisch irischer Sorglosigkeit von einem Boot Besitz, das am Flussufer lag, fuhren damit zu einem Kutter und kaperten ihn. Der Kutter war von drei Männern und einer Frau bemannt, die zu schreien begannen, als sie ihre Angreifer erblickten.
Sullivan machte ihnen jedoch in ausgezeichnetem Irisch deutlich, dass sie gut daran täten, den Mund zu halten, weil er und seine Gefährten sich sonst genötigt sähen, sie zum Schweigen zu bringen, und da er ihnen seine Segelmacherahle zeigte, um seine Worte zu unterstreichen, hielten die armen Teufel den Mund.
Im Handumdrehen war der Anker gelichtet und das Segel gesetzt, und da Nordwind herrschte, fuhr der Kutter so majestätisch auf den Atlantik hinaus wie ein ausgewachsenes Kriegsschiff.
Nach einer Seemeile ließ man die vier Iren das Boot besteigen, von dem aus man den Kutter gekapert hatte; René gab ihnen zwanzig Louisdor und versprach ihnen, falls er wohlbehalten Frankreich erreichen werde, einem Bankier in Dublin das Doppelte des Betrags, den ihr Schiff wert war, anweisen zu lassen.
Die guten Leute hielten dies für nichts weiter als große Worte, doch da er ihnen aus freien Stücken zwanzig Louisdor gegeben hatte, waren sie bereit, ihm zu glauben; die Strömung führte sie bald munter dem Fluss Shannon entgegen, und sie hatten ihren Ankerplatz wieder erreicht, bevor sie sich im Klaren waren, ob das, was sie erlebt hatten, Wirklichkeit oder ein Hirngespinst war.
96
Auf See
Sobald die Flüchtlinge über den Kutter verfügen konnten, war es ihre erste Sorge, ihn genau zu untersuchen, um sich seiner Ausstattung zu vergewissern. Er war mit Torf beladen und führte daneben nichts mit als hundert Erdäpfel, acht Kohlköpfe, zwei Fässchen Butter und zehn bis zwölf Wasserflaschen sowie ein völlig zerfetztes Großsegel, einen kaum besseren Klüver und ein noch übleres Vorstagsegel.
Unter Wahrung größter Sparsamkeit hatte man für allerhöchstens sechs Tage Lebensmittel an Bord; Brot gab es keines, weder an Bord noch im Haus der ursprünglichen Schiffseigner, denn das war und ist die Regel in Irland.
»Nun gut«, sagte René, »ich glaube, wir täten gut daran, uns sofort auf Diät zu setzen; gestern haben wir üppig zu Abend gespeist, heute Morgen haben wir gut gefrühstückt, und vor dem heutigen Abend müssen wir nichts zu uns nehmen.«
»Hmm, hmm«, ließen sich vereinzelte Stimmen vernehmen.
»Nichts da«, sagte René, »reißt euch zusammen, und über eine Sache wollen wir uns im Klaren sein: Keiner von uns wird vor acht Uhr abends Hunger haben.«
»Einverstanden«, sagte der Ire, »keiner von uns wird vor acht Uhr Hunger haben; und wer dennoch Hunger hat, wird sich den Bauch halten oder ein Schläfchen machen; wer schläft, kann vom Essen träumen.«
»Hoppla!«, sagte ein Matrose. »Finden Sie nicht, dass es im Augenblick am dringlichsten wäre, Feuer zu machen?«
»Ha«, sagte Sullivan, »an Torf wird es uns dafür jedenfalls nicht mangeln; die Sonne hat sich verkrochen und will offenbar nicht wiederkommen, es schneit unentwegt, was uns Wasser verschaffen wird, sofern wir den Schnee auffangen können, doch warum sollten wir uns nicht ein bisschen aufwärmen?«
Ein Kohlenbecken wurde angezündet, das man Tag und Nacht unterhielt.
Die Nachtkälte ist im Januar und im Februar an der englischen Küste und im Ärmelkanal geradezu unerträglich, und in diesem Fall ging es nicht nur um die Kälte, sondern auch um die Orientierung für die Navigation. Einen Kompass gab es, doch er war alt und verrostet, so dass man auf gröbste Fehlanzeigen gefaßt sein musste. Vergebens hatte man nach einem Log gesucht, um den zurückgelegten Weg zu messen; keine Instrumente halfen erkennen, mit welchem Wind man gefahren war oder fahren sollte, kein Öl und keine Kerzen erhellten das Kompasshäuschen; man wusste nur, dass es zuerst nach Süden und dann nach Osten zu segeln galt, doch dafür besaß man nur Renés kleinen Taschenkompass und kein anderes Licht als das des anfangs so verachteten Torfs.
René wurde als Kundigster von ihnen und als derjenige, dessen Mut man am meisten vertraute, einstimmig zum Kapitän gewählt.
Das Meer war stürmisch, der Wind wehte heftig und unberechenbar, und die Segel des Kutters waren zu Fetzen zerrissen; René befahl, alles Segeltuch, das man finden konnte, zusammenzutragen. Sullivan entdeckte eine Truhe, in der sich Segeltuch in recht gutem Zustand nebst einer Kerze befand, die dazu verwendet wurde, den Matrosen zu leuchten, während sie ein großes Segel zusammennähten.
Um acht Uhr abends war an alle die Ration aus zwei Kartoffeln, zwei Kohlblättern, etwas Butter und einem Glas Wasser ausgeteilt worden.
Da man nicht genug Segeltuch besaß, wurde beschlossen, auf das Vorstagsegel zu verzichten und das Segeltuch für das Großsegel zu verwenden; diese Umstellung brachte einen Zeitverlust von fünf Tagen mit sich. Sobald das Großsegel installiert war, fuhr man schneller und sicherer.
Die Kerze hatte man durch Kienspäne ersetzt, die mit Torf am Brennen gehalten wurden. Über den Kurs machte man sich keine Sorgen, denn mit Renés Taschenkompass konnte man ihn jederzeit korrigieren. Wenngleich die Flüchtlinge sich nicht gerade begeistert über die Verköstigung gezeigt hatten, sah man am vierten Tag, dass ihnen noch Nahrung für zwei bis drei Tage verblieb. Am Wasser hatte man gespart, so gut es ging, doch es war zum Kochen des Kohls benötigt worden, während die Kartoffeln im heißen Torf gebacken wurden.
Am fünften Tag sah man ein Schiff am Horizont. René rief seine Gefährten und zeigte ihnen das Schiff.
»Es ist ein Engländer oder das Schiff eines verbündeten Landes; wenn es englisch ist, kapern wir es; wenn es einer befreundeten Nation angehört, bitten wir um Hilfe, die man uns gewähren wird, so dass wir weiterfahren können. Die Standard, die wir mit der Revenant gekapert haben, hatte vierhundertfünfzig Mann Besatzung, und wir hatten nur hundertzwanzig Mann an Bord, sie hatte achtundvierzig Kanonen, und wir hatten nur sechzehn, und ausgehungert waren wir auch nicht. In den Wind, Ire, und auf ins Gefecht.«
Jeder nahm seine Segelmacherahle, und René ergriff seinen Gitterstab, doch das verbündete oder gegnerische Schiff, Kauffahrer oder Kriegsschiff, ergriff die Flucht vor dem Kutter, der auf eine weitere Verfolgung verzichten musste.
»Kann mir niemand einen Tropfen Wasser abgeben?«, fragte ein Matrose in jämmerlichem Ton.
»Gewiss doch, mein wackerer Junge«, sagte René.
»Und Sie?«, fragte ihn der Matrose.
»Ich«, sagte René mit einem Lächeln, um das ihn die Engel beneidet hätten, »ich bin nicht durstig.«
Und er gab dem Matrosen seine Wasserration.
Es wurde Abend, und die letzte Ration wurde ausgeteilt, die aus einer Kartoffel, einem Kohlblatt und einem halben Glas Wasser pro Mann bestand.
Seit Langem ist bekannt, dass die schlimmste aller Qualen notleidender Schiffsbesatzungen der Durst ist: Der Durst macht uns sogar dem engsten Freund gegenüber unbarmherzig.
Am Tag nach der letzten Ration hatte die Not unsere Flüchtlinge zu Rasenden gemacht; jeder hatte sich von den anderen abgesetzt, und alle Mienen waren bleich und abgezehrt. Unvermittelt ertönte ein Schrei, und einer der Matrosen sprang in seinem Fieberwahn ins Wasser.
»Aufbrassen und Rettungstaue auswerfen!«, rief René, der dem Matrosen hinterher ins Meer sprang.
Zwei Sekunden später kam René an die Wasseroberfläche zurück; er hielt den Matrosen im Arm und wehrte sich gegen dessen wilde Schläge. Er ergriff ein Tau, schlang es dem anderen um den Körper und verknotete es.
»Zieht jetzt!«, rief er.
Die anderen zogen den Matrosen an Bord.
»Und jetzt mich«, sagte René.
Mehrere Taue waren ihm zugeworfen worden, und er ergriff eines und war im nächsten Augenblick wieder an Bord des Kutters.
Renés zierlicher und zarter Körper schien als Einziger weder unter dem Hunger noch unter dem Durst zu leiden.
»Ach,«, sagte der Ire, »hätte ich doch nur etwas Blei zum Lutschen!«
»Meinst du, dass man mit Gold die gleiche Wirkung erreichen kann?«, fragte ihn René.
»Das weiß ich nicht«, sagte der Ire, »denn bisher war ich mit Blei vertrauter als mit Gold.«
»Lass uns sehen: Nimm dieses Goldstück in den Mund.« Der Ire sah die Münze an, ein Goldstück im Wert von vierundzwanzig Francs mit dem Bildnis Ludwigs XVI.
Seine Gefährten standen mit offenem Mund und ausgestreckten Armen da.
»Oh, das schmeckt gut, das kühlt«, sagte der Ire.
»Haben Sie gehört, Monsieur René?«, sagten die anderen und hechelten vor Gier.
»Hier«, sagte René, der die Goldstücke verteilte, »probiert selbst.«
»Und Sie?«, fragten sie.
»Ach, mein Durst ist nicht so unerträglich, ich werde mir dieses Mittel als letzten Ausweg aufsparen.«
Und wahrhaftig war diese eigentümliche Art der Erfrischung, welche die Matrosen sich für gewöhnlich mit einem Stück Blei im Mund verschaffen, mit einem Goldstück genauso wirksam. Sie beklagten sich zwar den ganzen Tag über, lutschten und kauten jedoch dabei ihre Louisdors.
Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch lichtete sich der Himmel im Süden. René, der die Nacht am Steurruder verbracht hatte, stellte sich auf die Zehenspitzen, und dann rief er unvermittelt: »Land!«
Dieser Ruf wirkte wie ein Zauberwort: Auf der Stelle waren die sieben Matrosen auf den Beinen.
»Steuern Sie steuerbords«, rief einer von ihnen, »denn das da ist Guernsey. Die Engländer kreuzen sicherlich vor den französischen Inseln, setzen Sie deshalb Kurs nach Steuerbord.«
Eine Drehung des Steuerrads entfernte das Schiff von der Insel und ließ es Kurs auf Kap Tréguir nehmen.
»Land!«, rief René abermals.
»Ah«, sagte der Matrose, »das ist Kap Tréguir, das sehe ich, da haben wir nichts zu befürchten; segeln Sie jetzt so eng an der Küste wie möglich, und in zwei Stunden sind wir in Saint-Malo.«
Der Ire, der seinen Posten am Steuerruder wieder eingenommen hatte, befolgte die Anweisungen gewissenhaft, und eine Stunde später ließ er zur Rechten die Felsklippen von Grand-Bé liegen, einer Halbinsel, auf der sich heute Chateaubriands Grabmal erhebt, und fuhr mit vollen Segeln in den Hafen von Saint-Malo ein.
Die Bauweise des Kutters verriet dessen englische Herkunft, doch an der Kleidung der Besatzung erkannte man sogleich, dass es sich um Matrosen handelte, die englischen Hulken oder englischen Kerkern entflohen waren.
An der Mole hielt der stellvertretende Vorsteher der Marineakademie das Schiff an und kam in einer Kriegsschaluppe, um es zu rekognoszieren.
Das Rekognoszieren war schnell erledigt; René berichtete alle Einzelheiten ihrer Flucht, und der Marineschreiber protokollierte seine Aussage.
Nachdem das Protokoll abgefasst und von René und den vier anderen schreibkundigen Matrosen unterzeichnet war, erkundigte sich René, ob im Hafen ein amerikanisches Schiff mit Namen The Runner of New York unter dem Kommando eines Kapitäns François bekannt sei.
Das Schiff lag nahe der Werft vor Anker; es war vor kaum zwei Wochen eingetroffen.
René erklärte, dass es sein Eigentum sei, wiewohl augenblicklich auf den Namen des Maats von Robert Surcouf eingetragen, und fragte, ob ihm gestattet sei, sich an Bord dieses Schiffs zu begeben.
Man erwiderte ihm, er könne tun und lassen, was ihm beliebe, nachdem seine Identität festgestellt war.
Während das Protokoll aufgesetzt wurde, hatte die Verfassung der bejammernswerten Flüchtlinge Mitleid in dem stellvertretenden Vorsteher der Marineakademie geweckt, und nachdem einige von ihnen gemurmelt hatten, sie würden verschmachten, und ohnmächtig geworden waren, hatte er acht Tassen Kraftbrühe und eine Flasche guten Weins herbeordert und den Wundarzt der Akademie rufen lassen.
Der Arzt traf zusammen mit der Nahrung ein, die von den armen Flüchtlingen so sehr ersehnt wurde und die ihnen nur behutsam eingeflößt werden durfte.
Der Arzt bestand darauf, dass sie die Kraftbrühe Löffel für Löffel zu sich nahmen, ohne Brot einzutunken, und dass sie den Wein in kleinen Schlucken tranken.
Nach einer Viertelstunde wollten die Matrosen René die Louisdors zurückgeben, doch er weigerte sich, sie zu nehmen, und sagte zu den Männern, sie stünden in seinem Dienst, bis sie eine bessere Arbeit fänden.
Als Nächstes erklärte René, er und seine Gefährten hätten den Kutter, auf dem sie gekommen waren, mit Gewalt irischen armen Teufeln entwendet, und er bat darum, dass der Wert des Schiffs geschätzt würde, damit er es den Besitzern ersetzen konnte.
Dies war umso einfacher, als René in einer Art Wandschrank im Schiff das Schiffspatent gefunden hatte, das die Adresse des Schiffseigners enthielt.
Der Kutter blieb daher vor dem Hafen liegen, während René und seine Gefährten, die ihre Kräfte allmählich wiedererlangten, in eine Barke sprangen.
»Auf, meine Freunde, so schnell ihr könnt!«, rief René. »Bringt mich zur Runner of New York. Für die Ruderer gibt es zwei Louis.«
»Ha!«, sagte einer der Rudernden, der René wiedererkannte. »Das ist Monsieur René, der für all meine Kumpane auf Monsieur Surcoufs Revenant ihre Schulden bezahlt hat. Hurra für Monsieur René!«
Und angespornt von der Aussicht auf doppelte Belohnung, riefen alle Rudernden aus voller Kehle: »Hurra!«
Bei diesem Geschrei kam die Mannschaft der Runner of New York an Deck, und auf der Poop erkannte René seinen Freund François, der mit dem Fernglas in der Hand Ausschau nach ihm hielt.
Kaum hatte François gerufen: »Kameraden, es ist der Patron! Hurra für Monsieur René!«, wurde das Schiff im Handumdrehen beflaggt, und ohne die Erlaubnis des Hafenkommandanten abzuwarten, feuerte die Mannschaft einen Salut von acht Kanonenschüssen ab. Dann kletterten alle die Wanten empor, schwenkten ihre Mützen und riefen: »Hurra, Monsieur René, hurra!«
François wartete oben an der Strickleiter mit ausgebreiteten Armen auf seinen Kapitän, als wollte er am liebsten ins Meer springen, um ihn so bald wie möglich in die Arme zu schließen.
Man kann sich denken, mit welcher Begeisterung René an Bord willkommen geheißen wurde. Seine Ruderer bezahlte er, wie sie es sich erhofft hatten, und seine Reisegefährten berichteten unterdessen jedem, der es hören wollte, alle Einzelheiten ihrer Flucht: wie René auf seine Wasserration verzichtet hatte, um sie ihnen zu geben, wie er alle dazu gebracht hatte, den Mut nicht sinken zu lassen, und dass er sie nun angestellt hatte, so dass sie bei ihm bleiben konnten, bis sich etwas Besseres fand.
Und damit jeder mitfeiern konnte, der mit René zu tun gehabt hatte, kamen einige Matrosen zu ihm und fragten, ob sie ihre Rationen mit den Ruderern teilen durften, die ihn an Bord gebracht hatten.
»Freunde«, sagte René, »sie werden nicht eure Ration mit euch teilen, sondern an meinem Festmahl teilhaben. Der Tag meiner Rückkehr ist ein Festtag, und jeder Matrose an Bord meines Schiffs darf sich als Offizier fühlen an dem Tag, an dem ich aus Englands Gefängissen zurückkehre.«
Nachdem er abermals Erfrischungen an seine Fluchtgefährten hatte austeilen lassen, ließ er den Koch rufen, um ihm den Speisezettel für das Festmahl zu diktieren.
Alles, was es in Saint-Malo an Feinem und Köstlichem gab, war an diesem Tag für die Mannschaft der Runner of New York und für ihren Kapitän bestimmt.
97
Die Ratschläge Monsieur Fouchés
René war am 11. Januar 1806 in Saint-Malo angekommen, an dem Tag, an dem das Königreich Neapel eingenommen wurde und Masséna in Spoleto einmarschierte.
Während der glücklose Villeneuve die Seeschlacht von Trafalgar verlor, hatte der Kaiser den Rhein überschritten und die Kampagne eröffnet, in deren Verlauf er die Brücke von Donauwörth einnahm und sich den Übergang über die Donau erkämpfte. Und während er Ulm belagerte und sich anschickte, die Stadt einzunehmen, hatte Marschall Soult Memmingen eingenommen, und Marschall Ney hatte die Schlacht von Elchingen gewonnen, die ihm den Herzogtitel einbringen sollte.
Ulm hatte sich ergeben. General Mack und die dreißigtausend Soldaten der Garnison waren vor dem Kaiser vorbeigezogen und hatten ihre Waffen niedergelegt; dann war er in Augsburg eingezogen; den Triumphzug führten die kaiserliche Garde und die achtzig ersten Grenadiere an, deren jeder ein erobertes gegnerisches Banner trug. Zuletzt war er in Wien eingezogen, hatte die Schlacht von Austerlitz gewonnen, ein Waffenstillstandsabkommen mit dem österreichischen Kaiser geschlossen und die Russen so schnell aus den österreichischen Ländern verjagt, dass Junot, der einen Brief Kaiser Napoleons an Zar Alexander überbrachte, in dem Napoleon einen Friedensschluss vorschlug, die Russen gar nicht einholen konnte.
Vom 19. bis zum 29. Dezember des Vorjahrs hatte Napoleon sich in Schloss Schönbrunn aufgehalten, und von dort hatte er am 27. Dezember dekretieren lassen, dass die Dynastie der Könige von Neapel nicht mehr regierte.
Am 1. Januar 1806 hatte er den republikanischen Kalender aufgehoben. Wollte er damit gewisse Daten vergessen machen? Falls ja, hatte er sich verkalkuliert: Die Daten wurden nicht nur nicht vergessen, sondern auch nicht durch ihre gregorianische Bezeichnung im alten Kalender ersetzt. Man sagte einfach: Tag von Offenburg und 18. Brumaire.
All diese Neuigkeiten waren in Frankreich bekannt geworden und hatten eine Begeisterung ausgelöst, in der die Katastrophe von Trafalgar übertönt worden war. Zudem hatte Napoleon angeordnet, dass diese Katastrophe, die ihn mitten unter seinen Triumphen an der Kehle packte, so darzustellen sei, als wäre sie eher dem Sturm geschuldet als einem Sieg der englischen Flotte.
Von Trafalgar gab es daher nur die Nachrichten, die zu verbreiten den Zeitungen erlaubt war, und René war möglicherweise der erste Franzose, der von diesem Seegefecht in sein Heimatland zurückgekehrt war. Deshalb wurde er am Tag nach seiner Ankunft in Saint-Malo eingeladen, den Marinepräfekten zu besuchen, der ihn in der Einladung als Kapitän titulierte.
René beeilte sich, der Einladung Folge zu leisten.
Der Präfekt wollte selbstverständlich genauestens über die Katastrophe von Trafalgar ins Bild gesetzt werden.
René wusste nichts von irgendwelchen kaiserlichen Befehlen, Stillschweigen zu wahren.
Bevor der Präfekt ihn ausfragte, informierte er ihn von diesen Befehlen, doch er verhehlte nicht, wie sehr ihn die Wahrheit über den desaströsen Ausgang der Seeschlacht interessierte.
Da René von niemandem Schweigen auferlegt worden war, erzählte er dem Präfekten alles, was er mit eigenen Augen gesehen hatte, und stellte es diesem anheim, Diskretion zu wahren.
Zum Dank teilte der Präfekt ihm mit, dass Kommandant Lucas in London acht oder zehn Tage auf Parole gefangen gewesen war und durch ein Regierungsdekret die Freiheit erhalten hatte, das ihn für die vorbildliche Tapferkeit auszeichnen sollte, mit der er sein Schiff geführt hatte; dieses Dekret war vor allem in der Absicht erlassen worden, den Eindruck zu tilgen, Lucas werde aus niedrigen Beweggründen in englischer Haft behalten, weil die Kugel, die Nelson tötete, von seinem Schiff Redoutable aus abgefeuert worden war.
Lucas war also am Tag zuvor in Paris eingetroffen; der Marinepräfekt hatte dies auf telegraphischem Weg erfahren.
Auf Renés Bitte versprach ihm der Präfekt, in Erfahrung zu bringen, wo Lucas logierte, und es ihm mitzuteilen. Und da beide ihre Wissbegier befriedigt hatten, verabschiedeten sie sich mit größter Hochachtung voneinander.
Durch sein hochherziges Betragen war René in Saint-Malo mehr als berühmt geworden, doch die Bewunderung der Malouins kannte keine Grenzen mehr, als sie erfuhren, dass René, nachdem der von ihm und seinen Reisegefährten entführte Kutter auf einen Wert von eintausendeinhundert Francs geschätzt worden war, bei dem bedeutendsten Bankier der Stadt einen Wechsel über zweitausendfünfhundert Francs auf das Bankhaus O’Brien &Co. hatte ausstellen lassen und dass er diesen Wechsel einem Habenichts und Küstenfahrer aus Loghill namens Patrick, dem Besitzer des Kutters, geschickt hatte.
Groß muss das Erstaunen in der Familie des Armen gewesen sein, als man sie benachrichtigte, dass ihr Oberhaupt nichts weiter zu tun habe, als in Dublin zu erscheinen, woraufhin das Bankhaus O’Brien &Co. ihm den doppelten Betrag dessen auszahlen würde, auf den sein Kutter geschätzt worden war.
Unterdessen hatte sich René von François in allen Einzelheiten erzählen lassen, wie er nach Saint-Malo zurückgekommen war und wie er auf Höhe von Kap Finistèrre von einer englischen Brigg gejagt worden war, der er nur entkommen konnte, indem er so tat, als wollte er nach Amerika fahren.
Das hatte seine Rückkehr nach Saint-Malo verzögert.
Bei dieser Verfolgungsjagd hatte die Runner of New York ihrem Namen alle Ehre gemacht und zehn bis zwölf Knoten in der Stunde zurückgelegt.
François beteuerte René, er hätte sich erschossen, wenn ihm das Missgeschick widerfahren wäre, gekapert zu werden. René kannte ihn gut genug, um daran nicht zu zweifeln.
Es erübrigt sich zu sagen, dass René nach François’ Treuebekenntnis auf seinem Schiff alles so vorfand, wie er es hinterlassen hatte, sein Portefeuille in der Schreibtischschublade, sein Testament im Portefeuille und seine Edelsteine in dem kleinen Beutel.
Mit den ihm von René ausgehändigten Mitteln hatte François die Mannschaft bezahlt; alles war geregelt, und selbst der gewissenhafteste Buchprüfer hätte an François’ Abrechnungen nicht das Geringste auszusetzen gehabt.
René bat François, sein Stellvertreter an Bord der Runner of New York zu bleiben und sie weiter in seinem Namen zu führen, bis eine Entscheidung über Renés weiteres Geschick gefallen wäre.
Unterdessen hatte der Marinepräfekt René von der Rückkehr Kapitän Lucas’ nach Paris und der erwarteten Ankunft des Kaisers in der Hauptstadt unterrichtet – zwei gewichtige Gründe für René, sich ebenfalls so schnell wie möglich dorthin zu begeben.
Es erübrigt sich zu sagen, dass sein zweiter Besuch Madame Surcouf galt, der er berichtete, dass ihr Mann wohlauf war.
Zu den Dingen, die René in seiner Slup vorgefunden hatte, gehörte eine gut ausgestattete Garderobe; er entnahm ihr, was er für nötig hielt, und nahm eine Eilpost, denn er wollte keine unnötige Aufmerksamkeit in der Postkutsche auf sich ziehen.
In Paris mietete er ein Zimmer im Hotel Mirabeau in der Rue de Richelieu. (Denn dort befand es sich damals und noch nicht in der Rue de la Paix.) Kaum hatte er es bezogen, kaum hatte er seinen Namen im Fremdenbuch eingetragen, suchte ihn Fouchés Sekretär auf und bat ihn, sobald wie möglich im Polizeiministerium vorzusprechen.
Nichts hinderte René daran, dieser Bitte umgehend Folge zu leisten; im Gegenteil erfüllte ihn größte Neugier zu erfahren, welche Zukunft Fouché für ihn voraussah.
Er bat den Sekretär, einen Augenblick zu warten, kleidete sich schnell um und begleitete den Sekretär in seinem Wagen.
Kaum war René dem Minister angekündigt worden, wurde die Tür des ministeriellen Arbeitskabinetts geöffnet, der Sekretär erschien und sagte: »Seine Exzellenz erwartet Monsieur René.«
René wollte Seine Exzellenz auf keinen Fall warten lassen und trat unverzüglich ein.
Er sah sich Fouché gegenüber, dessen Miene spöttisch wie immer war, doch eher wohlwollend als verdrießlich.
»Aha, der Herr Kapitän der Runner of New York ist wieder im Lande?«
»Ihre Exzellenz sprechen mich mit einem Titel an, der verrät, dass Sie auf dem Laufenden über meine bescheidenen Angelegenheiten sind.«
»Das gehört zu meinem Beruf«, sagte Fouché, »und ich beglückwünsche Sie dazu, wie Sie Ihre Angelegenheiten geregelt haben. Waren Sie mit dem Rat, den ich Ihnen gab, zufrieden?«
»Sicherlich; ein Mann mit der Scharfsicht Ihrer Exzellenz kann nur gute Ratschläge geben.«
»Es geht nicht allein um gute Ratschläge, mein lieber Monsieur René, sondern darum, dass sie auch befolgt werden. Und in dieser Hinsicht kann ich Ihnen nur gratulieren. Ich habe hier die Abschrift eines Briefs Monsieur Surcoufs an den Marineminister, in dem er ein Gefecht und das Kapern der Standard schildert. Es ist die Rede von einem Matrosen namens René, der sich dabei so hervorgetan hat, dass Surcouf keine Bedenken hatte, ihn zum Seekadetten erster Klasse zu befördern; die Anteilnahme, die ich diesem Monsieur René entgegenbringe, hat mich veranlasst, meinen Kollegen Monsieur Decrès um die Abschrift zu bitten. Und ich habe einen zweiten Brief, abermals an den Marineminister, in dem Surcouf seine Ankunft auf der Île de France berichtet und mitteilt, dass er den Seekadetten René beurlaubt habe, damit dieser mit einem aus eigenen Mitteln gekauften Schiff und unter amerikanischer Flagge seine zwei Cousinen und den Leichnam seines Onkels, des Vicomte de Sainte-Hermine, nach Birma begleiten konnte. Und in einem dritten Brief erfährt man von seiner Rückkehr zur Île de France, nachdem er wahre Heldentaten gegen die furchterregendsten und vielfältigsten Ungeheuer bestanden hat, wobei lediglich von Tigern von der Größe des nemäischen Löwen und Schlangen von den Ausmaßen des Drachen Python die Rede ist. Nach seiner Rückkehr aus Birma ist der Seekadett René mitten in ein Seegefecht geraten, das Surcouf gegen zwei englische Schiffe focht, er enterte das eine, so dass Surcouf das andere einnehmen konnte, wobei er sich nicht lange bitten ließ, wie sich jeder denken kann, der ihn kennt. Daraufhin teilte unser René seinen Prisenanteil zwischen den Armen der Île de France und seinen Matrosen, und in Kenntnis der Anweisungen des Kaisers, die Engländer durch ein großes Seegefecht vom Ärmelkanal abzuziehen, hat er um die Erlaubnis nachgesucht, an diesem Kampf teilzunehmen; mit Empfehlungsschreiben General Decaens versehen, des Gouverneurs der Île de France, und mit der Erlaubnis seines Kommandanten Surcouf hat er sich wieder auf seiner kleinen Runner of New York eingeschifft und ist drei Tage vor der Schlacht von Trafalgar in der Bucht von Cadiz eingetroffen. Er hat sich unverzüglich an Bord der Redoutable begeben, und ihr Kommandant, Kapitän Lucas, hat ihm den Rang eines dritten Leutnants verliehen.
Die Schlacht fand statt, Kapitän Lucas, von drei gegnerischen Schiffen bedrängt, hat sich in die Victory verbissen, und es wäre ihm gelungen, das englische Flaggschiff zu entern, wenn nicht die Temeraire dazwischengekommen wäre, die mit einer einzigen Breitseite hundertachtzig Männer an Bord der Redoutable getötet hat. Unterdessen war Nelson tödlich getroffen worden, und zwar von einer Kugel, die vom Mastkorb des Besanmasts der Redoutable abgefeuert worden war, wie es heißt, von einem dritten Leutnant namens René, der keinen festen Posten an Bord hatte und dem Kapitän Lucas erlaubt hatte, sich seinen Posten auszusuchen, woraufhin er selbstverständlich den gefährlichsten gewählt hat...« Unvermittelt hielt Fouché inne und sah den jungen Mann eindringlich an: »Stimmt es«, fragte er dann, »dass der dritte Leutnant René Admiral Nelson erschossen hat?«
»Ich kann es nicht mit Sicherheit behaupten, Herr Minister«, erwiderte René, »ich befand mich als Einziger mit einem Gewehr im Besanmastkorb; Nelson konnte ich für einen Augenblick an seinem blauen Rock, seinen Orden und seinen Generalsepauletten erkennen, ich habe auf ihn geschossen, doch aus den Mastkörben des Großmasts und des Fockmasts wurde ebenfalls gefeuert, so dass ich nicht mit Sicherheit behaupten kann, ich hätte Frankreich von diesem furchtbaren Feind erlöst.«
»Ich kann es auch nicht mit Sicherheit behaupten«, sagte Fouché, »aber jedem, der es wissen will, werde ich bereitwillig weitersagen, was man mir berichtet hat.«
»Dann sind Ihre Exzellenz zweifellos mit dem Ende meiner Odyssee ebenso vertraut wie mit ihrem Beginn?«
»Ja. Als Gefangener auf der Samson unter Kapitän Parker wurden Sie nach Gibraltar und von dort nach England gebracht, und nach einem schrecklichen Unwetter haben Sie sich mit Ihren Männern an die Pumpen gestellt und das Schiff gerettet, das ohne Ihre Hilfe gesunken wäre; zusammen mit sieben Mithäftlingen sind Sie aus dem Gefängnis von Cork entflohen, Sie haben auf dem Fluss Shannon einen kleinen Kutter gekapert und seinen Besitzer an Land abgesetzt, und mit diesem Kutter sind Sie nach Saint-Malo zurückgefahren; Sie waren der Ansicht, dem Besitzer eine Entschädigung zu schulden, und haben ihm deshalb einen Wechsel über zweitausendfünfhundert Francs auf das Bankhaus O’Brien in Dublin ausgestellt.«
»Verehrter Herr Minister«, fiel ihm René ins Wort, »ich muss sagen, dass Sie offenbar allwissend sind.«
»Sie werden verstehen, mein Lieber, dass es nicht alle Tage vorkommt, dass ein Matrose mit seinen letzten Groschen eine amerikanische Slup kauft, um auf eigene Rechnung unter neutraler Flagge zu segeln, dass er seine Prisengelder an die Armen und an seine Matrosen verteilt, dass er zweitausend Meilen zurücklegt, um auf der Seite der Unterlegenen in der Schlacht von Trafalgar zu kämpfen, dass er nach seiner Gefangennahme und nach acht Tagen Haft aus dem Gefängnis flieht, dass er sich nach seiner Rückkehr nach Frankreich als Erstes daran erinnert, einem armseligen Küstenschiffer den erbärmlichen Kutter weggenommen zu haben, der dessen einzige Erwerbsquelle war, und dass er, nachdem der Kutter auf einen Wert von elfhundert Francs veranschlagt wurde, dem Besitzer, bei dem er ihn ausgeborgt hatte, zweitausendfünfhundert Francs schicken lässt. Sie bezahlen Ihre Schulden sehr liberal, mein Herr, angefangen mit der Dankesschuld bei mir. Da meine letzten Ratschläge auf so fruchtbaren Boden fielen, wären Sie wohl bereit, den Rat, den ich Ihnen jetzt geben will, in einem Winkel Ihres Gedächtnisses aufzubewahren?«
»Geben Sie ihn, Monsieur, geben Sie ihn.«
»Sie nennen sich Monsieur René, und unter diesem Namen wird der Kaiser Sie empfangen; merken Sie sich gut, dass in dem Bericht, den ich für ihn abfassen oder abfassen lassen werde, keine Rede von einem Grafen von Sainte-Hermine sein wird. Der Kaiser hat keine Vorbehalte gegen den Matrosen René, und er wird sich Ihrer weiteren Laufbahn nicht nur nicht widersetzen, sondern sie nach Kräften fördern; sollte er aber den geringsten Zusammenhang zwischen dem Matrosen René und dem Grafen von Sainte-Hermine erkennen, würde er ungnädig werden, und Sie hätten mit höchster Wahrscheinlichkeit Ihre Wundertaten völlig vergebens vollbracht und müssten wieder von vorne anfangen. Deshalb habe ich Sie sofort nach Ihrer Ankunft holen lassen; der Kaiser wird voraussichtlich am 26. des Monats hier sein. Suchen Sie Kapitän Lucas im Marineministerium auf; der Kaiser wird ihn umgehend nach seinem Eintreffen zu sehen wünschen; und wenn Lucas Ihnen anbietet, Sie dem Kaiser vorzustellen, dann nehmen Sie an. Einen besseren Vermittler können Sie sich nicht wünschen, und ich zweifle nicht daran, dass der dritte Leutnant René sowohl militärisch als auch im zivilen Leben ein gemachter Mann sein wird, sofern Sie den Grafen von Sainte-Hermine in der Versenkung verschwinden zu lassen geruhen wollen.«
Als René sich von Seiner Exzellenz dem Polizeiminister verabschiedete, war er so ratlos wie zuvor, warum Fouché ihm so warme Anteilnahme entgegenbrachte. Hätte Fouché sich die gleiche Frage gestellt, hätte er sich wahrscheinlich achselzuckend gesagt: »Es gibt eben Menschen, die so sympathisch sind, dass sie sogar den Griesgrämigsten für sich einnehmen.«
René begab sich auf der Stelle zum Marineministerium, wo er Lucas vorfand, der von seiner Verwundung genesen war und mit Entzücken erfuhr, wie René mit den Engländern verfahren war.
»Bei unserer nächsten Kampagne«, sagte er, »kommen Sie mit mir, mein lieber René, und dann versuchen Sie, Admiral Collingwood die Schwester der Kugel zu schicken, mit der Sie Nelson beglückt haben.«
Kommandant Lucas wusste noch nicht, wann Napoleon nach Paris kommen würde; als er von René erfuhr, dass der Kaiser am 25. inkognito die Hauptstadt zu betreten gedachte, überlegte er einen Augenblick und sagte dann: »Besuchen Sie mich am 29., denn dann habe ich möglicherweise eine gute Nachricht für Sie.«
Wie gesagt war Napoleon am 26. in Paris angekommen; er hatte einige Tage in München verbracht, um die Hochzeit Eugène Beauharnais’ mit der bayerischen Prinzessin Auguste Amalie zu feiern, doch für die anderen Hauptstädte, in denen es keine Eheschließungen zu treffen galt, hatte er nur einen Tag reserviert.
Einen Tag für Stuttgart, um die Glückwünsche seiner neuen Verbündeten entgegenzunehmen, einen Tag für Karlsruhe, um Familienallianzen zu schmieden. Er wusste, dass das Volk von Paris ihn ungeduldig erwartete, um ihm seine Freude und seine Bewunderung zu demonstrieren. Zutiefst zufrieden mit dem Verlauf der politischen Geschäfte, seit es sich mit der Rolle des unbeteiligten Zuschauers begnügen durfte, hatte Frankreich den Überschwang der ersten Revolutionstage wiedergefunden, mit dem es den herrlichen Taten seiner Armeen und ihrem Anführer applaudierte.
Eine Kampagne von drei Monaten Dauer statt eines Krieges von drei Jahren Dauer, ein niedergerungener Kontinent, ein Frankreich, das sich Grenzen erobert hatte, die es nie hätte überschreiten dürfen, strahlender Ruhm, der sich mit dem Ruhm unserer Siege verband, wiederhergestelltes Ansehen der Regierung in den Augen der Öffentlichkeit und eine Befriedung, die Aussicht auf Ruhe und Wohlstand versprach: Das war es, was das Volk Napoleon mit tausendfachen Hochrufen danken wollte.
Nach Marengo war nie etwas Schöneres gesehen worden als das, was man nach Austerlitz zu sehen bekam.
Austerlitz war für das Kaiserreich in der Tat, was Marengo für das Konsulat gewesen war. Der Sieg von Marengo hatte die konsularische Macht in Napoleons Händen gesichert, der Sieg von Austerlitz sicherte die kaiserliche Krone auf seinem Haupt.
Als der Kaiser erfuhr, dass Kommandant Lucas sich in Paris befand, ließ er ihm am Vormittag des 3. ausrichten, er werde ihn am 7. empfangen, obwohl die Schlacht von Trafalgar ganz gewiss nicht der angenehmste Gesprächsgegenstand war.
Am 4. fand René sich im Marineministerium ein, wie Lucas es ihm empfohlen hatte. Der Kommandant hatte am Vorabend seine Einladung zur Audienz am 7. erhalten.
Die Audienz war für zehn Uhr vormittags anberaumt; Lucas und René vereinbarten, dass René Lucas zum Frühstück besuchen und danach mit ihm den Tuilerienpalast aufsuchen sollte.
René war einverstanden, im Vorzimmer zu warten, während Lucas beim Kaiser vorsprach. Sollte Napoleon den Wunsch äußern, ihn zu sehen, würde Lucas ihn holen lassen; sollte er dem jungen Seefahrer gegenüber gleichgültig bleiben, würde dieser sich nicht bemerkbar machen.
Es muss gesagt werden, dass René dieser möglichen Begegnung mit gemischten Gefühlen entgegensah. Der durchdringende Blick, den Bonaparte zweimal schweigend auf ihn gerichtet hatte, das erste Mal im Hause Permon, das zweite Mal bei der Gräfin von Sourdis, erschreckte ihn. Ihm war, als nähme Napoleon von allem, was er betrachtete, einen Eindruck auf, der sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingrub; glücklicherweise besaß René einen Frieden des Gemüts und des Gewissens, der durch nichts zu erschüttern war und der ihm erlaubte, jedem Blick standzuhalten, auch dem durchdringendsten.
Am 7. fand sich René um neun Uhr morgens wie vereinbart bei Lucas ein. Um Viertel vor zehn stieg er mit Lucas in einen Wagen; fünf Minuten darauf hielten sie vor dem Eingang des Tuilerienschlosses an.
René betrat das Schloss mit Lucas zusammen und blieb dann im Vorzimmer zurück, während der Kommandant weiterging.
Lucas war ein Mann von eminentem Geist; es gelang ihm, in Gegenwart des Kaisers, ohne Renés Namen zu nennen, alle Heldentaten des jungen Mannes anzusprechen, alles Edle und Tapfere, das er geleistet hatte, doch er musste feststellen, dass der Kaiser kaum minder gut über diese Dinge unterrichtet war als er selbst; dies ermutigte Lucas zu sagen, er könne ihm diesen Helden vorstellen, sofern der Kaiser es wünschen sollte, denn der junge Mann habe ihn begleitet und warte im Vorzimmer.
Der Kaiser machte eine zustimmende Geste und drückte eine Klingel, woraufhin ein Adjutant die Tür öffnete.
»Führen Sie«, sagte Napoleon, »Monsieur René herein, den dritten Leutnant der Redoutable.«
Der junge Mann trat ein.
Napoleon sah ihn und runzelte die Stirn: Der junge Mann trug keine Uniform.
»Wieso«, fragte der Kaiser, »kommen Sie in Zivilkleidung in den Tuilerienpalast?«
»Sire«, erwiderte René, »ich kam nicht her um der Ehre willen, Ihre Majestät zu sehen, denn ich rechnete nicht damit, von Ihnen empfangen zu werden, sondern als Begleiter des Kommandanten, mit dem ich einen Teil des Tages zu verbringen hoffe. Überdies, Sire, bin ich Leutnant, ohne es zu sein. Kommandant Lucas gab mir drei Tage vor der Schlacht von Trafalgar den Posten auf seinem Schiff, da der dritte Leutnant wenige Tage zuvor gestorben war, doch meine Ernennung ist nicht urkundlich bestätigt.«
»Ich dachte«, sagte Napoleon, »Sie hätten den Rang eines zweiten Leutnants bekleidet.«
»Gewiss, Sire, aber das war an Bord eines Kaperschiffs.«
»An Bord von Surcoufs Revenant, nicht wahr?«
»Ja, Sire.«
»Sie haben zur Einnahme des englischen Schiffs Standard beigetragen?«
»Ja, Sire.«
»Und dabei großen Mut bezeigt?«
»Ich tat, was ich konnte, Sire.«
»General Decaen, der Gouverneur der Île de France, hat mir von Ihnen berichtet.«
»Ich hatte die Ehre, ihn kennenzulernen, Sire.«
»Er hat mir von einer Reise ins Landesinnere Indiens geschrieben, die Sie unternommen haben sollen.«
»Ich habe das Landesinnere in der Tat auf etwa fünfzig Meilen erkundet, Sire.«
»Und die Engländer haben Sie in Ruhe gelassen?«
»Diesen Teil Indiens halten sie nicht besetzt, Sire.«
»Und wo ist das? Ich dachte, sie säßen in ganz Indien.«
»Das ist das Königreich Pegu, Sire, zwischen dem Fluss Sittang und dem Fluss Irrawaddy.«
»Und in diesem Teil Indiens sollen Sie, wie man mir beteuert, die waghalsigsten Jagdabenteuer bestanden haben.«
»Ich bin einigen Tigern begegnet, die ich erlegt habe.«
»War es sehr aufregend, als Sie das erste Mal eines dieser Tiere erlegt haben?«
»Das erste Mal ja, Sire, aber die weiteren Male nicht.«
»Und warum?«
»Weil ich den zweiten Tiger dazu gebracht habe, den Blick zu senken, und von da an wusste ich, dass der Tiger ein Tier ist, das der Mensch beherrschen kann.«
»Und bei Nelson?«
»Bei Nelson habe ich einen Augenblick lang gezögert, Sire.«
»Und warum?«
»Weil Nelson ein großer Feldherr war, Sire, und weil ich mir dachte, er wäre vielleicht als Gegengewicht zu Ihrer Majestät notwendig.«
»Ho, ho! Und dennoch haben Sie auf diesen Mann der Vorsehung abgedrückt!«
»Nun, ich sagte mir, wenn er wirklich von der Vorsehung gesandt wäre, dann würde die Vorsehung die Kugel von ihm ablenken; im Übrigen, Sire«, fuhr René fort, »habe ich mich nie gebrüstet, Nelson getötet zu haben.«
»Aber wenn es dennoch...«
»Sire«, unterbrach ihn René, »solcher Taten brüstet man sich nicht, man räumt sie höchstens ein. Hätte ich Gustav Adolf oder Friedrich den Großen getötet, dann hätte ich es getan, weil ich davon überzeugt gewesen wäre, dass das Wohl und Wehe meines Vaterlands davon abhing, aber ich hätte es niemals verwunden.«
»Und wenn Sie in den Reihen meiner Feinde wären, würden Sie auf mich anlegen?«
»In den Reihen Ihrer Feinde wäre ich niemals anzutreffen, Sire!«
»Sehr gut.«
Er bedeutete René, sich zurückzuziehen, ohne das Zimmer zu verlassen, und winkte Lucas zu sich.
»Kommandant«, sagte er zu ihm, »heutigen Tages erkläre ich England und Preußen den Krieg. In einem Krieg gegen Preußen, das nur einen engen Zugang zum Meer hat, gibt es für Sie nicht viel Arbeit, doch in einem Krieg gegen England werden Sie alle Hände voll zu tun haben. Sie zählen zu jenen, die seinerzeit sagten, sie verstünden zu sterben und scheuten den Tod nicht.«
»Sire«, sagte Lucas, »Admiral Villeneuve habe ich bei Trafalgar keine Sekunde aus den Augen verloren. Keiner von uns würde zu behaupten wagen, er hätte seine Pflicht anders als aufs Trefflichste und Gewissenhafteste erfüllt.«
»Gewiss, in der Schlacht von Trafalgar. Das weiß ich, aber bis dahin hat er meine Geduld arg auf die Probe gestellt. Ihm verdanke ich es, dass ich in Wien war, statt in London zu sein.«
»Sire, der Wechsel der Marschrichtung hat Ihnen nicht zum Nachteil gereicht.«
»Er hat mir Ruhm eingebracht, aber Sie sehen selbst, dass ich wieder von vorne anfangen muss, obwohl ich bis Wien vorgestoßen war, und deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als England und Preußen den Krieg zu erklären. Doch wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich England eben auf dem Festland schlagen, indem ich die Könige schlage, die es unterstützt. Kommandant Lucas, ich werde Sie vor Beginn dieses Feldzugs wiedersehen; ich bitte Sie, dieses Kreuz der Ehrenlegion anzunehmen, und vergessen Sie nicht, dass das Kreuz, das ich Ihnen gebe, mein eigenes war.«
Dann wendete er sich an René: »Was Sie betrifft, Monsieur René, teilen Sie bitte meinem Adjutanten Duroc Ihren Namen und Vornamen mit, und wir werden uns bemühen, Sie nach Möglichkeit nicht von Ihrem Freund zu trennen.«
»Sire«, sagte René, der näher trat und sich verneigte, »da Ihre Majestät mich nicht wiedererkannt haben, könnte ich den Namen beibehalten, unter dem man mich Ihnen gegenüber erwähnt hat und unter dem ich Ihnen vorgestellt wurde, doch das hieße den Kaiser täuschen. Napoelons Zorn darf man sich zuziehen, aber man täuscht ihn nicht. Sire, für alle Welt bin ich René, doch für Ihre Majestät bin ich der Graf von Sainte-Hermine.«
Und ohne zurückzuweichen, verbeugte er sich wieder vor dem Kaiser und wartete.
Der Kaiser verharrte einen Augenblick lang reglos; er runzelte die Stirn, und seine Miene zeigte zuerst Erstaunen und dann Unmut.
»Das war recht getan, Monsieur, aber es war nicht genug, dass ich Ihnen vergeben könnte. Gehen Sie nach Hause, hinterlassen Sie Ihre Adresse bei Duroc, und warten Sie auf meine Ordres, die Fouché Ihnen übermitteln wird. Denn wenn ich mich nicht täusche, ist Monsieur Fouché einer Ihrer Gönner.«
»Ohne dass ich es verdient hätte, Sire«, sagte Sainte-Hermine und verbeugte sich.
Dann ging er hinaus und wartete im Wagen auf Kapitän Lucas.
»Sire«, sagte Lucas unterdessen, »ich weiß nicht das Geringste, was die Gründe betrifft, dass Ihre Majestät meinem armen Freund René übelgesinnt sein könnten; aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass er einer der treuesten und tapfersten Männer ist, die ich kenne.«
»Zum Teufel!«, sagte Napoleon. »Das habe ich selbst gesehen! Wenn er sich nicht ohne Not offenbart hätte, wäre er jetzt Fregattenleutnant!«
Als er allein war, blieb Napoleon einen Augenblick lang nachdenklich stehen; dann warf er seine zerknitterten Handschuhe voller Heftigkeit auf den Schreibtisch und murmelte: »Das Glück ist mir abhold! Solche Männer wie diesen brauchte ich in meiner Marine.«
René oder der Graf von Sainte-Hermine wiederum konnte nichts anderes tun, als den Befehl zu befolgen, den er erhalten hatte.
Und das tat er.
Er kehrte in das Hotel Mirabeau in der Rue Richelieu zurück und wartete.
98
Die Postkutsche von Rom
Am 2. Dezember 1805 hatte Napoleon die Schlacht von Austerlitz gewonnen.
Am 27. hatte er dekretiert, dass das Herrscherhaus von Neapel nicht mehr regierte.
Am 15. Februar war Joseph Bonaparte in die Stadt eingezogen, nachdem die Bourbonen zum zweiten Mal desertiert waren, und am 30. März war er zum König beider Sizilien proklamiert worden.
Im Gefolge des neuen oder besser künftigen Königs von Neapel hatte die französische Armee den Römischen Staat besetzt, was den Heiligen Vater so über alle Maßen verärgert hatte, dass er Kardinal Fesch herbeizitiert hatte, um sich über das zu beklagen, was er als Verletzung von Landesgrenzen bezeichnete.
Kardinal Fesch hatte sich an Napoleon gewendet.
Napoleon hatte geantwortet:
Verehrter Heiliger Vater, Sie sind unbestritten der Herrscher von Rom, doch Rom ist Teil des französischen Kaiserreichs; Sie sind Papst, aber ich bin Kaiser, wie es die Kaiser des Römischen Reiches Deutscher Nation waren, wie es vor mir Karl der Große war, und für Sie bin ich Karl der Große in mehr als einer Hinsicht, denn ich bin es sowohl meiner Macht als auch meiner Wohltätigkeit wegen: Und deshalb werden Sie sich den Bündnisgesetzen des Kaiserreichs unterwerfen und Ihr Gebiet meinen Freunden öffnen und ihren Feinden verschließen.
Auf diese ganz und gar napoleonische Antwort hatten die für gewöhnlich so milden Augen Seiner Heiligkeit Funken gesprüht, und er hatte Kardinal Fesch erwidert, dass er keinen Herrscher über sich anerkenne und den Widerstand Gregors VII. zu wiederholen bereit sei, wenn Napoleon die Unterdrückung eines Heinrich IV. wiederholen wolle.
Daraufhin erwiderte Napoleon mit unverhüllter Herablassung, im 19. Jahrhundert sei ihm vor geistlichen Waffen wenig angst, und im Übrigen werde er keinen Vorwand für ihre Verwendung liefern, da er davon Abstand nehme, sich in religiöse Belange einzumischen; er begnüge sich damit, den gegenwärtigen Herrscher auf weltlichem Gebiet zu schlagen, und überlasse dem Papst als dem verehrten Bischof Roms und Oberhaupt aller Bischöfe der Christenheit den Vatikan.
Diese Verhandlungen hatten den ganzen Dezember des Jahres 1805 beansprucht, ohne einen Fortschritt oder Rückschritt zu erzielen, und Napoleon hatte diesen Monat dazu benutzt, unmissverständlich klarzumachen, dass es ihm mit seinen Ankündigungen ernst war, indem er General Lemarois die Regierungsbezirke Urbino, Ancona und Macerata besetzen ließ, die sich an der Adria entlangziehen.
Daraufhin nahm Pius VII. Abstand von seinem Vorhaben, Napoleon zu exkommunizieren, und ließ sich dazu herbei, ein Abkommen unter folgenden Bedingungen in Betracht zu ziehen:
Der Papst, unabhängiger Souverän über den Kirchenstaat, von Frankreich als solcher anerkannt und bestätigt, erklärte sich bereit, zusätzlich eine Allianz mit Frankreich zu schließen und im Kriegsfall den Feinden Frankreichs keinen Zutritt zu seinem Kirchenstaat zu gewähren; französische Truppen würden Ancona, Ostia und Civitavecchia besetzt halten, aber von der französischen Regierung unterhalten werden; der Papst verpflichtete sich, den verlandeten Hafen von Ancona ausheben und instand setzen zu lassen; er erklärte sich bereit, König Joseph anzuerkennen, den Konsul König Ferdinands, alle Franzosenmörder und die eidverweigernden neapolitanischen Kardinäle des Kirchenstaats zu verweisen sowie auf sein angestammtes Recht der Investitur der Krone Neapels zu verzichten; er erklärte sich bereit, das für Italien geltende Konkordat auch für alle vormals italienischen Regierungsbezirke anzuerkennen, die in französische Regierungsbezirke umgewandelt worden waren; er würde unverzüglich die französischen und italienischen Bischöfe ernennen und sie der Reise nach Rom entbinden; er würde Bevollmächtigte ernennen, die ermächtigt waren, ein Konkordat für die deutschen Gebiete abzuschließen, und zuletzt würde er sich bereit erklären, die Anzahl der französischen Kardinäle im Kardinalskollegium auf ein Drittel aller Kardinäle zu erhöhen, um Frankreichs Einfluss im Verhältnis zu seiner territorialen Ausdehnung Anerkennung zu zollen und um die Bereitschaft Seiner Heiligkeit zu bezeugen, Napoleon gegenüber Entgegenkommen zu beweisen.
Zwei dieser Forderungen waren dem Heiligen Stuhl ganz besonders zuwider: Die erste war die, sein Territorium den Gegnern Frankreichs zu verschließen, die zweite war die einer Vermehrung der französischen Kardinäle.
Daraufhin ließ Napoleon Kardinal de Bayane seine Papiere aushändigen und befahl die Einnahme der verbliebenen vatikanischen Gebiete. Zweitausendfünfhundert Soldaten waren in Foligno stationiert, und ebenso viele befanden sich unter General Lemarois in Perusa; Napoleon befahl General Miollis, sich an die Spitze dieser Brigaden zu begeben, unterwegs dreitausend weitere Soldaten aufzunehmen, die aus Terracina abzuschicken Joseph befohlen worden war, und mit diesen achttausend Soldaten die Hauptstadt der Christenwelt einzunehmen.
Mit List oder Gewalt sollte General Miollis sich der Engelsburg bemächtigen, sich die päpstlichen Truppen unterwerfen, den Papst mit einer Ehrengarde im Vatikan belassen, auf alle Vorstellungen, die man ihm machen konnte, erwidern, er besetze Rom in rein militärischer Hinsicht, um die Feinde Frankreichs aus dem Kirchenstaat zu vertreiben, er sollte die Polizei nur benutzen, um die Briganten zu verjagen, die Rom zu ihrem Schlupfwinkel auserkoren hatten, und zuletzt sollte er die neapolitanischen Kardinäle nach Neapel zurückexpedieren.
General Miollis, verdienter Soldat der Republik von unbeugsamem Charakter, gebildet und untadelig, gelang es, sowohl dem Oberhaupt der Christenheit die gebührende Achtung zu bezeigen als auch dank seines beträchtlichen Solds auf großem Fuß in Rom zu leben und die Römer daran zu gewöhnen, den französischen General in der Engelsburg als ihr eigentliches Regierungsoberhaupt zu betrachten und nicht den alten Pontifex im Vatikan.
Bekanntermaßen ist es von alters her Sitte bei den Päpsten, den Briganten, die das Land Neapels verwüsten, Asyl zu gewähren; diese Briganten sind nicht etwa eine vorübergehende Plage, sondern ein dem Land eigentümliches Leiden; in den Abruzzen, in der Basilikata und in Kalabrien wird man als Brigant geboren, der Berufsstand wird vom Vater auf den Sohn vererbt wie der des Zimmermanns, des Schneiders oder des Bäckers; vier Monate im Jahr verlässt man das elterliche Haus, um sich zum Strauchritter auszubilden, und im Winter bleiben die Briganten behaglich zu Hause, ohne dass irgendjemand auf den Gedanken käme, sie dort aufzuscheuchen. Im Frühjahr schwärmen sie dann wieder aus und beziehen ihre gewohnten Stellungen.
Unter diesen Posten sind die begehrtesten jene in Nähe der römischen Grenzen. Der Brigant, der sich von der neapolitanischen Regierung verfolgt sieht, überschreitet die Grenze und findet im Kirchenstaat Asyl – denn in Ausnahmesituationen wie derjenigen, um die es sich in unserer Erzählung handelt, verfolgt die neapolitanische Regierung ihre Banditen, während die römische Regierung nichts dergleichen tut.
So kam es, dass während der Belagerung von Gaeta eine Ordonnanz auf dem Weg von Rom zu General Reynier zwischen Terracina und Fondi ermordet worden war und kein Hahn nach diesem Mord krähte, indes in klerikalen Kreisen viel Aufhebens darum gemacht wurde, Fra Diavolo vor dem Henker zu retten, der wie ein gejagtes Wild dem unermüdlichen Hauptmann Hugo in die Falle gegangen war.
Zu dieser Zeit kam ein junger Mann zwischen sechsundzwanzig und achtundzwanzig Jahren von mittlerer Größe und in einer Phantasieuniform, die keinem Armeekorps entsprach, zur Poststation und verlangte Pferde und einen Wagen.
Er trug einen kleinen englischen Stutzen mit zwei Läufen an über der Brust gekreuzten Gurten und hatte ein Paar Pistolen im Gürtel stecken, was verriet, dass er wusste, welchen Gefahren sich Reisende zwischen Rom und Neapel aussetzen.
Der Postmeister erwiderte, er habe einen Wagen, den er aber nicht verleihen dürfe, da er ihm zum Verkauf überlassen worden sei; unter den Pferden hingegen könne der Reisende seine Wahl treffen.
»Wenn der Wagen nicht zu teuer ist und mir passt«, sagte der Reisende, »hätte ich nichts dagegen, ihn zu erwerben.«
»Dann kommen Sie, ich zeige ihn Ihnen.«
Der Reisende folgte dem Postmeister; der Wagen war ein offenes Kabriolett, doch da warmes Wetter herrschte, war das Fehlen eines Dachs eher von Vorteil als von Nachteil.
Der junge Mann reiste allein und hatte einen Koffer und ein Necessaire bei sich.
Über den Preis des Wagens hatte man sich bald geeinigt; der Reisende hatte eher halbherzig gehandelt, als wäre ihm mehr daran gelegen, das Gesicht zu wahren, als einen günstigen Preis zu erlangen.
Man einigte sich auf achthundert Francs. Der Reisende ließ den Wagen vorfahren und die Pferde anschirren. Während er zusah, wie der Postillion seinen Koffer hinten am Wagen festschnallte, näherte sich ein Husarenoffizier dem Postmeister, der auf der Schwelle stand und mit unerschütterlicher Gleichmut dem Postillion bei der Arbeit zusah, und fragte ihn das Gleiche wie kurze Zeit zuvor der Reisende.
»Kannst du mir Pferde und einen Wagen leihen?«
»Pferde habe ich, einen Wagen nicht«, erwiderte der Postmeister mit unbewegter Miene.
»Und warum hast du keinen Wagen?«
»Weil ich den letzten soeben an Monsieur verkauft habe, der gerade anschirren lässt.«
»Das Gesetz schreibt vor, dass du immer einen Wagen in Bereitschaft halten musst.«
»Das Gesetz!«, sagte der Postmeister. »Was verstehen Sie darunter? Für uns gibt es schon lange keine Gesetze mehr«, und bei den letzten Worten schnipste er mit den Fingern wie jemand, der das Fehlen solcher moralischer Schranken der Gesellschaft nicht unbedingt bedauerte.
Der Offizier ließ sich einen Fluch entschlüpfen, der seine Enttäuschung lebhaft kundtat.
Der Reisende sah ihn an; er sah einen schönen jungen Mann von achtundzwanzig bis dreißig Jahren vor sich, einen Mann mit strengem Gesichtsausdruck und hellblauen Augen, die sowohl auf Reizbarkeit als auch auf Hartnäckigkeit hindeuteten, und als der Offizier aufstampfte und leise fluchte: »Potz Bomben und Granaten! Morgen Abend muss ich um fünf Uhr in Neapel sein, aber soll ich diese sechzig Meilen in gestrecktem Galopp zurücklegen?«, näherte sich ihm der junge Mann und sagte mit der Höflichkeit, an der sich die Mitglieder der vornehmen Welt untereinander erkennen: »Ich reise ebenfalls nach Neapel.«
»Ja, aber Sie reisen im Wagen«, sagte der Offizier mit bitterem Humor.
»Ebendeshalb bin ich in der Lage, Ihnen einen Platz in meinem Wagen anzubieten.«
»Verzeihung, Monsieur«, sagte der Offizier, der höflich salutierte und einen anderen Ton anschlug, »ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen.«
»Aber ich kenne Sie; Sie tragen die Uniform eines Hauptmanns des dritten Husarenregiments General Lasalles, anders gesagt eines der tapfersten Regimenter der ganzen Armee.«
»Das ist kein Grund, so unverschämt zu sein, Ihr Angebot anzunehmen.«
»Ich weiß, was Sie zurückhält, Monsieur, und ich kann Sie beruhigen: Wir werden uns die Reisekosten teilen.«
»Dann«, sagte der Husarenhauptmann, »müssen wir uns nur noch über den Wagen verständigen.«
»Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Monsieur, und es käme mir sehr gelegen, Sie zum Reisegefährten zu haben; in Neapel wird keiner von uns beiden diesen alten Karren benötigen, und wir können ihn dort verkaufen oder zu Feuerholz machen, wenn wir ihn nicht verkauft bekommen; wenn wir ihn aber verkaufen können, bekomme ich vierhundert Francs, da ich achthundert Francs für ihn bezahlt habe, und den Rest können Sie haben.«
»Diesen Vorschlag nehme ich an, aber unter der Bedingung, dass ich Ihnen sogleich vierhundert Francs bezahle, so dass der Wagen uns beiden zu gleichen Teilen gehört und wir einen Verlust gerecht teilen können.«
»Ich suche keine Scherereien mit Ihnen, Monsieur, und nehme Ihren Vorschlag bereitwillig an, obwohl ich finde, dass dies eine Menge Förmlichkeiten zwischen Landsleuten ist.«
Der Offizier wandte sich an den Postmeister. »Ich kaufe diesem Herrn die Hälfte deines Wagens ab«, sagte er, »hier hast du vierhundert Francs.«
Der Postmeister blieb mit verschränkten Armen stehen. »Monsieur hat mich schon bezahlt«, sagte er, »Ihr Geld steht ihm zu und nicht mir.«
»Kannst du das nicht ein wenig höflicher sagen, du Spitzbube?«
»Ich sage es, wie ich es sage, fangen Sie damit an, was Sie wollen.«
Der Offizier machte eine Handbewegung, als wollte er seinen Säbel ziehen, doch er begnügte sich damit, die Hand in den Gürtel zu haken, und drehte sich zu seinem Reisegefährten um.
»Monsieur«, sagte er mit umso bemerkenswerterer Höflichkeit, als sein Ton dem Postmeister gegenüber unfreundlich gewesen war, »darf ich Sie bitten, die vierhundert Francs anzunehmen, die ich Ihnen schulde?«
Der erste Reisende verneigte sich und klappte den eisernen Verschluss eines kleinen ledernen Koffers auf, den er an einem Gurt trug, der sich über seiner Brust mit dem Gurt kreuzte, an dem sein Stutzen befestigt war.
Der Offizier ließ die Geldstücke, die er in der Hand hielt, in den Koffer fallen.
»Monsieur«, sagte er, »wir können aufbrechen, sobald es Ihnen beliebt.«
»Wollen Sie Ihren Koffer nicht hinten am Wagen festmachen lassen?«
»Nein, danke, ich werde ihn als Rückenstütze benutzen; er wird meine Rippen vor dem Geholper dieses alten Gerippes schützen, und außerdem habe ich darin ein Paar Pistolen, die ich nicht ungern in der Nähe behalte. Zu Pferd, Postillion, zu Pferd!«
»Die Herren wollen keine Eskorte mieten?«, fragte der Postmeister.
»Ha! Hältst du uns für Nonnen, die in ihr Kloster zurückfahren?«
»Ganz, wie Sie wünschen; es steht Ihnen frei.«
»Das ist der Unterschied zwischen uns und dir, du alter bigotter Teufel!« Und dem Postillion rief er zu: »Avanti, avanti!«
Der Postillion fuhr im Galopp an.
»Über die Via Appia, nicht durch die Porta San Giovanni di Laterano«, rief der Reisende, der als Erster an der Poststation gewesen war.
99
Die Via Appia
Es war fast elf Uhr vormittags, als die zwei jungen Männer in ihrem offenen Kabriolett die Pyramide des Sextius zur Rechten hinter sich ließen und die großen Pflastersteine der Via Appia befuhren, denen zweitausend Jahre Geschichte nichts hatten anhaben können.
Wie wir wissen, war die Via Appia im Rom Cäsars, was die Champs-Élysées, der Bois de Boulogne oder die Buttes Chaumont im Paris des Monsieur Haussmann sind.
In den Hochzeiten der Antike hieß sie »die große Appia«, die Königin der Straßen, der Weg zum Elysium; sie war im Leben wie im Tod der Ort, an dem die Reichsten, Edelsten und Vornehmsten der Ewigen Stadt sich ein Stelldichein gaben.
Bäume jeder Art spendeten Schatten, insbesondere prachtvolle Zypressen, die prunkvolle Grabmäler beschatteten; auch an den anderen Straßen, an der Via Flaminia und der Via Latina, befanden sich Gräber wie an der Via Appia. Der Ort, wo der Leichnam die Ewigkeit verbringen würde, war von vordringlichem Interesse für die Römer der Antike, deren Todesbesessenheit an die der Engländer heranreichte und bei denen unter der Herrschaft insbesondere Tiberius’, Caligulas und Neros der Selbstmord geradezu epidemische Ausmaße annahm.
Nur in seltenen Fällen überließ man als Lebender die Sorge um sein Grab den Erben, denn es war eine ganz besondere Befriedigung, mit eigenen Augen zuzusehen, wie das Grabmal entstand, und die meisten bis heute erhaltenen Grabmäler tragen entweder die zwei Buchstaben V und F, was bedeutet: Vivus Fecit, oder V S P, was heißt: Vivus Sibi Posuit, oder aber die Buchstaben V F C, und dies heißt Vivus Faciendum Curavit.
In der Tat war es für einen Römer, wie wir sehen werden, von größter Wichtigkeit, sich einer seit den Tagen Ciceros eingebürgerten religiösen Tradition gemäß bestatten zu lassen, auch wenn seit ebenjener Zeit die verschiedenen Formen des Glaubens im Schwinden begriffen waren und ein Augur – wenn wir unserem Rechtsgelehrten aus Tusculum glauben wollen – lachen musste, wenn er seinesgleichen begegnete, doch unverbrüchlich glaubte man, dass die Seele des Toten, der nicht bestattet worden war, hundert Jahre lang am Ufer des Styx umherirren musste. Wer unterwegs auf einen Leichnam stieß und diesen nicht bestattete, beging ein Sakrileg, für dessen Sühne er Ceres eine Sau opfern musste.
Doch die Bestattung war noch nicht alles, man wünschte auch, behaglich bestattet zu sein; der heidnische Tod, gefallsüchtiger als der unsere, zeigte sich den Sterbenden der Zeit eines Augustus keineswegs etwa als klapperndes Skelett mit knöchernem Totenkopf, leeren Augenhöhlen und furchterregendem Grinsen – nein, er zeigte sich in Form einer schönen Frau, der bleichen Tochter des Schlafs und der Nacht, mit langen aufgelösten Haaren, weißen und kalten Händen und eisigen Küssen, fast als wäre sie eine unbekannte Freundin, die aus der Finsternis kam, wenn man sie rief, ernst, langsam und schweigend näher trat, sich über das Kopfkissen des Sterbenden beugte und ihm mit demselben unheilvollen Kuss Lippen und Augen zugleich schloss. Dann war der Leichnam taub, stumm und fühllos bis zu dem Augenblick, da der Scheiterhaufen für ihn entzündet wurde, und wenn die Flammen seinen Körper verzehrten und den Geist von der Materie sonderten, wurde die Materie zu Asche und der Geist wurde göttlich. Diese neue Gottheit, die zu den Manen gehörte, den Totengöttern, blieb für die Lebenden so unsichtbar wie unsere Gespenster, nahm aber wieder die Gewohnheiten, Vorlieben und Leidenschaften des Verstorbenen auf; sie ergriff gewissermaßen Besitz von seinen Empfindungen, liebte, was er geliebt hatte, und hasste, was er gehasst hatte.
Deshalb legte man in das Grab eines Kriegers dessen Schild, Speere und Schwert, in das Grab einer Frau ihre Nadeln, ihre Diamanten, ihre goldenen Ketten und Perlenhalsbänder und in das Grab eines Kindes seine Lieblingsspielsachen, Brot, Früchte und in einem Alabastergefäß einige Tropfen Milch aus der Mutterbrust, an der es nur so kurz gesaugt hatte.
Und wenn die Lage des Hauses, das sie während ihres kurzen Lebens bewohnten, den Römern ernsthafter Erwägung würdig erschien, dann kann man sich denken, welch noch größere Aufmerksamkeit sie auf den Entwurf, die Lage und die mehr oder wenige erfreuliche, mehr oder weniger ihrem Geschmack, ihren Gewohnheiten und ihren Wünschen entsprechende Umgebung jener Behausung richten mussten, die sie in alle Ewigkeit bewohnen würden, denn die Manen waren sesshafte Gottheiten und an ihre Grabmäler gebunden, was ihnen allerhöchstens erlaubte, einen Spaziergang um das Grab herum zu machen.
Manche waren den ländlichen Freuden gewogen und von einfachem Geschmack und bukolischer Neigung; diese wenigen ordneten an, ihre Grabmäler in ihren Gärten oder auf ihren Ländereien zu errichten, damit sie ihre Ewigkeit in Gesellschaft der Nymphen, der Faune und Dryaden verbringen konnten, in Schlaf gewiegt vom sanften Geräusch der im Wind raschelnden Blätter, unterhalten vom Rauschen der Bäche über den Kieseln, entzückt vom Gesang der Vögel in den Zweigen.
Diese waren die Philosophen und die Weisen; andere jedoch – und sie waren die Mehrzahl, die große Mehrheit, der überwiegende Teil – bedurften ebenso sehr der Bewegung, der Unruhe und des Tumults wie Erstere der Ruhe und Sammlung, und diese anderen erwarben zu Höchstpreisen Grundstücke am Straßenrand, dort, wo Reisende aus allen Ländern vorbeikamen, die Neuigkeiten aus Asien und Afrika nach Europa brachten, Grundstücke an der Via Latina, an der Via Flaminia und vor allem an der Via Appia, welche so mondän geworden war, dass sie allmählich weniger als Landstraße betrachtet wurde denn als Vorort der Stadt Rom; sie führte zwar noch nach Neapel, doch links und rechts säumten sie Häuser, die Paläste waren, und Grabmäler, die Monumente waren; und so kam es, dass die begüterten Manen, die vom Schicksal so begünstigt waren, an der Via Appia bestattet zu sein, nicht nur bekannte und unbekannte Passanten vorbeiwandern sahen und nicht nur hörten, was die Reisenden an Neuigkeiten über Asien und Afrika austauschten, sondern darüber hinaus sogar aus dem Mund ihrer Grabmäler und mit ihren Grabinschriften zu diesen Passanten sprachen.
Und da wie gesagt der Charakter des Menschen ihn ins Jenseits begleitete, sagte der Bescheidene von sich:
Ich war und bin nicht mehr.
Das ist mein ganzes Leben und mein ganzer Tod.
Der Reiche sagte:
Hier ruht
STABIRIUS.
In allen römischen Dekurien
hätte er dienen können,
aber er wollte nicht.
Er war fromm, tapfer und treu
und kam aus dem Nichts; er hinterließ dreißig Millionen
Sesterzen
und hat nie etwas auf die Philosophen gegeben.
Gehabe Dich wohl und eifere ihm nach.
Und um die Aufmerksamkeit der Passanten noch unfehlbarer zu fesseln, hatte Stabirius, der Reiche, über seiner Grabinschrift gar eine Sonnenuhr einmeißeln lassen!
Der Gebildete sagte:
Reisender!
Sei es Dir auch eilig, Dein Ziel zu erreichen,
bittet Dich dieser Stein, ihm einen Blick zu gönnen
und zu lesen, was darauf geschrieben steht:
Hier ruhen die Knochen des Dichters
MARCUS PACUVIUS.
Dies wollte ich Dir sagen,
Adieu!
Der Verschwiegene sagte:
Mein Name, meine Geburt, meine Herkunft,
was ich war und was ich bin,
will ich nicht verraten.
Verstummt für alle Zeiten, bin ich nichts als
Asche, Knochen, nichts!
Aus dem Nichts gekommen, bin ich dorthin zurückgekehrt.
Mein Los harrt Deiner! Adieu!
Der mit allem Zufriedene sagte:
Mein Lebtag lang habe ich gut gelebt.
Mein Auftritt ist beendet, der Eure wird es bald sein.
Adieu! Spendet Beifall!
Zuletzt ließ eine unbekannte Hand, zweifellos die eines Vaters, das Grab seiner Tochter, die ihm im Alter von sieben Jahren genommen worden war, die Worte sagen:
Erde! Laste nicht auf ihr!
Sie lastete nicht auf dir!
Aber an wen richteten all diese Toten, die sich an das Leben klammerten, ihre Sprache der Grabinschriften? Wen riefen sie aus ihren Gräbern an, wie Freudenmädchen an ihre Fenster klopfen, um die Passanten zu veranlassen, sich umzudrehen? Was war das für eine Welt, der sie sich in Gedanken noch immer beigesellten und die fröhlich und sorglos schnellen Schritts vorbeiwanderte, ohne sie zu hören oder zu sehen?
Diese Welt war die Welt all dessen, was es in Rom an Schönheit, Eleganz, Reichtum und Aristokratie gab. Die Via Appia war das Longchamp der Antike, doch dieses Longchamp dauerte nicht drei Tage, sondern das ganze Jahr.
Gegen vier Uhr nachmittags, wenn die größte Hitze vorbei war, wenn die Sonne sich weniger glühend und weniger strahlend dem tyrrhenischen Meer entgegensenkte, wenn der Schatten der Pinien, der grünen Kastanien und der Palmen sich von Westen nach Osten verlängerte, wenn der sizilianische Oleander den Staub des Tages abschüttelte, sobald der erste Windhauch von den bläulichen Bergketten herabwehte, die der Tempel des Jupiter Latiaris überragt, wenn die indische Magnolie ihre elfenbeinfarbenen Blüten wieder öffnete, geformt wie duftende Schalen zum Auffangen des abendlichen Taus, wenn die Nixenblume des Kaspischen Meeres, die sich vor der Hitze des Zenits in den feuchten Schoß des Sees geflüchtet hatte, an die Wasseroberfläche zurückstieg, um mit der ganzen ausgebreiteten Fläche ihres Blütenkelchs die nächtliche Frische zu atmen – dann kam aus der Porta Appia, was man als Speerspitze der Stutzer, der trossuli, der kleinen Trojaner Roms bezeichnen kann, und die Bewohner der Vorstadt Appia kamen aus ihren Häusern, rissen alle Fenster und Türen auf, um Luft zu schöpfen, setzten sich auf Stühle oder Sessel, die aus dem Atrium herbeigetragen wurden, stützten sich auf die Prellsteine, die den Reitern zum Aufsitzen dienten, oder lehnten sich auf den runden Bänken zurück, die man zur größeren Bequemlichkeit der Lebenden an die Wohnungen der Toten angelehnt hatte, und machten sich daran, die Vorübergehenden kritisch zu mustern.
Weder die Pariser, die sich in zwei Spalieren an den Champs-Élysées drängten, noch die Florentiner, die zum Cascine-Park eilten, die Wiener, die den Prater stürmten, oder die Neapolitaner, die sich zu Pfropfen in der Via Toledo und in der Via Chiaia ballten, hatten jemals eine solche Vielfalt an Darstellern und einen solchen Wetteifer unter den Zuschauern erlebt!
100
Was sich fünfzig Jahre vor Christus auf der Via Appia abspielte
Zuerst kamen die Reiter auf ihren numidischen Pferden, welch Letztere die Vorfahren der Reittiere der Kavaliere unserer Tage sind; diese Pferde ohne Sattel und ohne Steigbügel waren mit goldgewirkten Schabracken oder solchen aus Tigerfell geschmückt; die einen Reiter halten an, um den Zug vorbeiziehen zu sehen, die anderen reiten im Schritt weiter, und ihnen gehen Läufer in kurzer Tunika voraus, in leichtem Schuhwerk, den Umhang über die linke Schulter geworfen und mit einem Ledergürtel um die Taille, den sie je nach Erfordernis enger oder lockerer schnüren, je nachdem ob sie schneller oder weniger schnell laufen müssen; andere schließlich rasen in wenigen Minuten die ganze Strecke der Via Appia entlang, als wollten sie einen Preis erringen, und lassen vor ihren Pferden prachtvolle Jagdhunde mit silbernem Halsband rennen. Wehe dem, der diesem Wirbelsturm in den Weg gerät! Wehe dem, der sich von dieser Windhose aus Gewieher, Gebell und Staub einfangen lässt! Den einen beißen die Hunde und zertrampeln die Pferde, den anderen trägt man blutig und zerschmettert fort, indes der junge Patrizier, der über ihn hinweggeritten ist, sich kurz umdreht, ohne innezuhalten, laut lacht und prahlerisch seine Geschicklichkeit zur Schau stellt, indem er das Ziel, dem er entgegenreitet, nicht aus den Augen verliert.
Nach den numidischen Pferden kommen die leichten Gefährte, die es an Geschwindigkeit beinahe mit den Wüstensöhnen aufnehmen könnten, deren Rasse fast zur gleichen Zeit wie Jugurtha nach Rom gebracht wurde: Es sind die cisii, luftige Fuhrwerke, gewissermaßen Tilburys, von drei fächerförmig angeschirrten Mauleseln gezogen, deren linkes und rechtes Zugtier galoppieren und ihre Silberglöckchen schütteln, während das mittlere mit der Unbeirrbarkeit, fast könnte man sagen: mit der Schnelligkeit eines Pfeils vorantrottet. Nach ihnen kommen die carrucae, höhere Kutschen, als deren Variante oder eher Nachfahren man den corricolo unserer Tage betrachten darf, und sie werden meist nicht von den Stutzern selbst gelenkt, sondern von einem nubischen Sklaven in der pittoresken Kleidung seines Heimatlandes.
Nach den cisii und den carrucae folgen die vierrädrigen Gefährte, die rhedae voller purpurfarbener Kissen und üppiger Teppiche, die über die Wagenschläge hängen, die covini, geschlossene Wagen, die so hermetisch geschlossen sind, dass sie bisweilen die Geheimnisse des Schlafzimmers in den Straßen Roms und auf den öffentlichen Lustwegen spazieren fahren; und den denkbar größten Gegensatz bilden die Matronen in ihren langen Stolen und ihrer dicht gewebten palla, die so steif wie Statuen in ihrem carpentum sitzen, einer Art Sänfte, deren sich nur die Patrizierinnen bedienen dürfen, zu den Kurtisanen in ihren Gazegewändern aus Kos, wie aus Nebel gewirkt, die nachlässig auf ihren Tragesesseln liegen, von acht Trägern in prunkvollen panulae getragen und zur Rechten von einer griechischen Freigelassenen begleitet, Liebesbotin, nächtliche Iris, die ihr süßes Gewerbe für einen Augenblick unterbricht, um mit einem Fächer aus Pfauenfedern die Luft zu erfrischen, die ihre Herrin atmet, zur Linken hingegen von einem liburnischen Sklaven, der ein samtbekleidetes Trittbrett trägt, an dem ein langer Teppich aus gleichem Stoff befestigt ist, damit die edle Priesterin der Lust von ihrem Tragesessel steigen und den Ort, an dem sie sich niederzulassen gedenkt, erreichen kann, ohne dass ihr nackter, edelsteingeschmückter Fuß den Boden berühren muss.
Denn sobald das Marsfeld überquert ist, sobald man die Porta Capena hinter sich gelassen hat und sich auf der Via Appia befindet, setzen zwar viele ihren Weg zu Pferde oder im Wagen fort, doch andere gehen nun zu Fuß, lassen ihre Fuhrwerke von ihren Sklaven führen und spazieren in dem Zwischenraum zwischen Häusern und Gräbern oder setzen sich auf die Stühle und Hocker, die ihnen Freiluftspekulanten für eine halbe Sesterze in der Stunde vermieten. Ah! Da sieht man die wahrhaft feine Welt! Da herrscht die Mode unerbittlich! Da kann man an unzweifelhaften Vorbildern des guten Geschmacks Bartform, Haartracht, Schnitt der Tunika und das große, von Cäsar gelöste und von der darauffolgenden Generation wieder infrage gestellte Problem studieren, ob man sie lang oder kurz, weit oder eng tragen soll. Cäsar trug sie lang und schlampig; doch seit seinen Tagen haben wir beachtliche Fortschritte gemacht! Da erörtert man in größtem Ernst das Gewicht von Schmuckringen, die Zusammensetzung des besten Rouges, die cremigste Pomade aus Saubohnen, um die Haut weich und zart zu machen, und die feinsten Pastillen aus Myrte und Mastix, mit altem Wein geknetet, die zu wohlriechendem Atem verhelfen! Die Frauen hören zu und werfen dabei wie Jongleure Kügelchen aus Ambra, die erfrischen und parfümieren, von einer Hand in die andere, spenden mit Kopf, Augen und bisweilen Händen den raffiniertesten und gewagtesten Theorien Beifall; ihre Lippen, vom Lächeln gekräuselt, enthüllen perlweiße Zähne; unter ihren zurückgeworfenen Schleiern sieht man in apartem Kontrast zu ihren pechschwarzen Augen und ebenholzfarbenen Brauen den reichen Schimmer rotblonder, goldblonder oder aschblonder Haare, je nachdem, ob die ursprüngliche Haarfarbe mittels einer Seife aus Buchenasche und Ziegentalg verändert wurde, die man aus Germanien kommen lässt, oder mittels einer Mischung aus Essigmutter und Mastixöl oder indem das einfachste Mittel ergriffen wurde und in einer der Tavernen am Minuciustor gegenüber dem Tempel des Herkules und der Musen einer der prachtvollen Haarschöpfe erstanden wurde, die arme Mädchen in Gallien dem Haarscherer für fünfzig Sesterzen verkaufen und die dieser für ein halbes Talent weiterverkauft.
Dieses Schauspiel verfolgen mit gierigen Blicken der halbnackte Plebejer, der halbverhungerte kleine Grieche, der für eine Mahlzeit den Himmel erstürmen würde, und der Philosoph im zerlumpten Mantel und mit leerem Beutel, der hier Stoff für ein Traktat gegen Luxus und Reichtum findet.
Und alle, die sie liegen, sitzen, stehen, gehen, kommen, auf dem einen oder dem anderen Bein tänzeln, die Hände erheben, damit die Ärmel zurückfallen und die mit Bimsstein enthaarten Arme entblößen, sie alle lachen, lieben, plaudern, verschlucken die Silben, summen Lieder aus Cadiz oder aus Alexandria und denken nicht an die Toten, die ihnen lauschen, sondern tauschen Kalauer im Idiom des Demosthenes, denn am liebsten sprechen sie Griechisch, da das Griechische die eigentliche Sprache der Liebe ist, und eine Kurtisane, die zu ihren Liebhabern nicht in der Sprache einer Thais oder Aspasia sagen könnte: »Mein Leben und meine Seele«, wäre nichts Besseres als eine Straßendirne, gerade gut genug für die Soldaten aus dem Volk der Marser, die Sandalen und Lederschilde tragen.
Doch um dieser eitlen und geistlosen Menge Zerstreuung, Denkmäler, Schauspiele und Brot zu geben – diesen leichtfertigen jungen Leuten, diesen flatterhaften Frauen, diesen Söhnen aus gutem Haus, die ihre Gesundheit in den lupanaria ruinieren und ihr Geld in den Tavernen vergeuden, diesem müßigen und faulen Volk, das vor allem italienisch ist, zugleich aber auch mürrisch wie die Engländer, stolz wie die Spanier, streitsüchtig wie die Gallier, diesem Volk, das sein Leben damit verbringt, vor den Stadttoren zu promenieren, in den Bädern zu debattieren und im Zirkus Beifall zu klatschen, diesen jungen Leuten, diesen Frauen, diesen Söhnen aus gutem Haus, diesem ganzen Volk -, singt Vergil, der sanfte Schwan aus Mantua, der dem Herzen, wenn auch nicht der Erziehung nach christliche Dichter, das Loblied des ländlichen Glücks, verurteilt er den politischen Ehrgeiz, verdammt er die Ruchlosigkeit der Bürgerkriege und arbeitet er an der schönsten und großartigsten Dichtung seit den Tagen Homers, die er verbrennt, als sie ihm nicht allein der Nachwelt, sondern auch seiner Zeitgenossen unwürdig erscheint! Um ihretwillen, um zu ihnen zurückzukehren, flieht Horaz bei Philippi und wirft seinen Schild fort, um schneller laufen zu können; um von ihnen gesehen und erwähnt zu werden, spaziert er zerstreut über das Forum, das Marsfeld, am Tiber entlang, völlig mit dem beschäftigt, was er als Bagatellen bezeichnet: seine Oden, seine Satiren und seine Dichtungen; an sie richtet der Libertin Ovid, seit fünf Jahren schon im Exil bei den Thrakern, wo er für das leichtfertige Vergnügen büßt, kurzzeitig Liebhaber der Tochter des Imperators gewesen zu sein, oder für den gefährlichen Zufall, das Geheimnis der Geburt des jungen Agrippa entdeckt zu haben, an sie richtet er seine Tristia, seine Epistulae ex Ponto und seine Metamorphosen; um wieder unter ihnen zu weilen, fleht er Augustus an und wird er Tiberius anflehen, ihm die Rückkehr nach Rom zu gestatten; sie vermisst er, als er fern der Heimat die Augen schließt und mit jenem letzten Blick, der dem Diesseits schon enthoben ist, die prunkvollen Gärten des Sallust schaut, das Armenviertel Subura, die majestätischen Wasser des Tibers, in denen Cäsar beinahe ertrunken wäre, als er gegen Cassius kämpfte, und das sumpfige Velabrum zwischen Tiber und Forum Romanum nahe dem heiligen Hain, Zuflucht der römischen Wölfin und Wiege von Romulus und Remus! Um ihretwillen, um sich ihre Liebe zu erhalten, die so launisch ist wie ein Apriltag, bezahlt Mäcenas, der Abkömmling der Könige Etruriens, der Freund des Augustus, der wollüstige Mäcenas, der nur zu Fuß geht, wenn er sich auf zwei Eunuchen stützen kann, die männlicher sind als er, bezahlt dieser Mäcenas seine Dichter für ihren Gesang, seine Maler für ihre Bilder, seine Komödianten für ihre Auftritte, seinen Mimen Pylades für seine Grimassen, seinen Tänzer Bathyllos für seine Sprünge! Für sie eröffnet Balbus ein Theater, für sie errichtet Philippus ein Museum und erbaut Pollius Tempel.
An sie verteilt Agrippa Lotteriescheine, mit denen man zwanzigtausend Sesterzen gewinnen kann, gold- und silberbestickte Stoffe aus Pontos, mit Perlmutt und Elfenbein eingelegte Möbel; für sie lässt er Bäder einrichten, in denen man vom Sonnenaufgang bis zum letzten Sonnenstrahl verweilen kann, wo man rasiert, parfümiert, abgerieben und auf Kosten des Gastgebers mit Speis und Trank versorgt wird; für sie lässt er dreißig Meilen Kanäle ausheben, siebenundsechzig Meilen Aquädukte anlegen, lässt er mehr als zwei Millionen Kubikmeter Wasser nach Rom befördern und auf zweihundert Brunnen, einhundertunddreißig Wassertürme und einhundertundsiebzig Wasserbecken verteilen. Und für sie, um ihr Rom aus Ziegelsteinen in ein marmornes Rom zu verwandeln, um ihnen Obelisken aus Ägypten zu bringen und um ihnen Foren, Basiliken und Theater zu errichten, lässt der weise Kaiser Augustus sein goldenes Geschirr einschmelzen, behält er von der Hinterlassenschaft der Ptolemäer nur ein murrhinisches Gefäß aus dem Erbe seines Vaters Octavius und aus der Erbschaft seines Onkels Cäsar, der Niederlage des Antonius und der Eroberung der Welt nur einhundertfünfzig Millionen Sesterzen (dreißigtausend heutige Francs); für sie lässt er die Via Flaminia bis nach Rimini ausbauen; für sie lässt er aus Griechenland Hanswurste und Philosophen kommen, aus Cadiz Tänzer und Tänzerinnen, aus Gallien und Germanien Gladiatoren, aus Afrika Riesenschlangen, Flusspferde, Giraffen, Tiger, Elefanten und Löwen, und zu ihnen sagt er zuletzt auf dem Sterbebett: »Seid ihr zufrieden mit mir, Römer? Habe ich meine Rolle als Kaiser gut gespielt? … Ja?... Dann spendet Beifall!«
So waren die Via Appia, Rom und die Römer zur Zeit eines Augustus beschaffen; doch zu der Zeit, da unsere beiden Reisenden sie befahren, waren beinahe zweitausend Jahre über sie hinweggegangen, und die Favoritin des Todes, die nunmehr selbst im Sterben lag, bot dem Blick von der Porta Capena bis nach Albano nur mehr eine lange Abfolge von Ruinen, in denen einzig das Auge eines Archäologen die Geheimnisse der Vergangenheit aufspüren konnte.
101
Archäologische Unterhaltung zwischen einem Marineleutnant und einem Husarenhauptmann
Die zwei jungen Männer schwiegen eine Zeit lang; der Jüngere der beiden, der den Wagen als Erster erworben hatte, betrachtete die riesengroßen Schriftzeichen der Antike voller Interesse; der Ältere betrachtete die historischen Ruinen, die sein Reisegefährte wie ein offenes Buch zu lesen schien, unbeteiligt und ohne sie mit einer Geschichte oder einer Stimme zu versehen.
»Wenn man bedenkt«, sagte der Husarenhauptmann obenhin und beinahe verächtlich, »wenn man bedenkt, dass es Leute gibt, die den Namen und die Geschichte jedes einzelnen Steins hier auswendig wissen!«
»Das stimmt, die gibt es«, sagte sein Begleiter lächelnd.
»Stellen Sie sich vor, gestern speiste ich bei unserem Botschafter Monsieur Alquier zu Abend, dem ich ein Schreiben des Großherzogs von Berg zu überbringen hatte; während der Abendgesellschaft kam ein Wissenschaftler, ein Architekt, mit einer weiß Gott überaus bezaubernden Ehefrau.«
»Visconti?«
»Sie kennen ihn?«
»Nun, wer würde ihn nicht erkennen, wenn Sie ihn so treffend beschreiben?«
»Sie wohnen in Rom?«
»Nein, ich habe die Stadt gestern zum ersten Mal betreten und heute Morgen zusammen mit Ihnen verlassen, aber das ändert nichts daran, dass ich Rom wie meine Westentasche kenne.«
»Sie haben ein berufliches Interesse, die Ewige Stadt, wie man sie nennt, zu studieren?«
»Mein Interesse ist der Wunsch nach Zerstreuung; ich liebe die Vergangenheit leidenschaftlich, die Menschen, die seinerzeit Riesen waren, und Vergil sagt zu Recht in einem großartigen Gedicht, dass wir über die Größe ihrer Knochen staunen, wenn der Karren über ihre Gräber fährt.«
»O ja, ich erinnere mich in der Tat«, sagte der junge Hauptmann und unterdrückte bei der Erinnerung an die Oberschule ein Gähnen, »mirabitur ossa sepulcris; aber«, fuhr er in muntererem Ton fort, »ist es wirklich gesagt, dass sie größer waren als wir?«
»Wir kommen gerade an einer Stelle vorbei, wo dieser Beweis erbracht wurde.«
»Und wo wäre das?«
»Wir befinden uns vor dem Zirkus des Maxentius; wenn Sie sich im Wagen aufrichten, können Sie eine Art Tumulus sehen.«
»Ist das denn kein Grabmal?«
»Doch, und im 15. Jahrhundert wurde es geöffnet: Es enthielt einen enthaupteten Toten, doch selbst ohne Kopf war er fast sechs Fuß groß. Sein Vater stammte von den Goten ab, seine Mutter von den Alanen; zuerst war er Hirte in den Bergen seiner Heimat, dann nacheinander Soldat unter Septimus Severus, Zenturion unter Caracalla, Tribun unter Heliogabal und zuletzt Kaiser als Nachfolger Alexanders. Am Daumen trug er die Armreife seiner Frau als Ringe; mit einer Hand konnte er ein beladenes Fuhrwerk ziehen; wenn er den erstbesten Stein in die Hand nahm, konnte er ihn mit seinen Fingern zu Staub zermalmen; er konnte dreißig Ringkämpfer nacheinander besiegen, ohne Luft holen zu müssen; zu Fuß war er so schnell wie ein Pferd im Galopp; er umrundete den Circus Maximus dreimal hintereinander in fünfzehn Minuten und füllte nach jeder Umrundung einen Kelch mit seinem Schweiß; und er verzehrte täglich vierzig Pfund Fleisch und leerte auf einen Zug eine ganze Amphore. Sein Name war Maximianus; er wurde bei Aquileia von seinen eigenen Soldaten erschlagen, die seinen Kopf dem Senat schickten, woraufhin dieser ihn in aller Öffentlichkeit auf dem Marsfeld verbrennen ließ. Sechzig Jahre später ließ ein anderer Kaiser, der von ihm abzustammen behauptete, in Aquileia nach seinem Leichnam suchen; und da er gerade diesen Zirkus errichtete, ließ er darin den Leichnam in einem Sarkophag bestatten; da die Lieblingswaffen des Verstorbenen Pfeil und Bogen gewesen waren, legte der Kaiser ihm als Grabbeigaben sechs Pfeile aus Schilfrohr vom Euphrat und einen Bogen aus germanischem Eichenholz in den Sarg; der Bogen war acht Fuß lang, die Pfeile waren fünf Fuß lang; wie gesagt hieß dieser Riese Maximianus und war römischer Kaiser gewesen. Derjenige, der ihm dieses Grabmal errichtete und es zu der Stelle erklärte, an der Pferde und Wagen bei den Rennen wendeten, hieß Maxentius und ertrank, als er Rom gegen Konstantin verteidigte.«
»Ja«, sagte der junge Husarenoffizier, »ich erinnere mich sehr gut an das Bild von Le Brun, auf dem Maxentius sich schwimmend zu retten versucht. Und dieser zinnengekrönte Turm, auf dem Granatapfelbäume wachsen wie in den hängenden Gärten der Semiramis, ist das sein Grabmal?«
»Nein, das ist das Grab einer bezaubernden Frau, deren Namen Sie auf der Marmorverkleidung lesen können. Dieses Grabmal diente im 13. Jahrhundert dem Neffen von Papst Bonifaz VIII. als Festung, und es wurde für Caecilia Metella errichtet, die Gattin des Crassus und die Tochter des Caecilius M. Creticus.«
»Ha«, sagte der Offizier, »sie war die Ehefrau des Geizhalses, der dem griechischen Philosophen, den er als Sklaven gekauft hatte, einen alten Strohhut zum Schutz gegen die Sonne lieh, wenn sie ausgingen, ihn aber bei der Rückkehr jedes Mal zurückforderte.«
»Was ihn nicht daran hinderte, Cäsar dreißig Millionen zu leihen, als dessen Gläubiger ihn seine Prätur in Spanien nicht antreten lassen wollten, aus der er vierzig Millionen Gewinn erzielte, nachdem alle Schulden beglichen waren. Die dreißig Millionen für Cäsar und dieses Grabmal zu Ehren seiner Ehefrau sind die einzigen uncharakteristischen Handlungen im Leben des Crassus.«
»Und war sie ein so aufwendiges Grabmal wert?«, fragte der Offizier.
»O ja; sie war eine edle Dame, geistreich, künstlerisch, dichterisch, die in ihrem Haus Catilina, Cäsar, Pompejus, Cicero, Lucullus und Terentius Varro empfing – kurzum alles, was in Rom den Ton angab; können Sie sich ausmalen, wie eine solche Abendgesellschaft verlief?«
»Sicher kurzweiliger als die unseres Botschafters Monsieur Alquier. Aber das Grab wurde offenbar ausgeraubt.«
»Es wurde auf Befehl von Papst Paul III. geöffnet; er entdeckte die Urne mit der Asche und ließ sie in eine Ecke des Eingangsraums des Farnese-Palasts bringen, wo sie sich heute noch befinden dürfte.«
Unterdessen fuhr ihr Wagen weiter; das Grabmal der Caecilia Metella lag hinter ihnen, und sie näherten sich einer rätselhafteren, denn weitaus verfalleneren Ruine.
Der Husarenoffizier hatte den ersten Erläuterungen seines Reisegefährten nur zerstreut gelauscht, doch je länger dieser sprach, desto aufmerksamer hörte er ihm zu. »Was ich nicht verstehe«, sagte er zuletzt, »das ist, warum die Geschichtsschreibung so langweilig sein muss, obwohl die erzählte Geschichte so unterhaltsam ist; Ruinen habe ich mein Lebtag gescheut wie ein Vipernnest, aber wenn Sie es jetzt von mir verlangten, würde ich jeden einzelnen Stein dieser Ruine umdrehen, um seine Geschichte zu erfahren.«
»Umso mehr«, sagte der junge Cicerone, »als die Geschichte ihrer Steine zu den merkwürdigsten gehört.«
»Fahren Sie fort, ich bin so neugierig wie der Sultan in Tausendundeine Nacht, dem die schöne Scheherazade jeden Abend eine Geschichte erzählt.«
»Es ist die Villa der Quintilier, zweier Brüder, die den Kaiser Commodus ermorden wollten.«
»Ho, ho! War das nicht der Enkel Trajans?«
»Und der Sohn Mark Aurels; aber die Kaiser folgen aufeinander, ohne einander zu ähneln. Als dem zwölfjährigen Commodus das Badewasser zu heiß war, befahl er, den Sklaven, der ihm das Bad bereitet hatte, in den Backofen zu stecken, und obwohl das Badewasser inzwischen auf die gewünschte Temperatur abgekühlt war, nahm er sein Bad erst, als der Sklave durchgebraten war. Die Grillen und Hirngespinste des jungen Kaisers waren allesamt grausamer und gewalttätiger Natur; dies führte zu zahlreichen Verschwörungen gegen ihn, darunter jener der Besitzer der Ruine, die wir gerade vor Augen haben. Es handelte sich darum, Commodus zu ermorden, doch das war leichter gesagt als getan bei einem Mann seiner Körpergröße und Kraft, der verlangte, dass man ihn nicht Commodus, Sohn des Mark Aurel, nannte, sondern Herkules, Sohn des Jupiter. Er verbrachte seine Tage im Zirkus, und er war kampfgewandter als jeder Gladiator; von einem Parther hatte er das Bogenschießen gelernt und von einem Mauren das Speerwerfen.
Eines Tages hatte ein Pantherweibchen im Zirkus gegenüber der Loge des Kaisers einen Mann gerissen, den es zu zerfleischen begann. Commodus, der nie ohne Bogen und Pfeile ausging, schoss einen Pfeil ab, der das Raubtier tötete, ohne dem Menschen ein Haar zu krümmen. Ein andermal ließ er in ganz Rom verkünden, er werde mit hundert Speeren hundert Löwen erlegen; das war, als er merkte, dass die Liebe des Volks zu ihm zu erkalten begann. Im Zirkus drängten sich die Neugierigen, wie man sich wohl denken kann; man brachte dem Kaiser hundert Speere mit vergoldeter Spitze und ließ hundert Löwen in den Zirkus; Commodus warf die hundert Speere und tötete mit ihnen die hundert Löwen.«
»Ho, ho!«, rief der junge Offizier.
»Das behaupte nicht ich«, sagte sein Begleiter, »sondern Herodianus, der alles mit eigenen Augen gesehen hat.«
»Das ist etwas anderes«, sagte der Husar und lüpfte seinen Kalpak, »dann will ich nichts dagegen sagen.«
»Außerdem«, fuhr der Erzähler fort, »war der Kaiser sechs Fuß groß und wie gesagt sehr stark; mit einem Stockschlag konnte er einem Pferd das Bein brechen, und mit einem Faustschlag tötete er einen Ochsen.
Eines Tages begegnete er einem ausgemacht korpulenten Mann, den er herbeirief und mit einem Schwerthieb in zwei Hälften zerteilte. Sie sehen, dass es keine leichte Sache sein konnte, gegen jemanden wie ihn zu konspirieren. Die Brüder Quintilii entschlossen sich dennoch dazu und trafen ihre Vorbereitungen: Sie vergruben all ihr Gold und Geld, allen Schmuck und alle Edelsteine; dann bereiteten sie Pferde für ihre Flucht vor, falls ihr Anschlag misslingen sollte, und verschanzten sich in einem Torweg, einer engen Durchfahrt zwischen Palast und Amphitheater.
Anfangs schien das Glück den Verschwörern hold zu sein: Commodus hatte nur wenige Begleiter bei sich. Die Quintilier stürzten sich auf ihn, von ihren Komplizen begleitet.
›Da‹, rief einer der Brüder, als er mit seinem Dolch zustach, ›da, Cäsar, nimm, was ich dir im Namen des Senats bringe!‹
Und in dem Halbdunkel der engen Durchfahrt begann ein fürchterliches Gemetzel. Commodus war nur leicht verwundet; die Stöße, die man gegen ihn führte, brachten ihn nicht einmal aus dem Gleichgewicht, während er mit jedem Schlag einen Gegner niederstreckte; zuletzt packte er den Quintilier, der ihn attackiert hatte, an der Kehle und erdrosselte ihn mit seinen eisengleichen Fingern. Im Sterben rief dieser Bruder, der Ältere, dem Jüngeren zu: ›Rette dich, Quadratus, wir haben verloren!‹
Der jüngere Bruder entfloh, sprang auf ein Pferd und raste im Galopp davon.
Die Soldaten machten sich sogleich an seine Verfolgung; für den Fliehenden ging es um Leben und Tod, für die Verfolger um eine ansehnliche Belohnung. Die Soldaten begannen, den Quintilier einzuholen, doch glücklicherweise hatten die Attentäter dies vorausgesehen und sich einen Ausweg einfallen lassen, der sonderbar genug anmuten mag, aber sollten Sie mir nicht glauben wollen, ist Cassius Dio mein Gewährsmann. Der Flüchtende führte einen Schlauch mit Hasenblut mit sich, und der Hase ist bekanntermaßen das einzige Tier, dessen Blut nicht gerinnt; der Flüchtende trank so viel von dem Blut, wie er konnte, und ließ sich vom Pferd fallen wie verwundet. Man fand ihn auf der Straße liegend und Sturzbäche von Blut speiend; und die Verfolger, die ihn für tot, ja mausetot hielten, plünderten ihn aus und entkleideten ihn, ließen den Leichnam liegen und berichteten Commodus, dass und wie sein Feind zu Tode gekommen war. Unterdessen hatte der Quintilier sich erhoben, war nach Hause gegangen, hatte sich angekleidet, alle Wertgegenstände, die er tragen konnte, mitgenommen und war entflohen.«
»Und Commodus«, fragte der Husarenoffizier, »wie ist er gestorben? Dieser Schlächter, der an einem Tag hundert Löwen töten konnte, hat mein Interesse geweckt.«
»Commodus wurde von seiner Favoritin Marcia vergiftet und von seinem Lieblingsathleten Narcissus erwürgt. Pertinax riss die Macht über das römische Reich an sich und bezahlte dafür sechs Monate später mit seinem Leben. Daraufhin kaufte Didius Julianus Rom und die Welt als Zugabe, doch Rom war es noch nicht gewohnt, verkauft zu werden.«
»Daran hat es sich seitdem gewöhnt«, warf der Offizier ein.
»Ja, aber diesmal lehnte es sich auf, auch wenn wir nicht vergessen dürfen, dass der Verkäufer zu bezahlen vergessen hatte. Septimus Severus nutzte den Aufstand, um Didius Julianus ermorden zu lassen, bestieg den Thron, und die Welt atmete auf.«
Da die nächste Poststation Velletri war und es von Rom bis Velletri fünf Meilen sind, bat der Postillion, seine Pferde verschnaufen zu lassen.
Diese Erlaubnis erteilten ihm die zwei Reisenden umso bereitwilliger, als sie eine der fesselndsten Stellen der römischen Campagna erreicht hatten.
102
In welchem Kapitel der Leser den Namen eines der zwei Reisenden errät und den des anderen erfährt
Sie befanden sich an ebenjenem Ort, an dem die Geschicke Roms entschieden worden waren.
Sie befanden sich am Schauplatz des Kampfes zwischen den Horatiern und den Curiatiern. Als er das erfuhr, führte der junge Husarenoffizier die Hand zum Salut an seinen Kalpak.
Beide Männer richteten sich in ihrem Wagen auf.
Vor ihnen lag links und rechts von der Straße nach Albano die Bergkette, deren äußerste linke Spitze der Soracte bildet, der zu Zeiten des Horaz gelegentlich schneebedeckt war und heute begrünt ist, und deren höchsten Gipfel der Tempel des Jupiter Latiaris krönt. Vor ihnen lag weiß schimmernd auf dem Gipfel eines Bergrückens Albano, das von Alba Longa abstammt, der es seinen Namen verdankt, und das aus den Ruinen der Villa des Pompejus entstanden war, ohne mit seinen achthundert Häusern und dreitausend Bewohnern die großzügigen Anlagen auszufüllen, die der Mückentöter Domitian an die Villa des Menschenschlächters Pompejus hatte anbauen lassen. Zu ihrer Rechten dehnte sich, sanft zum tyrrhenischen Meer hin abfallend, die Hügelkette, die um sie herum die Arena bildete, in der nacheinander die Völker der Falerier, der Aequer, der Volsker, der Sabiner und der Herniker gekämpft hatten und unterlegen waren. Hinter ihnen lag Rom, das Tal der Egeria, wo Numa Pompilius sich einfand, um sich von der Nymphe das Orakel sagen zu lassen, die lange Reihe der Grabmäler, an denen sie vorbeigekommen waren und die Rom wie durch eine Spur von Ruinen mit ihnen zu verbinden schien; und hinter Rom lag das unendliche Meer, von bläulichen Inseln übersät wie von Wölkchen, die auf dem Weg in die Ewigkeit in den Tiefen des Himmels Anker geworfen hatten.
Diese Arena umfasste zweieinhalbtausend Jahre Erinnerungen und war zwanzig Jahrhunderte lang Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte gewesen, zu Zeiten der Republik wie zu Zeiten der Päpste.
Die Pferde hatten verschnauft, und weiter ging es.
Auf Höhe des Grabmals der Horatier zweigte zur Rechten ein kleiner Pfad ab; mitten in dem rötlichen und fahlroten Gras, das die römische Campagna wie ein Löwenfell bedeckt, hatte dieser kaum sichtbare Pfad, der immer wieder in den Wellen der Hügel verschwand, dank seiner Nützlichkeit für Fußgänger als Abkürzung der Straße von Rom nach Velletri die Jahrhunderte überdauert.
»Sehen Sie diesen Weg?«, sagte der Jüngere der Reisenden, der zum Cicerone seines Reisegefährten geworden war, denn dieser seufzte inzwischen vor Ungeduld, wenn jener seine Erzählung unterbrach. »Höchstwahrscheinlich kamen die zwei Gladiatoren des Milo diesen Weg entlang, nachdem sie dessen Sänfte verlassen hatten, der sie zusammen mit einem Dutzend Kameraden als Eskorte dienten, um auf der Ebene Clodius zu überfallen, der sich dort mit Erntearbeitern unterhielt. Clodius wurde mit einem Speerhieb verwundet, der unter der linken Brust eindrang und an der Schulter austrat; er flüchtete sich in diese Ruinen, die früher ein Bauernhof waren, die Gladiatoren verfolgten ihn, fanden ihn in einem Ofen, in dem er sich versteckt hatte, erschlugen ihn und warfen seinen Leichnam auf die Landstraße.«
»Aber erklären Sie mir«, sagte der Husarenoffizier, »wieso Clodius sich so großen Einfluss auf die Römer bewahren konnte, obwohl er fast ruiniert und völlig verschuldet war.«
»Das ist leicht zu erklären: Zunächst einmal war er so schön, dass seine Mitbürger ihm den Beinamen Pulcher gegeben hatten; Sie wissen, welch große Rolle die Schönheit im Altertum spielte; seine Niederlage im Kampf gegen den Gladiator Spartakus, als dieser aus Capua floh, konnte seiner Beliebtheit nichts anhaben, und diese Beliebtheit förderten nach Kräften seine vier Schwestern, deren eine den Konsul Metellus Celer geehelicht hatte, die zweite den Redner Hortensius, die dritte den Bankier Lucullus, und deren vierte Lesbia war, die Geliebte des Dichters Catull. Böse Zungen in Rom behaupteten allerdings, Clodius sei der Liebhaber seiner vier Schwestern gewesen, und wir wissen, dass der Inzest in den letzten Tagen Roms überaus verbreitet war. Durch seine vier Schwestern hatte Clodius Zugriff auf die vier großen Machtbereiche unserer Welt: über die Frau des Metellus Celer war ihm die konsularische Macht zugänglich, durch die Frau des Hortensius stand ihm eine der wortmächtigsten Stimmen Roms zur Verfügung, durch die Frau des Lucullus stand ihm das Vermögen des reichsten Bankiers der Welt zur Verfügung, und durch Lesbia, die Mätresse Catulls, erlangte er das Ansehen, das Freundschaft und Verse eines großen Dichters ihm verschafften; zudem unterstützte ihn der reiche Crassus in der Voraussicht, eines Tages möglicherweise den Pöbel zu benötigen, über den Clodius gebot; Cäsar, dessen Laster er teilte, schmeichelte ihm und versuchte zugleich, ihm seine Frau abspenstig zu machen, und Pompejus hielt große Stücke auf ihn, weil er die Legionen seines Schwagers Lucullus zugunsten des Pompejus aufgewiegelt hatte; selbst mit Cicero stand er auf gutem Fuß, denn dieser war in seine Schwester Lesbia verliebt und wäre gern ihr Liebhaber gewesen, wogegen Clodius nicht das Geringste einzuwenden hatte.
Diese Liebe wurde für Clodius zum Verhängnis. Ich sagte bereits, dass er der Liebhaber der Mussia war, Tochter des Pompejus und Ehefrau Cäsars. Um sich ungestört mit ihr zu treffen, schlich er sich in Frauenverkleidung in ihr Haus; wie Sie wissen, war bei diesen lesbischen Orgien die Gegenwart von Männern, ja sogar männlicher Tiere strengstens verboten. Eine Dienerin erkannte Clodius und verriet ihn; Mussia half ihm, durch Geheimgänge zu entfliehen, doch das Gerücht von seiner Anwesenheit war bereits in aller Munde, und ein beispielloser Skandal war die Folge.
Clodius wurde von einem Tribun des Religionsfrevels angeklagt und vor Gericht zitiert, doch Crassus sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen, denn er, Crassus, werde die Richter bestechen; und wahrhaftig kam er mit Geld und schönen Patrizierinnen, die sich für Clodius opferten, und er ging sogar so weit, für diese Götter des Rechts die Fabel von Jupiter und Ganymed nachzustellen; all das führte zu einem solchen Skandal, dass Seneca sagte: ›Das Vergehen des Clodius war weniger schuldhaft als dessen Sühne.‹<
Zu seiner Verteidigung hatte Clodius ein Alibi ersonnen: Er behauptete, am Tag vor dem Fest der Bona Dea tausend Meilen von Rom entfernt gewesen zu sein. Zu seinem Pech hatte Terentia, die Ehefrau des Cicero, die schrecklich eifersüchtig war und Ciceros Liebe zu Lesbia bemerkt hatte, ihren Ehemann am Tag der Geheimfeiern im Gespräch mit Clodius gesehen, und sie stellte Cicero vor eine Wahl, der er sich bei all seiner Gewandtheit nicht entziehen konnte: ›Entweder sind Sie in die Schwester des Clodius verliebt; dann werde ich wissen, was ich zu tun habe, und Sie werden nicht gegen ihn aussagen; oder Sie sind nicht in sie verliebt, und dann gibt es keinen Grund, warum Sie nicht gegen ihren Bruder aussagen sollten.‹<
Cicero fürchtete sich vor seiner Frau, und er sagte gegen Clodius aus. Das hat Clodius ihm nie verziehen; und daher rührt der Hass, der die Tumulte und Aufstände auslöste, die Rom mehr als ein Jahr lang erschütterten, und der erst ein Ende fand, als Milo Cicero den Dienst erwies, Clodius von seinen Tierfechtern erschlagen zu lassen.
Das Volk hielt seinem Abgott über den Tod hinaus die Treue, was selten genug vorkommt, und nachdem ein Senator den Kadaver gefunden und nach Rom zurückgebracht hatte, errichtete seine Ehefrau Fulvia ihm einen Scheiterhaufen, und das römische Volk nahm glühende Holzscheite und brannte ein ganzes Stadtviertel nieder.«
»Mein lieber Reisegefährte«, sagte der junge Offizier, »Sie sind eine wahre wandelnde Bibliothek, und es wird mir mein Lebtag lang zur Befriedigung gereichen, in Begleitung eines zweiten Varro gereist zu sein … Ha! Sehen Sie«, rief er und klatschte begeistert über die klassische Anspielung, die ihm gelungen war, in die Hände, »auch ich bin von der römischen Geschichte affiziert! Aber fahren Sie fort, fahren Sie fort. Was ist das hier für ein Grabmal? Nur zu gern würde ich Sie einmal bei einer Wissenslücke ertappen.«
»Da haben Sie eine schlechte Wahl getroffen«, sagte der Cicerone, »denn dieses Grab ist mir besonders vertraut. Es ist das Grab des Askanios, des Sohns des Äneas, der so unvorsichtig war, bei der Plünderung Trojas den Rockzipfel seiner Mutter loszulassen, so dass er sie nicht wiederfand, sondern nur seinen Vater, der den Großvater Anchises und die Hausgötter forttrug; das führte letztlich zur Gründung Roms, doch zur gleichen Zeit, ja fast gleichzeitig, floh merkwürdigerweise aus einem anderen Stadttor Telegonos, Sohn des Odysseus und Gründer Tusculums, dessen Grab keine zwei Meilen von hier entfernt liegt. In diesen zwei Männern, dem Griechen und dem Asiaten, Söhne feindlicher Rassen, hatten die entgegengesetzten Nationalitäten in Europa ihre Verkörperung gefunden: Sie waren Rivalen, ihre Völker waren Feinde; die Zweikämpfe der Väter vor Troja setzten sich in den Kämpfen ihrer Nachfahren vor Rom fort. Die zwei bedeutendsten Geschlechter Albas und Tusculums waren das der Julier, dem Cäsar entstammt, und das der Porcier, dem Cato entstammt. Sie wissen, welch schrecklichen Kampf diese zwei Männer führten; nach mehr als tausend Jahren Dauer fand der Kampf von Troja vor Utica sein Ende. Cäsar, der Nachkomme der Besiegten, rächte Hektor an Cato, dem Nachkommen der Sieger. Das Grab des Askanios war das erste Grabmal, wenn man von Neapel kam, und des letzte, wenn man von Rom kam.«
Es war eine lange Reihe von Gräbern, und viele waren vergangen, ob edel oder niedrig, wie Ruy Gomez in Victor Hugos Hernani sagt; von diesen war nichts mehr zu sehen, denn die Sichel der Zeit hatte sie dem Erdboden gleichgemacht.
Der Ältere der Reisenden, anders gesagt: der Unwissendere, schwieg einen Augenblick; allem Anschein nach dachte er angestrengt nach.
»Sind Sie am Ende ein Geschichtslehrer?«, fragte er seinen Begleiter.
»Oh, meiner Treu, nein!«, erwiderte dieser.
»Aber wie haben Sie dann all dieses Wissen erworben?«
»Das weiß ich auch nicht; indem ich alle möglichen Bücher las; solche Dinge erwirbt man nicht, man behält sie im Gedächtnis; wenn man Geschmack an der Geschichte findet, sich für das Pittoreske interessiert, dann bahnen sich die Menschen und die Ereignisse einen Weg in den Kopf, erhalten dort ihre Form, und man sieht sie auf einmal in ganz neuem Licht.«
»Sapperlot!«, rief der junge Offizier. »Mit einem Gehirn wie dem Ihren würde ich mein Lebtag lang nichts anderes tun als lesen.«
»Das wünsche ich Ihnen nicht«, sagte der junge Gelehrte lachend. »Unter den Bedingungen zu studieren, unter denen ich studiert habe... Ich war zum Tode verurteilt, habe drei Jahre im Gefängnis verbracht und jeden Tag darauf gewartet, füsiliert oder guillotiniert zu werden; mit irgendetwas musste ich mich ablenken.«
»Wahrhaftig«, sagte der Offizier, der seinen Gefährten aufmerksam betrachtete und in dessen Zügen seine Vergangenheit zu ergründen suchte, »Ihr Leben muss recht hart gewesen sein.«
Der Angesprochene lächelte melancholisch. »Ich war nicht immer auf Rosen gebettet«, sagte er.
»Sie entstammen offenbar einer vornehmen Familie?«
»Mehr als vornehm, Monsieur, ich bin Edelmann.«
»Und Sie wurden aus politischen Gründen zum Tode verurteilt?«
»So ist es, aus politischen Gründen.«
»Stört es Sie, wenn ich Sie so ausfrage?«
»Keineswegs. Dinge, die ich nicht beantworten kann... oder will, werde ich einfach nicht beantworten.«
»Wie alt sind Sie?«
»Siebenundzwanzig Jahre.«
»Wie sonderbar, Sie wirken sowohl jünger als auch älter. Wann haben Sie das Gefängnis verlassen?«
»Vor drei Jahren.«
»Und was haben Sie getan, als Sie freikamen?«
»Ich bin in den Krieg gezogen.«
»Zur See oder zu Lande?«
»Zur See im Kampf gegen Männer, zu Lande habe ich gegen wilde Tiere gekämpft.«
»Das heißt?«
»Dass ich zur See Korsar war und zu Lande Jäger.«
»Und gegen wen haben Sie zur See gekämpft?«
»Gegen die Engländer.«
»Und welche Tiere haben Sie zu Lande gejagt?«
»Tiger, Panther und Boas.«
»Dann waren Sie in Indien oder in Afrika?«
»Ich war in Indien.«
»Und in welchem Teil Indiens?«
»In einem Teil des Landes, der in der übrigen Welt weitgehend unbekannt ist, in Birma.«
»Haben Sie an einer bedeutenden Seeschlacht teilgenommen?«
»Ich war bei Trafalgar.«
»Auf welchem Kriegsschiff?«
»Auf der Redoutable.«
»Dann haben Sie Nelson zu sehen bekommen?«
»Ja, sogar aus der Nähe.«
»Und wie sind Sie den Engländern entkommen?«
»Ich bin ihnen nicht entkommen; ich war ihr Gefangener und wurde nach England gebracht.«
»Wurden Sie ausgetauscht?«
»Ich bin entflohen.«
»Von den Hulken?«
»Nein, aus Irland.«
»Und wohin sind Sie jetzt unterwegs?«
»Das weiß ich nicht.«
»Und wie heißen Sie?«
»Ich habe keinen Namen; wenn wir voneinander Abschied nehmen, werden Sie mir einen Namen geben, und ich werde Ihnen gegenüber die Pflichten eines Patenkinds gegenüber seinem Paten haben.«
Der junge Offizier sah seinen Reisegefährten ein wenig ratlos an; er ahnte, dass sich hinter diesem sorglosen und unsteten Leben ein echtes Geheimnis verbarg; er war ihm dankbar für die Antworten, die dieser gegeben hatte, und war ihm nicht gram, dass er ihm andere Dinge vorenthalten hatte. »Nun zu mir«, sagte er. »Oder wollen Sie nicht wissen, wer ich bin?«
»Ich bin nicht neugierig, aber wenn Sie bereit wären, es mir zu sagen, wäre ich Ihnen dankbar.«
»Wohlan! Mein Leben ist so prosaisch, wie das Ihre ungewöhnlich und wahrscheinlich poetisch ist. Ich heiße Charles-Antoine Manhès; ich bin am 4. November 1777 in der Kleinstadt Aurillac im Departement Cantal geboren. Mein Vater war Staatsanwalt am Gericht. Sie sehen, dass ich nicht wie Sie zum französischen Hochadel zähle. Apropos, welchen Titel hatten Sie inne?«
»Den eines Grafen.«
»Ich habe das Gymnasium meiner kleinen Geburtsstadt besucht, was Ihnen erklären wird, dass meine Bildung etwas lückenhaft ist. Da die Verwaltungsbeamten meines Departements militärische Neigungen in mir erkannten, schickten sie mich auf die École de Mars. Ich wurde vor allem auf dem Gebiet der Artillerie ausgebildet und machte darin so große Fortschritte, dass ich mit sechzehn Jahren zum Ausbilder ernannt wurde. Nach der Auflösung der École de Mars wurde ich einer Prüfung unterzogen, die ich ehrenvoll bestand, woraufhin man mich dem dritten Bataillon des Cantal zuteilte und danach dem sechsundzwanzigsten Regiment der Linientruppen. Im Jahr 1795 meldete ich mich zum Kriegsdienst und diente vier Jahre in der Rhein- und Moselarmee; die Jahre VII, VIII und IX diente ich in der Italienarmee; bei Novi wurde ich schwer verwundet, musste sechs Wochen lang von meiner Verwundung genesen und konnte mich dann meinem Regiment bei Genua wieder anschließen … Haben Sie bisweilen am Hungertuch nagen müssen?«
»Bisweilen ja.«
»Nun, für mich war es oft genug das täglich Brot, und das ist ein hartes Brot. Auf Vorschlag meiner Freunde wurde ich zum Leutnant befördert; am 6. Juni vergangenen Jahres wurde ich zum Ritter der Ehrenlegion ernannt, nach der Kampagne von Austerlitz wurde ich zum Hauptmann befördert, und heute bin ich Hauptmann und Adjutant des Großherzogs von Berg, der mich beauftragt hat, die Nachricht von der Einnahme Berlins durch den Kaiser dessen Bruder Joseph zu überbringen, ihm die Kampagne von Jena, an der ich teilgenommen habe, in allen Einzelheiten zu berichten, und man hat mir zugesagt, dass ich nach meiner Rückkehr Schwadronschef sein werde, was für einen Neunundzwanzigjährigen nicht allzu übel wäre. Das ist meine ganze Geschichte; Sie sehen, dass sie kurz ist, ohne kurzweilig zu sein; aber interessanter als meine Geschichte ist der Umstand, dass wir Velletri erreicht haben, und da ich großen Hunger habe, lassen Sie uns aussteigen und uns zu Tisch begeben.«
Der namenlose Reisende erhob gegen diesen Vorschlag keine Einwendungen, sondern sprang aus dem Wagen und betrat zusammen mit dem künftigen Schwadronschef Charles-Antoine Manhès den Gasthof mit Namen Zur Geburt des Augustus – ein Name, der ohne archäologische Verifizierung zu verstehen gab, dass die Herberge auf den Ruinen des Hauses erbaut war, in dem der erste Kaiser Roms geboren worden war.
103
Die Pontinischen Sümpfe
Die Reisenden speisten schlecht, doch sie wären übel beraten gewesen, sich über die Kost in dem Gasthof Zur Geburt des Augustus zu beklagen, wenn man bedenkt, dass Augustus als Herrscher mit zwei getrockneten Fischen und einem Glas Wasser zum Abendessen vorliebnahm. Ein ganzes Buch ließe sich mit den Legenden verfassen, die über die Geburt des Augustus kursieren und die ihm, dem Sohn eines Müllers und einer Afrikanerin, die Herrschaft über das größte Weltreich weissagten.
Sagte Antonius nicht: »Dein Vorfahre war Afrikaner, deine Mutter arbeitete in der gröbsten Mühle von Aricia, und dein Vater wendete das Mehl mit einer Hand, die von dem Geld geschwärzt war, das er in Nerulum anfasste«?
Doch die Zeichen sprachen für sich.
Seine Mutter Atia war im Tempel des Apolls in ihrer Sänfte eingeschlafen, und die marmorne Schlange am Fuß der Statue, die den Gott der Heilkunde verkörperte, löste sich von dem Altar, kroch zu der Sänfte, glitt hinein, hielt Atia umschlungen und befruchtete sie, bevor sie sie verließ.
Eines Tages, als der junge Octavian zur Schule ging, ein Stück Brot in der Hand, stieß ein Adler auf ihn herab, entriss ihm das Brot und brachte es kurz darauf zurück, mit olympischem Ambrosia getränkt.
Zuletzt heiligte ein Gewitter das Haus seiner Eltern.
An jenem Abend wurde in Velletri ein Fest gefeiert, das alle Bauern und Bäuerinnen aus der Umgegend besuchten.
Man tanzte.
Schon immer war es in Italien üblich, dass die Hälfte der Bewohner singt und tanzt, während die andere Hälfte weint und wehklagt. Wenig kümmerte es die Bauern, ob die Franzosen Neapel eingenommen hatten, ob sie Gaeta belagerten oder ob man von jenseits der Pontinischen Sümpfe die Achtzigerkanonen donnern hörte, mit denen die Stadtmauern zusammengeschossen wurden.
Napoleon hatte seinem Bruder geschrieben: »Verstärken Sie die Belagerung.«
Und Joseph hatte gehorcht.
Man lächelte den Franzosen zu; die jungen Mädchen reichten ihnen die Hand und tanzten mit ihnen, und sie wendeten den Kopf nicht ab, wenn sie ihren Lippen begegneten; traf man sie aber allein an, dann erstach man sie.
Die Gäste, die bei dem Bankett am selben Tisch speisten wie die zwei Reisenden, richteten gierige Blicke auf den Sack voller Geldstücke, aus dem der Jüngere der beiden einen Louisdor holte, um die vier Francs zu zahlen, die seine Bewirtung und die seines Gefährten ausmachte, und nicht weniger gierige Blicke auf das Portefeuille, das der Begleiter des jungen Mannes aus seinem Mantel nahm und in seine Rocktasche steckte.
Der Bürgermeister von Velletri, der zwischen den Feiernden umherging, schenkte diesen Schätzen nicht weniger begierige Blicke als seine Mitbürger, doch das hinderte ihn nicht daran, den jungen Reisenden eine vierköpfige Eskorte für die Fahrt durch die Pontinischen Sümpfe anzubieten, wie es der Postmeister in Rom getan hatte.
Manhès jedoch holte seine zwei Pistolen aus seinem Felleisen und klopfte auf seinen Säbel, während sein Begleiter überprüfte, ob die zwei Läufe seines Stutzens geladen waren.
»Das ist unsere Eskorte«, sagte Manhès. »Wir Franzosen benötigen keine andere Eskorte als die unserer Waffen.«
»Es ist keinen Monat her«, sagte der Bürgermeister spöttisch, »dass ein französischer Adjutant bei uns genau wie Sie zu Abend gespeist hat; auch er führte gute Waffen mit sich, wie ich bestätigen kann, denn ich sah sie in den Händen seiner Mörder.«
»Und du hast sie nicht festnehmen lassen!«, rief Manhès und erhob sich voller Zorn.
»Mein Amt«, erwiderte der Bürgermeister, »verlangt, dass ich Reisenden eine Eskorte anbiete, und nicht, dass ich diejenigen festnehme, die sie töten, wenn sie keine Eskorte wollten; ich tue nur meine Pflicht.«
Manhès hielt es für klüger, nicht weiter zu insistieren, bedeutete seinem Begleiter, ihm zu folgen, und beide stiegen in ihren Wagen, der neue Pferde und einen neuen Postillion hatte, zahlten großzügig für ihre Verköstigung und fuhren im Galopp den Pontinischen Sümpfen entgegen.
Der doppelt schlechte Ruf, dessen sich dieser Teil des römischen Territoriums zwischen Velletri und Terracina erfreut, ist kein Geheimnis, und die faulige Luft, die man dort atmet, ist fast todbringender, als es die Banditen sind.
Erinnert sich der Leser der Barke unseres großen Malers Hébert mit dem abgezehrten Schiffer, den fiebrigen Fahrgästen, dem jungen Mädchen, das seine Fingerspitzen in das Wasser des Kanals hängen lässt, und mit den schönen grünen Pflanzen, die aus diesen mephitischen Gründen, die das menschliche Leben wie eine Fackel entzünden, vegetabilisches Leben schöpfen?
Während des Abendessens war die Nacht hereingebrochen, und als die zwei Reisenden den Gasthof verließen, färbte ein herrlicher Vollmond die Straße silbrig, bisweilen vom bebenden Laub der Bäume marmoriert. Hie und da warf ein Felsen seinen großen Schatten auf den Weg, als wollte er sich auf die Reisenden stürzen, die an seinem Fuß vorbeifuhren. Je näher sie den Pontinischen Sümpfen kamen, umso häufiger stiegen große Streifen zum Himmel auf, die keine Wolken waren, sondern Nebel, und die sich wie ein Schleier aus schwarzer Gaze über den Mond legten.
Auch der Himmel nahm eine sonderbar gelbliche und ungesunde Färbung an. Im Licht der Laternen, dessen Radius durch die dumpfe Luft immer kleiner wurde, bewegten sich in den Tümpeln unförmige Wesen, deren Größe die nächtliche Verzerrung der Optik noch grotesker machte, Tiere, die laut schnaufend den Kopf aus dem Wasser hoben: Es waren wilde Büffel, denen diese Sümpfe eine sichere Zuflucht bieten, in die sich nicht einmal die unerschrockensten Jäger wagen.
Hin und wieder schwangen sich auch große Vögel lautlos in die Luft, deren Gefieder die Farbe der Dämmerung hatte; es waren Graureiher und Rohrdommeln, die ihre unheimlichen Rufe ausstießen, während sie in die Dunkelheit entschwanden, in der sie nach dem dritten Flügelschlag unsichtbar wurden. Faust und Mephistopheles, die zum Hexensabbat gingen, hätten keinen gespensterreicheren Weg nehmen können als unsere zwei Reisenden.
»Haben Sie jemals etwas Vergleichbares erlebt?«, fragte Manhès.
»Ja, auf dem Weg von Pegu zum Land des Betels; doch was wir da vernahmen, war nicht das Brüllen von Büffeln, sondern das Knurren von Tigern und das Kreischen von Alligatoren; nicht Reiher und Rohrdommeln flogen über uns hinweg, sondern riesige Fledermäuse, die man Vampire nennt und die den Schlafenden die Adern öffnen, ohne dass diese es merken, und innerhalb von zehn Minuten einem Menschen all sein Blut aussaugen.«
»So etwas hätte ich zu gerne gesehen«, sagte Manhès.
Daraufhin schwiegen beide wieder.
Mit einem Mal ließ der Postillion sein kupfernes Horn, das er umgehängt trug, dreimal hintereinander ertönen. Da die Reisenden nicht wussten, was dieses Signal bedeutete, griffen sie zu ihren Waffen.
Doch kaum war das Signal ertönt, wurde es erwidert, und inmitten des grünen Gestrüpps der unseligen Sümpfe sah man einen Feuerschein, um den Gespenster herumsprangen. Es war eine Poststation.
Der Wagen hielt an.
Fünf, sechs schlotternde Pferdeknechte entzündeten Fackeln, ergriffen Peitschen und sprangen in das Gebüsch, während andere die Straße bewachten.
Innerhalb weniger Sekunden hatte der Postillion seine Pferde abgeschirrt.
»Bezahlen Sie mich«, sagte er zu den jungen Männern, »und ich mache mich aus dem Staub.«
Sie bezahlten ihn, er sprang auf eines seiner Pferde, und seine Pferde galoppierten davon, bis sie in der Finsternis verschwanden und das Geräusch ihrer Hufe erstarb.
Unterdessen war zwischen den wilden Pferdeknechten und ihren noch wilderen Pferden ein Kampf ausgebrochen, in dem die Menschen fluchten und die Vierbeiner wieherten, und dem Wagen näherten sich zwei unentwirrbare, formlose Knäuel aus Tieren und Menschen; die Menschen, deren wehende Haare von den Mähnen ihrer Pferde kaum zu unterscheiden waren, sahen aus wie Fabelwesen, wie dreiköpfige Kentauren. Die bezwungenen Pferde hatten zu wiehern aufgehört und stießen nur noch leise Klagelaute aus. Eines wurde als Gabelpferd vor die Deichsel gespannt, ein zweites neben ihm angeschirrt. Zwei Männer zu Pferde nahmen rechts und links vom Wagen Aufstellung, der Postillion sprang auf den ungesattelten Rücken des Pferdes neben dem Gabelpferd, und die Männer, welche die angeschirrten, laut schnaufenden und ungeduldig mit den Hufen scharrenden Pferde mit all ihrer Kraft zurückhielten, ließen auf einmal die Zügel los und sprangen zur Seite. Die wutschnaubenden Pferde rasten wiehernd los, mit dampfenden Nüstern und funkensprühenden Augen. Die zwei Reiter trieben ihre Pferde mit lauten Schreien an, um die angeschirrten Tiere in der Mitte der Straße zu halten und zu verhindern, dass sie in einen der Kanäle stürzten, welche die Straße säumen, und Reiter, Pferde, Wagen und Reisende brausten dahin wie ein Wirbelsturm.
An den nächsten drei Stationen bot sich jedes Mal das gleiche Schauspiel, das wir soeben zu schildern versucht haben; der einzige Unterschied war, dass die Pferde immer wilder und die Männer immer bleicher und zerlumpter waren, je weiter man gelangte.
An der letzten Poststation nahmen die beiden Reisenden zwei Fackeln mit, denn die Laternen ihres Wagens waren erloschen, und weder Postillion noch Pferdeknechte hatten eine Kerze, mit der man sie hätte anzünden können.
Wieder ging es in rasendem Tempo los; bis nach Terracina waren es nur mehr zweieinhalb Meilen.
An einer Stelle, wo der bis dahin ebene Boden zwischen Felsen hügelig zu werden begann, war es den Reisenden, als sähen sie auf einmal Schatten den Graben überqueren und auf die Straße springen.
»Faccia in terra!«, rief eine Stimme.
Und da beide Reisende sich aufrichteten, ertönte ein Schuss, und eine Kugel fuhr zwischen ihnen hindurch und schlug in die Rückseite des Kabrioletts ein; doch ohne sich die Mühe zu machen, den Stutzen anzulegen, schoss der Reisende, der seinen Namen nicht offenbart hatte, wie mit einer Pistole aus der Hüfte.
Ein Schrei durchdrang die Luft, und man hörte, wie ein Körper aufschlug.
Gleichzeitig warfen die zwei Reisenden ihre Fackeln zehn Schritt vor den Wagen, so dass die Straße beleuchtet wurde und man vier oder fünf Männer erblickte, deren einer sich bereits der Zügel der Kutschpferde bemächtigt hatte, während die anderen noch unschlüssig dastanden.
»Lass die Zügel los, du Wicht!«, rief Manhès. Und mit einem Pistolenschuss schickte er den Räuber zu seinem Kameraden in den Straßenstaub.
Drei Schüsse fielen gleichzeitig, eine Kugel riss den Kalpak seiner Husarenmütze ab, eine zweite streifte die Schulter seines Reisegefährten; doch der zweite Schuss des Stutzens warf einen dritten Briganten zu Boden.
Daraufhin suchten die überlebenden Räuber ihr Heil in der Flucht, doch die beiden Reisenden sprangen links und rechts aus dem Wagen, jeder mit einer Pistole in der Hand.
Das Pech der Banditen wollte es, dass der Tag zu dämmern begann und die zwei jungen Männer es als Läufer mit Atalante hätten aufnehmen können.
Manhès schickte den zweiten Schuss seiner Pistole dem Räuber hinterher, dem er nachsetzte, und dieser wankte, wollte einen Dolch aus dem Gürtel ziehen, doch bevor er das Messer aus der Scheide gezogen hatte, hielt der Offizier ihm die Spitze seines Säbels auf die Brust.
Der andere Räuber zog eine Pistole aus dem Gürtel, drehte sich um und feuerte, doch der Schuss verfehlte den Verfolger. Und im nächsten Augenblick spürte er eine eiserne Faust um seine Kehle, während die kalte Mündung einer Pistole seine Schläfe berührte.
»Ich könnte dich jetzt töten«, sagte der Reisende, »aber es beliebt mir, dich lebendig zu fangen und wie einen Bären am Nasenring denen vorzuführen, die noch immer glauben, ihr Banditen wärt mutig und verwegen. Auf, Freund Manhès, kitzeln Sie mit Ihrer Säbelspitze unsere Freunde, die den Boden küssen, damit sie uns helfen, diesen Spitzbuben die Hände zu fesseln.«
In der Tat hatten der Postillion und die zwei Reiter die Aufforderung der Briganten wortwörtlich ausgeführt und sich auf der Straße auf den Bauch gelegt; doch kaum spürten sie die Spitze des Säbels unseres Husarenoffiziers, sprangen sie wie von der Tarantel gestochen auf und riefen: »Was wünschen die signori?«
»Stricke«, erwiderte Manhès, »und fesselt mir diese zwei Spaßvögel ordentlich.«
Die Männer gehorchten; die beiden Banditen wurden in den Wagen gesetzt, und die Pistolen und der Stutzen, welche die Reisenden hingeworfen hatten, wurden aufgesammelt und neu geladen, denn man rechnete jederzeit mit einem weiteren Überfall.
Die zwei Reisenden gingen zu Fuß links und rechts neben dem Wagen; die drei Toten ließ man auf der Straße liegen.
»Ha, meiner Treu, lieber Kamerad«, sagte Manhès, schöpfte mit der Hand etwas Wasser und nahm seinem Reisegefährten die Mütze ab. »Sie baten mich, Ihr Pate zu sein, und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, die Taufe vorzunehmen. Im Namen Bayards, Assas’ und der Tour d’Auvergne taufe ich Sie auf den Namen Leo, denn niemandem stünde dieser Name besser an als Ihnen! Graf Leo, umarmen Sie Ihren Taufpaten!«
Graf Leo umarmte seinen Taufpaten lachend, und beide wanderten weiter nach Terracina als Eskorte ihrer gefesselten Gefangenen, gefolgt von ihrer Eskorte zu Pferde, die vor Angst noch bleicher, zitternder und abgezehrter aussah als zuvor.
104
Fra Diavolo
Kurz vor dem weißen Anxur, wie Vergil es nennt, und dem staubigen Terracina, wie wir es weniger poetisch, aber um nichts weniger treffend nennen wollen, bewachte ein französischer Posten die römische Grenze.
Die Reisenden, die einen leeren Wagen zu Fuß zu begleiten schienen, denn die Banditen hatten sich auf den Wagenboden gleiten lassen, wurden bei ihrem Eintreffen sogleich von Gaffern umringt, und da man sie auf den ersten Blick als Franzosen erkannte, rekrutierten die Neugierigen sich ausschließlich aus den Reihen französischer Soldaten.
Das Rätsel war mit dem ersten Blick in das Wageninnere gelöst.
»Sehr gut«, sagte der befehlshabende Sergeant, »da haben wir zwei Galgenstricke. Offizier, bringen Sie sie nach Neapel, da werden die Herren genug Gesellschaft ihres Schlages vorfinden.«
Die Reisenden fuhren in den Ort und hielten am Hotel zur Post an, vor dem ein Offizier hin und her spazierte. Manhès trat auf ihn zu und sagte: »Hauptmann, ich bin Hauptmann Manhès und Adjutant des Großherzogs von Berg, des Generals Murat.«
»Kann ich Ihnen in irgendeiner Weise zu Diensten sein, lieber Kollege?«, fragte ihn der Offizier.
»Eine halbe Meile von hier entfernt wurden wir von sechs Briganten überfallen; drei haben wir getötet; wenn Sie die Leichen begraben lassen wollen, um der Pestgefahr zu begegnen, finden Sie sie auf der Straße, tot oder so gut wie tot. Wir haben zwei Gefangene gemacht. Hätten Sie die Freundlichkeit, ihnen eine Wache zu geben mit der Empfehlung, ihnen bei der ersten Bewegung das Bajonett in den Bauch zu stoßen, solange wir ein Frühstück einnehmen, das wir dringend benötigen und zu dem wir Sie gerne einladen würden, sollten Sie so gütig sein, daran teilzunehmen? Sie können uns berichten, wie die Dinge hier stehen, und wir können Ihnen berichten, wie die Dinge dort stehen.«
»Meiner Treu«, sagte der Offizier, »dieses Angebot ist zu verlockend, als dass ich widerstehen könnte.«
Sogleich befahl er zwei Soldaten, ihr Gewehr zu ergreifen und sich links und rechts neben dem Wagen zu postieren, und auch der Wink bezüglich des Bajonetts wurde nicht vergessen.
»Und jetzt«, sagte der Offizier, »erweisen Sie mir die Ehre, mich Ihrem Reisegefährten vorzustellen, damit Sie ihm meinen Namen nennen können, mag er noch so unbekannt sein; ich bin Hauptmann Santis.«
Beide betraten die Küche der Herberge, wo sie Leo vorfanden, der damit beschäftigt war, sich unter dem Wasserhahn Gesicht und Hände zu waschen. »Mein Lieber«, sagte Manhès, »ich stelle Ihnen Hauptmann Santis vor, der unsere Banditen von zwei Schildwachen bewachen lassen wird. Hauptmann Santis, ich stelle Ihnen Graf Leo vor.«
»Ein schöner Name, Monsieur«, sagte Hauptmann Santis.
»Und wohlverdient«, sagte Manhès, »das kann ich Ihnen versichern; Sie hätten ihn vorhin erleben müssen: Zwei Schuss, zwei Tote; und der dritte war ihm nicht einmal die Mühe wert, zu zielen; er hat sich in den Kopf gesetzt, ihn lebend zu fassen, und mit dieser kleinen weißen Hand, die Sie sehen, hat er ihn am Hals gepackt und beinahe erwürgt; daraufhin bat der Brigant um Gnade und hat alles gestanden.«
Der Wirt trat näher, um zuzuhören; Manhès ergriff die Zipfelmütze des Wirts an ihrem Zipfel, wirbelte sie um den Finger wie ein spielendes Kind, und als der Wirt seine Mütze zu erhaschen trachtete, sagte er: »Mein guter Mann, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie versäumt haben, uns zu grüßen. Jetzt haben Sie es getan, und Sie können Ihre Baumwollmütze zurückhaben; bereiten Sie uns jetzt das denkbar beste Frühstück zu, und während wir darauf warten, geben Sie uns zwei oder drei Flaschen des berühmten Lacrimae Christi, den kennenzulernen es mich schon so lange gelüstet.«
Der Herbergswirt ging, um seinen Kellermeister in den Keller zu schicken, seine Küchenjungen die Öfen heizen zu lassen und seine Zimmermädchen den Tisch decken zu lassen.
Und während er sich kopfschüttelnd entfernte, hob er die Arme und murmelte: »Questi Francesi! Questi Francesi!«
Manhès brach in Gelächter aus. »Wir sind«, sagte er, »und bleiben ein ewiges Rätsel für diese guten Leute, die nicht begreifen können, dass wir uns wie die Löwen schlagen und wie die Kinder spielen können; sie können nicht begreifen, was unsere Stärke ausmacht. Auf, Kellermeister, bring uns zu unserem Zimmer und lass uns den Lacrymae Christi deines Wirts verkosten; und ich gebe dir mein Wort, dass ich dich zwingen werde, eine Flasche zu leeren, ohne abzusetzen, wenn er nichts taugt.«
Der Kellermeister stieg die Treppe hinauf, und die beiden Offiziere und Graf Leo folgten ihm.
Wie der Zufall es wollte, war der Wein gut.
»Mein Junge«, sagte Manhès, nachdem er den Wein gekostet hatte, »du wirst mir nicht den Verdruss bereiten, diesen Wein, dem ich ein anderes Schicksal zu bereiten gedenke, in deinen Magen zu versenken, aber du wirst mir die Freude machen, diese Münze in deine Tasche zu stecken.«
Und er warf dem Kellermeister ein Geldstück im Wert von drei Francs zu, das dieser in seiner Schürze auffing.
»Und jetzt«, sagte er zu dem Hauptmann, »erzähl uns, was hier vor sich geht.«
»Ich glaube, dass das, was dort vor sich geht, interessanter ist«, erwiderte dieser.
»Die Sache ist die«, sagte Manhès, »dass die Kampagne langsam angegangen wurde. Das Ganze hat einen Monat gedauert; die Kampagne begann am 8. Oktober, die Kapitulation Magdeburgs erfolgte am 8. November; in dieser Zeit fielen dreißigtausend Mann, tausend am Tag; das ist gute Arbeit, nicht wahr? Hunderttausend wurden gefangen genommen; von den fünfunddreißigtausend, die blieben, hat kein Einziger die Oder überquert; die Sachsen flüchteten nach Sachsen, die Preußen verstreuten ihre Waffen überall. Die Preußen hatten eine Armee von hundertsechzigtausend Mann, Napoleon hat sie weggepustet, und sie hat sich in Luft aufgelöst und hat auf dem Schlachtfeld, auf dem wir uns mit ihr gemessen haben, dreihundert Kanonen und genug Fahnen zurückgelassen, um den Invalidendom damit zu tapezieren. Der König von Preußen ist noch immer König von Preußen, nur hat er nun weder ein Königreich noch eine Armee.«
»Nun«, sagte der Offizier, »obwohl die Bourbonen sich nach Sizilien zurückgezogen haben, sind sie noch immer reicher als der König von Preußen, und noch besitzen sie mit Caserta Gaeta, das wir bombardieren und das sie halten, das sich aber früher oder später ergeben muss, und in Kalabrien haben sie eine Armee; dieses Heer besteht aus Zwangsausgehobenen, was nicht hindern wird, dass diese Söldner uns gemütlich einen nach dem anderen erwürgen. Ha! Der große Krieg! Der große Krieg! Nur diesen Krieg gibt es, mein lieber Kollege«, fuhr der Offizier fort, »denn der Krieg, den wir führen, ist nichts anderes als ein abscheuliches Gemetzel, und ich bedaure tapfere Offiziere wie General Verdier und General Reynier, dass sie gezwungen sind, diese Schlächterei zu betreiben.«
Der Wirt unterbrach den Hauptmann in seinen Klagen mit dem Frühstück.
»Die Soldaten dürfen im Dienst nicht trinken«, sagte Graf Leo, »doch die Gefangenen müssen allmählich verschmachten; bringen Sie ihnen einen Fiasko mit Wein und lassen Sie sie trinken, ohne ihre Hände zu entfesseln. Die Soldaten aber mögen unbesorgt sein! Sobald sie abgelöst werden, sollen sie ihre Belohnung erhalten. Und sagen Sie dem unverletzten Gefangenen, dass ihm der Wein von dem Reisenden spendiert wird, der sein Leben verschont hat; geben Sie auch unserem Postillion und unserer Eskorte aus den Pontinischen Sümpfen zu essen und zu trinken, selbst wenn sie für meinen Geschmack ein wenig zu eilfertig dem Befehl gehorcht haben, sich mit dem Gesicht nach unten zu Boden zu werfen. Dann lassen Sie anspannen, und geben Sie uns zwei verlässliche Postpferde als Eskorte mit.«
Als das Frühstück beendet war, tranken die drei Anwesenden auf Frankreich, reichten einander die Hand und gingen hinunter.
Leo dankte den zwei Schildwachen, sagte ihnen, dass ein üppiges Frühstück ihrer im Wirtshaus harre, und er und Manhès bestiegen ihre Pferde und machten sich zusammen mit einem neuen Postillion, der versprach, alles Menschenmögliche zu tun, im Galopp auf den Weg nach Capua, wo sie zum ersten Mal die Pferde wechseln sollten.
An Gaeta kamen die Reisenden in ebendem Augenblick vorbei, als man den Leichnam General Vallongues zurückbrachte, dem eine Kanonenkugel den Kopf abgerissen hatte; sechzig Artilleriegeschütze, Mörser und Vierundzwanzigerkanonen beschossen die Zitadelle.
Der Postillion hatte versprochen, die Pferde anzutreiben, und er hielt sein Wort; um acht Uhr morgens war Capua erreicht, und um Viertel nach elf Uhr betrat man Neapel.
Die Stadt der Sonne, die so lärmend und überschwänglich ist, dass man bereits aus einer Meile Entfernung ihre Geräusche vernimmt, wirkte an jenem Tag noch närrischer als sonst; alle Fenster waren mit den neuen neapolitanischen Farben geschmückt; auf den Straßen drängten sich die Leute, die nicht allein aus der Stadt stammten, sondern auch aus den benachbarten Dörfern gekommen waren.
Sobald der Wagen der zwei Reisenden in diesen Malstrom geraten war, blieb ihm und den beiden Reitern, die ihm folgten, nichts anderes übrig, als dem Strom zu folgen. Und der führte sie zur Piazza del Mercato, wo ein riesengroßer Galgen von achtzehn Fuß Höhe errichtet war. Ursache des Volksauflaufs war eine bevorstehende Hinrichtung, und der Name Fra Diavolo, der von allen Seiten erscholl, erhellte die zwei Reisenden über die Person des armen Sünders, dessen Hinrichtung vorbereitet wurde und dessen Bedeutung die Zuschauermenge bezeigte, die sich eingefunden hatte, um seinem Sterben beizuwohnen.
Während der Wagen mit den Gefangenen und ihrer Eskorte die Piazza del Mercato von der Piazza del Carmine aus erreichte, kam der Karren mit dem zum Tode Verurteilten über die Gasse mit dem Namen »de Sospiri del Abisso«, der sich trefflich als »Seufzer aus dem Abgrund« wiedergeben lässt.
Dieses Gässchen heißt so, weil der Verurteilte, der es überquert, zum ersten Mal den Galgen oder das Schafott erblickt, die Werkzeuge seiner Hinrichtung.
Und nur in den seltensten Fällen stößt der Verurteilte bei diesem Anblick keinen Seufzer aus.
Beim Anblick des Fra Diavolo, des Banditen, den man für unfassbar gehalten hatte und der wider alle Erwartungen dingfest gemacht worden war, ertönten von allen Seiten des Platzes laute Unmutsbekundungen, und sogar die gefesselten Briganten erhoben sich in dem Kabriolett.
Im selben Augenblick kamen Manhès und Graf Leo herbei, doch mit der blutrünstigen Munterkeit, die jedem Volk eigentümlich ist, ganz besonders aber dem neapolitanischen Volk, sagte der Postillion: »Lassen Sie die armen Teufel ruhig zusehen; was sie zu sehen bekommen, wird ihnen eine nützliche Lehre sein.«
Und er machte es sich auf seinem Pferd so bequem wie möglich, um das Schauspiel in aller Behaglichkeit zu genießen.
Wir wollen sehen, ob derjenige, der ganz Neapel so aus dem Häuschen brachte, seinen Ruf auch verdient hatte.
105
Die Jagd
Fra Diavolo ist in Frankreich bekannter durch die Operette der Herren Scribe und Auber als durch den langen Briefwechsel, den er zwischen Kaiser Napoleon und seinem Bruder König Joseph veranlasst hatte.
Er hieß Michele Pezza; er war in dem Dorf Itri geboren als Sohn einer armen Tagelöhnerfamilie, die mit zwei Maultieren einen bescheidenen Ölhandel mit den Nachbardörfern betrieb; seine Landsleute hatten ihm den Spitznamen Fra Diavolo gegeben, weil er die Gerissenheit des Mönchs mit der Bosheit des Teufels vereinigte.
Er hatte Geistlicher werden sollen, doch nachdem er den Priesterrock weggeworfen hatte, wurde er Lehrling bei einem der Wagner, die Packsattel für Maultiere und Pferde herstellen.
Nach einer lautstarken und heftigen Auseinandersetzung mit seinem Meister suchte er das Weite, und am Tag darauf tötete er ihn mit einem Gewehrschuss, als der Meister mit Gästen in seinem Garten speiste.
Diesen Mord beging der junge Mann im Jahr 1797, als er neunzehn Jahre alt war.
Wie stets in solchen Fällen flüchtete er in die Berge.
Als 1799 die Revolution nach Italien kam und Championnet das neapolitanische Territorium besetzte, übte er seit zwei Jahren das Gewerbe des Straßenräubers aus.
Daraufhin kam ihm die Erleuchtung, dass er Anhänger der Bourbonen sei und Royalist und infolgedessen zum Sanfedista werden müsse, um seine Untaten zu sühnen und sich der Verteidigung des gottgegebenen Rechts zu widmen. Er war somit einer der Ersten, die dem Ruf König Ferdinands folgten, sich gegen die Franzosen zu erheben.
Zuerst sammelte er seine drei Brüder um sich, ernannte sie zu seinen Leutnants, verdreifachte, vervierfachte, verfünffachte seine Bande mit Freiwilligen und bewies von Anfang an seinen Patriotismus mit den Taten, die er auf der Landstraße zwischen Rom und Neapel vollbrachte.
Seine Hinrichtung durch Erhängen war für die gefangenen Banditen umso interessanter, als er seine Laufbahn dort begonnen hatte, wo sie gefasst worden waren, denn kaum eine Meile von Itri entfernt hatten sie den Reisenden aufgelauert, von denen sie überwältigt worden waren.
Auf seinem ersten Feldzug tat Fra Diavolo sich durch mehrere Morde hervor: Der Adjutant General Championnets namens Claye, zu General Lemonie entsandt, war so unvorsichtig, einen Führer zu nehmen, den er nicht kannte, und dieser Führer brachte ihn mitten in die Bande Fra Diavolos, der ihn in Stücke hauen ließ.
Nach dem Angriff auf die Brücke über den Fluss Garigliano wurden Adjutant Gourdel, ein Bataillonschef der leichten Infanterie und ein weiteres Dutzend Offiziere und Soldaten von Fra Diavolo und seiner Bande auf dem Schlachtfeld überwältigt, an Bäumen mit grünem Laub festgebunden und langsam geröstet, während die Bauern der benachbarten Dörfer, Männer, Frauen und Kinder, diese Scheiterhaufen umtanzten und riefen: »Es lebe Fra Diavolo!«
Championnet, der mit Fra Diavolo zu tun gehabt hatte und dem es fast gelungen wäre, dessen Räuberbande zu vernichten, bevor sie ihm abermals entkam, räumte ohne zu zögern ein, dass dieser Räuberhauptmann ihm mehr zu schaffen gemacht hatte als manch ein General, der reguläre Streitkräfte befehligte.
Dies führte dazu, dass Fra Diavolo König Ferdinand und Königin Caroline nach Sizilien folgte, wo sie die Reaktion vorbereiteten, und aus ihrem erhabenen Mund seine Instruktionen erhielt, was hieß, dass er nicht nur kein Niemand war, sondern jemand, den man als Freund empfing. König und Königin bereiteten ihm einen wahrhaft königlichen Empfang. Der König verlieh ihm das Hauptmannspatent, und die Königin beschenkte ihn mit einem kostbaren Ring, der zwischen zwei Saphiren seine Initialen aus Diamanten aufwies.
Fra Diavolos Sohn, Cavaliere Pezza, bewahrt diesen Ring heute noch andächtig auf, falls er nicht gestorben ist; als sein Vater den Galgen bestieg, hinterließ er ihm seinen Adelstitel, und kraft des Bündnisses zwischen Vergangenheit und Gegenwart erhält der Sohn heute noch von König Victor Emmanuele die Pension, die König Ferdinand seinem Vater gewährt hatte.
Fra Diavolo kehrte in seine Heimat zurück und ging zwischen Capua und Gaeta mit einer Bande von vierhundert Mann an Land.
Während er der königlichen Sache unschätzbare Dienste erwies, ließ Fra Diavolo sich zu solchen Exzessen hinreißen, dass Kardinal Ruffo ihm verbot, Gaeta zu betreten, und es für ratsam befand, dies König Ferdinand mitzuteilen.
Der König schrieb eigenhändig zurück: »Ich heiße gut, dass Sie Fra Diavolo verwehrt haben, Gaeta zu betreten, wie er es wünschte; ich stimme mit Ihnen überein, dass er ein Anführer von Straßenräubern ist, doch andererseits sehe ich mich genötigt, Ihnen zu gestehen, dass er mir gute Dienste geleistet hat; man muss ihn benutzen und darf ihn nicht vergrämen, doch zugleich muss man ihn mit wohlgesetzten Worten davon überzeugen, dass er seine Leidenschaften zügeln und seinen Männern Disziplin auferlegen muss, wenn er sich in meinen Augen wahre und beständige Verdienste erwerben will.«
Doch mochten die Exzesse, denen Fra Diavolo sich hingab, ihm diesen väterlichen Tadel seitens Ferdinands einbringen, schadeten sie seinem Ansehen in Carolines Augen nicht im Geringsten, denn nach der erfolgten Rückeroberung Neapels geruhte sie, ihm in einem handschriftlichen Brief zu verkünden, dass er zum Obersten ernannt worden war. Dem Brief, der ihm diese Beförderung verkündete, war ein Armband beigelegt, in das eine Haarlocke der Königin eingeflochten war; zudem wurde er zum Herzog von Cassano ernannt, verbunden mit einer lebenslänglichen Rente von dreitausend Dukaten (dreizehntausendzweihundert Francs), und mit diesem Titel und im Rang eines Brigadekommandeurs sehen wir ihn 1806 und 1807 die Franzosen bekriegen.
Die Usurpation des Throns der Bourbonen durch König Joseph bot Fra Diavolo eine ausgezeichnete Gelegenheit, König Ferdinand und Königin Caroline neue Beweise seiner Treue zu liefern.
Er reiste nach Palermo, wurde von der Königin empfangen, die ihn mit größten Huldbezeigungen in die Abruzzen zurückschickte; doch ebenso wie der König vergaß sie, ihm aufzutragen, über die Disziplin seiner Soldaten zu wachen.
Fra Diavolo befolgte die Anweisungen der Königin Caroline so gewissenhaft, dass König Joseph zu dem Schluss gelangte, es sei höchste Zeit, sich von einem Gegner zu befreien, der vielleicht weniger gefährlich war als Lord Stuart und dessen Engländer, zweifellos aber unbequemer.
Daraufhin ließ der König Major Hugo zurückrufen.
In die Tapferkeit und die Treue dieses Majors setzte König Joseph uneingeschränktes Vertrauen; Hugo war ein Mann wie aus der Feder Plutarchs. Seine Loyalität war ihn teuer zu stehen gekommen. Er hatte unter Moreau gedient, schätzte ihn, verehrte ihn, bewunderte ihn. Als Bonaparte den Thron bestieg, wurden Glückwünsche an Bonaparte aufgesetzt, und Hugo unterzeichnete sie wie die Übrigen; als man ihn jedoch dazu bringen wollte, Lügengeschichten über Moreau zu unterschreiben, die Moreau in den Prozess gegen Cadoudal verwickeln sollten, weigerte er sich rundheraus.
Bonaparte erfuhr von dieser Weigerung, und Napoleon entsann sich dessen.
Jeder weiß, wie nachtragend Bonaparte sein konnte. Major Hugo erfuhr eines Morgens, dass er zu der Armee eingeteilt war, die nach Neapel aufbrach, das heißt aus den Augen des Kaisers entfernt. Der Kaiser aber sah und belohnte nur jene, die in dem Kreis kämpften, den sein Blick erfasste.
Major Hugo konnte sich einstweilen das spanische Wort zur Devise nehmen, das seinem Sohn eine Zeit lang als Signatur diente: hierro (»Eisen«). Nach Obigem erübrigt es sich wohl zu sagen, dass der Major schon damals der Vater unseres großen Dichters Victor Hugo war.
Sein Sohn hat ihn in wenigen Zeilen voller Mitleid und Zorn verewigt:
Mein Vater, dieser Held mit mildem Lächeln,
Gefolgt von dem Husaren, den er liebte
Für dessen Tapferkeit und dessen Körpergröße,
Ritt eines Abends nach einem Gefecht
Über das Schlachtfeld voller Toten in der Dämmerung,
Und ihm war, als vernähm er einen leisen Laut.
Ein Spanier der geschlagenen Armee, die flüchtete,
Kroch blutend, röchelnd, keuchend und fast tot
Über die Walstatt und rief flüsternd: »Wasser, Wasser!«
Mein Vater reichte mitleidig seinem treuen Husaren
Die Feldflasche mit Rum von seinem Sattel
Und sprach: »Gib diesem armen Mann zu trinken.«
Und als der Reiter sich zu dem Verletzten beugte,
Griff dieser, der ein Mohr war, zu seiner Pistole,
Zielte auf meines Vaters Stirn und rief: »Caramba!«
Der Schuss verfehlte ihn um Haaresbreite,
Nahm seinen Hut mit, und sein Pferd bäumte sich auf,
»Gib ihm trotzdem zu trinken«, sprach mein Vater.
106
Major Hugo
König Joseph ließ also wie gesagt Major Hugo nach Portici kommen; er kannte ihn seit Langem und brachte ihm die Wertschätzung entgegen, die er verdiente; zugleich aber flößte Napoleon aller Welt und sogar seinen Brüdern so große Furcht ein, dass König Joseph nichts für den Mann zu tun wagte, der die Stirn besessen hatte, Napoleons Missfallen zu erregen, sondern gewissermaßen höherer Gewalt nachgeben wollte, indem er Major Hugo Gelegenheit gab, sich auszuzeichnen und den Mann dingfest zu machen, an dem die Tapfersten und die Geschicktesten sich bislang die Zähne ausgebissen hatten.
Erinnern wir uns, dass der berühmte MacDonald fünf Jahre lang in Ungnade war, weil er mit Moreau befreundet war und in Verdacht stand, dessen republikanische Gesinnung zu teilen, und dass Prinz Eugène in Rom einen Patzer nach dem anderen begehen musste, bis Napoleon sich des Generals entsann und ihn zum Oberkommandierenden ernannte, wofür dieser sich revanchierte, indem er in der Schlacht von Wagram die Armee rettete und wie ein Held kämpfte.
Der König befahl Major Hugo, eine Kolonne aus Männern zu bilden, die er einzelnen Infanterieregimentern und der königlichen Garde, dem afrikanischen Korps, der korsischen Legion und der ersten und zweiten neapolitanischen Legion entnehmen sollte; an der Spitze dieser Kolonne von acht- bis neunhundert Mann sollte er Fra Diavolo verfolgen, ohne dem Gejagten eine Sekunde Atempause zu lassen.
Geschütze und fünfzig Dragoner vervollständigten die Kolonne.
Fra Diavolo hatte sich zu einem regelrechten Partisanenanführer entwickelt; unter seinem Befehl standen an die fünfzehnhundert Mann, und das Gebiet, auf dem unsere Leute ihm nachsetzten, umfasste die Berge zwischen dem Meer, dem Kirchenstaat und dem Fluss Garigliano.
Major Hugos Instruktionen besagten, dass er den Fluss überqueren solle, den Gegner auffinden und nicht mehr aus den Augen lassen, bis er ihn vernichtet hätte; strategische Vorkehrungen waren getroffen worden, um die Briganten daran zu hindern, das Gebiet, auf dem sie sich befanden, zu verlassen. General Duhesme hielt mit seiner Division die römischen Staaten besetzt; General Goullus bewachte mit einer Brigade das Soratal; Truppen waren gestaffelt am Fluss Garigliano aufgestellt, und General Valentin, der im Gebiet von Gaeta den Oberfehl hatte, sollte verhindern, dass Fra Diavolo auf dem Seeweg das Land verließ.
Man sieht, dass Fra Diavolo als ernst zu nehmender Gegner eingestuft wurde: Drei Generäle hielten ihn eingekreist, und ein Major sollte ihn angreifen.
Major Hugo schickte seine zwei Kanonen, die seine Operationen nur erschwert hätten, unter dem Schutz der Eskorte zurück; sollte er seine Dragoner benötigen, würde er sie rufen lassen, und sie würden sofort zu ihm eilen.
Doch die französischen Offiziere hatten es mit einem Widersacher zu tun, der ihnen auf unwegsamem Gelände durchaus die Stirn bieten konnte. Kaum hatte Fra Diavolo erkannt, mit welchen Maßnahmen man ihn einkreisen wollte, suchte er nicht etwa den Kampf mit der Kolonne Major Hugos, sondern unternahm einen Überraschungsangriff auf die Nationalgarde von San Guglielmo, überrumpelte ein Batallion, das unterhalb von Arce lagerte, und marschierte auf Cervaro zu.
Major Hugo setzte ihm nach und marschierte eine Stunde nach den Partisanen in Cervaro ein.
Hinter diesem wilden und waldigen Dorf teilte der Major seine Truppe, denn er vermutete, dass der Gegner sich in dem Dorf verschanzt hatte; der eine Teil der Truppe durchkämmte die Berge, der andere durchsuchte das Dorf.
Der Major hatte sich nicht getäuscht: Schon bald verkündeten Schüsse, dass der Gegner gefunden war, doch der Schusswechsel war zwar heftig, aber von kurzer Dauer. Mutmaßend, dass die erschöpften Franzosen nicht mit ihm Schritt halten konnten, war Fra Diavolo den Berg hinaufgestürmt und hatte die Gegner hinter sich gelassen. Die hereinbrechende Nacht, die Gefahr, sich auf unbekanntem Terrain in den Wäldern zu verirren, und die Notwendigkeit, sich zu verproviantieren, nötigten Major Hugo, gegen zehn Uhr abends die Verfolgung abzubrechen und nach Cervaro zurückzukehren.
Doch gegen drei Uhr morgens waren der Major und seine Soldaten wieder auf den Beinen und schwärmten diesmal in drei Kolonnen aus. Fra Diavolo hatte in den Schluchten von Acquafondata eine Nachhut hinterlassen, die diesen Durchgang gegen die Franzosen verteidigen sollte. Major Hugo stellte sich an die Spitze der neapolitanischen Grenadiere der zweiten Legion, die bei diesem Gefecht ihre Feuertaufe erlebten, und schlug mit ihnen die Nachhut in die Flucht; doch wieder brach die Nacht herein, von Wolkenbrüchen begleitet; die Franzosen mussten wohl oder übel Unterschlupf suchen und in einer kleinen verlassenen Meierei übernachten; bei Tagesanbruch machten sie sich wieder auf den Weg.
Fra Diavolo, der alle Wege kannte, folgte keinem; er benutzte Trampelpfade und wechselte alle naselang die Richtung. Um ihm auf der Fährte zu bleiben, waren die Franzosen auf die Hilfe der Schäfer angewiesen, denn gegen gute Bezahlung zeigten diese den Soldaten die kürzesten Wege, die oft nichts anderes waren als Flussbette, deren Windungen man folgen oder deren Wasserfälle man erklimmen musste; diese Flussbette waren so steinig, dass die Soldaten immer wieder innehalten mussten, um ihre Stiefel auszuziehen und barfuß weiterzugehen.
Diese hartnäckige Verfolgungsjagd währte inzwischen acht Tage; man war noch nicht in Berührung mit dem Feind gekommen, doch man war ihm dicht auf den Fersen; die Soldaten ruhten sich kaum noch aus, aßen im Gehen und schliefen im Stehen. Major Hugo sandte scharenweise Spione aus, mit denen die Polizei ihn unterstützte, und überzog das Land mit Eilboten, die er zu den Gouverneuren, Präfekten und Bürgermeistern entsandte; er wusste Tag für Tag, wo Fra Diavolo war und was er tat, doch er hatte ihn noch nicht eng genug im Schraubstock, um sich mit dessen Bande einen Kampf zu liefern.
Doch ein französisches Bataillon, das sich den Abruzzen näherte, ohne dass Fra Diavolo davon wusste, erfuhr, dass er sich mit seiner Bande im Wald nahe einem Dorf aufhielt, das es durchquerte; das Bataillon machte halt, nahm sich einen Führer, überfiel die Banditen und tötete an die hundert Mann.
Major Hugo hörte die Gewehrschüsse und eilte mit seiner Kolonne herbei. Fra Diavolo, der sich umzingelt sah und sich von einem Gefecht nichts erhoffen konnte, musste sich mit einer List retten.
Er versammelte seine Leute. »Teilt euch auf«, sagte er zu ihnen, »bildet kleine Einheiten von etwa zwanzig Mann; jede dieser Einheiten soll so tun, als wäre ich bei ihr, und auf die ihr am sichersten erscheinende Weise den Seeweg suchen. In Sizilien wollen wir uns wieder zusammenfinden.«
Gesagt, getan; die Bande teilte sich in Grüppchen auf, die sich wie Rauch oder Nebel in alle Richtungen zerstreuten; Major Hugo wurde von allen Seiten gemeldet, man habe Fra Diavolo gesehen, was ihn in größte Ratlosigkeit stürzte, denn die Berichterstatter wollten den Gesuchten ebenso in die Abruzzen fliehen gesehen haben wie zum linken oder rechten Ufer des Biferno, nach Apulien ausweichen oder die Flucht nach Neapel antreten.
Nach kurzem Überlegen erriet Major Hugo die Kriegslist des Banditen: Es war die gleiche List, deren sich Marschall von Rantzau bedient hatte.
Aber in welchem der Grüppchen war Fra Diavolo zu finden?
Um dies zu ergründen, musste man sie zwingen, allesamt die gleiche Richtung einzuschlagen. Und deshalb ließ Major Hugo am rechten Ufer des Biferon neapolitanische Truppenkontingente vorrücken, ließ die korsische Legion aus Isernia kommen und machte sich mit der königlichen Garde und dem afrikanischen Korps nach Cantalupo und zum Bojanotal auf.[10]
107
Der letzte Kampf
Als die Verfolger die Grafschaft Molise erreichten, sah die Landschaft aus, als hätte eine unvorstellbare Katastrophe sie heimgesucht, denn einige Zeit zuvor hatte ein Erdbeben die Provinz erschüttert; die geflohenen Bewohner kehrten nach und nach in ihre zerstörten Häuser zurück; andere hatten in hastig errichteten Baracken Schutz gesucht; doch Major Hugo, der schon oft mit ihnen zu tun gehabt hatte, wusste, wie gutwillig und gastfreundlich sie waren; er zweifelte keinen Augenblick lang daran, dass sie alles tun würden, um ihm zu helfen, und die Bauern, die er als Kuriere beschäftigte, waren ohne Ansehen der Gefahr Tag und Nacht unermüdlich unterwegs, um Fragen zu überbringen und Antworten zurückzubringen. Überall boten sich die Nationalgardisten als Führer und als Kundschafter an, ohne sich darum zu scheren, dass ihre Häuser dem Erdboden gleichgemacht waren oder welches Unglück ihnen widerfahren war; dies erstaunte Fra Diavolo nicht wenig, und es erschreckte ihn zu sehen, dass seine Landsleute zu seinen Feinden wurden.
Einer unbezwingbaren Macht gehorchend, sah der Bandit sich genötigt, nicht dem eigenen Plan zu folgen, sondern dem Willen seines Widersachers, und schon bald erfuhr Major Hugo, dass die Briganten, denen seine Truppen von allen Seiten nachsetzten, in das Bojanotal hinunterstiegen.
Das Wetter war abscheulich; Bäche und Flussläufe strömten wild und unberechenbar. Bei jedem Schritt traf man auf einen Wasserlauf, den es zu überqueren galt, und oft reichte das Wasser den Soldaten bis zum Gürtel. Der Biferno, der normalerweise nicht mehr als zwei Fuß Wasser führt, war so gestiegen, dass Fra Diavolo in der Falle gesteckt hätte, wenn die Nationalgarde von Cinchiaturo rechtzeitig eingetroffen wäre, um die Brücke zu halten, denn den Fluss konnte man unmöglich durchwaten.
An einem Tag, der aus Regenguss um Regenguss bestand, trafen die Soldaten des afrikanischen Korps und die Männer Fra Diavolos zwischen Bojano und dem Dorf La Guardia aufeinander; die Soldaten Major Hugos, von ihm befehligt, kämpften gegen eine vierfache Übermacht. Glücklicherweise stießen die anderen Kolonnen, die Fra Diavolo verfolgten, eine nach der anderen hinzu und mischten sich in die Kampfhandlungen; doch die anhaltenden Regenstürme führten dazu, dass nur noch mit Gewehrkolben, Bajonetten und Dolchen gekämpft wurde.
Dieser scheußliche Kampf oder eher dieses gewaltige Duell, in dem jeder seinen Gegner tötete oder von ihm getötet wurde, währte länger als zwei Stunden; nach wahren Wundern an Mut und Hartnäckigkeit konnten die Banditen zuletzt zerstreut werden; von den fünfzehnhundert Männern waren nur hundertfünfzig übrig, und diese überquerten die Brücke von Vinchiaturo und flohen das Tal von Tammaro bis nach Benevent entlang; die Soldaten machten etwa dreißig Gefangene, und tausend Gefallene bedeckten das Schlachtfeld oder ertranken in den reißenden Wasserläufen. Hätte Major Hugo seine Dragoner bei sich gehabt, wäre die ganze Bande zersprengt und Fra Diavolo gefasst worden.
Auf dem Weitermarsch näherte sich einer der Gefangenen dem Major und bot an, ihm im Tausch gegen seine Freiheit die Stelle zu zeigen, wo zehntausend Dukaten beziehungsweise fünfundvierzigtausend Francs aus dem Besitz der Banditen vergraben waren.
Major Hugo ging auf diesen Handel nicht ein; seine Aufgabe war nicht, Beute zu machen, sondern Fra Diavolo zu verfolgen.
Als die Vorhut der Kolonne, die Fra Diavolo auf den Fersen war, den Calore erreichte, musste man feststellen, dass der Fluss bis zu einer Höhe von fünfzehn, sechzehn Fuß gestiegen war; die Kolonne kehrte nach Benevent zurück, wo sie Major Hugo mitteilte, auf welches Hindernis sie gestoßen war. Fra Diavolo gewann so einen Vorsprung von vierundzwanzig Stunden gegenüber seinen Verfolgern, die nun befürchten mussten, dass es ihm gelingen würde, das Ufer zu erreichen und nach Capri überzusetzen, wenn sie seine Fährte verloren.
Major Hugo ließ Schuhe an seine Leute verteilen und zwang sie, trotz vereinzelten Murrens eine Stunde nach Mitternacht wieder aufzubrechen.
In Montesarchio erfuhr er, dass Fra Diavolo sich zwischen seinen Kolonnen hindurchgeschlängelt und den jenseitigen Abhang des Monte Vergine erreicht hatte.
Montesarchio liegt an der Straße von Neapel nach Benevent; an dieser Straße befinden sich die berühmten kaudinischen Pässe, unter denen vorbeizuziehen die römische Armee im Krieg gegen die Samniten gezwungen wurde. Der Engpass, den sie bilden, wird auf der einen Seite vom Monte Taburno und auf der anderen vom Monte Vergine abgeschlossen, der seinen Namen einem prachtvollen Kloster am gegenüberliegenden Hang verdankt; doch nach Benevent hin sind die Berge so steil, dass nur Hirten auf der Suche nach ihren Ziegen sich in diese Höhen wagen.
Major Hugo ließ seine Soldaten den unbesteigbaren Berg erklettern; so holte er nicht nur die vierundzwanzig Stunden Vorsprung des Gejagten auf, sondern hatte sogar die Chance, ihn einzuholen; obwohl die Führer nichts unversucht ließen, den Major von seinem Vorhaben abzubringen, beharrte er darauf, und bei Tagesanbruch begann er mit der Besteigung; als Führer dienten nur Hirten, die als Einzige bereit waren, an einem solchen Wagnis teilzunehmen; Hugos Soldaten folgten murrend, doch sie folgten.
Den immensen Schwierigkeiten dieser Bergbesteigung gesellte sich feiner Schneefall hinzu, der den Pfad, der über nacktes Felsgestein führte, noch unwegsamer machte. Das Glück wollte es, dass verstreut Bäume wuchsen, an deren Zweigen man sich festhalten konnte. Und nach drei Stunden unvorstellbarer Mühen gelangten die Soldaten, in denen die Erschwernisse der Bergwanderung Ehrgeiz geweckt hatten und die nun über ihre Stürze und ihr Stolpern lachen konnten, auf ein Hochplateau im Nebel, dessen Lage sich nicht einmal erraten ließ.
Doch kaum hatten sie ihre schneegetränkte Kleidung geschüttelt, fuhr ein Windstoß über die Gipfel, zerriss den Wolkenschleier, der sie einhüllte, und als höbe sich ein Vorhang im Theater, erblickten sie den Golf von Neapel in all seiner Pracht und Größe.
Der Berg war erstiegen. Froh, doch schweigend machte sich die Kolonne daran, in Richtung Aletta hinunterzusteigen, als sie von Musketenfeuer überrascht wurde; der Zufall hatte sie mitten in Fra Diavolos Bande geführt.
Fra Diavolo wäre nur zu gern geflohen, ohne zu kämpfen, doch das war ausgeschlossen: Die korsische Vorhut befand sich bereits im Handgemenge mit seinen Männern; die anderen Abteilungen eilten herbei, als sie die Schüsse hörten, und stürzten sich mit gesenktem Kopf in den Kampf, denn sie wussten, dass die Entscheidung bevorstand; doch auch diesmal gelang es Fra Diavolo, sich mit dreißig seiner Männer den Verfolgern zu entziehen, die seit zwei Nächten nicht geschlafen hatten. Hundertzwanzig Briganten blieben zurück und wurden entweder gefangen genommen oder warfen ihre Waffen weg und flohen, was den Major nicht weiter kümmerte, denn der Einzige, um den es ihm ging, war ihr Anführer. Sobald dieser gefasst wäre, bliebe von der Bande nichts übrig, denn die Männer, die unter ihm gedient hatten, hätten sich niemals einem anderen untergeordnet.
Fra Diavolo, der durch die lichte Bewaldung floh, die das Durchkommen nicht hinderte, und der mit der Gegend völlig vertraut war, konnte noch immer hoffen zu entkommen, doch dafür musste er die Straße nach Apulien erreichen und ihr eine Zeit lang folgen.
Bald war es so weit.
Eine tiefe Schlucht auf der anderen Straßenseite verhinderte dort das Weiterkommen; hinter dem Gejagten waren die Soldaten des Majors, und vor sich erblickte er plötzlich ein französisches Kavallerieregiment auf Patrouille, das ihm entgegenkam: Ging er weiter, musste er auf das Regiment treffen, ging er zurück, schnitten ihm die Verfolger den Weg ab, wenn sie die Straße erreichten, und jenseits der Straße gähnte der Abgrund.
Seine Gefährten blieben zitternd stehen, und ihre ängstlichen Blicke schienen zu besagen: »Nur du kannst uns aus dieser Klemme retten, und zwar mit einer der teuflischen Listen, die dir den Namen Fra Diavolo eingebracht haben.«
Und wahrhaftig ließ sein Einfallsreichtum ihn auch in dieser schwierigen Lage nicht im Stich.
»Bindet mir schnell die Hände hinter dem Rücken«, sagte er, »und tut das Gleiche mit meinem Leutnant.«
Die Briganten starrten ihn an, sprachlos vor Verblüffung.
»Beeilt euch! Beeilt euch!«, rief Fra Diavolo. »Wir dürfen keine Zeit verlieren!«
Der Gehorsam siegte: Da sie keine Stricke hatten, nahmen sie ihre Taschentücher und banden den beiden Männern die Hände.
»Und jetzt«, sagte Fra Diavolo, »marschieren wir frech dem Kavallerieregiment entgegen, und wenn ihr gefragt werdet, wer wir sind, antwortet ihr, wir seien zwei Banditen aus der Räuberbande des Fra Diavolo, die ihr gefangen genommen habt und nach Neapel bringt, um die Belohnung zu kassieren.«
»Und wenn sie euch selbst hinbringen wollen?«
»Dann lasst ihr sie gewähren und verzieht euch unter lautem Gezeter ob des Unrechts, das sie euch antun.«
»Aber Sie, Hauptmann?«
»Pah! Man stirbt nur einmal.«
Sein Befehl wurde ausgeführt. Fra Diavolo und sein Leutnant setzten mürrische Arme-Sünder-Mienen auf, und die vorgebliche Bürgerwehr wanderte munter den Soldaten entgegen, die sie anhielten und ausfragten. Als Neapolitaner ist man der geborene Improvisator, und einer der Briganten ergriff das Wort und erzählte, wie sie die Gefangenen gemacht hatten. Die Reiter spendeten ihm Beifall, und auf diese Weise gelangte das Trüppchen allmählich an das Ende des Regiments, bis man sich voneinander verabschiedete und einander eine gute Reise wünschte.
Dreihundert Schritt hinter der Nachhut des Regiments stießen die Banditen auf einen Pfad, der die Straße kreuzte und in eine Lichtung mündete. Fra Diavolo und sein Leutnant ließen sich losbinden, und Fra Diavolo befahl, auf das Reiterregiment zu schießen.
Die Soldaten wussten nicht, wer ihnen da entwischt war; sie merkten nur, dass man sich über sie lustig machte; doch da sie zu Pferde waren und die Gegend nicht kannten, dachten sie nicht daran, in beinahe undurchdringlichem Gebüsch Männer zu verfolgen, die zu Fuß waren und das Land wie ihre Westentasche kannten; wie sehr man sie zum Besten gehalten hatte, wurde ihnen erst klar, als sie auf der Straße den Soldaten Major Hugos begegneten, die ihnen sagten, mit wem sie es zu tun gehabt hatten.
Die Jagd ging weiter. Am Abend erreichte Major Hugo mit seiner Kolonne Lettere in der Nähe von Castellamare. Dort erfuhr er, dass in einiger Entfernung Lagerfeuer gesichtet worden waren, und es kam zu einem weiteren Scharmützel, in dessen Verlauf die meisten der Männer getötet wurden, die dem Räuberhauptmann geblieben waren; er selbst wurde verwundet und rettete sich nach La Cava. Da er fast niemanden mehr hatte, musste man ihn nicht mehr fürchten, doch zu befürchten blieb, dass er ein Boot fand, mit dem er nach Capri oder nach Sizilien übersetzen konnte, um dort eine neue Bande ins Leben zu rufen.
Das Meer war seine letzte Hoffnung. Da er annahm, allein eher fliehen zu können, verabschiedete er seine letzten Gefährten.
Auf seinen Kopf war eine Belohnung von sechstausend Dukaten ausgesetzt (achtundzwanzigtausend Francs). Die Nationalgarden der Umgebung und die französischen Truppen waren sämtlich alarmiert; so kam es, dass Fra Diavolo im Königreich beider Sizilien beinahe ebenso viele Feinde hatte, wie es dort Männer gab, die es nach sechstausend Dukaten Belohnung gelüstete.
Gegen Ende November konnte er am Fuß der Berge nicht mehr im Freien lagern, da es nachts sehr kalt war und Schnee den Boden bedeckte; zudem hatte er bei einer erneuten Auseinandersetzung mit der Bürgerwehr eine zweite Verwundung davongetragen und war sehr geschwächt; seit neunundzwanzig Tagen war er auf der Flucht vor den Franzosen; er stand im wahrsten Sinn des Wortes kurz vor dem Verhungern, denn seit Aletta hatte er nichts mehr gegessen. Die zehntausend Dukaten, die am Berghang vergraben waren und die einer seiner Männer Major Hugo angeboten hatte, hätte er sicherlich mit Freuden gegen ein Stück Brot und eine Nacht Schlaf eingetauscht.
Eine Stunde oder zwei wanderte er aufs Geratewohl dahin; die neue Gegend war ihm völlig unbekannt. Gegen neun Uhr abends fand er sich vor der Hütte eines Schäfers wieder; durch ein Astloch nahm er das Innere in Augenschein und sah, dass ein einzelner Mann sie bewohnte; er trat ein und bat um Gastfreundschaft, entschlossen, sie sich mit Gewalt zu verschaffen, sollte sie ihm verweigert werden.
Der Hirte gewährte sie ihm mit der Großzügigkeit, mit der die Armen das Wenige teilen, das Gott ihnen gegeben hat.
Fra Diavolo befragte seinen Gastgeber, und nachdem er sich vergewissert hatte, dass in der Umgebung noch nie eine Bürgerwehr gesehen worden war, legte er seine Waffen in eine Ecke, setzte sich nahe an das Feuer und aß die Reste, die vom Abendessen des Hirten geblieben waren, anders gesagt ein paar Kartoffeln, die dieser in der Asche vergessen hatte.
Dann warf sich Fra Diavolo auf einen Sack mit Maisstroh und schlief ein.
An die Bürgerwehr hatte er gedacht, doch nicht an die Räuber. Gegen Mitternacht betraten vier einheimische Banditen zufällig die Hütte, in der Fra Diavolo schlief. Der Hirte und sein Gast erwachten, als ihnen ein Pistolenlauf an die Kehle gedrückt wurde, und da Fra Diavolo nicht wissen konnte, ob er es mit seinesgleichen oder mit der Bürgerwehr zu tun hatte, verriet er nicht, wer er war, und ließ sich ohne Widerstand Waffen und Geld entwenden.
Nach diesem Besuch hoffte Fra Diavolo, dass ihm nichts mehr zu fürchten geblieben war als der Tod. Seit Major Hugo ihn verfolgte, hatte ihn das Glück ganz und gar im Stich gelassen; jedes Mal war er geschlagen worden; verwundet, ohne Mittel, ohne Waffen, was sollte seiner noch harren?
Doch der Unglückliche hatte den Kelch noch nicht bis zur Neige geleert; kaum hatten die Räuber hundert Schritte getan, kam ihnen der Gedanke, dass sie in der Hütte einen Mann zurückgelassen hatten, der sie anzeigen konnte, und sie machten kehrt und zwangen ihn, ihnen zu folgen.
Ihm blieb nichts übrig, als zu gehorchen.
Doch da er seit neunundzwanzig Tagen durch Dornen, Stacheln und über Felsbrocken geflohen war, die letzten drei Tage ohne Schuhe, waren die Füße des Bedauernswerten eine einzige offene Wunde. Die Banditen, die sahen, dass er seine Schmerzen zu verbergen trachtete, ihnen aber trotz aller Mühen nicht folgen konnte, trieben ihn vor sich her, indem sie ihn mit ihren Gewehrkolben schlugen und mit ihren Bajonetten stachen.
»Tötet mich, wenn ihr wollt«, sagte Fra Diavolo, »aber ich kann keinen Schritt mehr gehen.«
Und er stürzte hin.
108
La Forca
Sei es aus Erbarmen, sei es, weil er ihnen ungefährlich erschien: Die Banditen ließen den Sterbenden auf der Straße liegen.
Und warum hatte Fra Diavolo seinen Namen nicht genannt?, wird man sich fragen. Weil er wusste, dass auf seinen Kopf sechstausend Dukaten ausgesetzt waren, und weil er keine Sekunde lang bezweifelte, dass die Banditen, erfuhren sie den Namen, ihn sofort ausliefern würden, damit jeder von ihnen fünfzehnhundert Dukaten einstecken konnte.
Er wusste, mit was für Leuten er es zu tun hatte. Als sie fort waren, versuchte er aufzustehen; auf einen abgebrochenen Ast gestützt, wanderte er ziellos weiter; zuletzt erreichte er ein Dorf namens Baronisi. Er ging die erstbeste Straße entlang und gelangte auf den Dorfplatz.
Ein Apotheker hatte seinen Laden geöffnet, und da es geschneit hatte, wunderte er sich, einen Mann mit nackten Füßen auf dem Dofplatz stehen zu sehen, der sich ängstlich und unentschlossen umsah.
Er ging zu ihm hinaus und fragte ihn, was er suche.
»Ich warte auf einen Kameraden«, erwiderte der andere, »ich komme aus Kalabrien und werde weitergehen, sobald mein Freund gekommen sein wird.«
Fra Diavolos Pech wollte es, dass der Apotheker aus Kalabrien stammte; er wunderte sich, dass der vermeintliche Kalabrese den Dialekt nicht beherrschte, argwöhnte, dass er es mit einem Flüchtling zu tun hatte, und lud den Unbekannten ein, sich in seiner Küche zu wärmen, wo er ihm etwas Branntwein anbot; während er ihm diese heuchlerischen Wohltaten erwies, bedeutete er einer jungen Bediensteten, sich im Flüsterton mit ihm zu unterhalten, und wies sie an, zum Bürgermeister zu laufen und die Nationalgarde zu benachrichtigen.
Kurze Zeit später betraten vier Soldaten und ein Korporal den Laden. Der Korporal näherte sich Fra Diavolo und verlangte seine Papiere.
»Was für Papiere?«, fragte Fra Diavolo. »Kann man heute nicht mehr ohne Pass reisen?«
»Oh«, erwiderte der Korporal, »es sind so viele Räuber unterwegs, dass man gar nicht vorsichtig genug sein kann. Und da Sie uns nicht sagen wollen, wer Sie sind, werden wir Sie nach Salerno mitnehmen.«
Dorthin brachte man ihn und übergab ihn dem Schwadronschef Farinas, der ihn verhörte.
Als das Verhör begann, trat zufällig ein Pionier namens Pavese aus den Truppen Major Hugos in den Raum, und als er den Gefangenen erblickte, rief er: »Fra Diavolo!«
Man kann sich denken, welches Erstaunen dieser Ruf auslöste, nicht zuletzt bei dem Gefangenen.
Er wollte leugnen, doch zur Zeit der Bourbonen, als er Oberst und Herzog war und in seiner prunkvollen Uniform und unter seinem Titel in den Straßen Neapels paradierte, hatte der bescheidene Pionier ihm zu oft die militärischen Ehrenbezeigungen erwiesen, um ihn nicht wiederzuerkennen, auch wenn er halbnackt, halbtot und blutbesudelt war. Der Pionier erhärtete seine Aussage so unzweifelhaft, dass man sicher war, den gefürchteten und berüchtigten Fra Diavolo tatsächlich hinter Schloss und Riegel zu haben.
Major Hugo verkündete König Joseph, dass der gefürchtete Partisan verhaftet war, und in Anerkennung und Bewunderung seines Muts und seiner Geistesgegenwart empfahl er ihn der Milde des französischen Herrschers.
Joseph erwiderte, neben seinen politischen Untaten habe Fra Diavolo Verbrechen begangen, die eine Begnadigung durch den König unmöglich machten; den Partisanen und Bourbonenanhänger Fra Diavolo hätte er jederzeit begnadigt, ebenso den Brigadekommandeur der Armee König Ferdinands und den Herzog von Cassano, aber den Mörder und Brandstifter Fra Diavolo, den konnte er nicht begnadigen.
Fra Diavolo war überaus beliebt, und die Schaulustigen drängten sich im Gericht; der Angeklagte wohnte dem Verfahren bei, was vor der Regentschaft Josephs und Murats von den Richtern als unnötige Formalität betrachtet worden war. Aufgefordert, sich zu seiner Verteidigung zu äußern, schwieg er; im Gefängnis wiederholte er immer wieder, er habe nur seine Befehle befolgt; er hörte gleichmütig das Todesurteil an, und als es verlesen war, rief er: »Und doch habe ich nicht einmal die Hälfte dessen getan, was Sidney Smith mir aufgetragen hatte!«
Die Hinrichtung war für die Mittagsstunde des darauffolgenden Tages festgesetzt.
Am Tag darauf erreichten Manhès und Graf Leo um zwölf Uhr den Mercato Vecchio, den alten Marktplatz, wo sie dank der Uniform des Offiziers und ihrer Equipage einen guten Platz fanden.
Durch das Gässchen der »Seufzer aus dem Abgrund« kam wie gesagt Fra Diavolo; seine Miene war bleich, aber gefasst; seine Haare waren im Topfschnitt auf Höhe der Ohren abgeschnitten, damit sie dem Strick nicht in die Quere kamen; um den Hals trug er sein Brigadekommandeurspatent mit dem Wappen Neapels, dem großen roten Siegel und Ferdinands Unterschrift; die Jacke, die er über die Schultern geworfen hatte und die ihm erst am Fuß des Schafotts abgenommen werden würde, ließ seine Arme entblößt, und an einem Arm trug er das Armband mit den blonden Haaren Königin Carolines und mit einer Diamantenschließe.
Fra Diavolo betrug sich weder unterwürfig noch auftrumpfend; er war gelassen, mit jener Gelassenheit, die bezeugt, dass die Seele über den Körper herrscht und der Wille über die Materie. Drei Viertel der Zuschauer waren ihm persönlich bekannt, doch er grüßte nur diejenigen, die ihn zuerst grüßten. Manche Frauen bedachte er mit einem Lächeln, und einige wenige grüßte er. Ein Leibgardist vertrieb die Gaffer um den Karren und am Fuß des Galgens auf einen Umkreis von hundert Schritten; am Fuß der Leiter wartete der Henker Meister Donato mit seinen zwei Henkersknechten.
Der Karren hielt an; man wollte Fra Diavolo hinunterhelfen, doch er sprang ohne Hilfe zu Boden und ging sicheren Schritts auf die Leiter zu; Priester und Gerichtsschreiber folgten ihm; und am Fuß der Leiter verlas der Gerichtsschreiber das Urteil, das gegen ihn ergangen war.
Das Urteil führte alles auf, was die Gesellschaft Fra Diavolo zur Last legte, von dem Mord an seinem Lehrherren, dem Wagner, bis zu der Ermordung zweier französischer Soldaten. Die Bruderschaft der Eremiten des heiligen Paulus oder der Brüder des Todes war zur Gänze dem Karren von Castel Capuano bis zum Schafott gefolgt; ein Bruder des Todes hatte neben dem Delinquenten im Karren gesessen und hatte ihn, die Hand auf seiner Schulter, bis zum Galgen begleitet. Solange der Bruder des Todes den Verurteilten berührte, durfte der Henker nicht Hand an ihn legen, doch sobald er die Hand von ihm nahm, gehörte der Verurteilte dem Scharfrichter.
Nachdem das Urteil verlesen war, sprach Fra Diavolo aufrecht und ohne sichtliche Bewegung einen Augenblick lang leise mit dem Geistlichen; der Henker wartete; dann lehnte Fra Diavolo sich an die Leiter zum Galgen und sagte mit fester Stimme zu dem Bruder des Todes: »Ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen, nehmen Sie die Hand von mir, Bruder, ich bin bereit.«
Der Henker ging hinter ihm vorbei und bestieg die Leiter als Erster; er wollte dem Delinquenten unter die Arme greifen, um ihm die Sprossen hinaufzuhelfen, doch dieser schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht nötig«, sagte er, »ich kann allein hinaufsteigen.«
Und obwohl seine Hände gefesselt waren, stieg er rückwärts die Leiter hinauf und sagte bei jeder Sprosse, die er verließ, um die nächste zu erklimmen, dreimal: »Ave Maria.« Als er die Schlinge erreichte, legte der Henker sie ihm um den Hals und wartete einen Augenblick für den Fall, dass der Delinquent noch etwas sagen wollte.
In der Tat rief Fra Diavolo, so laut er konnte: »Ich bitte Gott und die Menschen um Vergebung für meine Verbrechen, und ich empfehle meine Seele der Jungfrau Ma-«
Er konnte nicht aussprechen, denn mit einem Fußtritt zwischen die Schulterblätter hatte Meister Donato ihn in die Ewigkeit befördert.
Der Bandit, der spürte, dass er stürzte, bäumte sich so heftig auf, dass er die Fesseln seiner Hände zerriss. Sogleich stieg der Henker mehrere Sprossen die Leiter hinauf, ergriff das Seil, als es sich näherte, und sprang dem Delinquenten auf die Schulter, um ihm das Rückgrat durch sein Gewicht zu brechen, falls es noch nicht gebrochen war; er schüttelte den Erhängten mehrere Male und ließ sich dann an seinem Körper entlang hinab, um sich an seine Füße zu hängen und von dort zu Boden zu springen.
Doch sei es, dass die Schlinge den Dienst versagt hatte, sei es, dass der Strick zu neu und nicht geschmeidig genug war, oder sei es, dass dieser kraftvolle Organismus schwerer zu zerbrechen war als ein schwächerer – in dem Augenblick, als der Henker die Brust des Gehängten erreichte, umschlang ihn dieser und drückte ihn mit aller Kraft an sich, die er zu Lebzeiten besessen hatte und die in seinem Todeskampf mit letzter Heftigkeit und Gewalt hervorbrach.
Das Volk rief wie aus einer Kehle: »Bravo, Fra Diavolo, bravo!«, während der Henker, der dem Tod fast so nahe war wie der Delinquent, vor Schmerz brüllte.
Die zwei Henkersknechte sprangen herbei, um ihrem Patron zu helfen; für einen Augenblick hingen die vier Männer als unförmige Masse am Ende des Stricks; dann riss das Seil, und alle vier stürzten auf das Schafott.
Bei diesem Anblick begann die Menge zu toben und zu schreien; Steine wurden geworfen, Händler schwenkten ihre Stöcke, die Lazzaroni zeigten ihre Messer, und alle rannten auf das Schafott zu und riefen: »Erschlagt Meister Donato! Erschlagt seine Helfer!«
Doch der neapolitanische Pöbel war nicht mehr der Pöbel, der er gewesen war, als er zu Zeiten König Ferdinands das Schafott demoliert und den Henker in Stücke zerrissen hatte, wenn dieser seinem Handwerk nicht gerecht geworden war.
Die Franzosen, die den Galgen umringt hielten, rückten mit gezückten Bajonetten gegen die Menge vor, drängten sie an den Rand des Marktplatzes zurück und hielten sie dort in Schach.
Unterdessen war dem Offizier, der die Hinrichtung beaufsichtigte, das Grüppchen aufgefallen, das Manhès, der Graf und die zwei Gefangenen in ihrem Wagen samt Postillion bildeten, und höflich hatte er von Offizier zu Offizier einige Fragen gestellt, die einsilbig beantwortet worden waren. Manhès hatte ihm erklärt, um was für Gefangene es sich handelte, und ihn gefragt, was er mit ihnen anfangen solle. Der Offizier hatte ihm geraten, sie im Vicaria-Gefängnis einsperren zu lassen.
Auf die Frage der jungen Männer, welches das beste Hotel der Stadt sei, hatte er ohne zu zögern gesagt: »Das Hotel La Vittoria von Martin Zir.«
»Hörst du«, sagte Manhès zu dem Postillion, nachdem er dem Offizier gedankt hatte.
Der Postillion brachte seine Passagiere zum Vicaria-Gefängnis. Beide stiegen aus und übergaben ihre Gefangenen dem Pförtner, der Name und Anschrift von ihnen verlangte; doch bevor Leo seinen Gefangenen übergab, bedachte er, dass die armen Teufel sicher nicht viel Geld bei sich hatten und sich mit dem Nötigsten versorgen mussten, und deshalb drückte er ihm verstohlen einen Louisdor in die Hand. Zehn Minuten später betraten er und sein Reisegefährte das Hotel La Vittoria, bezahlten den Postillion, bestellten ein heißes Bad und ein Mittagessen, zwei Dinge, die sie nach einer Nacht in den Pontinischen Sümpfen und nach zwölf Meilen in gestrecktem Galopp dringend benötigten.
Doch bevor er sich in das Bad begab, schrieb Manhès dem ersten Kammerherrn Joseph Bonapartes, während Graf Leo dem Polizeiminister Saliceti seine Karte schickte.
Als die beiden jungen Männer sich zu Tisch begaben, erhielt jeder von ihnen eine Antwort: Der erste Kammerherr des königlichen Palastes teilte Manhès mit, dass König Joseph ihn sobald wie möglich zu sehen wünsche und freudig etwaige Neuigkeiten des Kaisers und Murats erwarte.
Graf Leo erhielt ein Schreiben des Sekretärs des Polizeiministers, in dem ihm gesagt wurde, Seine Exzellenz werde ihn mit Vergnügen empfangen, sobald er im Palast vorstellig werde.
Das ließen sich beide gesagt sein, und sie gingen sich umkleiden.
109
Christophe Saliceti, Polizeiminister und Kriegsminister
Von Natur aus elegante Männer brauchen nicht lange, um sich umzukleiden.
Graf Leo, in dem der Leser längst René erkannt hat, gehörte zu dieser Spezies. Da sein Rang als zweiter Leutnant bei Surcouf und als dritter Leutnant bei Kapitän Lucas nicht offiziell bestätigt war, wollte er sich weder in der Phantasieuniform zeigen, die er als Korsar trug, noch in der Uniform, die er als Seemann trug, sondern er entschied sich für die Kleidung eines jungen Mannes jener Zeit, das heißt Gehrock mit kleinem Kragen und Knebeln, enganliegende Kaschmirhose, Stulpenstiefel, weiße Krawatte, weiße Weste und Chapeau en Bateau. Um drei Uhr nachmittags ließ er sich bei seiner Exzellenz, dem Polizeiminister und Kriegsminister, als Graf Leo anmelden.
Zwei, drei Wartende hielten sich in dem Vorzimmer auf, doch der Minister ließ ihnen ausrichten, sie sollten am nächsten Tag wiederkommen, die Audienzen seien für diesen Tag beendet; Graf Leo ließ er zu sich bitten.
Polizeiminister und Kriegsminister Christophe Saliceti war Korse, und zu jener Zeit war er sechzig Jahre alt.
Bei Ausbruch der Revolution war er Rechtsanwalt in Bastia; er wurde als Abgeordneter des dritten Standes in die Verfassunggebende Versammlung gewählt, setzte sich dafür ein, dass die Korsen zu französischen Bürgern erklärt wurden, und war danach Mitglied des Nationalkonvents und des Rats der Fünfhundert. Nach dem 18. Brumaire von Napoleon kurzzeitig aufs Abstellgleis geschickt, weil er sich diesem Staatsstreich widersetzt hatte, wurde er bald wieder mit dessen Huld bedacht und erhielt von Joseph, sobald dieser den Thron von Neapel bestieg, das Portefeuille der Polizei und des Krieges. Er hatte ein schönes Gesicht, einen zierlichen Körperbau und genoss den Ruf, von der ganzen Familie Joseph Bonapartes geschätzt und unterstützt zu werden.
Er saß an seinem Schreibtisch; bei den Worten: »Graf Leo!« erhob er sich anmutig und bot dem Besucher einen Stuhl an.
Leo dankte Saliceti für sein Wohlwollen und für die schnelle Antwort auf sein Begehren.
»Monsieur«, sagte Saliceti, »dass ich Sie so bald empfange, ist umso verdienstvoller, als mich dazu unter anderem die Furcht bewog, Sie könnten nach Neapel gekommen sein, weil es Sie nach meinem Posten gelüstet.«
»Oh, Monsieur«, erwiderte lachend derjenige, den wir bald Graf Leo, bald René nennen, »dieser Posten ist weitaus zu gut besetzt, als dass ich auch nur eine Sekunde lang begehrliche Blicke auf ihn richten könnte.«
»Sind Sie es nicht«, fragte Saliceti, »der zusammen mit Hauptmann Manhès aus Rom gekommen ist?«
»Ja, Eure Exzellenz, und Sie geben mir soeben den Beweis, dass Ihre Polizei so gut organisiert ist, dass ich nicht nur jede Hoffnung, sondern sogar jeden Wunsch, Ihr Nachfolger zu sein, verabschieden muss.«
»Sie haben unterwegs im Vicaria-Gefängnis zwei Banditen abgegeben, die Sie gefangen haben, und hatten zuvor drei weitere Räuber erschossen.«
»Man zieht sich unter solchen Umständen so gut man kann aus der Lage«, erwiderte Graf Leo. »Wir haben getan, was wir konnten, Monsieur.«
»Und darf ich jetzt erfahren, was mir die Ehre Ihres Besuchs verschafft, beziehungsweise wie ich Ihnen zu Diensten sein kann?«
»Exzellenz, ich befinde mich in der unglücklichen Lage, das Missfallen Seiner Majestät Kaiser Napoleons erregt zu haben, doch als Gegengewicht erfreue ich mich, ohne den Grund zu wissen, der Gewogenheit Monsieur Fouchés.«
»Und das ist nicht gering zu veranschlagen«, sagte Saliceti. »Fouché ist keineswegs der schlechte Mensch, für den ihn viele halten, sondern er hat viele gute Seiten; ich kenne ihn aus dem Nationalkonvent, wo wir oft einer Meinung waren, und wir sind Freunde geblieben. Hat er Ihnen nichts für mich aufgetragen?«
»Nein, Monsieur, als ich seine Befehle entgegennahm und ihn fragte, wohin ich mich wenden sollte, sagte er: ›Sind Sie gut gefahren mit den Ratschlägen, die ich Ihnen bislang gegeben habe?‹ – ›Ausgezeichnet, mein lieber Herzog.‹ – ›Nun, dann gehen Sie nach Neapel, sprechen Sie mit Saliceti, versuchen Sie, dem Bruder des Kaisers einige gute Dienste zu erweisen, und kommen Sie wieder zu mir.‹«
»Und Sie haben ihn nicht um Empfehlungen gebeten?«, fragte Saliceti.
»Gewiss, doch er erwiderte nur: ›Mein lieber Freund, ich habe keine zu geben. Sie sind ein Glückskind. Gehen Sie Ihren Weg geradeaus, und das Glück wird Sie finden.‹ Daraufhin bin ich abgereist und habe mich nach Rom begeben. An der Poststation bin ich Hauptmann Manhès begegnet: der Anfang der Glückssträhne, die Fouché mir vorausgesagt hatte; dann sind wir in den Pontinischen Sümpfen mit sechs Banditen aneinandergeraten, die uns den Weg versperren wollten, haben drei getötet und zwei gefangen genommen, wie Sie bereits sagten; und da uns das Glück noch immer die Treue hielt, kamen wir rechtzeitig nach Neapel, um mit anzusehen, wie Fra Diavolo aufgeknüpft wurde.«
»Sie sind ein lustiger Kumpan, Monsieur, und das dachte ich mir schon; kann ich Ihnen irgendeinen Wunsch erfüllen?«
»Meiner Treu, Exzellenz, ich fange langsam an, Monsieur Fouchés Ansicht zu teilen: Weisen Sie mir einen Weg, und ich werde ihm folgen.«
»Sie sind weder ein Freund der Diplomatie noch der Intrige, nicht wahr?«, fragte Saliceti.
»Oh, weiß Gott nicht«, erwiderte René. »Ich bin Soldat oder Seemann. Schicken Sie mich dorthin, wo ich mich umbringen lassen kann, zu Lande oder zur See, das ist mir ganz einerlei.«
»Warum wollen Sie sich umbringen lassen?«
»Weil ich ehrgeizig bin und eine herausragende Position erreichen will, die mir allein das Glück ersetzen kann, das ich verloren habe.«
»Eine Marine besitzen wir nicht, Monsieur; wir haben zwei Kriegsschiffe in Auftrag gegeben, die nicht vor zwei Jahren fertiggestellt sein werden; das würde für Sie zu lange dauern. Große Kriege führen wir nicht. Gaeta, das wir belagern, wird sich in wenigen Tagen ergeben; doch ich weiß, dass Sie sich als Großwildjäger hervorgetan haben, der Tiger und Panther zu erlegen versteht; solche Raubtiere kommen bei uns im Unterholz zahlreicher vor als in den Dschungeln Birmas, nur dass die Tiger unserer Breiten Torribio, Parafante, Benincasa oder Il Bizzarro heißen. Würde es Sie danach gelüsten, auf Tiger dieser Art Jagd zu machen? Jeder, den Sie töten oder lebendigen Leibes gefangen nehmen, wäre eine Beförderung wert.«
»Einverstanden«, sagte René. »Krieg wäre mir lieber, und ich wäre lieber Soldat als Jäger; doch Monsieur Fouché hatte zweifellos seine Gründe, mich zu Ihnen zu schicken.«
»Die Gründe glaube ich zu erraten, Monsieur: Er nimmt lebhaften Anteil an Ihrem Geschick, und er hat Sie zu mir geschickt, weil er überzeugt ist, dass ich es ebenfalls tun werde. Ich werde dem König von Ihnen erzählen, Monsieur; besuchen Sie mich wieder.«
»Und wann?«
»Morgen.«
René erhob sich und verneigte sich. »Gestatten Sie, Monsieur«, fragte er, »dass ich Monsieur Fouché von Ihrem überaus liebenswerten Empfang berichte?«
»Schreiben Sie so selten wie möglich nach Frankreich; erwähnen Sie in Ihren Briefen weder jene, die Sie in gutem Licht sehen, noch jene, über die Sie sich beklagen könnten, denn sonst werden Sie selbst das Instrument sein, das Ihre Freunde daran hindert, Ihnen zu nützen.«
»Ich habe verstanden, Monsieur; aber wie kommt es, dass ein Mann von der Größe Napoleons -«
»Pst!«, sagte Saliceti. »Napoleon ist mein Landsmann, und in meiner Gegenwart darf man ihn nicht einmal mit der Sonne vergleichen, denn selbst die Sonne hat Flecken, Monsieur.«
Graf Leo salutierte, verabschiedete sich von dem Minister und ging.
Vor der Tür des Hotels La Vittoria traf er auf Manhès, der ihn mit strahlender Miene begrüßte. »Ich darf nicht vergessen, es Ihnen zu sagen«, sagte Manhès, »ich habe Sie dem König gegenüber erwähnt, und er hat gesagt, er wolle Sie sehen.«
»Mein lieber Freund«, erwiderte Graf Leo, »seit ich nur noch mit Ministern verkehre – denn ich habe soeben eine Dreiviertelstunde bei Monsieur Saliceti verbracht -, entwickle ich einen ausgeprägten Sinn für Etikette. Monsieur Saliceti war so gütig zu sagen, er wolle mich dem König gegenüber erwähnen, und wir müssen ihn gewähren lassen, denn ich glaube, er wäre nicht erfreut, wenn ich einen anderen Weg wählte als den von ihm vorgeschlagenen.«
»Sie haben völlig recht«, sagte Manhès, »doch egal, zu welcher Stunde Sie dort vorsprechen werden, ich will versuchen, ebenfalls dort zu sein. Und was haben Sie für den Rest des heutigen Tages geplant? Würde es Ihnen zusagen, in Pompeji zu speisen?«
»Mit größtem Vergnügen«, sagte Leo; er klingelte und befahl dem Diener, einen guten Wagen und zwei gute Pferde für den Rest des Tages zu bestellen.
Meister Martin Zir, der Hotelier, ließ den schönsten Wagen vorfahren, den das Hotel besaß; er hatte erkannt, dass zwei Reisende, die eine Stunde nach ihrer Ankunft zum König und zum Minister gerufen wurden, Leute sein mussten, auf die keine Aufmerksamkeit verschwendet war.
Die zwei jungen Männer bestiegen den Wagen.
Es war ein herrlicher Tag: Obwohl man sich erst in der zweiten Januarhälfte befand, spürte man von Sizilien bereits die warmen Lüfte herwehen, denen Paestum verdankt, dass seine Rosen zweimal im Jahr blühen, und die wollüstig zitternd im Golf von Baia ersterben.
Es war noch nicht Frühling, doch es war nicht mehr Winter. Der Kai, so schmutzig und zugleich so lebendig, der dreimal den Namen wechselt und vom Piliero-Becken bis zum Carmine-Tor reicht, diese Mole mit ihrem Improvisator am einen Ende, der seinen Tasso deklamierte, und mit ihrem Kapuziner am anderen Ende, der die Wundertaten Jesus Christus’ pries, mit ihren Schweinen, denen man auf Schritt und Tritt begegnete und die damals ganz offenkundig die einzige Straßenreinigung waren, die man in Neapel kannte, mit ihrem Golf mit seinen schimmernden Wassern und seinem Kap Campanella zur einen und seinem Kap Misena zur anderen Seite, mit ihrer himmelfarbenen Insel Capri, die wie ein Sarg auf dem Meer ruht, und mit ihren jungen Mädchen mit Armen voller Blumen, die anderswo noch unter dem Schnee begraben waren, Mädchen voller Frische und Fröhlichkeit, die Metastasio die Worte eingegeben hatten:
O Jugend, Frühlingszeit des Lebens!
O Frühling, Jugendzeit des Jahres!
Und sie alle lachten, sangen, warfen einander Blumen zu und beschimpften einander ganze zwei Meilen lang, das heißt vom Kai bis nach Resina. In Resina veränderte sich das Schauspiel. Die jungen Mädchen, die Kapuziner, die Sänger und die Schweine waren noch immer da, doch zu ihnen gesellten sich nun Makkaronihersteller, deren Gewerbe von fast allen Bewohnern Porticis ausgeübt wird.
Sie bildeten das groteske Schauspiel von Männern, die bis zum Gürtel nackt waren und einander gegenseitig Teigrollen am Rücken rollten, bis diese den gastronomisch gewünschten Durchmesser hatten. Zweifellos verdanken die Makkaroni von Portici dem Tisch, auf dem sie gerollt werden, ihren Ruf, schmackhafter zu sein als alle anderen Teigwaren des Landes.
Als unsere Reisenden sich Torre del Greco näherten, wähnten sie, es mit einem Aufstand oder mit einem Raubüberfall zu tun zu haben. Gewehrfeuer ertönte so nahe, dass sie fast bereuten, ihre Waffen nicht mitgenommen zu haben, doch als sie sich erkundigten, erfuhren sie, dass sie keine Schüsse gehört hatten, sondern den Lärm einer Vielzahl von Böllerschüssen, die zu Ehren des heiligen Antonius abgefeuert wurden.
Unsere jungen Männer, die mit dem Heiligenkalender nicht allzu vertraut waren, erlaubten sich die Bemerkung, sie hätten gedacht, der Namenstag des berühmten Theologen, den auf der Fahrt nach Afrika ein Windstoß an die Küste Italiens getrieben hatte, werde im Juni begangen, doch man erklärte ihnen, dass es sich in diesem Fall nicht etwa um den heiligen Antonius von Padua handele, den Bezwinger des Vesuvs und des Feuers, sondern um den heiligen Antonius, den wir durch Callots Versuchung des heiligen Antonius kennen.
Die Ehre, in welcher der Heilige gehalten wurde, erklärte ihnen, warum so zahlreiche Schweine durch die Straßen streunten.
Zuletzt gelangten sie nach Pompeji.
Die unterirdische Stadt war damals noch lange nicht so freigelegt, wie sie es unserer Tage ist, doch so weit ausgegraben, dass man sich eine Vorstellung von den Wunderdingen machen konnte, die sie der Neugier ihrer Besucher offenbaren würde, sobald ein umsichtiger Geist die Ausgrabungen leiten würde.
Graf Leo erklärte seinem Freund an diesem Ort, was ein Atrium ist, ein Impluvium, ein Triclinium, kurzum die Austattung eines ganzen griechisch-römischen Gebäudes.
In der Via delle Tombe sahen sie die runden Bänke, die kaum aus dem Boden ragten, wie sie die Toten, die es nach guter Gesellschaft gelüstete, um ihre Gräber herum hatten aufstellen lassen, damit auf ihnen ihre Verwandten, ihre Freunde und, in deren Ermangelung, einfache Spaziergänger Platz nahmen.
Graf Leo erläuterte Manhès die Bestimmung jedes Lagerraums und jedes Ladengeschäfts, als hätte er zu jener Zeit gelebt, als der Freigelassene Diomedes sich das schönste Haus der Vorstadt errichten ließ.
Die Nacht brach herein, bevor Manhès’ Neugier befriedigt war und er des wissenschaftlichen Geplauders seines Reisegefährten überdrüssig geworden wäre, doch sie mussten zurückkehren, nachdem sie achtzehn Jahrhunderte zurückgewandert waren und drei Stunden mit den Zeitgenossen Plinius des Älteren und dessen Neffen Plinius des Jüngeren verbracht hatten.
Auf einmal veränderte sich die Szenerie, und statt der unheimlichen und stillen Totenstadt sahen sie die belebte und lebensvolle Straße vor sich, auf der das Leben ihnen abends noch lärmender als tagsüber vorkam. Der Mond hing über dem Krater des Vesuvs wie ein Schrapnell, das ein riesiger Mörser in den Himmel geschossen hatte. Das Meer war wie ein silberner Gazevorhang, auf dem Boote vorbeiglitten, an deren Bug Feuer loderten, vor denen sich der schwarze Umriss der Fischer mit ihrem Dreizack abzeichnete, der dem Fisch auflauerte, den der trügerische Lichtschein an die Wasseroberfläche lockte.
Die lange Straße von Pompeji nach Neapel war von zahllosen Lichtern besternt, so dass sie aussah wie eine römische Straße an einem Abend der moccoletti in den letzten Tagen des Karnevals.
Dieses Rumoren muss man gesehen haben, all diese Worte, die einander in der Luft begegnen, muß man gewissermaßen gespürt haben, um das Überschäumen an Lebendigkeit zu verstehen, das Gott mit vollen Händen diesen sonnengesegneten Ländern geschenkt hat.
In Portici hielt der Wagen an, damit die Pferde verschnaufen konnten; sogleich umringten ihn zahllose Schaulustige, neugierig, aber nicht feindselig, die auf die Trittbretter stiegen, den Reisenden ins Gesicht starrten und die silbernen Epauletten des Offiziers und die seidenen Knebel Graf Leos betasteten.
Plötzlich erschienen mitten unter diesem bunten Volk ein Kapuziner und ein Bettler, deren einer sich mit Ellbogen und Faust Platz schuf, während der andere auf die Demut seiner Gebete vertraute.
Der Bettler rief in seinem neapolitanischen Dialekt in so jämmerlichem Ton, dass man sein letztes Stündlein gekommen wähnte: »Einen grano, edler Herr! Einen grano, edler Herr! Ich sterbe vor Hunger, ich habe seit drei Tagen nichts gegessen!«
Der Franziskaner jammerte mit seinem näselnden Akzent, der den Schülern des heiligen Franziskus eigentümlich ist, während er einen Geldbeutel schüttelte, in dem sich ein paar Groschen befanden: »Edler Fürst, spendet für die armen Seelen der Sünder, die seit tausend Jahren im Fegefeuer sind und deren Schreie Ihr trotz allen Lärms um uns herum hören könntet, befände das Fegefeuer sich nicht mitten in der Erde.«
Und der Bettler setzte wieder ein und rief: »Edler General!«, während der Kapuziner wiederholte: »Edler Fürst!«
Daraufhin gab Manhès zu verstehen, dass er etwas sagen wollte, und beide verstummten.
»Mein Freund«, sagte Manhès zu dem Kapuziner, »wenn die Seelen seit tausend Jahren im Fegefeuer ausharren, können sie auch noch einige Tage länger warten, während dieser Bedauernswerte seinen Worten zufolge seit zweiundsiebzig Stunden nichts zu essen bekommen hat, und wenn das wahr ist, dürfen wir keine Sekunde verlieren, um ihn vor dem Hungertod zu bewahren.«
Daraufhin nahm er dem Mönch den Geldbeutel aus der Hand, öffnete ihn und leerte den Inhalt in den Hut des Bettlers; dann gab er ihn dem vor Staunen wortlosen Mönch zurück und rief dem Postillion zu: »Avanti! Avanti!«
Der Postillion trieb die Pferde zum Galopp an und hielt erst an, als sie das Hotel La Vittoria erreichten.
110
König Joseph
Als die zwei jungen Männer am nächsten Tag ihr Mittagessen beendeten, brachte ihnen ein reitender Bote folgende Depesche des Kriegsministers:
Herr Graf,
ich erwarte Sie heute gegen drei Uhr nachmittags, um Sie seiner Majestät vorzustellen, die gestern Abend meine kühnsten Wünsche vorwegnahm, indem sie den Wusch äußerte, Sie kennenzulernen. Nach der Rückkehr aus dem Königspalast werden wir zu Abend speisen. Ich werde Sie meiner Tochter vorstellen, der Herzogin von Lavello, die Sie kennenzulernen wünscht.
Ich bitte Sie, Ihrem Freund Hauptmann Manhès, dessen Adresse mir nicht bekannt ist, die nachfolgende Einladung zu übermitteln, die Sie beide, wie ich hoffe, zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags in meinem Haus versammeln wird.
René reichte Manhès den zweiten Teil des Schreibens, woraufhin dieser erwiderte, er werde sich wie sein Freund geehrt fühlen, der Einladung des Ministers Folge zu leisten.
König Joseph, das Familienoberhaupt, der sein Erstgeburtsrecht Napoleon abgetreten hatte, weil er dessen herausragende Fähigkeiten anerkannte, war vierunddreißig Jahre alt, von sanfter und wohlwollender Miene und von ebenso friedfertigem Charakter, wie sein nächstjüngerer Bruder streitlustig war. Er war der Erste der Brüder Napoleons, denen dieser einen Thron verlieh, doch man darf nicht vergessen, dass Joseph – ob als Herrscher oder als schlichter Bürger – von allen Brüdern Napoleons immer derjenige blieb, der seinem Bruder die größte Treue und Hingabe bewies.
Es gibt kaum eine merkwürdigere Lektüre als die acht oder neun Bände der Briefe, die Napoleon und Joseph wechselten und in denen Joseph stets Sire und Eure Majestät schreibt, während Napoleon ausnahmslos mit Mein Bruder antwortet.
Viele dieser Briefe sind Ratschläge, einige sind Befehle, und es ist befremdlich zu sehen, dass Napoleon, der nie einen Fuß nach Neapel gesetzt hatte, das Königreich Neapel sowohl topographisch als auch moralisch besser zu kennen scheint als Joseph, der sich an Ort und Stelle befindet; Napoleons Ermahnungen betreffen in erster Linie Josephs allzu große Gutherzigkeit; Napoleon will kein Wanken in der Festigkeit des Königs, er will auf keinen Fall Gnade für die Banditen und ebenso wenig für jene, die sie unterstützen, ob Zivilisten oder Priester.
So kam es, dass der Marquis von Rodio, von Ferdinand und Caroline mit diesem Titel versehen, der unter Josephs Herrschaft den Partisanenkrieg fortgesetzt hatte, in Apulien bewaffnet ergriffen wurde; vor ein Kriegsgericht gebracht, behauptete er, er hätte sich als Kriegsgefangener ergeben, und wurde freigesprochen. Doch auf höheren Befehl wurde ein zweites Gericht einberufen, das ihn verurteilte. Der König war abwesend. Saliceti ließ den Marquis füsilieren.
Da Joseph bedauert hatte, dass ihm keine Möglichkeit geblieben war, Gnade walten zu lassen, schrieb ihm Napoleon anlässlich dieses Verfahrens einen langen Brief, dem wir folgende Passage entnehmen:
Wenn Sie die Neapolitaner unbedingt mit den Korsen vergleichen wollen, dann vergessen Sie nicht, dass bei der Eroberung des Niolo vierzig Rebellen an den Bäumen aufgehängt wurden und dass ein solches Schreckensregime herrschte, dass niemand sich mehr zu rühren wagte. Piacenza hatte bei meiner Rückkehr von der Grande Armée aufbegehrt, und ich hatte Junot hingeschickt, der vorzugeben versuchte, es handelte sich nicht um einen Aufstand, und mich mit französischem Geschwätz beruhigen wollte; ich befahl ihm, zwei Dörfer niederzubrennen und die Anführer des Aufstands zu erschießen, unter denen sich sechs Priester befanden. Das geschah, Ruhe kehrte ein und wurde bis heute bewahrt.
Sie sehen selbst, welchen Schrecken die Königin verbreitet; ich will Ihnen nicht raten, ihrem Beispiel zu folgen, doch es steht außer Frage, dass sie mächtig ist. Wenn Sie Tatkraft und Energie beweisen, werden weder die Kalabresen noch sonstwer auf dreißig Jahre hin aufmucken.
Ich beende meinen Brief, wie ich ihn begonnen habe. Als König von Neapel und Sizilien werden Sie drei oder vier Jahre Frieden genießen. Wenn Sie als Faulenzer herrschen wollen, wenn Sie nicht mit fester und entschlossener Hand regieren wollen, wenn Sie auf die Meinung des Volkes hören wollen, das nie weiß, was es will, wenn Sie es nicht fertigbringen, die Missstände und das althergebrachte Unrecht abzuschaffen, die Ihnen nur Steine in den Weg legen, und wenn Sie nicht Steuern erheben, die Ihnen erlauben, Franzosen, Korsen, Schweizer und Neapolitaner in Dienst zu nehmen und Schiffe auszurüsten, dann werden Sie tatenlos gewesen sein, und in vier Jahren werden Sie mir nicht etwa von Nutzen sein, sondern mir schaden, denn Sie werden mich meiner Mittel berauben. Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen sage: Die Zukunft Ihres Königreichs hängt von Ihrem Auftreten nach Ihrer Rückkehr aus Kalabrien ab. Geben Sie keinen Pardon. Lassen Sie mindestens sechshundert Aufständische über die Klinge springen. Sie haben wesentlich mehr meiner Soldaten ermordet. Lassen Sie die Häuser von dreißig Großbauern abbrennen und ihren Besitz an die Armee verteilen. Lassen Sie alle Dorfbewohner entwaffnen, und geben Sie fünf oder sechs jener größeren Dörfer zum Plündern frei, die besonders unbotmäßig waren.
Wenn Kalabrien sich aufgelehnt hat, was verbietet Ihnen dann, die Hälfte des Besitzes dieses Landes zu nehmen und an die Armee zu verteilen? Es wäre eine Einnahmequelle, die Ihnen einerseits von großem Nutzen wäre und andererseits als abschreckendes Beispiel für die Zukunft dienen würde. Mit Weichheit und Nachgiebigkeit wurde noch kein Staat verändert und reformiert; so etwas erfordert außerordentliche Maßnahmen und Tatkraft. Da die Kalabresen meine Soldaten gemeuchelt haben, werde ich persönlich das Dekret erlassen, mit dem ich zugunsten meiner Armee die Hälfte der Erträge ihres Landes beschlagnahme; wenn Sie sich jedoch partout in den Kopf setzen wollen, dass sie sich nicht aufgelehnt hätten und Ihnen nie andere als freundschaftliche Gefühle entgegengebracht hätten, dann wird Ihre Güte nichts als Schwäche sein und Frankreich Schaden zufügen.
Sie sind zu gutmütig!
In der Tat war Joseph, wie bereits ausgeführt, von großer Güte; und er war keine vier Jahre lang König von Neapel, sondern nur zwei Jahre.
Kaum war Saliceti dem König angemeldet worden, wurde er mitsamt seinem Schützling vorgelassen.
Manhès, der seinem Reisegefährten nichts davon gesagt hatte, dass er bei der Audienz anwesend sein werde, stand neben König Joseph.
»Monsieur«, sagte Joseph zu Graf Leo, nachdem er die Komplimente Salicetis und Leos ehrerbietige Verbeugung erwidert hatte, »gestern erfuhr ich durch Ihren Reisegefährten Manhès, Ordonnanzoffizier bei meinem Schwager Murat, wie Sie mit den sechs Briganten verfahren sind, die Sie in den Pontinischen Sümpfen überfallen wollten. Zu dieser Tat kann ich Ihnen nur gratulieren; doch abends erfuhr ich von Saliceti, dem Sie offenbar durch einen engen Freund empfohlen wurden, dass Sie hergekommen sind, um in der Armee zu dienen. Für diesen Entschluss schulde ich Ihnen mehr als Glückwünsche, ich schulde Ihnen Dankesworte.«
»Sire«, erwiderte Graf Leo, »seine Exzellenz der Minister hat Ihnen sicherlich gesagt, dass es mir nicht um eine militärische Karriere zu tun ist; was Sie mir geben, genügt mir, sei es noch so gering. Ob Sie mich zum einfachen Soldaten oder zum Offizier machen, sobald ich das Gewehr oder den Degen in der Hand habe, wird es an mir sein, mich Ihrer Gunst würdig zu erweisen, und ich werde mein Bestes tun.«
»Monsieur«, ergriff der König das Wort, »Saliceti sagte mir, Sie hätten in der Marine gedient.«
»Ich war Korsar, Sire, im Dienst eines der berühmtesten Korsaren unseres Landes, des Malouins Surcouf.«
»Ich habe auch gehört, Sie seien bei Trafalgar zugegen gewesen. Wie kamen Sie dorthin, wenn Sie an Bord eines Kaperschiffs dienten?«
»Da ich wusste, dass eine große Seeschlacht bevorstand, habe ich meine Dienste Kapitän Lucas, dem Kommandanten, angeboten, dem General Decaen, der Gouverneur der Île de France, mich ebenso warm empfohlen hat wie mein verehrter Patron Surcouf, woraufhin Kommandant Lucas mir an Bord seiner Redoutable die Stelle des dritten Leutnants geben konnte, die gerade nicht besetzt war.«
»Und an Bord der Redoutable haben Sie laut Saliceti nicht nur wie ein Löwe gekämpft, sondern es gilt sogar als äußerst wahrscheinlich, dass Sie der Schütze sind, dessen Kugel Nelson getötet hat.«
»Damit habe ich mich nie gebrüstet, Majestät: zum einen, weil ich es nicht mit Gewissheit sagen könnte, und zum anderen, weil Nelson ein so großer Feldherr war, dass ich mich fast schämen müsste, mich seines Todes zu rühmen.«
»Und haben Sie Kapitän Lucas nicht nach Ihrer Rückkehr aus dem englischen Gefängnis wiedergesehen?«
»So ist, Majestät.«
»Hat Kommandant Lucas Sie nicht meinem Bruder gegenüber erwähnt?«
»Diese Ehre hat er mir erwiesen.«
»Und mein Bruder hat Ihnen nicht nur keinerlei Belohnung zuerkannt, sondern Sie nicht einmal in Ihrem Rang bestätigt?«
»Sire, wollte ich darauf antworten, müsste ich entweder mich oder Ihren Bruder kompromittieren. Wenn Sie zu befehlen geruhen, dass ich mich selbst kompromittiere …«
»Nein! Genug«, sagte König Joseph und berührte lächelnd Graf Leos Schulter, »all diese Dinge werden Sie mit Saliceti besprechen, den ich zum Kriegsminister ernannt habe; in dieser Eigenschaft wird er alles für Sie tun, was Sie wünschen.« Und mit einem Nicken zum Abschied: »Wenn Sie mit ihm nicht zufrieden sind, kommen Sie zu mir und sagen Sie es.«
»Ich beklage mich nie«, erwiderte René.
»Apropos«, sagte Joseph und hielt ihn zurück, denn René wollte den Raum verlassen, nachdem die Audienz beendet war, »ich weiß, dass Sie ein großer Jäger sind; mit Jagdpartien wie in Indien, wo es Tiger und Panther zu erlegen gibt, kann ich nicht aufwarten, aber in den Wäldern von Asproni gibt es viele Wildschweine, und wenn Ihnen ein so bescheidenes Wild nicht zu harmlos ist, wird Saliceti Ihnen so viele Jagdausflüge ermöglichen, wie Sie nur wünschen können.«
René verneigte sich zum Dank und verließ den Raum.
Manhès blieb zurück, bedeutete seinem Freund aber mit dem Blick und mit einer Handbewegung, dass er ihm folgen werde.
Manhès blieb, weil er erfahren wollte, welchen Eindruck sein Kamerad auf König Joseph gemacht hatte; seine fröhliche Miene, als er sich zu René gesellte, verriet, dass der Eindruck ganz hervorragend war.
In der Tat hatte die Tür sich kaum hinter Manhès geschlossen, als König Joseph das kleine Heft aus der Tasche zog, in dem er die Dinge notierte, die er nicht vergessen wollte, und schrieb mit Bleistift hinein: »Daran denken, persönlich Reynier oder Verdier den jungen Mann zu empfehlen, der mir ein Muster an Tapferkeit und Edelmut zu sein scheint.«
111
Il Bizzarro
Saliceti und seine zwei Gäste kehrten in das Kriegsministerium zurück. Saliceti hatte erraten, welchen Eindruck René auf König Joseph gemacht hatte. Manhès hatten die wenigen Worte beruhigt, die der König zu ihm gesagt hatte, nachdem René gegangen war. Und der Händedruck zwischen Manhès und René hatte genügt, Letzterem zu verstehen zu geben, was Ersterer ihm sagen wollte.
Die Herzogin von Lavello erwartete ihren Vater und die beiden Gäste im Salon.
Die Herzogin war eine ausnehmend hübsche Frau, noch jung, und ihr Vater liebte sie abgöttisch. Als der Palast, in dem das Kriegsministerium untergebracht war, im Jahr darauf einstürzte und man befürchtete, die Herzogin könnte unter den Trümmern begraben sein, wäre Saliceti fast gestorben, nicht wegen der Verletzungen, die er selbst bei diesem Unglück erlitten hatte, sondern aus Sorge um seine Tochter.
René wurde ihr vorgestellt, und als geschmackvolle, elegante Frau erkannte sie sogleich die Eleganz und Weltgewandtheit des jungen Mannes.
Man begab sich zu Tisch.
Saliceti hatte Wert darauf gelegt, en famille zu speisen, um ungezwungen mit den neuen Gästen plaudern zu können; aus René allein hätte er nicht viel herausbekommen, denn er hatte erraten, wie ungern dieser von sich sprach, ob aus Bescheidenheit oder aus Vorsicht; doch er hoffte, Manhès gesprächiger über die Themen zu finden, zu denen René sich ausschwieg.
Der sechste Gast war der erste Sekretär des Ministers, Korse wie Saliceti.
Als das Gespräch lebhafter wurde, was immer erst geschieht, wenn man bereits einige Zeit zu Tisch sitzt, sagte Saliceti zu seinem jungen Gast: »Monsieur, unter welchem Namen wollen Sie in Dienst treten? An Ihrer Stelle nähme ich den Namen an, den Ihnen Ihr Freund Manhès verliehen hat: Graf Leo ist ein schöner Name, nicht wahr, Tochter?«
»Vor allem, wenn Leo Löwe heißen soll, was ich annehme«, erwiderte die Herzogin von Lavello.
»Ich werde ihn nicht annehmen, weil Leo Löwe heißt, Madame, sondern weil er mir von einem Mann gegeben wurde, den ich zuerst lieben und dann schätzen lernte; Ihre Exzellenz und Sie, Madame, finden Gefallen an dem Namen, was ein weiterer Grund ist, ihn zu behalten.«
»Und nun, mein lieber Gast«, sagte Saliceti, »wollen wir versuchen, unsere Sache im Familienkreis zu regeln; wie mein Freund Fouché Ihnen seinerzeit erklärt hat, dass es Kaperschiffe und Schiffe der Kriegsmarine gibt, werde ich Ihnen nun erklären, dass wir hier reguläre Truppen und Banditenjäger haben. In den regulären Truppen gibt es nicht oft Gelegenheit, sich auszuzeichnen und befördert zu werden. Bei den Banditenjägern hingegen, deren Arbeit wesentlich gefährlicher ist als das normale Kriegshandwerk, hat man zehnmal mehr Gelegenheit, Aufmerksamkeit zu erregen. Major Hugo – wir sind unter uns, ich darf offen sprechen – wurde trotz seines heldenmütigen Betragens in der Schlacht von Caldiero nicht befördert, sondern blieb Major, weil man höheren Ortes dazu neigt, nachtragend zu sein. Aber inzwischen hat er Fra Diavolo zur Strecke gebracht, und es wird kein Monat vergehen, bis er zum Oberst befördert sein wird.«
»Was sagen Sie dazu, Freund Manhès?«, fragte René.
»Dass der Herr Minister Ihnen da einen ausgezeichneten Rat gibt, sapperlot! – Oh, Verzeihung, Frau Herzogin, ich bitte um Vergebung. Am liebsten bliebe ich hier, um mit Ihnen zusammen auf die Jagd zu gehen.«
»Umso mehr«, sagte der Sekretär, »als ich Ihnen einen prächtigen Banditen anbieten kann, neben dem ein Benincasa, ein Taccone und ein Panzanera sich wie Taschendiebe ausnehmen, wenn er so weitermacht wie bisher.«
»Haben Sie heute Depeschen erhalten?«, fragte Saliceti.
»Ja, der Adjutant General Verdiers hat mir geschrieben.«
»Und wie heißt Ihr Bandit?«, fragte der Minister.
»Er ist noch nicht allzu bekannt, doch sein Einstand in das Räubergewerbe gibt zu vermuten, dass er es bald sein wird; er heißt Il Bizzarro; er ist noch jung, keine fünfundzwanzig Jahre alt; man darf noch nicht zu viel von ihm verlangen.«
»Seien Sie unbesorgt«, sagte Manhès, »das werden wir schon selbst entscheiden.«
»Als Kind«, fuhr Salicetis Sekretär fort, »trat er in den Dienst eines reichen Pächters, dessen Tochter er verführte; das junge Paar war so unvorsichtig, die gegenseitige Neigung nicht zu verbergen, der Argwohn der Brüder wurde geweckt, sie lauerten dem Liebespaar auf, überraschten es in einem Augenblick, in dem an der schuldhaften Liebe kein Zweifel bleiben konnte -«
»Monsieur, Monsieur!«, sagte die Herzogin von Lavello. »Nehmen Sie sich in Acht!«
»Aber Frau Herzogin«, erwiderte der Sekretär lachend, »ich muss mich doch verständlich ausdrücken.«
»Das genügt, Robert«, sagte Saliceti.
»- an der schuldhaften Liebe kein Zweifel bleiben konnte«, wiederholte der Sekretär hartnäckig, »durchbohrten den Liebhaber mit Messerstichen und ließen ihn als tot auf einem Misthaufen liegen. Gute Menschen, die vorbeikamen, sahen den Leichnam, trugen ihn in die Dorfkirche, wo er bis zum nächsten Morgen bleiben sollte, bis man die Totengebete über ihn gesprochen haben würde.
Die Mörder dachten, sie hätten einen Toten liegen lassen, und in der Tat hatte er im Sarg die Totengebete reglos über sich ergehen lassen und darauf gewartet, dass die Nacht hereinbrach und die des Gebetesprechens müden Priester aus der Kirche vertrieb.
Die Priester verschwanden ausnahmslos in der Überzeugung, dass sie nur noch den Deckel auf den Sarg nageln mussten, bevor sie den armen Liebhaber in eine der offenen Gruben in der Kirche senkten.
Doch kaum war der letzte Priester verschwunden, öffnete der Tote zuerst ein Auge und dann das zweite, reckte den Kopf aus dem Sarg und sah im Licht der Kerzen, die noch brannten, dass die Kirche menschenleer war.
Zuerst wusste er nicht, was ihm widerfahren war und wo er sich befand; doch das Blut, das an seinem Körper klebte, die Schwäche, die der Blutverlust bewirkt hatte, und die schmerzenden Wunden riefen ihm ins Gedächtnis, was geschehen war; er biss die Zähne zusammen, stieg aus dem Sarg, verließ die Kirche und schleppte sich in die Berge, das ewige Asyl all jener, die auf der Flucht sind.
Dieser Prolog zu dem Drama, dessen ersten Akt ich schildern werde, ereignete sich um das Jahr 1800; der Bizzarro, wie der Held meiner Erzählung heißt, war damals keine neunzehn Jahre alt.
Vier, fünf Jahre lang hörte niemand mehr von ihm; als man den leeren Sarg vorgefunden hatte, war man der zutreffenden Ansicht gewesen, dass er geflohen war. Man nahm an, er habe sich einer Bande von Räubern und Mördern angeschlossen, die seit einigen Jahren die Gegend von Soriano unsicher machte und die anlässlich der zweiten französischen Invasion und der Ernennung Prinz Josephs zum König von Neapel in aller Bauernschläue beschlossen hatte, sich zu politischen Partisanen zu erklären und sich unter das Banner der Bourbonen zu begeben.
Mut und Kaltblütigkeit des Bizzarro setzten ihn bald bei seinen Gefährten in großes Ansehen. Er wurde zum Chef der Bande ausersehen, und sobald er die unumschränkte Macht in Händen hielt, schien ihm der Augenblick der Rache gekommen zu sein.
Eines Sonntags vor ungefähr einem halben Jahr war die ganze Bewohnerschaft von Varano – so heißt das Dorf, in dem man ihn als tot hatte liegen lassen -, die ganze Bewohnerschaft von Varano und darunter die Familie seines früheren Herrn in ebenjener Kirche versammelt, in der er eine so wenig heimelige Nacht zugebracht hatte, als der Bizzarro mit seiner Bande die Kirche betrat, zum Altar schritt, sich umdrehte und allen befahl, die Kirche zu verlassen.
Die Menge hatte einen Augenblick lang verwirrt und erschrocken gezaudert, doch sie gehorchte, als der Bizzarro seinen Namen sagte und zu schießen drohte; er war bereits so berüchtigt, dass niemand Widerstand leistete; alle stürzten zur Tür, und an den Briganten zog eine stumme, verschreckte und zu Tode verängstigte Menge vorbei.
Zwei Opfer erspähte der Bizzarro mitten unter den Flüchtenden, zwei Söhne seines einstigen Herrn, Brüder seiner Geliebten, zwei Rächer, die ihn mit Messerstichen traktiert hatten.
Weniger glücklich als einst der Bizzarro, stürzten die zwei armen Teufel tödlich getroffen zu Boden, um sich nie wieder zu erheben; doch die Rechnung des Bizzarro war noch nicht beglichen, denn sein ehemaliger Herr hatte fünf Söhne, seine Tochter hatte fünf Brüder, und fünf, nicht zwei Rächer waren über ihn hergefallen, so dass ihm noch drei Opfer fehlten.
Der Bizzarro durchsuchte mit seinen Leuten die Kirche, und hinter dem Altar fand er die Gesuchten, die sich dort versteckt hatten; er erstach sie mit eigener Hand, denn die Rache wollte er ganz allein auskosten; doch zwei weitere Personen suchte er noch immer, den Vater seiner Geliebten und die Geliebte selbst.
Er eilte zum Haus des alten Mannes und fand diesen krank im Bett vor, von seiner Tochter gepflegt. Diese erkannte ihren einstigen Geliebten, ahnte, dass er gekommen war, um schreckliche Rache zu üben, und warf sich zwischen ihn und ihren Vater; doch der Bizzarro stieß sie weg, vollendete am Vater das Massaker aller männlichen Familienmitglieder, entführte die in seinen Armen ohnmächtig gewordene Geliebte, warf sie über sein Pferd und ritt mit ihr in die Berge zurück.«
»Und was geschah mit ihr?«, fragte die Herzogin von Lavello. »Hat man seither von ihr gehört?«
»Leider, Madame, muss ich zur Schande oder zur Ehre Ihres Geschlechts – denn ich wüsste wahrhaftig nicht zu sagen, welches von beiden zutrifft – Folgendes bemerken: Die Liebe war stärker als die Blutsbande, sie hatte den Bizzarro als das Opfer ihres Vaters und ihrer Brüder weitergeliebt, sie liebte ihn auch als den Mörder ihres Vaters und ihrer Brüder, und da die Bande des Bizzarro wie eine militärische Truppe geführt wird, sah man sie seit jenem Tag zu Pferde und in Männerkleidung an seiner Seite, und in dem unerbittlichen Partisanenkrieg hat sie eine Kühnheit und einen Mut bewiesen, die sie ihrem Gefährten ebenbürtig machen.«
»Und es war nicht möglich, dieses Elenden habhaft zu werden?«, fragte die Herzogin.
»Auf seinen Kopf wurden zweitausend Dukaten Belohnung ausgesetzt, Madame; doch bislang wagte kein Spitzel, ihn zu verraten, und er ist allen Schlichen und Fallen entschlüpft, die man gegen ihn ersonnen hat.«
»Wohlan, Graf Leo«, sagte Manhès, »an deiner Stelle würde ich, zum Teufel auch, den Kopf des Bizzarro bekommen oder auf meinen Namen verzichten.«
»Ich werde meinen Namen behalten«, sagte Leo, »und seinen Kopf bekommen.«
»An diesem Tag«, sagte die Herzogin von Lavello, »werde ich Sie meine Hand küssen lassen.«
112
In welchem Kapitel die zwei jungen Männer Abschied voneinander nehmen, damit der eine seinen Dienst bei Murat wieder antreten und der andere Reynier bitten kann, ihn in Dienst zu nehmen
An dem Tag nach obigem Abendessen nahmen Manhès und Graf Leo das Angebot König Josephs an, Wildschweine in Asproni zu jagen: Denn dies zogen sie dem wenig verlockenden Wild von Capodimonte vor.
Sie erlegten ein Dutzend Wildschweine, die sie in einem Karren mitbrachten und deren Fleisch sie an die Soldaten verteilen ließen.
Saliceti überredete die zwei jungen Männer, eine Woche in Neapel zu verbringen, damit sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt, auf die er stolz war, besichtigen konnten; er begleitete sie persönlich auf einige dieser Ausflüge.
Sie besuchten Nisida und die Villa des Lucullus; sie besuchten Pozzuoli, das vor Neapel die Hauptstadt Kampaniens gewesen war, den Serapistempel, die Überreste der Brücke des Caligula, den Lucriner See, der durch das Erdbeben von 1538 zur Hälfte verschüttet war, und den Averner See, an dessen Ufer Äneas den goldenen Zweig pflückte, der ihm die Pforten der Unterwelt öffnen sollte; und zuletzt besuchten sie das Mare Morto oder den Acheron, in dem statt Flammen heutigentages schlammige Wasser plätschern, welche die Eigenschaft haben, Austern und Muscheln, die von Tarent hergebracht werden, zu mästen; über einen bezaubernden Weg vor einem Hintergrund grüner Bäume und gelber Heide gelangten sie zum Hafen von Misenum, dem heutigen Miseno, wo die römische Flotte ankerte, als Plinius der Ältere, der Admiral der Flotte, sich mit einem Boot von dort aufmachte, um das Phänomen des Vesuvausbruchs aus der Nähe zu erkunden, und zwischen Stabiae und Pompeji vom Sand erstickt wurde; dann besuchten sie Baia, wo Cicero eine Villa besaß, zu deren Besitz er sich des schlechten Rufs wegen, den der Badeort genoss, nicht zu bekennen wagte und die er deshalb als seine Villa in Cumae bezeichnete, und Bauli mit seinem Kirchturm aus Fayence, der in der Sonne funkelt: Bauli, wo Nero vorgab, sich mit seiner Mutter versöhnt zu haben, und ihr zum Abschied die Brüste küsste, was, wie Tacitus sagt, der größte Beweis von Aufmerksamkeit und Achtung war, den ein Sohn seiner Mutter widerfahren lassen konnte. Hundert Schritte von dort öffnete sich der Boden der vergoldeten Galeere, die sie zu ihrer Villa in Baia zurückbrachte. Ohne einen Schrei zu äußern, ohne um Hilfe zu rufen, schwamm Agrippina zu ihrem Haus in Baia, wo sie von ihren Sklaven aufgenommen wurde; doch eine Stunde später kam Anicetus, dem sie als letzte Worte an die Adresse ihres Sohnes die zwei schrecklichen Worte hinterließ: Feri ventrem! (»Schlage den Bauch!«). So strafte sie ihre Lenden dafür, einen Elternmörder getragen zu haben.
Und am anderen Ende des Halbmonds, den der Hafen von Neapel bildet, besuchten sie Portici, Torre del Greco, Castellamare mit seinen Orangenhainen, das seinen Namen der Festung verdankt, die im Meer von Sorrent zerfällt, dann das Kap Campanella, die Stelle, die der Insel Capri am nächsten ist, doch Capri konnten sie nicht betreten, denn es war vor etwa einem Jahr von den Engländern erobert worden.
Trotz der Gefahr, die es bedeutete, die Wälder von Cava zu durchqueren, um Salerno zu erreichen, konnten die jungen Männer der Verlockung, Paestum zu besuchen, nicht widerstehen, denn auch sie wollten ihre Namen den Denkmälern der griechischen Antike einschreiben, die schon zu Zeiten des Augustus Ruinen waren.
Inmitten der Dornenranken und des wuchernden Unkrauts, die den Zugang zu diesen Wunderwerken des Altertums verwehren, hatte René größte Mühe, eine jener Rosen zu finden, die einst körbeweise nach Neapel geschickt wurden, um dort den Tisch eines Apicius oder Lucullus zu schmücken.
Eine Schlange, von ihren Schritten aufgeschreckt, glitt aus den Dornen hervor, entrollte ihre goldenen Windungen auf den dunklen Steinfliesen eines Tempels und verschwand.
Zweifellos war sie die Schutzgottheit dieses einsamen Ortes.
Auf der Rückkehr machten die Reisenden in Salerno halt, um das Grab Papst Gregors VII. zu besuchen, der zuerst den deutschen Kaiser Heinrich IV. verfolgt hatte und dann von diesem verfolgt worden war und vor seinem Tod angeordnet hatte, dass auf seinem Grabmal die Worte stehen sollten: »Ich liebe die Gerechtigkeit, ich floh die Ungerechtigkeit, und deshalb sterbe ich im Elend und im Exil.«
Zuletzt hieß es aufbrechen und die schöne Stadt Neapel und die Gastfreundschaft des Hauses Saliceti verlassen. Leo und Manhés schworen einander Waffenbruderschaft und ewige Freundschaft und sagten einander Adieu.
Graf Leo wurde von Saliceti aufgefordert, sich dem nächsten Detachement anzuschließen, das nach Kalabrien aufbrechen würde.
René war jedoch nicht gesonnen, solche Maßnahmen zu treffen, um sein Leben nicht in Gefahr zu bringen, und da man ihm gesagt hatte, er werde dem Kommando General Reyniers unterstellt werden, dessen Aufenthalt unbekannt war, da alle Verbindungen unterbrochen waren, der sich aber vermutlich in Amantea oder in Cotrone aufhielt, begnügte er sich mit der Antwort, er werde dort sein, wo sich der General befand, dem er zugeteilt worden war.
»Sie müssen nur Ihren Namen nennen«, sagte Saliceti, »und er wird wissen, dass er sich mit Ihnen absprechen muss, um von Ihrer Mitarbeit zu profitieren.«
Die Herzogin von Lavello wollte ihm die Hand zum Handkuss reichen, doch er verbeugte sich vor der bezaubernden Frau und sagte: »Madame, ein solcher Gunstbeweis muss eine Belohnung sein und kein Ansporn.«
Auf einem ausgezeichneten Pferd, das gesattelt und gespornt vor Salicetis Tür gewartet hatte und, wie dieser René anvertraut hatte, ein Geschenk König Josephs war, machte René sich trotz aller guten Ratschläge Salicetis in seiner Offiziersuniform und mit seinem Stutzen am Sattel und seinen treuen Pistolen im Gürtel ganz allein auf den Weg.
Am Abend des ersten Tages wollte er in Salerno übernachten; sein Pferd, das sich während der größten Tageshitze zwei Stunden lang ausruhen durfte, konnte zehn Meilen am Tag zurücklegen, ohne zu ermüden.
Am zweiten Tag erreichte er Capaccio; dort hörte er sich um und erfuhr, dass die Straßen zum einen schwierig zu verfolgen seien, weil sie ständig ineinandermündeten, und zum anderen, weil zahlreiche Banditenhaufen, denen es gelungen war, die französische Armee von Neapel zu trennen, jede Verbindung zwischen der Hauptstadt und General Reynier unterbanden; zudem hieß es, der englische General Stuart habe ein Armeekorps von fünf- oder sechstausend englischen Soldaten und drei- bis vierhundert Zwangsverpflichteten als Verbündete der Bourbonen im Golf von Sant’ Eufemia abgesetzt.
René reiste dennoch von Capaceti ab, ohne sich um die Briganten oder den Zustand der Straßen zu sorgen.
Es war ein langer Weg, denn René wollte bis nach Lagonegro gelangen, und da er unterwegs auf kein einziges Haus treffen würde, hielt er es für geraten, in einer Satteltasche ein Stück Brot und ein gebratenes Hühnchen und in der anderen eine Flasche Wein zu verstauen.
Er machte sich bei Tagesanbruch um fünf Uhr auf den Weg, und um elf Uhr erreichte er eine Kreuzung, von der drei Wege abgingen.
Das war die erste Zwickmühle, die man ihm vorausgesagt hatte.
René vertraute auf den Glücksstern, den Fouché in den Wechselfällen seines Schicksals zu erkennen geglaubt hatte.
Er stieg ab, legte in Reichweite seiner rechten Hand Stutzen, Pistolen und Weinflasche auf den Boden und in Reichweite der Linken das Huhn und das Brot, und dann setzte er sich und begann so friedlich zu schmausen, als befände er sich im Park von Asproni oder von Capodimonte.
Er hoffte, dass irgendein Bauer des Weges käme, der so gefällig wäre, ihm den richtigen Weg zu sagen, oder der aus Geldgier bereit wäre, ihm als Führer zu dienen, bis er die französischen Truppen erreichte.
Er hatte sich nicht getäuscht: Kaum hatte er sein Hühnchen in Angriff genommen und seine Flasche zu einem Viertel geleert, als er den Hufschlag eines Pferdes vernahm und einen Reiter erblickte, der so weiß bestäubt war wie ein Müller, ein Auge unter einer Binde verborgen hatte und einen Hut mit breiter Krempe trug, der ihm das halbe Gesicht verdeckte.
René sprach ihn an.
Als der Müller Renés Stimme hörte, hielt er sein Pferd an und richtete das unbedeckte Auge auf den Sprechenden.
»Kamerad«, sagte René, »hast du Durst?« Und er zeigte ihm die Flasche. »Komm und trinke. Hast du Hunger?« Er zeigte ihm das Hühnchen. »Komm und iss.«
Der Mann rührte sich nicht von der Stelle.
»Sie kennen mich nicht«, sagte er.
»Aber du«, sagte René, »kennst mich. Du weißt, dass ich ein französischer Soldat bin. Du wirst mir sagen, welchen der drei Wege ich nehmen muss, um zur Armee zu gelangen, und dann sind wir quitt; aber wenn du dir ein paar Louisdors verdienen willst, umso besser, dann kannst du mir als Führer dienen.«
»Ich bin weder hungrig noch durstig«, erwiderte der Mann, »aber ich will Ihnen als Führer dienen.«
»Sehr gut.«
Der Bauer blieb auf seinem Pferd sitzen.
René beendete seine Mahlzeit; dann packte er die Weinflasche, das Brot und die übrig gebliebene Hälfte des Hühnchens zusammen, steckte sich die Pistolen in den Gürtel, hängte seinen Stutzen an den Sattel, legte die Reste seiner Mahlzeit für den nächstbesten Hungrigen an den Wegesrand, sprang auf sein Pferd und reichte dem Bauern einen Louisdor mit den Worten: »Reiten Sie voraus, hier ist Ihr Lohn.«
»Danke«, erwiderte der andere, »wenn Sie mit mir zufrieden sind, werden Sie mich nach getaner Arbeit entlohnen.«
Der Bauer ritt voraus, René folgte.
Obwohl der Klepper des Bauern jämmerlich aussah, schlug er einen munteren Trab an, dessen Geschwindigkeit René zusagte, denn seine Reise würde durch den Führer keine Verzögerung erleiden.
Ohne Zwischenfälle erreichten sie Lagonegro.
René war aufgefallen, dass sein Führer unterwegs ab und zu mit Männern, die aus den Wäldern auftauchten und wieder dorthin verschwanden, einige Worte gewechselt hatte; er nahm an, dass der Mann aus der Gegend stammte und dass die Leute, mit denen er sprach, Bauern aus seiner Bekanntschaft waren.
René hatte guten Appetit; er ließ sich ein ausgezeichnetes Abendessen kommen und bestellte das gleiche Essen für seinen Führer; diesen hatte er gebeten, ihn bei Tagesanbruch zu wecken, denn am nächsten Abend mussten sie Laino oder Rotonda erreicht haben, und bis dahin war es noch eine lange Reise von zehn Meilen.
Der Tag verging wie der Vortag; das Pferd des Müllers schritt munter aus, weder zu schnell noch zu langsam, und so legten sie zwei Meilen in der Stunde zurück.
Auch an diesem Tag begegnete der Müller immer wieder an Schluchteingängen, hinter hohen Felsen oder mitten in Wäldchen Leuten, die er kannte und mit denen er einige Worte wechselte, bevor sie verschwanden.
Am nächsten Tag nahm Renés Führer nicht die Hauptstraße, wenn es denn zu jener Zeit in Kalabrien einen Weg gab, der diese Bezeichnung auch nur annähernd verdiente, sondern ritt zur Rechten weg, ließ Cosenza links liegen, und zur Schlafenszeit erreichten sie San Mango.
René erfuhr, dass er nur noch wenige Meilen von der französischen Armee entfernt war, die sich am Golf von Sant’ Eufemia befand; doch zugleich fiel ihm auf, dass der Wirt seine Fragen mit einer gewissen Dreistigkeit beantwortete und ihn mit unverhohlener Missgunst beäugte.
Daraufhin bedachte René den Wirt mit einem Blick, der ihn aufforderte, sich keine Dummheiten zu erlauben.
Der Wirt reichte René diensteifrig Zimmerschlüssel und Talglicht, denn Wachskerzen waren in Kalabrien unbekannt.
René stieg zu seinem Zimmer hinauf und stellte fest, dass der Schlüssel nur zur Zierde da war, denn das Türschloss bestand aus einem Nagel, um den ein Bindfaden geschlungen war.
Dennoch betrat er sein Zimmer, wo er sich angekleidet auf das erbärmliche Lager warf, nachdem er seinen Stutzen in Reichweite und die Pistolen auf ein Tischchen gelegt hatte.
Nach etwa einer Stunde war ihm, als hörte er Schritte im Zimmer nebenan und als machten diese Schritte vor seiner Zimmertür halt. Darauf gefasst, dass seine Tür geöffnet wurde, ergriff René eine der Pistolen und richtete sie auf die Tür.
Zu seinem großen Erstaunen blieb die Tür geschlossen, nachdem sie zweimal in ihren Angeln gebebt hatte; er nahm sein Licht in eine Hand, die Pistole in die andere und ging zur Tür, um sie zu öffnen.
Vor der Tür lag ein Mann; der Mann drehte den Kopf zur Seite, und René erkannte seinen Führer.
»Um Himmels willen«, sagte der Führer, »bleiben Sie in Ihrem Zimmer.«
»Warum?«, fragte René.
»Sie kämen keine zehn Schritte weit, bevor man sie ermordete.«
»Und was tust du hier?«
»Ich bewache Sie«, erwiderte der Führer.
René ging nachdenklich zu seinem Bett zurück, legte sich hin und schlief ein. Ihm war undeutlich, als hätte er die Stimme des Mannes schon einmal gehört.
113
General Reynier
General Reynier, dem René sich anschließen wollte, war im Jahr 1792 auf Empfehlung La Harpes in seiner Eigenschaft als Ingenieur in die Artillerie des Generalstabs von General Dumouriez aufgenommen worden; von Dumouriez zum Adjutanten befördert, nahm er an der berühmten Kampagne der Nordarmee in den Niederlanden teil, in der Husarenregimenter die holländische Flotte eroberten, indem sie über die zugefrorene Insel Texel stürmten; er wurde zum Brigadegeneral befördert und bald darauf zum Chef des Generalstabs der Rheinarmee unter Moreau.
Bonaparte nahm ihn nach Ägypten mit und vertraute ihm das Kommando über eine Division an. Diese Division bildete eines der Karrees, die den Sieg der Schlacht bei den Pyramiden errangen. Nach der Einnahme Kairos wurde General Reynier beauftragt, Ibrahim Bey aus Syrien zu vertreiben und den Oberbefehl über die Provinz Charki zu übernehmen. Die Loyalität, mit der General Reynier sich ausnahmslos betrug, brachte ihm die Achtung aller arabischen Völker ein.
Bonaparte verließ Ägypten. Das Oberkommando über die Armee hätte von Rechts wegen Reynier zugestanden, wurde aber Bonapartes Günstling Menou verliehen. Die Armee murrte, und eines Tages ließ Menou Reynier festnehmen, auf eine Fregatte bringen und ohne Erklärung nach Frankreich verschiffen.
Bei seiner Ankunft in Paris erfuhr Reynier, dass er bei Bonaparte in Ungnade gefallen war, und er musste sich auf sein Landgut im Nièvre (vormals Nivernais) zurückziehen.
Unbeugsame und stolze Menschen wie Reynier waren Napoleon stets suspekt; dennoch rief er ihn für die Kampagne von 1805 in den aktiven Dienst zurück, und nach der Schlacht von Austerlitz vertraute er ihm das Kommando über die Armee an, die für seinen Bruder Joseph das Königreich Neapel zu erobern hatte.
Josephs Amtseinführung verlief ohne Zwischenfälle, und da er sich vom Augenschein blenden ließ, prahlte er sogar in dem Briefwechsel mit seinem Bruder, dem Kaiser, mit dem Wohlwollen, das die Neapolitaner ihm bezeigten und das, wie er sagte, bei manchen bis zur Begeisterung reichte. Doch die lange Belagerung Gaetas, die den Großteil seiner Truppen erforderte, ermöglichte den einstigen Parteigängern der Bourbonen oder eher jenen Briganten, die jede Gelegenheit nutzen, ihr ruchloses Gewerbe mit einem patriotischen Banner zu schmücken, ihre Banden wieder zusammenzurufen und das Land mit ihren sogenannten politischen Überfällen zu überziehen, die in Wahrheit das Deckmäntelchen für Plünderungen und private Rachefeldzüge waren.
Daraufhin wurde Reynier mit einer Armee von sieben- bis achttausend Mann nach Kalabrien entsandt. Keine Stadt, keine Räuberbande wagte sich ihm entgegenzustellen; und so erreichte er Scilla und Reggio, und in beiden Städten errichtete er Garnisonen.
Doch Ferdinand und Caroline, die nach Palermo geflüchtet waren, hatten sich mittlerweile mit den Engländern verständigen können, ihren althergebrachten Verbündeten gegen die Franzosen.
Die Engländer schickten Schiffe vor die kalabrische Küste und versorgten die Aufständischen mit Geld, Schießpulver und Waffen, während sie in Messina eine Flotte ausrüsteten, die noch wirksamere Hilfe bringen sollte.
Reynier musste also jeden Tag damit rechnen, dass die Engländer Truppen an Land absetzten, während die Anführer der Räuberbanden wie Panedigrano, Benincasa, Parafante oder Il Bizzarro seinen Männern aus dem Hinterhalt auflauerten und sie bisweilen sogar im offenen Kampf töteten.
Schon vor über einem Monat hatte er König Joseph mitgeteilt, dass zahlreiche englische Agenten in Kalabrien eingetroffen waren, denen jedes Mittel recht war, das Volk zum Aufstand aufzuwiegeln, und er hatte mehrere Kolonnen gebildet, die sie verfolgten.
Dann verließ die englische Flotte die Meerenge von Messina.
Reynier schrieb unverzüglich an General Compère, den er mit zwei Bataillonen zwischen Scilla und Reggio postiert gelassen hatte, er solle nur so viele Männer in den Städten belassen, wie für den Schutz der Paläste und des Krankenhauses erforderlich waren, und mit den übrigen Soldaten am Fluss Angitola zu ihm stoßen, und er sandte Boten an alle verstreuten Regimenter, um sie aufzufordern, sich ebenfalls an besagtem Fluss zu konzentrieren.
Als Reynier in Monteleone ankam, erfuhr er, dass die Engländer im Schutz der Dunkelheit am Golf von Sant’ Eufemia an Land gegangen waren. Drei polnische Kompanien, die sich ihnen in den Weg gestellt hatten, waren unter großen Verlusten zurückgeschlagen worden und hatten sich hinter den Angitola zurückziehen müssen. General Digonet war nachts mit einer Kompanie polnischer Grenadiere und dem neunten Jägerregiment hinzugestoßen und kampierte am Lamato.
Reynier kampierte mit seinen etwa fünfzehnhundert Mann oberhalb des Angitola. Von dem Hochplateau aus hatte er ungehinderte Sicht über den ganzen Golf von Sant’ Eufemia. Der Gegner, sechs- bis siebentausend Mann stark, hatte seit der Landung seine Stellung nicht verändert und mit seinem rechten Flügel samt Feldbatterie am Fuß des Turms der Bastion Posten bezogen, mit dem linken im Dorf von Sant’ Eufemia. Die Engländer schickten Patrouillen nach Sambiase und Nicastro, bei deren Erscheinen in beiden Orten Aufruhr ausbrach; man hisste die rote Kokarde und verbündete sich mit den Engländern. Den ganzen Tag kamen Briganten in Trüppchen von zwanzig bis vierzig Mann den Berg hinunter und verstärkten die englischen Einheiten.
Von seinem Aussichtspunkt aus konnte Reynier all das sehen; er dachte sich, dass die Engländer immer mehr Verstärkung erhalten würden, je länger er wartete, und obwohl diese Verstärkung auf flachem Land nicht allzu sehr zu fürchten war, beschloss er, trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit seiner Truppen am nächsten oder übernächsten Tag die Engländer anzugreifen.
So kam es, dass Reynier an ebenjenem Tag, an dem René in Amantea übernachtete, von dem Hochplateau hinter dem Angitola herunterkam und am Fluss Lamato Stellung bezog, in der Nähe von Maida, damit er innerhalb von zwei Stunden den Gegner in dessen Zentrum angreifen konnte, zwischen Bergen und Meer, so dass die französischen Truppen sich einerseits außerhalb Reichweite der Gewehre der Briganten befanden, die am Fuß der Berge versammelt waren, und andererseits außerhalb der Reichweite der Geschütze auf den Schiffen, die vor der Küste warteten und den linken Flügel des Gegners bis in das Meer verlängerten.
Am Vorabend hatte René durch seinen Führer erfahren, dass die französische Armee nur mehr wenige Meilen von ihm entfernt war und dass er sie am nächsten Tag erreichen werde; am nächsten Morgen war er bei Tagesanbruch auf den Beinen und bewaffnet; er öffnete die Tür seines Zimmers und sah seinen Führer an der Wand lehnen, ebenfalls bereit.
Der Führer legte den Finger auf den Mund und bedeutete René, ihm zu folgen; dann führte er ihn nicht etwa zu einer Tür, sondern zu einem Fenster, vor dem eine Leiter stand.
Der Führer kletterte als Erster hinaus, René folgte ihm; ihre Pferde warteten gesattelt vor einem Hintertürchen.
Als René sah, dass der Führer sich anschickte wegzureiten, sagte er: »Halt, mir scheint, wir haben vergessen abzurechnen.«
»Das ist schon erledigt«, erwiderte der Führer, »beeilen wir uns lieber.«
Und er trieb sein Pferd zum Trab an, der René inzwischen so vertraut war.
Gegen acht Uhr morgens erreichten sie den Gipfel des Bergs von Sant’ Eufemia mit Blick über den ganzen Golf, die beiden Armeen und die Flotte, während am Horizont eine lange bläuliche Linie die sizilianische Küste anzeigte und mehrere dunkle Flecken auf dem Wasser und Rauch und Feuer, die von einer Insel in Zuckerhutform aufstiegen, Stromboli und sein Archipel bezeichneten.
René hielt einen Moment inne, um das prachtvolle Schauspiel zu genießen, das alle Schönheiten und alle Schrecknisse der Natur zusammenfasste: Berge, Wälder, Meer, Inseln, den Golf mit goldenem Sandstrand und an diesem Golf mit einer Meile Zwischenraum zwei Armeen, im Begriff, einander umzubringen.
»Wir sind da«, sagte der Führer. »Dort sind die Franzosen, und hier stehen ihnen die Engländer gegenüber, von deren Landung Sie gestern erfuhren.«
René kramte in der Tasche.
»Hier«, sagte er, »sechs Louisdors für dich statt der drei, die ich versprochen habe.«
»Danke«, sagte der Führer und schob Renés Hand weg. »Ich habe noch die Hälfte des Geldes, das Sie mir gaben, als Sie mich im Vicaria-Gefängnis verließen.«
René sah ihn verblüfft an. Der Mann lüpfte den Hut, nahm die Binde ab, die sein Gesicht zur Hälfte verdeckt hatte, und obwohl er Bart und Schnurrbart abrasiert hatte, erkannte René den Banditen, den er in den Pontinischen Sümpfen gefangen genommen hatte.
»Wie! Du bist hier?«, sagte er.
»Ja«, erwiderte der Bandit und lachte.
»Konntest du entfliehen?«
»Ja«, sagte der Bandit, »der Gefängniswärter war ein Freund von mir; durch Zufall bin ich Ihnen begegnet, und ich hatte nicht vergessen, was Sie für mich getan hatten.«
»Was soll ich denn für dich getan haben?«
»Sie hätten mich erschlagen können, aber Sie haben mein Leben verschont; ich verschmachtete vor Durst, und Sie ließen mir zu trinken geben, ohne dass ich darum bitten musste; ich hatte kein Geld, und als sie mich am Gefängnis absetzten, steckten Sie mir einen Louisdor zu. Brigant mag ich sein, aber Ehrenmann bin ich trotzdem. Ich habe einige Male aufgepasst, dass Sie nicht im Schlaf ermordet wurden; wir sind quitt.«
Diesmal trieb der Bandit sein Pferd nicht zum Trab an, sondern zum Galopp, und war verschwunden, bevor René sich von seinem Erstaunen erholt hatte.
René zuckte die Schultern, sagte sich: »Nicht zu glauben, in welchen Winkeln die Dankbarkeit sich einnistet!«, und richtete den Blick wieder auf den Strand, wo die Schlacht stattfinden würde.
In den Reihen der Engländer herrschte Unruhe, sie bewegten sich auf das Meer zu, und einen Augenblick lang wollte es René scheinen, als wären sie im Begriff, an Bord zu gehen; doch dann teilten sie sich in zwei Kolonnen auf und marschierten der Flussmündung entgegen, die sie durchquerten, da sie nur knietief war; ein Kriegsschiff, eine Fregatte und mehrere Kanonenboote begleiteten sie auf dem Meer; sie verlagerten ihre rechte Flanke zum Lamato hin, den sie offenbar überqueren wollten, um den Franzosen den Weg nach Monteleone abzuschneiden.
Nun marschierte die Kolonne, die den Fluss an seiner Mündung überschritten hatte, den Flusslauf hinauf und dem französischen Lager entgegen.
René konnte von seinem Platz aus beinahe die Soldaten beider Armeen zählen. Die Franzosen waren zahlenmäßig völlig unterlegen. Mit ihren Alliierten aus dem Räubergewerbe waren die Engländer an die achttausend Mann stark, denen die Franzosen nur fünftausend Mann entgegenstellen konnten.
Unterdessen war General Reynier offenbar zu der Ansicht gelangt, dass der Augenblick für einen Angriff günstig sei und dass er das Zentrum der gegnerischen Armee mit einer kraftvollen Attacke umso eher vernichten konnte, als die englische Armee durch den Flusslauf des Lamato zweigeteilt war; die englische Abteilung, die sich nahe dem Meer befand, konnte sich dann zwar auf die Schiffe retten, doch die andere Abteilung, die Reyniers linke Flanke überwältigen wollte, müsste in die Sümpfe oder in die Wälder von Sant’ Eufemia flüchten.
Gelang es Reynier, den Lamato zu überschreiten, konnte er den Engländern mit seiner Infanterie, seiner leichten Artillerie und seiner Kavallerie entgegentreten (wobei die Kavallerie sich leider auf einhundertfünfzig Jäger beschränkte), überließ er aber den Lamato den Engländern, musste er alle Vorteile einbüßen, da er gezwungen wäre, auf einem Terrain zu kämpfen, das von Schluchten durchzogen und von Sümpfen durchsetzt war, in denen er weder seine Artillerie noch seine Pferde zum Einsatz bringen konnte.
Eine Viertelmeile vom Ort des Geschehens entfernt, sah René, wie General Reynier zwei Kompanien von Schützen abzog, damit diese den Vormarsch der englischen Kolonne störten, die den Lamato an der Mündung überschritten hatte, und wie unter dem Kommando eines Generals, den er nicht kannte, zwei Regimenter von annähernd zweieinhalbtausend Mann den Lamato überquerten und am jenseitigen Ufer in Gefechtsstellung gingen. Ihnen folgten das vierte Schweizer Bataillon und zwölf Kompanien des polnischen Regiments, ungefähr fünfzehnhundert Mann.
Das dreiundzwanzigste Regiment der leichten Infanterie unter General Digonet begab sich an die äußerste rechte Flanke, und die vier leichten Artilleriegeschütze und die hundertfünfzig Reiter bezogen in der Mitte Aufstellung.
Dann befahl General Reynier General Compère, sich an die Spitze des ersten Regiments zu setzen und gestaffelt den Engländern entgegenzumarschieren, während Schweizer und Polen als zweite Linie folgen sollten und das dreiundzwanzigste Infanterieregiment, das zu weit nach rechts abgeschwenkt war, sich den Schweizern nähern und ebenso wie General Compère alle Anstrengungen auf das Zentrum des englischen Heeres richten sollte.
Zum ersten Mal erlebte René eine geordnete Feldschlacht mit: Vor Neugier war er wie gebannt; zudem fragte er sich, was in einem solchen Gewimmel ein Mann mehr oder weniger bewirken sollte.
Die zwei Attacken wurden mit großer Ruhe und Kaltblütigkeit vorgetragen; General Compère ging an der Spitze der Soldaten. Als die Engländer die Franzosen kommen sahen, warteten sie bis auf halbe Gefechtweite, ohne zu schießen.
Dann gab das erste Regiment Signal zum Angriff und stürmte voran, vom zweiundvierzigsten Regiment gefolgt.
General Compère befand sich mit seinen zwei Ordonnanzen und seinem Leutnant in dem Zwischenraum zwischen den beiden Heeren.
Als die Franzosen sich den Engländern bis auf fünfzehn Fuß genähert hatten, feuerten die Engländer der ersten und der zweiten Reihe.
Die Franzosen marschierten unverdrossen weiter, wurden jedoch von neuem Gewehrfeuer begrüßt, nachdem die Männer aus der dritten englischen Reihe ihre geladenen Gewehre nach vorne gereicht hatten.
General Compère stürzte nach dieser Salve zu Boden, an Kopf und Arm getroffen.
Als die Franzosen ihren General am Boden sahen, ergriffen die Soldaten des ersten Regiments die Flucht, woraufhin die Soldaten des zweiundvierzigsten Regiments unschlüssig verharrten. René erkannte, dass diese Panik im Handumdrehen die ganze Armee überwältigen konnte; die Hufe seines Pferdes schienen sich wie von allein vom Boden zu lösen, und ohne zu überlegen, ob ihn unterwegs noch andere Hindernisse erwarteten als das abschüssige Terrain, gab er dem Pferd die Sporen und befand sich eine Sekunde später mitten unter den Flüchtenden, in jeder Hand eine Pistole.
Zuerst versuchte er die Flüchtenden aufzuhalten; doch als er sah, dass die Soldaten, die er aufhalten wollte, ihn mit ihren Gewehren bedrohten, sprang er vom Pferd und kümmerte sich um den verwundeten General, den die Engländer entführen wollten, nachdem sie gemerkt hatten, dass er nicht tot war, sondern nur verwundet, und den seine Adjutanten verzweifelt verteidigten.
Mit zwei Pistolenschüssen und zwei Schüssen aus dem Stutzen sorgte René für etwas Luft um den Verwundeten; da Pistolen und Stutzen entladen waren, hängte er den Stutzen an seinen Sattel, steckte die Pistolen in ihr Halfter, ergriff ohne abzusteigen einen Kavalleriesäbel vom Boden und preschte auf die fünf oder sechs Engländer los, die sich noch immer um den General herum aufhielten.
René handhabte den Säbel ebenso gewandt wie den Degen: In wenigen Sekunden waren drei der Engländer tot oder verwundet, und die drei anderen ergriffen die Flucht; einer von ihnen wurde dabei von einem der Adjutanten des Generals erschossen. Diesen Augenblick des Atemholens nutzte René, um seine Waffen zu laden.
Unterdessen hatte Reynier sich unter die Flüchtenden geworfen, begleitet von seinen hundertfünfzig berittenen Jägern; von seinem Feldherrenhügel aus hatte er voller Staunen gesehen, wie René sich in den Kampf gestürzt und gekämpft hatte. Da ihm Renés Uniform unbekannt war, zögerte er einen Augenblick, doch dann sagte er sich, dass sie das Herz eines tapferen Mannes bedeckte, und rief ihm zu: »Übernehmen Sie das Kommando über diese Männer, und tun Sie Ihr Bestes!«
»Wollt ihr mich als euren Anführer?«, rief René.
»Ja«, antworteten die Soldaten wie aus einem Mund.
Daraufhin nahm René seinen Hut auf die Spitze seines Säbels, stürzte sich gegen die englische Schlachtlinie, warf den Hut mitten unter die Engländer, erlegte einen Gegner mit einem Säbelhieb und rief: »Zwanzig Louisdors für den, der mir meinen Hut zurückbringt.«
Und die Soldaten, angefeuert durch ihren Mut und durch die Hoffnung auf Belohnung, zerteilten die Reihen der Engländer und gelangten bis zur dritten Reihe, doch dort kamen sie nicht weiter. René klemmte sich den Säbel zwischen die Zähne, nahm seine Pistolen aus dem Halfter und schoß zwei Männer nieder; dann steckte er die Pistolen wieder ein, nahm den Säbel wieder zur Hand, hob damit seinen Hut auf, den er als Einziger erreicht hatte, und sagte: »Nun gut, es sieht ganz so aus, als hätte ich meine zwanzig Louisdors gewonnen.«
Hinter ihm hatten sich die Reihen der Engländer geschlossen; er hatte zwei gegnerische Reihen durchquert, durchquerte nun die dritte, indem er zwei Männer niederstreckte, und fand sich als einziger Franzose hinter der englischen Armee wieder.
Offiziere zu Pferd umringten General Stuart, und zwei von ihnen kamen René entgegen.
René begriff, dass man ihm ein Duell anbot, nur dass es sich um ein Duell handelte, bei dem zwei gegen einen kämpften.
Er ließ sein Pferd anhalten, schoss mit seinem Stutzen aus fünfzig Fuß Entfernung auf einen der Reiter und aus zwanzig Fuß Entfernung auf den zweiten; beide stürzten zu Boden.
Daraufhin löste sich ein dritter Reiter aus der Gruppe, der seinen Säbel schwenkte und damit bedeutete, dass er einen Kampf mit blanker Waffe vorschlug. René befestigte seinen Stutzen am Sattel und galoppierte dem neuen Gegner entgegen.
Und wie im Altertum oder im Mittelalter boten René und sein Widersacher, homerischen Helden oder unerschrockenen Rittern vergleichbar, das Schauspiel eines Kampfes, den beide Kombattanten mit größtem Mut und Einsatz führten.
Nach zehn Minuten musste der Engländer sich ergeben, an der rechten Hand verwundet und Renés Säbelspitze vor der Brust.
»Monsieur«, sagte er daraufhin in tadellosem Französisch zu René, »wären Sie bereit, mich auf Parole zu meinem General zurückkehren zu lassen? Ich möchte ihm etwas sagen.«
»Gehen Sie, Monsieur.«
René nutzte die Atempause, um seine Waffen zu laden und wieder an ihrem Platz unterzubringen.
Kurz darauf sah er den englischen Offizier zurückkommen, den rechten Arm verbunden und in der Linken seinen Säbel mit einem weißen Taschentuch an der Spitze.
»Was bedeutet dieses weiße Taschentuch?«, fragte René lachend. »Kommen Sie als Unterhändler, um mich aufzufordern, mich zu ergeben?«
»Ich komme, um Sie zu bitten, mir zu folgen, Monsieur; und damit Ihnen kein Ungemach widerfährt, wenn Sie abermals die Reihen unserer Armee durchqueren, um zu Ihrer Armee zurückzugelangen, hat General Stuart mich beauftragt, als Ehrenbezeigung unsere Reihen für Sie zu öffnen.«
»Sollte General Stuart etwa der Ansicht sein, ich verstünde sie mir nicht selbst zu öffnen?«
»Keineswegs, Monsieur, doch er legt so großen Wert darauf, dass Sie wohlbehalten aus der Lage zurückkehren, in die Sie sich begeben haben, dass er mich bat, Ihnen auszurichten, er werde selbst Ihr Führer sein, wenn Sie mich nicht als Führer annähmen.«
»Du lieber Himmel«, sagte René, »dafür wollen wir ihn nicht bemühen. Reiten Sie voran, Monsieur, wenn es Ihnen recht ist, ich folge Ihnen.«
Unterdessen war der Ausgang der Schlacht entschieden worden: General Compère war gefangen genommen worden, der Bataillonschef des ersten Regiments war gefallen, der Bataillonschef der Schweizer war lebensgefährlich verwundet und der des dreiundzwanzigsten Regiments verwundet; die Verbindung zu Monteleone war unterbrochen, die französische Armee wurde von der englischen Armee verfolgt und befand sich auf dem Rückzug durch das Lamatotal.
Die englische Armee schrak davor zurück, sich in das Tal zu begeben, und gewährte General Reynier einen ungestörten Rückzug.
Renés Führer rief mit lauter Stimme: »Salutiert auf Befehl General Stuarts!«
Die Soldaten gehorchten, und René durchschritt eine doppelte Reihe erhobener Gewehre.
So gelangten sie zu der Stelle, wo die englische Vorhut innegehalten hatte.
»Monsieur«, sagte René zu seinem Führer, »niemand als Sie kann General Stuart meinen Dank angemessen ausdrücken; ich entlasse Sie unter der einzigen Bedingung, dass Sie ihm meinen innigen Dank aussprechen.«
Er gab seinem Pferd die Sporen, nachdem er den Gefangenen gegrüßt hatte, dem er die Freiheit gegeben hatte, und gesellte sich zu der französischen Nachhut, die erst bei Catanzaro anhielt, anders gesagt: sechs Meilen entfernt.
114
In welchem Kapitel René sieht, dass Saliceti sein Wort gehalten hat
René hatte sein Biwak mitten unter den Trümmern des neunten Jägerregiments aufgeschlagen, mit dem zusammen er auf Befehl Reyniers die englische Infanterie angegriffen hatte.
Die tapferen Männer, die ihm gefolgt waren und gesehen hatten, mit welcher Tollkühnheit er in die Reihen der Engländer eingedrungen und in ihnen verschwunden war, hatten ihn tot gewähnt. Als sie ihn nun erblickten, begrüßten sie ihn mit Freudenrufen, und jeder von ihnen gab ihm von dem Stroh ab, das sie sich als Bett zusammengerafft hatten, und ebenso von den Lebensmitteln, die ihr Abendessen bildeten.
René nahm eine Handvoll Stroh, breitete seinen Mantel darüber und nahm ein Brot, dessen Hälfte er seinem Pferd zu fressen gab.
Am nächsten Morgen weckte ihn bei Tagesanbruch ein Adjutant General Reyniers, den der befehlshabende General beauftragt hatte, den jungen Mann zu finden, der in der Uniform eines Marineleutnants so tapfer gekämpft hatte. Falls er nicht gefallen oder gefangen genommen war, wäre er leicht aufzufinden, da er der Einzige in solch einer Uniform war.
René erhob sich, schüttelte sich, bestieg sein Pferd und folgte dem Adjutanten, der ihn zum Gemeindehaus brachte, wo Reynier seinen Stützpunkt errichtet hatte.
René betrat das Ratszimmer, das der General zu seinem Arbeitszimmer gemacht hatte; Reynier lag halb auf einer großen Karte Kalabriens, auf der jedes einzelne Haus, jeder Baum, jeder Hohlweg markiert war; in den Leuchtern herabgebrannte Kerzen und erloschene Lampen verrieten, dass er bis zum Morgengrauen gearbeitet hatte.
Bei den Worten »General, hier ist der Offizier, nach dem Sie schicken ließen« wandte er sich zu René um, richtete sich auf und winkte René zu sich.
»Monsieur«, sagte General Reynier, »Sie haben gestern so außerordentlichen Mut bewiesen, dass ich annehmen darf, Sie sind kein anderer als der junge Mann, den Saliceti und jemand in noch höherer Stellung mir nachdrücklich empfohlen haben. Sie sind Graf Leo, nicht wahr?«
»Ja, Monsieur.«
»Sie haben Saliceti Ihren Wunsch mitgeteilt, mit mir zu beratschlagen, wie Sie in meiner Armee dienen können.«
»Und er sagte mir, General, dass das, was ich wünsche, zum Wohl unserer Sache ist und Sie es mir deshalb sicherlich gewähren werden.«
»Sie müssen hungrig sein«, sagte Reynier, »denn ich nehme an, dass Sie bei Catanzaro nicht allzu viel zu essen bekommen haben; wir werden miteinander speisen, und dabei können wir uns in Ruhe unterhalten.«
Zwei Soldaten trugen einen gedeckten Tisch herbei: vier Koteletts, zwei Hühnchen, einer jener Käse, die man von den Zimmerdecken der Lebensmittelläden hängen sieht und die in Kalabrien cacciocavallo heißen, sowie eine Flasche kalabrischen Weins bildeten die ganze Mahlzeit.
»Ich habe die Nacht darauf verwendet«, fuhr der General fort, »all meinen Leutnants zu schreiben, dass wir unsere Truppe auf Catanzaro konzentrieren müssen. Sobald sich die Nachricht unserer gestrigen Niederlage verbreitet, wird ganz Kalabrien sich gegen uns erheben. Als ich gestern hierher zurückkehrte, hatten einige Vorwitzige bereits die weiße Fahne statt der Nationalfahne gehisst und rote Kokarden statt solcher mit der Trikolore ausgegeben. Noch am Abend habe ich den Bürgermeister und seinen Adjunkten arretieren lassen; heute Nacht dürften sie verhört worden sein, und wenn sie mit dieser Sache auch nur das Geringste zu tun haben, werden sie heute Vormittag füsiliert. Im Lauf des Tages hoffe ich, dem König zu schreiben; sollten Sie in unserer derzeitigen Lage irgendeinen Ausweg sehen, der mir entgangen ist, sagen Sie es frei heraus, und ich werde die Schwachstelle unseres Panzers sofort flicken lassen.«
»Mein General«, sagte René, »Sie erweisen mir zu viel der Ehre; ich bin weder Stratege noch Ingenieur; und da ich gestern mitten in der englischen Armee steckte und vollauf damit beschäftigt war, meine Haut zu retten, konnte ich wenig oder fast nichts sehen.«
»Ja, ich weiß, dass Sie einen großartigen Kampf gegen drei englische Offiziere bestanden und zwei der Offiziere getötet und den dritten gefangen genommen haben; ich weiß auch, dass Sir James Stuart in Bewunderung Ihrer Tapferkeit verboten hat, auf Sie zu schießen, und den Befehl erteilt hat, Sie nicht nur nicht etwa unter einem kaudinischen Joch hindurchzuführen, sondern Ihnen im Gegenteil ein Ehrengeleit zu geben. Langen Sie tüchtig zu, junger Mann, solche Taten machen Appetit.«
René ließ sich nicht lange bitten; er aß wie jemand, der den ganzen Tag gekämpft hatte, ohne etwas zu sich zu nehmen.
Reynier, der dem Beispiel seines jungen Gasts folgte, fuhr fort: »Alles, was ich mit eigenen Augen gesehen habe und was man mir über Ihr gestriges Tun berichtet hat, macht es mir zur Pflicht, Sie ernsthaft zu fragen, welchen Dienst Sie bei mir zu verrichten wünschen.«
»Wenn Sie meinen Wünschen Gehör schenken wollen, General, dann wünschte ich mir eine Freischärlertruppe, deren Anführer und Meister ich sein darf und mit der ich Aufklärungsdienste auf den Straßen tun könnte; die Truppe würde ich aus Meisterschützen zusammenstellen, und wir könnten Ihnen sehr gute Dienste leisten. Sie sprachen von den Banditen, die einen Aufruhr anzetteln wollen: Nun, wäre es nicht ratsam, eine leichte Reitertruppe gegen diese ehrenwerte Gesellschaft aufzustellen, die uns so gerne aus dem Hinterhalt überfällt und sich im Handumdrehen in Luft auflöst? Einige dieser Banditen hat Saliceti mir genannt, und ich habe sogar gelobt, einen von ihnen zu fassen!«
»Schon morgen«, sagte Reynier, »können Sie damit beginnen. Wie viele Männer benötigen Sie?«
»Weder zu viele noch zu wenige«, erwiderte René, »vierzig bis fünfundvierzig Männer dürften genügen.«
»Sie werden sie morgen selbst unter den besten Schützen auswählen, und es wäre sicher nicht von Nachteil, dass diese Geschichte über die Gewehrschüsse hinaus hörbar wird. Dem Gegner haben Sie bereits großen Schrecken eingejagt, und die Proben ihres Könnens, die unsere Schützen morgen ablegen werden, dürften diesen Schrecken nicht unbeträchtlich steigern; es steht Ihnen frei, eine Bande Ihrer Wahl zu verfolgen, bis kein Bandenmitglied mehr übrig ist. Ein Mann wie Sie an der Spitze von fünfundvierzig Männern kann sich überall frei bewegen. Sie werden zu meinem Adjutanten ernannt, und wenn ich irgendwelche wichtigen Befehle zu erteilen haben sollte, werde ich Sie damit beauftragen.«
»Sie ermächtigen mich also, meine Männer selbst auszusuchen?«
»Wen werden Sie wählen?«
»Die besten Schützen. Außerdem«, fuhr René fort, »bitte ich, dass Sie mir erlauben, diese Männer besser zu bezahlen, da ich ihnen größere Strapazen abverlangen und sie häufiger Gefahren aussetzen werde als ihren Kameraden.«
»Ich wüsste nicht, was dagegen spräche, außer dass es Neid wecken und mich am Ende meiner ganzen Armee berauben könnte, sollten Sie reich genug sein, sie zu bezahlen; und die Gelegenheit ist günstig, den Banditen auf die Schliche zu kommen, denn unsere gestrige Niederlage wird sie zum Mahl der Raben und Schakale locken.«
»General, haben Sie die Güte zu befehlen, dass alle Berichte, die Ihnen über die Briganten vorgelegt werden, auch zu mir gelangen.«
»Seien Sie unbesorgt, suchen Sie Ihre Männer aus, üben Sie mit ihnen das Schießen, und möge Gott Sie geleiten! Mich hier kann man nicht vor zwei Wochen entsetzen, vorausgesetzt, die anderen beeilen sich, doch mit den fünf-, sechstausend Mann, die ich zusammenziehen kann, kann ich ganz Kalabrien die Stirn bieten. Und die Engländer werden es niemals wagen, ins Landesinnere vorzudringen, um mich anzugreifen.«
»General, da alles zwischen uns geregelt ist, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie für morgen eine Schießübung ansetzen wollten; jedes Regiment soll seine fünfzig besten Schützen mit jeweils drei Gewehrladungen schicken; der beste Schütze wird mit einer goldenen Uhr belohnt, der zweitbeste mit einer silbernen Uhr und der drittbeste mit einer silbernen Kette mit Schießschnur. Dann werde ich unter den besten Schützen meine fünfundvierzig Mann auswählen, die neben ihrem gewöhnlichen Sold zusätzlich einen Franc am Tag bekommen werden.«
»Können Sie sich diese Ausgaben lange genug leisten?«
»Solange ich in Ihren Diensten stehen werde, General, und das wünsche ich so lange wie möglich zu tun.«
Der General ließ jedes Regiment mit einem Trommelwirbel zusammenrufen und ließ verkünden, dass am nächsten Tag die fünfzig besten Schützen jedes einzelnen Regiments zur Schießstätte zu kommen hätten. Die drei Belohnungen waren das Verlockendste, was Graf Leo – wie ihn die Soldaten und ihre Anführer nannten – in Catanzaro hatte auftreiben können, sicherlich verlockend genug, um den Ehrgeiz der Schützen zu wecken.
Im Lauf des Tages fanden sich an die hundert Soldaten im Lager ein, die sich nach der Schlacht verirrt hatten.
Als am Tag darauf die Schießübung stattfinden sollte, ergriff Graf Leo das erstbeste Gewehr, um zu zeigen, dass es galt, den Gewandtesten zu übertreffen, und schoss drei Kugeln ins Schwarze.
Dann begann der Wettkampf.
Vierhundert Schützen waren angetreten; dreiundfünfzig Kugeln waren aus einer Entfernung von hundertfünfzig Schritt in den roten Ring um den schwarzen Mittelpunkt gefeuert worden; drei Einschüsse hatten den äußeren Rand des roten Kreises getroffen, und so blieben fünfzig Sieger übrig, die auf der Stelle als Jäger des Grafen Leo verpflichtet wurden, abgekürzt: Löwenjäger.
Die drei Preise wurden an die drei besten Schützen verliehen, und die siebenundvierzig Schützen, die in den roten Kreis getroffen hatten, erhielten jeder fünf Francs; jeder der vierhundert Teilnehmer bekam einen Franc Belohnung.
In Catanzaro stellte Graf Leo General Reynier die drei Sieger vor; der erste Sieger wurde zum Sergeanten ernannt, die beiden anderen zu Korporalen; dann stellte er ihm die siebenundvierzig Soldaten vor, die zu seiner Truppe zählen würden, und zuletzt die übrigen Teilnehmer.
Damit der Tag für alle ein Festtag war, entband der General sie von ihrem Dienst und forderte sie auf, sich zu vergnügen, ohne über die Stränge zu schlagen; dann bedeutete er René, dass er mit ihm sprechen wolle.
René folgte ihm.
Ein Bauer hatte gemeldet, dass die Stadt Cotrone von zwei Bandenchefs erobert worden war, die Santoro und Gargaglio hießen.
Dies ließ er den Bauern in Renés Gegenwart wiederholen; dann sagte er zu ihm: »Sehen Sie, es geht los.«
Doch Cotrone zurückzuerobern, stand nicht in Renés Macht, denn mit seinen fünfzig Schützen konnte er keine Belagerung durchführen.
General Reynier schickte unter dem Kommando eines Bataillonschefs einige Milizen, die den Banditen keine Atempause ließen, sie angriffen und als Erstes die Vororte zurückeroberten, so dass die Belagerten sich in das Innere der Stadt zurückziehen mussten. Am Abend des zweiten Tages waren sie so wagemutig, einen Ausfall zu versuchen, und wurden unter Verlusten zurückgeschlagen.
Der Bataillonschef hoffte, am Tag darauf sein Werk zu vollenden und die Stadt einzunehmen; doch zwei englische Slups näherten sich dem Meeresufer; der Anblick dieser Verstärkung machte den Banditen neuen Mut, und noch am selben Tag unternahmen sie zwei Ausfälle, die beide zurückgeschlagen wurden; daraufhin luden die Engländer vier große Kanonen ab und halfen den Briganten, sie auf der Stadtmauer anzubringen.
Die Franzosen erkannten, dass eine regelrechte Belagerung vonnöten sein würde; General Reynier wurde informiert, und er schickte den Belagerern General Camus mit einer Kompanie, damit dieser die Belagerung leitete, und dann ließ er Graf Leo zu sich rufen.
»Wie weit sind Sie mit Ihrer Kompanie?«, fragte er ihn.
»Sie ist aufgestellt, sie könnte nicht besser funktionieren, und ich warte nur noch auf Ihre Befehle.«
»Setzen Sie sich«, sagte der General, »und Sie werden sie erhalten.«
115
Das Dorf mit Namen Li Parenti
»Ich habe eine schlechte Nachricht erhalten, mein lieber Graf: Eine Kompanie des neunundzwanzigsten Regiments, die aus Cosenza aufbrach, um mir Verstärkung zu bringen, musste in den Bergen um Scilla den Wald durchqueren, in dem das Dorf namens Li Parenti gelegen ist, einer der abscheulichsten Brigantenschlupfwinkel von ganz Kalabrien.
Unter dem Vorsitz eines berüchtigten Räuberhauptmanns aus der Basilikata überlegten die Hauptbourbonen des Dorfs lange, ob sie sich in den Hinterhalt legen oder ob sie die Kompanie mittels einer List in das Dorf locken und dort niedermachen sollten, bevor jene wussten, wie ihnen geschah.
Am helllichten Tag ein Detachement von achtzig gut bewaffneten Soldaten anzugreifen, deren jeder achtzig Schuss Munition in seiner Patronentasche mit sich führte, war ein gefährliches Unterfangen, das wohl erwogen sein wollte.
Und man beschloss, ihnen einen Hinterhalt zu bereiten.
Der Räuberhauptmann heißt Taccone und hat sich durch die unvorstellbaren Gräueltaten, die er sowohl 1799 als auch 1806 und 1807 an den Franzosen verübt hat, den Spitznamen Il Boia – der Henker – erworben. Er ging in Begleitung einiger Einheimischer den Franzosen entgegen, und als er ihnen begegnete, gab er sich als Hauptmann der Nationalgarde aus, der mit zwei Leutnants gekommen war, um den französischen Soldaten Erfrischungen und Gastfreundschaft in dem Dorf anzubieten.
Der Hauptmann wusste zwar, dass er der vorgespielten Liebenswürdigkeit der Einheimischen nicht trauen durfte, doch er und seine Offiziere ließen sich mit typisch französischer Vertrauensseligkeit von der geheuchelten Herzlichkeit einwickeln und waren so unvorsichtig, ihren Männern zu befehlen, die Waffen vor dem Gemeindehaus abzustellen, in dem die Erfrischungen warteten; die Franzosen traten ein und aßen und tranken voller Sorglosigkeit. Nach zehn Minuten ertönte ein Pistolenschuss als Signal, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Salve.
Der Hauptmann und die zwei Leutnants, die sich im selben Raum befanden, waren auf der Stelle tot; die Soldaten eilten hinaus, doch dort erwarteten sie die Bauern mit einem Geschosshagel aus ihren eigenen Gewehren.
Nur sieben Soldaten konnten sich retten; sie sind nachts in unserem Lager angekommen und haben die schreckliche Neuigkeit berichtet.«
»Aha«, sagte René, »diesem Herrn Taccone muss man also schleunigst einen Denkzettel verpassen.«
»Ja, lieber Freund, aber vorher müssen Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Taccone ist keineswegs der feige Meuchelmörder, der am liebsten mit Fallen und aus dem Hinterhalt operiert, wie Sie nach meinem Bericht denken könnten; so manches Mal hat er gegen unsere tapfersten Soldaten gekämpft und konnte sie dank seiner günstigen Position, dank seiner genauen Kenntnis der Gegend oder dank der Dunkelheit besiegen; und wenn er nicht siegte, erstaunte er sie durch unerwartete Manöver …
Oft machte er seinen Leuten mitten im Kugelhagel ein Zeichen, sobald er genug Deckung hatte, und daraufhin verstreuten sie sich in alle Himmelsrichtungen. Wenn unsere Männer dann die leichtfüßigen Bergbewohner zu verfolgen suchten, wiederholte sich die alte Geschichte von Horatiern und Curiatiern: Die Banditen machten unvermutet kehrt, jeder von ihnen griff einen keuchenden, erschöpften Gegner an, und bevor der französische Soldat wusste, wie ihm geschah, hatte ihn eine Kugel oder ein Messer getroffen.
Stieß der Bandit auf einen Soldaten, der sich mannhaft verteidigte, dann floh er einfach, und wer soll einem Kalabresen auf den Fersen bleiben, der in die Berge flieht?
Taccone ist der Wagemutigste und Grausamste aus seiner ganzen Bande, und diesen Eigenschaften verdankt er seine Autorität über seine Gefährten; bei diesen wilden Banditen ist der Titel Hauptmann nicht wohlfeil; wer in den Bergen kommandiert, der ist des Kommandos auch würdig.
Taccone gilt zudem als schnellster Läufer seiner Räuberbande; man sollte meinen, Homers schnellfüßiger Achill hätte ihm seine goldene Chlamys vererbt oder Jupiters Bote Merkur hätte ihm seine Flügel an die Fersen geheftet, denn er springt so schnell wie der Blitz oder wie der Wind von einem Ort zum anderen.
Einmal hatten unsere Soldaten ihm in einem Wald heftig zugesetzt, und es sah ganz so aus, als wollte er ihnen lange Widerstand bieten; doch kaum war die Nacht hereingebrochen, verschwand er im Schutz der Dunkelheit so plötzlich wie ein Gespenst, seine Männer entschwanden mit ihm, und am nächsten Tag fand er sich vor Potenza ein, das er über Pfade erreicht hatte, die zu begehen man nur Gemsen und wilden Ziegen zutrauen würde.
Vergessen Sie nicht, lieber Graf, dass Potenza kein Dorf und keine Kleinstadt ist, sondern eine ansehnliche Stadt von acht- bis neuntausend Einwohnern. Diese acht- oder neuntausend Bewohner begaben sich in ihre Häuser und verschlossen Fenster und Türen, als sie die Räuberbande erblickten, die wie vom Himmel gefallen vor den Stadttoren stand, und die furchterregende Stimme Taccones hörten, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden, sich ihm zu widersetzen.
Und König Taccone, denn so nannte man ihn, bevor man ihn den Henker Taccone nannte, schickte einen Herold in die Stadt, der anordnete, dass alle zivilen, religiösen und militärischen Autoritätspersonen sich unverzüglich zu ihm zu begeben hatten – andernfalls würde die Todesstrafe ihrer harren und ihre Häuser würden niedergebrannt.
Eine Stunde später war ein seltsames Schauspiel zu sehen: Die Geistlichkeit ging voran, gefolgt von den Vertretern der Behörden, und diesen folgte die ganze Bevölkerung, um einem Anführer von Briganten zu huldigen und ihn auf den Knien und mit gefalteten Händen um Gnade zu bitten. Taccone ließ sie eine Weile die Demütigung auskosten und beschied sie dann mit der Großherzigkeit eines Alexander, der die Familie des unterlegenen Dareios aus dem Staub aufhebt, in den sie sich vor ihm geworfen hat: ›Erhebt euch, ihr Unseligen, denn ihr seid meines Zorns nicht würdig; gnade euch Gott, wenn ich zu einer anderen Zeit gekommen wäre, doch heute ist mein Herz dem Erbarmen geöffnet, da ich mich mithilfe der Heiligen Jungfrau von meinen Feinden befreien konnte; heute ist ein Festtag und ein Tag des Triumphs für alle Gerechten, und an diesem Tag will ich mich nicht mit eurem Blut besudeln, obwohl eure schändlichen Ansichten mich drängen, es zu vergießen. Aber freut euch nicht zu früh, denn gänzlich straffrei werdet ihr nicht ausgehen: Weil ihr euch gegen euren König empört habt und weil ihr euren Gott verleugnet habt, werdet ihr innerhalb einer Stunde die Steuer entrichten, die mein Sekretär euch nennen wird. Auf, erhebt euch und schickt Boten in die Stadt, damit ein meines Sieges würdiges Fest ausgerichtet wird; alle, die ihr hier weilt, werdet ihr mich begleiten und Lobgesänge singen, bis wir die Kathedrale erreichen, wo Monsignore ein Tedeum anstimmen wird, um dem Allerhöchsten für den Sieg unserer Waffen zu danken. Und jetzt auf die Beine und vorwärts!‹
Das Volk sang die heiligen Hymnen im Chor zusammen mit den Banditen, Olivenzweige in Händen, und Taccone näherte sich dem Dom auf einem Pferd, das mit Glöckchen, Federn und einer seidenen Pferdedecke herausgeputzt war, während er das Tedeum sang. Als die Steuer bezahlt war, machte die Bande sich aus dem Staub, doch nicht ohne eine weit kostbarere Beute als Gold und Silber mitzunehmen.
Beim Betreten der Stadt blickte der Triumphator hocherhobenen Kopfes neugierig in Fenster und Türen, als suchte er im Inneren der Häuser nach etwas.
Ein junges Mädchen hob schüchtern den Vorhang eines Fensters und zeigte sein Gesicht voll Liebreiz der Jugend und der Schönheit. Da hielt der Bandit sein Pferd an und heftete seinen Blick auf das junge Geschöpf; er hatte gefunden, was er suchte.
Als hätte es verstanden, dass es verloren war, trat das Mädchen einen Schritt zurück und bedeckte sein Gesicht mit den Händen.
Taccone sagte leise etwas zu zweien seiner Männer, und sie gingen in das Haus.
Als Taccone die Kirche verließ, sah er einen Greis vor sich, den Großvater des jungen Mädchens, dessen Vater tot war. Er war gekommen, um Taccone anzubieten, das junge Mädchen um jeden Preis auszulösen.
›Du irrst dich, Alterchen‹, sagte Taccone, ›mit meinem Herzen lasse ich nicht feilschen; deine Enkelin ist schön, ich liebe sie; sie will ich und nicht dein Geld.‹<
Der alte Mann wollte Taccone in den Arm fallen, doch dieser stieß ihn mit einem Faustschlag von sich; er kniete vor dem Briganten nieder, doch der stellte ihm einen Fuß auf die Schulter und warf ihn zu Boden, und dann bestieg er sein Pferd. Das in Tränen aufgelöste Mädchen wurde vor ihm über den Sattel gelegt, und dann verließ er die Stadt im Schritt, ohne dass jemand sich diesem Menschenraub zu widersetzen versucht hätte, und entführte die Jungfrau, die keine anderen Küsse als die ihrer Mutter gekannt hatte.
Das junge Mädchen wurde nie wieder in Potenza gesehen.
Taccone reihte als Bandit Erfolg an Erfolg; als er Potenza verließ, machte er sich auf den Weg zum Schloss des Barons Federici, eines erklärten Gegners der Bourbonen.
Obwohl der Baron aus heiterem Himmel überfallen wurde, blieb ihm genug Zeit, die Schlosstore zu schließen, nachdem er einige seiner Vasallen hereingeholt hatte; die Heftigkeit der Angreifer erwiderte er mit verbissenem Widerstand.
Der Kampf währte von morgens bis abends, und nicht wenige Tote blieben am Fuß der Schlossmauern liegen.
Doch das Unglück der Belagerten wollte, dass sie abends feststellen mussten, dass ihnen bei einem so erbittert fortgeführten Kampf die Munition am nächsten Nachmittag ausgehen würde.
Die Banditen begrüßten den Tagesanbruch mit einer entsetzlichen Gewehrsalve; nachdem sie eine Stadt eingenommen hatten, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben, empfanden sie es als Schmach, vor einer einfachen Festung aufgehalten zu werden; sie erkannten, dass der Widerstand nicht so bald zu brechen sein würde, solange die Bauern dem Beispiel ihres Lehnsherren folgten und zudem um Leib und Leben fürchteten, doch sie wussten auch, dass die Munitionsvorräte der Belagerten schnell schwanden, selbst wenn diese nur gezielte Schüsse abgaben.
Doch die Bauern im Schloss verlangten, dass man die Bedingungen der Banditen anhörte; sie behaupteten, die Banditen würden sich mit einem Lösegeld zufriedengeben und verschwinden, ohne das Schloss zu plündern und ohne seinen Bewohnern etwas anzutun.
›Lassen Sie uns kapitulieren, Herr Baron!‹, beschworen sie Federici. ›Wenn wir uns ergeben, können wir Bedingungen aushandeln, aber wenn die Briganten das Schloss erstürmen, dann sind wir alle verloren, wir, unsere Frauen und unsere Kinder.‹
›Meine armen Kinder‹, erwiderte der Baron, ›glaubt ihr wirklich, dass diese Briganten noch so viel Ehre besitzen, sich an Abmachungen zu halten? Verloren sind wir, wenn wir keine Hilfe von außerhalb bekommen. ‹<
Doch man konnte noch so lange aus den Fenstern im obersten Geschoss hinaussehen, weit und breit war keine Hilfe für die Belagerten zu sehen, sondern nur Unterstützung für die Belagerer, denn die Bauern der Umgegend, von Natur aus Verbündete der Briganten, kamen herbeigelaufen in der Hoffnung, beim Plündern mitzutun. Zuletzt ordnete Taccone die Erstürmung an; überall wurden Leitern angelegt, die Gewehre glänzten und die Äxte blinkten im Sonnenlicht. Die diabolischen Freudenrufe schienen bis zum Himmel zu erklingen.
Baron Federici sah all diese mörderischen Vorbereitungen; er sah auch seine zitternde Frau, seine totenblassen Töchter und seinen sechsjährigen Sohn, der vor Angst zu weinen begonnen hatte, und ihn erfasste blindwütiger und verzweifelter Zorn, als er sah, dass die Frauen seinem Blick abzulesen suchten, ob noch Hoffnung bestand. Da er sich eingestehen musste, dass alle sich ergeben wollten, beugte sich der Baron dem allgemeinen Wunsch und sandte einen Unterhändler zu Taccone, obwohl er keinen Pfifferling auf das Wort des Banditen gab.
Man ließ den Boten lange warten, bevor der illustre General ihn vorließ, der sich mit der Frau zurückgezogen hatte, die er in Potenza entführt hatte. Zuletzt wurde der Unterhändler von Taccone empfangen und sprach von Kapitulation und Vereinbarungen, doch Taccone brach in Gelächter aus. ›Geh zu deinem Baron zurück‹, sagte er zu ihm, ›Vereinbarungen sind unnötig, die Bewohner des Schlosses werden verschont.‹
Der Mann ging. Taccones Briganten beschwerten sich, dass ihr Anführer dem Baron gegenüber allzu großzügig sei, doch Taccone lächelte nur und zuckte die Schultern. ›Wer sagt euch‹, erwiderte er, ›dass diesem vermaledeiten Schloss nicht am Ende Hilfe zuteilgeworden wäre, wenn wir es noch länger belagert hätten? Denkt ihr etwa, sie hätten sich ergeben, wenn ich ihnen nicht versprochen hätte, sie zu verschonen? Wenn wir im Schloss sind, werden wir entscheiden, wer leben und wer sterben soll.‹
Gegen Abend wurden die Tore des Schlosses geöffnet; Baron Federici übergab Taccone die Schlüssel und schickte sich an, mit seiner Familie zu gehen.
›Wohin willst du, Abtrünniger?‹, herrschte Taccone ihn an und trat ihm in den Weg; dann wendete er sich an seine Leute und sagte: ›Haltet ihn fest, während ich mich im Schloss umsehe.‹<
Sie können sich vorstellen, mein lieber Graf«, sagte Reynier, »was vor sich ging, als diese Horde von Mördern das Haus durchsuchte: Alle Schränke wurden eingeschlagen, alle Truhen wurden zertrümmert, und aus den Trümmern errichteten sie im Hof einen riesigen Scheiterhaufen, auf den die Banditen Bilder, Möbel und alles andere warfen, was sie nicht gebrauchen konnten; all das geschah vor den Augen des geknebelten Barons, dessen Blick das Urteil der Sieger erwartete.
Nach erfolgter Plünderung war bedrohliches Gelärme zu vernehmen, und in den Hof torkelten und tanzten die betrunkenen Banditen mit Fackeln in den Händen; ein auflodernder Lichtschein verriet, dass sie das Schloss in Brand gesteckt hatten.
Als sie den Hof erreichten, wo der Baron von Banditen bewacht wurde, trat Taccone zu ihm, setzte ihm spaßeshalber einen alten Hut auf den Kopf, bat ihn um Verzeihung, dass er ihn so lange im Dunkeln gelassen hatte, und befahl, Licht zu machen.
Kaum hatte er diesen Befehl ausgesprochen, wurde der Scheiterhaufen entzündet, und die Flammen, die gierig das trockene Holz verzehrten, stiegen bald zum Himmel wie züngelnde Schlangenschwänze.
›Ha, bei Gott!‹, rief Taccone. ›Es wäre eine rechte Sünde, so ein schönes Licht ganz vergebens leuchten zu lassen. Auf, Freunde, auf! Lasst uns ein Tänzchen mit den Damen machen; Herr Federici wird es gewiss recht sein, dass seine Frau und seine Töchter uns in seinem Schloss willkommen heißen.‹<
Er ergriff die Hand einer der Töchter des Barons und führte den Reigen an; seine Kumpane bemächtigten sich der anderen Frauen, die Baronin und ihre Kammerzofe wurden mitgerissen, und zuletzt waren alle Frauen aus dem Schloss gezwungen, mit den Banditen um den lodernden Scheiterhaufen zu tanzen.
Bei diesem Anblick riss der Baron sich mit einer heftigen Bewegung von seinen Bewachern los und sprang mitten auf den Scheiterhaufen, der unter seinen Füßen nachgab und ihn unter sich begrub.
›Oho!‹, sagte Taccone zu seiner Tänzerin. ›Was für einen unmanierlichen Papa Sie haben, der sich weigert, der Hochzeit seiner Tochter beizuwohnen! Aber den Rotzbengel, den brauchen wir wahrhaftig nicht, schicken wir ihn zu seinem Papa.‹
Und er ergriff den sechsjährigen Jungen an einem Bein und warf ihn auf den Scheiterhaufen.
Die Frauen wurden eine nach der anderen vergewaltigt und ebenfalls in die Flammen geworfen.
Als einziges Mitglied der unglücklichen Familie überlebte der Junge wie durch ein Wunder: Er war auf der anderen Seite des Scheiterhaufens neben ein Kellerloch gefallen und trug nur einen verstauchten Fuß davon.
All diese Taten machten Taccone immer wagemutiger. Eines Tages trieb er es so weit, einen Bataillonschef herauszufordern, an einem bestimmten Tag mit seinen Männern aus Cosenza aufzubrechen und sich mit ihm an einem Ort namens Lago an der Straße zwischen Cosenza und Rogliano zu messen.
Der Offizier lachte über die Herausforderung und schenkte ihr in seiner Überheblichkeit keinen Glauben.
Das Bataillon erhielt jedoch den Befehl, auszurücken; als die Soldaten in eine enge Schlucht gelangten, sahen und hörten sie plötzlich, wie von oben unter Donnergetöse große Gesteinsmassen herabfielen.
Unter dem Aufprall dieser Massen bebte der Boden wie bei einem Erdbeben; zugleich war es, als entflammten sich die Berghänge, und wie von unsichtbarer Hand ging ein Kugelhagel über sie nieder.
In kaum einer Stunde waren von dem Bataillon, das seine Munition wirkungslos verschossen hatte, nur noch dreiundzwanzig Soldaten und zwei Offiziere namens Filangieri und Guarasci am Leben.
Taccone ließ sie vorführen.
›Soldaten‹, sagte er, ›euer Los ist wahrhaftig traurig, und ich ließe euch nur zu gern laufen, hätte ich nicht dem heiligen Antonius gelobt, keinen von euch zu verschonen; doch in Anbetracht dessen, dass ihr uns bekriegt, nicht aus freiem Willen, sondern gezwungen durch das unerbittliche Los der Aushebung, erfüllt mich Erbarmen mit euch; wenn ihr aber dieses Erbarmens teilhaftig werden wollt, müsst ihr zuerst eure Reue unter Beweis stellen. Und dieser Beweis besteht darin, dass ihr eigenhändig eure zwei Offiziere erschießt; tut ihr es, dann schwöre ich bei der Jungfrau Maria, dass ich euer Leben verschonen werde; tut ihr es nicht, dann werdet ihr alle zusammen sterben, Soldaten wie Offiziere.‹
Keiner der Soldaten rührte sich auf diesen Vorschlag hin, denn keiner wollte seine Hände mit dem Blut seiner Vorgesetzten beflecken; die zwei Offiziere jedoch, die erkannten, dass ihr Tod beschlossene Sache war, und die hofften, ihre Soldaten könnten am Leben bleiben, wenn sie bereit waren, sie zu töten, befahlen und flehten so lange, bis die Soldaten sich zuletzt dazu bereitfanden.
Doch die zwei Märtyrer lagen noch in den letzten Zuckungen des Todeskampfs, als die Briganten sich auf ein Zeichen Taccones auf die Soldaten stürzten, ihnen die Kleider vom Leib rissen, um sie nicht mit Blut zu besudeln, und die Gefangenen vor Taccones Augen mit Messerstichen niedermetzelten.
Seit dieser Zeit«, fuhr Reynier fort, »nennt man ihn Taccone den Henker; und diesen Mann müssen wir fassen.«
116
Der eiserne Käfig
René zog die ausgebreitete Landkarte zu sich heran.
»Lassen Sie mich die Straßen studieren«, sagte er. »Ich will keinen Führer nehmen, der mich verraten könnte.«
Der General wies mit dem Finger auf das Dorf Li Parenti, fast verborgen inmitten eines dunklen Fleckens, der einen Wald darstellte; dennoch waren auf dem dunklen Flecken eine deutlich eingezeichnete Straße und ein kaum sichtbarer Pfad zu erkennen.
»Ich darf Ihnen verraten«, sagte der General, »dass sich in dem Dorf an die tausend Männer aufhalten; Sie können es daher mit nur fünfzig Mann unmöglich angreifen; ich werde Ihnen hundert Mann und einen Hauptmann mitgeben, die der Straße folgen und das Dorf von dort aus angreifen werden, während Sie sich über den Pfad anschleichen und den Hügel hinter dem Dorf erklimmen, und sobald Sie die Spitze der Kolonne erblicken, geben Sie mit einem Schuss das Signal zum Angriff.«
»Steht es mir frei, an diesem Plan etwas zu verändern?«, fragte René.
»Was Sie wollen: Ich schlage Ihnen nur einen ungefähren Plan vor.«
Am Abend dieses Tages, als General Reynier aufbrach, um Cotrone den Gnadenstoß zu versetzen, nahm René in Begleitung seiner hundertfünfzig Soldaten den Weg zum Dorf Li Parenti.
Als sie fünf Meilen von dem Dorf entfernt die Stelle erreichten, wo der Pfad von der Straße abzweigte, fragte René den Hauptmann, ob er ihm seine vier Tamboure überlassen könne, die er nicht allzu dringend zu benötigen schien. Der Hauptmann war einverstanden.
Die zwei Truppen trennten sich, René riet dem Hauptmann, nicht zu schnell zu marschieren, da er und seine fünfzig Männer auf unwegsamerem Gelände einen weiteren Weg zurücklegen mussten.
Gegen vier Uhr morgens, als im Osten der Himmel aufzuhellen begann, erreichte René die höchste Stelle der Hügelkette, die sich hinter dem Dorf erhob.
Daraufhin schickte er einen seiner Männer quer durch das Dorf und dem Hauptmann entgegen. Der Mann hatte Ordre, einen Schuss in die Luft abzugeben, sobald das Detachement sich nur mehr einige hundert Schritte vor dem Dorf befinden würde.
Der Bote entfernte sich auf dem Weg, der vor dem Trüppchen vorbeiführte und an einem schroffen Abgrund entlang verlief.
Nicht lange, und ein Gewehrschuss ertönte: das vereinbarte Signal.
Sofort befahl René seinen vier Tambouren, einen Trommelwirbel zum Sturmangriff zu schlagen, und seinen Männern befahl er, »Tod oder Sieg!« zu rufen.
Dann überrannten sie das Dorf wie eine Lawine und schlugen mit den Gewehrkolben die Türen der Häuser ein.
Die ersten Türen wurden von innen geöffnet, und einer der ersten Dorfbewohner, der zu fliehen versuchte, eine Frau in den Armen, war Taccone.
Als René sah, wie schnell und mühelos der Brigant davonlief, zweifelte er nicht daran, Taccone vor sich zu haben; er fürchtete jedoch, dass eine Kugel, die er ihm in den Rücken schoss, auf der anderen Seite des Körpers austreten und die Frau tödlich verwunden konnte; deshalb senkte er den Lauf seines Stutzens, bevor er abdrückte.
Taccone stürzte und wälzte sich auf dem Weg, und die Frau, die er im Sturz losgelassen hatte, rutschte dem Abgrund entgegen.
Ein schrecklicher Schrei ertönte und verriet, dass das arme Geschöpf hinuntergestürzt war.
Taccone erhob sich, entschlossen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen; das erste Mal im Verlauf seiner langen Laufbahn als Bandit war er verwundet worden; er schleppte sich zu einem Baum, an den er sich lehnte, und wartete, die Waffe in der Hand.
Seine Körperkraft und sein Mut waren so legendär, dass niemand gewagt hätte, sich auf einen Zweikampf mit ihm einzulassen.
René hätte ihn ohne Weiteres mit einem Gewehrschuss erledigen können, doch er wollte ihn nicht töten, sondern fassen.
»Leben lassen! Leben lassen!«, rief er und stürzte sich auf Taccone, ohne sich darum zu kümmern, dass er dem Banditen eine prächtige Zielscheibe bot.
Doch schneller als der Brigant handelte der Bote, der zurückgekehrt war, aus dem dichten Gebüsch hinter dem Baum hervorsprang und Taccone das Bajonett in die Brust stieß.
Taccone schrie auf, sackte zu Boden und ließ seine Waffe aus der Hand gleiten; als der andere jedoch näher trat und sich bückte, um ihm den Kopf abzuschneiden, der tausend Dukaten wert war, richtete Taccone sich auf wie eine Schlange, die emporschnellt, umfasste den Soldaten mit beiden Armen, stieß ihm einen Dolch, den er in der Hand verborgen hatte, zwischen die Schultern, und die beiden Männer hauchten in einer Umklammerung des Hasses, die wie eine brüderliche Umarmung aussah, gleichzeitig ihr Leben aus.
René ließ zu, dass seine Männer Taccone den Kopf abschnitten und danach das Dorf Li Parenti plünderten und in Brand steckten.
Solche Unternehmungen interessierten ihn nicht; er stöberte das Wildschwein auf und erlegte es. An seinem Fleisch konnten sich die anderen gütlich tun.
Am nächsten Tag kehrte er nach Catanzaro zurück. Reynier kam nach der Einnahme Cotrones ebenfalls zurück und sah den Kopf des Taccone in einem eisernen Käfig über dem Stadttor von Catanzaro.
Sobald er angekommen war, ließ er René rufen.
»Mein lieber Graf«, sagte er, »beim Betreten der Stadt erfuhr ich das Neueste von Ihnen; über dem Tor hängt ein Kopf, der Ihre Taten verkündet; ich wiederum habe Briefe des Königs erhalten, die beweisen, dass er uns nicht im Stich lässt; er wird uns Marschall Masséna mit zwei- bis dreitausend Mann schicken; außerdem sind der deutsche Admiral und Konteradmiral Cosmao allem Anschein nach aus Toulon aufgebrochen; sie werden in Kalabrien zwischenlanden und in Korfu in Garnison gehen.«
General Reynier täuschte sich mit diesen Hoffnungen.
Während Cosmao und der Deutsche Toulon verließen, machte sich eine neue englische Flotte von Messina aus auf, um Ischia einzunehmen, wie Capri eingenommen worden war.
König Joseph behielt Masséna in Neapel und begnügte sich damit, dem kommandierenden General in Kalabrien eine Brigade seiner Garde und zwei neu gebildete Regimenter unter dem Befehl General Salignys zu schicken, das Regiment La Tour d’Auvergne und das Regiment Hambourg; dank der Landstraße, die inzwischen von Lagonegro zum Lager in La Corona führte, stand Neapel nun in Verbindung zu den Truppen General Reyniers, und auf dieser Landstraße konnte man Artillerie und Munition nach Kalabrien bringen.
Nunmehr ging es darum, Scilla und Reggio einzunehmen, wo die Engländer Garnisonen eingerichtet hatten, die zur Hälfte mit Engländern, zur Hälfte mit Aufständischen bemannt waren.
Napoleon verlangte ungeduldig die Rückeroberung der zwei Städte, denn eine Expedition nach Sizilien war undenkbar, solange diese Städte in englischer Hand waren.
Man machte sich auf, um Scilla einzunehmen.
René hatte gebeten, mit seinen Scharfschützen an der Spitze der Kolonne sein zu dürfen; dies wurde ihm umso bereitwilliger gewährt, als es seinen fünfzig Mann bisher gelungen war, keinen unnötigen Schuss abzugeben und mit jedem Schuss zu treffen.
Man richtete sich auf den Bergen von Scilla ein und sandte Kundschafter aus, und es kam nur zu kleinen Scharmützeln zwischen Schützen und einzelnen Räuberbanden, die den Wald unsicher machten.
Eine dieser Begegnungen hatte einen Zwischenfall zur Folge, der für Renés weiteres Leben nicht unerheblich war: Ein Dutzend Gefangene war gemacht worden, und da es sich um unverbesserliche Banditen handelte, hatte man kurzen Prozess mit ihnen gemacht, und das Erschießungspeloton lud die Gewehre, um sie zu füsilieren.
René kam mit seinen Scharfschützen vorbei, als er hörte, dass jemand ihn bei dem Namen Graf Leo rief.
Der Ruf ertönte aus der Gruppe gefangener Banditen.
René ging hin, und als er sich nach dem Mann umsah, der seinen Namen gerufen hatte, trat einer der Räuber einen Schritt vor und sagte: »Verzeihen Sie, Herr Graf, doch bevor ich sterbe, wollte ich Ihnen Adieu sagen.«
René, dem Stimme und Gesicht undeutlich bekannt vorkamen, sah den Mann aufmerksam an und erkannte den Räuber aus den Pontinischen Sümpfen, der ihm als Müller verkleidet und mit einer Augenbinde als Führer gedient hatte, bis sie am Tag der Schlacht von Maida in Sichtweite der französischen Armee gelangt waren.
»Oha, zum Henker«, sagte René, als er erkannte, welches Schicksal dem Banditen bevorstand, »ich glaube, du hättest Dümmeres tun können, als mich anzusprechen.«
Dann ging er zu dem Leutnant, der das Erschießungskommando befehligte, und nahm ihn beiseite: »Kamerad«, sagte er zu ihm, »könnten Sie mir den Gefallen tun, mir diesen Mann zu überlassen, der mich eben angesprochen hat? Oder muss ich mich an General Reynier wenden, damit er sich an Sie wendet?«
»Meiner Treu, Herr Graf«, sagte der Leutnant nonchalant, »einer mehr oder weniger wird für König Joseph wohl kaum einen großen Unterschied machen; und wenn Sie mich um diesen Mann bitten, dann haben Sie dafür sicher keinen unedlen Beweggrund; nehmen Sie ihn als Zeichen unserer Bewunderung für Ihre Vaterlandsliebe und Ihre Tapferkeit.«
René drückte dem Leutnant die Hand.
»Darf ich Ihren Männern ein Geschenk machen?«, fragte er.
»Nein«, erwiderte der Leutnant. »Meine Männer würden sich einhellig dafür aussprechen, Ihnen den Galgenvogel zu schenken, und einhellig dagegen, ihn Ihnen zu verkaufen.«
»Schon gut«, sagte René, »Freunde, ihr seid wackere Männer.«
»Bindet den Mann los«, befahl der Offizier seinen Soldaten.
Der Bandit sah voller Verblüffung, wie ihm geschah.
»Auf«, sagte René, »folge mir.«
»Wohin Sie wollen, mein Offizier, ich bin zu allem bereit.«
Und voller Freude schloss der Bandit sich René an.
René und sein Gefangener entfernten sich von der Stelle, wo René den Briganten befreit hatte.
»So«, sagte René, »da sind die Berge, dort sind die Wälder; entscheide selbst, welche Richtung du einschlagen willst; du bist frei.«
Der Bandit dachte kurz nach; dann schüttelte er den Kopf und stampfte mit dem Fuß auf und rief: »Ach, zum Teufel, nein! Ich bleibe lieber Ihr Gefangener. Dem Tod habe ich allmählich oft genug ins Gesicht geblickt – ob in Form einer Pistole, einer Seilschlinge oder eines Dutzends Gewehre -, und er ist eine so garstige alte Vettel, dass ich auf eine nähere Bekanntschaft gerne verzichte. Behalten Sie mich bei Ihnen, ich werde Ihr Führer sein, Sie wissen, dass ich die Wege kenne; benötigen Sie vielleicht einen Diener? Dann werde ich Ihr Diener sein, ich werde mich um Ihre Waffen und um Ihr Pferd kümmern. Aber von Wald und Bergen habe ich genug!«
»Gut, abgemacht!«, sagte René. »Ich nehme dich mit, und wenn du dich gut beträgst, wie ich hoffe, dann wirst du belohnt und nicht bestraft werden.«
»Ich werde mein Bestes tun«, erwiderte der Bandit, »und wenn ich Ihnen Ihre Güte nicht gebührend vergelte, soll es nicht an mir liegen.«
Sie erreichten die Stelle, an der sie anhalten wollten: auf dem Gipfel eines Berges, von wo aus man ein riesiges Panorama überblickte, das von Reggio di Calabria über die Küste Siziliens und Scilla bis zu den Liparischen Inseln reichte und in der Ferne bis zu den dunstigen Umrissen der Insel Capri.
Von dieser Stelle an war der Weg für die Artillerie nicht mehr passierbar, denn die reißenden Bäche des Aspromonte-Massivs unterbrachen ihn immer wieder.
General Reynier beriet sich mit seinen Offizieren; jeder schlug eine andere Lösung vor, und keine war praktikabel; doch ein Entschluss musste umso dringender gefasst werden, als man sich dem Feuer aus den Geschützen sizilianischer Kanonenboote ausgesetzt sah, die vor dem Ufer kreuzten; einige dieser Boote waren sogar vor Anker gegangen, und sie zielten so gut und schossen so fleißig, dass General Reynier sich genötigt sah, seine Zwölfergeschütze aufstellen zu lassen.
Nach einer halben Stunde brachte das sorgfältig ausgerichtete Feuer dieser Geschütze die Geschütze auf den gegnerischen Schiffen zum Schweigen und leerte ihre Decks; da sie keine Anstalten trafen, sich vom Ufer zu entfernen, forderte man sie mit lauten Rufen auf, sich zu ergeben.
Zur großen Verwunderung aller zeigte sich niemand an Deck, um auf die Aufforderung zu antworten, die dreimal wiederholt worden war.
Der Befehl, die Kanonenboote zu versenken, war gerade erteilt worden, als René zu General Reynier trat und ihm etwas ins Ohr flüsterte.
»Wahrhaftig«, sagte der General, »da mögen Sie recht haben.«
Und René, der sich mit seinem Banditen unterhalten hatte, streifte Rock und Hemd ab und sprang ins Wasser, um den Kommandanten der Boote aufzufordern, sich zu ergeben.
Der Kommandant hatte auf die Aufforderungen General Reyniers nicht geantwortet, weil sie auf Französisch erfolgt waren und er sie als Engländer nicht verstanden hatte.
René hatte den Grund für das Schweigen erraten; er schwamm bis auf halbe Schussweite an die Boote heran und rief der Besatzung auf Englisch zu, sie solle sich ergeben.
Sogleich senkten sie ihre Flagge; jedes der Boote war mit zwanzig Mann besetzt und mit einer Kanone vom Kaliber vierundzwanzig bestückt.
General Reynier ging dem jungen Mann entgegen, der triefend zurückkehrte.
»Sie sind ein kluger Kopf, René«, sagte er zu ihm, »ziehen Sie sich um, und helfen Sie uns dann, ein Mittel zu finden, unsere Artillerie in Reichweite von Reggio zu bringen.«
»General«, sagte René, »ich war vorhin damit beschäftigt, nach diesem Mittel zu suchen, und wenn Sie mich für zwölf oder fünfzehn Stunden beurlauben, hoffe ich, mit guten Neuigkeiten wiederzukommen.«
»Gehen Sie«, sagte Reynier. »Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es besser ist, Sie schalten und walten zu lassen, als Sie um Ratschläge zu bitten.«
Zehn Minuten später schlichen zwei Bauern, die von Pizzo zu kommen schienen, in einer Entfernung von fünfzig Schritten an General Reynier vorbei auf die Berge zu. Da er sie für Spione hielt, befahl er, sie zu ergreifen, doch einer der beiden Bauern lüpfte seinen Hut, und der General erkannte René.
117
In welchem Kapitel René in dem Augenblick die Fährte des Bizzarro findet, in dem er am wenigsten darauf rechnet
Es war in der Tat René, der mit seinem neuen Diener als Führer zum Berggipfel stieg, um zu sehen, ob es vielleicht einfacher wäre, die durch die Sturzbäche gegrabenen Rinnen und Furchen am Ursprung der Bäche zu überwinden als weiter unten am Berghang.
Und als sie am Fuß des Aspromonte ankamen, sah René, dass der Abstieg Reggio entgegen mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden war und dass man innerhalb von acht Tagen eine Belagerungsbatterie bis auf eine Viertelkanonenschussweite vor die Stadt transportieren konnte.
René und sein Führer näherten sich Reggio bis auf eine Meile und vergewisserten sich, dass die Straße immer besser wurde; die gute Nachricht mußte dem General nur noch überbracht werden.
Es wurde zwar allmählich dunkel, und allein hätte René den Rückweg niemals gefunden, doch mit einem so erfahrenen Führer wie seinem neuen Diener gab es nichts zu befürchten. Folglich setzten sich beide an den Fuß eines Baums, ohne sich darum zu scheren, dass es dunkel wurde, und ohne sich mehr Deckung zu suchen als den grünen Vorhang, den der Wald bot, und machten sich behaglich an ihr Abendbrot.
Mitten während der Mahlzeit spürte René mit einem Mal die Hand seines Gefährten auf der Schulter, und als er aufsah, gebot dieser ihm mit dem Finger auf dem Mund Schweigen.
René schwieg und lauschte.
Schwere Schritte und Schleifgeräusche waren zu hören, als würden Menschen gegen ihren Willen fortgeschleppt, begleitet von erstickten Geräuschen, als versuchten sie zu protestieren.
Dann sahen sie zwei gefesselte und geknebelte Männer, die zu einem Baum gezerrt wurden, der ihnen als Galgen dienen sollte.
Das war der Grund für den Widerstand, den sie ihren Mördern boten, und für die erstickten Schreie, die sie zu äußern versuchten, denn dass die Männer, die sie zu dem Baum schleppten, sie dort aufhängen wollten, stand außer Frage.
René drückte den Arm seines Gefährten.
»Seien Sie unbesorgt«, flüsterte dieser, »ich kenne die Burschen.«
Die zwei Gefesselten wurden von fünf Henkern geschleppt; all ihr Sträuben war vergebens, denn sie konnten sich nicht wehren. Man legte ihnen die Schlinge um den Hals. Ein Mann, der wie ein Maultiertreiber aussah, stieg auf den Baum, knüpfte die zwei Seile an zwei Äste, und unter tatkräftiger Hilfe seiner Kumpane, die von unten schoben, während er von oben zog, waren die zwei armen Sünder innerhalb von zehn Minuten aufgeknüpft.
René, der eine so beschämende Todesart mit lebhaftestem Widerwillen mit angesehen hatte, war kein Laut entschlüpft.
Als die Zuschauer und Akteure der Hinrichtung sicher sein konnten, dass die Erhängten mausetot waren, trennten sie sich: Vier setzten ihren Weg nach Reggio fort, der Fünfte schickte sich an, allein in die Richtung zurückzugehen, aus der sie gekommen waren, als Renés neuer Diener aus dem Wald sprang und rief: »Orlando?«
Der Angerufene hatte sich nicht an der Hinrichtung beteiligt, sie jedoch mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Als er seinen Namen hörte, griff er nach seinem Dolch und drehte sich zu der Stimme um: »Ah«, sagte er, »du bist es, Tomeo; was zum Teufel tust du hier?«
»Ich tue nichts, ich habe deinem Tun zugesehen.«
»Du bist doch nicht etwa ehrbar geworden?«, fragte Orlando lachend.
»Da täuschst du dich; jedenfalls bemühe ich mich nach Kräften, es zu werden; aber was haben die beiden armen Teufel angestellt, denen ihr so grausam die Gurgel zugeschnürt habt?«
»Das waren zwei elende Wichte, die meine Unterschrift missachtet haben; ich hatte den Maultiertreibern, die du dort ihren Weg nach Reggio fortsetzen siehst, einen Passierschein gegeben, aber obwohl der Bizzarro und ich ausgemacht hatten, die Unterschrift des anderen zu respektieren, haben Männer aus seiner Bande die Maultiertreiber festgehalten und ausgeraubt; daraufhin sind sie zu mir gekommen und haben verlangt, dass die Räuber bestraft werden. ›Bringt mich zum Bizzarro‹, habe ich zu ihnen gesagt. Sie haben mich hingebracht. ›Gevatter‹, habe ich zu ihm gesagt, ›deine Männer haben meine Unterschrift missachtet, und jetzt muss ich ein Exempel statuieren, und zwar ein schreckliches Exempel.‹ Der Bizzarro hat sich von mir erzählen lassen, worum es ging, während er sich die Nase begoss. ›Urteile die Schuldigen ab, aber beeile dich, Gevatter; du weißt, dass ich es nicht schätze, beim Essen gestört zu werden.‹ Ich habe meine Maultiertreiber hergerufen, die an der Tür warteten, sie haben die Straßenräuber wiedererkannt, der Bizzarro hat sie mir überlassen, und den Rest hast du selbst gesehen.«
Unterdessen hatte René sich an den Waldrand vorgeschlichen und hatte mit angehört, was Orlando erzählte.
»Trinke einen Schluck mit uns, Gevatter!«, rief René ihm zu.
Orlando zuckte zusammen und drehte sich um; er erblickte einen Mann, der eine Flasche am Hals hielt.
Er sah zu seinem Kameraden, der ihm mit dem Blick bedeutete, dass er dem neuen Akteur, der sich auf der Szene eingefunden hatte, vertrauen konnte.
René reichte ihm die Flasche, nachdem er selbst die ersten Schlucke getrunken hatte, um den Banditen zu beruhigen, und fragte ihn über seinen Freund Bizzarro aus.
Orlando war mit dem Wein zufrieden, und da er keinen Grund sah, nicht weiterzusagen, was er über den Bizzarro wusste, gab er René bereitwillig alle Auskünfte, die dieser sich nur wünschen konnte. Da es immer später wurde und Renés Wissensdurst gestillt war, erinnerte er seinen Gefährten daran, dass sie weitergehen mussten.
Man leerte die Flasche, reichte einander die Hand zum Abschied und ging; an dem Baum blieben die verfluchten Früchte zurück, die in so kurzer Zeit seinen Ästen entsprossen waren.
Zwei Stunden später kehrte René in das Lager zurück.
Am nächsten Tag fand sich Graf Leo bei Tagesanbruch bei General Reynier ein.
Der General war bereits wach und saß sorgenvoll über einer Karte von Kalabrien im Bett.
»General«, sagte René lachend, »zerbrechen Sie sich nicht länger den Kopf über geographische Karten, ich habe einen Weg ausfindig gemacht, auf dem Ihre Kanonen so mühelos fahren werden wie auf einem Billardtisch. In fünfzehn Tagen werden wir Reggio beschießen, und in achtzehn Tagen werden wir die Stadt eingenommen haben.«
Der General sprang aus dem Bett. »Ich zweifle nicht an Ihren Worten, mein lieber Graf«, sagte er, »aber solche Dinge will man mit eigenen Augen gesehen haben.«
»Nichts leichter als das, General. Kleiden Sie sich an; ich werde meine fünfzig Mann zusammenrufen, und wenn der Ort, zu dem ich Sie führe, Ihnen zusagt, werden wir den Rest unserer Armee hinzuholen und lassen bei Scilla nur so viele Männer zurück, wie nötig sind, um die Stadt eingeschlossen zu halten.«
»Und wenn wir nur zu dritt gingen?«, fragte Reynier.
»Oh, was das betrifft, mein General«, sagte der junge Mann, »diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Mit meinen fünfzig Mann kann ich mich für Ihre Sicherheit verbürgen; wenn wir zu dritt aufbrechen wollen, kann ich mich aber nur dafür verbürgen, vor Ihnen zu fallen, und da damit niemandem gedient wäre, schlage ich vor, dass wir uns lieber an meinen ersten Vorschlag halten.«
Als General Reynier eine Viertelstunde später sein Quartier verließ, fand er die fünfzig Mann Graf Leos in Habtachtstellung vor, ihre Gewehre zu einer Pyramide zusammengestellt.
Der General begutachtete diesen Anblick.
»Mein lieber Graf«, sagte er zu René, »bei so einem Gefolge dürfte es wenig Sinn haben, unsere Expedition heimlich durchführen zu wollen. Kommen Sie herein und frühstücken Sie mit mir, während ich ein paar Flaschen Wein an Ihre Männer austeilen lasse.«
Nach einer halben Stunde waren alle zum Aufbruch bereit.
Tomeo nahm diesmal einen Weg, den auch die Pferde gehen konnten.
Gegen neun Uhr morgens erreichten sie den Gipfel des Aspromonte; man vergewisserte sich, dass man die Kanonen nur bis nach Maida zurückbringen musste, um von dort einen Weg zu finden, der zum Berggipfel führte, woraufhin man von Gipfel zu Gipfel weiterziehen konnte, bis man den Aspromonte erreichte.
Ein so erfahrener Mann wie General Reynier erkannte auf den ersten Blick, dass es keine andere Möglichkeit gab, die Belagerungsartillerie nach Reggio zu befördern, als diejenige, die sein junger Leutnant aus dem Hut gezaubert hatte.
Deshalb wurde einem Teil der Truppe befohlen, auf dem Berg zu biwakieren, während die übrigen Soldaten am Ufer zurückblieben, um eine Landung der Engländer zu verhindern.
Doch kaum sah René, dass die Ingenieure sich an die Arbeit machten und die Artillerie ihre Geschütze bewegte, bat er General Reynier um die Erlaubnis, sich vierzehn Tage von der Truppe zu entfernen.
»Falls es ein Geheimnis ist«, sagte General Reynier, »will ich nicht in Sie dringen; aber wenn es sich um etwas handelt, was Sie einem Freund anvertrauen können, würde ich gerne wissen, was Sie vorhaben.«
»Ach, Gott«, sagte René, »es ist nichts weiter. Sie müssen wissen, dass bei einem Essen im Hause des Ministers Saliceti die Rede auf einen Räuberhauptmann namens Il Bizzarro kam. Es wurden die abscheulichsten Geschichten über diesen Unmenschen erzählt, und die Herzogin von Lavello, die Tochter des Kriegsministers, hat sich von mir versprechen lassen, dass ich ihr seinen Kopf schicken werde. Dieses Versprechen ging mir nicht aus dem Sinn, doch erst gestern habe ich verlässliche Nachricht über den Aufenthalt dieses Mannes erhalten. Da er ein schlauer Bursche zu sein scheint, bitte ich Sie um vierzehn Tage, und dabei kann ich nicht einmal mit Bestimmtheit versprechen, ihn Ihnen nach diesen vierzehn Tagen an Händen und Füßen gefesselt zu bringen.«
»Was kann ich in dieser Zeit für Sie tun?«, fragte Reynier.
»Meiner Treu, mein General, Sie könnten die Güte haben, mir eine elegante Kiste aus Olivenholz oder aus Eichenwurzelholz schreinern zu lassen und mit den Initialen der Herzogin von Lavello zu versehen, damit wir ihr den Kopf des Don Bizzarro in einem Sarg schicken können, der ihrer würdig ist.«
118
Die Jagd auf die Banditen
Seit René der Herzogin von Lavello gelobt hatte, ihr den Kopf des Bizzarro zu schicken, hatte dieser sich von der Gegend um Cosenza zum äußersten Rand Kalabriens zurückgezogen.
Dort gibt es einen Wald namens Sila, in dem sich nur Banditen und Einheimische auskennen. In diesem Wald hatte der Bizzarro sich versteckt, und es dauerte nicht lange, bis er neue Beweise jener Grausamkeit und Blutgier lieferte, mit der er die Bürger und kleinen Leute so drangsaliert hatte und die nun selbst diejenigen gegen ihn aufbrachte, die für gewöhnlich als Helfershelfer der Banditen ihr Auskommen suchen.
Doch nicht damit zufrieden, bei der Bevölkerung verhasst zu sein, trug er Sorge, seine Leute so verhasst zu machen, dass keiner von ihnen jemals gewagt hätte, den Anführer zu denunzieren, um das eigene Leben zu erkaufen, denn jeder von ihnen hatte so viele Gräueltaten verübt, dass mit Gnade nicht zu rechnen war.
Ein junger Hirte, den die Soldaten gezwungen hatten, ihnen bei der Verfolgung des Bizzarro als Führer zu dienen, wurde von den Männern des Bizzarro gefangen und getötet, indem jeder von ihnen ihm einen Hieb mit dem Messer versetzte.
Beim neunundvierzigsten Hieb lebte er noch, und erst der fünfzigste, den ihm der Bizzarro versetzte, brachte ihm den Tod.
Daraufhin ließ dieser Schlächter ihn in so viele Teile zerstückeln, wie seine Truppe Männer zählte; das noch zuckende Fleisch warf er in einen großen Kessel und kochte daraus eine Suppe, von der jeder ein paar Löffel trinken und ein Stück Fleisch essen musste.
Er besaß zwei riesige Molosserhunde, denen er drei Tage lang nichts zu fressen gab; dann überließ er ihnen zwei Offiziere der Nationalgarde von Monteleone, nackt und unbewaffnet, und konnte sich für einen Augenblick an dem Schauspiel eines jener Kämpfe des Altertums weiden, in denen Christen gegen wilde Tiere antreten mussten.
All das führte dazu, dass der Bizzarro zum Geächteten erklärt wurde und dass jedermann sich vornahm, ihn zur Strecke zu bringen zu helfen, so gut er konnte.
Tomeo kannte ihn nicht, er hatte nie unter ihm gedient. Tomeo gehörte zu jenen, die dem Brigantenwesen wie einem Gewerbe nachgehen, die es ehrenhaft ausüben, denn sie stehlen zwar und töten auch notfalls, doch sie begehen keine unnötigen Untaten.
Als René sich mit ihm beriet, gab es folglich nichts, was dagegen gesprochen hätte, dass Tomeo sich bereit erklärte, eine Gelegenheit abzupassen, den Bizzarro fangen zu helfen.
Zuerst musste man herausfinden, wo der Bizzarro sich aufhielt, und diese Aufgabe fiel Tomeo zu.
Da Tomeo in den Bergen von Scilla eine Zeit lang mit einem weithin bekannten Briganten namens Parafante der Straßenräuberei nachgegangen war, machte er sich berechtigte Hoffnungen, nicht unverrichteter Dinge zurückzukommen.
Am nächsten Abend war er wieder da.
Er wusste den Aufenthalt des Banditen.
Eine weinende alte Frau am Fuß eines Baums war ihm aufgefallen; er hatte sich ihr genähert, hatte sie ausgefragt und erfahren, dass sie die Mutter des jungen Hirten war, den der Bandit so grausam zu Tode gefoltert hatte.
Nachdem Tomeo ihr offenbart hatte, warum er sie ausfragte, hatte die alte Frau gelobt, mit Körper und Seele Rache für ihren Sohn zu nehmen, hatte sich mit Tomeo für den übernächsten Tag verabredet und hatte ihm versichert, alles in Erfahrung zu bringen, was er wissen wollte.
Dies berichtete Tomeo René, der sich sofort an die Spitze seiner fünfzig Mann setzte und Tomeo folgte, dem er uneingeschränkt vertraute.
Die alte Frau wartete am vereinbarten Ort.
Tomeo und René gingen allein zu ihr.
Sie erklärte Tomeo genau, wo der Bizzarro die nächste Nacht verbringen würde, und nachdem Tomeo erfahren hatte, was er wissen wollte, gingen er und René zu ihren Männern zurück.
René ging mit seinen fünfzig Mann in Stellung, und als es dunkelte, zündeten sie Fackeln an und durchsuchten die Wälder, doch vergebens, denn sie schreckten nur Vögel und wilde Tiere auf.
Allerdings stießen sie auf den Lagerplatz der Banditen, dessen gelöschte Feuer noch heiße Glut bargen, was Tomeo und René davon überzeugte, dass die Auskünfte zutrafen; Renés fünfzig Soldaten waren offenkundig von den Briganten gesehen worden, und diese hatten die Flucht ergriffen.
Ein zweiter Versuch musste unternommen werden, und er wurde unternommen.
Diesmal befanden der Bizzarro und seine Männer sich an der angegebenen Stelle, doch rings um das Lager postierte Wachen schlugen Alarm; Gewehrschüsse wurden getauscht, doch das einzige Ergebnis war ein toter Bandit.
Mittlerweile hatte es sich herumgesprochen, dass der Bizzarro gejagt wurde.
Eine Zeit lang war dieser Brigant der ungekrönte König dieser Gegend gewesen.
Als Reynier am Golf von Sant’ Eufemia geschlagen worden war und sich bis in die Basilikata zurückziehen musste, hatte das den Briganten im Süden Kalabriens freie Hand gelassen. Daraufhin hielt der Bizzarro einen triumphalen Einzug in Palmi, von dem die Leute heute noch sprechen und der den Glanzpunkt seines Ruhms bildete.
Er ritt an der Spitze von hundert Männern zu Pferde, gefolgt von zahlreichen Briganten zu Fuß, wurde von Stadtverwaltung und Geistlichkeit unter einem prunkvollen Baldachin begrüßt und zur Kirche geführt, vorbei an einem Menschenauflauf aus Neugierigen und Gaffern aller benachbarten Provinzen; in der Kirche wurde das Tedeum angestimmt, um die Legitimität des Königshauses zu bekräftigen, und das Ende der Festlichkeiten begleiteten Hochrufe: »Es lebe der König! Es lebe Caroline Marie! Es lebe der Bizzarro!«, welch dreifaches Hurra böswilligen Geistern ein Lächeln entlockte.
[An dieser Stelle endet der Romanabdruck mit der Veröffentlichung vom 30. Oktober 1869. Claude Schopp hat folgenden möglichen Schluss der Episode skizziert:]
Seinem Kapitol war sein tarpejischer Felsen eng benachbart. Der ungekrönte König war zum gehetzten Wild geworden.
Nun erwiderte die Bevölkerung dem Banditen seine Grausamkeiten und seine Exzesse mit unbändigem und unversöhnlichem Hass; die Bürgerwehr hatte gelobt, die Waffen erst niederzulegen, wenn der Bizzarro tot war.
René und Tomeo mussten niemanden mehr um Auskünfte bitten, sondern konnten sich der Informanten kaum erwehren. Mehrere Tage lang waren sie dem Banditen dicht auf den Fersen, doch in letzter Sekunde gelang es ihm jedes Mal, ihnen zu entkommen; jeden Morgen fanden sie Überreste eines Lagerplatzes, warme Asche und bisweilen den verstümmelten Leichnam eines Banditen als stummes Zeugnis, dass der Bizzarro einen seiner Kumpane als Verräter verdächtigt, erschlagen und seinen Hunden zum Fraß vorgeworfen hatte.
Doch je weiter sie vorrückten, desto spärlicher wurden die Überreste an den Lagerstellen. Wie ein Indianer der Savanne beugte sich Tomeo über diese Funde, untersuchte eingehend die Fußabdrücke und die Nahrungsreste; in dem letzten Lager, das sie fanden, war er zu dem Schluss gelangt, dass der Brigant nur noch drei Gefährten aus seiner Bande bei sich hatte, darunter einen Heranwachsenden oder eine Frau. Wie vor ihm Taccone hatte er sich offenbar dafür entschieden, seine Bande auszulichten.
René beschloss daraufhin, seine Truppe, die für einen Überraschungsangriff zu groß war, in dem Dorf Maida zu lassen und die Jagd mit Tomeo allein zu Ende zu führen.
Zwei Bauern hatten den Bizzarro auf der Straße von Maida nach Vena gesehen; mit seinen letzten Getreuen hatte er sich vermutlich in einer der zahllosen Höhlen verkrochen, die den Berghang wie ein Labyrinth durchziehen. René und Tomeo waren auf ein Felsplateau gelangt, das unterhalb des Berggipfels lag, und sie beschlossen, die Nacht im Schutz der Felsen zu verbringen, die strahlend helles Mondlicht wie auf einem Gemälde Salvador Rosas beschien, und ihren Weg am nächsten Morgen fortzusetzen. Nach wenigen Stunden Schlaf spürte René, dass man ihn behutsam zu wecken versuchte; er öffnete die Augen und sah Tomeo, der die Hand wie ein Hörrohr um das Ohr hielt und ihm mit Zeichen zu verstehen gab, dass er lauschen solle.
Wahrhaftig konnte René ein fernes Gewimmer ausmachen, von unwirschen Lauten gefolgt.
»Ein Käuzchen oder ein anderer Nachtvogel«, murmelte René.
»Nein, ein Kind!«
René entsann sich, dass die Mutter des gefolterten jungen Schäfers ihnen gesagt hatte, die junge Gefährtin des Bizzarro habe vor Kurzem entbunden.
Er erhob sich lautlos und schlich vor Tomeo in ein Gewirr von Felsblöcken. Als das Wimmern, das sie leitete, verstummte, mussten sie sich aufs Geratewohl weitertasten. Das Weinen hob wieder an, und sie mussten feststellen, dass sie sich dem Versteck des Banditen nicht genähert, sondern sich von ihm entfernt hatten und umkehren mussten; so ging es mehrere Male.
Doch mit einem Mal verstummte das Gewimmer, ohne wieder einzusetzen. Am nächsten Morgen konnten die beiden die Gegend noch so argusäugig absuchen: Sie entdeckten nichts, was ihnen weiterhalf.
Dennoch waren sie überzeugt, dass der Brigant sich in dieser Steinwüste versteckt hielt; sie verbrachten sechs Nächte in dieser Weltabgeschiedenheit und nahmen jeden Morgen die Suche wieder auf, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen.
In der siebten Nacht beschloss René entmutigt, aufzugeben und am nächsten Morgen nach Maida zurückzukehren; kaum war er eingeschlafen, weckte ihn das erstickte Geräusch einer Detonation, deren Echo sich im Erdinneren fortpflanzte; René und Tomeo sprangen auf und versuchten festzustellen, in welcher Richtung der Schuss gefallen war, doch am Himmel ballten sich dunkle Wolken zusammen und verdeckten den Mond. Eine Stunde lang irrten sie umher, stolperten über spitze Steine und hielten sich fest, um nicht in Felsspalten zu stürzen. Feuchter Wind war aufgekommen, und bald waren sie schweißbedeckt. Sie glaubten ihr Ziel erreicht zu haben, als sie in wenigen hundert Schritten Entfernung hinter einem Felsriegel zwei Detonationen hintereinander vernahmen.
Sie begannen den Felsen zu erklettern, tasteten mit Händen und Füßen nach Halt. Doch dann brach unversehens der Gewittersturm über sie herein.
Man muss ein Gewitter im Mittelmeerraum erlebt haben, um sich eine Vorstellung davon machen zu können, mit welcher Urgewalt Wind, Regen, Donner, Hagel und Blitze wüten und toben. René und Tomeo mussten von ihrem Vorhaben ablassen; sie rutschten zum Fuß des Felsens hinunter und versuchten ihn auf verschlungenen Pfaden zu umrunden, neben denen sich gefährliche Abgründe öffneten. Der Wind trieb Wolken und Nebelschwaden über den Boden, Wasserfluten rauschten den Berg hinunter, Blitze blendeten die Verfolger, und der Donner dröhnte in ihren Ohren, bis sie sich eingestehen mussten, dass unter diesen Umständen nichts auszurichten war. Sturmgetöse und Finsternis ließen ihnen keine Hoffnung, den Bizzarro zu finden.
Im strömenden Regen, der sie bis auf die Knochen durchnässte, machten sie sich auf den Weg zurück nach Maida. Die Wolken, die an ihnen vorbeijagten und sie einhüllten, und der heißfeuchte Atem des Schirokko bedeckten ihre Hände und Gesichter mit einem klebrigen Schweiß, der wenige Minuten darauf in der kalten Luft eisig wurde. Sie durchwateten zunehmend reißendere Bäche, die ihnen mittlerweile bis zum Knie reichten. Dann, als fast der Morgen graute, hörten sie Rufe und sahen Lichter: Es waren Männer, die außerhalb Maidas kampiert hatten, weil sie sich Sorgen um René und Tomeo machten und sich auf die Suche nach ihnen begeben hatten.
Man suchte die einzige Herberge des Dorfs auf, eine bescheidene Hütte, die im Tosen des Winds wackelte und in deren Inneren man durch die breiten Ritzen in den Wänden die Blitze draußen zucken sah. Im Kamin wurde ein großes Feuer entzündet, und über dem Feuer briet man an einem Haselstecken als Spieß ein mageres Huhn. Der Wirt wärmte Tücher, in die René und Tomeo sich hüllten, während das einzige saubere Tischtuch, das es gab, mit zwei angeschlagenen Tellern gedeckt wurde.
Wiederbelebt machte René sich gerade über eine magere Hühnerkeule her, als der Soldat, der vor der Tür des Hauses Wache hielt, hereinkam und sagte, eine Frau verlange ihn zu sprechen und behaupte, ihm etwas über den Bizzarro sagen zu können.
»Herein mit ihr«, sagte René.
Die Frau trat ein. Ihre langen schwarzen Haare und ihre zerlumpten Kleider trieften vor Nässe; in der Hand hielt sie ein Päckchen in einem Tuch, dessen vier Zipfel verknotet waren. Sie richtete einen durchdringenden Blick auf René.
»Sie bringen mir Kunde über den Bizzarro?«, fragte der junge Mann.
»Ich bringe Ihnen mehr und Besseres als das«, erwiderte sie mit düsterer Stimme.
Dann legte sie ihr Päckchen auf den Boden, entknotete es, fasste hinein und holte einen Gegenstand hervor, den man in dem dunklen Raum nicht deutlich erkennen konnte. Sie trat zu René an den Tisch in der Nähe des Kamins, und er sah, dass sie einen blutigen Kopf an seinen langen Haaren hielt, den sie neben den Tellern auf den Tisch stellte.
René konnte eine Geste des Abscheus nicht verbergen und erhob sich.
»Dieser Kopf ist zweitausend Dukaten wert«, sagte die Frau. »Geben Sie mir das Geld.«
René trat an den Kamin, vor dem seine Uniform zum Trocknen über einem Stuhlrücken hing, und entnahm seinem Gürtel Goldstücke, die er neben dem Kopf mit seinen verzerrten Gesichtszügen auf den Tisch warf. Die Frau zählte sie und steckte sie eines nach dem anderen in ihre Schürzentasche.
Als sie fertig war, ging sie zur Tür, wie sie hereingekommen war, doch René hielt sie auf.
»Sie sind völlig durchnässt und erschöpft«, sagte er, »und sicher hungrig.«
»Sehr hungrig«, erwiderte sie.
»Setzen Sie sich ans Feuer«, befahl René.
Er trug dem Wirt auf, ihr die Reste des Hühnchens zu servieren, und setzte sich neben sie. Sie stürzte sich auf das abgenagte Tier, das vor sie gestellt wurde, und als nur noch die blanken Knochen übrig waren, fragte René: »Warum haben Sie ihn getötet?«
Und sie berichtete mit unbewegter Stimme, ohne zu schluchzen, ohne lauter oder leiser zu werden, den Tod des Banditen.
Als der Bizzarro sich von allen Seiten eingekreist fand, hatte er in einer Höhle, deren Zugang nur ihm bekannt war, seine letzte Rettung gewähnt. Er hatte seine letzten zwei Gefährten verabschiedet und nur Frau und Kind bei sich behalten.
Die Höhle war tatsächlich von außen nicht zu erkennen. Der Eingang war so eng, dass man auf dem Bauch kriechen musste, um hineinzugelangen; und sobald man hineingelangt war, bildeten draußen Dornen, Moos und Efeu eine schier undurchdringliche Hecke.
Doch dem Kind war dieses Leben nicht gut bekommen; es kränkelte, weinte, wenn es wach war, und wimmerte leise im Schlaf.
»Frau, Frau!«, sagte der Bandit. »Bring dein Kind zum Schweigen; man sollte wahrhaftig meinen, es wäre uns nicht vom Herrgott geschenkt worden, sondern vom Teufel, um mich meinen Feinden zu verraten.«
Die Frau gab dem Säugling die Brust, doch da sie selbst Hunger litt, hatte sie nicht genug Milch für das arme Wurm, das weiter schrie und weinte.
Eines Abends hatte sie den schreienden Säugling mit keinem Mittel beruhigen können, und die Hunde knurrten unruhig, als spürten sie, dass Menschen in der Nähe herumschlichen.
Der Bizzarro erhob sich, packte das Kind an einem Bein, ohne ein Wort zu sagen, entriss es den Armen seiner Mutter und schlug es gegen die Felsmauer der Höhle, so dass sein Schädel zerschmettert wurde.
»Im ersten Augenblick wollte ich ihm an die Kehle springen und ihn erwürgen, das Untier! Und ich schwor bei der heiligen Muttergottes, dass ich mein Kind rächen würde«, sagte die Frau.
Sie hatte nichts gesagt, sondern sich bleich und wortlos erhoben, hatte den Leichnam ihres Kindes aufgehoben, in ihre Schürze gewickelt, auf die Knie genommen und mit einer mechanischen Bewegung und am ganzen Körper zitternd begonnen, ihn zu wiegen, als wäre das Kind noch am Leben.
Am Morgen hatte der Bandit die Höhle verlassen, um mit seinen Hunden auf Erkundung zu gehen.
Und die Frau hatte mit ihrem Messer in der Höhle eine kleine Grube gegraben, in der sie ihr Kind beerdigte, und ihre Bettstatt darüber gebreitet, damit die Hunde den Leichnam nicht ausgraben konnten, um ihn zu fressen, was unfehlbar geschehen wäre, wenn sie ihn draußen begraben hätte.
In ihren schlaflosen Nächten sprach die Unglückliche leise mit dem Kind, von dem sie nur eine Schicht Ginster und eine Handbreit Erde trennten.
Und nachdem sie seiner armen Seele flüsternd Rache gelobt hatte, entsann sie sich der Familie, die sie verlassen hatte, ihres abenteuerlichen Lebens an der Seite des Mörders und all dessen, was sie klaglos ertragen hatte; sie gelangte zu dem Schluss, dass der Dank dafür die Ermordung ihres Kindes war und dass sie als Nächste ermordet werden würde, wäre sie erst schwach genug, um den Mörder in Gefahr zu bringen.
Und in der letzten Nacht, als der Brigant tief und fest eingeschlafen war, erschöpft von einer langen und anstrengenden Wanderung auf der Suche nach Nahrung, hatte sie sich von ihrem Lager auf dem Grab ihres Kindes erhoben, auf dem sie zu wachen pflegte, hatte ein paar Worte geflüstert, die wie ein Gelöbnis klangen, hatte den Boden geküsst, sich aufgerichtet und sich mit den lautlosen Schritten einer Erscheinung dem Banditen genähert. Sie hatte sich über ihn gebeugt, hatte gelauscht, ob er wirklich schlief, und als seine tiefen, gleichmäßigen Atemzüge sie beruhigten, hatte sie sich zurückgebeugt, den Stutzen des Banditen ergriffen, der geladen neben ihm lag, hatte nach dem Zündhütchen getastet und sich vergewissert, dass der Feuerstein trocken war, und dann hatte sie den Lauf an das Ohr des Schlafenden gehalten und abgedrückt.
Der Bizzarro hatte keinen Laut geäußert, doch der Schuss hatte seinen Körper herumgeworfen, so dass er nun mit dem Gesicht auf dem Boden lag.
Daraufhin hatte die Frau sein Messer genommen, ihm den Kopf abgetrennt und diesen in ihre Schürze gepackt, die noch vom Blut ihres Kindes befleckt war; dann hatte sie die zwei Pistolen des Banditen genommen und in ihren Gürtel gesteckt und die Höhle verlassen.
Sie war kaum hundert Schritte gegangen, als die zwei Hunde, die draußen wachten, mit blutunterlaufenen Augen und gesträubtem Fell auf sie zugestürmt kamen. Sie spürten, dass ihrem Herrn etwas widerfahren war und dass diese Frau die Schuld daran trug.
Doch mit zwei Pistolenschüssen hatte sie die Hunde erlegt.
»Und dann bin ich hergekommen, ohne zu rasten, zu essen oder zu trinken.«
119
Die Hand der Herzogin
Am selben Tag verließen René und seine Scharfschützen das Dorf unter einem Himmel, den der Sturm klar und rein zurückgelassen hatte.
René hatte von dem Wirt ein Maultier erworben, auf dessen Rücken Tomeo einen Weidenkorb festgezurrt hatte. Dieser Korb enthielt den Kopf des Bizzarro, der noch immer in die Schürze gewickelt war, deren Zipfel man wieder verknotet hatte. Das Maultier ging voraus, von Tomeo geführt; in hundert Schritt Entfernung folgten ihm die Soldaten, als wollten sie aus instinktivem Entsetzen Abstand zu den abscheulichen Verbrechen halten, deren Ursprung dieser Kopf war.
René hatte Tomeo gebeten, sie nach Reggio zu führen, denn er hielt es für möglich, dass General Reynier während ihrer Abwesenheit die Stadt bereits eingenommen hatte; vielleicht kämen sie gerade noch rechtzeitig, um sich an der Rückeroberung Reggios zu beteiligen, dessen schwache Garnison die bourbonischen Räuberbanden mit Unterstützung der Engländer unter Hochrufen auf König Ferdinand massakriert hatten, nachdem die Niederlage der Franzosen bei Maida ihnen die Stadt ausgeliefert hatte.
»Sie müssen unter allen Umständen in Reggio und Scilla Fuß fassen. Es ist eine Schande, dass die Engländer die Nase auf den Kontinent vorstrecken, und ich kann und will es nicht zulassen. Treffen Sie die entsprechenden Maßnahmen«, hatte der Kaiser seinem Bruder Joseph geschrieben; und gewiss hatte Reynier in dem Wunsch, die erlittene Niederlage wettzumachen, seine Männer zur Eile angetrieben, hatte den Weg ebnen lassen, den René in den Bergen entdeckt hatte, und die Belagerungsgeschütze bereits auf eine Viertelkanonenschussweite an die Stadt herangeschafft. Die Belagerung hatte sicherlich schon begonnen.
Doch als René mit seinen Männern die Ausläufer des Aspromonte erreichte und die kalabrische Küste sehen konnte, waren keine Truppenbewegungen zu erkennen, die auf eine Schlacht hingewiesen hätten. Über der Stadt Reggio stiegen lediglich vereinzelte Rauchfahnen träge in den blauen Himmel. René fragte sich, was dort vor sich gehen mochte, und in seiner Ungeduld kam der Abstieg ihm so zäh und mühsam vor, als ginge es in die Unterwelt hinunter.
Der Wachtposten eines Vorpostens konnte seine Frage endlich beantworten: »Bei den ersten Kanonenschüssen haben sich die ganzen Santa-Fede-Lumpen aus dem Staub gemacht wie ein Schwarm Sperlinge. Sie sind in ihre Boote gesprungen und haben sich nach Sizilien davongemacht.«
»Und die Engländer?«
»Die haben wir nicht zu Gesicht bekommen. Lord Stuart und seine Schiffe sind am Horizont verschwunden.«
Auf den Straßen von Reggio hatten die Soldaten ihre Gewehre zu Pyramiden aufgestellt; die einen saßen im Schatten auf Prellsteinen oder Mäuerchen und hatten ihre spartanischen Rationen hervorgeholt, die sie in kleinen Bissen aßen, um länger etwas davon zu haben, die anderen hatten an den Brunnen ihre Uniformen abgelegt und planschten halbnackt herum, lachend und einander neckend wie Kinder.
Fünf, sechs Häuser brannten noch von dem Bombardement; um zu dem alten Schloss der Aragonier zu gelangen, in dem Reynier seinen Generalstab eingerichtet hatte, mussten René und seine Scharfschützen sich ihren Weg durch rauchende Trümmer bahnen und über halbverkohlte Leichen steigen.
Auf der Piazza Castello hingen büschelweise Erhängte an einem Baum.
»Das sind Briganten, die wir bewaffnet erwischt haben«, sagte ein Soldat, der diesen sinistren Rebstock bewachte. »Sie haben genug unserer Waffenbrüder hingemetzelt!«
In dem Schloss beendeten die Offiziere gerade eine Mahlzeit, die für die vorherigen Bewohner der Stadt zubereitet und von ihnen in ihrer überstürzten Flucht wie alles andere zurückgelassen worden war.
René wurde gemeldet, und Reynier kam ihm mit ausgestreckten Armen entgegen.
»Mein lieber Graf Leo, Sie kommen zu spät«, sagte er und umarmte ihn.
»Muss ich mich aufhängen wie Crillon?«
»Nein, ich habe gefahrlos gesiegt. Um ehrlich zu sein, haben eigentlich Sie Reggio eingenommen, in absentis, indem Sie den Weg fanden, auf dem wir die Belagerungsartillerie heranschaffen konnten.«
»Behalten Sie den Sieg, General«, sagte René lächelnd.
»Sie denken, ich könnte ihn gut brauchen, um mich nach der Niederlage bei Maida zu rehabilitieren?«
»Wäre es so, wäre es mir recht.«
»Und Sie, mein lieber Graf Leo, konnten Sie Ihre Unternehmung glücklich zu Ende bringen?«
»Ich habe den Kopf des Bizzarro und musste mir nicht einmal die Hände mit seinem Blut besudeln.«
»Berichten Sie mir von Ihrer Brigantenjagd, lieber Freund.«
Und René berichtete ihm von seiner langen Verfolgungsjagd, die ergebnislos verlaufen war und die er hatte abbrechen wollen, als die Gefährtin des Banditen ihm dessen Kopf gebracht hatte.
»Ich hätte nicht übel Lust, den Kopf des Mannes zu sehen, der für einige Stunden König von Palmi war und vor dem ganz Kalabrien zitterte.«
Auf ein Zeichen Renés brachte Tomeo den Weidenkorb und holte die unheimliche Fracht heraus.
»So viele Köpfe, die in fünfzehn Jahren abgeschlagen wurden!«, murmelte Reynier und wandte den Blick von den verzerrten Zügen des Bizzarro ab, dem niemand die Augen geschlossen hatte.
»Ja, weiß Gott, und Köpfe, die mir lieb und teuer waren«, erwiderte René mit erstickter Stimme. »In jahrelanger erzwungener Einsamkeit habe ich gründlich darüber nachgedacht, welchen Sinn man in den Bergen von Menschenopfern sehen soll, die mich zuerst mit tiefstem Entsetzen erfüllt haben.«
»Und zu welchem Schluss sind Sie gelangt?«
»Dass das Schafott eines der Mittel ist, deren sich eine unergründliche Macht bedient hat – nennen Sie sie Gott oder Vorsehung, es macht keinen Unterschied! -, um die Hindernisse zu beseitigen, die von den Völkern dem Siegeszug der Freiheit in den Weg gestellt wurden...«
»Der Einfall des guten Doktor Guillotin wäre also kein Zufall, und die Erfindung des Instrumentenbauers mehr als ein glücklicher Einfall?«
»Nein, sie kamen zu ihrer Stunde wie alles Unausweichliche und vom Schicksal Vorherbestimmte. Die Waffe der Revolution musste gebaut werden. Das Flammenschwert, das der Revolution gereicht wurde, setzt sich wie Jupiters Blitz aus zwölf gewundenen Strahlen zusammen: drei Strahlen des Hasses, drei der Rache, drei der Tränen, drei des Blutes. Sagte Saint-Just nicht: ›Wer nicht tief genug schürft, wenn es um die Revolution geht, der gräbt sein eigenes Grab und das der Freiheit‹? General, wir leben in von Revolutionen erschütterten Zeiten, die zu überstehen den Atomen, die wir sind, schwerfällt.«
»Mein lieber Graf Leo, vergessen wir, dass dieser Brigant ein Mensch war, denn durch seine Taten hat er sich unter die blutrünstigen Bestien eingereiht, die Sie einst im Königreich Birma bekämpft haben. Während Sie ihn verfolgten, habe ich mein Wort gehalten. Holen Sie mir Jean«, sagte der General zu seinem Adjutanten, »und sagen Sie ihm, dass er mitbringen soll, was er angefertigt hat.«
Kurz darauf kam ein Soldat herein, an dessen lebhaftem Gebaren und schalkhafter Miene man den Pariser Handwerker erkannte.
»Jean, zeigen Sie Monsieur das Meisterwerk, das Sie für ihn gebaut haben.«
Der Soldat stellte vor René eine große Kiste aus Olivenholz mit goldenen Initialen ab, die kunstvoll gearbeitet und poliert war, und öffnete ihren Deckel; das Innere war mit rotem Samt ausgeschlagen.
»Das ist der Schrein, den ich für den Kopf des Bizzarro in Auftrag gegeben habe; wir werden unseren Wundarzt bitten, ihn sorgfältig zu präparieren, bevor Sie aufbrechen, denn ich gebe Ihnen Urlaub, mein lieber Graf Leo, besser gesagt, ich schicke Sie in Mission nach Neapel: Sie werden König Joseph die Wiedereroberung Reggios verkünden.«
Am nächsten Tag verließen René auf einem der besten Pferde des Generals und Tomeo auf dem Maultier, das er ins Herz geschlossen und Regina getauft hatte, bei Tagesanbruch das Castello und machten sich auf den Weg nach Neapel. Von Maida an nahmen sie den gleichen Weg wie auf der Hinreise, begleitet von der gleichen Heimlichtuerei zwischen Renés Führer und Bauern mit Galgengesichtern, die unvermittelt aus dem Unterholz auftauchten und ebenso schnell wieder darin verschwanden, und jeden Abend legte Tomeo sich in der Herberge zur Sicherheit vor Renés Zimmertür.
Sechs Tage später näherten sie sich eines frühen Morgens Neapel, und je näher sie kamen, desto lauter war das Gelärme der Stadt zu vernehmen. Die Neapolitaner sind das mit Abstand lärmendste Völkchen auf dem ganzen Erdenrund: Ihre Kirchen besitzen zahllose Glocken, ihre Pferde und Maultiere sind über und über mit Glöckchen behängt, ihre Lazzaroni, Frauen und Kinder sind mit einem Mundwerk gesegnet, das nie stillsteht, und alles dröhnt, klingt und schreit ohne Unterlass um die Wette. An der Maddalenabrücke wurden sie von einem Dutzend neugieriger Kinder umringt, die ihrem Gepäck eine so ausgeprägte Wissbegier entgegenbrachten, dass Tomeo sie mit dem Stöckchen vertreiben musste, mit dem er hin und wieder seine geliebte Regina antrieb.
René ließ sich zum Hotel La Vittoria führen, wo Meister Martin Zir ihn herzlich willkommen hieß, denn er hatte René in die Kategorie der großzügigen Reisenden eingeordnet, die zwar schlechte Händler sein mögen, aber ausgezeichnete Kunden sind. Kaum hatte René seine Toilette beendet, erhielt er die Antwort auf den Brief, den er Saliceti geschickt hatte und in dem er um eine dringende Audienz beim König ersuchte; trotz der frühen Stunde erwartete man ihn im Königspalast.
Er begab sich eilig dorthin und wurde von Saliceti zum König geführt. Joseph trat ihm entgegen: »Im Gegensatz zu meinem Bruder wäre es mir am liebsten, man weckte mich nur, um mir gute Nachrichten zu melden. Und ich glaube verstanden zu haben, dass die Nachricht, die Sie überbringen, keine schlechte Nachricht ist …«
»In der Tat, Sire, Reggio ist eingenommen, und das fast ohne einen Schuss. Ein paar Kanonenkugeln genügten, um die Kanaille in die Flucht zu schlagen.«
»Wenn ich mich nicht täusche, ließ Reynier durchblicken, er verdanke diesen Sieg dem Umstand, dass Sie einen Weg ausgekundschaftet hatten, auf dem er die Artillerie bis nach Reggio bringen konnte.«
»Wenn der General es sagt … Aber bei der Einnahme der Stadt war ich nicht anwesend.«
»Ich weiß: Er sagte mir, Sie hätten sich auf die Jagd nach einem Banditen begeben, der im Namen der Bourbonen in Kalabrien Angst und Schrecken verbreitete.«
»Und jetzt ist Kalabrien um diesen einen Banditen ärmer. Aber sie sind ein fruchtbares Geschlecht.«
»Nun rückt eine Invasion Siziliens in greifbare Nähe«, fuhr Joseph fort, »wenn es uns gelingt, von Reggio sieben- bis achttausend Mann über die Meerenge zu bringen, an Land abzusetzen, den Leuchtturm zu besetzen und dort unsere Truppen zusammenzuziehen.«
»Gewiss, Sire, doch zuvor müssen wir in Neapel unsere Marine aufrüsten, damit wir so viele Soldaten wie möglich nach Sizilien entsenden können.«
»Sie haben recht; angesichts der derzeitigen Konstellationen in Europa darf es uns nicht an Truppen mangeln; der Kaiser wird Vorsorge treffen und mir so viele Soldaten schicken, wie ich von ihm verlange. Lesen Sie, was er mir schreibt.«
Und er reichte René eine Depesche, die mit Napoleons hastiger Unterschrift unterzeichnet war:
Seien Sie darauf bedacht, immer bereit zu sein, in Neapel Ihre Truppen einzuschiffen, nach Mortelle zu marschieren und den Leuchtturm einzunehmen. Bewahren Sie darüber größtes Stillschweigen, denn für Spione ist der Weg von Neapel nach Sizilien nicht weit, und eine Indiskretion würde uns in das größte Unglück stürzen. Niemand außer Saliceti, einem Marineoffizier und Ihnen darf davon wissen, auch nicht der Offizier, den Sie nach Otranto und Brindisi entsenden; Sie werden ihm einen versiegelten Brief mitgeben, den er erst öffnen darf, wenn er in Otranto erfährt, dass etwas Außergewöhnliches vorgefallen ist.
»Ich muss Sie nicht eigens um Verschwiegenheit bitten …«
Nachdem der König sie verabschiedet hatte, begleitete der Polizeiminister René bis zur großen Treppe. »Mein lieber René, es versteht sich von selbst, dass ich Sie zum Mittagessen dabehalten werde. Meine Tochter, die Herzogin, würde es mir niemals verzeihen, wenn ich ihr den Bericht über den Tod des Bizzarro vorenthielte.«
Als René drei Stunden später in den Salon der Residenz des Kriegsministers geführt wurde, erwartete ihn die Herzogin von Lavello zusammen mit ihrem Vater und dessen korsischem Sekretär.
»Ah, da sind Sie ja!«, rief die Herzogin, sobald sie René erblickte, vom anderen Ende des Zimmers aus. »Wir haben Sie ungeduldig erwartet! Darf ich Sie weiterhin Graf Leo nennen?«
René bückte sich, um die Kiste aus Olivenholz zu Füßen der Herzogin abzustellen. »Sie dürfen mich bei diesem Namen nennen, er ist mir nicht abhandengekommen. Hier habe ich den Kopf des Bizzarro.«
»Hier ist meine Hand, wie versprochen, Graf Leo.«
René führte ehrerbietig seine Lippen an die kleine aristokratische Hand der Herzogin, deren Wangen sich sichtlich röteten. Und vielleicht um ihre Bewegung zu verbergen, kniete die junge Frau sich vor die Kiste und öffnete den Deckel.
Dann stieß sie einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht.
(Die nächsten drei Kapitel leiten eine spätere Episode des Romans ein.)
PRAGER MANUSKRIPT
ERSTES KAPITEL
Seine Kaiserliche Hoheit Vizekönig Eugène-Napoléon
Bekanntlich wurde nach dem Vertrag von Campo Formio das gesamte Territorium der vormaligen Republik Venedig Österreich zugeschlagen und das Territorium diesseits der Etsch der Cisalpinischen Republik einverleibt.
Diese Cisalpinische Republik wurde später zum Königreich Italien, dem 1805 das venezianische Territorium hinzugefügt wurde, das der Vertrag von Campo Formio den Österreichern überlassen hatte.
Prinz Eugène de Beauharnais wurde daraufhin von Napoleon zum Fürsten von Venedig ernannt, und das Gebiet wurde in acht Departements mit jeweils eigener Bezirkshauptstadt aufgeteilt.
Venedig wurde Bezirkshauptstadt des Adriatischen Departements, Padua Hauptstadt des Departements Brenta, Vicenza Hauptstadt des Departements Bacchiglione, Treviso Hauptstadt des Departements Tagliamento, Capo d’Istria Hauptstadt des Departements Istrien und Udine Hauptstadt des Departements Passeriano.
Udine ist eine reizende kleine Stadt, mitten in einer fruchtbaren Ebene und am Ufer des Flusses Ledra gelegen; sie hat eine Innenstadt und eine äußere Stadt, die Mauern und Gräben voneinander trennen.
Diese Stadt hatte der Vizekönig Italiens als Residenz gewählt.
Er hatte den Hofstaat, der einem Prinzen seines Alters gebührt: keine dreißig Jahre alt, fröhlich, ungestüm und hochfahrend, denn die Jugend zieht die Jugend unwiderstehlich an. Es war ein Hofstaat schöner Kavaliere und schöner Damen – die Kavaliere furchtlos, zärtlich und draufgängerisch, die Damen gefühlsselig und musikalisch, wie man es in jenen Tagen war, denn sie sangen am Klavier Romanzen der Königin Hortense, Jadins des Älteren und Monsieur d’Alvimars.
Die Vormittage verbrachte man mit Spaziergängen in der näheren Umgebung und mit Jagdausflügen oder Fischfang in den Lagunen von Marano.
Man lebte sorglos, es herrschte Frieden, die Schatztruhen des Vizekönigreichs waren wohlgefüllt. Was sollte man anderes tun als sich vergnügen?
So kam es, dass der ganze Hof am Morgen des Vortags zu einem großen Wettfischen in der Lagune aufgebrochen war.
Es war der 8. April 1809.
Um neun Uhr morgens wurde ein staubbedeckter Reisewagen von drei Pferden in kraftvollem Trab den ziemlich steilen Hügel hinaufgezogen, auf dem das Schloss von Udine liegt.
Das Schloss von Udine war einst die Residenz der Patriarchen von Aquileia gewesen und war nun die Residenz des jungen Vizekönigs.
Auf dem Marktplatz hatte der Wagen kurz angehalten. Ein junger und hübscher Offizier hatte den Kopf zum Wagenschlag herausgestreckt und die Säule von Campo Formio betrachtet, die anlässlich des gleichnamigen Friedensschlusses errichtet worden war und auf der das Datum des Vertrags eingraviert war sowie der Lobpreis der Größe und Hochherzigkeit des Ersten Konsuls, der geruht hatte, Venedig eines Teils seines Territoriums zu berauben. Dann war der Wagen weitergefahren, und nun fuhr er den Hügel zum Schloss hinauf.
Als er vor dem Schloss ankam, hielten die Wachen ihn an.
»Kurier des Kaisers!«, sagten zwei Stimmen gleichzeitig.
Die eine war die Stimme des jungen Offiziers im Wagen. Die andere war die eines kalabrischen Dieners, der auf dem Kutschbock saß.
»Holen Sie den diensthabenden Offizier!«, befahl der junge Offizier.
Ein alter Leutnant kam brummend herbei, ein Veteran der Italienfeldzüge.
»So, so«, sagte er, als er den jungen Offizier erblickte, »noch so ein Milchbart!«
Der Milchbart hatte gehört, was dem alten Offizier entschlüpft war. »Alter Freund«, sagte er lachend, »nicht alle Bärte haben die Ehre, das Blitzen der türkischen Säbel bei den Pyramiden und das Feuer der Kanonen von Marengo mit angesehen zu haben, und mein junger Bart beneidet den Ihren darum.«
Der Leutnant errötete: Er hatte einen Vorgesetzten beleidigt, denn der junge Offizier trug Uniform und Ehrenzeichen eines Schwadronschefs der berittenen Jäger.
»Verzeihen Sie, mein Kommandant«, sagte der alte Soldat und fügte erklärend hinzu, »Sie wissen oder sind eher in der glücklichen Lage, nicht zu wissen, dass unseresgleichen lieber der Ungerechtigkeit der Vorgesetzten als der Kürze der eigenen Beine die Schuld gibt, wenn wir ins Hintertreffen geraten; doch letzten Endes«, er klopfte gegen das Kreuz an seiner Brust, »darf man sich nicht beklagen, wenn man das hier bekommen hat.«
»Sie haben recht, mein Wackerer, und Sie sehen«, sagte der junge Mann und deutete auf seine Brust, die kein Orden zierte, »dass ich in dieser Hinsicht nicht so glücklich war wie Sie. Doch vergeuden wir keine kostbare Zeit... Ich muss auf der Stelle Seine Kaiserliche Hoheit den Vizekönig sprechen. Ich bringe ihm Depeschen des Kaisers.«
»Auf der Stelle«, wiederholte der alte Soldat; »da haben wir es wieder: Die Jugend denkt, sie müsste nur befehlen, damit ihre Wünsche erfüllt werden. Und wenn Seine Hoheit nicht in Udine weilen sollten, sondern auf der Jagd wären, beim Fischfang, sich in der Lagune vergnügten, was wäre dann mit Ihrem auf der Stelle?«
»Er ist nicht in Udine? Wo ist er? Wo er auch sein mag, ich muss sofort zu ihm. Ich habe dem Kaiser versprochen, ihn wo auch immer am 8. April vor dem Mittag zu erreichen.«
»In meiner Heimat, Kommandant, sagen wir: mehr Glück als Verstand. Wie es um Ihren Verstand bestellt ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sie Glück haben. Sehen Sie dort hinten die Staubwolke auf der Straße nach Palmanova in einer halben Meile Entfernung? Das ist der Staub, den die Wagen des Hofstaats aufwirbeln.«
»Dann«, sagte der junge Offizier und sprang aus seinem Wagen, »ist meine Reise einstweilen zu Ende. Tomeo, bezahle den Postillion.«
Unterdessen hatte sich um den Wagen des Neuankömmlings ein Kreis Neugieriger gebildet, und ein Offizier aus dem Palast kam hinzu und bat den Schwadronschef im Namen des Vizekönigs, dessen Ankunft gemeldet worden war, in das Schloss zu kommen.
Der junge Mann drückte dem alten Soldaten herzlich die Hand. »Ich danke Ihnen, mein Wackerer«, sagte er. »Ich werde die Wahrheiten, die Sie mir gesagt haben, nicht vergessen, und sollte sich die Gelegenheit ergeben, Ihre Schulter mit einer zweiten Epaulette zu krönen, werde ich um Erlaubnis nachkommen, sie eigenhändig anzubringen.«
Der alte Soldat sah ihm nach, als er sich entfernte, und brummte kopfschüttelnd: »Grünschnabel. Hat mir wahrhaftig seine Protektion versprochen!«
Er zuckte die Schultern und ging in die Wachstube zurück.
Der Schwadronschef wurde in ein Zimmer des Schlosses geführt und nach seinen Wünschen gefragt.
»Ich brauche Wasser und meinen Diener«, erwiderte er.
Fünf Minuten später war beides da.
Tomeo – wir erinnern uns an den Namen des italienischen Dieners unseres Reisenden, der auf dem Kutschbock gesessen hatte -, Tomeo öffnete ein kostbares silbernes Necessaire und verteilte dessen Inhalt auf dem Toilettentisch; aus einem besonderen Fach holte er einen prachtvollen Federbusch aus perlen- und diamantengefassten Reiherfedern und warf seinem Herrn stumm einen fragenden Blick zu.
»Aber gewiss doch«, erwiderte dieser lächelnd.
Zehn Minuten später war die Toilette des jungen Offiziers beendet: Er hatte sich umgekleidet und war frisiert, geschniegelt und parfümiert wie ein wahrer Salonadjutant.
Er zupfte seinen Schnurrbart zurecht, als die Wagen in den Hof des Palasts einfuhren.
Kaum hatte der Prinz seine Gemächer betreten, wurde dem Reisenden gemeldet, dass Seine Hoheit ihn erwarte.
Er nahm in seinem Kalpak die Depesche des Kaisers mit und folgte dem Adjutanten, der ihn vorzustellen hatte.
Eugène de Beauharnais, den wir vierzehn Jahre zuvor in Straßburg Fechtstunden bei Augereau nehmen sahen, war ein ausgesprochen schöner und eleganter Prinz von acht- bis neunundzwanzig Jahren.
Die zwei jungen Männer waren etwa gleichaltrig.
Sie sahen einander zuerst mit der eigentümlichen Bewunderung an, die Männer für die Schönheit anderer Männer empfinden, doch Eugène erkannte sogleich in der Schönheit des jungen Offiziers jene Entschlossenheit – vielleicht weil er selbst sie nicht besaß -, die verrät, dass derjenige, der über sie gebietet, von einem unerwarteten Schicksalsschlag zermalmt, aber nicht gebrochen werden kann. Und der Prinz grüßte den jungen Offizier mit einer Achtung, die weder Dienstgrad noch Alter des Gegenübers gebot.
Der junge Offizier näherte sich dem Prinzen mit einer halben Verbeugung und überreichte ihm seine Depesche mit den Worten: »Brief Seiner Majestät, des Kaisers der Franzosen, an Seine Hoheit, den Vizekönig von Italien und Fürsten von Venedig.«
»Geben Sie ihn mir, Monsieur«, sagte Eugène, und er führte den Brief an seine Lippen und brach das Siegel. »Paris!«, rief er verwundert. »Der Kaiser ist doch nicht in Paris, der Kaiser ist in Valladolid!«
»Lesen Sie, Monsieur«, wiederholte der Offizier beharrlich.
Der Prinz las weiter und äußerte zugleich wachsendes Erstaunen, das bis zum Zweifel reichte.
»Unmöglich!«, murmelte er. »Unmöglich! Der Kaiser kann nicht besser wissen, was hier vor sich geht, als ich«, und zu dem Kurier gewendet: »Hat der Kaiser Ihnen gesagt, welche Nachricht Sie mir überbringen?«
»Ja, Monseigneur, ich soll Sie im Namen seiner Majestät auffordern, Verteidigungsmaßnahmen zu treffen, und Ihnen ankündigen, dass in drei, spätestens vier Tagen Erzherzog Johann einen Angriff vortragen wird.«
»Einfach so! Aus heiterem Himmel! Ohne Kriegserklärung! Unmöglich, dass ich davon bisher nichts erfahren hätte. Der Erzherzog und seine Österreicher werden ja wohl nicht im Ballon angeflogen kommen!«
»Sicherlich nicht, aber über Tolmezzo und Fella Torte kann er in zwei Tagen Ihre Vorposten attackieren.«
»Der Kaiser schreibt, er habe von Valladolid aus von König Murat eine Division der neapolitanischen Armee angefordert, die am 8. oder 9. unter dem Kommando von General Lamarque in Udine eintreffen soll.«
Der Vizekönig klingelte; ein Adjutant erschien.
»Lassen Sie augenblicklich General Sahuc rufen«, befahl der Vizekönig.
Der Adjutant verschwand.
Die jungen Männer setzten ihr Gespräch fort, für das die Nachrichten, die der Kurier gebracht hatte, genug Stoff boten.
»Hat der Kaiser Ihnen nichts aufgetragen, was Sie mir besonders eindringlich ans Herz legen sollen?«
»Er empfiehlt Eurer Hoheit, alle Straßen penibel überwachen zu lassen. Wenn die Truppen Eurer Hoheit geschlossen sind und sich in vorteilhafter Stellung befinden, können, nein, müssen Eure Hoheit die Schlacht eröffnen. Eure Hoheit werden verstehen, wie wichtig diese erste Schlacht ist. Ein Sieg wird der ganzen Armee Mut verleihen, eine Niederlage … nicht auszudenken, welche Folgen eine Niederlage hätte.«
Eugène wischte sich mit dem Taschentuch über die schweißnasse Stirn und wurde sichtlich blasser. »Und wenn meine Armee zerstreut ist und sich nicht in vorteilhafter Stellung befindet?«
»Dann, Monseigneur, lautet der Rat des Kaisers, dass Eure Hoheit sich hinter den Tagliamento zurückziehen und dort Eure Operationslinie wählen.«
»Aber einen Feldzug mit der Flucht zu beginnen!«
»Ein Rückzug ist keine Flucht. Das militärische Ansehen eines der größten Generäle des Altertums und das eines der größten Generäle der Neuzeit beruht auf Rückzügen. Ziehen Sie sich acht Tage lang zurück. Halten Sie dann an. Gehen Sie in den Kampf. Gewinnen Sie die Schlacht. Und die acht Tage werden keine verlorene Zeit gewesen sein.«
General Sahuc wurde angekündigt.
»Er möge eintreten!«, rief der Vizekönig ungeduldig.
»General«, unterbrach Eugène den General mitten in seiner Begrüßung, »haben Sie Patrouillen auf den Straßen?«
»Gewiss, Eure Hoheit.«
»Und wo?«
»Überall.«
»Verdoppeln Sie sie. Sorgen Sie dafür, dass in jeder Patrouille Männer sind, die Italienisch sprechen, damit sie die Bauern befragen können. Der Kaiser warnt mich – was ich Ihnen jetzt sagen werde, General, ist nur für Ihre Ohren bestimmt -, der Kaiser warnt mich vor einem bevorstehenden Angriff.«
»Als ich mich anschickte, mich zu Eurer Hoheit zu begeben, hat man mir gemeldet, dass sich von der venezianischen Küste ein großes Truppenkontingent nähert«, sagte General Sahuc, »doch an der Trikolore hat man erkannt, dass es ein französisches Korps ist.«
»Das ist General Lamarque mit seiner Division«, sagte der Prinz leise zu dem jungen Offizier.
»Aber wer kann uns angreifen wollen?«
»Die Österreicher, zum Kuckuck!«
»Ohne Kriegserklärung?«
»Das sähe ihnen ganz ähnlich … Jedenfalls schreibt mir der Kaiser, dass die Kriegshandlungen voraussichtlich zwischen dem 13. und dem 15. eröffnet werden. Seien wir also auf der Hut. Senden Sie Ihre Patrouillen aus, und verschaffen Sie sich im Generalstab Übersicht über die Verteilung der Truppen.«
»Unverzüglich, Eure Hoheit.«
Als General Sahuc gegangen war, trat der Hausdiener herein und verkündete Seiner Hoheit, dass angerichtet sei.
»Sie speisen mit uns«, sagte Eugène zu dem Kurier.
»Der Kaiser hat mich beauftragt, Eurer Hoheit zur Verfügung zu stehen«, erwiderte der junge Mann mit einer Verbeugung.
Dann folgte er dem Vizekönig.
ZWEITES KAPITEL Das Mittagessen
Die Türflügel wurden geöffnet, und der Prinz führte den jungen Mann in einen Salon, in dem der Hofstaat versammelt war.
Seine Zusammensetzung erwähnten wir bereits. Der junge Offizier war überwältigt: Nie zuvor hatte er so viele bezaubernde Frauen und elegante Offiziere in einem Raum gesehen.
»Meine Damen und Herren«, sagte Eugène, »ich darf Ihnen den Schwadronschef René vorstellen, der mir als Sonderkurier des Kaisers gesandt und von unserem Kriegsminister empfohlen wurde. Ein Rivale für Sie, meine Herren, und ein neuer Diener für Sie, meine Damen. Monsieur René, ich gestatte Ihnen, der Prinzessin den Arm zu reichen. Prinzessin, lassen Sie Ihren Kavalier Platz nehmen.«
Die Türen des Speisezimmers wurden geöffnet.
Eine Zeit lang waren alle damit beschäftigt, ihren Platz einzunehmen; man schob die Sessel hin und her, um einander nicht in die Quere zu kommen, doch sobald die Gäste sich gesetzt hatten, blickten alle neugierig zu René.
Als er den Salon betrat, waren seine Schönheit und seine Eleganz allen aufgefallen, doch als man sah, wie er der Prinzessin den Arm reichte, wie er sie zu ihrem Sessel führte und wie er sich vor ihr verneigte, während er selbst Platz nahm, bezweifelte niemand mehr, dass dieser Gast in der allerbesten Gesellschaft zu verkehren gewohnt sein musste.
»Monsieur René«, sagte der Prinz, »ich sehe, dass die Damen kaum an sich halten können, Sie auszufragen, woher Sie kommen und was Sie erlebt haben. Erzählen Sie ihnen doch das eine oder andere.«
»Eure Hoheit bringen mich in große Verlegenheit, wenn Sie mich auffordern, die Unterhaltung an mich zu reißen. Mein Leben war das Leben eines Gefangenen, eines Matrosen, eines Reisenden, eines Soldaten und eines Banditenjägers. Daran ist nichts besonders Interessantes.«
»Ich staune!«, sagte die Prinzessin. »Sie finden daran nichts besonders Interessantes? Ich finde all das überaus interessant.«
»Drängen Sie ihn, Prinzessin, drängen Sie ihn«, sekundierte der Vizekönig seine Frau.
»Sie waren im Gefängnis?«, fragte die Prinzessin ihren Tischnachbarn.
»Mehr als drei Jahre lang, Prinzessin.«
»Und wo?«
»Im Temple-Gefängnis.«
»Waren Sie Staatsgefangener?«
»Ich hatte die Ehre«, erwiderte René lächelnd.
»Und worauf warteten Sie im Temple?«
»Nun, darauf, dass man mich einen Kopf kürzer machte oder mich füsilierte.«
»Oh! Und wer?«
»Seine Majestät Kaiser Napoleon.«
»Aber Sie sind hier -«
»Er gelangte offenbar zu der Ansicht, dass ich es nicht einmal wert sei, guillotiniert oder füsiliert zu werden.«
»Er hat Sie also begnadigt?«
»Ja.«
»Und unter welcher Bedingung?«, fragte Eugène.
»Unter der Bedingung, dass ich mich im Feld umbringen lasse.«
»Sie haben recht daran getan, die Bedingung nicht zu erfüllen.«
»An mir liegt es nicht«, sagte René mit einem Lächeln von unergründlicher Bitterkeit, »ich tat, was ich konnte, um sie zu erfüllen, darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort.«
»Ich hoffe dennoch, dass Sie Ihren Frieden mit dem Kaiser geschlossen haben.«
»Hm! Wir verhandeln noch«, sagte der junge Offizier und lachte, »doch wenn ich im Dienst Eurer Hoheit eine ordentliche Verwundung davontragen könnte, würde dies meiner Sache sicherlich zum Vorteil gereichen.«
Die Frauen begannen, René mit einem gewissen Erstaunen zu betrachten. Die Männer wurden zunehmend ratlos.
»Und dann?«, fragte die Prinzessin. »Sind Sie dann als einfacher Soldat in die Armee eingetreten?«
»Nein, Madame, als einfacher Korsar.«
»Unter wessen Kommando?«, fragte Eugène.
»Unter Surcoufs Kommando, mein Prinz.«
»Haben Sie gute Prise gemacht?«
»Wir haben die Standard erobert.«
Unter den Adjutanten des Prinzen befanden sich Offiziere aller Dienstgrade und Waffengattungen.
»Unglaublich!«, sagte einer von ihnen. »Sie waren einer dieser tollkühnen Piraten!«
»Korsaren, Monsieur«, erwiderte René erhobenen Kopfes.
»Verzeihen Sie, Monsieur«, antwortete der Marineoffizier. »Sie sind tatsächlich einer der tollkühnen Korsaren, die mit einer Slup von zwölf Kanonen und mit achtzehn Mann Besatzung die Standard gekapert haben, ein Schiff mit zweiundvierzig Kanonen und mehr als vierhundert Mann?«
»Ich war dabei, Monsieur, das ist wahr. Bei diesem Anlass ernannte mich Surcouf zum Kapitän, nachdem er mich zuvor bereits zum Leutnant ernannt hatte, und gestattete mir, ein kleines Schiff zu kaufen und auf eigene Faust die Meere zu befahren.«
»Nach allem, was man über Ihren Mut zu hören bekommen hat, wäre es für Sie ein Leichtes gewesen, das Schiff zu kapern, statt es zu kaufen.«
»Das eine war so leicht wie das andere, mein Prinz, denn meine Mittel erlaubten es, und ich war auf meinen Prisenanteil von fünfhunderttausend Francs nicht angewiesen, sondern konnte ihn an meine Kameraden verteilen; es war mir ein Anliegen, ein amerikanisches Schiff zu erwerben, das damals unter neutraler Flagge segelte, und damit nach Indien zu fahren. Ich wollte unbedingt auf Tigerjagd gehen, das hatte ich mir in den Kopf gesetzt. Ich kaufte ein Schiff, übernahm Schiffsnamen und Papiere von dem Kapitän, der es mir verkaufte, und machte mich auf die Fahrt zum Königreich Birma.«
»Und dort sind Sie auf Tigerjagd gegangen?«, fragte einer der Offiziere.
»Ja, Monsieur.«
»Und getötet haben Sie -«
»Ein Dutzend etwa.«
»Aber war das nicht schrecklich gefährlich?«, fragte die Prinzessin.
»Oh, Madame!«, sagte René. »Die Tigerjagd ist nur dann gefährlich, wenn der von einem ersten Schuss verwundete Tiger den Jäger angreift.«
»Aber was dann?«, fragte der Prinz.
»Ich werde Eurer Hoheit wie ein Aufschneider erscheinen«, erwiderte René, »aber -«
»Aber?«, wiederholte der Prinz beharrlich.
»Ich habe herausgefunden, dass es ein ganz einfaches Mittel gibt: Ich habe nie einen Tiger mit dem ersten Schuss verwundet, sondern jeden Tiger mit dem ersten Schuss erlegt.«
»Und wohin haben Sie gezielt?«
»In eines der beiden Augen.«
»Dann sind Sie ja ein wahrer Meisterschütze«, sagte einer der Gäste mit ungläubigem Lächeln.
»O nein, aber ich habe hervorragende Waffen, die Lepage eigens für mich gefertigt hat.«
»Verzeihen Sie die Indiskretion meiner Frage«, sagte der Offizier, der sich wieder einmischte, »aber haben Sie schon öfter Duelle geschlagen?«
»Nur zweimal, Monsieur. Das Erste mit einem Dolch gegen einen Hai von fünfzehn Fuß Länge, dem ich den Bauch von vorne bis hinten aufgeschlitzt habe.«
»Und das Zweite?«
»Das war mit dem Entermesser gegen eine Schlange, die meine zwei Elefanten zu erdrücken drohte.«
»War diese Schlange am Ende der Drache Python?«, fragte der Offizier.
»Wie sie hieß, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie zweiundfünfzig Fuß lang war.«
Da er sah, dass alle amüsiert lächelten, sogar die Damen, sagte René: »Eure Hoheit, bitte beenden Sie die Fragestunde oder befehlen Sie mir zu lügen. Die Natur ist in Indien so verschieden von allem, was wir kennen, dass es uns schwer ankommt zu glauben, was dort alltäglich ist.«
»Aber ich fand alles, was Sie erzählt haben, sehr unterhaltsam«, sagte die Prinzessin. »Ich bitte Sie, fahren Sie fort, fahren Sie fort!«
»Bitte, fahren Sie fort«, schloss sich der Vizekönig an.
»O ja, bitte!«, riefen die Damen, die alles lieben, was sie für unmöglich halten.
René erzählte weiter, doch diesmal ohne kränkendes Ausfragen, wie er zur Île de France zurückgekehrt war, eines der zwei englischen Schiffe überwältigt hatte, die Surcouf beschossen, wie er General Decaen kennengelernt hatte, dem er seinen Wunsch gestand, an einer großen Seeschlacht teilzunehmen, worauf dieser ihm Empfehlungsschreiben an unsere angesehensten Kapitäne mitgab, wie er bei seiner Ankunft in Cadiz auf Lucas getroffen war, als dritter Leutnant auf der Redoutable angeheuert und an der Schlacht von Trafalgar teilgenommen hatte, wie er gefangen genommen worden war, entfliehen konnte, nach Frankreich zurückgekehrt war, zu Joseph entsandt worden war und von dort zu Murat gekommen war.
An dieser Stelle seines Berichts war er angekommen, als man dem Vizekönig die Ankunft General Lamarques und seiner Division ankündigte, während gleichzeitig ein Trommelwirbel zu vernehmen war, gefolgt von Marschmusik.
Die Marschmusik übt eine seltsame Macht über die Menschen aus; sobald sie erklang, blickten alle Gäste zum Vizekönig mit der stummen Bitte, den Tisch verlassen zu dürfen, um zum Fenster zu eilen.
Die Fenster standen offen und ließen den herrlichen Sonnenschein herein. Die Division aus Neapel wanderte den Weg zum Schloss hinauf, und ihre Gewehre funkelten in der Sonne wie die Schuppen einer riesigen Schlange. Dieser lange Lichterzug, Ergebnis des Blitzens der Sonne unter einer Staubwolke, begleitet von der Marschmusik und den Befehlen der Anführer, war ein Konzert und ein Schauspiel, dessen französische Augen und Ohren niemals überdrüssig werden.
Als die Division vor dem Schloss ankam, traten die Kapelle und die Offiziere in den Ehrenhof, angeführt von General Lamarque.
Beim Anblick so vieler tapferer Männer, die ganz Italien durchquert hatten, um sich für ihn töten zu lassen, spürte der Prinz, wie sein Herz klopfte, dem die Natur an Güte gegeben hatte, was sie ihm an Entschlossenheit versagt hatte.
Er stieg mit ausgebreiteten Armen die Treppe hinunter und umarmte General Lamarque, den er bisher nur vom Hörensagen gekannt hatte, denn seit der glanzvollen Einnahme Capris wurde der Ruhm des Generals überall verkündet.
Der Vizekönig besprach mit dem General alles Erforderliche für die Unterbringung der Neuankömmlinge und versuchte in Erfahrung zu bringen, was der General, der ihm zu Hilfe kam, über seine Situation wusste.
General Lamarque war in der Nähe von Rom stationiert gewesen und hatte dort den Befehl erhalten, sich mit seiner Division in Bewegung zu setzen, sich im Eilmarsch nach Friaul zu begeben und sich dort dem Kommando des Prinzen Eugène zu unterstellen.
Er hatte gehorcht.
Der Brief, in dem Napoleon diese Hilfe von Murat verlangte, war aus Valladolid datiert.
Mehr wusste der General nicht.
Prinz Eugène wiederum wusste nicht viel mehr, als dass ihn zwischen dem 12. und dem 14. April die Österreicher überfallen würden.
Der Vizekönig befahl, einen Saal im Erdgeschoss für die Offiziere herzurichten und ihnen dort Erfrischungen zu reichen.
Den General nahm er mit, um ihn den Damen vorzustellen.
Die Damen waren in den Salon gegangen, wo der Kaffee gereicht wurde, und da sie ihre Neugier nicht bezähmen konnten, untersuchten sie mit typisch weiblichem Interesse, das heißt einem nicht ganz neidlosen Interesse, den Federbusch aus Reiherfedern mit seiner Fassung aus Perlen und Diamanten, der den Kalpak des jungen Offiziers schmückte und den die Damen auf einen Wert von mindestens zwanzigtausend Francs veranschlagten.
Als der Prinz mit General Lamarque den Raum betrat, hielt gerade die Prinzessin den Kalpak in der Hand; ihrer weiblichen Neugier gehorchend, hatte sie sehen wollen, was die anderen Damen so sehr bewunderten, und obwohl sie mit Perlen und Diamanten zu vertraut war, um sie zu bestaunen, bewunderte sie die exquisite Manier ihrer Fassung. Sie war mit dem Schmuck so beschäftigt, dass der Prinz in den Kreis um sie herum trat und neben ihr stand, bevor sie ihn bemerkte.
Sie stieß einen leisen Schrei der Überraschung aus.
»Madame«, sagte der Prinz, »gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit für einen Augenblick von diesem bezaubernden Geschmeide abzulenken und Ihnen General Lamarque vorzustellen. Sie wissen, wofür sein Name steht: für Tapferkeit, Vaterlandsliebe und Treue. Seine Majestät Kaiser Napoleon schickt ihn uns zu Hilfe, denn Sie müssen wissen, meine Damen, dass die Tage ungetrübter Freuden vorbei sind, denn wir laufen Gefahr, unversehens angegriffen zu werden. Heute Abend wird noch getanzt werden, doch ab morgen oder übermorgen gibt es nur noch Musik, und zwar jene Musik, zu der die Männer allein tanzen.«
General Lamarque verneigte sich vor der Prinzessin als Mann von Welt und als Mann des Krieges; beide Eigenschaften vereinigte er in sich aufs Vollkommenste.
Die Prinzessin wiederum stand ein wenig eingeschüchtert da und hielt den Kalpak des jungen Schwadronschefs in der Hand.
»Ach ja«, sagte der Vizekönig, »das ist der Federbusch unseres jungen Kuriers, wahrscheinlich das Geschenk einer Fürstin, denn mit den Bezügen eines Schwadronschefs kann man sich solche Kostbarkeiten wohl kaum leisten.«
»Ich bitte Sie«, sagte eine der Hofdamen, »vergessen Sie nicht, dass dieser Mann seiner Mannschaft sein Prisengeld von fünfhunderttausend Francs geschenkt hat.«
»Verzeihung«, sagte der General und streckte die Hand aus, um den Gegenstand zu betrachten, der die Damen so beschäftigte, »aber mir scheint, ich kennte diesen Federbusch.«
Er sah ihn aufmerksam an.
»Aber ja!«, fuhr er fort. »Das ist der Federbusch unseres Freundes René!«
»Sie kennen den jungen Mann?«, fragte Prinz Eugène.
»Sehr gut sogar«, erwiderte Lamarque.
»Und dieser Federbusch?«, fragte die Prinzessin.
»Den hat ihm König Murat geschenkt, damit er ihm als Talisman Tag und Nacht den Zugang zu seinem Palast ermöglicht; ist er hier?«
»Gewiss doch, der Kaiser hat ihn mir als Sonderkurier gesandt. Er kam vor zwei Stunden erst an.«
»Und Eure Hoheit kannten ihn vorher nicht?«
»Nein.«
In diesem Augenblick betrat René den Salon, nachdem er sich im Vorraum mit den Adjutanten unterhalten hatte.
»Darf ich Sie mit ihm bekannt machen?«
»Gewiss.«
»O ja!«, rief die Prinzessin, welche die Neugier teilte, die dem jungen Offizier von den anderen Damen entgegengebracht wurde.
General Lamarque tat einen großen Schritt auf René zu, der einen Freudenruf ausstieß, als er ihn sah; der General nahm ihn bei der Hand, trat auf den Prinzen und die Prinzessin zu und sagte: »Ich habe die Ehre, Euren Hoheiten den Sieger von Capri vorzustellen.«
»Capri!«, rief der Prinz. »Ich dachte, das wären Sie!«
»Eingenommen habe ich die Insel in der Tat«, sagte Lamarque, »aber Monsieur hat sie mir übergeben.«
»Oh, Hoheit«, fiel René ein, »glauben Sie ihm nicht -«
»Schweigen Sie, Schwadronschef!«, sagte Lamarque. »Und ich befehle Ihnen, mir nicht wieder ins Wort zu fallen!« Dann fügte er lachend hinzu: »Wenn ich von Ihnen sprechen will, wohlgemerkt!«
»General«, sagte der Prinz, »wären Sie so freundlich, mich in mein Arbeitskabinett zu begleiten: Es gibt viel zu besprechen.« Dann wandte er sich an René mit größerer Höflichkeit, als er es zehn Minuten zuvor getan hätte, und sagte: »Sie können mit uns kommen, Monsieur.«
DRITTES KAPITEL Vorbereitungen
Eine große Karte des vormaligen Friaul lag auf einem Tisch im Arbeitskabinett des Prinzen.
Der Prinz trat hinzu und legte den Finger auf Udine.
»General«, sagte er zu Lamarque, »der Kaiser hat mir ein großes Geschenk gemacht, indem er Sie zu mir schickte; nun obliegt es mir, Sie mit den Nachrichten vertraut zu machen, die Monsieur mir überbracht hat.
Allem Anschein nach will Österreich unseren Friedensvertrag brechen und uns am 12. dieses Monats angreifen. Dies habe ich vor kaum zwei Stunden erfahren, und ich habe sämtliche Kommandeure anweisen lassen, ihre Truppen um Udine herum zusammenzuziehen, doch die Truppen, die aus Italien kommen, brauchen mindestens fünf bis sechs Tage, bevor sie hier sein werden.«
»Mein Prinz, gestatten Sie mir die Frage, mit welchem Gegner Sie zu tun haben werden«, sagte General Lamarque, »wo seine Truppen stehen und wie viel Mann sich unter seinem Befehl gesammelt haben dürften?«
»Der Name meines Gegners ist Erzherzog Johann.«
»Umso besser!«, sagte General Lamarque.
»Warum umso besser?«
»Weil er der Unerfahrenste und Waghalsigste der drei Brüder ist. Er wird einen Fehler machen, der Eurer Hoheit zupasskommen wird.«
»Leider«, erwiderte der Prinz seufzend und mit kaum merklichem Achselzucken, »bin auch ich nicht sonderlich erfahren, aber wir werden unser Bestes tun... Aber Sie haben mir drei Fragen gestellt.«
»Ich wollte wissen, wo die österreichischen Truppen ihr Standquartier haben.«
»Da ich mich im Frieden wähnte, habe ich die Überwachung des Gegners verringert, doch ich glaube, mich dafür verbürgen zu können, dass er den Golf von Triest noch nicht verlassen hat. Seine Truppenstärke dürfte zwischen fünfzigtausend und fünfundfünfzigtausend Mann betragen.«
»Und wenn Eure Hoheit alle Streitkräfte konzentrieren …«
»Wenn wir alle Truppen zusammenziehen, kommen wir auf fünfundvierzigtausend Mann.«
»Der Unterschied ist kein Anlass zu Besorgnis. Von welcher Seite rechnen Eure Hoheit mit dem Angriff?«
»Da bin ich leider völlig überfragt.«
»Verzeihung, Hoheit«, mischte René sich zum ersten Mal in das Gespräch ein, »mir schien, als hätte der Kaiser gesagt, es werde vermutlich über Fella Torte geschehen.«
»Monsieur, selbst wenn der Kaiser noch so überragende Fähigkeiten besitzt«, sagte der Vizekönig, »wie soll er von Paris aus erraten, welchen Weg Erzherzog Johann nehmen wird?«
»Verzeihen Sie, dass ich insistiere, aber diese Karte zeigt uns den Grund.«
»Wie soll das möglich sein?«
»Wollte der Erzherzog auf direktem Weg nach Udine marschieren, müsste er den Isonzo und La Torre unter dem Gewehrfeuer unserer Soldaten überqueren. Wenn er stattdessen dem Isonzo folgt, gelangt er auf eigenem Territorium zu zwei Brücken, die er sorglos passieren kann, und dann geht es durch die Berge zum Pontebba hinauf und von dort in das Glaristal, die Bergkette entlang nach Süden bis zu Ihrer ersten Ortschaft namens Chiusaforte, die er ebenso einnimmt wie Orpi und Osoppo, um ohne weitere Störungen nach Udine zu marschieren.«
Der Prinz sah Lamarque fragend an.
»So würde ich handeln, wenn ich an der Stelle des Erzherzogs Johann wäre«, sagte Lamarque.
»Hoheit«, sagte René, »ich habe einen überaus gewandten Mann in meinem Dienst, einen früheren Banditen, dem ich das Leben gerettet habe. Wenn Eure Hoheit es wünschen, könnte ich ihn als Späher aussenden.«
»Aber er könnte gefasst und gehängt werden«, sagte der Prinz.
»Meiner Treu«, sagte René, »so stand es um ihn, als ich das Seil abschnitt, und wenn er früher oder später am Galgen enden muss, was macht es dann für einen Unterschied, ob heute oder morgen? Aber ich vertraue darauf, dass er mit heiler Haut zu uns zurückkommen wird.«
»Schicken Sie ihn.«
»Ich werde ihm ein gutes Pferd mitgeben. Sein Auftrag: den Chiarzo auf der Höhe von Tolmezzo überqueren, denn dort müsste sich der Gegner aufhalten, der meiner Ansicht nach früher angreifen wird, als wir erwarten.«
»Und Geld?«, rief Eugène, als René sich anschickte, den Raum zu verlassen.
»Geld bekommt er nur von mir«, erwiderte René. »Machen Sie sich keine Gedanken.«
Und er eilte hinaus.
Eugène sah Lamarque an und begann zu lachen. »Jetzt sind wir allein«, sagte er, »und jetzt müssen Sie mir sagen, wer Ihr famoser Monsieur René ist. Wären wir im Mittelalter, wäre ich geneigt, ihn für den Patensohn einer Fee zu halten.«
»Oder für den Bastard eines Zauberers. Er ist so schön wie Renaud de Montauban. Er kennt keine Furcht und sucht in jedem Gefecht den Tod, ohne dass es ihm je gelungen wäre, und spricht von sich selbst nur, wenn man ihn dazu nötigt, was bei unseren jungen Leuten nicht die Regel ist. Es wird behauptet, er habe Nelson in der Schlacht von Trafalgar erschossen. Und wie ich bereits sagte, hat er Hudson Lowe dazu gebracht, sich zu ergeben, als er mit seinen fünfzig Männern die Bresche stürmte. Als Korsar hat er Wunder der Tollkühnheit vollbracht, und in Indien hat er wie ein thebanischer Herkules wahre Fabelungeheuer erlegt.«
»Aber wie kommt es«, fragte Eugène, »dass er nach all diesen Taten keine einzige Belohnung erhalten hat?«
»Das weiß ich nicht. Offenbar ist zwischen ihm und dem Kaiser irgendetwas vorgefallen. Es heißt, er habe mit Cadoudal konspiriert und sei von Fouché gerettet worden, der ihn ins Herz geschlossen hatte; so viel wenigstens habe ich König Murat sagen hören, der ihn gern in seine Dienste genommen hätte, nachdem er Gelegenheit hatte, seinen Mut zu bewundern. Doch er hat sich geweigert, einem anderen als dem Kaiser zu dienen und in einer anderen als der französischen Armee zu dienen, woraufhin König Murat ihn seinem Schwager das englische Banner überbringen ließ, das er auf Capri erobert hatte, sowie die Kunde von dem Sieg über jenen Gegner, den er am liebsten besiegt: England.«
»Und der Kaiser, der so gütig ist, der Mut und Tapferkeit so hoch schätzt, hat ihm nichts verliehen, weder für die Nachricht noch für seinen Anteil an diesem Kampf?«
»Nein; jedenfalls gibt es kein äußeres Anzeichen irgendeines Gunstbeweises. Er trägt die Uniform eines Schwadronschefs der Jäger, doch er hat immer Phantasieuniformen getragen; in Neapel hatte er fünfzig Mann unter sich, die für ihn kämpften, und was er mit diesen fünfzig Mann zuwege gebracht hat, ist unerhört.
Er muss tatsächlich unter einem Glücksstern stehen, wenn er ständig den Tod sucht und noch nie einen Kratzer davongetragen hat. Wir können uns glücklich schätzen, dass unsere Damen nicht wie in den Tagen Ludwigs XIV. der Armee folgen: Ein Romanheld wie dieser junge Mann würde ihnen allen den Kopf verdrehen.«
»Dahinter steckt mit Sicherheit irgendeine Frauengeschichte«, sagte Eugène.
»Wahrscheinlich«, sagte der General.
Die Tür wurde geöffnet, und der Türsteher fragte, ob es René erlaubt sei einzutreten.
»Sehen Sie«, sagte Eugène, »solche Feinheiten verraten auf eine Meile gegen den Wind den Mann von Welt!«
»Er ist unterwegs«, sagte René, als er eintrat, »und wir werden morgen Abend oder spätestens übermorgen mehr wissen, oder mein Bote wird nicht mehr am Leben sein.«
In diesem Augenblick meldete ein Türsteher General Sahuc an.
Der General kam mit einer handschriftlichen Notiz herein. »Hoheit«, sagte er, »ich komme vom Generalstab. Hier habe ich die Stellungen unserer Soldaten im Umkreis von Udine und die Namen der Generäle.«
»Lesen Sie vor«, sagte der Prinz und beugte sich zusammen mit General Lamarque und René über die Karte.
»Die erste Infanteriedivision unter dem Kommando von General Seran befindet sich in Palmanova, Cividale und Udine.
Die zweite unter dem Kommando von General Bouvier befindet sich in Artegna, Gemona, Ospedaletto, Venzone, San Daniele, Maiano und Osoppo; ihre Detachements reichen im Fellatal bis nach Pontebba auf dem Weg nach Tarvisio.
Die dritte unter dem Kommando von General Grenier befindet sich im Rücken der zwei ersten in Pordenone, Sacile und Conegliano.
General Lamarque, der mit der vierten Division seinen Standort zugeteilt bekommen wird, erwartet die Befehle Eurer Hoheit.«
Die zwei Generäle salutierten voreinander, und General Sahuc ergriff wieder das Wort: »Die fünfte unter dem Kommando von General Barbou befindet sich in Treviso, Cittadella und Bassano. Die sechste Division, die zur Gänze aus Italienern besteht, befindet sich unter dem Kommando General Serterolis zur Hälfte in Padua und zur Hälfte in Este sowie an einzelnen Stellen nahe diesen zwei Städten.
Die siebte Division, ebenfalls rein italienisch, sammelt sich unter General Fontanellis Kommando im Lager von Montechiaro; ein Teil dieser Division ist noch auf dem Weg vom Königreich Neapel zu uns.
Zwei Dragonerdivisionen unter dem Kommando der Generäle Pally und Grouchy sind über Villa Franca, Rovigo, Isola della Scala, Roverbella, Castellaro, Sanguinetto, Mantua und Ferrara verstreut.
Unser ganzer Artilleriepark befindet sich in Verona, aber wir haben nicht genug Pferde, um ihn herzuholen.
Die Grenadiere der italienischen königlichen Garde sind in Padua stationiert, die Karabiniere, die Jäger, die Dragoner, die Elitegendarmen, die berittene Artillerie und der Armeetrain der Garde befinden sich in Mailand und Umgebung.
Meine Männer und ich«, fuhr Sahuc fort und salutierte vor dem Prinzen, »befinden uns in Udine, bereit, unser Leben für Eure Hoheit zu geben; unsere erste Brigade bildet am Torre eine Linie von Nogaretto bis Vilesi, die zweite Brigade ist auf Ceneda, Pordenone, Conegliano, Vivenve und Padua verteilt.«
Nachdem beide Generäle auf der Karte verifiziert hatten, was General Sahuc vorgetragen hatte, sahen sie einander beunruhigt an: Die dreißigbis fünfunddreißigtausend Mann, über die Prinz Eugène verfügen konnte, waren von Tirol bis zur Lagune von Grado verstreut, von Piave bis zum La Torre.
Kuriere wurden zu allen Standquartieren abgesandt, um den Generälen Briefe des Prinzen zu bringen, in denen er sie aufforderte, Tag und Nacht auf der Hut zu sein, da man mit einem Angriff rechnete, dass man jedoch den ersten Kanonenschuss abwarten müsse, bevor man sich in Bewegung setzte, da man noch nicht wusste, aus welcher Richtung der Angriff erfolgen würde.
Die Stunde des Abendessens nahte. Der Vizekönig behielt General Lamarque und General Sahuc zum Essen da, doch das änderte nichts daran, dass René der Kavalier der Prinzessin blieb. Die Damen hatten sich doppelt und dreifach herausgeputzt, wenn man so sagen darf.
Waren der Anlass das Konzert und der Ball, die den Abend beschließen sollten? Oder war es der geheimnisvolle schöne Fremde?
Alles, was General Lamarque über ihn erzählt hatte und noch erzählte, steigerte nur die Neugier der Damen. Die Vorstellung, dass ein Liebesleid der Grund für die Blässe und die Melancholie seiner Miene war, rührte gewaltig an ihr Herz.
Was sonst sollte einem Mann einen so hartnäckigen Todeswunsch einflößen als eine unglückliche Liebe, vor allem wenn der junge Mann so schön, so tapfer und so reich war?
Die Hofetikette ist bekannt: Die Prinzessinnen lassen die Tänzer benachrichtigen, denen sie die Ehre erweisen wollen, mit ihnen zu tanzen. Die Prinzessin gab René zu verstehen, ihr Mann habe ihr erlaubt, ihm diese Gunst zu erweisen, doch mit ungeheucheltem Bedauern erwiderte René, dass er vor langer Zeit gelobt habe, nie mehr zu tanzen, er ihr jedoch für alles andere zur Verfügung stehe.
»Für alles andere? Was verstehen Sie darunter?«
»Prinzessin«, erwiderte René lächelnd, »darunter verstehe ich, dass ich zuerst bereit bin, die anderen zum Tanzen zu bringen, und danach, diejenigen der Damen zu begleiten, die uns sicherlich das Vergnügen bereiten werden zu singen.«
»Begleiten«, sagte die Prinzessin, »auf welchem Instrument?«
»Auf jedem, Madame.«
»Sind Sie etwa Musiker?«
»Während meiner drei Jahre Gefangenschaft war die Musik meine einzige Zerstreuung.«
»Und Dichter?«
»Wer wäre das nicht auf seine bescheidene Weise?«
»Ich werde Sie nachher an alles erinnern, was Sie soeben sagten.«
»Sie werden befehlen, Madame, und ich werde gehorchen.«
Das Gespräch wurde allgemein. René, der nie zu glänzen versuchte, steuerte nur hin und wieder ein paar Worte bei.
Den Damen wurde angekündigt, dass sie am nächsten Morgen nach Venedig aufzubrechen hätten, angeführt von der Prinzessin, da sie zu keinem Armeekorps zählten.
Die Prinzessin zeigte sich rebellisch. »Warum sollen wir uns von der Armee entfernen?«, fragte sie. »Sind wir in Ihren Reihen nicht ebenso sicher wie in Venedig?«
»Nicht ganz und gar«, erwiderte René, »und deshalb würde ich Eure Kaiserliche Hoheit gerne bitten, sich den Anordnungen des Prinzen nicht zu widersetzen.«
Diese Worte sagte er in leisem, doch so ernstem Ton, dass sie ihren Eindruck auf die Prinzessin nicht verfehlten.
»Besteht denn Grund zur Besorgnis?«, fragte die Prinzessin René beunruhigt.
»Die Truppen sind ungünstig verteilt«, sagte René. »Und sollte Erzherzog Johann kein völliger Anfänger in der Kriegskunst sein, dann müsste er uns getrennt angreifen und die ersten Gefechte gewinnen.«
»Haben Sie das Eugène gesagt?«, fragte die Prinzessin.
Doch René verneigte sich leicht und antwortete: »Madame, es steht mir nicht zu, solche Voraussagen zu treffen.«
»Sie sind also auch der Ansicht, dass wir nach Venedig abreisen sollten?«
»Ich für meine Person würde Eure Hoheit unbedingt darum bitten, und da meine Person und meine Stimme wenig zu bedeuten haben, bitte ich Euch, Eurem erhabenen Gemahl zu gehorchen.«
In einem Schweigen, das verriet, welche Wirkung die Aufforderung an die Damen gehabt hatte, am nächsten Tag nach Venedig aufzubrechen, verließ man den Tisch.
Eine Zeit lang lauschten die Gäste noch zerstreut der Musik, die während des Abendessens gespielt worden war; dann wurden die Musiker zu ihrem eigenen Abendessen geschickt.
Schönstes Aprilwetter herrschte, und man beschloss, auf der Terrasse und in den herrlichen Gärten des Schlosses von Udine spazieren zu gehen.
Die Aussicht war bezaubernd: In dem klaren Abendlicht sah man auf der Ebene östlich unterhalb des Schlosses wie große Schlangen, deren Schuppen die untergehende Sonne zurückwarfen, den Isonozo und den La Torre; der La Torre floss am Fuß der Stadtbefestigungen vorbei, und der Isonzo beschrieb eine den Bergen von Görz geschuldete Krümmung; im Norden und im Nordwesten erhoben sich die Tiroler Berge, deren Gipfel, wenn sie im Nebel verschwanden, zu am Himmel festgefrorenen Wolken wurden, und im Westen erblickte man den Tagliamento, der den weiten Bogen seiner Wasser beschrieb, die im Schatten wie polierter Stahl schimmerten, und hinter dem Fluss die zahllosen Sturzbäche, von denen die Ebene durchzogen ist und die silberne Blitze aussandten, wenn ein Sonnenstrahl durch die Berge zu ihnen fand und ihre wirbelnden Wasser berührte.
Die Luft war so mild, so rein und so dufterfüllt, dass man den Garten erst verließ, als es dunkel war, sofern es in Italien nachts überhaupt dunkel werden kann.
Im Salon war Licht al giorno entzündet worden, und bald erfüllte ihn der Duft der Damen, so dass es schien, als hätten sie ihn nur verlassen, um das Parfum der Blumen zu pflücken und in den Salon zu bringen.
Die Fenster waren geschlossen, doch das Klavier war geöffnet.
Die Prinzessin glitt mit den Fingern über die Tasten, denen sie einen Akkord entlockte, der wie ein Zauber Stille bewirkte.
Alle drängten sich um das Klavier.
»Meine Damen«, sagte die Prinzessin, »Monsieur René genießt den Ruf eines herausragenden Musikers, und er hat mir beim Abendessen zugesagt, alles auszuführen, was ich ihm befehlen werde … Ich befehle ihm, sich an das Klavier zu begeben und uns ein Lied eigener Komposition und mit selbstgedichteten Versen vorzusingen.«
Zum Erstaunen aller ließ der junge Offizier sich keineswegs lange bitten, wie Virtuosen es zu tun pflegen, sondern ging zum Klavier, setzte sich ohne Ziererei auf den Hocker und legte die Hände auf die Tasten.
Die vollendete Schönheit dieser Hände mit den rosigen Nägeln und den bleichen, schmalen Fingern wie die einer Frau kam nun zur Geltung. Am rechten Zeigefinger trug der junge Mann einen auffallend schönen Saphir.
Noch nie wurde der Triumph eines Virtuosen mit größerer Neugier und tieferer Stille erwartet.
Und in dieser Stille erhob sich mit einem Mal eine klare, melodiöse und doch männliche Stimme. Sie sang mit einer verhaltenen Melancholie, die sich jedem Beschreibungsversuch entzieht, die folgenden Verse, die wie eine jener Melodien klingen, wie sie zwischenzeitlich durch Saint-Hubert in Mode gebracht wurden, seinerzeit jedoch völlig unbekannt waren.
Der Berg ruht vor dem dunklen Firmament;
Die Täler liegen stumm, vom Tau getränkt;
Der Staub erstirbt auf dem entflammten Weg.
Das Blatt hängt still, kein Wind sich regt.
Wart noch ein Weilchen, bis auch du bald schläfst!
Die Wirkung dieser klagenden Worte zur Begleitung melancholischer Klaviertöne, in denen man das letzte Rascheln der Blätter und den letzten Hauch des Windes zu hören vermeinte, bevor sie in einem Aufschrei des Instruments endeten, der wie der Schrei einer brechenden menschlichen Seele klang, lässt sich nicht mit Worten schildern.
Als der letzte Nachhall der Stimme und des Klaviers verstummt war, dauerte es mehrere Sekunden, bis die Zuhörer sich wieder zu regen wagten und in Beifall und Bravorufe ausbrachen.
René erhob sich und griff nach seinem Kalpak.
»Oh«, sagte die Prinzessin fragend, »wollen Sie schon gehen?«
»Hoheit«, erwiderte René, »ich habe Ihnen versprochen, zu tun, was Sie mir befehlen. Sie befahlen mir zu singen, eigene Verse zu eigener Musik, und ich habe Ihnen gehorcht, doch gestatten Sie mir, Ihnen etwas zu sagen: Ein Soldat, der singt, der andere beim Singen begleitet oder auf einem Instrument brilliert, um beklatscht zu werden, war in meinen Augen immer eine lächerliche Figur, aber ein Mann, ob Soldat oder Zivilist, der einer Frau etwas abschlägt, vor allem, wenn diese Frau eine Prinzessin ist – so jemand ist ein Grobian und ein ungezogener Lümmel; indem ich Eurer Hoheit gehorchte, habe ich mir keine Lächerlichkeit zuschulden kommen lassen, doch ich möchte mich nicht vor mir selbst lächerlich machen, indem ich weiterspiele. Wenn ich singe oder musiziere, tue ich es zu meinen Vergnügen und um meinen Gedanken zu entfliehen; begegnen Sie meiner Schwäche, denn Schwäche ist es, mit Nachsicht, und erlauben Sie mir, mich zurückzuziehen.«
Diese Worte sprach René mit erstickter Stimme und mit Tränen in den Augen, als drückten die schmerzlichsten Erinnerungen ihm das Herz ab.
Die Prinzessin war zutiefst ergriffen und trat beiseite, um dem jungen Offizier Platz zu machen; die Gäste ahmten ihr Beispiel nach, und der junge Offizier entfernte sich durch die Lücke, zu der die vornehme Welt zurücktrat, während sie sich vor ihm verneigte.
ANHANG
Nachwort des Herausgebers
Dass man bisweilen findet, ohne gesucht zu haben, kann daran liegen, dass man lange gesucht hat, ohne zu finden. Gegen Ende der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts war ich mit Recherchen in den Archives de la Seine beschäftigt, deren Gegenstand mir entfallen ist (denn so gründlich ich bin, wenn es um Daten zu Leben und Werk Alexandre Dumas’ geht, so nachlässig verfahre ich mit solchen meines eigenen Erdenwandels). Dieses Archiv war im Hôtel Le Maignan untergebracht, einem steinernen Ungetüm, das überall undicht war und auf Spitzhacke und Abrissbirne zu warten schien. Der Lesesaal war finster und selbst bei strahlendem Sommerwetter lichtarm; hastig blätterte man in alphabetisch geordneten, schmutzstarrenden und eselsohrigen Karteikärtchen, die sich auf das frühere Standesamtsregister bezogen, das nach dem Rathausbrand unter der Kommune rekonstruiert worden war. Es war, als flanierte man auf einem riesigen Friedhof.
Was mag ich gesucht haben? Etwas Bescheidenes vermutlich, vielleicht die Geburtsurkunde eines unehelichen Kindes Alexandre Dumas’ oder Unterlagen, die mir helfen sollten, die Identität einer seiner Mätressen zu bestimmen, einen seiner Verleger herauszufinden... Wahrscheinlich hatte ich die Akten bestellt und wartete. In den Archives de la Seine verbringt man mehr Zeit mit Warten als mit Recherchieren. Vor lauter Langeweile öffnete ich aufs Geratewohl eine Schublade und blätterte in ihren Karteikärtchen. War es Zufall, dass ich unter dem Buchstaben D folgende Eintragung zu lesen bekam: »Alexandre Dumas (Vater). Joséphines Schulden, L.a.s., 2 p.«?
Schnell war der Bestellzettel für das Geheimnis mit der Signatur 8 AZ 282 ausgefüllt und abgegeben, doch es erforderte noch einiges an Geduld, bis ich die zwei hellblauen Blatt karierten Papiers in Händen hielt.
Ich transkribiere das Dokument, wie es mir damals vorlag:
Joséphines Schulden
In Widerspruch zu der in der gestrigen Ausgabe des Pays eingerückten neuerlichen Notiz, abgedruckt im Moniteur universel, erhält unser Mitarbeiter und Freund Alexandre Dumas nicht nur seine Behauptungen aufrecht, sondern fügt zur Erbauung der Neugierigen den bereits von ihm erbrachten Beweisen neue Beweise hinzu.
Nicht er, sondern Bourrienne, der als Einziger die Rechnungen des Ersten Konsuls und Joséphines bezeugen kann, spricht hier:
»Man kann sich den Zorn und die Übellaunigkeit des Ersten Konsuls denken, denn obwohl ich ihm die Hälfte des Betrags gestanden hatte, argwöhnte er zu Recht, dass seine Frau etwas vor ihm zu verbergen hatte; dennoch sagte er zu mir: ›Nun denn! Nehmen Sie sechshunderttausend Francs; begleichen Sie die Schulden mit diesem Geld, und dass ich nie wieder davon höre. Ich ermächtige Sie, den Händlern damit zu drohen, dass sie gar nichts bekommen, wenn sie nicht auf ihre unermesslichen Gewinne verzichten; sie müssen lernen, nicht so leichtfertig auf Kredit ihre Waren zu liefern.‹«
An dieser Stelle hätte ich die überragende Macht desjenigen herausstellen können, der sich über die Verfassung des Jahres VIII hinweggesetzt und den 18. Brumaire inszeniert hatte und der keine Skrupel gehabt haben dürfte, sich über die Handelskammer hinwegzusetzen, indem er sich weigerte, die Schulden seiner Frau zu bezahlen, oder sie nur zur Hälfte bezahlte. Doch es scheint, als hätten damals sechshunderttausend Francs ausgereicht, um Schulden von zwölfhunderttausend Francs zu begleichen, denn Bourrienne sagt als Nächstes: »Nach lebhaften Vorhaltungen war es mir vergönnt, mit den sechshunderttausend Francs alles zu regeln«, auch wenn er nicht viel später hinzufügen muss: »Madame Bonaparte verfiel jedoch bald darauf in die gleiche Maßlosigkeit. Diese unbegreifliche Verschwendungssucht war die fast alleinige Ursache all ihrer Kümmernisse; ihre unbedachte Vergeudung stiftete ständige Unordnung in ihrem Haushalt, bis sie, wie es heißt, nach Bonapartes zweiter Ehe ordentlicher wurde.«
Man wird Bourrienne schwerlich der Böswilligkeit gegenüber Joséphine zeihen können, denn im Gegenteil war er bis zuletzt ihr bester Freund. Keine Gelegenheit, Lobreden auf Joséphine anzustimmen, lässt er ungenutzt verstreichen, kein einziges Mal erwähnt er sie, ohne auf seinen Dank für all die Wohltaten zu sprechen zu kommen, mit denen sie ihn überhäuft hat.
Doch lassen wir den Mann zu Worte kommen, der sich am besten mit Joséphines Schulden auskennen sollte, denn er beglich sie.
»Joséphine«, sagt der Kaiser, »neigte im Übermaß zum Luxus, zur Unordnung, zum gedankenlosen Geldausgeben, wie es den Kreolen angeboren ist. Unmöglich, ihrer Schulden jemals Herr zu werden, denn sie machte dauernd neue, und wenn sie ihre Schulden endlich bezahlen musste, kam es regelmäßig zu großem Streit. Oft habe ich erlebt, dass sie ihren Händlern ausrichten ließ, sie sollten nur die Hälfte des geschuldeten Betrags geltend machen. Bis nach Elba wurde ich mit solchen Erinnerungen an Joséphine aus allen Teilen Italiens überhäuft.« (Seite 400) Mémorial de Ste-Hélène, Bd. 3.
Schließen wir mit dem Vergleich, den Napoleon zwischen seinen zwei Ehefrauen anstellt:
»Zu keiner Zeit waren Haltung und Betragen Ersterer von anderer als erfreulicher und bezaubernder Art; niemals hätte sie sich anmerken lassen oder hätte man ihr ansehen können, dass dies irgendeine Beschwerlichkeit für sie bedeutete; alles, was die Kunst im Dienst der Anziehungskraft vermag, wurde von ihr angewendet, und mit so viel Geschick, dass nicht das Geringste davon zu merken war. Die andere hingegen ahnte nicht einmal, dass sich mit solch unschuldigen Kunstgriffen etwas erreichen ließ.
Die eine hielt es nie mit der Wahrheit, und ihr erster Impuls war stets das Leugnen; der anderen war jede Täuschung unbekannt und jede Unaufrichtigkeit fremd. Die Erste bat ihren Gatten nie um Geld, war aber überall verschuldet; die zweite zögerte nicht, um Geld zu bitten, wenn sie keines mehr hatte, was aber höchst selten vorkam; sie hätte sich niemals erlaubt, etwas zu erstehen, ohne es sofort zu bezahlen. Im Übrigen waren beide gutherzig, sanftmütig und ihrem Ehemann sehr zugetan. Doch man wird sie bereits erraten haben, und wer sie gekannt hat, wird die beiden Kaiserinnen wiedererkannt haben.« (S. 407) Mémorial de Ste-Hélène, Bd. 3.
Dies, mein lieber Verleger, hätte ich Monsieur Henry d’Escamps erwidern können, doch ich dachte mir, es sei nicht erforderlich, Le Pays um Gotteslohn einen Artikel zu schenken, der nicht gänzlich uninteressant ist.
Ich habe mich damit begnügt, ihm folgenden Brief zu schreiben:
»An den Herausgeber der Zeitung Le Pays.
Monsieur,
Ihre Antwort ist keine. Ich sprach von den zwölfhunderttausend Francs Schulden, die Joséphine von 1800 bis 1802 angehäuft hat, das heißt innerhalb eines Jahres. Nicht erwähnt habe ich ihre Schulden aus den Jahren 1804 bis 1809. Die Aufstellung dieser fünf Jahre überlasse ich den Herren Ballhouey und de Lavalette und Ihnen, da ich nicht daran zweifle, dass es Ihnen dreien gelingen wird, mir eine ebenso genaue Abrechnung zu erstellen, wie es Monsieur Magne mit den vier veruntreuten Milliarden gelungen ist, die sieben oder acht Jahre lang dazu benutzt wurden, das Budget auszugleichen.
Seien Sie meiner Hochachtung versichert
Alexandre Dumas.«
Es handelte sich zweifellos um Handschrift und Unterschrift Alexandre Dumas’ des Älteren – und nicht des Jüngeren oder General Matthieu Dumas’ oder irgendeines anderen der unzähligen Dumas.
Ich hatte gefunden, jetzt musste ich suchen.
Dumas hatte offenbar Joséphine unter der Knute ihrer Gläubiger dargestellt, in einem Text, der im Moniteur universel erschienen war, und hatte mit dieser Veröffentlichung Monsieur Henry d’Escamps von Le Pays in höchste Empörung versetzt. Dumas antwortete seinem Kritiker in einem offenen Brief, in dem er die Quellen angab, die er verwendet hatte – so viel war klar. Der Text, auf den Dumas sich bezog, war mir unbekannt; er war auch, wie ich mich vergewissern konnte, in keiner Bibliographie seiner Werke erwähnt (weder in Frank W. Reeds Bibliography of Dumas Père noch in Alexandre Dumas Père. A Bibliography of Works Published in French, 1825-1900 von Douglas Munro). Selbstverständlich war der Brief – wie fast immer bei Dumas – undatiert.
Ich wüsste nicht mehr im Einzelnen anzugeben, wie ich mich zum Ziel durchgekämpft habe. Ergebnislos suchte ich nach den Lebensdaten des Henry d’Escamps; vermutlich wusste ich, dass Pierre Magne von 1867 bis 1870 Finanzminister war; fruchtlos förderte ich im zweiten Band der Erinnerungen des Grafen Lavalette[11] auf Seite 376 eine Broschüre aus dem Jahr 1843 zutage, die lautete: Brief vom 16. Mai 1827 aus der Feder Monsieur Ballhoueys, des früheren Finanzsekretärs Ihrer Majestät Kaiserin Joséphine. Vermutlich war mir klar, dass der Moniteur universel nicht länger das offizielle Organ der Regierung des Zweiten Kaiserreichs gewesen sein konnte, wenn er etwas veröffentlichte, was Joséphines posthumem Ansehen abträglich war – was heißt, dass die Veröffentlichung nach dem 1. Januar 1869 erfolgt sein musste, dem Datum, an dem das Journal officiel als neues Regierungsblatt erstmals erschienen war.
Wie auch immer: Eines Tages saß ich unter der Kuppel des Zeitschriftensaals der Bibliothèque Nationale in der Rue de Richelieu in einem der Verschläge, die wie Beichtstühle aussehen, entrollte den Mikrofilm des Moniteur universel aus dem ersten Trimester 1869 und entdeckte... nicht etwa den Brief, den ich ausgegraben hatte (er ist nie erschienen, weder im Moniteur noch in Le Pays), und auch keinen Zeitungsartikel von Dumas über Joséphines Schulden, sondern einen Roman in Fortsetzungen, einen sehr umfangreichen, aber leider unvollendeten Roman: einhundertachtzehn Kapitel, in relativ unregelmäßiger Reihenfolge zwischen dem 1. Januar und dem 30. Oktober 1869 erschienen – fast ein ganzes Jahr lang! Ich war so glücklich, als hätte ich das sagenhafte Eldorado entdeckt. Ich hatte den letzten Roman Alexandre Dumas’ vor Augen, den Krankheit und Tod beendet hatten, an dem die unermüdliche Feder des Autors bis zuletzt geschrieben hatte!
Ich schlachtete mein Sparschwein und erhielt einige Monate später die Fotokopie der Fortsetzungen in Form eines dicken Papierstapels, auf den ich mich stürzte, um seinen Inhalt zu verschlingen. Damals war noch nicht abzusehen, dass Dumas eines Tages in das Panthéon aufgenommen werden würde.[12] Dass das Buch erscheinen konnte, verdanke ich Jean-Pierre Sicre, der sich mit allen Kräften dafür eingesetzt hat. Habent sua fata libelli (ein Text kann nur vermitteln, was der Leser auffasst), wie Dumas das Wort des Terentianus Maurus zu zitieren pflegte.
Der rekonstruierte Roman
Einhundertzwanzig Jahre vor der Wiederentdeckung der Fortsetzungen im Moniteur saß Alexandre Dumas an seinem Schreibtisch in der Wohnung am Boulevard Malesherbes oder in seinem großen niedrigen Bett und schrieb auf das hellblaue Papier im Format von 21 x 27 Zentimetern den ersten Satz seines Romans.
Im Vorjahr (1867) war in dem Periodikum La Petite Presse Dumas’ Roman Les Blancs et les Bleus in vier separaten Teilen als Fortsetzungsroman abgedruckt worden; dieses Panorama der französischen Geschichte zwischen Dezember 1793 und August 1799, also von der Terreur bis zu Bonapartes Rückkehr aus Ägypten, charakterisierte der Verfasser mit den Worten: »Dieses Buch ist alles andere als ein Roman und manchen Lesern wahrscheinlich nicht romanhaft genug; wir sagten schon, dass es verfasst wurde, um mit der Geschichte Schritt zu halten«[13], und an anderer Stelle sagt er: »Es lässt sich nicht leugnen, dass wir in diesem Werk eher romanhafter Historiker als historischer Romanschriftsteller sind. Wir glauben, unsere Phantasie oft genug bewiesen und uns das Recht erworben zu haben, historische Wahrhaftigkeit zu beweisen, ohne indessen unsere Erzählung der poetischen Einfälle zu entkleiden, welche die Lektüre leichter und angenehmer machen, als es die eines schmucklosen Geschichtswerks wäre.«[14]
Im November 1866 hatte Dumas in Vorbereitung seiner historischen Arbeit in ziemlich hoheitsvollem Ton folgenden Brief an Napoleon III., den kleinen Neffen des großen Korsen, geschrieben:
Erlauchter Kollege,
als Sie sich daranmachten, Ihre Lebensbeschreibung des Siegers über die Gallier[15] zu verfassen, war es den Bibliotheken ein Anliegen, Ihnen die Dokumente in ihrem Besitz zur Verfügung zu stellen.
Das Ergebnis war ein anderen Arbeiten überlegenes Werk, indem es die größtmögliche Anzahl historischer Dokumente umfasst.
Da ich gegenwärtig mit der Geschichte eines zweiten Cäsars namens Napoleon Bonaparte beschäftigt bin, benötige ich die Dokumente, die sein Auftreten im Weltgeschehen betreffen.
Kurzum, ich hätte gern Kenntnis von allen Schriften, die der 13. Vendémiaire[16] gezeitigt hat.
Ich bat die Bibliotheken darum, doch sie wurden mir verweigert.
Es bleibt mir daher nichts anderes übrig, als mich an Sie zu werden, mein erlauchter Kollege, dem niemand etwas abschlägt, und Sie zu bitten, in Ihrem Namen diese Schriften von den Bibliotheken zu erlangen und sie mir zur Verfügung zu stellen.
Sollte meine Bitte Ihr Gehör finden, würden Sie mir einen Dienst erwiesen haben, den ich nie vergessen werde.
Ich habe die Ehre, erlauchter Kollege, mich mit größter Hochachtung zu empfehlen als Ihr bescheidener und überaus dankbarer Kollege
ALEX. DUMAS.[17]
Allem Anschein nach wurde die Bitte Dumas’ erfüllt; Victor Duruy, der Unterrichtsminister, ermöglichte ihm den Zugang zu den gewünschten Quellen, und Dumas konnte Napoleon Bonaparte auf der Weltbühne auftreten lassen, den Mann, der »den ersten Teil des 19. Jahrhunderts mit der Fackel seines Ruhms erleuchtete«.[18]
Bei aufmerksamer Lektüre des Romans Les Blancs et les Bleus kann man einen flüchtigen Hinweis auf Hector de Sainte-Hermine finden, wenn sein älterer Bruder Charles dem Vendéegeneral Cadoudal erklärt, dass im Fall seiner Hinrichtung sein jüngerer Bruder ebenso in seine Fußstapfen treten werde, wie er in die seines füsilierten älteren Bruders getreten war und dieser in die des guillotinierten Vaters.
Unterdessen hatte Dumas im Februar 1868 sein letztes journalistisches Abenteuer mit dem Periodikum Le Dartagnan unternommen, dessen letzte Ausgabe Anfang Juli erschien; im Juli reiste er nach Le Havre, wo er neben seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen mit Unterstützung seines Mitarbeiters Alphonse Esquiros an dem sechzehn Jahre zuvor begonnenen Roman Création et Rédemption weiterschrieb. »Man darf ihm nicht gram sein, dass er vor vier Uhr nachmittags niemanden einlässt, denn bis zu dieser Stunde muss er arbeiten«, schrieb sein Sekretär Georges d’Orgeval.
Ich fasse im Folgenden zusammen, was meine Recherchen über ein gutes Dutzend Jahre hinweg zur Entstehung des verschollenen Hector de Sainte-Hermine ergeben haben.
In Le Havre hat Dumas vermutlich im Spätsommer 1868 einen Brief an Paul Dalloz, den Herausgeber des Moniteur universel, diktiert; Dalloz druckte zu jener Zeit eine Reihe von »Plaudereien über das Meer« von Dumas ab. In diesem Brief entwirft Dumas ein Projekt von kolossalen Ausmaßen, nämlich nichts Geringeres als die Fortsetzung der Geschichte Napoleons I. von seinem Aufstieg über seinen Triumph bis zu seinem Sturz.
Anbei, lieber Freund, was ich Ihnen vorschlage: ein Roman in vier oder sechs Bänden mit dem Titel Hector de Sainte-Hermine.
Hector de Sainte-Hermine ist der letzte Spross einer Adelsfamilie aus dem Jura (Besançon). Sein Vater, der Graf von Sainte-Hermine, wurde guillotiniert und hat seinen ältesten Sohn Léon de Sainte-Hermine schwören lassen, wie er für die royalistische Sache zu sterben; Léon wurde in der Festung von Harnem [sic] füsiliert und hat seinen Bruder Charles schwören lassen, wie er für die Sache der Bourbonen zu sterben; u. Charles de Sainte-Hermine wurde als Anführer der Compagnons de Jéhu in Bourg-en-Bresse guillotiniert, wobei er seinem jüngsten Bruder Hector de Sainte-Hermine das Versprechen abnahm, dem Beispiel des Vaters und der zwei älteren Brüder zu folgen.
Daraufhin hat Hector sich den Compagnons de Jéhu angeschlossen, hat den Bourbonen Treue geschworen u. Cadoudal Gehorsam gelobt, und obwohl er bis über die Ohren in eine junge, von Joséphine protegierte Kreolin verliebt ist u. von ihr geliebt wird, hat er nie gewagt, ihr seine Liebe zu erklären, weil er den Bourbonen u. Cadoudal sein Wort verpfändet hat.
Doch als die Vendée befriedet ist, kommt Cadoudal nach Paris u. trifft sich mit Bonaparte, der ihm den Rang eines Obersten oder hunderttausend Francs Pension anbietet.
Cadoudal lehnt ab, erklärt Bonaparte, er wolle nicht in Frankreich bleiben, sondern sich nach England zurückziehen, und als er das Land verlässt, beauftragt er seinen Freund Coster Saint-Victor, allen die Freiheit wiederzugeben, die ihm Treue geschworen hatten.
Erst da kann Hector de Sainte-Hermine, von seinem Wort befreit, Mademoiselle de La Clémencière seine Liebe gestehen, und er hält um ihre Hand an.
Sie wird ihm sofort gewährt; alles wird für die Hochzeit vorbereitet, der Tag ist festgesetzt, der Ehevertrag wird unterzeichnet, als im Moment der Unterzeichnung, als Hector schon die Feder in der Hand hält, ein maskierter Mann erscheint, auf ihn zutritt u. ihm ein Blatt Papier reicht.
Es ist die Ordre, sich unverzüglich in den Wald von Andelys zu begeben, wo seine Freunde von den Compagnons de Jéhu sich sammeln.
Geschehen war Folgendes:
Cadoudal hat sein Versprechen gehalten, aber Fouché, der Bonaparte Angst einjagen will, beauftragt Banden von Fußbrennern, in der Normandie und der Bretagne Bauernhöfe zu überfallen u. sich als Anhänger Cadoudals auszugeben.
Cadoudal erfährt davon, kehrt nach Frankreich zurück, landet an der Klippe von Biville u. bittet einen Bauern um Unterkunft.
Zufällig will eine Bande von Fußbrennern unter Führung eines falschen Cadoudal an diesem Abend den Bauernhof plündern.
Die Fußbrenner ergreifen den Bauern, seine Frau u. Kinder; sie verbrennen dem Bauern die Füße, seine Schreie rufen Cadoudal herbei, der mit einer Pistole in jeder Hand eintritt.
»Wer von euch ist Cadoudal?«, fragt er.
»Das bin ich«, antwortet ein Maskierter.
»Du lügst!«, sagt Cadoudal und pustet ihm das Lebenslicht aus. »Cadoudal bin ich!«
Und weil die andere Seite ihr Versprechen gebrochen hat, erklärt er seinen Leuten, dass er die Kriegshandlungen wiederaufnimmt und dass ihm alle wieder gehorchen müssen wie zuvor.
Diesen Befehl hat Hector erhalten, als er seinen Ehevertrag unterschreiben wollte, und deshalb musste er den Salon verlassen u. mit der Postkutsche nach Andelys aufbrechen.
Der Überfall auf die Eilpost findet statt, Hector wird verwundet und gefangen genommen, in Rouen ins Gefängnis geworfen, wo er den Präfekten kennt, den er zu sich bittet u. dem er sagt, dass er unbedingt den Polizeiminister Fouché sprechen müsse; der Präfekt übernimmt die Verantwortung für den Gefangenen und reist mit ihm nach Paris, wo sie Fouché aufsuchen.
Der junge Mann gesteht u. erbittet als einzige Gnade, dass man ihn füsiliert, ohne dass sein Name bekannt wird. Er war im Begriff, sich mit einer vornehmen Familie zu verbinden, eine Frau zu heiraten, die er abgöttisch liebt, und er will verschwinden, ohne Blut oder Schande über diejenige zu bringen, die seine Frau werden sollte.
Fouché steigt in einen Wagen, fährt zu den Tuilerien, erzählt alles Bonaparte, der nur sagt: »Gewähren Sie ihm die Gnade, um die er bittet, lassen Sie ihn füsilieren.«
Fouché verlangt beharrlich, dass der Gefangene am Leben bleibt. Bonaparte kehrt ihm den Rücken zu u. verlässt das Zimmer.
Fouché begnügt sich damit, den Gefangenen in ein Geheimverlies zu stecken, und will später wieder mit Bonaparte sprechen.
Die Verlobte ist verzweifelt, niemand kann ihr sagen, was mit ihrem Geliebten passiert ist. Die Verschwörung Pichegrus, Cadoudals u. Moreaus nimmt ihren Lauf. Cadoudal wird verhaftet. Pichegru wird verhaftet. Moreau wird verhaftet. Prozess. Zustände in Paris während des Prozesses. Gemütsverfassung des Ersten Konsuls. Hinrichtung Cadoudals. Pichegru erdrosselt sich. Moreau geht ins Exil.
Napoleon lässt sich krönen.
Am Vorabend der Krönung sucht Fouché ihn auf.
»Sire«, sagt er, »ich komme, um zu erfahren, was mit dem Grafen von Sainte-Hermine geschehen soll.«
»Wer soll das sein?«, fragt Bonaparte.
»Das ist der junge Mann, der Sie bat, ihn füsilieren zu lassen, ohne dass sein Name bekannt würde.«
»Nanu, ist er denn nicht füsiliert worden?«, fragt der Kaiser.
»Sire, ich dachte mir, dass der Kaiser am Vorabend seiner Krönung eine Gnade, um die ich ihn bitte, nicht abschlagen wird. Ich bitte ihn um Gnade für den jungen Mann, mit dessen Vater ich zusammen aufgewachsen bin.«
»Dann soll man ihn als einfachen Soldaten in die Armee schicken, wo er sich umbringen lassen kann.«
Hector de Sainte-Hermine wird einfacher Soldat und versucht sich während des langen Kampfs des Kaiserreichs gegen die ganze Welt umbringen zu lassen. Doch in jeder gefahrvollen Situation vollbringt er eine Heldentat, so dass er in alle Ränge befördert wird, für die der Kaiser nicht zustimmen muss, das heißt bis zum Rang des Hauptmanns.
Danach verweigert Napoleon, der den Namen wiedererkannt hat, zweimal die Beförderung. Bei Friedland wird er Zeuge einer Heldentat des armen Soldaten in Ungnade, erkennt ihn nicht, nähert sich ihm u. sagt: »Hauptmann, ich ernenne Sie zum Bataillonschef.«
»Das kann ich nicht annehmen«, erwidert Hector.
»Und warum nicht?«
»Weil Eure Majestät nicht wissen, wer ich bin.«
»Und wer sind Sie?«
»Ich bin der Graf Hector von Sainte-Hermine.«
Napoleon reißt sein Pferd herum u. galoppiert davon.
Zwei weitere Male wird Hector de Sainte-Hermine dem Kaiser als Bataillonschef vorgeschlagen, doch erst bei der Schlacht von Eylau ist er bereit, die Ernennung zu unterzeichnen.
Auf dem Rückzug aus Russland ist es Hector, der sich anerbietet, den Schlitten zu ziehen, der Napoleon nach Frankreich zurückbringt.
Napoleon hat sein Kreuz abgenommen, um es ihm zu geben, als der Muschik zurückweicht und sagt: »Verzeihung, Sire, ich bin der Graf von Sainte-Hermine.«
Napoleon nimmt sein Kreuz zurück.
Der Feldzug von 1814 kommt. Ein Bataillonschef bringt Bonaparte ein Schreiben des Marschalls Victor, als Napoleon auf dem Hügel eigenhändig eine Kanone bedient; eine Bombe fällt vor Napoleons Füßen nieder, der Bataillonschef reißt ihn weg und wirft sich zwischen ihn u. die Bombe.
Die Bombe explodiert. Napoleon ist unverletzt, und obwohl er Hector de Sainte-Hermine erkennt, nimmt er sein Kreuz ab u. reicht es ihm mit den Worten: »Meiner Treu, was bleibt mir anderes übrig!«
Napoleon muss abdanken; die ganze Familie Sainte-Hermine sammelt sich um ihn; Hector ist knapp fünfunddreißig u. hat eine prachtvolle Laufbahn vor sich, wenn er den Bourbonen dienen will, denen seine Vorfahren, sein Vater u. seine Brüder gedient haben. Man ernennt ihn zum Hauptmann der Musketiere, was dem Rang eines Generals gleichkommt – er nimmt an.
Doch während seiner ersten Audienz bei Ludwig XVIII. kränkt er diesen, weil er ihn Majestät nennt. Der König gibt ihm zu verstehen, dass der Begriff Majestät durch den Usurpator geschändet wurde und man deshalb nicht mehr Majestät sagt, sondern sich der dritten Person bedient und »der König« sagt.
Nach dieser Audienz begegnet Hector einem Bettler, dem er ein Geldstück gibt.
»Ach«, sagt der Bettler, »das ist nicht sehr großzügig gegenüber einem alten Gefährten.«
»Gefährten?«
»Oder Kompagnon, wie Sie wollen. Compagnon de Jéhu. Wir waren bei dem denkwürdigen Überfall zusammen, als Sie sich erwischen ließen. Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit einem Almosen abspeisen lasse.«
»Du hast recht, dir steht mehr zu als das. Komm in die Nummer elf in der Rue de Tournon, dort wohne ich.«
»Und wann?«
»Komm gleich, ich werde dich erwarten.«
Hector spornt sein Pferd zum Galopp an, so dass er zehn Minuten vor dem Bettler zu Hause ist.
Er steckt ein Paar Pistolen ein, schickt seinen Diener fort, der Einkäufe machen soll, und wartet.
Der Bettler klingelt. Hector geht zur Tür. Er nimmt den Bettler in sein Arbeitszimmer mit, öffnet einen Sekretär voller Geld und sagt: »Bedien dich.«
Während der Bettler die Hand ausstreckt u. eine Handvoll Geld einstecken will, zieht Hector eine Pistole und schießt ihm eine Kugel in den Kopf – dann schließt er die Tür, geht in den Tuilerienpalast zurück, bittet, den König zu sprechen, und erzählt ihm, was vorgefallen ist.
Er erklärt ihm, dass er Wegelagerer war, um Geld für Cadoudal u. für die Sache des Royalismus zu besorgen.
Ludwig XVIII. ist noch beleidigt wegen der Anrede Majestät; er ist bereit, Hector zu begnadigen, aber nur unter der Bedingung, dass er seine Demission einreicht und Frankreich verlässt.
»Danke, Sire«, antwortet Hector.
Er geht nach Italien, schifft sich in Livorno ein und landet auf Elba. Dort trifft er auf Napoleon.
Er kehrt mit Napoleon von Elba zurück, wird bei der Schlacht von Ligny zum General ernannt, nimmt an der Schlacht von Waterloo teil, kehrt mit Ney nach Paris zurück. Labédoyère wird wie sie zum Tode verurteilt.
Daraufhin wirft sich Mademoiselle de La Clémencière, die zwölf Jahre in einem Kloster ihrer alten Liebe die Treue gewahrt hat, dem König Ludwig XVIII. zu Füßen u. bittet ihn um Gnade für Hector.
Ludwig XVIII. schlägt ihr die Bitte ab u. sagt: »Wenn ich Ihren Geliebten begnadige, muß ich auch Ney und Labédoyère begnadigen, und das kann ich nicht.«
»Wohlan, Sire«, erwidert Mademoiselle de La Clémencière, »dann gewähren Sie mir eine letzte Gunst. Sobald Graf Hector tot ist, gestatten Sie, dass ich seinen Leichnam mitnehme, um ihn in der Gruft meiner Familie beizusetzen. Da ich in dieser Welt nicht mit ihm leben durfte, werde ich wenigstens in der Ewigkeit neben ihm schlafen.«
Der König Ludwig XVIII. schreibt auf ein Blatt Papier: »Sobald der Graf von Sainte-Hermine tot ist, erlaube ich die Herausgabe des Leichnams an Mademoiselle de La Clémencière.«
Mademoiselle de La Clémencière ist mit Doktor Cabanis verwandt; sie fragt ihn, ob es ein Betäubungsmittel gibt, das einen so todesähnlichen Zustand hervorrufen kann, dass ein Gefängnisarzt den Betäubten für tot erklärt.
Cabanis bereitet den Schlaftrunk eigenhändig zu, man flößt ihn Hector ein, und in derselben Nacht, in der er füsiliert werden soll, stellt der Arzt der Conciergerie seinen Tod fest.
Um drei Uhr morgens findet sich Mademoiselle de La Clémencière mit einer Postkutsche vor dem Gefängnis ein u. zeigt den Befehl Ludwigs XVIII., ihr den Toten auszuhändigen.
Der Befehl ist echt, der Tote wird ihr übergeben, man bricht in die Bretagne auf, doch unterwegs flößt Mademoiselle de La Clémencière Hector ein Gegenmittel ein, und er erwacht in den Armen der Frau, die er vor zwölf Jahren geliebt hat, die er immer noch liebt, aber nie wiederzusehen gewagt hatte!
A. DUMAS[19]
Höchstwahrscheinlich hat Paul Dalloz im Herbst 1868 Dumas in Paris aufgesucht und mit ihm einen Vertrag ausgehandelt, den Dumas in einem Brief an Dalloz (undatiert wie fast immer) festgehalten hat; dieser Vertrag besagt, dass Dumas seinen neuen Roman für Le Grand Moniteur universel in sechs Lieferungen schreiben wird – Arbeitstitel Hector de Sainte-Hermine – und dass er die erste Lieferung rechtzeitig für eine Veröffentlichung in täglichen Fortsetzungen ab dem 1. Januar 1869 abgeben wird; Dalloz steht es frei, den Abdruck der Fortsetzungen je nach Erforderlichkeit zu unterbrechen, doch er ist der Ansicht, dass eine ununterbrochene Veröffentlichung vorzuziehen wäre; als Bezahlung sind 40 Centimes Zeilenhonorar vereinbart, und das Urheberrecht an dem Werk fällt nach der Veröffentlichung im Moniteur ohne Abstriche an den Verfasser zurück, unter der Bedingung, dass der Verleger der ersten Buchausgabe (Michel Lévy frères) eine Frist von zwei Monaten nach Erscheinen der letzten Fortsetzung einhält, bevor er eine gebundene Ausgabe auf den Markt bringt.
Anfang November 1868 weilt Dumas nachweislich in Paris, vermutlich unter anderem mit der Arbeit an Hector de Sainte-Hermine beschäftigt; Alter und Krankheit zwingen ihn, seine Texte zu diktieren, wenn seine Hand so stark zittert, dass er nicht schreiben kann; die Einrichtung seines Arbeitszimmers hat die Reiseschriftstellerin Mathilde Shaw überliefert: »In seinem Arbeitszimmer hatte er sein Schlafzimmer aufgeschlagen und seine Erinnerungen an Familie und Freunde untergebracht: das Porträt seines Vaters mit den Zügen eines Mulatten, voller Energie und Tapferkeit, Aquarelle, die sein Freund Wilhelm III. von Holland ihm geschenkt hatte, als er Kronprinz war, und eine Sammlung sehr schöner alter Waffen.«
Fortsetzung folgt (oder auch nicht)
Bei näherer Betrachtung der einzelnen Folgen des Romans im Moniteur universel fällt auf, dass die erste Lieferung aus zweiundzwanzig Kapiteln zwischen dem 1. Januar und dem 9. Februar 1869 in täglichen Fortsetzungen erschienen ist, unterbrochen nur montags, wenn das Theaterfeuilleton an ihre Stelle trat. Das Feuilleton befand sich traditionsgemäß am Fuß der ersten und zweiten Seite (Ausnahmen bilden der 9. und 17. Januar) und vom 21. Januar an lediglich am Fuß der ersten Seite (mit Ausnahme des letzten Abdrucks, der wieder auf der ersten und der zweiten Seite stand).
Die zweite Lieferung von sechsundzwanzig Kapiteln wurde vom 16. Februar an veröffentlicht und erschien unter wiederholten und unterschiedlich langen Pausen (die längste währte vom 8. bis zum 28. April) bis zum 5. Juni 1869.
Was lässt sich daraus schließen? Wohl nichts anderes, als dass Dumas den ersten Teil oder die erste Lieferung seines neuen Romans vor Beginn der Veröffentlichung im Moniteur universel fertiggestellt hatte, während er die weiteren Lieferungen ad hoc verfassen musste und es ihm oft schwerfiel, genug Stoff für die tägliche Fortsetzung zu verarbeiten.
Die nächste Lieferung erscheint vom 6. Juni an im Moniteur universel, diesmal wieder regelmäßig, abgesehen von wenigen Unterbrechungen, die ebenso gut redaktionelle Gründe haben können wie Verzögerungen seitens des Verfassers, und endet am 30. September. Das Manuskript dieser Lieferung hatte Dumas offenbar vor seiner Abreise am 20. Juli in die Bretagne Paul Dalloz überlassen. Den Sommer will Dumas in Roscoff verbringen und dort an seinem Großen Wörterbuch der Kochkunst weiterarbeiten; in seinen eigenen Worten bricht er auf, »erschöpft von der Galeerensklavenarbeit, die seit fünfzehn Jahren nicht weniger als drei Bände im Monat hervorbringt, mit überreizter Phantasie, schmerzgeplagtem Kopf, restlos ruiniert, aber schuldenfrei«, wie er in der Vorrede zu seinem kulinarischen Kompendium erklärt.
Der Abdruck der vierten Lieferung schließt fast nahtlos an die letzte Folge der dritten Lieferung an; er beginnt am 2. Oktober und endet am 30. Oktober 1869 und wird nur am 22. und 26. Oktober ausgesetzt. Mitte September war Dumas aus Roscoff nach Paris zurückgekehrt, und es ist denkbar, dass er die vierte Lieferung in Paris geschrieben hat.
Am Fuß der letzten Folge vom 30. Oktober steht unter dem Verfassernamen: »Ende des dritten Teils (Fortsetzung folgt)«, und das letzte Kapitel (»Die Jagd auf die Banditen«) bricht mitten in der Handlung ab.
Mehr war nicht zu finden, auch wenn ich noch so argusäugig die Mikrofilme des Moniteur universel absuchte: keine Fortsetzung in den Monaten November und Dezember 1869, keine in den Monaten Januar und Februar 1870 oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ich musste mich damit abfinden, dass es keine Fortsetzung gab, keine fünfte und sechste Lieferung.
Andererseits gab es Briefe und Dokumente, aus denen man schließen konnte, Dumas habe auch nach dem Erscheinen der vierten Lieferung an seinem letzten Roman weitergeschrieben.
In einem ausnahmsweise datierten Brief vom 15. Januar 1870 lädt Dumas den Archivar im Marineministerium Pierre Margry zum Abendessen ein (Truthahn und Languste aus Roscoff) und bittet ihn – falls möglich -, verschiedene Unterlagen zu besorgen: »Das Manuskript des Barons Fain von 1812, Warrens Indien und Ségurs Kampagne in Russland«.[20]
Wozu benötigte er diese Werke?
Baron de Fains und Paul-Philippe Ségurs Schriften beziehen sich auf die politischen Ereignisse von 1812, den katastrophalen Russlandfeldzug Napoleons; Édouard de Warrens Bericht behandelt des Verfassers Tätigkeit als Beamter und Dolmetscher im Dienst Großbritanniens um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Indien.
Am Ende des abgebrochenen Romans haben wir mitten im 118. Kapitel den Helden Hector oder René gegen Anfang des Jahres 1807 in Kalabrien zurückgelassen. Wenn man nicht annehmen will, dass Dumas gegen alle Wahrscheinlichkeit und gegen all seine Usancen einen Zeitsprung von fünf Jahren zu machen beabsichtigte, um mit Napoleons Russlandfeldzug fortzufahren, dann darf man vermuten, dass das Ende des Erscheinens der Fortsetzungen im Moniteur universel nur eine Atempause für den Verfasser bedeutete, bevor er wieder anhob, um seinen Helden und den Roman bis zum Jahr 1812 (oder noch weiter?) zu führen.
Aus meiner Vermutung wurde Gewissheit, als ich Anfang 1990 eine verblüffende Entdeckung machte. In Maria Ullrichovàs Verzeichnis von Manuskripten Alexandre Dumas’, die seine Tochter Marie Alexandre vor ihrem Tod ihrem Freund Richard von Metternich geschenkt hatte, dem Sohn des früheren Staatskanzlers, stieß ich neben Beschreibungen der ersten Kapitel des vorliegenden Romans auch auf die Beschreibung des Fragments eines Kapitels über den Vizekönig Eugène Beauharnais und seine Bekanntschaft mit einem gewissen René im Jahr 1809 in Italien – »Der Vertrag von Campo Formio wird das Geschick der Republik Venedig entscheiden. Eugène Beauharnais wird von Napoleon zum Fürsten von Venedig ernannt. Seine Residenz ist Udine an der Ledra. Am 8. April 1809 erscheint bei ihm ein junger Offizier namens René, der Depeschen von Napoleon überbringt und ankündigt, dass Erzherzog Karl sie in wenigen Tagen angreifen werde. Beim Frühstück muss René seine abenteuerliche Lebensgeschichte erzählen. Er war Gefangener, Seemann, Reisender, Soldat, Jäger und Bandit. Er hat bei Cadiz und Trafalgar gekämpft, wurde zu Joseph Bonaparte und Murat geschickt. Neben seinen militärischen Fähigkeiten ist er sehr musikalisch und spielt vor der Prinzessin eine eigene Komposition, die von allen Anwesenden mit großem Beifall bedacht wird«[21] -, der sich entnehmen lässt, dass der Held des Romans ein neues waghalsiges Abenteuer unternimmt.
Ich war damals der einzige lebende Leser von Hector de Sainte-Hermine, aber ein treuer Leser, und ich wandte mich sofort an das Prager Archiv mit der Bitte um Kopien der entsprechenden Manuskripte, die ich einige Monate darauf erhielt.
Doch statt Licht in die Sache zu bringen, gaben diese Seiten mir neue und quälende Rätsel auf. Wenn dieses Fragment existierte, gab es dann möglicherweise noch weitere Kapitel in irgendwelchen Schubladen und ungesichteten Nachlässen oder im Besitz eifersüchtiger Sammler, die ihre Schätze mit niemandem teilen wollten – Kapitel, die beweisen konnten, dass Dumas seinen Roman zumindest bis zum Jahr der Handlung 1809 fortgesetzt hatte und bei seinem Tod im Begriff stand, die Zeitspanne zwischen 1809 und 1812 zu schildern?
Die Veröffentlichung aller bisher bekannt gewordenen Teile des Romans mag auch als Appell an alle Interessierten dienen, nach weiteren Manuskripten zu fahnden.
Polemik
Der nicht veröffentlichte Brief, den Dumas dem Herausgeber des Moniteur universel als Reaktion auf die »neuerliche Notiz« von Henry d’Escamps in Le Pays zur Verfügung gestellt hatte (und der mir dazu verholfen hatte, den Roman auszugraben), war als letzte Replik in einem Schlagabtausch gedacht, den die Veröffentlichung des ersten Romankapitels über Joséphines Schulden ausgelöst hatte.
Seit dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851, mit dem Louis-Napoléon sich umfassende Regierungsvollmachten gesichert hatte, war Le Pays offiziöses Organ der Regierungspartei. In der Ausgabe vom 8. Januar 1869 hatte Henry d’Escamps eine heftige Attacke gegen den von ihm nicht mit Namen genannten Verfasser des Romanabdrucks geritten und ihn antibonapartistischer Umtriebe geziehen: »Wir müssen unsere Leser bitten, sich vor dem Eindruck zu hüten, wir verwendeten einen Titel wie ›Joséphines Schulden‹. Das ist der Titel eines Feuilletons, welches in den ersten Ausgaben des Moniteur universel veröffentlicht wurde. Der Verfasser inszeniert darin den Ersten Konsul, seine Ehefrau und seinen Sekretär Monsieur Bourrienne mit so abscheulichem und albernem Sprechen und Fühlen, dass die Geschichte lautstark dagegen protestieren muss. Um die Unangemessenheit einer solchen Veröffentlichung ins rechte Licht zu rücken, genügt es, einige Auszüge zu zitieren.«
Nach langatmigem Zurückweisen dessen, was Henry d’Escamps als unangemessen empfindet, schließt er mit hymnischen Worten über die historische Joséphine: »Die Erinnerung an die Kaiserin, die sich zunehmend aus den Wolken befreit, mit denen sie bisweilen aus böswilliger Absicht oder aus Dummheit verhüllt werden sollte, wird für alle Zeiten wie eine Aureole des Ruhms und der Milde Napoleons siegreiche Stirn schmücken, und sie selbst wird im Gedenken des französischen Volkes, das sie über alles liebte, seiner Kinder und Kindeskinder ›die gute Joséphine‹ bleiben.«
Man kann sich denken, dass Alexandre Dumas so viel Aufsehen in Zusammenhang mit dem Vorabdruck seines neuen Romans nicht ungelegen kam.
Gleichzeitig nutzte er seine Antwort an den Bonapartisten, um in dem ausgefeilten Schreiben seine Vorstellung von Geschichtsschreibung darzulegen und das bonapartistische Bild Napoleons III. als Befreier Italiens zu erschüttern. Dieser Brief findet sich in der Ausgabe des Moniteur vom 11. Januar 1869 abgedruckt.
An den Herausgeber von Le Pays
Monsieur,
es gibt zwei Arten von Geschichtsschreibung.
Die eine ad narrandum – um zu erzählen -, wie bei Monsieur Thiers.
Die andere ad probandum – um zu beweisen -, wie bei Michelet.
Letztere scheint uns die Bessere zu sein, und wir sagen gern, warum.
Erstere zieht offizielle Verlautbarungen zu Rate, den Moniteur, Zeitungen, Briefe und Unterlagen in Archiven, anders gesagt die Ereignisse, wie sie von jenen dargestellt sind, die sie bewirkt haben, und folglich fast ausnahmslos von ihnen zu ihrem Nutzen verdreht.
So lässt Napoleon sein Leben auf Sankt Helena Revue passieren und arrangiert es für die Nachwelt.
In Monsieur de Montholons Hand sah ich das Original der Notiz, mit der Hudson Lowe Napoleons Tod mitgeteilt wurde. An drei Stellen hatte Napoleon sie eigenhändig korrigiert.
So hat der sterbende Napoleon sich einen napoleonischen Tod arrangiert.
Diese Methode ist unserer Ansicht nach nicht wahrheitsförderlich, sondern wendet Monsieur de Talleyrands Maxime an, die da lautet: Die Sprache ist uns gegeben, um unsere Gedanken zu verbergen.
Die zweite Methode verfährt völlig anders; sie rekonstruiert die chronologische Reihenfolge der Ereignisse, anders gesagt: der unwiderlegbaren Tatsachen; und erst dann sucht sie nach Ursache und Folgen dieser Ereignisse in den Erinnerungen der Zeitzeugen. Zuletzt zieht sie ihre Schlüsse, Schlüsse, die jenen versagt sind, die nur schreiben, um zu erzählen, und deren sich jene, die schreiben, um zu beweisen, triumphierend bedienen können.
In der Geschichtsschreibung ad narrandum hieße es beispielsweise: »Italiens Einigung wurde unter der Oberhoheit Napoleons III. in die Tat umgesetzt.«
In der Geschichtsschreibung ad probandum hieße es hingegen: »Italiens Einigung wurde gegen den Widerstand Napoleons III. durchgesetzt; er musste sich mit Siziliens Eroberung durch Garibaldi abfinden, untersagte es diesem aber, die Meerenge von Messina zu überschreiten, und die Großherzöge der Toskana und anderer Kleinstaaten wurden gestürzt trotz aller Unterstützung, die ihnen unser Konsul in Livorno auf Befehl Monsieur Walewskis zukommen ließ und deren Scheitern der Anlass war, dass er nach Amerika entsandt wurde.«
Im Geist dieser Methode, im Berücksichtigen kleinster Details, habe ich vierhundert Bände historischer Romane verfasst, die wahrhaftiger sind als die Geschichtsschreibung.
Und anhand des Romans Hector de Sainte-Hermine, über den sich beunruhigt zu zeigen Sie mir die Ehre erweisen, werde ich es Ihnen beweisen.
Zu der Notwendigkeit, historische Persönlichkeiten genau zu untersuchen, will ich eine Stelle aus den Memoiren der Herzogin von Abrantès anführen; Madame d’Abrantès war nicht nur überaus geistreich, sondern obendrein von kaiserlichem Geblüt, denn sie stammte von den Comnènes ab.
Folgendes bemerkt sie über die vortreffliche Person, die Joséphine genannt wurde, die man »Notre Dame des Victoires« nannte und von der behauptet wurde, mit ihr habe Napoleon das Glück verlassen: »Es gibt Personen«, schreibt Madame d’Abrantès, »die der Geschichte gehören, und zu ihnen zählt Joséphine. Ob man sie als Mademoiselle de la Pagerie betrachten will, als Madame de Beauharnais oder als Madame Bonaparte, unterliegt ihre Person zwangsläufig genauester Beobachtung. Aus dem Zusammenführen, Annähern und Vergleichen dieser Beobachtungen wird die Nachwelt dereinst ein Porträt Joséphines gewinnen, das eine gewisse Ähnlichkeit beanspruchen kann. Die scheinbar unbedeutendsten Dinge bieten oftmals den Gegenstand tiefgründiger Überlegungen. Als Ehefrau des Mannes, der die Welt regierte und über den sie selbst eine gewisse Herrschaft ausgeübt hat, ist Joséphine eine Persönlichkeit, die zu studieren von unmittelbarem Interesse ist; obwohl sie als Person nicht das geringste Interesse verdiente, muss man sie eingehendst studieren.
Erstaunlich bleibt, welchen Ruf sich Madame Bonaparte von Anfang an zu verschaffen verstand. Ich werde in der Folge oft genug Gelegenheit haben, sie in ihrem wahren Licht zu zeigen, einem Licht von äußerst zweifelhafter Helligkeit, sobald Monsieur de Bourrienne sie nicht anleitete, denn er hatte sich ihres Geistes oder eher ihres schwachen Charakters bemächtigt, und sobald sie in Mailand eintraf, geriet sie zweifellos, ohne sich darüber im Klaren zu sein, unter seine direkte Leitung.«
Dies, Monsieur, sind zwei Absätze, die uns klipp und klar sagen, dass Joséphine eine historische Persönlichkeit ist, die in allen Facetten untersucht werden muss, und dass Monsieur de Bourrienne sich ihres Geistes oder eher ihres schwachen Charakters ganz und gar bemächtigt hatte.
Lassen wir Bourrienne selbst sagen, in welchem Verhältnis er zum Ersten Konsul und auch zu Madame Bonaparte stand: »In den ersten Monaten im Tuilerienpalast schlief Bonaparte immer bei seiner Frau. Jeden Abend ging er zu Joséphine hinunter und benutzte die kleine Treppe, die in einen Ankleideraum führt, der zu einem Kabinett gehört, das früher einmal das Betzimmer der Maria von Medici war. Auch ich habe Bonapartes Schlafzimmer immer nur über diese Treppe betreten. Und er kam immer durch dieses Ankleidezimmer in unser Arbeitskabinett hinauf.«
Sie behaupten, Monsieur, es sei undenkbar, dass Bourrienne sich erlaubt hätte, morgens in Bonapartes Schlafgemach einzudringen, während Joséphine noch im Bett lag.
Sie werden noch ganz andere Dinge erfahren, die ihm nicht nur erlaubt, sondern sogar angeordnet waren: »Zu den besonderen Anordnungen, die Bonaparte mir gegeben hatte, gehört eine besonders merkwürdige. ›Kommen Sie nachts so selten wie möglich in mein Zimmer‹, hatte er gesagt. ›Wecken Sie mich nie, wenn Sie eine gute Nachricht haben. Gute Nachrichten sind nicht eilig; aber wenn es sich um eine schlechte Nachricht handelt, dann wecken Sie mich auf der Stelle, denn dann darf man keine Minute verlieren.‹«
Sie sehen also, Monsieur, dass Bourrienne sehr wohl befugt war, nachts Bonapartes Zimmer zu betreten. Folglich hatte er einen Schlüssel zu diesem Zimmer, damit er es jederzeit betreten konnte, oder aber der Schlüssel steckte in der Tür, da die Treppe zu Bonapartes Kabinett führte.
Auch diese Stelle beweist, dass er den Befehl hatte, jeden Morgen um sieben Uhr das Zimmer zu betreten: »Bonaparte schlief fest, so fest, dass er verlangte, jeden Morgen um sieben Uhr von mir geweckt zu werden. Ich betrat deshalb als Erster sein Zimmer, doch oft sagte er im Halbschlaf zu mir, wenn ich ihn weckte: ›Ach, Bourrienne, lassen Sie mich noch einen Augenblick schlafen!‹ Und wenn nichts allzu Dringendes zu erledigen war, kam ich um acht Uhr wieder.«
Bourrienne sagt unmissverständlich, dass Bonaparte nach dem ersten Jahr im Tuilerienpalast die eheliche Gepflogenheit aufgab, jede Nacht bei seiner Frau zu verbringen, und dass er bisweilen nach seinen nächtlichen Spaziergängen mit Duroc oder aus anderen Gründen in einem Junggesellenzimmer schlief, das er sich im ersten Stock hatte einrichten lassen; an diesen Tagen betrat Bourrienne, der von Bonapartes nächtlichen Eskapaden nichts wusste, morgens wie gewohnt das Schlafzimmer des Ersten Konsuls, wo er Joséphine allein vorfand.
Im Übrigen wüsste ich gern, Monsieur, ob es nicht unanständiger ist, einen Mann und eine Frau im selben Bett zu sehen, auch wenn es sich um Ehemann und Ehefrau handelt, als eine Frau allein in ihrem Bett – in einer Epoche, die eng auf die Zeit folgte, als Frauen im Bett zu empfangen pflegten und dies mit den guten Sitten durchaus in Einklang stand?
Aber gehen wir zu Joséphines Schulden über. Diese Schulden hatten für so großes Aufsehen gesorgt, dass niemand wagte, das Thema dem Ersten Konsul gegenüber anzuschneiden.
»Eines Abends gegen halb zwölf Uhr sprach Monsieur de Talleyrand dieses heikle Thema an. Sobald er gegangen war, kehrte ich in das kleine Arbeitskabinett zu Bonaparte zurück, und er sagte zu mir: ›Bourrienne, Talleyrand hat mir von den Schulden meiner Frau berichtet. Ich habe das Hamburger Geld; lassen Sie sich von ihr eine korrekte Aufstellung geben. Sie soll keine Ausflüchte machen, ich will die Sache ein für alle Mal bereinigen und nichts mehr davon hören; aber bezahlen Sie nichts, ohne mir vorher die Rechnungen dieser Halunken zu zeigen, die ein Haufen Halsabschneider sind.‹
Bis dahin hatte die Furcht vor einer lautstarken Szene, bei deren bloßer Vorstellung Joséphine in größte Ängste geriet, mich davon abgehalten, dieses unerquickliche Thema vor dem Ersten Konsul zur Sprache zu bringen; doch nachdem Monsieur de Talleyrand glücklicherweise die Initiative ergriffen hatte, beschloss ich, alles zu tun, was in meiner Macht stand, um diese unerfreuliche Sache zu beenden.
Gleich am nächsten Morgen sprach ich mit Joséphine. Zuerst machte das Vorhaben ihres Mannes sie überglücklich, doch diese Gemütsverfassung hielt nicht an. Als ich von ihr die genaue Aufstellung ihrer Schulden verlangte, beschwor sie mich, darauf nicht zu beharren, sondern mich mit dem Betrag zufriedenzugeben, den einzugestehen sie bereit war.
Nach einer weiteren Viertelstunde fruchtlosen Debattierens sah ich mich genötigt, ihren lebhaften Vorstellungen nachzugeben und ihr zu versprechen, dem Ersten Konsul nicht mehr als sechshunderttausend Francs Schulden zu gestehen.
Man kann sich den Zorn und die Übellaunigkeit des Ersten Konsuls lebhaft ausmalen; er ahnte wohl, dass seine Frau ihm etwas verheimlichte, doch er sagte zu mir: ›Wohlan, nehmen Sie sechshunderttausend Francs, aber begleichen Sie mit diesem Betrag alle Schulden, und lassen Sie mich von dieser Sache nie wieder etwas hören. Ich ermächtige Sie, den Lieferanten damit zu drohen, dass sie gar nichts bekommen, wenn sie nicht bereit sind, auf ihre übermäßigen Profite zu verzichten; sie müssen lernen, weniger leichtsinnig auf Kredit zu liefern.‹
Madame Bonaparte übergab mir all ihre Unterlagen. Die übermäßige Höhe der Preise als Folge der Befürchtung, mit erklecklicher Verspätung bezahlt zu werden und dabei erheblich heruntergehandelt zu werden, spottete jeder Beschreibung. Zudem hatte ich den Eindruck, dass in den Mengen der gelieferten Artikel gewaltig übertrieben wurde. Auf der Mahnung des Modisten fanden sich für einen Monat achtunddreißig höchst kostspielige neue Hüte; es wurden Reiherfedern für tausendachthundert Francs und Federbüsche für achthundert Francs in Rechnung gestellt. Ich fragte Joséphine, ob sie jeden Tag zwei Hüte aufsetzte; sie beteuerte, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Die Übertreibungen des Sattlers hinsichtlich seiner Preise und für Artikel, die er niemals geliefert hatte, waren schlichtweg lächerlich. Von den übrigen Lieferanten brauche ich nicht zu sprechen: Sie waren allesamt die gleichen Halsabschneider.
Die Ermächtigung des Ersten Konsuls nutzte ich weidlich und sparte weder mit Vorwürfen noch mit Drohungen. Ich schäme mich zu sagen, dass die Mehrzahl der Lieferanten sich mit der Hälfte des verlangten Betrags zufriedengab; einer von ihnen erhielt fünfunddreißigtausend Francs statt achtzigtausend Francs und besaß die Unverfrorenheit, mir ins Gesicht zu sagen, er habe dabei einen guten Schnitt gemacht.
Zuletzt war ich so glücklich, nach heftigsten Streitigkeiten die ganze Sache mit sechshunderttausend Francs zu bereinigen. Madame Bonaparte verfiel jedoch bald wieder in die alten Unsitten. Glücklicherweise war inzwischen mehr Geld zur Hand. Diese unvorstellbare Verschwendungssucht war ursächlich für fast all ihre Kümmernisse verantwortlich; ihre unüberlegten Ausgaben sorgten für ständige Unordnung in ihrem Haushalt, was bis zu Bonapartes zweiter Eheschließung anhielt, woraufhin sie, wie ich hörte, vernünftiger wurde. Aus ihrer Zeit als Kaiserin im Jahr 1804 kann ich dergleichen nicht behaupten.«
Und vielleicht ist Ihnen nicht bekannt, Monsieur, dass ich vor bald zwei Jahren einen Prozess gewonnen habe, der für alle Verfasser historischer Romane von größter Bedeutung sein dürfte.
In meiner Studie des Wegs nach Varennes hatte ich erzählt, dass der König am Gipfel des Anstiegs, von wo aus man die ganze Stadt überblicken kann, auf eine Eskorte treffen sollte.[22] Die Dragoner waren jedoch nicht gekommen, und einer der Leibgardisten, die den König begleiteten, ging den Weg hinunter und klopfte an die Tür eines Hauses, durch dessen Fensterläden man Licht schimmern sah.
Die Königin und Monsieur de Valory näherten sich ebenfalls dem Haus, doch man schlug ihnen die Tür vor der Nase zu. Der Leibgardist tritt vor, stößt die Tür auf und sieht sich einem etwa fünfzigjährigen Mann im Morgenrock, mit nackten Beinen und in Pantoffeln gegenüber.
Es war dies ein Edelmann, dessen Namen ich hier nicht wiederholen will und der in seiner Eigenschaft als Major und als Ritter des Ordens von Saint-Louis zweimal dem König den Treueeid geschworen hatte. Doch unter den Umständen dieses Augenblicks hatte ihn aller Mut verlassen; als er die Königin erkannte, weigerte er sich zuerst, ihr zu antworten, antwortete dann stotternd und schloss ihr zuletzt die Tür vor der Nase, so dass die erhabenen Reisenden so hilflos wie zuvor waren. Sein Enkelsohn hat als frommer Wächter über die Ehre seiner Vorfahren einen Verleumdungsprozess gegen mich angestrengt, um seinen Großvater zu verteidigen. Das Gericht entschied, daß in Fällen wie diesem, in dem ich mich zudem auf zwei Zeitzeugen stützen konnte, jeder, der in historischen Ereignissen eine Rolle gespielt hatte, der Geschichte Rechenschaft schuldete, wies die Klage des Enkels zurück und verurteilte ihn dazu, die Prozesskosten zu tragen.
Dies, Monsieur, wollte ich Ihnen sagen, und ich danke Ihnen für die Gelegenheit, dem Publikum auf diesem Weg darzulegen, dass ich mich in meinen Büchern eng an die historischen Zeugnisse halte.
ALEXANDRE DUMAS
Der Brief wurde am Tag darauf in Le Pays abgedruckt, begleitet von folgendem Kommentar Henry d’Escamps’:
»Die Leitung des Moniteur universel appelliert an unsere Kollegialität und bittet uns um den Abdruck obigen Leserbriefes; wir rücken ihn umso bereitwilliger ein, als er unsere Aussagen zur Gänze bestätigt.
Was seinen Roman betrifft, führt unser Widersacher zwei Arten der Geschichtsschreibung ins Feld, die Monsieur Thiers’ und die Monsieur Michelets, und positioniert sich bescheiden zwischen diesen beiden Namen, indem er hinzufügt, dass in seinen Augen die beste Methode der Geschichtsschreibung darin bestehe, nicht in veröffentlichten und seriösen Dokumenten Nachforschungen zu betreiben, sondern in den zeitgenössischen Memoiren.
Dergleichen Theorien müssen wir nicht weiter erörtern, doch mit Fug und Recht darf man sich wundern, dass dieser Verfasser, obwohl kein Mangel an diesbezüglichen Dokumenten besteht, für die Schilderung einer Kaiserin, die vom französischen Volk abgöttisch geliebt wurde, ausgerechnet die Erinnerungen eines Monsieur de Bourrienne zu Rate zieht, die Erinnerungen eines Mannes, der sich genötigt sah, seinen Dienst bei dem Ersten Konsul unter seinem Ruf wenig förderlichen Umständen zu quittieren. Ein solcher Mitarbeiter muss demjenigen, der sich seiner Feder und seiner Zitate bedient, zwangsläufig Unglück bringen.
Und wahrhaftig beweisen die Zitate, auf welchen der Verfasser des betreffenden Romans so hartnäckig herumreitet, genau des Gegenteil dessen, was er mit ihnen belegen will.
Um nur eine Stelle zu zitieren: Monsieur Bourrienne schreibt dort: ›Ich fragte Joséphine, ob sie jeden Tag zwei Hüte aufsetzte; sie beteuerte, es müsse sich um einen Irrtum handeln.‹ Ungeachtet dieser Widerlegung, ungeachtet Bourriennes eigenen Zeugnisses behandelt der Romancier die Behauptung als Wahrheitsbeweis. Wir überlassen es dem verständigen Publikum, sein eigenes Urteil zu treffen.
Was die historischen Beweise des Verfassers betrifft, sehen sie so aus: Er konnte zwischen dem Grafen La Valette, den wir erwähnten, und Monsieur Bourrienne wählen, und er hat sich für Letzteren entschieden.
Wir könnten seinen vorangehenden Brief Zeile für Zeile widerlegen, doch wir wollen nicht einmal den Anschein erwecken, als wollten wir ein Angedenken verteidigen, das sogar seitens des Auslands mit Ehrerbietung behandelt wird.
Der Leser weiß so gut wie wir, dass es Dinge gibt, deren Erörterung sich erübrigt. Was den Verfasser des Romans betrifft, so nötigt er uns zu der Erkenntnis, dass es eine Tugend gibt, die für den Romancier so unerlässlich ist wie für den Historiker und die weder durch Phantasie noch Begabung oder Geist aufzuwiegen ist: und zwar das moralische Empfinden.«
Der eingangs zitierte und nie erschienene Brief Dumas’ war also die Antwort auf diesen Kommentar aus Le Pays. Leider verstummte nicht nur die Kontroverse, sondern erstarb auch bald jedes Interesse an dem Romanabdruck. Pierre Margry berichtet in einer Notiz von einem seiner Besuche am Krankenbett des alten und leidenden Dumas von einem Gespräch, in dem ein befreundeter Geistlicher Dumas zu der Feuilletonveröffentlichung seines letzten Romans gratulierte, die er, wie er sagte, mit großem Vergnügen verfolge, worauf Dumas ihm traurig erwiderte, er sei der Einzige, der ein freundliches Wort über sein Buch zu ihm sage.
Die unvollendete Kathedrale
Der historische Roman findet im Werk von Alexandre Dumas, dessen Anfänge ganz im Theater gründen, erst spät seinen Platz. In seinen frühen historischen Chroniken und Szenenfolgen teilt Dumas die Geschichte Frankreichs in vier Epochen auf, die er anhand der Verteilung des Landbesitzes unterscheidet: die Zeit der Lehensherrschaft, die Zeit des Feudalwesens, die Zeit der Aristokratie und die Zeit des Privatbesitzes. Unter diesem Aspekt behandeln die Romane La Reine Margot, La Dame de Monsoreau und Les Quarante-Cinq den Verfall des Feudalwesens, Die drei Musketiere, Zwanzig Jahre danach und Der Vicomte de Bragelonne zeigen den Untergang des Feudalwesens und das Heraufkommen der absolutistischen Monarchie, die Mémoires d’un médecin markieren das Ende der Aristokratie, und die Trilogie aus Les Blancs et les Bleus, Les Compagnons de Jéhu und Le Chevalier de Sainte-Hermine führt uns in die Neuzeit, deren Held schlechthin der Graf von Monte Christo ist.
Nach dem großen Erfolg seiner ersten historischen Romane Die drei Musketiere und Zwanzig Jahre danach schrieb Dumas seinem Freund Bérenger: »Mein ganzes künftiges Leben bilden im Voraus gefüllte Abteilungen, künftige Arbeiten, die bereits angelegt sind. Wenn Gott mir noch fünf Lebensjahre vergönnt, werde ich die Geschichte Frankreichs vom heiligen Ludwig bis zum heutigen Tag erschöpfend behandelt haben. Wenn er mir noch zehn Jahre vergönnt, werde ich Cäsar mit dem heiligen Ludwig unauflöslich verbunden haben. Verzeihen Sie mir die Eitelkeit, die Sie diesen Zeilen entnehmen mögen, doch es gibt Menschen, in deren Augen ich als derjenige erscheinen will, der ich bin, und unter diesen sind Sie gewiss nicht der Letzte.«[23]
Dumas wollte die Geschichte Frankreichs in Romanform kleiden, doch was ihm vorschwebte, waren nicht in die Geschichte eingebettete Romane mit allem pittoresken Drumherum, sondern Romane, in denen die Geschichte selbst eine tragende Rolle spielte und deren Helden die sozialen Klassen verkörperten, deren Widerstreit die Dynamik des Stoffes bildete. In Les Compagnons de Jéhu, dem zweiten Band seiner Bürgerkriegstrilogie, erklärte er seine »Methode« folgendermaßen: »Diejenigen, die jedes unserer Bücher für sich allein lesen, wundern sich vielleicht, dass wir manchmal auf Einzelheiten eingehen, die für das betreffende Buch etwas weithergeholt erscheinen. Der Grund ist, dass wir das Buch nicht für sich allein geschrieben haben, sondern [...] dass wir einen unermesslich großen Rahmen ausfüllen oder auszufüllen versuchen. Für uns beschränkt sich die Gegenwart unserer Figuren nicht auf ihr Auftreten in einem einzigen Buch: Der Mann, den Sie in diesem Buch als Adjutanten sehen, wird Ihnen im nächsten als König wiederbegegnen und im dritten als Verfolgter, dessen Leben ein Erschießungskommando ein Ende setzt. Balzac hat ein großes und schönes hundertgesichtiges Werk mit dem Titel Die menschliche Komödie geschaffen. Unser eigenes Werk, das wir zur gleichen Zeit begannen wie er das seine, ohne dass wir uns mit ihm vergleichen wollten, könnte Das Drama Frankreichs heißen.«[24]
Als Dumas gegen Ende seines Lebens – nicht fünf, sondern fünfundzwanzig Jahre nach den Zeilen an Bérenger – sein vollendetes Werk betrachtete, musste er sich die schmerzlichen Lücken eingestehen, darunter insbesondere die der Zeit zwischen 1799 und 1815. War die große Kathedrale seines Werks dazu bestimmt, wie so viele Bauwerke unvollendet zu bleiben? Der letzte Stein, den er in sein Bauwerk einfügte, war sein unvollendeter letzter Roman, in dem die vielgesichtige Figur Napoleons mit dem Helden kontrastiert wird, dem letzten Sprössling der Familie Sainte-Hermine, der für Napoleon eine unauflösbare Mischung aus Bewunderung und Abscheu empfindet.
Napoleon als Darsteller im Drama Frankreichs
Gegen Lebensende des Schriftstellers ist Napoleon bereits in die Geschichte eingegangen, doch der junge Dumas hat ihn noch mit eigenen Augen gesehen.
In einem Vortrag vor dem Cercle national des Beaux-Arts im Jahr 1865 in Paris erinnert sich Dumas:
Napoleon verließ Elba am 26. Februar [1815]. Am 2. März landete er im Golf von Juan. Am 20. erreichte er Paris.
Villers-Cotterêts lag auf dem Weg, den die Armee nehmen musste, um dem Feind zu begegnen.
Nach einem Jahr Herrschaft der Bourbonen, anders gesagt, nach einem Jahr der Verleugnung eines Vierteljahrhunderts unserer Geschichte, war es – wie ich zugeben muss – für die Witwe und den Waisensohn eines Revolutionsgenerals eine große Freude, die alten Uniformen wiederzusehen, die alten Kokarden, die sich auf dem Weg von Elba nach Paris in den Trommeln der Tamboure gefunden hatten, und die ruhmreichen alten Trikoloren mit den Löchern der Kugeln von Austerlitz, Wagram und der Schlacht von Borodino.
Ein herrliches Schauspiel war der Anblick dieser alten Garde – einer Art von Militär, die es heutzutage nicht mehr gibt und die man als lebende Verkörperung jener kaiserlichen Epoche betrachten kann, die wir kurz zuvor durchlebt hatten, der lebendigen und ruhmvollen Legende Frankreichs.
Innerhalb von drei Tagen durchquerten dreißigtausend Mann unsere Ortschaft, dreißigtausend Riesen von entschlossenem, ruhigem, beinahe nüchternem Auftreten. Jedem von ihnen war bewusst, dass ein Teil des großen napoleonischen Bauwerks aus seinem Blut zementiert war, auf seinen Schultern ruhte, und wie Pugets schöne Karyatiden, die den Ritter Bernini so erschreckt hatten, als er in Toulon an Land ging, schienen alle stolz auf die Last zu sein, die sie trugen, auch wenn es fast über ihre Kräfte ging.
Oh, vergessen wir sie nicht, vergessen wir sie niemals, die Männer, die mit festem Schritt nach Waterloo marschierten, anders gesagt dem Grab entgegen, denn sie verkörperten Aufopferung, Tapferkeit, Ehrgefühl; sie verkörperten das edelste Blut Frankreichs, zwanzig Jahre ununterbrochenen Kampfs gegen ganz Europa, die Revolution, unsere Mutter, den Ruhm der Vergangenheit und die Freiheit der Zukunft, sie waren nicht der Adel Frankreichs, sondern der Adel des französischen Volkes.
Ich sah sie alle vorbeimarschieren, alle bis zu den letzten Überbleibseln des Ägyptenfeldzugs: zweihundert Mamelucken in ihren roten Hosen und weißen Turbanen und mit ihren gebogenen Säbeln.
Etwas nicht allein Erhabenes, sondern sogar Religiöses, Heiliges, Geheiligtes ging von diesen Männern aus, die so unausweichlich und unwiderruflich verurteilt waren wie die Gladiatoren der Antike und wie sie hätten sagen können: »Caesar, morituri te salutant (Cäsar, die Todgeweihten entbieten dir ihren Gruß).
Doch diese Männer gingen nicht zum Zeitvertreib ihres Herrschers in den Tod, sondern für die Unabhängigkeit eines Volkes, und sie wurden nicht gezwungen, sondern gingen aus freien Stücken, aus freiem Willen.
So zogen sie an uns vorbei!
Eines Morgens verstummte das Geräusch ihrer Schritte, und die letzten Klänge ihrer Marschmusik verhallten.
Die Musik war das Stück »Veillons au salut de l’Empire«.
Dann verkündeten die Zeitungen, dass Napoleon am 12. Juni aus Paris aufbrechen und sich seiner Armee anschließen werde.
Napoleon nahm immer den Weg, den seine Garde genommen hatte. Er würde also durch Villers-Cotterêts kommen.
Ich muss gestehen, dass es mich unbändig danach verlangte, diesen Mann zu sehen, der mit allem Gewicht seines Genius’ auf Frankreich und ganz besonders schwer auf mir gelastet hatte, dem armen Atom, das sich unter zweiunddreißig Millionen Menschen verlor und das er dennoch weiterhin zu Boden drückte, ohne sich meiner Existenz gewahr zu sein.
Am 11. erfuhren wir, dass er nachweislich durch unsere Stadt kommen würde, denn die Pferde waren bei der Poststation bestellt.
Er würde gegen drei Uhr morgens aus Paris abreisen und folglich Villers-Cotterêts zwischen sieben und acht Uhr morgens durchqueren.
Ab sechs Uhr morgens wartete ich nach einer schlaflos durchwachten Nacht am einen Ende der Stadt in Gesellschaft der körperlich tüchtigsten Bewohnerschaft, das heißt all derer, die mit den kaiserlichen Kutschen mithalten konnten.
In der Tat konnte man Napoelon während seiner Vorbeifahrt nicht gut sehen, sondern erst während seines Aufenthalts.
Das wurde mir klar, und kaum hatte ich in einer Viertelmeile Entfernung den Staub gesehen, den die wartenden Pferde aufwirbelten, rannte ich zur Poststation, so schnell ich konnte.
Je näher ich ihr kam, desto lauter hörte ich hinter mir, ohne die Zeit zu erübrigen, mich umzudrehen, Räder donnernd näher kommen.
Ich erreichte die Poststation, drehte mich um und sah wie einen Wirbelsturm drei Kutschen herbeirollen, so schnell, dass ihre Räder Funken schlugen, von schäumenden Pferden gezogen und von Postillionen in vollem Staat mit gepuderten Haaren und Ordensbändern gelenkt.
Alle Gaffer drängten sich um die Kutsche des Kaisers.
Selbstverständlich befand ich mich in der ersten Reihe.
Ich sah ihn!
Er saß rechts hinten im Wagen und trug die grüne Uniform mit weißen Aufschlägen und den Orden der Ehrenlegion.
Sein bleiches, kränkliches Antlitz, das dennoch so schön wie eine antike Münzprägung war, sah aus, als wäre es ohne Widerstand aus einem Stück Elfenbein geschnitten, dessen gelbliche Färbung es hatte, und er hielt es leicht auf die Brust gesenkt. Zu seiner Linken saß sein Bruder Jérôme, der ehemalige König von Westfalen, der jüngste und treueste seiner Brüder; Jérôme gegenüber und vorne im Wagen saß der Adjutant Le Tort.
Als erwachte er aus einer Betäubung oder aus seinen Gedanken, hob der Kaiser den Kopf, sah sich um, ohne etwas zu sehen, und fragte: »Wo sind wir?«
»In Villers-Cotterêts, Sire«, sagte eine Stimme.
»Also sechs Meilen von Soissons entfernt?«, fragte er.
»Sechs Meilen von Soissons entfernt, jawohl, Sire.«
»Beeilen Sie sich.«
Und er fiel in den Halbschlaf zurück, aus dem ihn das Anhalten des Wagens gerissen hatte.
Die Pferde waren ausgetauscht, die neuen Postillione saßen auf dem Kutschbock, und die Stallknechte, die seine Pferde ausgespannt hatten, schwenkten die Hüte und riefen: »Es lebe der Kaiser!«
Die Peitschen knallten; Napoleon machte eine leichte Kopfbewegung, die einen Gruß bedeutete, und die Kutschen wurden im Galopp entführt und verschwanden in der Kurve der Straße nach Soissons.
Das riesige Tableau war entschwunden.
Sechs Tage vergingen, und während dieser sechs Tage erfuhren wir von dem Übergang über die Sambre, von der Einnahme Charlerois, von der Schlacht von Ligny und der bei Quatrebras.
So waren die ersten Meldungen Siegesmeldungen.
Am 18. Juni, dem Tag der Schlacht von Waterloo, hatten wir den Ausgang der Schlachten vom 15. und 16. Juni erfahren.
Begierig erwarteten wir weitere Nachrichten. Der 19. verging, ohne dass wir etwas Neues hörten.
Der Kaiser, hieß es in den Zeitungen, habe das Schlachtfeld von Ligny besucht und habe angewiesen, dass den Verwundeten geholfen werde.
General Le Tort, den ich dem Kaiser gegenüber in seiner Kutsche sitzen gesehen hatte, war bei der Einnahme von Charleroi getötet worden.
Napoleons Bruder Jérôme, der neben ihm gesessen hatte, war im Kampf um Charleroi von einer Kugel der Degenknauf abgeschosssen worden.
Der Tag des 20. Juni verging langsam und bedrückend, der Himmel war finster und stürmisch. Regenströme hatten sich ergossen, und alle dachten sich, dass bei einem solchen Wetter, wie es seit drei Tagen anhielt, sicherlich keine Gefechte hatten stattfinden können.
Und unvermittelt machte das Gerücht die Runde, dass Männer, die schlechte Nachrichten brachten, festgehalten und in den Hof des Rathauses gebracht worden seien.
Alle eilten dorthin, ich, wie man sich denken kann, unter den Ersten.
Tatsächlich sehen wir sieben oder acht Männer, die einen noch zu Pferde, die anderen neben ihren Pferden stehend, von der Menge umringt, die sie nicht aus den Augen läßt.
Sie sind blutbeschmiert, von Kopf bis Fuß verschmutzt und zerlumpt!
Sie bezeichnen sich als Polen und können nur mühsam ein paar Worte auf Französisch radebrechen.
Ein ehemaliger Offizier, der Deutsch spricht, kommt und befragt sie auf Deutsch.
Mit dieser Sprache vertrauter, erzählen sie, dass Napoleon am 18. einen Kampf gegen die Engländer geführt habe. Die Schlacht, sagen sie, habe gegen Mittag begonnen. Um fünf Uhr seien die Engländer geschlagen gewesen. Doch um sechs Uhr sei Blücher, der den Kanonenschüssen folgte, mit vierzigtausend Mann Verstärkung erschienen und habe die Schlacht zugunsten des Gegners entschieden. »Entscheidungsschlacht. Die französische Armee ist nicht auf dem Rückzug, sondern auf der Flucht.«
Sie sind die Vorhut der Flüchtenden.
Es ist ungefähr drei Uhr nachmittags. Innerhalb von achtundvierzig Stunden sind diese Männer von Planchenois hergekommen.
Sie haben mehr als eineinhalb Meilen in der Stunde zurückgelegt. Unglücksboten haben Flügel.
Ich kehre nach Hause zurück. Ich berichte meiner Mutter, was ich gesehen habe. Sie schickt mich zur Poststation: Dort erhält man immer die allerneuesten Nachrichten.
Ich beziehe dort Stellung.
Um sieben Uhr kommt ein Eilbote: Er trägt die grüne und goldene kaiserliche Livree.
Er ist von Kopf bis Fuß mit Schmutz bedeckt, sein Pferd zittert am ganzen Körper und bäumt sich auf, um nicht vor Erschöpfung umzufallen.
Der Bote verlangt vier Pferde für einen Wagen, der ihm folgt; man bringt ihm ein neues, gesatteltes Pferd; man hilft ihm beim Aufsteigen; er gibt ihm die Sporen und ist fort.
Vergebens hat man ihn auszufragen versucht; er weiß nichts oder gibt vor, nichts zu wissen.
Die vier verlangten Pferde werden aus dem Stall geholt; sie werden angeschirrt, man wartet auf den Wagen.
Ein dumpfes, schnell lauter werdendes Grollen kündigt ihn an.
Man sieht ihn um die Straßenbiegung kommen; er bleibt vor der Poststation stehen.
Der Postmeister tritt verblüfft vor.
Ich ziehe ihn am Ärmel: »Er ist es, der Kaiser!«, sage ich.
»Gewiss!«
Es war der Kaiser, ebendort, wo ich ihn vor acht Tagen gesehen hatte, in einem ähnlichen Wagen, mit einem Adjutanten neben ihm und einem gegenüber.
Doch die beiden sind nicht Jérôme und Le Tort. [...]
Es ist der Kaiser, zweifellos, es ist derselbe Mann, es ist die gleiche bleiche, kränkliche, reglose Miene.
Nur ist der Kopf diesmal noch etwas weiter auf die Brust gebeugt.
Liegt es nur an der Erschöpfung?
Ist es der Schmerz, um die Welt gespielt und verloren zu haben?
Wie beim ersten Mal hebt er den Kopf, als er merkt, dass der Wagen anhält, sieht sich mit demselben vagen Blick um, der so durchbohrend wird, wenn er sich auf einen Menschen oder einen Horizont richtet, die zwei geheimnisvollen Dinge, hinter denen sich immer eine Gefahr verbergen kann.
»Wo sind wir?«, fragt er.
»In Villers-Cotterêt, Sire«, antwortet der Postmeister.
»Also achtzehn Meilen von Paris entfernt?«
»Ja, Sire.«
»Weiter!«
Und wie beim ersten Mal gab er nach einer ähnlichen Frage in fast den gleichen Worten den gleichen Befehl und fuhr schnell weiter.
Auf den Tag genau waren drei Monate seit seiner Rückkehr von der Insel Elba in den Tuilerienpalast vergangen.
Doch zwischen dem 20. März und dem 20. Juni grub Gott einen Abgrund, der seinen Glücksstern verschlang.
Dieser Abgrund ist Waterloo.[25]
Dumas fühlte sich »vom Gewicht Napoelons erdrückt« als Sohn eines Mannes, dessen Karriere ein brüskes und vorzeitiges Ende fand, weil er zu jenen gehörte, denen Bonaparte nicht verzeihen konnte, dass sie ihre republikanische Gesinnung nicht verleugneten. General Alexandre Dumas, der an den schicksalsträchtigen Tagen im Vendémiaire des Jahres IV (Oktober 1795) nicht in Paris geweilt hatte und daher der Aufforderung des Konvents, den Aufstand der royalistischen Sektionen niederzuschlagen, nicht rechtzeitig Folge hatte leisten können, was dem jungen und ehrgeizigen General Bonaparte Gelegenheit gab, sich an Stelle des damals berühmteren Dumas hervorzutun, hatte sich in Ägypten mit Bonaparte überworfen, war auf der Rückkehr durch einen Sturm gezwungen worden, im Königreich Neapel zu landen, und war dort bis zum Frühjahr 1801 gefangen gehalten worden. Schwer erkrankt und mittellos nach Hause zurückgekehrt, musste er feststellen, dass er aus dem aktiven Dienst entfernt worden war, und 1806 starb er an den Folgen seiner Haft; mit keinem seiner Bittschreiben hatte er Napoleon dazu bewegen können, ihm wenigstens einen Teil seines ausstehenden Solds zu bezahlen, und er hinterließ Frau und Kind in Armut.
Diese nahe und schmerzliche Vergangenheit seiner Kindheit wird Dumas sein Leben lang nicht loslassen: die abgöttische Liebe zu dem kaum gekannten Heldenvater und die Mischung aus Bewunderung und Abscheu gegenüber demjenigen, der einerseits Frankreich über alle anderen Länder erhoben hat und andererseits der »korsische Menschenfresser« war, der das Land ausblutete.
Unter der Restauration nahm die Gestalt des nach Sankt Helena verbannten Napoleons dann schnell umso mythischere Züge an, je unbeliebter die Bourbonen sich machten; Dumas schreibt dazu: »Es war so weit gekommen, dass meine Mutter und ich, trotz aller Gründe, die wir hatten, Napoleon zu verfluchen, allmählich die Bourbonen noch weit mehr verabscheuten, die uns kein Leid angetan hatten oder die uns eher mehr Gutes als Böses hatten angedeihen lassen.«
In seiner Geschichtsstudie Gaule et France von 1833 charakterisiert er Napoleon folgendermaßen:
»Drei Männer waren meiner Meinung nach von Gott dazu ausersehen, das Werk der [nationalen] Erneuerung zu vollbringen: Cäsar, Karl der Große und Napoleon.
Cäsar ebnet dem Christentum den Weg, Karl der Große der Zivilisation und Napoleon der Freiheit. [...]
Als Napoleon am 18. Brumaire Frankreich eroberte, war das Land noch im Fieberwahn des Bürgerkriegs befangen, und in seinem Überschwang hatte es sich so weit vor allen anderen Völkern vorgewagt, dass die anderen Nationen nicht mehr folgen konnten; das Gleichgewicht des allgemeinen Fortschritts war durch das Übermaß individuellen Fortschritts beeinträchtigt; Frankreich war freiheitstrunken, und die Könige befanden, dass man es anketten müsse, damit es zur Besinnung kam.
Napoleon betrat die Bühne mit seiner Doppelbefähigung zum Despoten und zum Feldherrn, seiner doppelten Natur volkstümlicher und aristokratischer Ausprägung, den Gedanken Frankreichs hinterherhinkend, aber den Gedanken Europas vorauseilend, Mann des Widerstrebens nach innen, Mann des Fortschritts nach außen.
In ihrer Verblendung bekriegten die Könige ihn!
Daraufhin nahm Napoleon, was Frankreich an Unverdorbenstem, Intelligentestem und Fortschrittlichstem zu bieten hatte, und bildete daraus seine Armeen, die er über Europa verbreitete; überall brachten sie den Königen den Tod und den Völkern den Lebensatem, überall, wo Frankreichs Geist weht, macht die Freiheit in seinem Gefolge einen gewaltigen Schritt und verstreut die Revolutionen im Wind wie ein Sämann den Weizen.
[Nach dem katastrophalen Russlandfeldzug] ist Napoleons Auftrag abgeschlossen und der Augenblick seines Sturzes gekommen, denn nun ist sein Sturz für die Freiheit so nützlich, wie es einst sein Aufstieg gewesen war. [...] Gott zieht seine Hand von Napoelon ab, und damit das göttliche Eingreifen in die menschlichen Belange auch klar zu erkennen ist, tragen nicht Menschen über andere Menschen den Sieg davon, sondern die Jahreszeiten verschwören sich gegen sie, Schnee und Eis machen ihnen den Garaus, die Elemente töten eine ganze Armee. [...]
So folgen mit neunhundert Jahren Abstand aufeinander und wie als lebender Beweis für unsere Worte, dass der herausragende Geist umso blinder ist, je herausragender er ist:
Cäsar, der Heide, der das Christentum einleitet,
Karl der Große, der Barbar, der die Zivilisation einleitet,
Napoleon, der Despot, der die Freiheit einleitet.
Wäre man nicht fast versucht zu glauben, es handelte sich um ein und denselben Mann, der zu bestimmten Epochen unter verschiedenen Namen erscheint, um ein und denselben Gedanken auszuführen?«
Dieser Sicht des Schicksals Napoleons als vorherbestimmt wird Dumas bis zuletzt treu bleiben – in seinem Theaterstück über Napoleon aus dem Jahr 1831 mit dem Titel Napoléon Bonaparte ou Trente ans de l’histoire de France ebenso wie in seinen historischen Porträts (Napoléon von 1839), seinen journalistischen Arbeiten und seinem Romanwerk, in dem Napoleon in Les Blancs et les Bleus und in Le Chevalier de Sainte-Hermine eine tragende Rolle spielt.
Der jüngere Monte Christo
Dem historischen Goliath Napoleon stellt Dumas in seinem letzten Roman einen erfundenen David gegenüber, Hector, den letzten Sprössling der Grafen von Sainte-Hermine, der seine Brüder und seinen Vater in dem Bürgerkrieg zwischen Republikanern und Royalisten verloren hat.
Wie Edmond Dantès im Graf von Monte Christo erlebt der junge Mann seine Kerkerhaft als seelischen Reifungsprozess, aus dem er als neuer Mensch hervorgeht, besser gesagt als Übermensch. Äußeres Indiz dieser Verwandlung ist der neue Name: Während der Plebejer Edmond Dantès sich den Titel eines Grafen von Monte Christo zulegt, entscheidet sich der Adelige Hector de Sainte-Hermine für den schlichten Vornamen René. In den drei Jahren, die Hector im Kerker verbringt, ist er ganz auf sich gestellt; Fouché, der aus der Ferne über sein Geschick wacht, ist kein Abbé Faria, der Edmond Dantès aktiv zu einer neuen Lebensperspektive verhilft.
Der junge Mann, der nach drei Jahren Kerkerhaft in die Welt zurückkehrt, hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, auf alle Hoffnungen und Wünsche verzichtet, und dieser Verzicht bedeutet zugleich eine Befreiung, denn Hector ist nicht nur desillusioniert, sondern auch aller Verpflichtungen ledig, die ihm Familientradition und Standeszugehörigkeit auferlegt hatten. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Hector grundlegend von Edmond Dantès: Den Grafen von Monte Christo treibt unstillbarer Rachedurst an, es all jenen heimzuzahlen, die ihm Unrecht getan haben, Hector hingegen, der »ohne Begeisterung und ohne Überzeugung« getan hatte, was ihm auferlegt worden war, kann das eigene Schicksal so kaltblütig und unbeteiligt betrachten wie die Weltgeschichte; sein künftiges Handeln ist nicht von persönlichen Motiven diktiert, sondern Ergebnis einer fast unpersönlichen, nahezu wissenschaftlichen Neugier. Hector kämpft weder für noch gegen Napoleon: Er ist Zeuge der Geschichte Napoleons.
Claude Schopp
Anmerkungen und Erläuterungen
Die Handlung ist in dem Zeitraum zwischen Februar 1801 und April 1809 angesiedelt; daneben gibt es zahlreiche Rückblenden in die Zeit der Französischen Revolution (1789 bis 1794) und des an die Revolutionsregierung anschließenden Direktoriums, das von Ende 1795 bis 1799 bestand und mit Napoleon Bonapartes Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November) 1799 gestürzt und durch die Regierungsform des dreiköpfigen Konsulats ersetzt wurde (mit Bonaparte als Erstem Konsul und einem Zweiten und Dritten Konsul mit lediglich beratender Stimme in den Regierungsgeschäften, die nicht ohnehin dem Ersten Konsul allein oblagen); nicht gespart wird mit Andeutungen, in denen die unheilschwangeren Worte Waterloo und Sankt Helena fallen.
Dumas beschäftigte sich leidenschaftlich und engagiert mit der Zeitgeschichte und recherchierte akribisch, wobei er die Hilfe eines ganzen Stabs bezahlter Mitarbeiter in Anspruch nahm. Die Beschreibungen von Bällen, Bespitzelungsaktionen, Gefechten, Hinrichtungen und Unterredungen der historisch verbürgten Personen halten sich äußerst zuverlässig an die von ihm verwendeten Dokumente, die der Herausgeber Claude Schopp überprüft und im Anhang aufgeführt hat.
Anmerkungen des Autors, wie sie in den Fortsetzungsabdrucken im Moniteur universel eingerückt waren, sind in Entsprechung dazu als Fußnoten aufgeführt. Für die deutsche Ausgabe wurde der Anmerkungsapparat des Herausgebers bearbeitet und ergänzt; nicht aufgenommen wurden Querverweise auf einzelne Passagen aus Romanen Alexandre Dumas’, die nur einem des Französischen mächtigen Leserkreis bekannt sein können. Eine Zeittafel wurde angefügt, um die Orientierung in einem Geschehen zu erleichtern, das der Autor kunstvoll und spannungsreich und nicht selten verwirrend mit häufigen Schauplatzwechseln und Zeitsprüngen erzählt. Französische Titel und Anredeformen wurden beibehalten. In der Originalausgabe wurden Flüchtigkeitsfehler beziehungsweise Druckfehler und orthographische Unklarheiten stillschweigend bereinigt; kleinere Unstimmigkeiten inhaltlicher Natur werden dem aufmerksamem Leser nicht entgehen – wenn eine Brigg sich unversehens in einen Kutter verwandelt, aus dreihundert Kombattanten vierhundert werden, wenn Bonaparte sich etliche Kapitel zu spät entsinnt, dass er früher einmal in Madame Permon verliebt war, oder wenn die Belagerung und Eroberung von Gaeta durch die Franzosen nach der Schlacht von Jena und Auerstädt stattfindet (und nicht ein halbes Jahr vorher), sind dies anschauliche Beispiele für die Arbeitsweise eines Verfassers von Fortsetzungsromanen, den in diesem Fall der Tod der Möglichkeit beraubte, vor einer Buchveröffentlichung Ungereimtheiten auszuräumen und Schönheitsfehler zu tilgen.
Das »Ausleihen« ganzer Kapitel aus früheren Dumas-Romanen, das akribische Nacherzählen von Reiseführern und ausgiebiges Zitieren und Paraphrasieren lassen sich mit der Erfordernis erklären, die täglichen Fortsetzungen zu liefern; Dumas befand sich wie üblich in Zeitnot und Geldnot, aber Krankheit und Erschöpfung erschwerten ihm in den letzten Lebensjahren seine Galeerensklaventätigkeit nicht unbeträchtlich. Für eine spätere Buchausgabe hätte er den Text seines letzten Romans vermutlich erheblich gestrafft und um allzu offenkundig entbehrliche Kapitel erleichtert.
Angaben zu deutschen Ausgaben der Quellen, die Dumas für seinen Roman verwendet hat, finden sich am Ende der Anmerkungen.
Kapitel 1: Joséphines Schulden
Die Selbstverständlichkeit, mit der Dumas schon auf der ersten Seite des Romans anspricht, dass das Romangeschehen fortsetzt, wovon die Romane Les Compagnons de Jéhu (erschienen 1857) und Les Blancs et les Bleus (erschienen 1867; der Titel spielt auf die Bezeichnungen für königstreue Rebellen und loyale Republikaner an) handelten, mag auf den ersten Blick befremden, doch ein so populärer Autor wie Dumas konnte sich darauf verlassen, dass seine vorausgegangenen Bürgerkriegsromane einem breiten Publikum vertraut waren.
Als Quelle für die Schilderung von Lebensumständen und Tagesablauf des Ersten Konsuls im Tuilerienpalast hat Dumas die Erinnerungen von Bonapartes Jugendfreund und zeitweiligem Sekretär Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne benutzt, die 1829 erschienen waren (Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’État, sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration); auf Bourriennes Erinnerungen basieren auch die Ausführungen zu Joséphines Verschwendungssucht.
Der Begriff Citoyen bezeichnete im späten 18. Jahrhundert den stimmoder wahlberechtigten Bewohner einer Stadt (cité); seit dem 10. Brumaire des Jahres II (31. Oktober 1793) waren per Dekret des Konvents Citoyen und Citoyenne als einzig erlaubte demokratische Anrede anstelle der verbotenen Formen Monsieur und Madame wie auch das Duzen anstelle des Siezens Vorschrift; unter Kaiser Napoleon I. wurden diese Verordnungen 1804 aufgehoben.
Der republikanische Kalender wurde am 5. Oktober 1793 vom Konvent verabschiedet und trat rückwirkend in Kraft – der erste Tag des Jahres eins der Republik war der 22. September (1. Vendémiaire) 1792, wobei zufälligerweise das Datum der Tag- und Nachtgleiche mit dem Datum der Erklärung der Republik identisch ist. Das Jahr hatte zwölf Monate und begann im Herbst mit dem »Weinlesemond« Vendémiaire, gefolgt von Brumaire (Nebelmonat), Frimaire (Reifmonat), Nivôse (Schneemonat), Pluviôse (Regenmonat), Ventôse (Windmonat), Germinal (Keimmonat), Floréal (Blütemonat), Prairial (Wiesenmonat), Messidor (Erntemonat), Thermidor (Hitzemonat) und Fructidor (Fruchtmonat). Der Monat bestand aus dreißig Tagen oder drei Dekaden, und am Jahresende wurde das Jahr durch fünf (in Schaltjahren sechs) Feiertage ergänzt, die Sansculotiden. Die Tage der Dekaden waren mit Ordnungsnamen bezeichnet: Primidi, Duodi usw., Ruhetage waren Quintidi und Dekadi.
Am 31. Dezember 1805 war es mit der republikanischen Zeitmessung vorbei. Während der Pariser Kommune 1871 wurde sie für kurze Zeit wiederbelebt.
Der Tuilerienpalast (zwischen Louvre und Tuileriengarten gelegen) wurde während der Pariser Kommune in Brand gesteckt und 1882 abgerissen.
Der Louisdor war die 1640 unter Ludwig XIII. eingeführte Hauptgoldmünze, ursprünglich im Wert von zehn Livres, die bis 1793 geprägt wurde; die 1803 erstmals ausgegebenen Goldmünzen im Wert von zwanzig Francs oder Livres wurden bald als Napoleondor, kurz Napoleon, bekannt. Der Franc oder Franken ist seit 1795 Einheit des französischen Münzfußes und entspricht zwanzig Sous oder hundert Centimes.
Kapitel 2: Wie es dazu kam, dass die Freie und Hansestadt Hamburg Joséphines Schulden bezahlte
Der Bittbrief zu Beginn des zweiten Kapitels entstammt wörtlich dem vierten Band der Erinnerungen Bourriennes.
Kapitel 3: Die Compagnons de Jéhu
Die konterrevolutionären Gruppierungen, die seit den ersten Tagen der Revolutionsregierung fern von Paris offen oder heimlich gegen den jakobinischen Obrigkeitsterror agitierten und kämpften, hatten wesentlich länger Bestand als ihre ursprüngliche Gegnerschaft.
Die Chouans (abgeleitet von chat-huant, »Waldkauz«, mit dessen Ruf die Chouans sich verständigten) waren bereits ab 1791 im Maine und in der Bretagne als Guerillabewegung aktiv; der große Aufstand in der benachbarten Vendée brach im März 1793 aus – nicht unbedingt aus Königstreue der Bauern und Landadeligen, sondern eher als Revolte gegen die neue wohlhabende Klasse der städtischen Bourgeoisie – und mündete in einen regelrechten Bügerkrieg, der am Jahresende mit der vernichtenden Niederlage der Aufständischen ein vorläufiges Ende fand; gegen die Partisanentrüppchen allerdings blieb die Regierung machtlos, und selbst der Genozid an der Bevölkerung durch die Vergeltungs- und Präventivschläge der berüchtigten, wahllos brandschatzenden und mordenden colonnes infernales des Generals Turreau konnte die immer wieder aufflackernden Unruhen nicht ersticken; erst Bonaparte gelang um 1800 eine Befriedung der Vendée durch Versöhnung.
Als terreur blanche wurden die Repressalien gegen die ehemaligen Terroristen jakobinischer Prägung bezeichnet, die im Frühsommer 1795 in Lyon, Marseille und Avignon ausbrachen; eine zweite, schwächere Welle erfasste im Sommer 1799 die Vendée, die Normandie, das Maine und abermals den Süden.
Den Namen der Compagnons de Jéhu (»Gefährten Jehus«), die in und um Lyon herum tätig waren, erklärt Dumas völlig zutreffend mit dem Zitat aus dem 2. Buch Richter, 9 und 10; es ist verblüffend, wie viele seriöse Historiker sich noch heute über den Ursprung dieser Bezeichnung den Kopf zerbrechen. Auf dem benachbarten Terrain der Provence und des Gard operierte die Compagnie du Soleil. Beide Insurgentenbewegungen wurden zweifellos von emigrierten Royalisten und von der englischen Regierung alimentiert.
Roland de Montrevel und Alfred de Barjols sind fiktive Figuren. Eine Dynastie de la Baume-Montrevel ist im frühen 17. Jahrhundert erloschen.
Kapitel 6: Der Kampf der Hundert
Bei der sogenannten Schlacht der Dreißig handelt es sich um eine Episode des bretonischen Erbfolgekriegs; am 27. März 1351 wurde dieser Kampf zwischen je dreißig Vertretern des französischen Heeres und der englischen Belagerer ausgefochten und von den Franzosen gewonnen.
Kapitel 8: Die Begegnung
Die in diesem Kapitel zitierten Meldungen des Moniteur sind von Dumas stark ausgeschmückt; die Zeitung Gazette nationale ou le Moniteur universel war anlässlich der Einberufung der Generalstände im Frühjahr 1789 gegründet worden und bildete seit Dezember 1799 das offizielle Organ der Republik.
Der erste Brief des späteren Ludwig XVIII. vom 20. Februar 1800 oder dem 1. Ventôse des Jahres VIII an Bonaparte ist nach Bourriennes Erinnerungen wiedergegeben, ebenso der zweite, nicht datierte, sowie Bonapartes Antwortschreiben vom 7. September 1800 (20. Fructidor VIII).
George Monk oder Monck, erster Herzog von Albemarle, General im englischen Bürgerkrieg, erreichte nach Cromwells Tod die Ablösung des Langen Parlaments durch ein neues Parlament, das zur Wiedereinführung der Monarchie verpflichtet war, und ermöglichte dadurch die Inthronisierung Karls II.
Das Sueton-Zitat (ornandum et tollendum) lautet korrekt: ornandum tollendumque (»schmücken und erheben«) und entstammt dem Abschnitt über Augustus in seinem Leben der Cäsaren (um 120 n. Chr. erschienen).; tollere heißt pikanterweise auch »aufknüpfen«.
Kapitel 9: Zwei Waffenbrüder
Madame de Sourdis und ihre Tochter Claire sind ebenso wie Hector de Sainte-Hermine und seine Familie fiktives Romanpersonal. Der Name Sainte-Hermine ist bei einem alten französischen Adelsgeschlecht aus der Vendée entlehnt, das allerdings keinen aktiven Konterrevolutionär zu seinen Mitgliedern zählte, aber mit einem Geschlecht der Sourdis verwandt war.
Kapitel 10: Zwei junge Mädchen
Von April bis August 1794 war Joséphine de Beauharnais im Carmes-Gefängnis inhaftiert; ihr Ehemann, vormals Kommandant der Rheinarmee, war am 5. Thermidor (23. Juli) im Rahmen der sogenannten Carmes-Verschwörung zusammen mit fünfundvierzig weiteren »Verschwörern« guillotiniert worden. Kinder aus vormals vornehmen Familien wurden in der Revolutionszeit umerzogen, indem man sie bei aufrechten Citoyens aus dem vierten Stand in die Lehre gab.
Kapitel 11: Der Ball bei Madame de Permon
Den Ball bei Madame de Permon hat Dumas aus zwei Bällen amalgamiert, die in den Erinnerungen der seinerzeitigen Debütantin Laure de Permon, der späteren Gattin Junots und noch späteren Herzogin von Abrantès, Erwähnung finden (Mémoires de Mme la duchesse d’Abrantès, ou Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration, Paris, 1835).
Kapitel 13: Die drei Sainte-Hermines: Der Vater
Dumas zitiert und entlehnt für dieses Kapitel aus seinem Roman Le Chevalier de Maison-Rouge. Als historisches Ausgangsmaterial für das Schicksal der Eltern Hector de Sainte-Hermines benutzt er die sogenannte Nelkenverschwörung, mittels deren im August 1792 Marie-Antoinette aus der Conciergerie befreit werden sollte; Alexandre Gousse oder Gonsse, der sich Chevalier de Rougeville nannte, und sein Helfer Michonis aus der Gefängnisverwaltung warfen zwei Nelken mit einem verborgenen Zettel in die Zelle der Königin, die durch den Gendarmen Gilbert antworten ließ, doch weiter gedieh das Befreiungsunternehmen nicht, denn es war bereits dem Wohlfahrtsausschuss denunziert worden; der »Chevalier« rettete sich nach Belgien.
Kapitel 14: Léon de Sainte-Hermine
Der Inhalt der Kapitel vierzehn bis neunzehn ist den zwei vorausgegangenen Bänden von Dumas’ Bürgerkriegstrilogie entlehnt.
Der junge Charles ist der Dichter Charles Nodier, dessen Erinnerungen (Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l’histoire de la Révolution et de l’Empire, Paris, 1831) Dumas für dieses und die folgenden Kapitel teilweise benutzt hat.
Die Abschiedsworte León de Sainte-Hermines zitieren die letzten Worte Karls I. von England vor seiner Enthauptung – »Erinnere dich«.
Kapitel 15: Charles de Sainte-Hermine (1)
Die Familie de Fargas ist fiktiv. Für die Szene der Ermordung des Vaters dürfte der Lynchmord an dem republikanischen Kanzleisekretär Nicolas-Jean-Baptiste Lescuyer im Oktober 1791 in Avignon Pate gestanden haben; Jules Michelet schildert ihn in seiner Geschichte der Französischen Revolution (6. Buch, 2. Kapitel) in aller Scheußlichkeit, und Dumas greift darauf in Les Compagnons de Jéhu zurück.
Kapitel 17: Die Höhlen von Ceyzériat
Die Abteikirche von Brou in Bourg-en-Bresse ist ein berühmtes spätgotisches Bauwerk; sie enthält die Grabmäler der Margarete von Bourbon, ihres Sohnes Philiberts des Schönen und Margaretes von Österreich, der Gemahlin Philiberts, die das vormalige Priorat Brou zu einer Klosteranlage ausbauen ließ und die prunkvolle Grabanlage in Auftrag gab, die drei überlebensgroße Grabplastiken von Conrat Meit enthält.
Bei der Gefangennahme der Compagnons de Jéhu wird Diana poetisch mit Racines mörderischer Liebesgöttin in Phädra verglichen, die sich an ihr Opfer krallt – »à sa proie attachée«.
Die Gefährten Charles de Sainte-Hermines in der Bruderschaft Jehu sind ebenso fiktiv wie er.
Kapitel 18: Charles de Sainte-Hermine (2)
Charles de Sainte-Hermines letzte Worte auf dem Schafott an seinen jüngeren Bruder sind eine Wiederholung der Worte Léon de Sainte-Hermines im vierzehnten Kapitel.
Kapitel 19: Hector de Sainte-Hermine
Der royalistische Bandit Jean-Charles Laurent findet in Charles Nodiers Erinnerungen Erwähnung; das Montaigne-Zitat entstammt dessen Essais (II, 17).
Kapitel 21: In welchem Kapitel Fouché daran arbeitet, in das Polizeiministerium zurückzukehren, aus dem er noch nicht ausgeschieden ist
Die Wahrsagerin und Kartenlegerin Marie-Anne-Adélaide Lenormand (»Sybille des Faubourg Saint-Germain«) begann ihre Karriere zur Zeit der Terreur und will unter anderen David, Marat, Robespierre, Saint-Just und Tallien geweissagt haben; nach dem Thermidor war sie die gefragteste Wahrsagerin der feinen Kreise, aber auch des Dienstpersonals – eine Kombination, die einem klugen Kopf nur nützen konnte; Joséphine war ihre treueste Stammkundin, Fouché und Talleyrand erpressten sie und benutzten sie als Informantin. Sie hat umfangreiche Erinnerungen hinterlassen, am berühmtesten darunter zwei Bände Enthüllungen mit dem Titel Mémoires historiques et secrets de l’impératrice Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-la-Pagerie, première épouse de Napoléon (Paris, 1820).
Kapitel 24: Gegenordre
Bonaparte vergleicht Cadoudal in seinem Zornesausbruch mit dem berühmten Wegelagerer des Ancien Régime Louis Mandrin (1725-1755), der einen Kleinkrieg gegen die Generalpächter im Südosten Frankreichs führte, und mit dem weniger berühmten, aber zeitgenössischeren Einbrecher und Dieb Jean Chevalier, genannt Poulailler, der 1786 gehängt wurde.
Fouchés Spitzel Victor mit dem Beinamen »der Limousiner« ist eine fiktive Figur, für deren frappierende Verwandlungskünste der legendäre Polizeispitzel und Geheimpolizist François Vidoqc Pate gestanden haben dürfte.
Kapitel 25: Der Herzog von Enghien (1)
Die Entfernung zwischen Ettenheim und Straßburg beträgt nicht zwanzig, sondern mehr als fünfzig Kilometer.
Die Geheimgesellschaft der »Philadelphes«, von der Sol de Grisolles dem Herzog von Enghien erzählt, ist mit keiner der Freimaurerlogen gleichen Namens identisch und wohl kaum mit der Société des Philadelphes, die der sechzehnjährige Charles Nodier gründete und deren Mitglieder einem Tugend- und Freundschaftskult mit viel zahlenmystischem Hokuspokus huldigten; Claude Schopp charakterisiert sie als »Zusammenschluss von Royalisten und Republikanern, die ihr Hass auf Bonaparte einte und die bis in die Kaiserzeit Verschwörungen anzettelten, die nie weit gediehen«.
Kapitel 27: Die Höllenmaschine
Die Verschwörung einiger Jakobiner und Babeuf-Anhänger unter Anführung des korsischen Offiziers Joseph-Antoine Aréna – von Bonaparte nach dem Staatsstreich des 18. Brumaire seiner Ämter enthoben -, welche zum Ziel hatte, während eines Opernbesuchs im Oktober 1800 den Ersten Konsul zu beseitigen, wurde als conspiration des poignards »Verschwörung der Dolche« bekannt; sie war nicht sehr ernst zu nehmen und wurde umgehend durch die Polizei vereitelt; die Beteiligung des Bildhauers Ceracchi und des Malers Topino-Lebrun ist ebenso zweifelhaft, wie offenkundig ist, dass diese laienhafte Konspiration nichts mit dem Sprengstoffattentat zwei Monate später zu tun hat; am 31. Januar 1801 wurden Aréna, Ceracchi, Demerville (ehemaliger Sekretär des einstigen Wohlfahrtsausschussmitglieds Bertrand de Barère, dem diese Entsorgung eines potentiell gefährlichen Mitwissers seiner Vergangenheit sicherlich nicht ungelegen kam) und Topino-Lebrun guillotiniert.
Mit »September-Blutsäufern« meint Bonaparte in seinem Wutausbruch jene »sansculottischen Patrioten«, die, von Danton angestachelt, in den ersten Tagen des Septembers 1792 in mehreren Pariser Gefängnissen ein fürchterliches Gemetzel anrichteten, weil das Gerücht umging, unter den Gefangenen befänden sich gefährliche, bis an die Zähne bewaffnete Konterrevolutionäre, die einen konzertierten Ausbruch nebst darauffolgender Machtergreifung planten; als »Versailles-Mörder« bezeichnet er diejenigen, die am 6. Oktober 1798 die königliche Familie aus Versailles nach Paris brachten, »31.-Mai-Briganten« bezieht sich auf den Aufstand der Pariser Kommune gegen den Konvent im Mai 1793, und die »Prairial-Verschwörer« sind die Pariser Sansculotten, die im Mai 1795 mit der Losung »Brot und Verfassung!« den Konvent stürmten, den Abgeordneten Féraud ermordeten, seinen Kopf auf eine Pike spießten und ihn dem Vorsitzenden Boissy d’Anglas präsentierten.
François-Noël (genannt Gracchus) Babeuf und seine Mitangeklagten kennt man unter dem Begriff der »Verschwörung der Gleichen« – die Verschwörung beschränkte sich auf die Bildung eines »Geheimdirektoriums der Wohlfahrt«, das mit Pamphleten und Anschlägen das Pariser Volk »revolutionieren« wollte; das echte Direktorium verstand in Sachen soziale Revolution keinen Spaß und nutzte die Gelegenheit, sich sogenannter Verschwörer zu entledigen; von den rund fünfzig Angeklagten wurden nur Babeuf und ein Mann namens Darthé zum Tode verurteilt und nach einem Selbstmordversuch am 26.5.1797 guillotiniert.
Kapitel 28: Die wahren Schuldigen
Die Erinnerungen Charles Desmarets’, des Chefs der Geheimpolizei während der Zeit des Konsulats und des Kaiserreichs, aus denen Dumas in diesem und den folgenden Kapiteln schöpft, sind unter dem Titel Témoignages historiques, ou Quinze ans de haute police sous Napoléon 1833 erschienen.
Die Liste der Verschwörer, die an dem Attentat mit der »Höllenmaschine« beteiligt waren, umfasst Pierre Robinault de Saint-Régeant (oder Réjant), Pierre Picot de Limoëlan, Georges Cadoudal, Jean-Baptiste Coster, genannt Saint-Victor, Joyaux d’Assas, Jérôme Pétion de Villeneuve, Lahaye Saint-Hilaire und den in Paris angeheuerten Chouan François-Joseph Carbon.
Die Notiz im Moniteur über die Hinrichtung der zwei Attentäter ist ein klein wenig umfangreicher als zitiert und lautet: »Das Kassationsgericht hat das Urteil bestätigt, das vom Kriminalgericht des Seine-Bezirks über die Angeklagten verhängt wurde, die des Attentats auf die Person des Ersten Konsuls am Abend des vergangenen 3. Nivôse für schuldig befunden wurden. Carbon und Saint-Régeant haben heute die Todesstrafe erlitten.«
Kapitel 29: König Ludwig von Parma
Im XIX. Gesang der Odyssee (Vers 560-569) spricht Penelope von den zwei Pforten des Schlafs aus Horn und aus Elfenbein, aus denen die wahren und die trügerischen Träume kommen; Vergil hat diese Stelle fast wörtlich in die Äneis übernommen (VI. Buch, Vers 893-896); bei Dumas ist die Anspielung obendrein eine versteckte Hommage an den toten Freund Gérard de Nerval, dessen Erzählung Aurélia mit diesem Bild beginnt (»Der Traum ist ein zweites Leben. Nie konnte ich ohne Zittern die hörnerne oder die elfenbeinerne Pforte durchqueren, die uns von der Welt des Unsichtbaren tennen«).
Am 13. Vendémiaire im Jahr III (5. 10. 1795) schlug Bonaparte mit bewaffneten Einheiten im Auftrag des Direktoriumsmitglieds Paul-François (Vicomte de) Barras den royalistischen Aufstand einiger Pariser Sektionen nieder; am 18. Fructidor im Jahr V (4. 9. 1797) kam es zu einem republikanischen Staatsstreich des Direktoriums, in dessen Folge royalistische Abgeordnete verhaftet und Royalisten deportiert wurden.
Henri du Vergier, Graf von La Rochejacquelein, Charles-Melchior-Artus, Marquis de Bonchamps, Maurice-Joseph-Louis Gigost d’Elbée, François-Athanase de Charette de la Contrie und Louis-Marie, Marquis de Lescure, sind berühmte, ja legendäre, aber historisch verbürgte Vendée-Anführer, Valensolles, Jahiat, Ribier und Sainte-Hermine sind fiktive.
Metge, Veycer und Chevalier sind jakobinische »Verschwörer«, die im Januar 1801 im Zuge von Napoleons gnadenlosem Abrechnen mit Linksextremisten hingerichtet wurden – Metge war Verfasser glühender antibonapartistischer Pamphlete, Chevalier ein Chemiker, der mit Sprengstoffen experimentiert und sich damit als Bombenbauer verdächtig gemacht hatte.
Bei dem Herzog von Rovigo, Napoleons ehemaligem Adjutanten, handelt es sich um Anne-Jean-Marie-René Savary, aus dessen Erinnerungen Dumas hier zitiert (Mémoires du duc de Rovigo pour servir à l’histoire de l’empereur Napoléon, Paris, 1828).
Kapitel 30: Jupiter auf dem Olymp
Thomas Alexandre Davy de La Pailletterie (kurz: Alexandre) Dumas, Vater des Verfassers, Sohn einer farbigen Mutter und eines französischen Adeligen, wurde mit Mutter und Geschwistern vom Vater an einen anderen Plantagenbesitzer auf Santo Domingo verkauft, erhielt 1791 die Freiheit und brachte es durch Tapferkeit und Wagemut früh zum General; in Ägypten schlug er den Aufstand von Kairo nieder, geriet auf der Rückkehr in österreichische Gefangenschaft, kehrte krank (infolge mehrerer Vergiftungsversuche) nach Frankreich zurück und wurde 1802 in den Ruhestand verabschiedet, weil er aus seinem Missvergnügen an Napoleons Regime kein Geheimnis machte.
Die Note des englischen Königs an das Parlament zitiert Dumas nach dem von ihm in diesem Kapitel erwähnten Geschichtswerk Histoire du Consulat et de l’Empire (1845-62) von Adolphe Thiers, das auch die Quelle für die Tiraden ist, mit denen Bonaparte den englischen Gesandten überschüttet.
Kapitel 31: Der Krieg
Joachim Murat, Junots Nachfolger als Gouverneur von Paris, war mit Bonapartes Schwester Caroline verheiratet.
Capucinades – Kapuzinaden oder Kapuzinerpredigten – sind derbkomische Strafpredigten, wie in manchen Orden üblich und besonders durch Abraham a Sancta Clara berühmt geworden.
Kapitel 32: Die Polizei des Citoyen Régnier und die Polizei des Citoyen Fouché
Neben den Erinnerungen Desmarets’ und Savarys dient Dumas als Quelle für die »Höllenmaschinen-Verschwörung« Deux conspirations sous l’Empire des mit ihm befreundeten Émile Marco de Saint-Hilaire (1845).
In Georges Cadoudal et la chouannerie (Paris, 1887) sind folgende Royalisten als diejenigen genannt, die am 21. August 1803 bei Biville an Land gingen: Hermely, Lahaye Saint-Hilaire, Brèche, Joyaux, Querelle, Troche junior und Cadoudals Diener Louis Picot.
Kapitel 33: Das Nest ist leer
Ein Manuskript Bonapartes, mit dem Schiff Le Héron von Sankt Helena nach Frankreich gebracht, konnte Claude Schopp nicht ausfindig machen.
Kapitel 34: Die Enthüllungen eines Gehenkten
Der Brief Bouvet de Loziers findet sich in Deux conspirations von Marco de Saint-Hilaire (unter Kapitel 32 aufgeführt).
Kapitel 36: Georges
Die Assassinen (»Haschischraucher«) spalteten sich im 11. Jahrhundert als Geheimbund von den schiitischen Ismailiten ab; Alter vom Berge (Scheich-al-Djebel, wörtlich: »Gebieter des Gebirges«) ist die Bezeichnung für das Oberhaupt der Assassinen im syrischen Bergland; die Assassinen bekämpften muslimische Fürsten und Kreuzfahrer mit gedungenen Meuchelmördern.
Kapitel 37: Der Herzog von Enghien (2)
Der »aberwitzige Komet von 1811«, den Bonaparte mit seinem Glücksstern verwechselt, ist die Geburt seines legitimen Sohnes, des »Königs von Rom«.
Die Briefe des Herzogs und des Prinzen von Condé konnte Dumas in der Veröffentlichung Le Duc d’Enghien, épisode historique du temps du Consulat von Émile Marco de Saint-Hilaire (1843) nachlesen.
Charles-François Du Périer, genannt Dumouriez, hatte unter dem Ancien Régime seine Karriere als militärischer Geheimagent begonnen, sie als »revolutionärer Patriot« fortgesetzt und war im April 1793 zu den Österreichern übergelaufen; sein Name war keine Empfehlung.
Chateaubriands Erinnerungen, Reiseerlebnisse und Reflexionen in diesem und den folgenden Kapiteln entstammen paraphrasiert und wörtlich (wenn auch nicht immer als Zitat erkennbar) dessen Essai historique, politique et moral (1797), Erinnerungen (1848-50) und Reise in Amerika (1827). Die durchgehende Selbststilisierung ihres Verfassers ist nicht unbedingt Garant für größtmögliche historische Akkuratesse: Für die Altersgleichheit mit Bonaparte musste Chateaubriand sich um ein Jahr verjüngen, der Besuch bei Washington fand in Washingtons Abwesenheit statt, und Chateaubriands Gespräche mit bedeutenden Zeitgenossen sind in seiner Wiedergabe, gelinde gesagt, farbig ausgeschmückt.
Kapitel 38: Chateaubriand
Die Darstellung von Jakobinern und Cordeliers ist ein Pasticcio der entsprechenden Passagen in Chateaubriands Erinnerungen und der Kapitel über Jakobiner und Cordeliers in Jules Michelets Geschichte der Französischen Revolution (4. Buch, 5. und 6. Kapitel).
Die Assignaten, das Papiergeld der Revolutionszeit, waren 1789 auf die enteigneten geistlichen und königlichen Güter in Umlauf gesetzt worden, in kurzer Zeit fast völlig entwertet und wurden 1796 durch eine neue Papierwährung ersetzt.
Chateaubriands exotisch-romantische Erzählung Atala erschien 1801 mit großem Erfolg, seine ein Jahr später veröffentlichte Schrift Der Geist des Christentums wurde ebenfalls begeistert aufgenommen; in diese Schrift waren Atala, Les Natchez und René eingefügt.
Der Begriff »das Infame« in der Unterhaltung Bonapartes mit Chateaubriand bezieht sich auf Voltaires Motto Écrasez l’infâme (sehr frei interpretierbar als: »Rottet den abscheulichen Aberglauben aus, denn nichts anderes ist die Religion«).
Die Guillotine, ursprünglich Louison (nach ihrem Erfinder, dem Instrumentenbauer Antoine Louis), befand sich seit dem Sturz der Robespierristen wieder auf dem Grève-Platz vor dem Pariser Rathaus.
Kapitel 39: Die römische Gesandtschaft
Die Fürstin Borghese, der Chateaubriand in Rom seine Aufwartung macht, ist niemand anders als Bonapartes Schwester Pauline, vormalige Madame Leclerc, die nach dem Tod des Generals 1803 den Principe Camillo Borghese heiratete.
Die schwindsüchtige Pauline de Beaumont war Chateaubriands Gönnerin und Geliebte; nach ihrem Tod in Rom ließ er in der Kirche San Luigi dei Francesi ein marmornes Grabmal für sie errichten und mit der griechischen Grabinschrift versehen, die Dumas zitiert.
Die schmeichlerische Widmung Chateaubriands an den Ersten Konsul war nur in der zweiten Auflage von Der Geist des Christentums aus dem Jahr 1803 enthalten.
Kapitel 40: Der Entschluss
Napoleons Tobsuchtsanfall ist Lesefrucht des von seinem letzten Sekretär Emmanuel de Las Cases verfassten und 1823 zuerst erschienenen Mémorial de Sainte-Hélène (Eintragung vom 20. 11. 1816).
Bourrienne hat in diesem Kapitel einen Nachfolger in Napoleons Diensten, weil er wegen Unterschlagungen im großen Stil (und deren Aufdeckung) entlassen worden war.
Marie Nicolas Sylvestre Guillon war Bibliothekar und Hauskaplan der Prinzessin von Lamballe, die bei den Septembermassakern 1792 im Gefängnis La Force ermordet wurde. Seine Wendigkeit ermöglichte ihm, danach unter Napoleon, den Bourbonen und dem Haus Orléans Karriere zu machen. Sein Namensvetter ist Abbé Aimé Guillon, genannt de Montléon, aus Lyon, erbitterter Konterrevolutionär, der eine Geschichte Lyons unter der Revolution verfasst hat, die trotz ihrer Einseitigkeit eine wertvolle Quelle ist.
Der Eridanos ist ein mythischer Strom und als Gottheit Sohn des Okeanos und der Thetys; geographisch wurde er oft mit dem Po gleichgesetzt. Pontos Euxeinos ist das Schwarze Meer.
Kapitel 41: Der schmerzensreiche Weg
Als Quellen für die Darstellung von Entführung und »Hinrichtung« des Herzogs von Enghien dienen Dumas Bourriennes Erinnerungen, der unter dem 37. Kapitel erwähnte, von Marco de Saint-Hilaire herausgegebene Dokumentenband (Deux conspirations) und die unter Kapitel 29 genannten Erinnerungen A. J. M. R. Savarys (Mémoires du duc de Rovigo).
Der Hund des Herzogs von Enghien hieß nicht Fidèle, sondern Mohiloff (Helmut Domke: Der Tod des Herzogs von Enghien, München, 1984), aber vielleicht wählte Dumas den Namen Fidèle als Reminiszenz an den treuen Hund aus Bernardin de Saint-Pierres Roman Paul und Virginie, den er in den Kapiteln 60 und 61 ausführlich würdigt.
Kapitel 42: Selbstmord
In diesem und den folgenden Kapiteln hält Dumas sich eng an die vorab erwähnten Quellensammlungen von Desmarets (Témoignages historiques) und Marco de Saint-Hilaire (Deux conspirations) sowie an Charles Nodiers Erinnerungen (unter dem 14. Kapitel erwähnt).
»Incroyables« und »Merveilleux« sind die Stutzer oder Gecken und ihre weiblichen Pendants, die »Merveilleuses«, zur Zeit des Direktoriums, auf zahlreichen Stichen mit spöttischen Bildlegenden verewigt.
Thags oder Thugs ist der Name einer indischen Raubmördersekte, deren Mitglieder mit seidenen Schlingen Reisende erdrosselten, um sie der Göttin Kali als Opfer darzubringen; um die Mitte des 19. Jahrhunderts rotteten die Engländer sie aus.
Der Spieler ist die Hauptfigur des gleichnamigen Theaterstücks von Jean-François Regnard (1696); sein Diener hält ihm anhand eines Seneca-Traktats eine Standpauke.
Der »Selbstmord« Pichegrus im Gefängnis bleibt so mysteriös, wie es Dumas’ akribische Schilderung der rekonstruierten Todesumstände vermuten lässt.
Kapitel 44: Das Temple-Gefängnis
Neben den bereits genannten Quellen hat Dumas für dieses Kapitel die Erinnerungen des royalistischen Agenten Abraham-Louis Fauche, genannt Fauche-Borel, verwendet (Mémoires de Fauche-Borel, Paris, 1829).
Moreau hatte keinen Sohn, sondern eine Tochter.
Kapitel 45: Das Gericht
Die Wiedergabe von Verhören, Prozessführung und Hinrichtung in den folgenden Kapiteln stützt sich auf Marco de Saint-Hilaires Deux conspirations und auf Bourriennes Erinnerungen.
Kapitel 46: Das Urteil
Paul Pélisson oder Pellisson, königlicher Rat unter Ludwig XIV., wurde für vier Jahre in der Bastille eingekerkert, weil er für seinen Freund, den Finanzminister Nicolas Fouquet, eingetreten war, nachdem der König diesen unter fadenscheinigen Vorwänden zu lebenslanger Haft verurteilt hatte; Fouquet war so unvorsichtig gewesen, mit Vaux le Vicomte ein Schloss- und Gartenensemble anlegen zu lassen, das Versailles in den Schatten stellte; als Minister hatte er Neid und Missgunst Colberts geweckt, den es nach seinem Posten gelüstete.
Kapitel 47: Die Hinrichtung
Die Schreckensherrschaft oder Terreur wurde vom Wohlfahrtsausschuss offiziell am 5. September 1793 in Kraft gesetzt, als ultima ratio gegen die äußere und innere Bedrohung der Republik; sie bedeutete Notstandsgesetze, Sondergerichte, Verhaftung (und Hinrichtung) auf bloßen Verdacht bzw. bloße Denunziation hin und dergleichen mehr; sie endete am 11. Thermidor des Jahres II (29. 7. 1794) nach Sturz und Guillotinierung der Robespierristen (9. und 10. Thermidor) mit einer letzten Hinrichtungsorgie an siebzig Kommunemitgliedern.
Am 18. 5. 1804 hatte sich Napoleon per Senatsbeschluß zum Kaiser erklären lassen.
Im 26. Kapitel wird Hector de Sainte-Hermine in Vincennes eingekerkert, nicht im Abbaye-Gefängnis.
Kapitel 48: Nach drei Jahren Kerkerhaft
Haidar, Heider oder Hyder Ali, muslimischer Herrscher des südindischen Fürstentums Mysore, bekriegte die Briten mit Unterstützung der Franzosen; sein Sohn Tipu Sahib oder Tipu Sultan setzte die Feldzüge fort und besiegte die Briten 1783. Vizeadmiral Pierre André de Suffren, der spätere Bailli de Suffren, war Haidar Alis Verbündeter auf französischer Seite. Joseph Dupleix war Gouverneur von Pondicherry und Generalgouverneur der französischen Kolonien in Indien, Marquis Charles de Bussy war französischer Feldmarschall, der für Dupleix und die Compagnie des Indes (die französische Ostindienkompanie) gegen die englische Ostindienkompanie, die East India Company, kämpfte.
Kapitel 49: Saint-Malo
Das umfangreiche Wissen über Geschichte und Topographie Saint-Malos, das Dumas in diesem und den folgenden Kapiteln entfaltet, verdankt sich höchstwahrscheinlich nicht allein entsprechender Lektüre; vermutlich unternahm Dumas im Mai 1869 eine Reise nach Saint-Malo, um dort zu recherchieren; einen Beweis seines Aufenthalts liefert ein Brief an den Archivar des Marineministeriums Pierre Margry, in dem er seinen Aufenthalt explizit erwähnt.
Der Benediktinermönch Matthew Paris ist ein bedeutender Geschichtsschreiber und Kartograph des frühen 13. Jahrhunderts, beliebt seines lebendigen, anschaulichen Stils wegen.
Het Zwin oder der Swin ist eine im 16. Jahrhundert versandete belgisch-niederländische Nordseeflussmündung.
»Ligue du Bien public« nannte sich der Zusammenschluss französischer Fürsten unter Karl dem Kühnen von Burgund zu einer Adelsrevolte gegen Ludwig XI., weil die Adeligen ihre Vorrechte durch den König geschmälert sahen.
Neufundland wurde je nach Überlieferung von den Wikingern um das Jahr 1000 oder etwas später von isländischen, baskischen, französischen oder portugiesischen Fischern entdeckt; verbürgt ist, dass Giovanni Caboto unter dem Namen John Cabot 1497 die englische Flagge auf neufundländischem Boden hisste; Baccalaos oder Isla dos Bacalhao wurde die Insel von den Europäern der frühen Neuzeit genannt (bacalao, bacalhau oder baccalà heißt der gesalzene, getrocknete Kabeljau auf Spanisch, Portugiesisch und Italienisch, wohl abgeleitet von dem lateinischen baculus, Stock), denn die Gewässer vor Neufundland waren für geradezu märchenhafte Kabeljaubestände berühmt. – Dumas kehrt Ursache und Wirkung um: Der Stockfisch heißt nicht nach der Insel (manche halten Baccalao sogar für ein indianisches Wort), sondern die Insel nach der transporttauglichen Dörrform des Kabeljaus.
Ligisten sind in diesem Fall die Anhänger der 1576 in Frankreich ins Leben gerufenen »heiligen Liga« zur Bekämpfung der Hugenotten.
René Duguay-Trouin war Marineoffizier und erfolgreicher Korsar; er eroberte 1711 Rio de Janeiro. Der Name René, den Hector de Sainte-Hermine sich in seinem neuen Leben zulegt, symbolisiert die Zerrissenheit oder Dialektik des Helden: einerseits verträumt, melancholisch und lebensüberdrüssig, wie René de Chateaubriand sich selbst darzustellen liebte, andererseits modern, zupackend und tatkräftig wie der Korsar René Duguay-Trouin.
Jean-Baptiste Le Carpentier rühmte sich vor dem Konvent, in seiner Eigenschaft als Konventskommissar (und nicht Prokonsul) in Saint-Malo »mittels revolutionärer Säuberungsmaßnahmen die Aristokratie, den Föderalismus und den Aberglauben mit Stumpf und Stiel ausgerottet« zu haben; von Ende 1793 bis Juli 1794 brachte er es auf dreihundert Guillotinierungen; zurückbeordert wurde er 1794 nach dem Sturz Robespierres.
Kapitel 50: Die Herberge der Madame Leroux
Die Revenant ließ Robert Surcouf, der berühmte Korsar im Dienst Napoleons, erst im Frühjahr 1807 vom Stapel. Für dieses und die folgenden Kapitel benutzt Dumas die Dokumentensammlung Histoire de Robert Surcouf capitaine de corsaire (hrsg. von Charles Cunat, 1842) sowie Louis de Garnerays zweibändiges Werk Voyages, aventures et combats (Band 1: Corsaire de la République, Band 2: Le Négrier de Zanzibar) als lockeren Leitfaden durch das Leben des Seeräubers. Karl May hat 1882 unter dem Pseudonym Ernst von Linden die Erzählung Robert Surcouf. Ein Seemannsbild veröffentlicht.
Kapitel 51: Die falschen Engländer
Île de France hieß die Insel Mauritius von 1715 bis 1810.
Das in diesem Kapitel geschilderte Abenteuer firmiert in keinem der historischen Werke über Surcouf.
Kapitel 54: In See gehen
Joseph de Boulogne de Saint-George, genannt Chevalier de Saint-George, Sohn eines Adeligen und einer farbigen Sklavin, war ein berühmter Komponist und Fechtvirtuose, Freund und Förderer des späteren Generals Alexandre Dumas; anlässlich der Wiedereinsetzung der Sklaverei in den französischen Kolonien und des Verbots von Eheschließungen zwischen Weißen und Farbigen hielt Napoleon I. es für ratsam, nicht nur sämtliche Schriften des gefährlichen farbigen Aufrührers Toussaint l’Ouverture (der 1791 einen erfolgreichen Sklavenaufstand auf Santo Domingo angeführt und die Unabhängigkeit der Insel eingeleitet hatte) verbrennen zu lassen, sondern auch die des Chevaliers de Saint-George.
Baptiste-Pierre-François Bisson war für seine Tapferkeit im Feld als Revolutionssoldat und als Offizier unter Napoleon ebenso berühmt wie für seine Fress- und Saufgelage; Jean-Anthelme Brillat-Savarin hat ihn in seiner Physiologie des Geschmacks (1825) literarisch verewigt – »General Bisson, der täglich acht Flaschen Wein zum Frühstück trank, sah aus, als rühre er nichts an«.
Kapitel 57: Das Sklavenschiff
Die Sklaverei in den französischen Kolonien wurde allen Bemühungen der von Brissot 1788 in Paris gegründeten Gesellschaft zur Befreiung der Schwarzen zum Trotz und dank erfolgreicher Intervention der Verteidiger der Sklaverei, die sich 1789 zu der Société correspondante des colons français zusammengeschlossen hatten, erst im Februar 1794 vom Konvent aufgehoben; schon im Mai 1802 führte Bonaparte sie wieder ein, und endgültig beseitigt wurde sie nicht vor 1848. England verbot den Sklavenhandel englischer Schiffe im Jahr 1807, die Sklaverei selbst duldete es in seinen Kolonien noch bis weit ins 19. Jahrhundert. In dänischen und niederländischen Kolonien wurde die Sklaverei 1848 und 1863 abgeschafft, auf den spanischen Besitzungen Kuba und Puerto Rico 1870/73 und in Brasilien 1888.
Kapitel 59: Die Île de France
Mascarenhas oder Maskarenen lautet die Bezeichnung der Inselgruppe, die aus Mauritins, La Réunion und Rodriguez besteht; Mauritius, die größte der drei Inseln, wurde gegen 975 von den Arabern entdeckt und Dina Arobi (Silberinsel) genannt, 1507 von den Portugiesen entdeckt und Ilha do Cirne oder Cerne (Schwaneninsel) genannt, 1598 von den Holländern übernommen und Mauritius genannt, 1715 den Franzosen überlassen und zu Île de France umbenannt, 1810 an England abgetreten und wieder Mauritius genannt; La Réunion wurde 1507 nach ihrem portugiesischen Entdecker Mascarenhas getauft, 1638 von den Franzosen annektiert und Île de Bourbon genannt, 1793 in Île de Réunion umgetauft und zum französischen Departement erklärt, 1803 zur Kolonie zurückgestuft; Rodriguez, die kleinste der Maskarenen-Inseln, heißt seit 1507 unverändert Rodriguez.
François Leguat, ein hugenottischer Flüchtling, bereiste Ende des 17. Jahrhunderts die Inselgruppe der Maskarenen und veröffentlichte 1708 einen Bericht seiner Reiseabenteuer und seiner naturkundlichen Beobachtungen (Voyages et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux isles désertes des Indes orientales.)
Die Anspielung auf die Ehrenrettung Bertrand-François Mahé de Ra Bourdonnais’ durch die Literatur bezieht sich auf seine achtungsvolle und bewundernde Erwähnung in Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierres Roman Paul und Virginie (1788); die herzergreifende Geschichte des jungen Liebespaares mit ihrem tragischen Ende ist auf Mauritius zur Zeit Mahé de la Bourdonnais’ angesiedelt; der Verfasser kannte die Insel aus eigener Anschauung und machte sie mit seinem Roman weltberühmt.
Kapitel 60: An Land
Die Umstände der Veröffentlichung von Paul und Virginie erzählt Dumas in enger Anlehnung an die diesbezüglichen Auslassungen des Verfassers in seinem umfangreichen Vorwort zu Paul und Virginie von 1806, das mit einer blumigen Widmung an die Adresse Napoleons und Joseph Bonapartes endet (beziehungsweise beinahe endet, denn angefügt ist eine umfangreiche Darlegung des irrsinnigen Systems, mit dem Bernardin de Saint-Pierre durch eine ganz eigene Kosmologie die Naturwissenschaften zu revolutionieren gedachte und dessen hartnäckige Propagierung seinem Ansehen nicht sehr zuträglich war).
Da Bernardin de Saint-Pierre in der Einleitung zu Paul und Virginie beteuert, eine wahre Begebenheit zu berichten, ist es wenig verwunderlich, dass Lebensstationen und Gräber der Protagonisten zu besichtigen sind; die landschaftlichen Bezeichnungen gehen allerdings nicht auf die Erzählung zurück.
Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, tat in einem ihrer Briefe die berühmte, wenn auch unzutreffende Prophezeiung: »Racine passera comme le café« (der Tragödiendichter Racine wird ebenso aus der Mode kommen wie der Kaffeegenuss).
Armenien, Anatolien, das Quellgebiet von Euphrat und Tigris, aber auch das tiefer gelegene Zweistromland gehören zu den immer wieder genannten Kandidaten derjenigen, die einen geographisch lokalisierbaren Garten Eden beweisen wollen, so wie Santorin (Thera) zu den Inseln zählt, in denen man Atlantis vermutet.
Kapitel 61: Die Rückkehr (1)
Charles-Marie-René Leconte, genannt de Lisle (weil er von der Île de Bourbon stammt), wurde 1877 – sieben Jahre nach Dumas’ Tod – erstmals für die Académie Française vorgeschlagen, doch erst 1886 auf den Sitz des verstorbenen Victor Hugo gewählt; Dumas’ Spekulation, die an das Zitat aus dem Gedicht des Freundes anschließt, war wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl. Das Gedicht ist eine Hommage an die Jugendliebe des Dichters, seine Cousine Elixène.
Kapitel 64: Die malaiischen Piraten
Perahu Besar ist die malaiische Bezeichnung für »großes Schiff«.
»Veillons au salut de l’Empire« ist eine Arie aus Nicolas-Marie Dalayracs komischer Oper Renaud d’Ast aus dem Jahr 1787, deren Libretto 1791 dem politischen Zeitgeschmack angepasst wurde.
Kapitel 65: Die Ankunft
Zu Anfang des 14. Kapitels erzählt Hector seiner Verlobten, wie sein Vater nach dem erfolglosen Versuch, Marie-Antoinette zur Flucht zu verhelfen, guillotiniert wurde, seine Mutter einige Zeit darauf an Gram und Herzeleid starb und seine älteren Brüder danach im Kampf gegen die Republik ihr Leben ließen; hier ist die Reihenfolge verändert.
Hélène zitiert Hamlet, der zu Rosenkranz und Güldenstern (2. Aufzug, 2. Szene, in der Fassung von A. W. von Schlegel und L. Tieck) sagt: »O Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären.«
»Une fièvre brûlante« entstammt André-Erneste-Modeste Grétrys komischer Oper Richard Cœur-de-Lion, »Dernière pensée« ist die Umwandlung eines frühen Trios oder einer Variation für Klavier des (1786 geborenen) Wunderknaben Carl Maria von Weber zu einem Lied; in Paris beliebte Komponisten der Zeit um 1800 waren Cherubini, Gossec, Grétry, Lesueur und Méhul.
André-Marie de Chénier, Mitglied im gemäßigten Club der Feuillants, wurde 1794 kurz vor dem Sturz Robespierres guillotiniert, nachdem er die Jakobiner immer wieder mit heftigen polemischen Artikeln angegriffen hatte; sein dichterisches Werk war nur in Auszügen bekannt und wurde 1819 posthum veröffentlicht; Charles-Hubert Millevoye hingegen war um 1800 einer der bekanntesten und beliebtesten Dichter Frankreichs, berühmt vor allem durch seine melancholischen Elegien.
Chiang Saen liegt in der Provinz Chiang Rai, die lange zu Birma (heute Myanmar) gehörte, bis König Rama I. sie 1786 wieder Siam (heute Thailand) eingliederte; Chiang Saen wurde im Lauf der Jahrhunderte wiederholt zerstört und wiederaufgebaut.
Die Shwedagon-Pagode von Rangun ist ein weltberühmtes buddhistisches Wallfahrtsziel; sie wurde 588 v. Chr. errichtet und erhielt ihre heutige Gestalt im 17. und 18. Jahrhundert; die Dächer der Pagode sind mit Goldplatten belegt, und ihre Schirme sind mit unzähligen Edelsteinen verziert; nach buddhistischer Überlieferung birgt sie den Reliquienschatz von acht Haupthaaren Buddhas.
Kapitel 66: Pegu
Zamindar ist das Hindi-Wort für einen Steuereintreiber, aus dem Persischen abgeleitet (zamin für »Erde« und dar für »halten«); Shabundar oder Shabandar ist die malaiische Bezeichnung (von shah für »Herrscher« und bandar für »Stadt, Hafen«) eines königlichen Beamten, der Händler beaufsichtigt, Häfen kontrolliert und Zölle kassiert; die Bezeichnungen Nak-kann und Serodogee konnten nicht verifiziert werden.
Die Frucht des Wegerichs ist als Flohsamen bekannt, in der Volksmedizin ein Mittel zur Darmreinigung, aber der Betelnuss nicht unbedingt ähnlich; woher Dumas die Information hatte, die Betelpalme sei eine Schlingpflanze, konnte nicht eruiert werden.
Die Zwölftafelgesetze sind die Grundlage des römischen Rechts, vermutlich auf die Solonische Gesetzgebung Athens zurückgehend; der Überlieferung nach sollen sie um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. als bronzene oder hölzerne Tafeln existiert haben und bei der Eroberung Roms durch die Gallier 387 v. Chr. vernichtet worden sein.
»Sklavin des Götterbildes« ist eine blumige Formulierung der eigentlichen Wortbedeutung von Devadasi, nämlich »Dienerin Gottes«.
Kapitel 67: Die Reise
Palankin ist die Bezeichnung für einen Tragesessel oder eine Sänfte, aber auch für die Sitzgelegenheit auf dem Elefantenrücken, meist aus Holz gezimmert.
Bei der Belagerung und Einnahme der griechischen Stadt Methone verlor der makedonische König Philipp II. das rechte Auge durch einen Pfeilschuss; in Kapitel 85 lässt Dumas die entsprechende Anekdote ausführlich erzählen.
Kapitel 68: Der Königspython
René vergleicht die Kugeln des Waffenschmieds Lepage mit Apollons Pfeilen in Anspielung auf dessen Erlegung des Drachen Python zu Delphi.
Kapitel 69: Die Wegelagerer
Der Naturforscher François Levaillant unternahm mehrere Reisen in das Innere des afrikanischen Kontinents; seine Reiseberichte Voyage dans l’intérieur de l’Afrique von 1790 und Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique von 1796 wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
Kapitel 71: Das irdische Paradies
Das Königreich Pegu wurde 1539 dem birmanischen Königreich Taungu, Taungoo oder Toungoo einverleibt und dem Königreich Ava unterworfen; nach einer Rebellion erklärte es sich 1740 als Königreich Hongsawadi unabhängig; 1757 eroberten die Birmanen es zurück, wobei die Stadt Pegu zerstört wurde.
Zu Anfang des Kapitels spricht Dumas von einem Abstand von fünfundzwanzig Jahren zwischen dem ersten Aufenthalt des Vicomte de Sainte-Hermine in Pegu und dem Eintreffen seiner Töchter in diesem Land; einige Absätze später schrumpft diese Zeitdifferenz zu siebzehn Jahren.
Wie Claude Schopp schreibt, kommt sich Augustus in seinem entsprechenden Monolog in Corneilles Drama Cinna ou la Clémence d’Auguste vor, als wäre er Herrscher über das Universum.
Kapitel 73: Das Begräbnis des Vicomte de Sainte-Hermine
Das Bild der mit erhobenem Wurfspieß laufenden Thessalierinnen, dessen sich Phädra entsinnt, stammt aus Euripides’ Drama Hippolytos.
Kapitel 74: Tiger und Elefanten
Die Manton-Gewehre Sir James Asplays sind von Joseph Manton gefertigt, dem berühmten englischen Büchsenmacher, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Steinschlossgewehr zu einem bis dahin ungekannten Grad perfektionierte.
Kapitel 75: Janes Leiden
Die Chronologie der Ereignisse im Leben der beiden Familien Sainte-Hermine ist trotz der verworrenen und verwirrenden Lebensläufe fast durchgehend stimmig; im 56. Kapitel erzählt Hélène, Hector sei bei ihnen aufgewachsen und als Achtjähriger mit ihrem Vater, dem Vicomte, erstmals zur See gefahren, während im 65. Kapitel und hier für Hector die einleuchtendere Altersangabe von elf Jahren im Jahr 1790 und dreizehn Jahren beim Verlassen seines Onkels und seiner Cousinen 1792 genannt wird, was zudem damit übereinstimmt, dass er 1804 fünfundzwanzig oder sechsundzwanzig Jahre alt sein soll; die kleine Verlobte des Knaben Hector war im 65. Kapitel die seinerzeit siebenjährige Hélène, während es hier in Kapitel 75 Jane gewesen zu sein scheint, was angesichts des Altersunterschieds wenig wahrscheinlich ist.
Im 26. Kapitel wird Hector de Sainte-Hermine in Vincennes eingekerkert, im 47. Kapitel ist es das Abbaye-Gefängnis und hier nun das Temple-Gefängnis.
Kapitel 77: Die Nächte Indiens
Puschkin findet in diesem Zusammenhang unter anderem deshalb Erwähnung, weil Dumas Teile seiner Verserzählung Der eherne Reiter übersetzt hat, aber möglicherweise auch der vergleichbaren Herkunft wegen, denn Puschkins Großvater war Mohr am Zarenhof; die Stelle des Gedichts, auf die Dumas anspielt, lautet (in der Übersetzung von Rolf-Dietrich Keil): »Ich lieb [...] / Den mondlos blassen Dämmerschein / Deiner gedankenvollen Nächte, / Wo ich in meinem Kämmerlein / Kann ohne Lampe lesen, schreiben, / Wo scharf die Schlafkonturen bleiben / Der Straßenschlucht, wo schimmernd steht / Der Pfeil der Admiralität; / Wo, dass nicht decken dunkle Schatten / Der Himmel goldgetönte Pracht, / Sich Abendrot und Frührot gatten / Und kaum ein Stündchen bleibt der Nacht.«
Die Worte, es gebe keine Pyrenäen mehr, schreibt Voltaire Ludwig XIV. zu; sie beziehen sich darauf, dass Ludwigs Enkel Philippe von Anjou Nachfolger des spanischen Königs Karl II. wurde.
Das Edikt von Nantes, mit dem Heinrich IV. 1598 den Hugenotten Religionsfreiheit und Bürgerrechte eingeräumt hatte, wurde schon unter Ludwig XIII. beschnitten und von Ludwig XIV. 1685 mit dem Edikt von Fontainebleau aufgehoben; trotz Auswanderungsverbots flüchteten an die zweihunderttausend Hugenotten nach Holland, Deutschland und Übersee; Ludwig XVI. erließ 1787 ein Toleranzedikt, das die Religionsausübung erlaubte, aber volle Bürgerrechte für Protestanten wurden erst 1789 von der Nationalversammlung dekretiert.
Hector/René teilt Dumas’ und Michelets leidenschaftlichen Abscheu gegenüber dem katholischen Klerus des Ancien Régime, und deshalb schreibt er den Widerruf des Edikts von Nantes den Einflüsterungen François d’Aix de La Chaises, Beichtvater Ludwigs XIV., und dessen frömmlerischer letzter Mätresse und heimlicher Ehefrau Madame de Maintenon zu; weniger pfaffenfeindliche Historiker bescheinigen sowohl dem Beichtvater als auch Madame de Maintenon eher mäßigenden Einfluss auf den König mit seiner rigorosen Ausmerzungspolitik gegenüber Protestanten und Jansenisten.
Mit der Fortsetzung des fatalen Werks Ludwigs XIV. durch seinen Enkel Ludwig XV. meint René hier weniger die katastrophale Staatsverschuldung als vielmehr das moralisch wenig erbauliche Schauspiel eines Königs, der sich offizielle maîtresses en titre hält, und er zählt die Damen in der Reihenfolge ihrer Amtsinhaberschaft auf (Marie-Anne de Mailly-Nesle, Marquise de La Tournelle, Herzogin von Châteauroux, Jeanne-Antoinette Poisson, Dame Le Normant d’Étioles, Marquise de Pompadour, und Marie-Jeanne Bécu, Comtesse de Dubarry).
Der »bestochene Minister« ist der Herzog von Choiseul und Marquis de Stainville, Außen- und Kriegsminister unter Ludwig XV., der die Ehe zwischen dem Thronfolger und Maria Theresias Tochter Marie-Antoinette vermittelte – bestochen, wie René glaubt, vom Hause Habsburg, das die Herrschaft über Frankreich an sich zu bringen trachtete.
Kapitel 78: Die Hochzeitsvorbereitungen
In seinem berühmten Monolog (3. Aufzug, 1. Szene) spekuliert Hamlet über »das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wandrer wiederkehrt«.
Kapitel 80: Eurydike
Die Dryade Eurydike, Gattin des Orpheus, trat auf der Flucht vor dem Gott Aristaios auf eine Schlange, deren Biss tödlich war.
Marie-François-Xavier Bichat, Begründer der Histologie, der ohne Mikroskop einundzwanzig Gewebetypen des menschlichen Körpers entdeckte und als Vorläufer Virchows in der Zellularpathologie gilt, konnte während der Revolution zahlreiche Experimente zur Reaktion des Herzmuskels auf elektrische Stimulation an frisch guillotinierten Leichen machen; ein Klassiker der modernen Pathologie ist sein 1800 erschienenes Buch Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Franz Joseph Gall und sein Schüler Johann Caspar Spurzheim sind die Begründer der Schädellehre oder Phrenologie, einer Pseudowissenschaft, die Charaktereigenschaften und Temperament der Schädelform ablesen wollte, aber neben allem unhaltbar Spekulativen sind sie mit ihrer Lokalisationstheorie letztlich die Vorläufer der modernen Hirnforschung. Ihre Veröffentlichungen konnte René zur Zeit seines Kerkeraufenthalts noch nicht gelesen haben. Bichat betrachtet er als Antagonisten der Phrenologen, weil Bichat Materialist ist, während die Phrenologen Spinner sind, um es anspruchslos auszudrücken, oder etwas anspruchsvoller: Bichat führt zur modernen Medizin, Gall und Spurzheim führen zur Forensik und zur Eugenik.
Janes Definition des Betens als Opiat klingt nach einer Reverenz vor dem Freund des Verfassers, Heinrich Heine, dem auch Karl Marx die Definiton der Religion als Opium verdankt.
Jan Swammerdam hat in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter dem Mikroskop Insekten seziert und aufsehenerregende anatomische Entdeckungen gemacht, bevor er in Schwermut und religiöse Schwärmerei verfiel und in geistiger Umnachtung starb; auf ihn spielt Jane an.
Die von Jane zitierten Worte Shakespeares stammen aus der 1. Szene des 2. Aufzugs von Hamlet.
In Kapitel 67 hat der Biss der birmanischen Giftschlange die Wirkung, dass die Opfer bei Sonnenuntergang oder bei Sonnenaufgang sterben, unabhängig von der Tageszeit des Bisses.
In Kapitel 74 erwägt nicht Jane, sondern Hélène, René die gelehrigen Elefanten abzukaufen, und er macht sie den Schwestern zum Geschenk.
Kapitel 81: Die Rückkehr (2)
»Eichenholz und dreifache Erzschicht umschloss die Brust des Mannes, der zuerst den zerbrechlichen Kahn der wilden See anvertraute«, schreibt Horaz in seinem Geleitgedicht an das Schiff, das ihn trägt (Oden, I, 3, 9).
Kapitel 83: Rückkehr zum Quai Chien-de-plomb
Die Saint-Géran ist das Schiff, das in Paul und Virginie die junge Heldin aus Frankreich zurückbringt und vor der Insel Mauritius im Sturm Schiffbruch erleidet.
Kapitel 85: Die Armenkollekte
Der Faustkampf zwischen Dares und Entellus ereignet sich im fünften Kapitel der Äneis bei den Trauerfeierlichkeiten anlässlich der Beisetzung des Anchises; der junge Dares ist voller Kampfbegier, der abgeklärte Entellus muss zum Kampf genötigt werden und besiegt den Jüngeren.
Kapitel 86: Aufbruch
Der »Chant du départ« war die Nationalhymne zur Feier des Bastillesturms (Verse von Marie-Joseph Chénier, Musik von Étienne-Nicolas Méhul), die sich großer und lang anhaltender Beliebtheit erfreute.
Kapitel 87: Was sich unterdessen in Europa ereignete
Dieses und das folgende Kapitel entstammen Dumas’ Roman La San Felice (1864), der nach der Schlacht von Abukir am Hof von Neapel spielt.
Als Geburtsdatum Lord Horatio Nelsons nennt Dumas den 20. September 1758; andere Quellen geben den 19. und auch den 29. September dieses Jahres an. Nelson hatte insgesamt zehn Geschwister; als seine Mutter 1767 starb, waren acht der elf Kinder noch am Leben. Nelsons Onkel, der den Zwölfjährigen als Midshipman in seine Mannschaft aufnahm, war Maurice Suckling, der Bruder von Nelsons Mutter; sie und ihr Bruder waren Großnichte und Großneffe des ersten britischen Premierministers Robert Walpole. Das von Suckling kommandierte Kriegsschiff, auf dem Nelson seinen ersten Dienst antrat, hieß nicht Redoutable, sondern Raisonnable.
Die Arztwitwe Frances Nisbett heiratete Nelson vor seiner Rückkehr nach England 1787 auf der Karibikinsel Nevis.
Sir William Hamilton, Wissenschaftler und Gelehrter, war seit 1764 englischer Gesandter am Hof des Königs von Neapel und beider Sizilien; seine Geliebte Amy Lyon (Künstlername Emma Hart) hatte er 1791 geheiratet.
Der Jakobinerhass Ferdinands IV. und seiner Gemahlin Caroline Marie hängt zweifellos damit zusammen, dass Carolines Schwester Marie-Antoinette von der französischen Republik guillotiniert worden war.
Der Marinehafen Toulon hatte sich im August 1793 auf die Seite der Royalisten geschlagen und die republikanischen Kriegsschiffe im Hafen den Engländern überantwortet; dem Artillerieoffizier Buonaparte war nach zäher Belagerung im Dezember die Vertreibung der Engländer und die Rückeroberung Toulons gelungen.
Die Geschehnisse des 13. Vendémiaire sind in den Anmerkungen zum 29. Kapitel referiert.
In der Schlacht von Montenotte (12. April 1796) und in der Schlacht von Dego (14. April 1796) besiegte Bonaparte die Österreicher unter Graf Argenteau; in der Schlacht von Arcole (15. bis 17. November 1796) besiegte er die Österreicher unter Baron Alvinczy, in der ersten Schlacht von Rivoli (22. November 1796) besiegte er die Österreicher unter Baron Davidovich, und in der zweiten Schlacht von Rivoli (14. bis 15. Januar 1797) besiegte er abermals die Österreicher unter Alvinczy. (Sieger gegen Napoleon war Feldzeugmeister Joseph Freiherr Alvinczy von Borberek in der zweiten Schlacht von Bassano am 6. November 1796 und in der Schlacht von Caldero oder Caldiero am 12. November 1796.) Feldmarschall Dagobert Sigismund Wurmser wurde von Napoleon in der Schlacht von Castiglione (5. August 1796) und in der ersten Schlacht von Bassano (8. September 1796) besiegt. General Jean-Pierre, Baron de Beaulieu, unterlag Napoleon in der Schlacht von Lodi (10. März 1796) und in der Schlacht von Borghetto (30. Mai 1796). Erzherzog Karl von Österreich wurde von Napoleon in der Schlacht von Valvassone (16. März 1797) geschlagen (und 1809 in den Schlachten von Eckmühl, Regensburg und Wagram, während er im selben Jahr in der Schlacht von Aspern gegen die Franzosen siegte).
Herodot ist Urheber oder zumindest Chronist der üblen Nachrede, die Kambyses III., der Ägypten in das persische Großreich eingliederte, als geisteskranken, lasterhaften Willkürherrscher darstellt.
Der Sultan, der Nelson eine Diamantbrosche verehrte, war Selim III., der König von Sardinien war Karl Emmanuel IV. – Die Geschenke, die Nelson erhielt, finden sich ausführlich beschrieben und akribisch aufgelistet in Robert Southeys Life of Nelson aus dem Jahr 1813.
Hallowells »Zertifikat« und seinen Brief an Nelson kann Dumas Southeys Nelson-Porträt oder auch der Veröffentlichung The Dispatches and Letters of Vice-Admiral Lord Viscount Nelson (herausgegeben und annotiert von Sir Nicholas Harris Nicolas, London, 1845) entnommen haben.
Kapitel 88: Emma Lyon
Zum Herzog von Bronte (nach dem Kyklopen Brontes) ernannte Ferdinand IV. Admiral Nelson im Jahr 1799 zum Dank für die Wiedereroberung Neapels und seine, Ferdinands, Wiedereinsetzung als König.
Amy oder Emma Lyon wuchs bei ihrer Großmutter in Wales auf und wurde mit zwölf Jahren als Dienstmädchen nach London verdingt. Den Maler George Romney, der sie wiederholt malte, lernte sie 1782 in London kennen.
Eine Miss Arabell gibt es nicht unter den Mätressen des Prinzregenten George IV.; Anfang der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts war er mit Grace Elliott und mit Frances Villiers liiert.
Dumas zitiert Alphonse de Lamartines Beurteilung Lady Hamiltons in dessen Nelson-Porträt (1853); wörtlich lautet die Stelle: »Zum ersten Mal strauchelte sie nicht in das Laster, sondern in Unbesonnenheit und Güte.«
Die berüchtigten press gangs waren zur Zeit des Seekriegs gegen Napoleon eine wohlbekannte Institution der englischen Marine, die von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende der Napoleonischen Kriege existierte. Da die königliche Marine auf legalem Weg nie genug Seeleute anwerben konnte, war sie ermächtigt, im Namen des Königs englische »diensttaugliche Vollmatrosen im Alter zwischen achtzehn und fünfundfünfzig Jahren« zwangszuverpflichten; mit Alter, Nationalität und seemännischer Tauglichkeit der Gepressten nahm man es manchmal nicht allzu genau, wenngleich kundige und körperlich einsatzfähige Seeleute aus naheliegenden Gründen bevorzugt wurden; in näherer Umgebung der Hafenstädte war der Hass der Bevölkerung auf den Impress Service groß. Die Romane Billy Budd von Herman Melville und Sylvia’s Lovers von Elizabeth Gaskell handeln von der Praxis des Impressments an Land und zur See und den daraus resultierenden Konflikten.
John Willet-Payne, Emmas erster »Patron«, war Kapitän, nicht Admiral. Sir Henry Fatherson hieß korrekt Sir Harry Featherstonehaugh; er erwarb Emma von dem schottischen Wunderdoktor James Graham und war der Vater ihrer Tochter Emma Carew, die von Emmas Großmutter aufgezogen wurde. Die drei Kinder, die als Frucht des Zusammenlebens mit dem Neffen Sir William Hamiltons bezeichnet werden, hat es in dieser expliziten Form nicht gegeben.
Die von Dumas erwähnte Bibliothèque impériale trug diesen Namen unter den Kaisern Napoleon I. und Napoleon III.; in republikanischen Tagen hieß sie Bibliothèque de la Nation, vor der Revolution und seit der Zeit Karls V. Bibliothèque du Roi, von 1815 bis 1848 Bibliothèque royale, danach bis zum Putsch Louis-Napoléons Bibliothèque nationale, wie sie auch heute heißt.
Kapitel 89: In welchem Kapitel Napoleon erkennen muss, dass die Menschen manchmal schwerer zu lenken sind, als es das Glück ist
Das Gefecht, in dem General Baron Mack im Dienst Ferdinands IV. mit sechzigtausend Soldaten von Jean-Étienne Championnet mit kaum zehntausend Soldaten vernichtend geschlagen wurde, ereignete sich im Dezember 1798 und eröffnete Championnet den Weg nach Neapel, das er im Januar 1799 einnahm und zur Hauptstadt der Parthenopäischen Republik erklärte. Das Königshaus beider Sizilien und die feinen Kreise Neapels hatten sich im Dezember gerade noch rechtzeitig von Nelson nach Palermo bringen lassen.
Der neapolitanische Admiral Francesco Caracciolo war nach einem Zerwürfnis mit Ferdinand IV. in den Dienst der Parthenopäischen Republik getreten; er wurde nach der Übergabe Neapels an Kardinal Ruffo im Juni 1799 am Mast seiner Fregatte standrechtlich gehängt. Der unbarmherzige Rachefeldzug gegen »Franzosenfreunde« im Auftrag Ferdinands IV. ist selbst in den Augen der Bewunderer Nelsons ein bleibender Makel an seinem Charakter.
Die Ortschaft Merton, der Wohnsitz Nelsons ab 1800, gehört heute zu Greater London und liegt unmittelbar südlich von Wimbledon.
Dumas vergleicht Napoleon in dessen Vermessenheit mit Ajax, dem Lokrer, der auf der Rückkehr von Troja von Poseidon persönlich vernichtet wird, als er prahlt, er werde dem Sturm auch ohne Hilfe der Götter entrinnen (Odyssee, IV, 500-511).
Kapitel 90: Der Hafen von Cadiz
Napoleons Grande Armée hatte am 24. September 1805 den Rhein überquert. Vorgefechte zwischen Franzosen und Österreichern fanden am 8. Oktober bei Wertingen und am 9. Oktober bei Günzburg statt, die Schlacht von Elchingen fand am 14. Oktober statt, am 15. Oktober schlossen die Franzosen Ulm ein, und am 20. Oktober kapitulierten die Österreicher unter Feldmarschall Baron Mack in Ulm.
Kapitel 91: Der kleine Vogel
Emma Hamiltons Ehemann Sir William Hamilton war 1803 gestorben.
Lord Nelson war am 18. August 1805 in England gelandet und hatte sich nach Merton zurückgezogen; am 13. September suchte ihn Kapitän Henry Blackwood auf, um ihm mitzuteilen, dass die Franzosen in Cadiz blockiert waren, und am 15. September ging Nelson an Bord der Victory und segelte aus Spithead ab.
Den optischen Telegraphen erfand 1791 der französische Physiker Claude Chappe; dieser sogenannte Balkentelegraph bestand aus einem an erhöhtem Standpunkt angebrachten Masten mit einem daran befestigten Balken und an diesem angebrachten Armen; Balken und Arme ließen sich mittels Hebeln verstellen. In Deutschland stellte Johann Lorenz Beckmann 1794 seine Weiterentwicklung des Chappeschen Telegraphen vor, in England und Russland wurde die optische Telegraphie ebenfalls eingeführt, die noch eine Zeit lang neben der seit den Zwanzigerjahren Fortschritte machenden elektrischen Telegraphie weiterbestand.
Linienschiffe waren im 18. Jahrhundert Kriegsschiffe mit zwei bis vier Batteriedecks (im Unterschied zu den kleineren Fregatten mit nur einem Geschützdeck), die in einer Schlachtlinie hintereinander segelten.
Kapitel 92: Trafalgar
Der »makedonische Keil« ist die von Philipp II. eingeführte und von seinem Sohn Alexander dem Großen perfektionierte keil- oder winkelförmige Schlachtordnung anstelle der bis dahin vorherrschenden griechischen Phalanx in rechteckiger Form.
Nelson verfügte für die Schlacht von Trafalgar über siebenundzwanzig Linienschiffe und vier Fregatten, der gegnerische Oberkomandierende Admiral Pierre-Charles Jean-Baptiste Silvestre de Villeneuve über vierunddreißig Linienschiffe und sechs Fregatten.
Die Vielsprachigkeit der Schiffsnamen – sowohl die Engländer als auch die Franzosen setzten in der Schlacht von Trafalgar eine Neptune und eine Swiftsure ein, und die Belleisle war ein englisches Schiff, die Berwick hingegen ein französisches – rührt daher, dass eroberte oder gekaperte Schiffe nicht immer umgetauft wurden, sondern ihren Namen behalten konnten.
Nelson hatte als Signal an seine Schiffe bei Schlachtbeginn als Losung ausgeben lassen wollen: »Nelson confides that every man will do his duty«, verzichtete dann auf seinen Namen und nannte lieber das Vaterland, doch der Signalmaat flaggte statt »confides« (»vertraut darauf«), was ihm zu umständlich war, »excpects« (»erwartet«).
Der Bath-Orden war Nelson 1797 für seine Leistung in der Schlacht von St. Vincent verliehen worden; den Orden des türkischen Halbmonds hatte ihm der türkische Sultan für seinen Sieg in der Schlacht von Abukir verliehen; den sizilianischen Ritterorden des heiligen Ferdinands hatte Ferdinand IV. Nelson zusammen mit der Ernennung zum Herzog von Bronte 1799 verliehen, und das Johanniter- oder Malteserkreuz hatte der Seeheld für die Rückeroberung Maltas verliehen bekommen.
Kettenkugeln und Stangenkugeln, von Surcouf in Kapitel 55 als Abtakelungsgeschosse erwähnt, hatten durch ihre Sperrigkeit eine besonders zerstörerische Wirkung.
Kapitel 93: Unstern
Auf der Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft starb Admiral Villeneuve am 22. April 1806 in einem Gasthaus bei Rennes; als Todesursache wurde Selbstmord angegeben, was angesichts der Zahl der Messerstiche wenig wahrscheinlich ist. Wie im Fall Pichegrus darf man einen Auftragsmord vermuten.
Dumas nennt als Quelle für die letzten Stunden Lord Nelsons den Bericht des Schiffsarztes Sir William Beatty, 1807 veröffentlicht unter dem Titel An Authentic Narrative of the Death of Lord Nelson, with the Circumstances preceding, attending and subsequent to that Event; the Professional Report of His Lordship’s Wound; and several Interesting Anecdotes.
Kapitel 94: Der Sturm
Die Geschichte der Marine, auf die Dumas sich bezieht, wurde von William James verfasst und trägt den Titel Naval History of Great Britain from the Declaration of War by France in 1793 to the Accession of George IV in February 1820 (1822-24); in dem im 92. Kapitel von Dumas in einer Fußnote erwähnten »ausgezeichneten Buch« Jean-Pierre Edmond Jurien de La Gravières mit dem vollständigen Titel Guerres maritimes sous la République et l’Empire (1847) konnte Dumas die Stelle über den »tapferen Kapitän Camas« in französischer Übersetzung lesen, denn dort wird aus James’ Werk zitiert.
Das Linienschiff Le Vengeur unter dem Kommando Kapitän Renaudins weigerte sich im Verlauf der Seeschlacht zwischen England und Frankreich namens Bataille d’Ouessant beziehungsweise Glorious Battle of the 1st of June am 1. Juni 1794 (13. Prairial des Jahres II), sich zu ergeben, und wurde versenkt.
Die britische Flotte verzeichnete nach der Schlacht von Trafalgar zwischen vierhundert und vierhundertvierzig Tote und tausend bis tausendzweihundert Verwundete, die spanische tausend Tote und tausendvierhundert Verwundete, die französische dreitausend Tote und tausend Verwundete.
Die Santa Ana wurde nicht von Cuthbert Collingwood versenkt, sondern am 23. Oktober den Engländern von einem französischen Prisenkommando unter Kapitän Julien Cosmao-Kerjulien wieder abgejagt.
Als größten brennenden Scheiterhaufen aller Zeiten auf dem Meer bezeichnet Dumas die brennende Santissima Trinidad, das bis dahin größte Schiff aller Zeiten.
Nach Cadiz gelangte die Bucentaure nicht, wie Dumas weiter oben verriet; sie wurde nicht an Felsklippen zerschmettert, sondern sank, bevor sie den Hafen erreichte.
Die Indomptable hatte die Überlebenden der Bucentaure an Bord genommen; von den mehr als tausend Schiffbrüchigen überlebten keine hundertfünfzig den Untergang des Schiffs.
Der Dreimaster und Kauffahrer Samson ist fiktiver Natur.
Kapitel 95: Die Flucht
Hulken, Holken oder Blockschiffe (englisch hulks, französisch pontons) sind Gefängnisschiffe, entmastete ehemalige Kriegsschiffe, von Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem an Englands Küsten und in der Themsemündung in Gebrauch; sie waren leicht zu bewachen, die Unterbringung der Kettensträflinge spottete jeder Beschreibung, ein Entkommen war kaum zu bewerkstelligen; in den ersten Kapiteln seines Romans Große Erwartungen schildert Charles Dickens diese schwimmenden Kerker sehr anschaulich.
»Die Luft geht scharf, es ist entsetzlich kalt«, sagt Hamlet zu Horatio (in der Übersetzung von A. W. von Schlegel; 1. Aufzug, 4. Szene), und dieser erwidert: »’s ist eine schneidende und strenge Luft.«
Kapitel 97: Die Ratschläge Monsieur Fouchés
Die Umschreibung »Tag von Offenburg« bezieht sich auf die Entführung des Herzogs von Enghien.
Die neuen Verbündeten, die Napoleon nach seinem Aufenthalt in München besuchte, waren die Regenten des von ihm frisch gebackenen Königreichs Württemberg in Stuttgart und des ebenso neuen Großherzogtums Baden in Karlsruhe, die er durch Familienbande noch enger an sich zu binden gedachte.
Kapitän Lucas bittet René, ihn am 29. Januar 1806 aufzusuchen; eine halbe Seite weiter ist aus dem 29. Januar der 4. Februar geworden.
Kapitel 98: Die Postkutsche von Rom
Das Konkordat, das 1801 zwischen Papst Pius VII. und dem französischen Staat geschlossen wurde, hatte die Wiederherstellung der Freiheit und Öffentlichkeit des katholischen Kultus in Frankreich (der jedoch nicht wieder zur Staatsreligion erklärt wurde) zum Gegenstand; die Geistlichen wurden verbeamtet, die Bischöfe mussten den Treueeid auf den Ersten Konsul leisten, der sie ernannte.
Kapitel 99: Die Via Appia
Für dieses und die folgenden Kapitel hat Dumas seinen unvollendeten Roman Isaac Laquedem (1853; über den Anfang ist das Projekt eines Romans über den Ewigen Juden nie hinausgediehen), seine Reisebeschreibung Le Corricolo (1853) und seinen Roman La San Felice (1864) ausgeschlachtet. Als Wissensquelle für die Geschichte der Via Appia diente ihm neben den antiken Autoren die Studie Rome au siècle d’Auguste, ou voyage d’un Gaulois à Rome, à l’époque du règne d’Auguste pendant une partie du règne de Tibère des Historikers und Archäologen Louis Charles Dezobry aus dem Jahr 1835.
Die lateinischen Inschriften bzw. deren Abkürzungen auf den Grabmälern an der Via Appia lauten: »fertigte es zu Lebzeiten«, »errichtete es zu Lebzeiten für sich« und »ließ es zu Lebzeiten fertigen«.
Kapitel 100: Was sich fünfzig Jahre vor Christus auf der Via Appia abspielte
Lupanaria hießen in Rom die Bordelle, die vor allem in der Nähe des Circus Maximus und im übelbeleumdeten Viertel Subura gelegen waren.
Die Marsi oder Marser sind ein mittelitalisches Volk, das seit Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. Bundesgenosse der Römer war; wie der Name, der sich von dem des Kriegsgotts herleitet, andeutet, galten sie als besonders kriegerisch. Mit dem germanischen Volk der Marser, das zuerst am Rhein und später zwischen Ruhr und Lippe siedelte, haben die italischen Marser nichts zu tun; Dumas bezieht sich auf die italischen Marser.
In der Schlacht bei Philippi unterlag die republikanische Armee 42 v. Chr. den Truppen Marcus Antonius’ und Octavians.
Julia, Enkelin des Augustus, wurde wegen lasterhaften Lebenswandels lebenslänglich verbannt und gebar in der Verbannung ein Kind, das Augustus ihr aufzuziehen verbot; Opfer der moralischen Entrüstung des Herrschers wurde auch der mit Julia befreundete Ovid, den Augustus nach Tomis am Schwarzen Meer verbannte, was mit der Unsittlichkeit seiner Gedichte begründet wurde; die Mutter eines kleinen Agrippa war nicht die Julia, deren Verbannung Ovids Verbannung nach sich zog, sondern ihre Mutter Julia, von deren Vater Augustus in die dritte Ehe mit Tiberius gezwungen, was sie mit zahlreichen Seitensprüngen und Konspirationen zur Beseitigung des Tiberius quittierte, woraufhin ihr Vater die Scheidung verfügte und seine Tochter in die Verbannung schickte.
Murrhinische Gefäße, Trinkgefäße aus in Parthien gefördertem Flußspat, der erhitzt und mit Myrrhenharz eingerieben wurde, galten im Rom der Spätantike als höchster Luxus.
Die letzten Worte des Augustus sind nach Suetons Leben der Cäsaren zitiert.
Kapitel 101: Archäologische Unterhaltung zwischen einem Marineleutnant und einem Husarenhauptmann
In den Georgica (I, 497) spricht Vergil von den Gebeinen hünenhafter Krieger: »Kommt wohl einst die Zeit, da findet der Bauer in jenen Ländern, wenn er das Feld durchfurcht mit gebogenem Pfluge, Speere, zerfressen von schäbigem Rost [...] und sieht voll Erstaunen mächtiges Heldengebein in aufgeworfenen Gräbern.«
Der mitteilungsfreudige Reisende vermischt die Geschichte des Maxentius (römischer Kaiser von 306 bis 312 n. Chr.) mit der des Galerius Maximianus (dessen Tochter Valeria Maximilla mit Maxentius vermählt wurde) und versetzt diese Mischung mit Zutaten aus der eigenen Phantasie (Caracalla und Heliogabal lebten hundert Jahre früher; welchen Alexander er meint, bleibt eine offene Frage); Galerius Maximianus wurde in seiner Heimat Pannonien bestattet, nicht in Rom; Maxentius, der im Kampf gegen Konstantin im Tiber ertrank, wurde posthum der Kopf abgeschlagen; den Zirkus ließ Maxentius 309 n. Chr. erbauen und seinem Sohn Romulus widmen.
Caecilia Metella war nicht die Gattin des für seinen Reichtum berühmten Marcus Licinius Crassus Dives, sondern seines älteren Sohnes Marcus Licinius Crassus.
Nicht die Quintilier wollten Commodus ermorden, sondern dieser verfolgte die Brüder, um sich ihres Vermögens zu bemächtigen; die missglückte Verschwörung mit anschließender Hinrichtung der Verschwörer, die René schildert, wurde nicht von den Quintiliern betrieben, sondern von Lucilla, der Schwester des Commodus, zusammen mit ihrem Vetter Marcus Ummidius Quadratus; Commodus’ Vorliebe für Spiele und Wettkämpfe brachte Rom in beträchtliche Geldnot; der Historiker Herodianos war Lehrer des Commodus und verfasste eine Geschichte der römischen Kaiser vom Tod Marc Aurels bis zur Thronbesteigung Gordians III.
Kapitel 102: In welchem Kapitel der Leser den Namen eines der zwei Reisenden errät und den des anderen erfährt
Der Kampf zwischen Rom und Alba Longa über die Vorherrschaft wurde der Überlieferung nach zwischen den Drillingspaaren der römischen Horatier und der albanischen Curiatier ausgetragen und vom letzten überlebenden Horatier entschieden.
Domitian genoss den Ruf eines besonders grausamen Menschen, der sich daran erfreut haben soll, Fliegen fangen zu lassen, um sie dann mit einem Federkiel zu erstechen.
Clodius hatte nicht vier Schwestern, sondern drei Schwestern, die alle Clodia hießen; mit dem Rhetor Hortensius war keine der Schwestern verheiratet; Lesbia war der Kosename Catulls für die von ihm geliebte zweitälteste Schwester des Clodius; die üble Nachrede Ciceros, der diese Clodia als »Viergroschenhure« schmähte, hat die Geschichtsschreibung lange beeinflusst.
Die dritte Ehefrau Cäsars, der Clodius nachstellte, hieß Pompeia, nicht Mussia, und war keine Tochter des Pompeius.
Die Feierlichkeiten zu Ehren der Bona Dea, einer Frauengottheit, unter Ausschluss der Männer vereinen vermutlich die Kulte um eine italische und eine griechische Gottheit.
Die Ecole de Mars wurde auf Konventsbeschluss am 13. Prairial des Jahres II (1. Juni 1794) gegründet und bald danach sang- und klanglos zugemacht; sechs Sechzehnjährige pro Distrikt, zur Hälfte ländliche und zur Hälfte städtische Sansculottenkinder, sollten den Umgang mit Waffen lernen sowie »Brüderlichkeit, Disziplin, Bedürfnislosigkeit, gute Sitten, Vaterlandsliebe und Hass auf das Königtum«.
Joachim Murat wurde im März 1806 von seinem Schwager zum Großherzog von Berg und Kleve ernannt. Manhès berichtet seinem Reisebegleiter von Napoelons Einzug in Berlin (27. Oktober 1806) und von der Schlacht von Jena/Auerstädt (14. Oktober 1806), doch zu Beginn des folgenden Kapitels erleben die Reisenden die Belagerung von Gaeta mit, das sich nach langem Widerstand im Juli hatte ergeben müssen, also einige Monate vor Napoleons Sieg gegen die Preußen. Die vertauschte Chronologie zieht sich auch durch die nächsten Kapitel.
Kapitel 103: Die Pontinischen Sümpfe
Augustus stammte aus wohlhabender, wenn auch nicht besonders vornehmer Familie; sein Vater war der Prätor, Tribun und Quästor Caius Octavius, seine Mutter Atia war die Tochter des Prätoren Manus Acilius Balbus, der mit Cäsars Schwester Julia verheiratet war. Die Gerüchte über die Herkunft des Augustus verdankt Dumas Suetons Leben der Cäsaren (»Derselbe Antonius jedoch, der auch auf die mütterliche Abkunft des Augustus verächtlich herabsieht, wirft ihm vor, sein Urgroßvater stamme von Afrikanern ab und habe bald einen Salbenhandel, bald das Müllergewerbe in Aricia betrieben«).
Faunus kann seiner Tochter Bona Dea erst beiwohnen, als er sich in eine Schlange verwandelt; Klatsch und Tratsch im alten Rom übertrugen dies auf die Umstände der Zeugung des Augustus.
Das Bild von Ernest Hébert heißt La Malaria und wurde erstmals im Salon von 1850/51 ausgestellt; heute befindet es sich im Musée d’Orsay.
Kapitel 104: Fra Diavolo
Anxur lautet der – vermutlich volskische – Name Terracinas, der um 500 v. Chr. in Tarracina geändert wurde; Vergil erwähnt in der Äneis (7, 799) lediglich den dort verehrten Jupiter Anxurus; Horaz spricht in seinen Satiren (I, 5, 26) von »Anxur, das von seinem weißen Felsen weit in die Ferne glänzt«; in Le Corricolo hat Dumas das Zitat korrekt Horaz zugeschrieben.
Fra Diavolo wurde am 11. November 1806 in Neapel öffentlich gehängt, und wenn der Adjutant des Großherzogs von Berg am 10. November vormittags von Rom aufbricht und am 11. in Terracina berichten kann, was am 8. November in Magdeburg geschah, dann müsste er die Reise von Berlin nach Rom an einem einzigen Tag bewältigt haben.
Kapitel 105: Die Jagd
Fra Diavolo oder das Gasthaus in Terracina des Gespanns Daniel-François-Esprit Auber und Augustin-Eugène Scribe von 1830 war auf Anhieb ein Erfolg; als Fra Diavolo oder auch The Devil’s Brother verfilmte Hal Roach die Operette 1933 mit den Banditen Stanilo und Olivero in tragenden Nebenrollen.
Sanfedista hießen die Partisanen der von Kardinal Ruffo ins Leben gerufenen Freischaren für Glaube, Gott und König, die mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln den gottlosen Franzosen das Handwerk legen sollten.
Dumas zitiert aus Victor Hugos Gedichtzyklus La Légende des siècles das Gedicht »Après la bataille« (Teil XLIX, »Le Temps présent«), verfasst am 18. Juni 1850, dem Jahrestag von Waterloo. Der Zyklus erschien erstmals 1859.
Kapitel 106: Major Hugo
Als Quelle dient Dumas die Veröffentlichung Mémoires du général Hugo, gouverneur de plusieurs provinces et aide-major-général des armées en Espagne (Paris, 1823).
El Empecinado (»Pechmann« oder »Pechsieder«) war Juan Martín Díaz, der als Guerillaführer die Franzosen in Spanien so erfolgreich bekämpfte, dass General Hugo zu seinem »ausschließlichen Verfolger« ernannt wurde; Hugo nahm Díaz’ Mutter (erfolglos) als Geisel, was El Empecinado mit verschärften Angriffen und der Erschießung von hundert französischen Soldaten erwiderte. Nach der Restauration von 1823 wurde der Volksheld als Liberaler festgenommen und 1825 gehängt (statt, wie er es sich erbeten hatte, füsiliert). Sein Spitzname ist im Spanischen zum Synonym für Hartnäckigkeit geworden.
Die Kriegslist des Marschalls von Rantzau, deren Fra Diavolo sich bedient, ist das Manöver, mit dessen Hilfe Josia Rantzau im Dreißigjährigen Krieg im Februar 1636 Saint-Jean-de-Losne bei Nacht und Nebel einnehmen konnte.
Kapitel 107: Der letzte Kampf
Die kaudinischen Pässe sind der Engpass nahe dem samnitischen Ort Caudium zwischen Neapel und Benevent, wo die Samniten unter Gaius Pontius den Römern 321 v. Chr. eine vernichtende Niederlage bereiteten; die römischen Feldherren Titus Veturius und Spurius Postumnius samt ihren überlebenden Soldaten sollen genötigt worden sein, zum Zeichen ihrer Demütigung unter einem Joch aus Speeren hindurchzugehen (daher der Begriff des kaudinischen Jochs für eine Zwangslage, aus der es kein ehrenvolles Entkommen gibt).
Ein Improvisator ist ein mündlicher Stegreifdichter; die berühmtesten neapolitanischen Improvisatoren des späten 18. Jahrhunderts fielen den »blutigen Reaktionsexzessen« Ferdinands und Kardinal Ruffos 1799 zum Opfer.
Ende November kann die Flucht Fra Diavolos nicht geendet haben, wenn er Anfang November hingerichtet wurde; die Wetterverhältnisse wiederum sind für Ende Oktober etwas verfrüht.
Kapitel 108: La Forca
Der Titel des Kapitels ist die italienische Bezeichnung für den Galgen.
Das »erstklassige« Hotel La Vittoria wurde von Dumas während seiner ersten Neapelreise beehrt, und in seinem Reisebuch Le Corricolo singt er das Loblied des Hoteliers Martin Zir.
Kapitel 109: Christophe Saliceti, Polizeiminister und Kriegsminister
Saliceti ist 1757 geboren und 1809 gestorben.
Der Satz, in dem Dumas das bunte Treiben am Kai von Neapel schildert, hört nach den Zeilen des Dichters Metastasio abrupt auf.
Das Atrium ist der Mittelraum des italischen Hauses, das Impluvium ist das rechteckige Sammelbecken für Regenwasser im Fußboden des Atriums, und Triclinium ist die Bezeichnung für drei Klinen (Ruhebetten, nicht nur zum Schlafen, auch zum Speisen), die um einen zentralen Tisch herum angeordnet sind.
Moccoletti sind »Kerzchen«.
Ein grano ist wörtlich ein Gran, im übertragenen Sinn eine Münze von bescheidenem Geldwert.
Die verwirrenden Zeitangaben zur Belagerung von Gaeta ziehen sich seit Kapitel 102 durch den Text. Nicht zu übersehen ist auch, dass die Handlung des ganzen Kapitels 109 an einem einzigen Tag spielen soll, obwohl vom 11. November oder vom Ende des Monats zur zweiten Januarhälfte gesprungen wird.
Antonius von Ägypten oder der Große wird mit Schweinen zusammen abgebildet, weil er als Einsiedler in der Wüste dämonischen Versuchungen ausgesetzt war, in denen schweineartige Tiere vorkamen; später entwickelte der Orden daraus den Brauch des Antonius-Schweins, das am Antoniustag geschlachtet, gesegnet und an die Armen verteilt wurde.
Kapitel 110: König Joseph
Den Brief Napoleons an seinen Bruder Joseph entnimmt Dumas der Veröffentlichung Correspondance de Napoléon 1er (veröffentlicht auf Anweisung des Kaisers Napoleon III., 1863, Bd. 13, Brief 10573 vom 30. Juli 1806).
Kapitel 111: Il Bizzarro
Il Bizzarro konnte nach dem Mordanschlag der (zwei, nicht fünf) Brüder seiner Geliebten auf ihn nicht in die Berge entfliehen, sondern wurde bei seinem Fluchtversuch aus der Kirche ertappt und musste mehrere Jahre als Galeerensträfling Frondienste tun.
Kapitel 112: In welchem Kapitel die zwei jungen Männer Abschied voneinander nehmen, damit der eine seinen Dienst bei Murat wieder antreten und der andere Reynier bitten kann, ihn in Dienst zu nehmen
Der Serapistempel von Pozzuoli ist kein Tempel, sondern das macellum, die Markthalle der Stadt aus antiker Zeit.
Kapitel 114: In welchem Kapitel René sieht, dass Saliceti sein Wort gehalten hat
Seit Kapitel 109 spielt die Handlung des Romans im Januar des Jahres 1807, obwohl der Sieg der englischen Truppen unter Sir John Stuart in der Schlacht von Maida, in deren Folge General Jean-Louis-Ebénézer Reynier Kalabrien räumen musste, am 4. Juli 1806 stattgefunden hatte, zwei Wochen bevor Gaeta sich am 18. Juli den französischen Belagerern ergab.
Kapitel 115: Das Dorf mit Namen Li Parenti
Die Geschichte, die General Reynier in diesem und dem folgenden Kapitel erzählt, ist mit Anekdoten zu Leben, Taten und Sterben diverser Briganten des frühen 19. Jahrhunderts im Süden Italiens angereichert, darunter Giovanni Benincasa, genannt Specchiale, Lorenzo Benincasa, Vincenzo Barberio, genannt Occhiodipecora, Francatrippa, Nicola Gualtieri, genannt Panedigrano, Pietropaolo Mancuso, genannt Parafante oder König Parafante, Franceso Moscato oder Muscato, genannt Il Bizzarro, Angelo Paonessa, genannt Panzanera, Antonio Santoro, genannt König Corenne, Arcangelo Scozzafava, genannt Galano. Dumas konnte für seine Darstellung des Brigantenwesens auf Pietro Collettas Storia del Reame di Napoli zurückgreifen (Capolago, 1834) und auf die von Francesco Montefredine zusammengestellten und herausgegebenen Erinnerungen des Generals Manhès (Memorie autografe del generale Manhès intorno a’ briganti. Neapel, 1861).
Das Brigantenwesen jener Zeit hatte sich zuerst gegen die Großgrundbesitzer gerichtet; Ferdinand IV. und Kardinal Ruffo verstanden es geschickt gegen die Franzosen zu instrumentieren, unter deren Herrschaft die Bauern sich von den Besatzern ebenso ausgebeutet fanden wie zuvor von den Grundbesitzern; schnell begriffen die Briganten, dass es einträglicher war, die Beute nicht mit König und Kirche zu teilen, und dass man auf eigene Faust und Rechnung Bauern, Großgrundbesitzer und französische Besatzer gleichermaßen terrorisieren konnte. Charles-Antoine Manhès (Beiname »Exterminator«) wurde nach seiner erfolgreichen Eindämmung des Brigantenwesens in den Abruzzen beauftragt, die Briganten in Kalabrien und in der Basilikata auszurotten, was ihm mit Maßnahmen von unerhörter Grausamkeit und Härte innerhalb von kaum sechs Monaten auch weitgehend gelang.
Der Hinterhalt in dem Dorf Li Parenti, in den französische Soldaten gelockt wurden, bevor man sie massakrierte, gehört zu den Anekdoten über Francatrippa, die Manhès in seinen Erinnerungen berichtet.
Der Dreikampf der Drillingspaare der Horatier und Curiatier ist in Kapitel 102 erwähnt.
Parafante wurde nach seinem Tod (1811) gevierteilt, seine Körperteile wurden in eisernen Käfigen zur Erbauung des Publikums zur Schau gestellt, und seinen Kopf brachte Manhès nach Cosenza, um ihn dort auszustellen.
Kapitel 118: Die Jagd auf die Banditen
Das Kapitel und der Romanabdruck im Moniteur enden abrupt mitten in Renés Vorbereitungen zur Verfolgung des Bizzarro; Claude Schopp hat die Verfolgungsjagd fortgesetzt und mit dem historisch verbürgten Ende des Bizzarro durch die Hand einer von ihm entführten Frau beendet sowie ein weiteres Kapitel angefügt, in dem René nach vollbrachter Mission in Kalabrien und Lukanien nach Neapel zurückkehrt; diese Zusätze aus der Feder des Herausgebers sind kursiv gedruckt.
Das Kapitol als Stätte des wichtigsten römischen Heiligtums und der tarpejische Felsen (der Abhang am Rand des Kapitols, von dem gestürzt wurde, wer sich falschen Zeugnisses, Verrats, Blutschande, Verrats am Volk oder Hochverrats schuldig gemacht hatte) gehören zum festen Bestand der französischen Revolutionsrhetorik, die in napoleonischer Zeit weiterhin verwendet wurde.
Kapitel 119: Die Hand der Herzogin
Nach einer erfolgreich geschlagenen Schlacht soll Heinrich IV. zu Louis de Balbe de Bertonde Crillon, der zu spät kam, gesagt haben: »Häng dich auf, mein wackerer Crillon, wir schlugen uns bei Argues, und du warst nicht dabei!« Crillon hatte den Beinamen »Mann ohne Furcht«, und Heinrich nannte ihn den Tapfersten der Tapferen.
PRAGER MANUSKRIPT
Erstes Kapitel: Seine Kaiserliche Hoheit Vizekönig Eugène-Napoléon
Die folgenden drei Kapitel wurden von Claude Schopp als späterer Teil des vorliegenden Romans identifiziert und als Prager Manuskript bezeichnet (das Manuskript in Dumas’ Handschrift befindet sich im Fonds Metternich in Prag).
In Kapitel 118 erlebten die Protagonisten im Jahr 1807 Ereignisse aus der ersten Hälfte des Jahres 1806; dieses neue Kapitel beginnt am 8. April 1809; man darf annehmen, dass eine zwischen diesen Zeitangaben situierte Handlung, deren Manuskript Claude Schopp für verschollen hält, Renés Reisegefährten Manhès ins Spiel gebracht hätte, der zwischen 1807 und 1811 die Briganten und ihre Helfershelfer in Süditalien das Fürchten lehrte und den Dumas sicherlich nicht in die Handlung eingeführt hatte, um ihn nach ein paar Stadtrundfahrten auf Nimmerwiedersehen aus dem Roman verschwinden zu lassen.
Die Cisalpinische Republik mit der Hauptstadt Mailand hatte Napoleon Ende 1796 ins Leben gerufen; 1799 wurde sie nach den Siegen der Russen und Österreicher in Oberitalien aufgelöst, 1800 wurde sie wiederhergestellt, kurz darauf in die Republik Italien umgewandelt (unter Präsident Bonaparte), die 1805 zum Königreich Italien wurde, mit dem es zehn Jahre später vorbei war.
Seinen Stiefsohn Eugène de Beauharnais hatte Napoleon 1805 zum Prinzen von Frankreich und zum Vizekönig von Italien (weitgehend ohne Befugnisse) ernannt; im Januar 1806 hatte er ihn mit Prinzessin Auguste Amalie von Bayern verheiratet, und 1807 ernannte er ihn zum Fürsten von Venedig.
Die Fechtstunden des halbwüchsigen Eugène de Beauharnais in Straßburg sind nur demjenigen vertraut, der Les Blancs et les Bleus gelesen hat, in dem sie vorkommen.
Zweites Kapitel: Das Mittagessen
General Jean-Maximilien Lamarque eroberte 1808 die von den Engländern unter General Hudson Lowe besetzt gehaltene Insel Capri nach dreizehntägiger Belagerung zurück.
Drittes Kapitel: Vorbereitungen
Renaud de Montauban ist Hauptfigur eines mittelalterlichen Heldenlieds aus dem 12. Jahrhundert und einer der Protagonisten in Ariosts Rasendem Roland; seine sprichwörtliche Eleganz findet sich auf Bildteppichen und Miniaturen verewigt.
René hat offenbar Goethe gelesen, wie man seiner Dichtung entnehmen kann; zeitlich wäre es durchaus möglich, dass er beispielsweise »Wandrers Nachtlied« in der Februarausgabe von 1801 der Londoner Zeitschrift The mouthly magazine gelesen hätte.
Biographische Notiz
Alexandre Dumas wurde am 24. Juli 1802 in Villers-Cotterêts in der Nähe von Paris geboren und starb am 5. Dezember 1870 in Puys bei Dieppe in der Normandie. Seine Eltern waren der Revolutionsgeneral Thomas Alexandre Davy-Dumas de La Pailleterie aus Haiti, unehelicher Sohn eines französischen Adeligen und dessen schwarzer Sklavin, und Marie-LouiseÉlisabeth Labouret, Tochter des ehemaligen Hoteliers Claude Labouret in Villers-Cotterêts. Der frühe Tod des in Ungnade geratenen und deshalb vorzeitig in den Ruhestand versetzten Vaters im Jahr 1806 hinterließ die Witwe mit ihrer dreizehnjährigen Tochter und dem kleinen Sohn so gut wie mittellos. Die Tochter Marie-Alexandre-Aimée mußte aus dem Mädchenpensionat nach Hause zurückkehren, und an eine gründliche Schulbildung für den Sohn war nicht mehr zu denken; statt dessen wurde Alexandre Dumas mit vierzehn Jahren in die Kanzlei eines Notars gegeben, wo er als Schreiber arbeitete. In seiner freien Zeit vergnügte der phantasiebegabte Knabe sich mit dem Verfassen und Aufführen von Theaterstücken.
Durch die Vermittlung eines Freundes seines Vaters erhielt Dumas 1822 als Zwanzigjähriger in Paris eine Stelle im Büro des Herzogs von Orleans, des späteren »Bürgerkönigs« Louis-Philippe. Schnell fand der junge Dichter und Dramatiker Zugang zum Kreis der romantischen Schriftsteller um Victor Hugo, Alfred de Vigny und Charles Nodier, denen er ein Leben lang freundschaftlich verbunden blieb. 1824 wurde sein (unehelicher) Sohn Alexandre geboren, der erste von vielen illegitimen und – bisweilen – legitimen Nachkommen.
In den folgenden Jahren verfaßte Dumas, oft in Zusammenarbeit mit Freunden und Schriftstellerkollegen wie Gérard de Nerval, zahlreiche Theaterstücke, Reiseberichte und journalistische Arbeiten. Ein Theaterstück über Heinrich III. (Henri III et sa cour) brachte 1829 erstmals den erhofften Publikumserfolg, der dem Dramatiker Dumas von da an treu blieb.
Der überzeugte Republikaner Dumas engagierte sich als Offizier der Nationalgarde aktiv in der Julirevolution von 1830, die durch rigorose absolutistische Ausnahmegesetze Karls X. ausgelöst worden war; auch an den Aufständen von 1832 und an der Februarrevolution von 1848 gegen Louis-Philippe beteiligte er sich. Zu Beginn des Jahres 1851 emigrierte er bei Nacht und Nebel nach Brüssel, aber nicht aus Gründen politischer Verfolgung wie sein Freund Victor Hugo, sondern weil ihm wegen seines gigantischen Schuldenbergs das Schuldgefängnis drohte. 1853 durfte er sich in Paris wieder blicken lassen, und Ende dieses Jahres gründete er seine erste Zeitschrift, Le Mousquetaire, gefolgt von Le Monte-Cristo. 1885 und 1859 bereiste Dumas Rußland, die Türkei und Griechenland, und im Frühjahr 1860 fuhr er nach Turin, um Garibaldi kennenzulernen, dessen Erinnerungen er überarbeiten sollte; im Juli gründete er in Palermo die Zeitschrift L’Indipendente, doch Garibaldis Partisanenfeldzug unterstützte er nicht nur ideell, sondern auch finanziell, und erst im März 1865 kehrte Dumas nach Frankreich zurück. Im Februar 1868 gründete er seine letzte Zeitschrift Dartagnan. Die letzten Lebensmonate verbrachte der chronisch schuldengeplagte und gesundheitlich zerrüttete Autor abwechselnd in Paris und in verschiedenen Seebädern, von seinem Sohn, dem Erfolgsautor Alexandre Dumas d. J., finanziell unterstützt.
Seit Mitte der dreißiger Jahre hatte Dumas sich dem Genre der Erzählungen und Novellen zugewendet und sich auf historische Romane und Abenteuerromane spezialisiert, wie Sir Walter Scott sie im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts mit Waverley und Ivanhoe international in Mode gebracht hatte; dieser Schritt machte Dumas schnell zu einem der auflagenstärksten Verfasser der damals äußerst beliebten und lukrativen Fortsetzungsromane. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen Die drei Musketiere (1844), Der Mann mit der eisernen Maske oder Zwanzig Jahre danach (1845), Königin Margot oder Die Bartholomäusnacht (1845), Der Graf von Monte-Christo (1845-6), Joseph Balsamo (1846-8), Das Halsband der Königin (1848-50), Der Vicomte von Bragelonne oder Zehn Jahre später (1850), Die schwarze Tulpe (1850), Ange Pitou (1851), Die Gräfin von Charny (1852-5) und Die Mohikaner von Paris (1855). Die mit seiner Popularität einhergehende große Nachfrage befriedigte Dumas, indem er nicht nur unermüdlich ein Buch nach dem anderen schrieb, sondern Co-Autoren wie Auguste Maquet und Paul Lacroix beschäftigte, die für ihn recherchierten und Handlungsstränge konzipierten. Als erfahrener Dramatiker verstand Dumas es meisterhaft, mit pointierten Dialogen eine spannende Romanhandlung zu gestalten, statt sich in umständlichen Beschreibungen zu ergehen oder sich in den Abgründen einer immer unwahrscheinlicheren Handlung zu verlieren, und Liebesszenen zu schreiben, die ohne allzu larmoyante Sentimentalität auskamen.
Im Brüsseler Exil veröffentlichte Dumas seine mehrbändigen Erinnerungen (Mémoires, 1852-4), und in seinen letzten Lebensmonaten verfaßte er neben seinen schriftstellerischen Arbeiten ein umfangreiches Wörterbuch der Kochkunst, das 1871 posthum erschien. Zeit seines Lebens war ihm jedoch die literarische Annerkennung verwehrt worden. Diese erteilte man ihm erst anlässlich seines 200. Geburtstags: Im Juli 2002 wurde er feierlich im Pariser Panthéon zwischen Victor Hugo und Emile Zola beigesetzt.
Auswahlbibliographie deutscher Ausgaben einzelner von Dumas verwendeter Quellen
Laure Junot d’Abrantès: Memoiren der Herzogin von Abrantès. Leipzig, 1903.
Hortense Beauharnais: Um Napoleon. Memoiren der Königin Hortense. München, 1920.
Napoleon Bonaparte: Briefe Napoleons des Ersten. Stuttgart, 1910. – Die Memoiren seines Lebens. Hamburg / Zürich, 1910. – Gespräche Napoleons des Ersten. Stuttgart, 1911-13.
Louis A. F. Bourrienne: Memoiren über Napoleon, das Directorium, das Consulat, das Kaiserreich und die Restauration. Leipzig, 1829-1830.
François-René de Chateaubriand: Von jenseits des Grabes. Denkwürdigkeiten. Leipzig, 1848-50. – Reise in Amerika. Freiburg i. Br., 1827-38. – Über Bonaparte und die Bourbonen. Hamburg, 1814.
Charles M. Dezobry: Rom im Jahrhundert des Augustus oder Reise eines Galliers nach Rom zur Zeit von Augustus’ Regierung und während eines Theils der Regierung Tibers. Leipzig, 1837.
Agathon J. F. Fain: Neun Jahre Napoleons Sekretär, 1806-1815. Memoiren. Berlin, 1926.
Agathon J. F. Fain: Manuscript vom Jahre Tausend Achthundert und Zwölf. Darstellung der Begebenheiten dieses Jahres als Beitrag zur Geschichte des Kaisers von Baron Fain, damaligem Cabinets-Sekretär. Leipzig, 1827.
Joseph Fouché: Erinnerungen von Joseph Fouché, Polizeiminister Napoleons I. Stuttgart, 1925.
Antoine-Marie Chamans, Graf von Lavalette: Im Dienste Napoleons. Erinnerungen des Grafen von Lavalette. Stuttgart, 1900.
Jules Michelet: Geschichte der Französischen Revolution. Hamburg, 1929-30.
M. E. de Rémusat: Napoelon I. und sein Hof, Memoiren 1802-1810. Köln, 1880-82.
Anne-Jean-Marie-René Savary: Memoiren des Herzogs von Rovigo, als Beiträge zur Geschichte des Kaisers Napoleon. Leipzig, 1828.
Paul-Philippe Ségur: Denkwürdigkeiten, Rückerinnerungen und Anekdoten aus dem Leben des Grafen von Ségur. Stuttgart, 1825-26.
Paul-Philippe de Ségur: Geschichte Napoleons und der großen Armee im Jahre 1812. Stuttgart, 1835.
Robert Southey: Lord Nelson. Ein literarisches Porträt. Leipzig, 1837.
Adolphe Thiers: Geschichte des Konsulats und des Kaiserreichs. Leipzig, 1843-64.
Zeittafel
1768Die Republik Genua tritt Korsika an Frankreich ab
1769Geburt Nabulione bzw. Napoleone Buonapartes (15. August) in Ajaccio
1776Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika
1779Buonaparte ist Stipendiat der Militärschule von Brienne
1784Buonaparte wird in die Militärschule von Paris aufgenommen
1785Buonaparte dient als Artillerieleutnant
1789Beginn der Französischen Revolution; Bauernaufstände in den Provinzen
1790Mulattenaufstand auf Martinique; Sklavenaufstand auf Santo Domingo (Haiti)
1791Verfassung der konstitutionellen Monarchie in Frankreich; erneuter Sklavenaufstand auf Santo Domingo; Staatsbürgerschaft der Juden; konterrevolutionäre und revolutionäre Ausschreitungen in Avignon
1792Beginn der französischen Revolutionskriege; Buonaparte wird zum Hauptmann befördert; siegreicher Sklavenaufstand auf Santo Domingo; Ausbruch des Vendée-Aufstands; Septembermassaker; Einberufung des Konvents, Erklärung der Republik Frankreich
1793Hinrichtung Ludwigs XVI.; Kriegseintritt Englands, Bildung der Ersten Koalition gegen Frankreich; Ausbreitung des Vendée-Aufstands und Bürgerkrieg; Errichtung der Revolutionsregierung; Terreur; Revolutionstribunal; Entchristlichungskampagne; Buonaparte wird zum Brigadegeneral befördert
1794Beförderung Buonapartes zum General; Abschaffung der Sklaverei durch Konventsbeschluss; Sturz der Robespierristen und thermidorianische Reaktion
1795Eroberung der Niederlande; Friedensschluss in Basel mit Preußen und Spanien; Germinal- und Prairialaufstand in Paris; Verfassung des »Jahres III«; Niederschlagung des Vendémiaire-Aufstands in Paris durch Buonaparte; Beginn der Herrschaft des Direktoriums
1796Heirat Napoleone Buonapartes mit Joséphine de Beauharnais; Namensänderung; Italienfeldzug unter Oberbefehl Bonapartes; Bündnis Frankreichs mit dem bourbonischen Spanien
1797»Verschwörung der Gleichen«, Hinrichtung Babeufs und Darthés; Gründung der Cisalpinischen Republik; Staatsstreich des Direktoriums vom 18. Fructidor; Friedensschluss von Campo Formio zwischen Frankreich und Österreich; Liquidierung der Republik Venedig
1798Gründung der Römischen und der Helvetischen Republik; Ägyptenexpedition Bonapartes; Bildung der Zweiten Koalition gegen Frankreich
1799Syrienfeldzug Bonapartes; Staatsstreich vom 30. Prairial; Staatsstreich vom 18. Brumaire und Absetzung des Direktoriums; Verkündung der Verfassung »des Jahres VIII«: Bonaparte wird zum Ersten Konsul, Cambacérès und Lebrun werden zu Mitkonsuln ernannt
1800Plebiszit über die Konsulatsverfassung; Amnestierung der Chouans; Bonaparte bezieht den Tuilerienpalast; Schlacht von Marengo; Teilamnestierung der Emigranten; Sieg Moreaus bei Hohenlinden; Attentat der »Höllenmaschine« auf Bonaparte
1801Senatsbeschluss über die Deportation von hundertdreißig »Jakobinern«;Frieden von Lunéville; Unterzeichnung des Konkordats; Organisation der nationalen Gendarmerie
1802Cisalpinische Republik wird Republik Italien; Frieden von Amiens; Generalamnestie für die Emigranten; Entlassung Fouchés als Polizeiminister; Gesetz über öffentlichen Unterricht; Verbot der Eheschließung zwischen Farbigen und Weißen; Wiedereinführung der Sklaverei in den französischen Kolonien; Verbot für Farbige und Schwarze, in die Armee einzutreten; Bonaparte lässt Schriften farbiger Autoren verbrennen; Plebiszit bestätigt Bonaparte als Konsul auf Lebenszeit; Annexion Piemonts; Aufstand auf Santo Domingo
1803Ende der Helvetischen Republik, Umwandlung in Konföderation; Verkauf von Louisiana an die USA; Wiederaufnahme des Kriegs gegen England; heimliche Rückkehr Cadoudals aus England
1804Endredaktion des Code civil; Erschießung des Herzogs von Enghien; Senat befürwortet erbliches Kaisertum Napoleons; Verfassung »des Jahres XII«; Senatsbeschluss über Kaiserwürde; Hinrichtung Cadoudals; Wiederberufung Fouchés zum Polizeiminister; Kaiserkrönung Napoleons I. in Notre-Dame
1805Republik Italien wird zum Königreich erklärt; Dritte Koalition gegen Frankreich; Annexion Genuas; Eugène Beauharnais Vizekönig von Italien; Nelsons Sieg und Tod in Seeschlacht von Trafalgar; Schlacht von Austerlitz; Friedensschluss von Preßburg zwischen Frankreich und Österreich, Ende der Dritten Koalition; Flucht der Bourbonen aus Neapel
1806Wiedereinführung des Gregorianischen Kalenders; Joseph Bonaparte König von Neapel; Louis Bonaparte König von Holland; Verbot der Spielkasinos in Frankreich; Gründung des Rheinbunds; Auflösung des Heiligen Römischen Reiches und des Reichstags zu Regensburg; Schlacht von Jena und Auerstädt; Einzug Napoleons in Berlin; »Dekret von Berlin« über Kontinentalsperre gegen England; Einzug in Warschau; Beitritt Sachsens zum Rheinbund; Kriegserklärung der Türkei an Russland
1807Schlacht von Eylau; Dekret über Status der Juden; Schlacht von Friedland; Friedensschluss von Tilsit; Ende der Vierten Koalition; Gründung des »Großherzogtums Warschau«; Entlassung Talleyrands als Außenminister; Jérôme Bonaparte König von Westfalen; »Oktoberedikt« in Preußen über Aufhebung der Erbuntertänigkeit; französisch-spanischer Geheimvertrag zur Aufteilung Portugals
1808Senatsbeschluss über die Schaffung des kaiserlichen Adels; Erhebungen in Spanien gegen Besatzung; Annexion Parmas und der Toskana; Joseph Bonaparte König von Spanien; Joachim Murat König von Neapel; Kapitulation von Cintra; Spanienfeldzug Napoleons; Städteordnung in Preußen
1809Talleyrand fällt in Ungnade; Fünfte Koalition; Tiroler Aufstand unter Andreas Hofer; Annexion des Kirchenstaates und Gefangennahme von Papst Pius VII.; Schlacht von Aspern und Essling; Exkommunikation Napoleons durch Papst Pius VII.; Schlacht bei Wagram; Sieg Lord Wellingtons bei Talavera; Frieden von Schönbrunn, Bildung der »Illyrischen Provinzen«, Ende der Fünften Koalition; Senatsbeschluss über Napoleons Scheidung von Joséphine
1810Anullierung der Ehe Napoleons und Joséphines; Wiedereinführung der Zensur in Frankreich; Erschießung Andreas Hofers; zivile und kirchliche Trauung Napoleons mit Marie Louise von Österreich; Unabhängigkeitskriege in Spanisch-Amerika; Polizeiminister Fouché durch Savary abgelöst; Thronverzicht Louis Bonapartes, König von Holland
1811Code pénal tritt in Kraft; 20. März Geburt des »Königs von Rom«; Rückzug aus Portugal; Wirschaftskrise in Frankreich
1812Napoleon setzt Konkordat außer Kraft; französisch-preußischer Bündnisvertrag; Judenemanzipation in Preußen; französisch-österreichischer Bündnisvertrag; Schlacht von Borodino; Einzug in Moskau; gescheiterter Putsch des republikanischen Generals Malet in Paris, Erschießung der Putschisten; Schlacht an der Beresina; russisch-preußische Konvention von Tauroggen
1813Russisch-preußischer Bündnisvertrag von Kalisch; preußische Kriegserklärung an Frankreich; sechster Koalitionskrieg; Schlacht von Lützen-Großgörschen; Sieg Wellingtons bei Vitoria; Kriegserklärung Österreichs an Frankreich; Schlacht von Dresden; Abfall Bayerns von Napoleon; Völkerschlacht von Leipzig mit Niederlage Napoleons
1814Wiederherstellung des Kirchenstaates; Kapitulation von Paris, Einmarsch der Alliierten; Abdankung Napoleons; Einzug Ludwigs XVIII. in Paris; Tod Joséphines in La Malmaison; Verkündung der »Charte« Ludwigs XVIII.; Eröffnung des Wiener Kongresses
1815Landung Napoleons und Einzug in Paris; Bildung einer provisorischen Regierung; Beschluss in Wien der siebten Koalition und der Ächtung Napoleons; Schlacht bei Waterloo; zweite Abdankung Napoleons, zweiter Einmarsch der Alliierten in Paris; Bildung der »Heiligen Allianz«; Verbannung Napoleons nach Sankt Helena
1821Tod Napoleons (5. Mai) in Longwood auf Sankt Helena
1840Überführung Napoleons sterblicher Überreste nach Paris